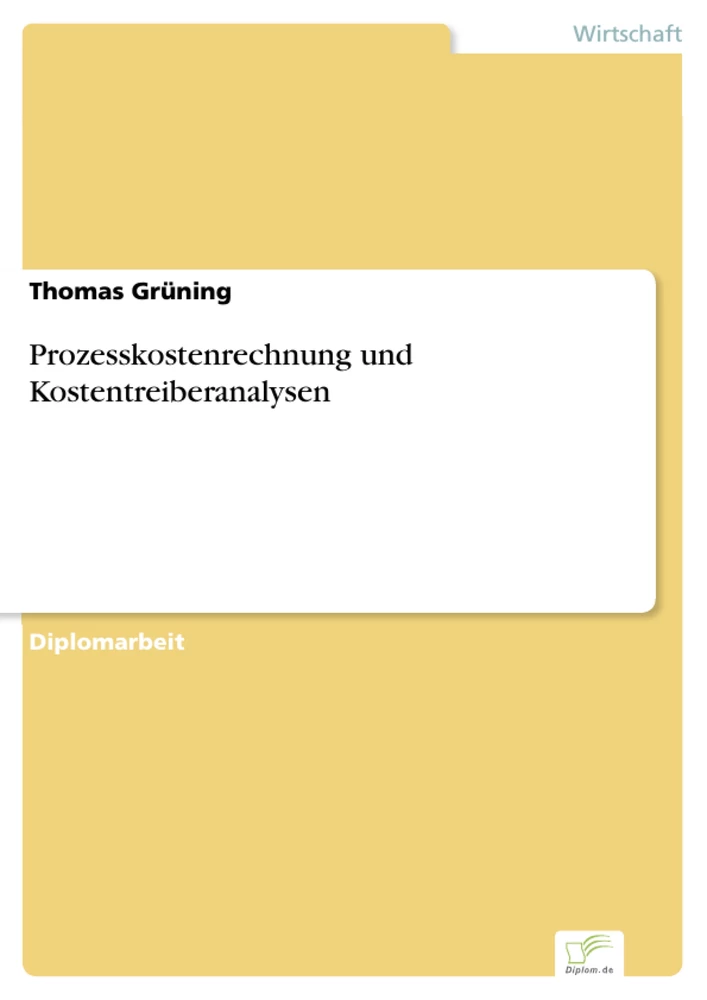Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
©2003
Diplomarbeit
84 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Ausgangspunkt der Arbeit ist das Anliegen, dem Leser in einer kompakten Darstellung die seit geräumiger Zeit und von verschiedenen Seiten immer wieder verstärkt propagierte Anwendung einer prozessorientierten Kostenrechnung näher zu bringen. Ferner soll die Arbeit aufzeigen, dass neben dem mit der Anwendung einer Prozesskostenrechnung ursprünglich verfolgten Ziel einer besseren Verteilung der Gemeinkosten auf die Kalkulationsobjekte, diese auch immer mehr Gebrauch findet als ein Kostenmanagementinstrument zur Planung, Steuerung und Kontrolle der oft mit hohen Gemeinkostenanteilen belasteten sog. indirekten Unternehmensbereiche.
Vor diesem Hintergrund erfolgt im Kapitel 2, nach einer Vorstellung der prozessorientierten Kostenrechnung hinsichtlich ihrer Entstehungshintergründe, Ziele sowie Inhalte, eine nähere Erörterung ihrer wesentlichsten Einsatzfelder, bevor es am Ende dieses Kapitels zu einer genaueren Abwägung ihrer Stärken und Schwächen kommt. Hervorzuheben ist hierbei, dass neben der Analyse der einschlägigen Literatur zur Prozesskostenrechnung eine wesentliche Grundlage für die Ausführungen zu diesem Kapitel, insbesondere innerhalb der Vorstellung eines prozessorientierten Kostenrechnungskonzeptes, die durch ZWICKER erfolgte Ausarbeitung eines Prozesskostenrechnungsansatzes und seiner möglichen Implementierung im System der integrierten Zielverpflichtungsplanung bildet.
Einen weiteren zu erörternden Schwerpunkt dieser Arbeit bildet die Beantwortung der Fragen zur Ermittlung geeigneter sog. Kostentreiber innerhalb des Einsatzes einer Prozesskostenrechnung. Das analytische Vorgehen zur Lösung von Ermittlungsproblemen dieser Größen in der Praxis steht dabei ebenso im Mittelpunkt der Untersuchung wie die Analyse hierzu vorliegender Veröffentlichungen. Zusammen mit der Abgrenzung des Anwendungsgebietes für eine Prozesskostenrechnung, der Ablaufanalyse und -strukturierung der Prozesse, der Bestimmung der Bewertungssätze sowie der prozesskonformen Kostenverrechnung stellt die Ermittlung und Definition geeigneter Kostentreiber eine wesentliche Hauptaufgabe jedes Implementierungsvorhabens einer Prozesskostenrechnung dar.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
InhaltsverzeichnisI
AbkürzungsverzeichnisII
AbbildungsverzeichnisIV
1.Einleitung und Überblick1
2.Prozesskostenrechnung als Informationslieferantin eines Kosten-Leistungsmodells2
2.1Entwicklungshintergründe und Entstehung der […]
Ausgangspunkt der Arbeit ist das Anliegen, dem Leser in einer kompakten Darstellung die seit geräumiger Zeit und von verschiedenen Seiten immer wieder verstärkt propagierte Anwendung einer prozessorientierten Kostenrechnung näher zu bringen. Ferner soll die Arbeit aufzeigen, dass neben dem mit der Anwendung einer Prozesskostenrechnung ursprünglich verfolgten Ziel einer besseren Verteilung der Gemeinkosten auf die Kalkulationsobjekte, diese auch immer mehr Gebrauch findet als ein Kostenmanagementinstrument zur Planung, Steuerung und Kontrolle der oft mit hohen Gemeinkostenanteilen belasteten sog. indirekten Unternehmensbereiche.
Vor diesem Hintergrund erfolgt im Kapitel 2, nach einer Vorstellung der prozessorientierten Kostenrechnung hinsichtlich ihrer Entstehungshintergründe, Ziele sowie Inhalte, eine nähere Erörterung ihrer wesentlichsten Einsatzfelder, bevor es am Ende dieses Kapitels zu einer genaueren Abwägung ihrer Stärken und Schwächen kommt. Hervorzuheben ist hierbei, dass neben der Analyse der einschlägigen Literatur zur Prozesskostenrechnung eine wesentliche Grundlage für die Ausführungen zu diesem Kapitel, insbesondere innerhalb der Vorstellung eines prozessorientierten Kostenrechnungskonzeptes, die durch ZWICKER erfolgte Ausarbeitung eines Prozesskostenrechnungsansatzes und seiner möglichen Implementierung im System der integrierten Zielverpflichtungsplanung bildet.
Einen weiteren zu erörternden Schwerpunkt dieser Arbeit bildet die Beantwortung der Fragen zur Ermittlung geeigneter sog. Kostentreiber innerhalb des Einsatzes einer Prozesskostenrechnung. Das analytische Vorgehen zur Lösung von Ermittlungsproblemen dieser Größen in der Praxis steht dabei ebenso im Mittelpunkt der Untersuchung wie die Analyse hierzu vorliegender Veröffentlichungen. Zusammen mit der Abgrenzung des Anwendungsgebietes für eine Prozesskostenrechnung, der Ablaufanalyse und -strukturierung der Prozesse, der Bestimmung der Bewertungssätze sowie der prozesskonformen Kostenverrechnung stellt die Ermittlung und Definition geeigneter Kostentreiber eine wesentliche Hauptaufgabe jedes Implementierungsvorhabens einer Prozesskostenrechnung dar.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
InhaltsverzeichnisI
AbkürzungsverzeichnisII
AbbildungsverzeichnisIV
1.Einleitung und Überblick1
2.Prozesskostenrechnung als Informationslieferantin eines Kosten-Leistungsmodells2
2.1Entwicklungshintergründe und Entstehung der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7661
Grüning, Thomas: Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Technische Universität Berlin, Technische Universität, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2003 abgeschlossen und an der
Fakultät VIII Wirtschaft und Management am Lehrstuhl Unternehmensrechnung und
Controlling der Technischen Universität Berlin als Diplomarbeit angenommen. Für
die hierbei erfahrene Unterstützung, für zahlreiche Ratschläge und Hinweise möchte
ich mich an dieser Stelle bedanken.
Hervorheben möchte ich besonders Frau Dagmar Ehlers. Sie hat den Entste-
hungsprozess dieser Arbeit durch die Übernahme des Lektorates am unmittelbarsten
begleitet, wofür ich ihr herzlich danke.
Zu danken habe ich letztlich auch Nicole, der es hin und wieder nicht erspart blieb,
sich im Laufe des Schaffensprozesses die sie wenig betreffenden Erkenntniswege des
Autors anzuhören. Auch ihre nimmermüden Aufmunterungen, trotz mancher Launen
meinerseits während einiger Phasen der Anfertigung dieser Arbeit, haben erst zur
endgültigen Erstellung der vorliegenden Arbeit geführt. Ihr sei hiermit diese Arbeit
gewidmet.
Berlin, im September 2003
Thomas Grüning
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-I-
Inhaltsverzeichnis
Seite
Inhaltsverzeichnis...I
Abkürzungsverzeichnis ... II
Abbildungsverzeichnis ...IV
1. Einleitung
und
Überblick...1
2. Prozesskostenrechnung als Informationslieferantin eines Kosten-Leistungs-
modells...2
2.1 Entwicklungshintergründe und Entstehung der Prozesskostenrechnung...2
2.2 Zielsetzungen und Aufgaben der Prozesskostenrechnung ...5
2.3 Merkmale und Systematik der Prozesskostenrechnung ...8
2.4 Das INZPLA-Prozesskostenrechnungskonzept in seinem Aufbau...17
2.4.1 Vorbetrachtungen...18
2.4.2 Prozesskostenmodelle
des Fertigungsbereiches...21
2.4.3 Prozesskostenmodelle
des
Vertriebs- und Verwaltungsbereiches ..29
2.5 Darstellung der Einsatzfelder einer Prozesskostenrechnung ...38
2.5.1 Prozessorientierte Kalkulation und ihre Effekte ...39
2.5.2 Prozesskostenrechnung als Instrument des Gemeinkosten-
managements
...
46
2.5.2.1 Kostenplanung
mit der Prozesskostenrechnung ...46
2.5.2.2 Kostenkontrolle
mit der Prozesskostenrechnung...49
2.6 Beurteilung der Prozesskostenrechnung ...51
3. Kostentreiber im System der Prozesskostenrechnung ...57
3.1 Abgrenzung und Funktionen der Kostentreiber...57
3.2 Kriterien zur Auswahl geeigneter Kostentreiber...59
3.2.1 Generelle
Auswahlkriterien ...59
3.2.2 Spezielle
Auswahlkriterien ...60
3.3 Ermittlung der Kostentreiber ...62
3.3.1 Verfahren zur Bestimmung der Kostentreiber ...62
3.3.2 Anzahl notwendiger Kostentreiber ...63
4. Zusammenfassung und Ausblick ...67
Literaturverzeichnis...70
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-II-
Abkürzungsverzeichnis
Abb...Abbildung
ABC...Activity Based Costing
BM...Bestellmenge
bzgl...bezüglich
bzw. ...beziehungsweise
ca. ...circa
d. h...dass heißt
DIN...deutsche Industrienorm
EDV...Elektronische Datenverarbeitung
EP ...Elementarprozess
EUR...Euro
evtl...eventuell
ggf. ...gegebenenfalls
Gmk...Gemeinkosten
Hrsg. ...Herausgeber
HP...Hauptprozess
i. d. R. ...in der Regel
i. e. S...im engeren Sinn
INZPLA..integrierte Zielverpflichtungsplanung
Jg. ...Jahrgang
KBZ...Kollektivbasisziele
lmi...leistungsmengeninduziert
lmn...leistungsmengenneutral
ME...Mengeneinheiten
NAZ...Nettoarbeitszeit
PK...Personalkosten
PKR ...Prozesskostenrechnung
sog. ...sogenannt
S...Seite
tg...Tangens
TP ...Teilprozess
TU...Technische Universität
u. a. ...unter anderem
u. U...unter Umständen
US...United States
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-III-
USA...United States of America
usw. ...und so weiter
Vgl...Vergleich
vs. ...versus
z. B. ...zum Beispiel
z. T...zum Teil
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-IV-
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abb. 1:
Kalkulationsbeispiel ,,Krawattenhändler" Teil 1...6
Abb. 2:
Kalkulationsbeispiel ,,Krawattenhändler" Teil 2...6
Abb. 3:
Bildung des Hauptprozesses ,,Material beschaffen" aus verschiedenen
Teilprozessen...9
Abb. 4:
Beispiel eines hierarchischen Prozesstreiberdiagramms eines
Hauptprozesses ...12
Abb. 5:
Arten von INZPLA-Prozesskostenmodellen ...19
Abb. 6:
Abweichungen zwischen Bestellemengen- und Prozesstreiberdia-
grammen ...24
Abb. 7:
Typen von Hauptprozessen ...28
Abb. 8:
Schematische
Darstellung
der Kalkulationsvarianten ...34
Abb. 9:
Kostenverteilung
innerhalb
der prozessorientierten Produktkalku-
lation...40
Abb. 10:
Effekte der prozessorientierten Kalkulation ...45
Abb. 11:
Doppelfunktion von Bezugsgrößen und Kostentreibern ...60
Inhaltsangabe
Ausgangspunkt der Arbeit ist das Anliegen, dem Leser in einer kompakten Darstellung die seit
geräumiger Zeit und von verschiedenen Seiten immer wieder verstärkt propagierte Anwendung einer
prozessorientierten Kostenrechnung näher zu bringen. Ferner soll die Arbeit aufzeigen, dass neben
dem mit der Anwendung einer Prozesskostenrechnung ursprünglich verfolgten Ziel einer besseren
Verteilung der Gemeinkosten auf die Kalkulationsobjekte, diese auch immer mehr Gebrauch findet als
ein Kostenmanagementinstrument zur Planung, Steuerung und Kontrolle der oft mit hohen
Gemeinkostenanteilen belasteten sog. indirekten Unternehmensbereiche.
Vor diesem Hintergrund erfolgt im Kapitel 2, nach einer Vorstellung der prozessorientierten
Kostenrechnung hinsichtlich ihrer Entstehungshintergründe, Ziele sowie Inhalte, eine nähere
Erörterung ihrer wesentlichsten Einsatzfelder, bevor es am Ende dieses Kapitels zu einer genaueren
Abwägung ihrer Stärken und Schwächen kommt. Hervorzuheben ist hierbei, dass neben der Analyse
der einschlägigen Literatur zur Prozesskostenrechnung eine wesentliche Grundlage für die Ausfüh-
rungen zu diesem Kapitel, insbesondere innerhalb der Vorstellung eines prozessorientierten Kosten-
rechnungskonzeptes, die durch Z
WICKER
erfolgte Ausarbeitung eines Prozesskostenrechnungs-
ansatzes und seiner möglichen Implementierung im System der integrierten Zielverpflichtungs-
planung
1
bildet.
Einen weiteren zu erörternden Schwerpunkt dieser Arbeit bildet die Beantwortung der Fragen zur
Ermittlung geeigneter sog. Kostentreiber innerhalb des Einsatzes einer Prozesskostenrechnung. Das
analytische Vorgehen zur Lösung von Ermittlungsproblemen dieser Größen in der Praxis steht dabei
ebenso im Mittelpunkt der Untersuchung wie die Analyse hierzu vorliegender Veröffentlichungen.
Zusammen mit der Abgrenzung des Anwendungsgebietes für eine Prozesskostenrechnung, der
Ablaufanalyse und -strukturierung der Prozesse, der Bestimmung der Bewertungssätze sowie der
prozesskonformen Kostenverrechnung stellt die Ermittlung und Definition geeigneter Kostentreiber
eine wesentliche Hauptaufgabe jedes Implementierungsvorhabens einer Prozesskostenrechnung dar.
1
Zur genaueren Darstellung des Gesamtkonzeptes der integrierten Zielverpflichtungsplanung kurz
INZPLA als
ein Verfahren der Gesamtunternehmensplanung und -kontrolle siehe Zwicker, E.
(2001a).
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-1-
1. Einleitung und Überblick
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist das Anliegen, dem Leser in einer kompak-
ten Darstellung die seit geräumiger Zeit und von verschiedenen Seiten immer wieder
verstärkt propagierte Anwendung einer prozessorientierten Kostenrechnung näher zu
bringen. Ferner soll die Arbeit aufzeigen, dass neben dem mit der Anwendung einer
Prozesskostenrechnung ursprünglich verfolgten Ziel einer besseren Verteilung der
Gemeinkosten auf die Kalkulationsobjekte, diese auch immer mehr Gebrauch findet
als ein Kostenmanagementinstrument zur Planung, Steuerung und Kontrolle der oft
mit hohen Gemeinkostenanteilen belasteten sog. indirekten Unternehmensbereiche.
Vor diesem Hintergrund erfolgt im Kapitel 2, nach einer Vorstellung der prozess-
orientierten Kostenrechnung hinsichtlich ihrer Entstehungshintergründe, Ziele sowie
Inhalte, eine nähere Erörterung ihrer wesentlichsten Einsatzfelder, bevor es am Ende
dieses Kapitels zu einer genaueren Abwägung ihrer Stärken und Schwächen kommt.
Hervorzuheben ist hierbei, dass neben der Analyse der einschlägigen Literatur zur
Prozesskostenrechnung eine wesentliche Grundlage für die Ausführungen zu diesem
Kapitel, insbesondere innerhalb der Vorstellung eines prozessorientierten Kosten-
rechnungskonzeptes, die durch Z
WICKER
erfolgte Ausarbeitung eines Prozesskosten-
rechnungsansatzes und seiner möglichen Implementierung im System der integrierten
Zielverpflichtungsplanung
1
bildet.
Einen weiteren und im darauffolgenden Kapitel 3 zu erörternden Schwerpunkt dieser
Arbeit bildet die Beantwortung der Fragen zur Ermittlung geeigneter sog. Kosten-
treiber innerhalb des Einsatzes einer Prozesskostenrechnung. Das analytische Vor-
gehen zur Lösung von Ermittlungsproblemen dieser Größen in der Praxis steht dabei
ebenso im Mittelpunkt der Untersuchung wie die Analyse hierzu vorliegender Ver-
öffentlichungen. Zusammen mit der Abgrenzung des Anwendungsgebietes für eine
Prozesskostenrechnung, der Ablaufanalyse und -strukturierung der Prozesse, der
Bestimmung der Bewertungssätze sowie der prozesskonformen Kostenverrechnung
stellt die Ermittlung und Definition geeigneter Kostentreiber eine wesentliche Haupt-
aufgabe jedes Implementierungsvorhabens einer Prozesskostenrechnung dar.
1
Zur genaueren Darstellung des Gesamtkonzeptes der integrierten Zielverpflichtungsplanung kurz
INZPLA als ein Verfahren der Gesamtunternehmensplanung und -kontrolle siehe Zwicker, E.
(2001a).
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-2-
2. Prozesskostenrechnung als Informationslieferantin eines Kosten-Leistungs-
modells
Kaum eine andere Strömung vermochte in den vergangenen Jahren die Entwicklung
der Betriebswirtschaftslehre in Theorie und Praxis stärker zu prägen als das prozess-
orientierte Denken und Handeln
2
. Vorrangiges Ziel dieses Kapitels ist es, die
Prozesskostenrechnung als einen maßgeblichen Bestandteil dieser Überlegungen
näher darzustellen sowie darauf einzugehen, wie sie als ein wichtiges Instrumentarium
einer besseren kostenrechnerischen Abbildung des jeweiligen Unternehmensbereiches
und insbesondere für die indirekten Leistungsbereiche von Unternehmen Anwendung
finden kann. Dies geschieht durch Vorstellung der Entwicklungshintergründe, die zur
Entstehung prozessorientierter Kostenrechnungsansätze führten. Es folgt die Schilde-
rung der Zielsetzungen und Aufgaben einer Prozesskostenrechnung, ihrer Merkmale
und ihrer Systematik sowie die sich anschließende Darstellung eines Prozesskosten-
rechnungskonzeptes im Kontext mit dem System einer durch Z
WICKER
entwickelten
integrierten Zielverpflichtungsplanung. Weiterhin ist das Anliegen dieses Kapitels, die
prozessorientierte Kostenrechnung in ihren wichtigsten Anwendungsfeldern zu
beschrieben. Das Kapitel endet mit einer Erörterung der Vor- und Nachteile eines
prozessorientierten Kostenmanagementeinsatzes.
2. 1 Entwicklungshintergründe und Entstehung der Prozesskostenrechnung
Ein fortschreitender Wettbewerbs- und Globalisierungsdruck in den letzten Jahr-
zehnten führte zu einer grundlegenden Veränderung der Kostenstruktur innerhalb der
Unternehmen. Die den Kostenträgern direkt zurechenbaren Einzelkosten rückten in
den Mittelpunkt betrieblicher Kostensenkungsprogramme, so dass sich die Wert-
schöpfung in den Unternehmen auf die vorbereitenden, planenden, steuernden und
kontrollierenden Aktivitäten, die fixe Gemeinkosten zur Folge haben, verschob
3
.
Somit gewannen durch die zunehmende Automatisierung und Rationalisierung der
Herstellung sowie der damit einhergehenden Verlagerung von produktiven zu
administrativen Tätigkeiten
4
, die sogenannten indirekten oder Gemeinkostenbereiche,
gegenüber der Fertigung i. e. S. immer mehr an Bedeutung
5
.
Um aber weiterhin alle Kosten bei der Kalkulation von Produkten mit aufzunehmen,
mussten unter Annahme der herkömmlichen vollkostenrechnerischen Einbeziehung
2
Vgl. Hail, L. (1996), S. 127; Weber, J. (1995), S. 28.
3
Vgl. Horváth, P. (2001), S. 553.
4
Vgl. Striening, H.-D. (1991), S. 133.
5
Vgl. Weber, J. (1991), S. 53, Horváth, P. / Mayer, R. (1995), S. 59.
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-3-
der Gemeinkosten per Zuschlagssatz gemäß der Zuschlagskalkulation diese tradi-
tionellen Gemeinkostenzuschlagssätze
6
, mit deren Hilfe versucht wird, die Gemein-
kosten den Kostenträgern zuzurechnen, stetig erhöht werden. Kalkulationssätze von
teilweise mehreren hundert Prozent
7
sind jedoch ein Anzeichen dafür, dass herkömm-
liche Kostenrechnungsverfahren allein nur begrenzt geeignet sind, die Kostensituation
heutiger Unternehmen realitätsnah abzubilden
8
.
Mit wachsender Unzufriedenheit wurden daher (auch) von Plankostenrechnungs-
anwendern die Bemühungen um den Entwurf neuer Kostenrechnungssysteme
verstärkt
9
. Hierzu stellt das Konzept der Prozesskostenrechnung für den deutsch-
sprachigen Raum einen Lösungsbeitrag dar. Vordringliches Ziel dieses Ansatzes ist es,
die Planung, Steuerung und Kontrolle der Gemeinkosten sowie ihre verursachungs-
gerechte Verteilung zu ermöglichen, um damit letztendlich auch zu einer höheren
Transparenz in den indirekten Bereichen beizutragen
10
.
Die Ursprünge der aktivitätsorientierten Kostenrechnung an sich sind in den Verei-
nigten Staaten zu finden. Sie wurde aufgrund des Unmutes über das bis dahin übliche
Verfahren zur Gemeinkostenverteilung der Fertigungsbereiche auf Basis der variablen
Einzelkosten entwickelt
11
. Einer der konkreten Auslöser zur Überprüfung der
herkömmlichen ,,standard costing"-Systeme war im Jahre 1985 der Aufsatz von
M
ILLER
und V
OLLMANN
,,The hidden factory"
12
. Im Zentrum dieses Beitrages dreht
es sich um das Problem der Steuerung, Senkung und Kalkulation der indirekten sowie
zugleich fixen Kosten der Fertigung. Unter der Bezeichnung ,,Activity Based Costing"
(ABC-Systeme) wurden Methoden entwickelt, welche die fixen Gemeinkosten nicht
mehr über die Lohnstunden, sondern über die in Anspruch genommenen Aktivitäten
auf die Produkte zuordneten.
Das Activity Based Costing entstand demzufolge hauptsächlich aufgrund der Unzu-
länglichkeiten des amerikanischen Rechnungswesens im Fertigungsbereich. In
Deutschland dagegen war der Problemdruck in diesem Bereich geringer, da die in den
6
Vgl. Männel, W. (1995), S. 16.
7
Solch gigantische Zuschlagssätze waren vorwiegend im US-amerikanischen Raum zu finden, da dort
traditionell die Kostenrechnung andere Aufgaben erfüllt als im deutschsprachigen Raum. Vgl.
Reckenfelderbäumer, M. (1994), S. 14.
8
Vgl. Scholz, H.-G. (2001), S. 13.
9
Vgl. Mayer, R. (1997), S. 141.
10
Vgl. Mayer, R. (1991), S. 75.
11
Vgl. Vikas, K. / Klein, A. (1997), S. 470.
12
Miller, J. G. / Vollmann, Th. E. (1985), S. 142 ff.
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-4-
Fertigungsbereichen deutscher Unternehmen verbreiteten Kostenrechnungssysteme,
mit einer, im Gegensatz zu den USA, ausgereiften Kostenstellenrechnung und inner-
betrieblichen Leistungsverrechnung, seit Jahren zufriedenstellend funktionierten
13
.
Durch diese Systeme, insbesondere ist hier die dem Grundkonzept der Grenzplan-
kostenrechung entsprechende Bezugsgrößenkalkulation zu nennen, gelang bereits eine
viel bessere Verteilung der Kosten der Produktionsbereiche auf die Kostenträger als
mit der herkömmlichen Zuschlagskalkulation
14
. So besteht auch bei vielen Befür-
wortern des Einsatzes einer Prozesskostenrechnung kein methodischer Bedarf ihrer
Anwendung für die Fertigungsbereiche deutscher Industrieunternehmen
15
. Demgegen-
über bemerkt Z
WICKER
in seinen Ausführungen allerdings, dass sich die Entwicklung
eines ,,Prozesskostenmodells" für mehrstufige Fertigungsprozesse geradezu anbietet,
da die angefertigten Zwischenprodukte immer als Prozesstreiber gedeutet werden
können
16
. Zwar sieht auch er keinen Anlass die herkömmliche Konfiguration mehr-
stufiger Fertigungsprozesse durch eine ,,Konfiguration mit Prozesskosteninter-
pretation" zu ersetzen, jedoch kann eine nachträgliche Prozesskosteninterpretation
zum Vorteil einer ,,besseren" Modellexploration führen, dessen Ausmaß allein vom
einzelnen Anwender zu beurteilen ist
17
.
Das Konzept der Prozesskostenrechnung gewann im deutschsprachigen Raum seit
1989 durch eine Reihe von Veröffentlichungen an Popularität, wobei sich insbe-
sondere H
ORVÁTH
und seine Mitarbeiter als Wegbereiter dieses Kostenrechungs-
ansatzes erwiesen
18
. Im Gegensatz zu den amerikanischen ABC-Systemen orientiert
sich die Prozesskostenrechnung stärker an den einzelnen Prozessen (fast) aller Unter-
nehmensbereiche. So wird von H
ORVÁTH
und
M
AYER
explizit betont, dass sich die
Anwendung einer prozessorientierten Kostenrechnung für alle Bereiche eines Dienst-
leistungsunternehmen eignet
19
. Das mögliche Erweitern ihres Einsatzfeldes auf die
dortigen gesamten Leistungsprozesse beruht darauf, dass dort für alle Prozesse
generell die gleichen Bedingungen vorherrschen wie in den Gemeinkostenbereichen
von Industrieunternehmen. Dies ist auch an der Tatsache erkennbar, dass es im Dienst-
13
Vgl. Vikas, K. / Klein, A. (1997), S. 471.
14
Vgl. Männel, W. (1995), S. 16.
15
Vgl. Horváth, P. / Mayer, R. (1995), S. 61f.
16
Vgl. Zwicker, E. (2003), S. 4.
17
Vgl. Zwicker, E. (2003), S. 19 und siehe im weiteren die Ausführungen des Abschnitts 2.4.2.
18
Z. T. gab es auch schon früher in Deutschland, vor allem auf Seiten der Praxis entwickelte, unterneh-
menseigne prozessorientierte Kostenrechnungsansätze. Vgl. Reckenfelderbäumer, M. (1994), S. 19.
19
Vgl. Horváth, P. / Mayer, R. (1995), S. 62, sowie auch Männel, W. (1999), S. 133.
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-5-
leistungssektor aufgrund der spezifischen Produktionsbedingungen an klassischen
Bezugsgrößen wie Maschinenstunden, Durchsatzgewichten usw. mangelt
20
.
2. 2 Zielsetzungen und Aufgaben der Prozesskostenrechnung
Wie aus den Ausführungen des vorhergehenden Abschnittes erkennbar, ist der Einsatz
der Prozesskostenrechnung in Deutschland größtenteils auf die indirekten Leistungs-
bereiche eines Unternehmens beschränkt. Dies beruht auf dem beschriebenen
Ansteigen des Gemeinkostenanteils der Unternehmen und der damit einhergehenden
Aufdeckung der Defizite traditioneller Kostenrechungskonzepte mit ihren Arten der
Kostenaufschlüsselung. Der wesentliche Nachteil der konventionellen Vorgehens-
weise in diesen Bereichen ist eine tendenziell willkürliche und damit ungenaue
Aufschlüsselung der betrieblichen Gemeinkosten sowie eine hierdurch entstehende
Verzerrung innerhalb der Produktkostenkalkulation
21
. So werden z. B. durch die
Zuschlagskalkulation wertmäßig hochvolumige Produkte, wie Standardserien, mit
hohen Gemeinkosten und niedrigvolumige Produkte mit niedrigen Gemeinkosten
belastet
22
. Dies liegt hauptsächlich in der Berücksichtigung einer nur unzureichenden
Bezugsgröße als Maßgröße der Kostenveranlassung, wie etwa die Aufschlüsselung der
Materialgemeinkosten einer Kostenstelle auf Grundlage der Materialeinzelkosten
23
.
Dabei wird unterstellt, dass Produkte mit hohem Materialwert auch hohe Material-
gemeinkosten in Anspruch nehmen. Wenn diese Annahme jedoch unzutreffend ist und
sich damit nicht alle Kosten der Materialabteilung proportional zu dieser gewählten
Bezugsgröße verhalten, ist bei keiner weiteren dann notwendigen Differenzierung der
Bezugsgrößen diese praktizierte Gemeinkostenverteilung wenig verursachungsgerecht
und begünstigt falsche strategische Entscheidungen durch fehlerhaft kalkulierte
Produkte
24
.
Mit einem kurzem Beispiel
25
soll untermauert werden, wie folgenreich die eben
beschriebene Unterstellung sein kann, dass Produkte mit hohem Materialwert auch
hohe Gemeinkosten (hier bestehend aus den Vorgängen ,,Bestellen", ,,Ein- und
Auslagern" sowie ,,Rechnung schreiben") verursachen. Hervorgehoben wird dies
mittels der folgenden Abbildungen 1 und 2:
20
Vgl. Vikas, K. / Klein, A. (1997), S. 468.
21
Vgl. Reckenfelderbäumer, M. (1994), S. 20.
22
Vgl. Cooper, R. (1995a), S. 55, Striening, H.-D. (1991), S. 134.
23
Vgl. Olshagen, Ch. (1991), S. 14.
24
Vgl. Striening, H.-D. (1991), S. 134 sowie Scholz, H.-G. (2001), S. 13.
25
In Anlehnung an: Coenenberg, A. G. (1990), S. 11, abgebildet bei: Olshagen, Ch. (1991), S. 15.
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-6-
Produkt
Einkaufs-
preis
[in EUR /
Stück]
Menge
[in Stück]
Material-
einzel-
kosten
[in EUR]
Gesamte
Gemein-
kosten
[in EUR]
Gemeinkosten
[in EUR / Stück]
Gesamtkosten
[in EUR / Stück]
Krawatte Typ A
(Standard)
5,-
10
50,-
100,-
10,-
15,-
Krawatte Typ B
(Exklusiv)
50,-
10
500,-
1.000,-
100,-
150,-
1.100,-
Abb.1: Kalkulationsbeispiel ,,Krawattenhändler" Teil 1
Durch die Verwendung der oft noch benutzten Prämisse von Proportionalität zwischen
(Material-)Gemeinkosten und (Material-)Einzelkosten ergeben sich bei der Verteilung
der Gemeinkosten über einen Kalkulationssatz von 200 %
26
Stückkosten für die
Krawatte des Typ A von 15,- EUR und für die Krawatte des Typ B von 150,- EUR.
Unter der Annahme, dass durch jede Krawatte gleich hohe Gemeinkosten für die
betrieblichen Prozesse beim Bestellen, Ein- und Auslagern sowie dem Schreiben der
Rechnung verursacht werden, wäre allerdings ein gleich hoher Verrechnungssatz von
55,- EUR pro Stück zutreffend
27
!
Produkt
Einkaufspreis
[in EUR / Stück]
Prozesskosten
[in EUR / Stück]
Gesamtkosten je Stück
[in EUR]
Krawatte Typ A
(Standard)
5,-
55,-
60,-
Krawatte Typ B
(Exklusiv)
50,-
55,-
105,-
Abb.2: Kalkulationsbeispiel ,,Krawattenhändler" Teil 2
So wird aus Abbildung 2 ersichtlich, dass sich durch die Kalkulation unter der für
dieses Beispiel verursachungsgerechteren zweiten Annahme die Gesamtkosten je
Stück für die Krawatte von Typ A auf 60,- EUR und für die Krawatte von Typ B auf
105,- EUR belaufen.
Demzufolge spielt die Wahl der (,,richtigen") Produktkalkulationsvariante bei
entsprechender Gemeinkostenhöhe eine wesentliche Rolle, da es zu erheblichen
Verzerrungen kommen kann. Die Krawatte vom Typ B wurde bei dem in Abbildung 1
dargestellten Beispiel zu teuer kalkuliert und findet u. U. auf dem Markt keinen
Bestand. Die Krawatte vom Typ A bekam hingegen nur einen Teil der von ihr
26
Materialgemeinkosten / Materialwert ×100% = 1.100 EUR / 550 EUR ×100% = 200%.
27
Gemeinkosten / Gesamte Menge an Krawatten von Typ A und Typ B 1.100 EUR / 20 Stück =
55
EUR/Stück.
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-7-
verursachten Kosten zugeteilt. Da der Verkaufspreis nicht die tatsächlich vom Produkt
verursachten Prozesskosten deckt, führt dies bei jedem Verkauf mit zu niedrig kalku-
lierten Preisen zu einem zusätzlichen Verlust, wodurch die Rentabilität und auch der
Gewinn geschmälert werden. Dieses Phänomen ist auch unter dem Begriff Walkurve
bekannt geworden.
Den Erläuterungen des Beispieles zufolge ist es ferner wichtig zu bemerken, dass die
Gemeinkosten, die durch ein Produkt verursacht werden, (oft) nicht von den (Pro-
dukt-)Einzelkosten, also bestimmten wertmäßigen Zuschlagsbasen abhängen, sondern
von anderen Faktoren: ,,So werden z. B. die Materialgemeinkosten nicht durch den
Materialwert bestimmt, sondern u. a. durch die erforderliche Zahl an Bestellungen
oder Lagerbewegungen, die Fertigungsgemeinkosten nicht durch die Fertigungslöhne,
sondern z. B. durch die erforderlichen Prozesssteuerungsvorgänge oder die Zahl der
Rüstvorgänge und die Vertriebsgemeinkosten nicht durch die Höhe der Herstellkosten,
sondern vor allem durch die erforderlichen Absatzaktivitäten des Vertriebsperso-
nals"
28
. Ein grundlegender Gedanke der Prozesskostenrechnung besteht daher darin,
die betrieblichen Gemeinkosten nicht mehr über die tendenziell ungenauen Zuschlags-
sätze auf die zu kalkulierenden Produkte zu verteilen, sondern entsprechend der
tatsächlichen Inanspruchnahme betrieblicher Tätigkeiten durch die betrachteten
Kalkulationsobjekte
29
.
Dem erwähnten Problem der Verrechnung der Kosten der indirekten Unternehmens-
bereiche auf die Kostenträger ist das Problem einer angemessenen Kostenplanung vor-
gelagert. So ist festzustellen, dass beispielsweise in den ,,verwaltenden" Bereichen der
Unternehmungen nur selten die Bedingungen einer analytischen und mengenorien-
tierten Kostenplanung gegeben sind
30
. Ferner ist es in den Gemeinkostenbereichen, die
i. d. R. durch inkrementale Budgetveränderungen gesteuert werden, oft der Fall, dass
keine kontinuierlichen Produktivitätsfortschritte ermittelbar sind
31
. Die mit einer
Prozesskostenrechnung verfolgten Ziele beziehen sich aber neben der Behandlung im
Rahmen der Kalkulation gerade auch auf die Planung, Steuerung und Kontrolle der
betrieblichen Gemeinkosten
32
, so dass sie daher auch als ein Gemeinkostenmanage-
28
Franz, K.-P., (1990a), S. 197.
29
Vgl. Witt, F.-J., (1991), S. 20.
30
Vgl. Striening, H.-D. (1991), S. 134.
31
Vgl. Striening, H.-D. (1991), S. 136.
32
Vgl. Mayer, R. (1991), S. 75.
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-8-
mentinstrument bezeichnet werden kann und dementsprechend u. a. auch innerhalb
von Produktivitätsanalysen Anwendung findet
33
.
Die Prozesskostenrechnung wird somit zur Verfeinerung und Ergänzung der traditio-
nellen Kostenrechnung eingesetzt, um die Schwachpunkte aufgrund des Gemein-
kostenproblems der bisherigen Kostenrechnungskonzepte überwinden zu helfen.
Weiterhin soll sie auch die Aufgabe eines Kontroll- und Entscheidungsinstrumentes
im Rahmen eines prozessorientierten (Gemein-)Kostenmanagements erfüllen
34
.
Inwieweit jedoch die von den Verfechtern des Einsatzes einer Prozesskostenrechnung
gesetzten Ziele erfüllt und damit den von ihr beanspruchten Aufgaben gerecht werden,
wird im Abschnitt 2.6 nach der Beschreibung ihrer grundlegenden Charakteristika
sowie ihres Verrechnungsprinzips eingehender erörtert.
2. 3 Merkmale und Systematik der Prozesskostenrechnung
Die Prozesskostenrechnung ist, wie dargestellt, hauptsächlich als eine auf die Gemein-
kostenbereiche konzentrierte, aktivitätsorientierte Kostenrechnung zu verstehen
35
.
Wesentliches Merkmal der prozessorientierten Kostenrechnung ist dabei die
Auflösung des untersuchten Unternehmensbereiches in einzelne, voneinander zu
unterscheidende Tätigkeiten, wobei jedoch aus Praktikabilitäts- und Wirtschaftlich-
keitsgründen das Einsatzfeld der Prozesskostenrechnung auf die repetitiven und mit
geringem Entscheidungsspielraum behafteten Aktivitäten, die innerhalb einer Kosten-
stelle anfallen, beschränkt ist
36
. Es ist festzustellen, dass eine Prozesskostenverrech-
nung in all jenen Unternehmensbereichen von vornherein zum Scheitern verurteilt ist,
in denen die Wiederholbarkeit und auch die faktische Wiederholung der zugrunde
gelegten Prozesse als zwingende Voraussetzung für ihre wirtschaftliche Erfassbarkeit
nicht oder nicht in hinreichendem Maße gegeben ist
37
.
Zum Verständnis der Prozesskostenrechnung stellt H
ORVÁTH
die Erkenntnis heraus,
dass die für den Markterfolg einer Unternehmung wichtigen Abläufe (Hauptprozesse)
in den meisten Organisationsstrukturen kostenstellenübergreifend sind
38
. So durchläuft
z. B. eine einfache Materialbeschaffung, wie durch die folgende Abbildung 3 verdeut-
33
Siehe hierzu ausführlicher die Seite 53 im Abschnitt 2.6
34
Eine ausführliche Bearbeitung der Ziele und Aufgaben der prozessorientierten Kostenrechnung
findet sich bei Reckenfelderbäumer, M. (1994), S. 26 ff.
35
Vgl. Horváth, P. (2001), S. 554.
36
Vgl. Reckenfelderbäumer, M. (1994), S. 47.
37
Vgl. Vikas, K. / Klein, A. (1997), S. 474.
38
Vgl. Männel, W. (1999), S. 135, Horváth, P. (2001), S. 555.
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-9-
licht, meist eine ganze Reihe von Abteilungen. In all den dort dargestellten Kosten-
stellen entstehen somit Kosten für diesen Prozess.
Kostenstellen
Hauptprozess
Teilprozesse
,,Material beschaffen"
Kostenstellen:
220 Einkauf
282 Warenannahme
110 Qualitätssicherung
112 Lager
Abb. 3: Bildung des Hauptprozesses ,,Material beschaffen" aus verschiedenen Teil-
prozessen
39
Durch eine Analyse sämtlicher Tätigkeiten verfolgt die Prozesskostenrechnung in all
jenen den Prozess berührenden Kostenstellen das im vorhergehenden Abschnitt
erwähnte Ziel, eine erhöhte Kostentransparenz der Gemeinkostenbereiche zu schaffen.
Diese Transparenz soll möglichst dadurch erreicht werden, dass konkret aufgezeigt
wird, welche Kosten in der Abteilung für welche Tätigkeiten anfallen. Die prozess-
orientierte Kostenrechnung bedient sich dabei, wie die traditionelle Vollkosten-
rechnung auch, der Kostenarten-, Kostenstellen- sowie Kostenträgerrechnung und
kann demnach bei einer Implementierung in diese Bereiche aufgeteilt werden
40
. Die
Stellenrechnung ist erforderlich, um die eine differenzierte Verrechnung der Gemein-
kosten auf die Produkte zu gewährleisten
41
. Nach Möglichkeit wird jedoch ein großer
Teil der indirekten Kosten nicht über Zuschlagsätze, sondern über die Kostentreiber
mit ihrer Anzahl an ausgelösten Prozessen bzw. der zeitlichen Dauer der Prozesse auf
die Kostenträger verteilt. Um dies zu erreichen, wird die traditionelle Kostenrechnung
um eine Prozessanalyse erweitert.
39
In Anlehnung an: Coenenberg, A. G. / Fischer, Th. M. (1991), S. 27.
40
Vgl. Kilger, W. (1993), S. 104.
41
Vgl. Reckenfelderbäumer, M. (1994), S. 22 f.
220
282
110
112
Material
beschaffen
112
2201
Angebote für
Material
einholen
2821
Material-
lieferung
entgegen-
nehmen
1102
Material prüfen
1122
Material lagern
2822
Hilfs- u.
Betriebs-stoffe
entgegen-
nehmen
2203
Angebote für
Hilfs- u. Be-
triebsstoffe
einholen
2202
Bestellungen
für Material
durchführen
2204
Bestellungen
für Hilfs- u.
Betriebsstoffe
durchführen
1101
Prüfung für
Werkstoff-
technik
durchführen
1103
Eingangs-
prüfung für
Hilfs- u. Be-
triebsstoffe
durchführen
1103
Chemische
Kontrollen
durchführen
1121
Hilfs-
u. Betriebs-
stoffe lagern
1123
Unfertige
Erzeugnisse
lagern
1124
Fertige
Erzeugnisse
lagern
2201
Angebote für
Material
einholen
2202
Bestellungen
für Material
durchführen
2821
Materialliefe-
rung entgegen-
nehmen
1102
Material prüfen
1122
Material lagern
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-10-
Zusammenfassend lässt sich die Prozesskostenrechnung in ihrer Anwendung mit den
nachfolgend erläuterten drei konstituierenden Faktoren kennzeichnen. Gleichzeitig
soll dabei die unterschiedliche Herangehensweise hinsichtlich der Begriffsbestim-
mungen einiger Autoren innerhalb der prozessorientierten Kostenrechnung heraus-
gestellt werden, da ein einheitliches und allgemeingültiges Schema diesbezüglich noch
nicht existiert.
(1) Prozesse:
Im Rahmen der prozessorientierten Kostenrechnung sind Prozesse nach der von
Z
WICKER
verwendeten Definition der DIN-Norm 1922 ,,die Gesamtheit von aufeinan-
der einwirkender Vorgänge in einem System"
42
. Für H
ORVÁTH
hingegen sind
Prozesse innerhalb der Terminologie der Prozesskostenrechnung eine ,,auf die
Erbringung eines Leistungsoutputs gerichtete Kette von Aktivitäten"
43
. Aufgrund der
Beschreibung des Prozesses als eine gerichtete Kette bestimmter Aktivitäten geht auch
er augenscheinlich mit dieser Definition von einer Abhängigkeitsbeziehung aus.
Zur Unterteilung der Prozesse finden sich in der Literatur ebenfalls unterschiedliche
Ansätze. H
ORVÁTH
und M
AYER
, deren entwickelte Prozesskostenrechnung am häufig-
sten verwendet wird, unterscheiden hierbei vier Prozessebenen. Dies sind Aktivitäten,
Teil-, Haupt- und Geschäftsprozesse. Die sich auf der untersten Ebene befindenden
Aktivitäten werden zu abteilungsspezifischen Teilprozessen, die einer Kostenstelle zu-
geordnet werden, zusammengefasst. Alle Teilprozesse wiederum mit identischen
Kosteneinflussfaktoren können zu einem Hauptprozess verdichtet werden. Hierbei
kann ein Teilprozess einem Hauptprozess voll oder nur teilweise zugeordnet werden
und dadurch auch in verschiedene Hauptprozesse einfließen.
44
In dieser zusammenfas-
senden Verdichtung zu wenigen Hauptprozessen liegt einer der zentralen Aspekte
dieses prozessorientierten Kostenrechnungsansatzes. Ihre Vertreter versprechen sich
davon Wirtschaftlichkeitsvorteile, da sich der spätere Erfassungs- und Rechenaufwand
auf diese Hauptprozesse konzentriert und damit reduziert
45
. Die oberste Ebene bilden
die Geschäftsprozesse, welche aus näher bestimmten aggregierten Hauptprozessen
bestehen. Innerhalb des Prozesskostenrechnungsansatzes von H
ORVÁTH
und M
AYER
erfolgt aber die kostenseitige Bewertung und Ermittlung von Mengenbeziehungen nur
für die Teil- und Hauptprozesse, d. h. maximal zweistufig, da sich auf dem Detail-
42
Vgl. Zwicker, E. (2003), S. 22.
43
Vgl. Horváth, P. (2001), S. 555.
44
Vgl. Horváth, P. (2001), S. 555.
45
Vgl. Cooper, R. (1992), S. 380.
Prozesskostenrechnung und Kostentreiberanalysen
-11-
lierungsniveau der Aktivitäten und der Aggregationsebene der Geschäftsprozesse
dieses Vorgehen als für sie nicht sinnvoll herausgestellt hat
46
.
In dem von Z
WICKER
gewählten Prozesskostenrechnungsansatz, des im weiteren als
INZPLA-Prozesskostenrechnung bezeichneten Prozesskostenmodellierungsansatzes,
erfolgt die Differenzierung der Prozesse bzgl. der einzelnen Aggregationsstufen etwas
tiefgreifender durch eine Unterscheidung der Prozesse in Haupt- und Elementar-
prozesse. Elementarprozesse beschreiben dabei bestimmte Aktivitäten eines Unter-
nehmens, von denen jeder eine Input- und eine Outputmenge besitzt
47
. Während die
Input- oder Einsatzmenge die Einsatzfaktoren des Elementarprozesses verkörpert,
stellt die Output- oder Liefermenge seine Leistung dar
48
. Treten ferner zwischen
Elementarprozessen Verknüpfungsformen in ihren In- und Outputmengen auf, dann
können diese durch die Verknüpfungen zusammengehörenden Elementarprozesse als
Komponenten eines übergeordneten Hauptprozesses interpretiert werden
49
. Dies ist
etwa der Fall, wenn die Liefermengen eines Elementarprozesses zugleich auch die
Einsatzmengen eines anderen Elementarprozesses sind. Des weiteren ist es möglich,
dass einige der Elementarprozesse des derart definierten Hauptprozesses die Kompo-
nenten eines Teilprozesses in diesem Hauptprozess bilden.
An dieser Stelle sollen kurz Möglichkeiten der Verknüpfungsformen erläutert werden.
Das Erstellen einer Leistung durch einen Elementarprozess führt dazu, dass diese an
eine andere Einheit geliefert wird. Die Beziehungen zwischen den Liefermengen von
Elementarprozessen in einem Kostenmodell können durch ein Liefermengendiagramm
beschrieben werden. Dieses korrespondiert mit einem Bestellmengendiagramm, wenn
die Pfeilbeziehungen umkehrt werden
50
. Da innerhalb der Fertigungsbereiche die
echten Bestellmengen im Gegensatz zu den echten Liefermengen als echte Prozess-
treiber interpretiert werden können, spielen Bestellmengendiagramme eine bedeutende
Rolle in der INZPLA-Prozesskostenrechnung. So kann mit einem ,,Ausschnitt" aus
einem Bestellmengendiagramm ein Prozesstreiberdiagramm generiert werden
51
, aus
dem wiederum Teil- und Hauptprozesse zu erkennen sind, die sich aus der Gesamtheit
aller ihnen zuzurechnenden Elementarprozesse bilden.
46
Vgl. Zwicker, E. (2003), S. 45f., zitiert nach: Mayer, R. (1998), S. 4 und 9.
47
Vgl. Zwicker, E. (2003), S. 5.
48
Vgl. Zwicker, E. (2003), S. 5.
49
Vgl. Zwicker, E. (2003), S. 5.
50
Vgl. hierzu ausführlicher Zwicker, E. (2003), S. 6.
51
Vgl. Zwicker, E. (2003), S. 7.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832476618
- ISBN (Paperback)
- 9783838676616
- DOI
- 10.3239/9783832476618
- Dateigröße
- 914 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Berlin – Wirtschaft und Management
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- prozesskostenmanagement activity based costing cost driver gemeinkosten kosten
- Produktsicherheit
- Diplom.de