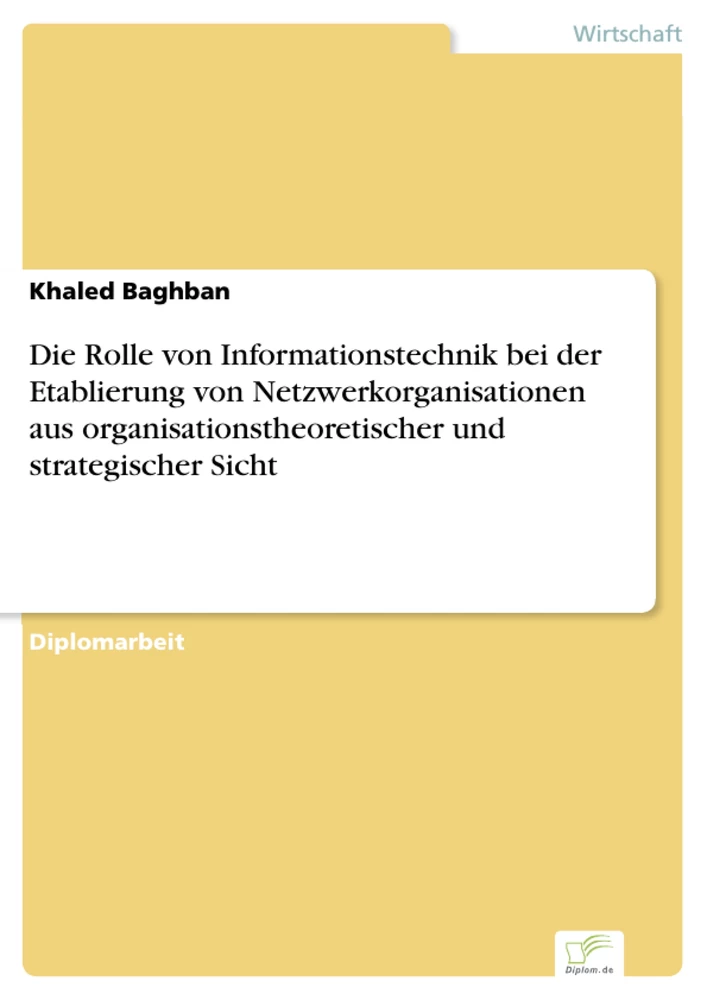Die Rolle von Informationstechnik bei der Etablierung von Netzwerkorganisationen aus organisationstheoretischer und strategischer Sicht
©2003
Diplomarbeit
99 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Entwicklung von Netzwerkorganisationen und Informationstechnik, die aus unterschiedlichen Perspektiven rekonstruiert wird. Da die Untersuchung organisatorische, strategische und informationstechnische Fragestellungen verbindet, ist Kapitel 2 als einführender Überblick konzipiert, der den Zugang zu der interdisziplinären Fragestellung erleichtern soll. Nach einer kurzen Bestimmung relevanter Grundbegriffe aus Organisationslehre und Informatik erfolgt eine definitorische und konzeptionelle Einordnung von Netzwerkorganisationen. Anschließend werden wirtschaftliche und informationstechnologische Triebkräfte dargestellt, die Unternehmen dazu veranlassen, Kooperationen einzugehen.
In Kapitel 3 werden ausgewählte organisationstheoretische Ansätze und ihre Beiträge zur Erklärung des Einsatzes von Informationstechnik bei der Etablierung von Netzwerkorganisationen diskutiert. Um den Teildisziplinen der Fragestellung Rechnung zu tragen und sie miteinander in Beziehung setzen zu können, werden die aus der Betriebswirtschaftslehre stammende Transaktionskostentheorie, die sozialwissenschaftliche Strukturationstheorie und die Koordinationstheorie als strategischer Ansatz herangezogen.
In Kapitel 4 werden die aus den unterschiedlichen Theorien gewonnenen Erkenntnisse für die Gestaltung des Einsatzes von Informationstechnik in Netzwerkorganisationen verwendet. Hierzu wird zunächst aus den Implikationen der Organisationstheorien ein Anforderungsprofil entwickelt, anhand dessen anschließend das Modell der Neuen Unternehmensführungslehre nach PICOT, REICHWALD und WIGAND und das Modell Informatiksysteme in Organisationen nach ROLF auf ihre Eignung als Gestaltungsansätze evaluiert werden. Aufbauend auf den Evaluationsergebnissen wird mit dem selbst entwickelten Modell Informatiksysteme in Netzwerkorganisationen der Versuch unternommen, einen möglichen Gestaltungsansatz zu entwerfen, der die besondere Bedeutung der Strategiebildung in Netzwerkorganisationen darstellt und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Informationstechnikeinsatz und Netzwerkorganisationen ableitet.
Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Darstellung der Untersuchungsergebnisse und einem möglichen Ausblick auf weitere Forschungsbedarfe ab.
Problemstellung:
Die erhöhte Komplexität und Dynamik der technologischen, marktlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen führen zur Entstehung neuer und […]
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Entwicklung von Netzwerkorganisationen und Informationstechnik, die aus unterschiedlichen Perspektiven rekonstruiert wird. Da die Untersuchung organisatorische, strategische und informationstechnische Fragestellungen verbindet, ist Kapitel 2 als einführender Überblick konzipiert, der den Zugang zu der interdisziplinären Fragestellung erleichtern soll. Nach einer kurzen Bestimmung relevanter Grundbegriffe aus Organisationslehre und Informatik erfolgt eine definitorische und konzeptionelle Einordnung von Netzwerkorganisationen. Anschließend werden wirtschaftliche und informationstechnologische Triebkräfte dargestellt, die Unternehmen dazu veranlassen, Kooperationen einzugehen.
In Kapitel 3 werden ausgewählte organisationstheoretische Ansätze und ihre Beiträge zur Erklärung des Einsatzes von Informationstechnik bei der Etablierung von Netzwerkorganisationen diskutiert. Um den Teildisziplinen der Fragestellung Rechnung zu tragen und sie miteinander in Beziehung setzen zu können, werden die aus der Betriebswirtschaftslehre stammende Transaktionskostentheorie, die sozialwissenschaftliche Strukturationstheorie und die Koordinationstheorie als strategischer Ansatz herangezogen.
In Kapitel 4 werden die aus den unterschiedlichen Theorien gewonnenen Erkenntnisse für die Gestaltung des Einsatzes von Informationstechnik in Netzwerkorganisationen verwendet. Hierzu wird zunächst aus den Implikationen der Organisationstheorien ein Anforderungsprofil entwickelt, anhand dessen anschließend das Modell der Neuen Unternehmensführungslehre nach PICOT, REICHWALD und WIGAND und das Modell Informatiksysteme in Organisationen nach ROLF auf ihre Eignung als Gestaltungsansätze evaluiert werden. Aufbauend auf den Evaluationsergebnissen wird mit dem selbst entwickelten Modell Informatiksysteme in Netzwerkorganisationen der Versuch unternommen, einen möglichen Gestaltungsansatz zu entwerfen, der die besondere Bedeutung der Strategiebildung in Netzwerkorganisationen darstellt und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Informationstechnikeinsatz und Netzwerkorganisationen ableitet.
Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Darstellung der Untersuchungsergebnisse und einem möglichen Ausblick auf weitere Forschungsbedarfe ab.
Problemstellung:
Die erhöhte Komplexität und Dynamik der technologischen, marktlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen führen zur Entstehung neuer und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7644
Baghban, Khaled: Die Rolle von Informationstechnik bei der Etablierung von
Netzwerkorganisationen aus organisationstheoretischer und strategischer Sicht
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Universität Hamburg, Universität, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
II
I
NHALTSVERZEICHNIS
A
BKÜRZUNGSVERZEICHNIS
... IV
A
BBILDUNGSVERZEICHNIS
... VI
T
ABELLENVERZEICHNIS
... VII
L
ITERATURVERZEICHNIS
... VIII
E
IDESSTATTLICHE
V
ERSICHERUNG
...XXI
1 Einleitung...1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung ...1
1.2 Gang der Untersuchung ...2
2 Grundlagen ...4
2.1 Begriffsbestimmungen...4
2.1.1 Grundbegriffe der Organisationslehre ...4
2.1.2 Grundbegriffe der Informatik ...5
2.1.3 Definition und konstituierende Merkmale von Netzwerkorganisationen...6
2.1.4 Konzeptionelle Einordnung von Netzwerkorganisationen ...10
2.2 Grundlagen der Vernetzung von Organisationen ...12
2.2.1 Wirtschaftliche Treiber der Vernetzung ...13
2.2.2 Informationstechnische Treiber der Vernetzung ...14
2.2.3
Vernetzung als ,,informationstechnologisches Paradigma" nach C
ASTELLS
17
3 Organisationstheoretische Ansätze zur Erklärung des Einsatzes von
Informationstechnik in Netzwerkorganisationen ...20
3.1 Anforderungen an eine Theorie zur Erklärung von Netzwerkorganisationen ...20
3.1.1
Zur Notwendigkeit der Integration der Informationstechnik in die
Organisationstheorie ...20
3.1.2 Begründung der Auswahl der theoretischen Ansätze ...21
3.2 Transaktionskostentheorie ...23
3.2.1 Grundlagen der Transaktionskostentheorie ...23
3.2.2 Informationstechnik, Spezifität und Koordinationsform ...25
3.2.3
Informationstechnik, Grad der Arbeitsteilung und Unternehmensgröße ...27
3.2.4 Erkenntnisse und Kritik...29
III
3.3 Strukturationstheorie ...31
3.3.1
Grundlagen der Strukturationstheorie ...31
3.3.2 Relevanz der
Strukturationstheorie
für
organisationstheoretische Zwecke.33
3.3.3
Netzwerkorganisationen und Informationstechnik als Anwendungs-
gebiete der Strukturationstheorie ...34
3.3.4 Die Dualität von Informationstechnik...35
3.3.5 Erkenntnisse...37
3.4
Koordinationstheorie...37
3.4.1
Grundlagen der Koordinationstheorie...38
3.4.2
Netzwerkorganisationen als koordinierte Prozesse...39
3.4.3 Einfluss des Einsatzes von Informationstechnik auf Netzwerk-
organisationen ...40
3.4.4
Das Konzept der Koordinationsstrategie ...41
3.4.5
Erkenntnisse und Kritik...43
4 Ansätze für die strategiekonforme Ausgestaltung des Einsatz von
Informationstechnik zur Etablierung von Netzwerkorganisationen...44
4.1 Anforderungen an ein Gestaltungsmodell ...44
4.2 Das NUL-Modell nach P
ICOT
,
R
EICHWALD
und W
IGAND
...45
4.2.1 Charakterisierung des NUL-Modells ...46
4.2.2 Evaluation des NUL-Modells ...48
4.3 Das ISO-Modell nach R
OLF
...50
4.3.1 Charakterisierung des ISO-Modells ...51
4.3.2 Evaluation des ISO-Modells ...55
4.4 Das ISOnet-Modell ...57
4.4.1 Wechselwirkungen zwischen Informatiksystem und Netzwerk-
organisationen ...58
4.4.2 Die Mesoebene des ISOnet-Modells...60
4.4.3 Die Koordinationsstrategie als konzeptioneller Gestaltungsrahmen ...62
4.4.4 Formen kollektiver Koordinationsstrategien ...64
4.4.5 Implikationen für die Gestaltung von Netzwerkorganisationen und
Informationstechnikeinsatz ...69
5 Schlussbetrachtung...75
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse...75
5.2 Ausblick ...76
IV
A
BKÜRZUNGSVERZEICHNIS
a. M.
am Main
Aufl.
Auflage
BPR
Business
Process
Reengineering
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CLRC
Customer Resource Life Cycle
CRM
Customer-Relationship-Management
d. h.
das heißt
DSS
Decision
Support
System
EDI
Electronic
Data
Interchange
eMail
electronic
Mail
etc.
et
cetera
et al.
et alii (und andere)
EU
Europäische
Union
EUS
Entscheidungsunterstützende
Systeme
evtl.
eventuell
f.
folgende
ff.
fortfolgende
F&E
Forschung und Entwicklung
HTML
Hypertext
Markup
Language
Hrsg.
Herausgeber
i.d.R.
in der Regel
IKT
Informations-
und
Kommunikationstechnik
IKT
Informations-
und
Kommunikationssystem
IP
Internet
Protokoll
IOS
Interorganisationssystem
IS
Informationssystem
ISO
Informatiksysteme
in
Organisationen
ISOnet
Informatiksysteme in Netzwerkorganisationen
IT
Informationstechnik
Iv
Informationsverarbeitung
Jg.
Jahrgang
KMU
kleine
und
mittlere
Unternehmen
MIS
Management
Informationssysteme
NAFTA
North American Free Trade Association
NUL
Neue
Unternehmensführungslehre
Nr.
Nummer
V
OLAP
Online
Analytical
Processing
S.
Seite
SAP/R3
Systeme Anwendungen Produkte / Realtime 3
SCM
Supply
Chain
Management
TNP
Techniknutzungspfad
TCO
Total Cost of Ownership
TCP
Transmission
Control
Protocol
u.a.
unter
anderem
usw.
und so weiter
u.U.
unter
Umständen
vgl.
vergleiche
www
World
Wide
Web
XML
Extensible
Markup
Language
z.B.
zum
Beispiel
ZfB
Zeitschrift für Betriebswirtschaft
z.T.
zum
Teil
VI
A
BBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 3-1: Einflussgrößen auf die Transaktionskosten ...24
Abbildung 3-2: Koordinationsform, Transaktionskosten und Spezifitätsgrad...25
Abbildung 3-3: Transaktionskosten, Spezifität und Informationstechnik ...27
Abbildung 3-4: Kostenminimaler Grad der Arbeitsteilung...28
Abbildung 3-5: Effekte der IT auf den kostenminimalen Grad der Arbeitsteilung...28
Abbildung 3-6: Strukturationstheoretische Sichtweise des Einsatzes von
Informationstechnik ...35
Abbildung 3-7: Koordination von Geschäftspartnern über gemeinsame Informationen...39
Abbildung 4-1: Entstehung von Koordinationsformen nach P
ICOT
,
R
EICHWALD
und
W
IGAND
...46
Abbildung 4-2: Zustandssicht auf der Mikro- und Makroebene...51
Abbildung 4-3: Prozesssicht auf der Mikro- und Makroebene...52
Abbildung 4-4: Darstellung der strukturellen Kopplung ...53
Abbildung 4-5: Das Akteursmodell aus Sicht der Technikentwicklung...54
Abbildung 4-6: Systeme, Lebenswelt und Gesellschaft ...55
Abbildung 4-7: Die Mesoebene im ISOnet-Modell ...61
Abbildung 4-8: Bezugsrahmen zur Gestaltung der Netzwerkorganisation...62
Abbildung 4-9: Positionierung unterschiedlicher kollektiver Koordinationsstrategien
in Abhängigkeit von der Netzwerkgröße und Netzwerktopologie ...65
VII
T
ABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 2-1: Typisierungsmöglichkeiten interorganisationaler Netzwerke...9
Tabelle 2-2: Vergleich von Koordinationsformen nach W
ILLIAMSON
...11
Tabelle 3-1: Transaktionskostenvorteile von Netzwerkorganisationen
... 30
1
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Die erhöhte Komplexität und Dynamik der technologischen, marktlichen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen führen zur Entstehung neuer und zur Anpassung
bestehender Organisationsformen. Die Grenzen von Unternehmen werden dabei ver-
schoben und neu definiert, teilweise wird auch davon gesprochen, dass sie ver-
schwimmen. Als Folge dieser Entwicklungen sind in der Praxis vermehrt intermediäre
Formen der interorganisatorischen Zusammenarbeit zwischen mehreren rechtlich selb-
ständigen Unternehmungen zur Umsetzung gemeinsamer Wettbewerbsziele beob-
achtbar, die im Rahmen dieser Arbeit unter dem Begriff der Netzwerkorganisation dis-
kutiert werden.
Netzwerkorganisationen repräsentieren kein neues Phänomen, denn bereits im Mittel-
alter sind neben dem Warentausch und der Leistungserstellung zahlreiche Formen
wirtschaftlicher Kooperation belegt. In den letzten beiden Jahrzehnten und vor allem in
den letzten fünf Jahren haben sich Netzwerkorganisationen allerdings, nicht zuletzt
unter dem Einfluss neuer Informations- und Kommunikationstechniken, maßgeblich
verbreitet und in der Wissenschaft und Forschung verstärkt Beachtung gefunden. Etwa
gleichzeitig mit der Ausbreitung von Netzwerkorganisationen sind Informationssysteme
geschaffen worden, die die Abwicklung von Geschäftstransaktionen zwischen Unter-
nehmen unterstützen. Es stellt sich die Frage, inwiefern zwischen der Entwicklung von
Informations- und Kommunikationstechnik und Netzwerkorganisationen wechselseitige
Beziehungen bestehen.
Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit verbindet organisatorische,
informationstechnische und strategische Fragestellungen. Das Phänomen der Netz-
werkorganisation überschreitet die zwischen den Disziplinen gezogenen, zum Teil
künstlichen, Trennungslinien. Netzwerkorganisationen sind in diesem Sinne interdiszi-
plinär konstituiert und ihre Untersuchung ist in vielfältige wissenschaftliche Disziplinen
ausdifferenziert, etwa der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Wirt-
schaftsinformatik und der Soziologie, die erst im Verbund einen angemessenen Zu-
gang zum Phänomen ermöglichen.
Trotz zunehmender empirischer Nachweisbarkeit von Netzwerkorganisationen und der
Literaturfülle zu diesem Themenkomplex ist allerdings zu beobachten, dass die Inter-
dependenzen der Entwicklung von Netzwerkorganisationen und Informationstechnik
oftmals nur sehr populärwissenschaftlich
und ohne die notwendige (integrative) theore-
tische Fundierung untersucht werden.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Bedeutung von Informationstechnik bei der Etablierung von
Netzwerkorganisationen vor dem Hintergrund ausgewählter Organisationstheorien zu
diskutieren und im Zusammenwirken von sozialen, organisatorischen sowie informati-
2
onstechnischen Einflussfaktoren strategische Gestaltungsoptionen für den Einsatz von
Informationstechnik in Netzwerkorganisationen zu analysieren.
Hinsichtlich des Einflusses der Informationstechnik auf die Handlungen von Akteuren
und der Struktur der Netzwerkorganisation soll die vorliegende Arbeit auf die Bedeu-
tung sozialer, organisatorischer und technischer Wechselwirkungen aufmerksam ma-
chen und bewusst nicht von einseitig determinierenden Einflüssen ausgehen. Konkrete
Ausprägungsformen - sowohl des IT-Einsatzes, als auch von Netzwerkorganisationen -
werden dabei stets als Ergebnis strategisch-gestaltenden Handelns menschlicher Ak-
teure verstanden.
1.2 Gang der Untersuchung
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Entwicklung von Netzwerkorganisationen und
Informationstechnik, die aus unterschiedlichen Perspektiven rekonstruiert wird. Da die
Untersuchung organisatorische, strategische und informationstechnische Fragestellun-
gen verbindet, ist Kapitel 2 als einführender Überblick konzipiert, der den Zugang zu
der interdisziplinären Fragestellung erleichtern soll. Nach einer kurzen Bestimmung
relevanter Grundbegriffe aus Organisationslehre und Informatik erfolgt eine definitori-
sche und konzeptionelle Einordnung von Netzwerkorganisationen. Anschließend wer-
den wirtschaftliche und informationstechnologische Triebkräfte dargestellt, die Unter-
nehmen dazu veranlassen, Kooperationen einzugehen.
In Kapitel 3 werden ausgewählte organisationstheoretische Ansätze und ihre Beiträge
zur Erklärung des Einsatzes von Informationstechnik bei der Etablierung von Netz-
werkorganisationen diskutiert. Um den Teildisziplinen der Fragestellung Rechnung zu
tragen und sie miteinander in Beziehung setzen zu können, werden die aus der Be-
triebswirtschaftslehre stammende Transaktionskostentheorie, die sozialwissenschaftli-
che Strukturationstheorie und die Koordinationstheorie als strategischer Ansatz
herangezogen.
In Kapitel 4 werden die aus den unterschiedlichen Theorien gewonnenen Erkenntnisse
für die Gestaltung des Einsatzes von Informationstechnik in Netzwerkorganisationen
verwendet. Hierzu wird zunächst aus den Implikationen der Organisationstheorien ein
Anforderungsprofil entwickelt, anhand dessen anschließend das Modell der ,,Neuen
Unternehmensführungslehre" nach P
ICOT
,
R
EICHWALD
und W
IGAND
und das Modell
,,Informatiksysteme in Organisationen" nach R
OLF
auf ihre Eignung als Gestaltungsan-
sätze evaluiert werden. Aufbauend auf den Evaluationsergebnissen wird mit dem
selbst entwickelten Modell ,,Informatiksysteme in Netzwerkorganisationen" der Versuch
unternommen, einen möglichen Gestaltungsansatz zu entwerfen, der die besondere
Bedeutung der Strategiebildung in Netzwerkorganisationen darstellt und Handlungs-
empfehlungen für die Gestaltung von Informationstechnikeinsatz und Netzwerkorgani-
sationen ableitet.
3
Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Darstellung der Untersuchungser-
gebnisse und einem möglichen Ausblick auf weitere Forschungsbedarfe ab.
4
2 Grundlagen
2.1 Begriffsbestimmungen
Interdisziplinäre Problemstellungen erfordern eine ausführlichere Begriffsbestimmung
und -abgrenzung als Abhandlungen innerhalb klar definierter Fachgrenzen, bei denen
die Grundbegriffe als bekannt vorausgesetzt werden können. Daher werden im Fol-
genden die für die Problemstellung zentralen Grundbegriffe aus Organisationslehre
und Informatik kurz skizziert.
2.1.1 Grundbegriffe der Organisationslehre
Kaum ein anderer Begriff, wie derjenige der ,,Organisation", weist sowohl in der Um-
gangssprache, als auch in der Wissenschaft eine vergleichbare Vielfältigkeit auf. Es
können grundsätzlich zwei unterschiedliche Begriffsvorstellungen gegeneinander ab-
gegrenzt werden:
1
der (engere) instrumentelle Organisationsbegriff, der unter Organisation die Ge-
samtheit aller generellen, expliziten, zielgerichteten Regelungen zur Gestaltung
von Aufbau- und Ablaufstrukturen des Unternehmens versteht;
Die Unternehmung hat eine Organisation
der (weitere) institutionelle Organisationsbegriff, der Organisation als zielorientier-
tes, sozio-technisches System versteht, welches mit Hilfe von expliziten und im-
pliziten Strukturen ein arbeitsteiliges und koordiniertes Zusammenwirken der Or-
ganisationsmitglieder anstrebt.
Die Unternehmung ist eine Organisation
Im Ergebnis der Organisation wird die Aufbau- von der Ablauforganisation unterschie-
den. Während sich die Aufbauorganisation auf die Gliederung von Unternehmen in
aufgabenteilige Einheiten und ihre Koordination bezieht, handelt es sich bei der Ab-
lauforganisation um die raum-zeitliche Strukturierung der Arbeits- und Bewegungsvor-
gänge.
2
Die Aufgabe der Organisationsgestaltung ist die Schaffung eines koordinierten und
arbeitsteiligen Aktivitätengefüges, das von Menschen und Technologie getragen wird
und so die gewünschten Funktionen des Unternehmens bestmöglich gewährleistet.
3
Die Aufgabe einer Organisationstheorie liegt in der Bereitstellung eines Fundaments
für die Gestaltung der Organisation in der Praxis. Dabei wird eine empirisch ermittelte
Ursache-/Wirkungs- Beziehung in eine Ziel-/Mittel- Relation transformiert, d.h. aus der
Ursache wird das Mittel und aus der Wirkung wird das Ziel abgeleitet.
4
In der Organisa-
1
Vgl. nachfolgend [Bleicher 1991, S.34 ff.], [Gaitanides 1983, S.1 ff.], [Grochla 1982, S.1 ff.], [Frese
1991, S.1 ff.], [Kieser/Kubicek 1978, S.11 ff.], [Bühner 1999, S.2 f.] und [Schreyögg 1996, S.4 ff.].
2
Vgl. [Bühner 1999, S.11].
3
Vgl. [Berg 1981, S.17] und [Grochla 1982, S.2].
4
Vgl. [Bea/Göbel 2002, S.199].
5
tionstheorie basieren Organisationen auf Strukturen und Handlungen, die im Wesentli-
chen stabile soziale Entitäten darstellen und die organisatorische Kontinuität als ein
organisatorisches Gleichgewicht garantieren.
5
Eine Organisationstheorie stellt dabei
immer eine Abstraktion von konkreten Organisationen dar. Eine theoretisch fundierte
Betrachtung kann dazu beitragen, die Bedeutung einzelner organisatorischer Phäno-
mene einzuordnen und miteinander in Beziehung zu setzen.
6
Es gibt jedoch keine all-
gemein gültige und allgemein akzeptierte Organisationstheorie.
7
Stattdessen existiert
eine Vielzahl von Ansätzen, wobei die Frage unbeantwortet bleiben muss, welcher
dieser Ansätze der ,,richtige" ist. Tatsächlich ist das Erkenntnisobjekt Organisation zu
komplex, als dass es den ,,one best way" gibt.
8
2.1.2 Grundbegriffe der Informatik
Die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) umfasst alle Prinzipien, Methoden
und Mittel zur Bereitstellung, Verarbeitung, Übermittlung, Speicherung und Verwen-
dung von Informationen sowie zur Gestaltung und Nutzung von Informations- und
Kommunikationssystemen (IKS).
9
Während Informationstechnik (IT) vom spezifischen
Einsatzkontext abstrahiert und Infrastrukturen im Sinne einer Plattform bestehend aus
Hardware, Software und deren Vernetzung bezeichnet, zielen Informationssysteme
(IS) auf spezielle Funktionalitäten zur Informationsverarbeitung (IV) ab. IS sind stets in
einen Kontext eingebunden und somit von ihrer Anwendung abhängig.
10
Werden IS
zwischenbetrieblich genutzt, so wird von Interorganisationssystemen (IOS) gespro-
chen.
11
Beim Einsatz von IOS geht es vor allem um die gemeinsame Nutzung von In-
formationen sowie um den Austausch geschäftsbezogener Nachrichten, z.B. Electronic
Data Interchange (EDI). Die Grundidee von IOS liegt darin, die Funktionen von IS auf
den zwischenbetrieblichen Bereich auszudehnen, um Vorteile der Integration, Transpa-
renz, Effizienz etc. auch auf interorganisationaler Ebene zu realisieren.
12
In der Litera-
tur werden zahlreiche Begriffsvarianten zur Bezeichnung von IOS verwendet, die auf
ein gemeinsames Grundverständnis verweisen, aber unterschiedliche Aspekte beto-
nen. Gemeinsam ist diesen Begriffsvarianten (1.) die Betonung eines Verbundes zwi-
schen mehreren unabhängigen Organisationen, (2.) die Verwendung von computerge-
5
Vgl. [Frese 1992, S.1706 f.].
6
Vgl. [Hinck 1999, S.9].
7
Vgl. [Hinck 1999, S.4] und [Rolf 2002d, S.7].
8
Vgl. [Bea/Göbel 2002, S.83 ff.].
9
Vgl. [Stahlknecht/Hasenkamp 2002, S.13], [Rolf 1998, S.206 f.], [Raupp 2003, S.161 ff.] und [Zahn
1997, S.300].
10
Vgl. [Hansen/Neumann 2001, S.132 ff.], [Stahlknecht/Hasenkamp 2002, S.397 ff.] und [Rolf 1998,
S.147 ff.]. Beispiele für IS sind Managementinformationssysteme (MIS), Führungsinformationssyste-
me (FIS), Entscheidungsunterstützungssysteme (EUS bzw. DSS).
11
Vgl. [Klein 1996a, S.39 ff.], [Mertens 2001, S.249 f.], [Gaugler 2000, S.55 ff.] und [Raupp 2003, S.170
ff.].
12
Vgl. [Klein 1996 S.39].
6
stützten Informationssystemen als Basis des Verbundes und (3.) der Austausch bzw.
die gemeinsame Verwendung von Daten und Informationen als Ziel des Verbundes.
13
Unter Informatiksystem werden sowohl wissenschaftliche als auch ökonomische Orga-
nisationen zusammengefasst, die an der Produktion von Informationstechnik beteiligt
sind und die im Sinne der Systemtheorie als Systeme betrachtet werden können.
14
Eine systemtheoretische Orientierung ermöglicht es, Wechselwirkungen und Rück-
kopplungen zwischen zwei Systemen plausibel zu beschreiben.
15
Informatiksysteme
sind entstehungsgeschichtlich im akademischen Raum zu verorten, konkret in Form
entsprechender Institutionen (insb. Hochschulen, Forschungsinstitute und andere Aus-
bildungseinrichtungen), z.T. sehr jungen Teildisziplinen (wie die Bio- oder die Medien-
informatik) und Verbänden (so etwa im deutschsprachigen Raum die Gesellschaft für
Informatik). Informatiksysteme spielen jedoch auch im wirtschaftlichen Raum eine
wichtige Rolle und werden dort repräsentiert durch Software-Unternehmen, durch IT-
Abteilungen in Organisationen, durch Wirtschaftsverbände und gewerkschaftlich orga-
nisierte Gruppen. Informatiksysteme und Organisationen sind aufeinander bezogen,
sobald die informationstechnische Infrastruktur in den Organisationen berührt wird.
Diese Infrastruktur verändert Strukturen und Abläufe einer Organisation, indem sie ihre
interne und externe Kommunikation regelt; sie erlangt somit soziale Bedeutung.
2.1.3
Definition und konstituierende Merkmale von Netzwerk-
organisationen
In der netzwerkspezifischen Literatur hat sich bisher keine eindeutige Definition des
Begriffs Netzwerkorganisationen etabliert, was sich insbesondere in der großen Anzahl
unterschiedlicher Typologisierungsversuche widerspiegelt.
16
Das Ziel dieser Arbeit ist
es nicht, einen Überblick über sämtliche Definitionen zu geben oder gar das Spektrum
um zusätzliche Begrifflichkeiten zu erweitern; im Folgenden wird daher lediglich eine
zusammenfassende Darstellung der konstituierenden Merkmale von Netzwerkorgani-
sationen angestrebt.
Netzwerkorganisationen können als besondere Ausprägung sozialer Netzwerke be-
schrieben werden und stellen eine bestimmte Art der Verbindung zwischen definierten
Sets von Akteuren dar. Den weiteren Ausführungen dieser Arbeit wird die Definition
nach S
YDOW
zugrunde gelegt:
13
Vgl. [Klein 1996 S.39 f.], [Raupp 2003, S.174 f.] und [Gaugler 2000, S.56 ff.].
14
Definition nach dem Institut für Angewandte und Sozialorientierte Informatik der Universität Ham-
burg.
15
Vgl. [Rolf 2002c, S.39].
16
Eine umfassende vergleichende Übersicht über unterschiedliche Begriffe und Konzepte zur Beschrei-
bung von Netzwerkorganisationen findet sich in [Sydow 1992a, S.61-70]. Auflistungen möglicher De-
finitionen von Netzwerkorganisationen findet sich bspw. in [Winkler 1999, S.26 f.] und [Klein 1996b,
S.88 ff.].
7
,,E
INE
N
ETZWERKORGANISATION STELLT EINE AUF DIE
R
EALISIERUNG VON
W
ETTBEWERBSVORTEILEN
ZIELENDE
,
POLYZENTRISCHE
,
OFTMALS JEDOCH VON EINER ODER VON MEHREREN
U
NTERNEHMUNGEN
STRATEGISCH GEFÜHRTE
O
RGANISATIONSFORM ÖKONOMISCHER
A
KTIVITÄTEN DAR
,
DIE SICH DURCH
KOMPLEX
-
REZIPROKE
,
EHER KOOPERATIVE DENN KOMPETITIVE UND RELATIV STABILE
B
EZIEHUNGEN
ZWISCHEN RECHTLICH SELBSTÄNDIGEN
,
WIRTSCHAFTLICH JEDOCH ZUMEIST ABHÄNGIGEN
U
NTERNEH-
MUNGEN AUSZEICHNET
.
E
IN DERARTIGES
N
ETZWERK
,
DAS ENTWEDER IN EINER ODER IN MEHREREN
MITEINANDER VERFLOCHTENEN
B
RANCHEN AGIERT
,
IST DAS
E
RGEBNIS EINER
U
NTERNEHMENSGREN-
ZEN ÜBERGREIFENDEN
D
IFFERENZIERUNG UND
I
NTEGRATION ÖKONOMISCHER
A
KTIVITÄTEN
."
17
Hinsichtlich der Entstehung solcher Organisationsstrukturen können idealtypisch zwei
Bewegungsrichtungen aufgezeigt werden.
18
Zum einen bieten Netzwerkorganisationen
eine Alternative zur hierarchischen Integration, wenn eine rein marktliche Koordination
den organisatorischen Anforderungen nicht genügt.
19
Zum anderen können, im Zuge
einer Konzentration auf Kernkompetenzen, Geschäftbereiche aus bestehenden Unter-
nehmen (quasi-) ausgegliedert werden, so dass eine ,,Substitution inter-hierarchischer
Strukturen durch eine Netzwerkorganisation"
20
erfolgt.
21
In Anlehnung an die oben dargestellte Definition von Netzwerkorganisationen werden
ihre zentralen Merkmale im Folgenden genauer erläutert. Dabei wird in drei Schritten
untersucht, wer die Akteure eines solchen Netzwerkes sind, wie sie miteinander inter-
agieren und warum sie diese Form der Zusammenarbeit gewählt haben:
Akteure in Netzwerkorganisationen sind rechtlich selbständige, wirtschaftlich je-
doch in gewisser Weise voneinander abhängige Unternehmen bzw. Geschäfts-
einheiten. Dabei sind Kooperationen mit Unternehmen aus der gleichen oder aus
anderen Branchen möglich.
22
Hierbei ist im Falle von Netzwerkorganisationen
nicht mehr nur das einzelne Unternehmen Gegenstand des Organisierens, son-
dern zunehmend das umfassendere Netzwerk. Dieses erfordert nicht nur ein
,,thinking in networks" seitens des Managements, sondern auch das Umsetzen in
konkrete Praktiken.
23
Die Beziehungen zwischen den Akteuren sind relativ stabil und geprägt von einer
komplexen Interdependenz, bei der sowohl kooperative als auch kompetitive E-
lemente die Zusammenarbeit prägen. Sie überschreiten nicht nur die Grenzen
17
[Sydow 1992a, S.79]. Unter Polyzentrismus wird eine Verteilung von Entscheidungskompetenzen auf
verschiedene Partialsysteme verstanden; vgl. [Winkler 1999, S.40].
18
Vgl. [Sydow 1995,, S.160], [Sydow 1992a, S.12] und [Vier 1996, S.111].
19
Vgl. [Sydow 1995, S.160]. Gerade kapitalschwachen kleinen und mittleren Unternehmen wird über
interorganisationale Netzwerke der Zugang zu fehlenden Kompetenzen und Kapazitäten ermöglicht;
vgl. [Reiss 1999, S.5].
20
[Sydow 1995,, S.160].
21
Der Begriff (Quasi-) Ausgliederung bzw. Externalisierung verdeutlicht dabei, dass keine rein marktli-
che Koordination ökonomischer Aktivitäten, sondern zusätzlich eine Aufrechterhaltung der wirtschaft-
lichen Beziehungen angestrebt wird; vgl. [Vier 1996, S.111].
22
Netzwerke können grundsätzlich auf horizontale, vertikale und diagonale Kooperation ausgerichtet
sein; vgl. [Sydow/Windeler 1999, S.16]. [Winkler 1999, S.25] folgt dieser Meinung nicht sondern sieht
vertikale Kooperation als konstituierendes Merkmal eines Unternehmensnetzwerkes. Die unterschied-
lichen Formen der Kooperation werden in Teilabschnitt 4.4.4 dieser Arbeit dargestellt.
23
Vgl. [Sydow 2001, S.278].
8
einzelner Unternehmen, sondern sind derart organisiert, dass sie organisationsin-
ternen Beziehungen ähneln. Allerdings differieren die Qualität der Beziehungen,
die Intensität der Kopplung, die Offenheit der Kommunikation und das Niveau des
Vertrauens.
24
So ist es denkbar, dass sich die Beziehungsintensität evolutionär
ändert, um sich der jeweiligen Marktsituation flexibel anzupassen.
25
Allgemein
kann von einem Koordinationskonzept gesprochen werden, bei dem die Verknüp-
fungen über strukturierte Beziehungen loser als in einer idealtypischen Hierar-
chie, jedoch fester als in einem idealtypischen Markt gekoppelt sind.
26
Netzwerkorganisationen basieren auf einer Austauschlogik, die sich durch eine
gewisse Gemeinsamkeit, zumindest durch eine Kompatibilität von Interessen
auszeichnet. Von den Unternehmen ist eine win/win-Situation anzustreben, die
sich gegenüber dem Markt durch eine stärkere Langfristorientierung und Kohä-
renz und gegenüber der Hierarchie durch eine stärkere Ausprägung von Flexibili-
tät und Responsivität auszeichnet.
27
In der Praxis variieren die zur Charakterisierung von Netzwerkorganisationen darge-
stellten Merkmale in ihrer Ausprägung stark. Dies erklärt die Vielfalt an Typologisie-
rungsansätzen für die verschiedenen Ausprägungen von Netzwerkformen. Tabelle 2-1
gibt einen Überblick über mögliche Unterscheidungen interorganisationaler Netzwerke:
24
Vgl. [Rolf 2002d, S.16].
25
Vgl. [Fischer 1995, S.49].
26
Vgl. [Rolf 2002d, S.16].
27
Vgl. [Picot et al. 2001, S.6 f.], [Sydow 1992a, S.78 ff.] und [Kappelhoff 1999, S.25 f.].
9
Netzwerktypen
Bestimmung über bzw. Synonyme
industrielle Netzwerke - Dienstleistungsnetzwerke
Sektorenzugehörigkeit der meisten Netzwerkunter-
nehmungen
Unternehmungsnetzwerke Netzwerke von Non
Profit-Organisationen
business networks non business networks;
gemischt in ,,public private partnerships"
konzerninterne konzernübergreifende Netzwerke
Konzernzugehörigkeit der meisten Netzwerkunter-
nehmungen
strategische regionale Netzwerke
Art der Führung und weitere Merkmale (s.u.), stra-
tegic networks small firm networks
lokale globale Netzwerke
räumliche Ausdehnung des Netzwerks
einfache komplexe Netzwerke
Zahl der Netzwerkakteure, Dichte des Netzwerks;
Komplexitätsgrad des Beziehungsgeflechts
vertikale horizontale Netzwerke
Stellung der Unternehmungen in der Wertschöp-
fungskette
obligationale promotionale Netzwerke
Netzwerkzweck im Sinne eines Leistungsaustau-
sches bzw. einer gemeinsamen Interessendurch-
setzung
legale illegale Netzwerke
Verstoß gegen bestehende Gesetze oder
Verordnungen (z.B. Kartelle)
freiwillige vorgeschriebene Netzwerke
gesetzlich vorgeschriebene Zusammenarbeit der
Unternehmungen
stabile dynamische Netzwerke
Stabilität der Mitgliedschaft bzw. der Netzwerkbe-
ziehungen
Marktnetzwerke Organisationsnetzwerke
Dominanz des Koordinationsmodus
hierarchische heterarchische Netzwerke
Steuerungsform nach Form der Führung
intern extern gesteuerte Netzwerke
Steuerungsform nach Ort (z.B. durch Drittparteien
bzw. Netzwerkmanagementorganisationen)
zentrierte dezentrierte Netzwerke
Grad der Polyzentrizität
bürokratische clan-artige Netzwerke
Form der organisatorischen Integration der Netz-
werkunternehmungen
Austauschnetzwerke Beteiligungsnetzwerke
Grund der Netzwerkmitgliedschaft
explorative exploitative Netzwerke
dominanter Zweck des Netzwerks
soziale ökonomische Netzwerke
dominanter Zweck der Netzwerkmitgliedschaft
formale informale Netzwerke
Formalität bzw. Sichtbarkeit des Netzwerks
offene geschlossene Netzwerke
Möglichkeit des Ein- bzw. Austritts aus dem
Netzwerk
geplante emergente Netzwerke
Art der Entstehung
Innovationsnetzwerke Routinenetzwerke
Netzwerkzweck in Hinblick auf Innovationsgrad
käufergesteuerte produzentengesteuerte Netz-
werke
,,Ort" der strategischen Führung
Beschaffungs-, Produktions-, Informations-, F&E-,
Marketing-, Recycling-Netzwerke u.ä.
betriebliche Funktionen, die im Netzwerk kooperativ
erfüllt werden
Tabelle 2-1: Typisierungsmöglichkeiten interorganisationaler Netzwerke
28
28
Quelle: [Sydow 1999, S.285].
10
2.1.4 Konzeptionelle Einordnung von Netzwerkorganisationen
Die Präzisierung der Eigenschaften von Netzwerkorganisationen erfolgt i.d.R. im Ver-
gleich zu Merkmalen von Hierarchie und Markt, wobei in der Literatur die folgenden
drei Positionen vertreten werden: (1.) Netzwerkorganisationen stellen eine Hybridform
zwischen Markt und Hierarchie dar, (2.) Netzwerkorganisationen stellen eine eigen-
ständige Organisationsform dar und (3.) Netzwerkorganisationen stellen eine dialekti-
sche Synthese der Charakteristika des Marktes und der Hierarchie dar.
29
Bevor auf
diese drei Positionen im Einzelnen eingegangen wird, erfolgt zunächst eine kurze Be-
stimmung der Begriffe Markt und Hierarchie.
In der institutionellen Ökonomie werden Markt und Hierarchie als reine Modelle alterna-
tiver Austauschkoordination verstanden, denen unterschiedliche Funktionsprinzipien
zugrunde liegen. Auf einem Markt tauschen beliebige, (begrenzt) rationale, opportunis-
tische und voneinander unabhängige Akteure exakt spezifizierte Leistungen aus, wobei
die Austauschkoordination ausschließlich über den Preismechanismus erfolgt.
30
In
Hierarchien hingegen erfolgt die Transaktionsabwicklung auf Grundlage expliziter An-
weisungen der Unternehmensleitung gegenüber einer begrenzten Anzahl an Akteuren.
Die Koordination durch Weisung ist auf den Austausch unspezifizierter Leistungen
ausgerichtet. Sie umfasst tendenziell längerfristige Beziehungen, denen i.d.R. unglei-
che Machtverteilungen zugrunde liegen und ersetzt idealtypisch jegliche Marktkoordi-
nation.
31
Netzwerkorganisationen als Hybridform zwischen Markt und Hierarchie
Ein zentraler Zweig der Organisationsforschung vertritt die Position, dass Netzwerkor-
ganisationen keine eigenständige, sondern eine intermediäre Organisationsform zwi-
schen Markt und Hierarchie darstellen. Hierzu zählen Ansätze, die auf der Neuen Insti-
tutionenökonomik aufbauen. W
ILLIAMSON
kommt bei einem Vergleich von Eigenschaf-
ten der Koordinationsformen zu dem Ergebnis, dass die Hybridform hinsichtlich sämtli-
cher Eigenschaften gegenüber Markt und Hierarchie eine mittlere Ausprägung auf-
weist.
32
29
Während [Sydow 1992a, S.101 ff.], [Semlinger 1993, S.322 ff.], [Kappelhoff 1999, S.28] und [Vogt
1997, S.77 ff.] die ersten beiden Positionen unterscheiden, bringt [Klein 1996a, S.91 ff.] die dritte Per-
spektive in die Diskussion ein.
30
Vgl. [Sydow 1992a, S.98], [Picot et al. 2001, S.25] und [Raupp 2003, S.16].
31
Vgl. [Sydow 1992a, S.98 f.], [Brunner 2000, S.50 f.] und [Picot et al. 2001, S.236 f.].
32
Vgl. [Williamson 1991, S.41 f.].
11
Koordinationsform
Attribut
Markt Hybrid
Hierarchie
Instrumente
Anreizintensität
++ + o
administrative
Kontrollmöglichkeiten
o + ++
Wirkungsdimensionen
autonome
Adaption
++ + o
kooperative beidseitige Adaption
o + ++
Vertragsbeziehungen
++ + o
o schwach
+ mittel
++ sehr stark
Tabelle 2-2: Vergleich von Koordinationsformen nach W
ILLIAMSON
33
S
YDOW
verdeutlicht den hybriden Charakter von Netzwerkorganisationen vor dem Hin-
tergrund eines breiten sozio-ökonomischen Bezugsrahmens. Markt und Hierarchie
bilden die Pole eines breiten Spektrums sozio-ökonomischer Institutionen. Im Vorder-
grund steht dabei das Verständnis von Netzwerkorganisationen als polyzentrische Sys-
teme, wobei diese Eigenschaft besonders auf die relative Autonomie der Netzwerkun-
ternehmen zurückzuführen ist.
34
Obwohl S
YDOW
Netzwerkorganisationen als interme-
diäre Organisationsform betrachtet, für die eine Kombination marktlicher und hierarchi-
scher Eigenschaften konstitutiv ist, steht er der institutionenökonomischen Markt-
Hierarchie-Polarisierung insofern besonders kritisch gegenüber, als in empirisch beob-
achtbaren Märkten und Hierarchien immer auch die Eigenschaften der jeweils anderen
Koordinationsform zu finden sind.
35
Netzwerkorganisationen als eigenständige Organisationsform
Eine zweite in der Literatur vertretene Position betrachtet Netzwerkorganisationen als
eigenständige - von Markt und Hierarchie zu differenzierende - Form wirtschaftlicher
Koordination. P
OWELL
beschreibt Netzwerkorganisationen als ,,a distinctive form of
coordinating economic activity"
36
und betrachtet sie als eigenständige Interaktionsmus-
ter, die sowohl hinsichtlich der Austauschmodalitäten als auch hinsichtlich ihrer sozia-
len Koordinationsmechanismen qualitativ von Markt und Hierarchie zu unterscheiden
sind.
37
Bei seinem Vergleich der drei Koordinationsformen identifiziert P
OWELL
das Re-
ziprozitätskriterium, einen effizienten Informationsaustausch und eine auf Vertrauen
33
Quelle: [Klein 1996a, S.90].
34
Vgl. [Sydow 1992a, S.82].
35
Vgl. [Sydow 1992a, S.102].
36
[Powell 1990, S.301 f.].
37
Vgl. [Powell 1990, S.302 f.].
12
basierende, tendenziell längerfristige kooperative Zusammenarbeit als spezifische Ei-
genschaften von Netzwerkorganisationen.
38
Netzwerkorganisationen als dialektische Synthese
K
LEIN
vertritt eine dritte Position, welche die Bildung von Netzwerkorganisationen als
gegensätzliche Synthese von Merkmalen des Marktes und der Hierarchie interpre-
tiert.
39
Mit der Betonung des strategischen Gehalts von Netzwerkorganisationen wird
hervorgehoben, dass ,,nicht einzelne Attribute im Vergleich oder in Kombination von
marktlichen und hierarchischen Attributen den spezifischen Charakter von Netzwerken
bestimmen. Vielmehr ist gerade die dialektische Kombination von Widersprüchen oder
die 'Organisation von Ambivalenz' [...] konstituierend für Netzwerke und die spezifische
Qualität der Netzwerkkoordination."
40
Beispiele für Widersprüche oder Paradoxien in-
nerhalb von Netzwerkorganisationen sind:
41
die Erweiterung und Einengung von Handlungsspielräumen;
die Kombination von Autonomie und Interdependenz, von Kooperation und Wett-
bewerb sowie von Konsens und Konflikt;
die Verbindung von Risiko und Vertrauen;
die Balancierung von Spezialisierung und Integration;
die Verbindung der Stabilität hierarchischer Beziehungen mit den wirkungsvollen
Anreizen marktlicher Koordination oder von Kooperation und Wettbewerb.
2.2 Grundlagen der Vernetzung von Organisationen
Die Märkte, auf denen Organisationen heute konkurrieren, und das Wettbewerbsum-
feld, in dem sie agieren, haben sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Die
Fähigkeit zur Vernetzung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Unternehmen,
um im Informationszeitalter Bestand zu haben und ist zentraler Bestandteil zukünftiger
Organisationsformen.
42
Gleichzeitig stellt sie große Herausforderungen an die Unter-
nehmen, da zahlreiche wirtschaftliche und informations- und kommunikationstechnolo-
gische Entwicklungen die physische Desintegration von Unternehmen und Märkten
vorantreiben und neue Aktionsmuster verlangen.
43
Die Verknüpfung von Unternehmen
zu Netzwerken ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen in der Ökonomie, Soziolo-
38
Vgl. [Powell 1990, S.303 ff.]. Für weitere Ansätze, die Netzwerkorganisationen als eigenständige Or-
ganisationsform verstehen, siehe [Semlinger 1993, S.322-353] für einen informationstheoretischen An-
satz, [Teubner 1992, S.204 ff.] für einen systemtheoretischen Netzwerkansatz sowie [Vogt 1997, S.77-
108], der auf der Basis des Transaktionskostenansatzes insgesamt sieben Koordinationstypen entwi-
ckelt.
39
Vgl. [Klein 1996a, S.91 ff.].
40
[Klein 1996a, S.92]; ohne Angabe der dort verwendeten Literaturquellen.
41
Vgl. nachfolgend [Klein 1996a, S.93].
42
Vgl. [Österle et al. 2000, S.2] und [Castells 2003, S.83 f.].
43
Vgl. [Fleisch 2000, S.1].
13
gie und Informatik.
44
Die Untersuchungen beschreiben Netzwerkphänomene und bie-
ten i.d.R. sehr abstrakte Ansätze zur Klassifikation und Gestaltung von Netzwerken.
45
2.2.1 Wirtschaftliche Treiber der Vernetzung
Globalisierung
46
und Dynamisierung der Wettbewerbsmärkte, basierend auf der Nut-
zung neuer Kommunikationsnetze sowie einer Vielzahl politischer Veränderungen,
verschaffen Unternehmen weltweiten Zugang zu Märkten, die in der Vergangenheit nur
schwer erreichbar waren, und verringern die Wettbewerbsvorteile von regionalen An-
bietern. Ausgangspunkt der Globalisierung sind alle Technologien, die zur Reduktion
von Transportkosten von Gütern und Leistungen beitragen.
47
Globaler Technologiever-
gleich und -transfer sind Folgen der Globalisierung und erschweren den Aufbau tech-
nologischer Barrieren zunehmend. Der Eintritt neuer Wettbewerber in regionale Märkte
reduziert Gewinnspannen und führt in letzter Konsequenz zu radikalen unternehmeri-
schen Reaktionen wie Standortverlagerung, Konzentration auf Kernkompetenzen oder
Outsourcing. Dabei werden regionale Rahmenbedingungen und Gesetzgebung zu
maßgeblichen Kriterien für die Überlebensfähigkeit regionaler Unternehmen.
48
Weder Technologie noch Wirtschaft wären jedoch allein in der Lage gewesen, eine
globale Wirtschaft zu entwickeln.
49
Erst in Verbindung mit der Privatisierung öffentlicher
Unternehmen, der staatlichen Deregulierung der Binnenmarktaktivitäten und der Libe-
ralisierung des internationalen Handels wird die Markteintrittsbarriere ,,geografische
Grenze" abgebaut.
50
Die Dynamisierung der Wettbewerbsmärkte, die durch tendenziell kürzere Produktle-
benszyklen deutlich wird, zwingt Unternehmen dazu, Innovationsprozesse zu be-
schleunigen und macht den Faktor Zeit zu einer kritischen Erfolgsgröße.
51
In diesem
Kontext gelingt es den Unternehmen oftmals nicht mehr, rechtzeitig das erforderliche
Know-How aufzubauen. Die Zeit erweist sich auch in Bezug auf den Aufbau von Wis-
44
Vgl. bspw. [Klein 1996a, S.14 ff.] und [Sydow 1992a, S.15 ff.].
45
Zur Relevanz von Netzwerken formuliert beispielsweise K
ELLY
: ,,Networks have existed in every eco-
nomy. What's different now is that networks, enhanced and multiplied by technology, penetrate our
lives so deeply that `network' has become a central metaphor around which our thinking and our econ-
omy are organized"; [Kelly 1999, S.2].
46
Nach F
LEISCH
bezeichnet ,,Globalisierung" im Sinne einer physischen Desintegration das Phänomen
der sich ausbreitenden geographischen Reichweite betrieblicher Koordinationsformen wie Hierarchie,
Netzwerk und Markt; vgl. [Fleisch 2000, S.21]. Zur Globalisierung aus organisationstheoretischer und
sozialwissenschaftlicher Sicht siehe [Brunner 2000, S.129 ff.].
47
Vgl. [Brunner 2000, S.114 ff.] und [Fleisch 2000, S.22].
48
Vgl. [Fleisch 2000, S.21 f.].
49
So verweist P
OWELL
in seiner Analyse der Netzwerkorganisation auf die historische Entwicklung wirt-
schaftlicher Koordinationsformen aus einem engen Beziehungsgeflecht politischer, religiöser und sozi-
aler Beziehungen; vgl. [Powell 1990, S.298].
50
Zu den politischen Veränderungen zählen bspw. die Schaffung von Freihandelszonen wie die Liberali-
sierung des Handels innerhalb der EU oder der NAFTA (North American Free Trade Association).
Darüber hinaus erfolgte eine Liberalisierungswelle in einigen Entwicklungsländern sowie die Privati-
sierung und Deregulierung bedeutender Volkswirtschaften, wie beispielsweise in den ehemaligen Ost-
blockländern. Vgl. ausführlich [Brunner 2000, S.121 ff.] und [Castells 2003, S.146].
51
Vgl. [Bullinger et al. 1995b, S.376], [Klein 1996a, S.18 f.] und [Müller/Kliemecki 1997, S.10 f.].
14
sen als limitierender Faktor und veranlasst Unternehmen dazu, Kooperationen einzu-
gehen.
52
Im letzten Jahrzehnt ist ein zunehmender Wandel von Anbieter- zu Käufermärkten auf
den Produkt- und Dienstleistungsmärkten zu beobachten.
53
Auf einem Käufermarkt
wird nicht mehr für einen anonymen Massenmarkt produziert, sondern für Einzelkun-
den mit individuellen Produkt-, Liefer- und Qualitätsanforderungen.
54
Der Kunde fragt
i.d.R. nicht mehr nur nach einem einzelnen Produkt, sondern nach einer Leistung, die
ihn in seinem Customer Resource Life Cycle (CRLC) unterstützt. Der CRLC beschreibt
jene Abfolge von Aufgaben, für die der Kunde die Leistungen des Anbieters benötigt.
55
Aus diesem veränderten Nachfrageverhalten folgt, dass standardisierte und formali-
sierte Arbeitsabläufe, wie sie der Taylorismus hervorgebracht hat, den Anforderungen
der Kunden nicht mehr gerecht werden. Die Unternehmen müssen auf ihre individuel-
len Bedürfnisse eingehen und sind dadurch nicht mehr in der Lage, ihren Leistungser-
stellungsprozess im Voraus bis ins Detail zu planen. Diese erhöhte Serviceorientierung
seitens der Anbieter erzeugt zusätzliche Komplexität, die ohne zusätzliche Anstren-
gungen, wie bspw. ein Customer-Relationship-Management (CRM), kaum noch zu
bewältigen ist.
56
Eine Abgrenzung zu Konkurrenten auf Grund rein fertigungstechni-
scher Vorteile wird zunehmend schwieriger. Stattdessen wird die Nähe zum Markt, d.h.
schnell und flexibel auf Kundenwünsche einzugehen, zum strategischen Wettbewerbs-
vorteil.
57
Die Notwendigkeit organisationaler Veränderung wird schließlich von einem tief grei-
fenden Wertewandel in Arbeit und Gesellschaft überlagert.
58
In der Arbeitswelt drückt
sich dieser Wandel in zunehmender Ablehnung von Unterordnung, Verpflichtung und
reiner Arbeitsausführung, ohne eigenen Handlungsspielraum aus. Werte wie Eigenver-
antwortung, Selbständigkeit, Individualität und Selbstverwirklichung gewinnen stattdes-
sen zunehmend an Bedeutung.
59
2.2.2 Informationstechnische Treiber der Vernetzung
Während Märkte und Wettbewerber immer enger zusammen rücken, wird die Rolle der
Information zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.
60
Die Qualität der Aufgaben-
erfüllung ist dabei wesentlich von der Qualität und Aktualität der verarbeiteten Informa-
52
Vgl. [Ott 1996, S.15].
53
Vgl. [Picot et al. 2001, S.3 f.].
54
Vgl. [Bullinger et al. 1995a, S.18].
55
Eine ausführliche Darstellung des CRLC-Konzeptes findet sich bei [Österle 1995, S.155 ff.] und
[Dichtl 1991, S.149 ff.].
56
Vgl. [Österle 1995, S.156 f.] und [Fleisch 2000, S.21].
57
Vgl. [Picot/Reichwald 1994, S.549].
58
Vgl. [Picot et al. 2001, S.4] und [Rolf 1998, S.26 ff.].
59
Vgl. [Steinmann/Schreyögg 2000, S.423 ff.] und [Picot et al. 2001, S.4].
60
Vgl. [Castells 2003, S.83 f.].
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832476441
- ISBN (Paperback)
- 9783838676449
- DOI
- 10.3239/9783832476441
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hamburg – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- management unternehmensnetzwerke informations- kommunikationstechnologie organisationstheorien gestaltungsansatz
- Produktsicherheit
- Diplom.de