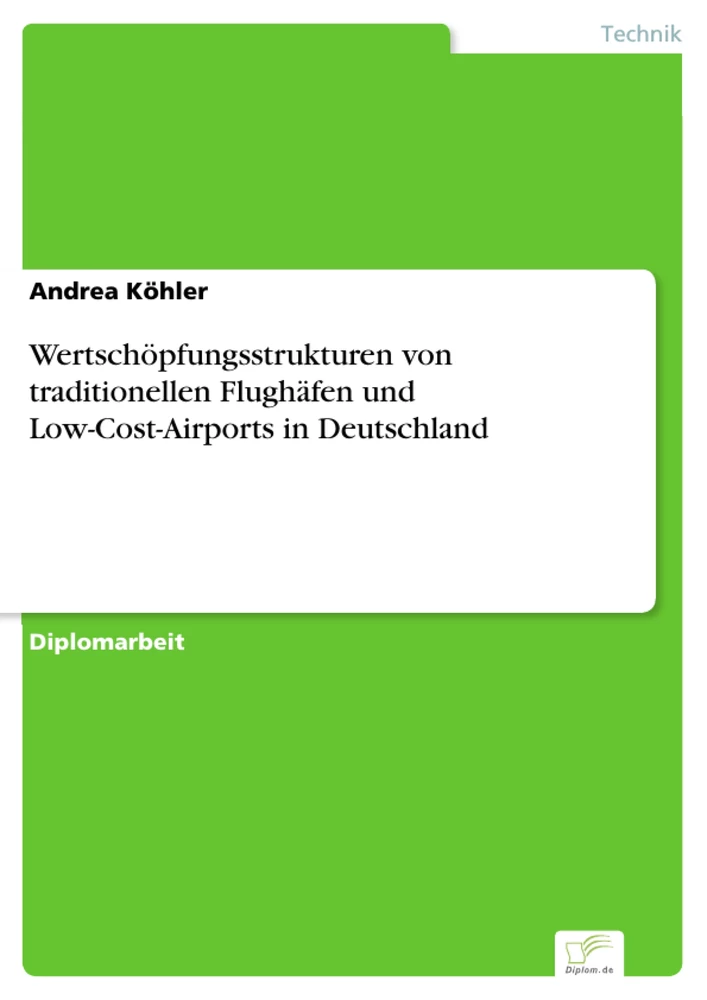Wertschöpfungsstrukturen von traditionellen Flughäfen und Low-Cost-Airports in Deutschland
Zusammenfassung
Die deutsche Flughafenbranche befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Bedingt durch veränderte wirtschaftliche, gesellschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen im internationalen Luftverkehr, werden hohe Anforderungen an Flughäfen gestellt, die als Schnittstelle zwischen Luft- und Landtransport dienen. Flughäfen müssen sich aufgrund des steigenden Wettbewerbs- und Rentabilitätsdrucks von reinen Infrastrukturanbietern zu modernen, privatisierten Dienstleistungsunternehmen wandeln. Die deutsche Flughafenbranche ist noch sehr stark durch öffentliche Gesellschafterstrukturen gekennzeichnet, die meist mit staatlichen Subventionen an Flughäfen einhergehen.
Gang der Untersuchung:
Diese Arbeit untersucht die Wertschöpfungsstrukturen von Flughäfen in Deutschland. Anhand der Wertkette von Porter wird das Geschäftsmodell eines traditionellen Flughafens betrachtet und dessen Kosten- und Erlösstruktur untersucht. Dieses Geschäftsmodell wird unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung und vor allem im Hinblick auf zunehmende Kooperationen und Beteiligungen zum Geschäftsmodell einer Global Airport Company weiterentwickelt.
Im Anschluss daran wird die Reaktion der Flughäfen auf den Markteintritt der Low-Cost-Carrier betrachtet. Es werden vier Typen von Flughäfen entwickelt, die das schwierige Verhältnis zwischen Flughäfen und Low-Cost-Airlines in Deutschland widerspiegeln. Als Idealfall ergibt sich das Geschäftsmodell eines Low-Cost-Airports. Dieser wird durch eine Differenzierung der Wertschöpfungsstufen auf seine Profitabilität untersucht. Die Gewinne eines Low-Cost-Airports werden demnach fast ausschließlich aus dem Non-Aviation-Bereich generiert. Ob es Low-Cost-Airports in Deutschland gibt und ob diese eine Zukunft haben, ist fraglich. Sie könnten als Entlastungsflughäfen für Großflughäfen dienen und/oder im Netzwerk einer Global Airport Company den Geschäftsbereich Low-Cost abdecken.
Die Arbeit gelangt zu dem Ergebnis, dass Flughäfen und Fluggesellschaften in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten müssen, um profitabel wirtschaften zu können. Flughäfen müssen flexiblere Gebührenstrukturen und eine schlankere Abfertigung anbieten, die den Anforderungen der (Low-Cost-)Airlines entsprechen. Dies ist nur durch eine entsprechende Symbiose und ein offenes Entgegenkommen beider Seiten […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Anhangsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einführung in die Thematik und Aufbau der Arbeit
2 Grundlegende Definitionen
2.1 Definition und Einteilung von Flughäfen
2.1.1 Juristische Einteilungskriterien
2.1.2 Funktionale Einteilungskriterien
2.1.3 Übersicht und Zuordnung deutscher Flughäfen
2.2 Klassische Geschäftsbereiche von Flughäfen
2.2.1 Aviation
2.2.2 Groundhandling
2.2.3 Non-Aviation
2.3 Flughafenentgelte und -gebühren
3 Entwicklung der Luftverkehrsbranche: Airports & Airlines
3.1 Neuregelungen des europäischen Luftverkehrs
3.1.1 Liberalisierung der Flugmärkte
3.1.2 Deregulierung der Bodenverkehrsdienste
3.2 Aktuelle Entwicklung und Problematik des deutschen Flugmarktes
3.2.1 Veränderungen im Passagier- und Frachtaufkommen
3.2.2 Die Low-Cost-Revolution
3.2.3 Privatisierung von Flughäfen
3.3 Subventionierung von Flughäfen
3.3.1 Möglichkeiten der Subventionierung
3.3.2 Quersubventionierung von Low-Cost-Airlines durch die Flughäfen in Deutschland?
3.3.3 Trend und zukünftige Entwicklung der Subventionierung in Deutschland
3.4 Konsequenzen dieser Entwicklung für die Flughäfen
4 Zum Verständnis des Begriffs Geschäftsmodell – State of the Art
4.1 Unterschiedliche Definitionen in der gängigen Literatur
4.2 Kombination verschiedener Ansätze von Bieger
5 Geschäftsmodell eines traditionellen Flughafens unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation
5.1 Wertschöpfungskette
5.1.1 Traditionelle Wertkette
5.1.2 Weiterentwicklung der traditionellen Wertkette
5.2 Kosten- und Erlösstruktur
5.2.1 Kostenstruktur
5.2.2 Erlösstruktur
5.3 Gegensätzliche Trends: Spezialisierung versus Kooperation
5.3.1 Spezialisierung und Auslagerung einzelner Bereiche
5.3.2 Kooperationen und Beteiligungen
5.3.3 Spezialfall: „Global Airport Company”
6 Strategische Ausrichtung und Reaktion der Flughäfen im Hinblick auf den Markteintritt der Low-Cost-Carrier
6.1 Schwieriges Verhältnis: Low-Cost-Carrier und Flughäfen
6.1.1 Low-Cost-Carrier aus Sicht der Flughäfen
6.1.2 Erwartungen der Low-Cost-Carrier von Flughäfen
6.2 Unterschiedliche Reaktion der Flughäfen: Entwicklung von Flughafen-Typen
6.2.1 „Die großen Traditionellen“
6.2.2 „Die Partizipanten“
6.2.3 „Die abhängigen Billigen“
6.2.4 „Die kleinen Möchtegerne“
6.2.5 Zukünftige Entwicklungsperspektiven
6.3 Idealfall: Low-Cost-Airport
6.3.1 Merkmale
6.3.2 Differenzierung der Wertschöpfungsstufen und Profitabilität
6.3.3 Low-Cost-Airports in Deutschland?
7 Zukünftige Entwicklung der Flughafenbranche und Vergleich der Geschäftsmodelle
8 Fazit
Anhang A – Allgemeiner Anhang
Anhang B – Expertengespräche
Literatur- und Quellenverzeichnis
Erklärung
Abstract
Die deutsche Flughafenbranche befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Bedingt durch veränderte wirtschaftliche, gesellschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen im internationalen Luftverkehr, werden hohe Anforderungen an Flughäfen gestellt, die als Schnittstelle zwischen Luft- und Landtransport dienen. Flughäfen müssen sich aufgrund des steigenden Wettbewerbs- und Rentabilitätsdrucks von reinen Infrastrukturanbietern zu modernen, privatisierten Dienstleistungsunternehmen wandeln. Die deutsche Flughafenbranche ist noch sehr stark durch öffentliche Gesellschafterstrukturen gekennzeichnet, die meist mit staatlichen Subventionen an Flughäfen einhergehen.
Diese Arbeit untersucht die Wertschöpfungsstrukturen von Flughäfen in Deutschland. Anhand der Wertkette von Porter wird das Geschäftsmodell eines „traditionellen Flughafens“ betrachtet und dessen Kosten- und Erlösstruktur untersucht. Dieses Geschäftsmodell wird unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung und vor allem im Hinblick auf zunehmende Kooperationen und Beteiligungen zum Geschäftsmodell einer „Global Airport Company“ weiterentwickelt.
Im Anschluss daran wird die Reaktion der Flughäfen auf den Markteintritt der Low-Cost-Carrier betrachtet. Es werden vier Typen von Flughäfen entwickelt, die das schwierige Verhältnis zwischen Flughäfen und Low-Cost-Airlines in Deutschland widerspiegeln. Als Idealfall ergibt sich das Geschäftsmodell eines „Low-Cost-Airports“. Dieser wird durch eine Differenzierung der Wertschöpfungsstufen auf seine Profitabilität untersucht. Die Gewinne eines Low-Cost-Airports werden demnach fast ausschließlich aus dem Non-Aviation-Bereich generiert. Ob es Low-Cost-Airports in Deutschland gibt und ob diese eine Zukunft haben, ist fraglich. Sie könnten als Entlastungsflughäfen für Großflughäfen dienen und/oder im Netzwerk einer Global Airport Company den Geschäftsbereich Low-Cost abdecken.
Die Arbeit gelangt zu dem Ergebnis, dass Flughäfen und Fluggesellschaften in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten müssen, um profitabel wirtschaften zu können. Flughäfen müssen flexiblere Gebührenstrukturen und eine schlankere Abfertigung anbieten, die den Anforderungen der (Low-Cost-)Airlines entsprechen. Dies ist nur durch eine entsprechende Symbiose und ein offenes Entgegenkommen beider Seiten möglich.
Danksagung
Hiermit möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Walter Schertler bedanken, der mir die Ausarbeitung dieser äußert interessanten Thematik ermöglichte und meine Arbeit bis zum Schluss betreute.
Mein besonderer Dank gilt Herrn Klaus D. Hartmann (Geschäftsführer, Flughafen Hof-Plauen GmbH), Herrn Lutz Honerla (Leiter Aviation Marketing, Flughafen Düsseldorf GmbH), Herrn Jörg im Wolde (Leiter Vertrieb, Flughafen Stuttgart GmbH), Herrn Manfred Jung (Geschäftsführer, Baden-Airpark GmbH), Herrn Jörgen Kearsley (Aviation Marketing, Flughafen Hamburg GmbH), Frau Brigitte Kunz (Leitung PR, Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH), Herrn Eberhard Müller (Geschäftsführer, Augsburger Flughafen GmbH), Herrn Roger Niermann (Leiter Marketing und Vertrieb, Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH), Herrn Walter Römer (Pressesprecher, Flughafen Köln/Bonn GmbH), Herrn Wolfram Schlegel (Geschäftsführer, Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH), Herrn Walter Schnitzler (Referent Controlling, Flughafen München GmbH), Herrn Thomas Thielmann (Kaufmännischer Leiter, Flughafen Niederrhein GmbH) und Herrn Stefano Wulf (Bereichsleiter Finanzen, Fraport AG), die sich die Zeit für Expertengespräche genommen und wesentlich zum Gelingen meiner Arbeit beigetragen haben. Mein Dank gilt zudem Herrn Daniel Wieland (Mercer Management Consulting) für das aufschlussreiche Telefonat im Vorfeld der Expertengespräche.
Herrn Felix Meyers möchte ich für die vielen anregenden Diskussionen danken, die meine Arbeit wesentlich bereichert haben. Meinen Eltern danke ich für die liebevolle Unterstützung während meiner gesamten Studienzeit.
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Beziehungen zwischen Flughäfen, Fluggesellschaften und Passagieren
Abb. 2: Juristische und funktionale Einteilungskriterien von Flughäfen
Abb. 3: Veränderung und Prognose der Passagier-Wachstumsraten in Deutschland
Abb. 4: Veränderung der Fracht-Wachstumsraten in Deutschland
Abb. 5: Entwicklung ausgewählter Low-Cost-Airlines in Europa
Abb. 6: Äußere Einflüsse auf das Flughafenmanagement
Abb. 7: Wertkette eines „traditionellen Flughafens“
Abb. 8: Veränderung der traditionellen Flughafen-Wertkette
Abb. 9: Durchschnittliche Kostenstruktur europäischer Flughäfen
Abb. 10: Durchschnittliche Erlösstruktur westeuropäischer Flughäfen
Abb. 11: Systematisierung der Erlösquellen
Abb. 12: Verschiedene Möglichkeiten der Kooperation
Abb. 13: Flughafen-Typen in Deutschland im Hinblick auf Low-Cost-Carrier als Kunden
Abb. 14: Entwicklungsperspektiven der Flughafen-Typen
Abb. 15: Differenzierung und Profitabilität der Wertschöpfungsstufen eines Low-Cost-Airports
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Arten der Subventionierung von Flughäfen in Deutschland
Tab. 2: Vergleich der verschiedenen Geschäftsmodelle eines „traditionellen Flughafens“, einer „Global Airport Company“ und eines „Low-Cost-Airports“
Anhangsverzeichnis
Anhang A – Allgemeiner Anhang
Anhang A1: Räumliche Verteilung der internationalen Verkehrsflughäfen und der aufkommensstärksten Regionalflughäfen in Deutschland
Anhang A2: Übersicht über Luftsicherheitsgebühren, Passagier- und Landeentgelte an ausgewählten deutschen Flughäfen
Anhang A3: Deregulierungsphasen in den
Anhang A4: Etappen der Liberalisierung des Luftverkehrs in derEU
Anhang A5: Die Freiheiten der Luft
Anhang A6: Geschäftsmodell von Southwest Airlines (USA)
Anhang A7: Eigentumsstruktur ausgewählter deutscher Flughäfen
Anhang A8: Finanzielle Unterstützung ausgewählter Flughäfen in Rheinland-Pfalz
Anhang A9: Marketingzuschüsse und Regelung der Flughafengebühren im Vertrag von Ryanair am Flughafen Straßburg-Enzheim
Anhang A10: Modell einer Wertkette nach Porter
Anhang A11: Kundensegmentierung und Anforderungen der Kundengruppen an einen Flughafen
Anhang A12: Anteil der Non-Aviation-Erlöse an den Gesamterlösen ausgewählter deutscher Flughäfen
Anhang A13: Entwicklung der Kooperationen und Beteiligungen an deutschen Verkehrsflughäfen (Auswahl)
Anhang B – Expertengespräche
Anhang B1: Expertengespräch mit Herrn Klaus D. Hartmann , Geschäftsführer, Flughafen Hof-Plauen GmbH, am 18.09.2003
Anhang B2: Expertengespräch mit Herrn Lutz Honerla , Leiter Aviation Marketing, Flughafen Düsseldorf GmbH, am 22.09.2003
Anhang B3: Expertengespräch mit Herrn Jörg im Wolde , Leiter Vertrieb, Flughafen Stuttgart GmbH, am 19.09.2003
Anhang B4: Expertengespräch mit Herrn Manfred Jung , Geschäftsführer, Baden-Airpark GmbH, am 22.09.2003
Anhang B5: Expertengespräch mit Herrn Jörgen Kearsley , Aviation Marketing, Flughafen Hamburg GmbH, am 17.09.2003
Anhang B6: Expertenbefragung von Frau Brigitte Kunz , Leitung PR, Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH
Anhang B7: Expertengespräch mit Herrn Eberhard Müller , Geschäftsführer, Augsburger Flughafen GmbH, am 24.09.2003
Anhang B8: Expertengespräch mit Herrn Roger Niermann , Leiter Marketing und Vertrieb, Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, am 24.09.2003
Anhang B9: Expertengespräch mit Herrn Walter Römer , Pressesprecher, Flughafen Köln/Bonn GmbH, am 06.10.2003
Anhang B10: Expertengespräch mit Herrn Wolfram Schlegel , Geschäftsführer, Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH, am 01.10.2003
Anhang B11: Expertengespräch mit Herrn Walter Schnitzler , Referent Controlling, Flughafen München GmbH, am 25.09.2003
Anhang B12: Expertengespräch mit Herrn Thomas Thielmann , Kaufmännischer Leiter, Flughafen Niederrhein GmbH, am 29.09.2003
Anhang B13: Expertengespräch mit Herrn Stefano Wulf ,Bereichsleiter Finanzen, Fraport AG, am 10.10.2003
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einführung in die Thematik und Aufbau der Arbeit
„During the last twenty-five years the airport industry has been transformed from being a branch of government into a dynamic and commercially oriented business. The change has come about as the close ties between governments and airports have been progressively loosened. […] As the pressure to become commercially oriented grew, so it became increasingly apparent that little was known about airport economics or the airport business.”[1]
Aufgrund der Deregulierung und Liberalisierung des Luftverkehrs, zuerst in Amerika und einige Jahre später auch in Europa, hat sich für die Luftverkehrsbranche vieles verändert. Die Konkurrenz stieg und der Wettbewerb wurde angekurbelt. Es drangen neue Fluggesellschaften, sogenannte Low-Cost-, No-Frills- oder Low-Fare-Carrier[2], die extrem billige Flugtickets anbieten, in die ehemals so übersichtlichen und stark regulierten Märkte ein. Diese Marktdynamik hält bis heute an.
Aber auch die Flughäfen sind von dieser Entwicklung betroffen. In der heutigen kommerzialisierten, deregulierten und krisenbehafteten Flughafen-Umwelt werden Einnahmen aus dem Non-Aviation-Bereich immer wichtiger. Deswegen müssen Flughäfen auch die Passagiere, die ihnen die Fluggesellschaften bringen, mehr und mehr als Kunden sehen, da sie Einnahmen im Non-Aviation-Bereich erzeugen.[3]
Low-Cost-Carrier setzen die Flughäfen immer mehr unter Druck und erwarten, neben extrem niedrigen Flughafenentgelten, auch Marketing-Zuschüsse. Werden ihnen diese nicht gewährt, drohen sie damit, einen anderen Flughafen anzufliegen. Das traditionelle Airline-Airport-Verhältnis ist viel schwieriger geworden.
Dieses Verhältnis zwischen Flughäfen und Fluggesellschaften und das daraus resultierende Konfliktpotential sind der Ansatzpunkt dieser Arbeit. Abb. 1 verdeutlicht diesen Ansatzpunkt und zeigt die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Flughäfen, Fluggesellschaften und Passagieren auf. Ziel dieser Arbeit ist es, die (notwendige) Veränderung der Geschäftsmodelle von Flughäfen und deren Reaktion auf die Entwicklung der Luftverkehrsbranche anhand einer Analyse der Wertschöpfungsstrukturen darzustellen. Aufgrund der hohen Aktualität des Themas und um den Praxisbezug zu den wenigen theoretischen Grundlagen herzustellen, wurden Expertengespräche[4] mit Geschäftsführern bzw. Verantwortlichen von dreizehn deutschen Flughäfen durchgeführt.
Abb. 1: Beziehungen zwischen Flughäfen, Fluggesellschaften und Passagieren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an: Ashford/Stanton/Moore (1997), S. 2.
Im Anschluss an diese Einführung werden zum grundsätzlichen Verständnis im folgenden Kapitel 2 der Begriff „Flughafen“ definiert und ein Überblick über die Geschäftsbereiche eines Flughafens gegeben. Zudem werden die Flughafenentgelte und -gebühren beschrieben. Kapitel 3 gibt einen grundlegenden Überblick über die Entwicklung der Luftfahrtbranche (sowohl der Flughäfen als auch der Fluggesellschaften) und stellt die daraus resultierenden Konsequenzen für die Flughäfen dar.
Auch der Begriff „Geschäftsmodell“ hat sich in den letzten Jahren verändert. Das folgende Kapitel 4 gibt einen kurzen Überblick über die gängigen Definitionen und eine Synthese der Ansätze von Bieger, welche in Kapitel 7 auf die entwickelten Geschäftsmodelle der Flughäfen angewendet wird.
In Kapitel 5 wird das Geschäftsmodell eines „traditionellen Flughafens“ beschrieben und aufgrund der veränderten Marktsituation weiterentwickelt. Anhand der Wertkette[5] von Porter werden die traditionellen Wertschöpfungsstufen eines Flughafens beschrieben. Zudem wird die Kosten- und Erlösstruktur von Flughäfen dargestellt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungstendenzen werden Möglichkeiten der Spezialisierung, Auslagerung, Kooperation und Beteiligung betrachtet, aus denen sich als Spezialfall das Modell einer „Global Airport Company“ ergibt.
Kapitel 6 geht auf die aktuelle Entwicklung im Low-Cost-Bereich ein. Nach einer Gegenüberstellung der gegenseitigen Ansprüche und Erwartungen von Low-Cost-Carriern und Flughäfen, sowie einer Typisierung der Flughäfen im Hinblick auf Low-Cost-Carrier, wird das Geschäftsmodell eines Low-Cost-Airports, als Idealfall, beschrieben. Anhand einer Differenzierung der Wertschöpfungsstufen wird die Profitabilität eines solchen Flughafens betrachtet.
Nachdem die Geschäftsmodelle eines „traditionellen Flughafens“, einer „Global Airport Company“ und eines „Low-Cost-Airports“ entwickelt wurden, werden diese in Kapitel 7 zusammenfassend gegenübergestellt und ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Flughafen-Branche gegeben. Letztendlich wird in Kapitel 8 ein Fazit gezogen, welches die wichtigsten Ergebnisse und Entwicklungen zusammenfasst.
2 Grundlegende Definitionen
Dieses Kapitel soll einen Überblick über die verschiedenen Definitionen und Einteilungskriterien von Flughäfen geben und die klassischen Geschäftsbereiche eines Flughafens beschreiben. Zudem werden die verschiedenen Arten von Flughafenentgelten und -gebühren charakterisiert. Diese grundlegenden Definitionen sollen ein einheitliches Verständnis für den weiteren Verlauf der Arbeit gewährleisten.
2.1 Definition und Einteilung von Flughäfen
„Airports are complex industrial enterprises. They act as a forum in which disparate elements and activities are brought together to facilitate, for both passengers and freight, the interchange between air and surface transport.“[6] Ein Flughafen wird von der ICAO definiert als ein festgelegtes Gebiet auf dem Land oder im Wasser, einschließlich aller Gebäude, Anlagen und Ausrüstungen, das ganz oder teilweise für Ankunft, Abflug und Bodenbewegungen von Luftfahrtzeugen bestimmt ist.[7]
Zur detaillierteren Definition werden die verschiedenen Arten von Flughäfen anhand von juristischen und funktionalen Kriterien unterschieden.
2.1.1 Juristische Einteilungskriterien
Im Gegensatz zum allgemeinen Verständnis von Flughafen wird im juristischen Sinn vom Oberbegriff „Flugplatz“ ausgegangen. Das Luftverkehrsgesetz (LuftVG) unterteilt Flugplätze in Flughäfen, Landeplätze und Segelfluggelände.[8] Der Betrieb jedes Flugplatzes bedarf einer Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde. Dabei wird ein Flughafen charakterisiert durch einen Bauschutzbereich, welcher bei Landeplätzen und Segelfluggelände nicht vorgeschrieben ist.[9] Landeplätze dienen vorwiegend der allgemeinen Luftfahrt, der Flugbetrieb ist nur bei Tageslicht unter Sichtflugregeln möglich und auf Fluggeräte bis 20 Tonnen Startgewicht begrenzt.[10]
Eine weitere Unterteilung nach dem Nutzerkreis wird durch die Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO) vorgenommen. Flughäfen werden als Verkehrs- oder Sonderflughäfen genehmigt und Landeplätze als Verkehrs- oder Sonderlandeplätze.[11] Im Gegensatz zu Verkehrsflughäfen und -landeplätzen, die der Allgemeinheit zugänglich sind, stehen Sonderflughäfen und -landeplätze nur einem bestimmten Nutzerkreis (öffentlich, halböffentlich oder privat) zur Verfügung.[12]
Verkehrsflughäfen haben eine Betriebspflicht. Sie müssen eine ausreichende Start- und Landebahn sowie ausreichend Betriebsflächen ausweisen, eine Flugsicherungskontrolle und Einrichtungen zum Instrumentenanflug haben, sowie ein minimales Startgewicht von 20 Tonnen garantieren. Die deutsche Rechtsordnung enthält jedoch keine Vorschriften zur rechtlichen Organisation von Verkehrsflughäfen.[13]
2.1.2 Funktionale Einteilungskriterien
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) unterteilt, zusätzlich zu den gesetzlichen Kriterien, Verkehrsflughäfen in internationale Verkehrsflughäfen und regionale Verkehrsflughäfen (Regionalflughäfen).[14]
Eine spezielle Form von internationalen Verkehrsflughäfen sind sogenannte „Megahubs“. Dies sind „herausragende Drehscheiben (Hubs) für den internationalen Luftverkehr, Ausgangspunkte für interkontinentale Langstreckenflüge, Knotenpunkte für innereuropäische Flüge und Heimatflughäfen (Homebase) großer europäischer Fluggesellschaften“[15].
Der Begriff Regionalflughafen ist rechtlich nicht definiert. Nach der allgemein anerkannten Definition der ADV und deutscher Luftfahrtbehörden sind Regionalflughäfen „Flugplätze mit regelmäßigem öffentlichen Verkehr [.], soweit sie nicht zu den internationalen Verkehrflughäfen gehören. Die Regionalflughäfen können der Genehmigung nach Flughäfen oder Landeplätze sein und sie betreiben die Flugsicherung in eigener personeller und technischer Verantwortung, während an den internationalen Verkehrsflughäfen die Flugsicherungsdienste direkt von der DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH) geleistet werden“[16].
2.1.3 Übersicht und Zuordnung deutscher Flughäfen
Abb. 2 zeigt eine zusammenfassende Übersicht über die verschiedenen Arten von Flughäfen. Für den weiteren Verlauf der Arbeit werden vor allem die Begriffe „Regionalflughafen“ und „internationaler Verkehrsflughafen“ von Bedeutung sein.
In Deutschland werden 18 Flughäfen als internationale Verkehrsflughäfen definiert.[17] Seit 2003 zählt das Statistische Bundesamt auch den Flughafen Frankfurt-Hahn zu den internationalen Verkehrsflughäfen hinzu.[18] Frankfurt/Main ist der einzige Megahub in Deutschland und Heimatflughafen der Deutschen Lufthansa AG.[19] Die räumliche Lage der internationalen Verkehrsflughäfen orientiert sich grundlegend an der Bevölkerungsverteilung in Deutschland. Folglich befinden sich die internationalen Verkehrsflughäfen überwiegend in Ballungsgebieten. Die Regionalflughäfen verteilen sich über die gesamte Fläche Deutschlands und liegen auch in Gebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte.[20]
Abb. 2: Juristische und funktionale Einteilungskriterien von Flughäfen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Erstellung.
2.2 Klassische Geschäftsbereiche von Flughäfen
Flughäfen bieten eine große Vielfalt an Infrastruktureinrichtungen und Servicedienstleistungen an. Diese können in drei wesentliche Geschäftsbereiche untergliedert werden: „Aviation“, „Groundhandling“ und „Non-Aviation“.[21] Jeder Flughafen bzw. jede Flughafengesellschaft kann jedoch individuell über den Umfang des eigenen Leistungsangebots sowie die an Dritte ausgelagerten Dienste entscheiden. Somit unterscheidet sich jeder Flughafen von einem anderen.[22]
2.2.1 Aviation
Der Geschäftsbereich „Aviation“ umfasst alle notwendigen Maßnahmen, um den Flugbetrieb eines Flughafens zu gewährleisten und den Flugzeugen Starts und Landungen zu ermöglichen.[23] Hierzu zählen:
- die Bereitstellung von Flugbetriebsflächen wie Start- und Landebahnen, Rollwegen, Wartepositionen, Sicherheitsflächen sowie Anlagen zur Befeuerung und Bodennavigation,
- die Bereitstellung von Terminals und die Gewährleistung des Terminalbetriebs, z. B. der Gepäckfördereinrichtungen sowie
- luftverkehrsspezifische Sicherheitsdienstleistungen zur Lenkung und Überwachung des Verkehrs, d. h. zur Gewährleistung von Sicherheit auf den Flughafenbetriebsflächen.[24]
Diese Infrastruktureinrichtungen und Serviceleistungen werden den Fluggesellschaften für Passagierverkehr, Luftfracht- und Luftpostverkehr gegen Entgelt[25] zur Verfügung gestellt. Sie werden stark von politischen Entscheidungen oder nationalen und internationalen Regulierungen beeinflusst.[26]
2.2.2 Groundhandling
Der Geschäftsbereich „Groundhandling“ beinhaltet die Erbringung von Bodenverkehrsdienstleistungen wie Flugzeugabfertigung, Passagier- und Frachtservice.[27] Dabei werden luft- und landseitige Bereiche der Bodenabfertigung sowie die Transitfunktion unterschieden. Die landseitige Abfertigung umfasst die Abfertigung von Passagieren und Gepäck an den Schaltern des Fluggastterminals sowie von Fracht und Post in den Frachtgebäuden. Zur luftseitigen Abfertigung („ramp handling“), zählen:
- die Vorfeldabfertigung der Flugzeuge, d. h. Be- und Entladevorgänge der Flugzeuge sowie Transport von Passagieren, Crew, Gepäck, Fracht und Post zwischen Flugzeugen und Abfertigungsgebäuden,
- Versorgungsdienstleistungen, die die Flugzeuge mit Treibstoff, Strom, Wasser, Reinigung, Catering, etc. versorgen und
- die Vorfeldkontrolle, d. h. Leitung und Einweisung von Flugzeugen sowie von Versorgungs- und Transportfahrzeugen auf dem Rollfeld und Überwachung der Abfertigungspositionen.[28]
Unter der Transitfunktion eines Flughafens werden alle regionalen Zubringer- und Verteilerdienste für Personen, Fracht und Post sowie die Verknüpfung der grenzüberschreitenden Flüge im internationalen Verkehr verstanden. An kleineren Flughäfen ist kein Transitverkehr vorhanden. Sie dienen nur als Zubringerflughäfen zu den Hub-Flughäfen, bei denen die Transitfunktion einen wichtigen Bereich darstellt.[29]
2.2.3 Non-Aviation
Unter dem „Non-Aviation-Bereich“ eines Flughafens werden verschiedene kommerzielle Aktivitäten zusammengefasst, die den Flugbetrieb nicht direkt betreffen.[30] Hierzu zählen:
- Vermietung/Verpachtung von Büroräumen, Check-In-Schaltern, Ladenflächen, Frachtlagerhallen, etc.,
- Konzessionsvergabe an Betreiber von Flugbetriebsdiensten (z. B. Tankgesellschaften), Geschäften, Restaurants, etc.,
- Parkraummanagement,
- eigene Verkaufsaktivitäten, z. B. Geschäfte, Restaurants, Cafés und
- sonstige Serviceleistungen.[31]
An den meisten deutschen und europäischen Flughäfen werden kommerzielle Einrichtungen von Konzessionären betrieben, die sich auf diese Bereiche spezialisiert haben. Eigene Verkaufsaktivitäten werden nur noch von wenigen Flughäfen selbst durchgeführt.[32]
2.3 Flughafenentgelte und -gebühren
Gebühren und Entgelte spielen im Luftverkehr eine wichtige Rolle. Durch sie werden Dienstleistungen, die ein Flughafenbetreiber für seine Kunden bereithält, finanziert. Es besteht jedoch ein erheblicher Unterschied zwischen Flughafenentgelten und Flughafengebühren. Flughafenentgelte werden direkt vom Flughafen für infrastrukturelle Leistungen, die er Passagieren und Fluggesellschaften zur Verfügung stellt, eingenommen.[33] Flughafengebühren dagegen werden nicht vom Flughafen selbst erhoben, sondern sind direkte Belastungen der Fluggesellschaften durch die Bundesbehörden oder deren Beauftragte. Der sog. „Fummeltaler“ oder die „Grabschgebühr“ sind die bekanntesten Gebühren. Diese Luftsicherheitsgebühr wird in Deutschland u. a. vom Bundesgrenzschutz für die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen erhoben. Weitere Gebühren werden von der Flugsicherung für An- und Abflug sowie Überflüge erhoben.[34]
Für Flughäfen sind folglich nur Flughafenentgelte von Bedeutung. Sie bilden neben den Einkünften aus dem Non-Aviation-Bereich den größten Einnahmenblock (vgl. Kapitel 5.2.2 zur Erlösstruktur). Man unterscheidet Landeentgelte, Passagierentgelte, Abstellentgelte sowie Emissions- und Lärmentgelte.[35]
Landeentgelte umfassen die Benutzung der Start- und Landebahnen, Rollwege, Befeuerungs- und Bodennavigationsanlagen sowie aller Einrichtungen und Anlagen, die für Starts und Landungen notwendig sind. Diese fixen, gewichtsbezogenen Entgelte richten sich nach dem höchsten in den Zulassungsunterlagen verzeichneten Abfluggewicht des Flugzeugtyps (maximum take-off weight MTOW).[36]
Passagierentgelte werden für die Benutzung der Flughafeninfrastruktur und für Serviceleistungen erhoben, z. B. für Informationsschalter oder Toiletten. Diese Entgelte sind variabel und richten sich nach der Anzahl der abfliegenden Passagiere. Die zusteigenden Passagiere werden häufig nach Inlands-, EU- und Nicht-EU-Verkehr unterschieden.[37] Für Transit- und Transferfluggäste sind die Entgelte in der Regel niedriger.[38]
Abstellentgelte sowie Emissions- und Lärmentgelte sind weniger bedeutend, da die Erlöse aus diesen Bereichen sehr gering sind (vgl. Kapitel 5.2.2). Abstellentgelte werden überwiegend dann erhoben, wenn eine bestimmte Standzeit am Boden, die in den Landeentgelten bereits enthalten ist, überschritten wird. Sie sind abhängig vom Gewicht und der Aufenthaltsdauer des Flugzeugs.[39] Emissions- und Lärmentgelte werden anhand von Lärmkategorien berechnet, die sich nach dem Abgas- und Lärmausstoß der Maschinen richten.[40]
Die Höhe der Flughafenentgelte und -gebühren an deutschen Flughäfen ist sehr unterschiedlich. Anhang A2 gibt einen Überblick über Passagier- und Landeentgelte sowie Luftsicherheitsgebühren an deutschen Flughäfen. Es sind große Preisspannen zwischen Großflughäfen wie Frankfurt/Main, München oder Düsseldorf und kleineren Flughäfen wie Friedrichshafen oder Neubrandenburg zu erkennen. Der Flughafen Frankfurt-Hahn verlangt sogar für die klassischen Maschinen der Low-Cost-Airlines (Airbus A 320 und Boing 737-300) keinerlei Landegebühren.
3 Entwicklung der Luftverkehrsbranche: Airports & Airlines
Momentan befindet sich die gesamte europäische Luftfahrtbranche in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Der Kostendruck für Airlines und Flughäfen wird immer größer.[41] Diese Phase der Veränderungen wurde durch die Liberalisierungsbestrebungen der EU ausgelöst. Sie geht einher mit einem Wachstum der Low-Cost-Airlines und zunehmenden Privatisierungstendenzen der Flughäfen. Die Bedeutung der Hubs in Europa verändert sich ebenso wie das Verhältnis zwischen Fluggesellschaften und Flughäfen.[42]
3.1 Neuregelungen des europäischen Luftverkehrs
Die seit den siebziger Jahren in den USA und den achtziger Jahren in Europa einsetzenden Liberalisierungs- und Deregulierungsprozesse haben den Luftverkehrsmarkt grundsätzlich verändert.[43]
3.1.1 Liberalisierung der Flugmärkte
Der Luftverkehr innerhalb der Europäischen Union wurde lange Zeit durch komplexe Verflechtungen bilateraler Luftverkehrsabkommen geregelt. Die Mehrzahl der Mitgliedsländer sah den Luftverkehr als eine öffentliche Aufgabe und befürchtete durch eine Liberalisierung den Verlust eines wichtigen Teils nationaler Souveränität.[44] Die Liberalisierung des europäischen Luftverkehrsmarktes wurde in mehreren Etappen durchgeführt. Zu den wichtigsten zählen die Richtlinie über die Zulassung des interregionalen Linienflugverkehrs 1983, die drei Liberalisierungspakete in den Jahren 1987, 1990 und 1992 sowie die Freigabe der Inlandskabotage im Jahr 1997.[45]
Durch diese Verordnungen wurden die sogenannten „Freiheiten der Luft“[46], die zum Teil bereits im Rahmen des Chicagoer Abkommens 1944 entwickelt wurden, umgesetzt. Neben diesen Freiheiten basiert das Idealbild eines liberalisierten Luftverkehrsmarktes nach Sterzenbach/Conrady auf folgenden Merkmalen:
- konsequente Berücksichtigung der Nachfragerpräferenzen,
- Gestaltungsfreiheit von Beförderungskapazitäten und Preisen,
- Gestaltungsfreiheit der Fluggesellschaften bei den Streckennetzen,
- technisch effizienter Einsatz der Produktionsfaktoren,
- Förderung von effizienzsteigernden Kooperationsabkommen,
- Wahrung der Interessen der im Luftverkehr Bediensteten und
- Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bürger mit Verkehrsleistungen.[47]
3.1.2 Deregulierung der Bodenverkehrsdienste
Am 15. Oktober 1996 wurde vom Europäischen Rat die Richtlinie 96/67/EG über den Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdienste auf den Flughäfen der Gemeinschaft erlassen, welche eine schrittweise Liberalisierung der Bodenabfertigungsdienste festlegt.[48] Sie wurde mit der Verordnung über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen (BADV) vom 10. Dezember 1997 in Deutschland in nationales Recht umgesetzt und ermöglicht die Selbstabfertigung durch die Fluggesellschaften oder die Drittabfertigung durch ein anderes Unternehmen.[49]
Ziele der Deregulierung der Bodenabfertigungsdienste sind:
- Auflösung der Abfertigungsmonopole der Fluggesellschaften, um den Wettbewerb zu intensivieren und den Markteintritt neuer Wettbewerber (sog. Handlingfirmen) zu erleichtern,
- Senkung der Preise für Bodenabfertigungsdienste und damit Senkung der Betriebskosten der Fluggesellschaften sowie
- bessere Anpassung der Dienstleistungen an die Bedürfnisse der Kunden.[50]
3.2 Aktuelle Entwicklung und Problematik des deutschen Flugmarktes
Neben den Deregulierungs- und Liberalisierungsprozessen wurde der gesamte Luftverkehrsmarkt auch durch aktuelle Ereignisse wie die Terroranschläge des 11. September 2001, die Ausbreitung von SARS oder den 2. Irak-Krieg kurzfristig stark beeinflusst. Dies führte zu sinkenden Passagierzahlen und wirtschaftlichen Einbußen.[51]
3.2.1 Veränderungen im Passagier- und Frachtaufkommen
Nach einer Phase des Wachstums im deutschen Passagier-Luftverkehr seit 1992 – mit jährlichen Wachstumsraten zwischen 2,7 % (1996) und 12,0 % (1992) – war im Jahr 2001 eine rückläufige Entwicklung zu verzeichnen (Vgl. Abb. 3). Die Gesamtzahl einsteigender Passagiere ist um 3,7 % gesunken, der innerdeutsche Verkehr sogar um 8,6 %.[52]
Abb. 3: Veränderung und Prognose der Passagier-Wachstumsraten in Deutschland
Quelle: Eigene Erstellung. Daten und Berechnungen aus: Statistisches Bundesamt (1999), o. S., Statistisches Bundesamt (2000), o. S., Statistisches Bundesamt (2001), o. S., Statistisches Bundesamt (2002b), o. S., Statistisches Bundesamt (2003b), o. S. und Grotrian/Ickert/ Limbers/Rommerskirchen (2003), S. 43.
Diese Entwicklung begründet sich in der durch die terroristischen Anschläge im Jahr 2001 ausgelösten Verunsicherung bei der Bevölkerung und einem damit einhergehenden Nachfragerückgang. Aber schon zu Beginn des Jahres 2001 war ein Rückgang der Passagierzahlen zu verzeichnen. Die Weltkonjunktur war bereits zu diesem Zeitpunkt ins Stocken geraten. Die Anschläge haben diese Situation nur noch um ein Vielfaches verschärft.[53] Bedingt durch die Nachwirkungen dieser Ereignisse sanken auch im Jahr 2002 die Wachstumsraten. Im vierten Quartal zeichnete sich erstmals wieder ein positiver Trend mit 10,2 % Passagier-Wachstum ab. Dieser Wert resultiert jedoch nur aus den sehr schlechten Vorjahreswerten.[54]
Für das laufende Jahr 2003 erwartet die ProgTrans AG im innerdeutschen Flugverkehr ein Wachstum von 8,8 %. Gründe dafür sind das veränderte Marktangebot durch die Markteintritte mehrerer Low-Cost-Airlines und deren Preispolitik, die den Neuverkehr erhöhen. Die Zunahme wird durch den Nachhol-Effekt der Vorjahre verstärkt. Der Auslandsverkehr wird nur ein leichtes Plus von 0,4 % verzeichnen können. Hier zeigt sich eine beginnende Stabilisierung des weltweiten Luftverkehrs. Diese Erholung der Passagierzahlen wird jedoch durch den 2. Irak-Krieg und den Ausbruch von SARS im ersten Halbjahr 2003 etwas abgeschwächt. Insgesamt wird ein jährliches Passagierwachstum von 1,6 % prognostiziert.[55]
Für das Jahr 2004 erwartet die ProgTrans AG eine Abschwächung der Nachhol-Effekte im innerdeutschen Verkehr, d. h. ein Wachstum von 4,3 %. Mittelfristig werden 4,2 % Wachstum prognostiziert. Dies wird hauptsächlich durch die Angebote der Low-Cost-Carrier und die Angebotsanpassungen der etablierten Unternehmen begründet. Der Auslandsverkehr wird aufgrund einer Stabilisierung des globalen Marktes, der weitgehend abgeschlossenen Bereinigung im Anbieterspektrum und einer positiven Entwicklung der Tourismusbranche ebenfalls wachsen. Die Wachstumsraten werden im Jahr 2004 bei 3,1 % und mittelfristig bei 3,5 % liegen. Daraus ergibt sich für 2004 ein Gesamtwachstum von 3,3 % der einsteigenden Passagiere in Deutschland und für die Jahre 2005 bis 2007 jeweils ein Zuwachs um 3,6 %.[56]
Auch der Bereich Luftfracht ist ein wichtiger Geschäftsbereich der Flughäfen. Nachdem im Jahr 1998 die beförderte Luftfrachtmenge um 3,9 % gesunken ist, stieg sie 1999 um 5,6 % an und übertraf den bisherigen Höchstwert des Jahres 1997. Im Jahr 2000 war ein starkes Wachstum von 10,3 % zu verzeichnen (Vgl. Abb. 4).[57]
Abb. 4: Veränderung der Fracht-Wachstumsraten in Deutschland
Quelle: Eigene Erstellung. Daten aus: Statistisches Bundesamt (1999), o. S., Statistisches Bundesamt (2000), o. S., Statistisches Bundesamt (2001), o. S., Statistisches Bundesamt (2002a), o. S. und Statistisches Bundesamt (2003a), o. S.
Die oben beschriebenen Ereignisse und die damit einhergehende Reduktion der Flugfrequenzen im Passagierbereich wirken sich stark auf das Frachtgeschäft aus. Es kommt auch hier zu einer Reduktion der Flugfrequenzen und einem Rückgang der transportierten Frachtmengen. So sank die beförderte Menge 2001 um 4,2 % und im innerdeutschen Verkehr sogar um 11,1 %. Auch hier sanken die Wachstumsraten bereits im Frühjahr 2001. Im Jahr 2002 konnten zumindest im Verkehr mit dem Ausland wieder positive Wachstumsraten von 4,8 % verzeichnet werden.[58]
Der Bereich Luftfracht befindet sich derzeit in einem schwierigen Umfeld. Sowohl äußere Einflüsse wie der 2. Irak-Krieg oder die Lungenkrankheit SARS bewirken einen Rückgang der Frachtkapazitäten, als auch die Zurückdrängung der traditionellen Netzwerk- und Linienfluggesellschaften durch die in den Markt drängenden Low-Cost-Carrier. Die ProgTrans AG erwartet im Jahr 2003 ein Wachstum im europäischen Luftfrachtaufkommen von 3,9 %. Mittelfristig für die Jahre 2005 bis 2007 wird ein durchschnittliches Wachstum von 2,5 % prognostiziert. Diese moderaten Zuwächse sind auf die bereits reifen Märkte in Europa zurückzuführen. In Deutschland wirkt zudem die wachsende Konkurrenz des Straßengüterverkehrs hemmend auf die Luftfrachtentwicklung.[59]
3.2.2 Die Low-Cost-Revolution
„Zehn Jahre nach der Verabschiedung der dritten und letzten Stufe der Liberalisierung ist die Freiheit am europäischen Himmel tatsächlich grenzenlos. Die Revolution ließ lange auf sich warten. Erst der aggressive Auftritt der Low-Cost-Carrier scheint die bis dahin abgesteckten Claims der traditionellen Fluggesellschaften aufzubrechen.“[60]
Die europäische Entwicklung im Low-Cost-Segment begann mit der irischen Fluggesellschaft Ryanair, die im Jahr 1985 gegründet wurde und sich ab dem Jahr 1991 als erste europäische Low-Cost-Airline verstand. Das Geschäftsmodell von Ryanair basiert seitdem auf dem mit großem Erfolg entwickelten Prinzip „Low Cost/No Frills“ (übersetzt: „niedrige Kosten/kein Schnickschnack“) von Southwest Airlines.[61]
Im Oktober 1995 wurden EasyJet und im Juni 1996 Debonair mit Sitz in London Luton gegründet. Die belgische Billig-Fluggesellschaft Virgin Express entstand 1997 aus den ehemaligen Eurobelgian Airlines. Kurz nach Gründung dieser Fluggesellschaften und begründet durch die Liberalisierungsprozesse begann die Expansion von Ryanair. 1997 wurde das Streckennetz um vier, 1998 um sieben und 1999 um weitere acht kontinentaleuropäische Strecken (darunter Deutschland mit dem Flughafen Frankfurt-Hahn) erweitert. Im Mai 1998 gründete British Airways mit Go als Tochtergesellschaft eine weitere Low-Cost-Airline, gefolgt von Buzz im Januar 2000, einer Tochter von KLM. Die Konkurrenz wurde immer größer. In Italien wurden 1999 Air One, in Norwegen Color Air und in Spanien Air Europe gegründet. Der zunehmenden Konkurrenz nicht gewachsen, verschwand Debonair im September 1999 wieder vom Markt.[62]
Mit Beginn des Jahres 2002 wurden auch in Deutschland immer mehr Strecken von Low-Cost-Carriern angeboten. Nachdem Ryanair im November 2001 den Flughafen Frankfurt-Hahn zu ihrem zweiten kontinentaleuropäischen Standort und Hub ausgebaut hatte, starteten ab Februar 2002 täglich über 30 Flüge von Hahn auf zehn innereuropäischen Strecken. Bereits im Jahr 2000 hatte Ryanair ihre zweite Strecke nach Deutschland (Hamburg-Lübeck) eröffnet.[63] Im Februar 2002 wurde die erste osteuropäische Billigfluggesellschaft SkyEurope mit Sitz in Bratislava (Slowakei) gegründet. SkyEurope ist die größte Fluggesellschaft in der Slowakei und bietet unter anderem Linienflüge von Bratislava und Košice nach Berlin und München an.[64] Die erste österreichische Low-Cost-Airline Intersky nahm im März 2002 ihren Betrieb auf. Von der schweizerischen Basis Bern fliegt sie unter anderem nach Berlin-Tempelhof.[65]
Auch die traditionellen, deutschen Fluggesellschaften Deutsche BA, die sich ab April 2003 mit dem neuen Namen dba im Low-Cost-Segment positionierte, und Air Berlin, die seit Oktober 2002 den sog. „Air Berlin City Shuttle“ anbietet, reagierten auf den Low-Cost-Boom.[66] Die erste deutsche Billigfluggesellschaft ist Germanwings, als Tochtergesellschaft von Eurowings. Sie nahm im Oktober 2002 ihren Betrieb am Flughafen Köln/Bonn auf und bedient neben innereuropäischen Strecken auch die deutschen Destinationen Berlin und Dresden. Knapp ein Jahr nach dem Start (im September 2003) expandierte Germanwings und machte Stuttgart zur zweiten Drehscheibe in Deutschland.[67] Hapag-Lloyd Express, als zweiter deutscher Low-Cost-Carrier und Tochter der TUI AG, bietet seit Dezember 2002, ebenfalls von der Basis Köln/Bonn, innerdeutsche und europäische Flüge an. Im April 2003 wurde Hannover zum zweiten Hub gewählt und ab Juli 2003 startete Hapag-Lloyd-Express auch von Stuttgart, das zum dritten Standort in Deutschland wird.[68]
Seit März 2003 fliegt auch am Flughafen Hahn eine zweite Low-Cost-Airline: Volareweb.com. Die italienische Billigfluggesellschaft wurde im Februar 2003 als Tochter der Volare Group gegründet.[69] Im April und Mai 2003 kam es zu den ersten Marktbereinigungen. Go wurde von EasyJet übernommen und Buzz von Ryanair.[70]
Als weiterer deutscher Billigflieger entstand im Juni 2003 Germania Express als Marke der Germania Fluggesellschaft mbH. Mit einem Fixpreissystem (alle Flüge zu 77, 88 oder 99 Euro) wollen sie sich von den anderen Low-Cost-Carriern unterscheiden. Germania Express fliegt in Deutschland von Berlin-Tegel, Hannover und München. Ab Oktober sollen Hamburg und ab November Bremen, Düsseldorf und Stuttgart ins Streckennetz aufgenommen werden.[71] Abb. 5 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Entwicklung der beschriebenen Low-Cost-Carrier in Europa.
Abb. 5: Entwicklung ausgewählter Low-Cost-Airlines in Europa
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Erstellung. Daten aus: Doganis (2001), S.135 ff., Genger (2003), o. S., Germania Express (2003), o. S., Ryanair Unternehmensgeschichte (2003), o. S., Special LCC (2003), o. S., Troendle (2003a), o. S., Troendle (2003b), o. S. und Volareweb.com Vision (2003), o. S.
Das Low-Cost-Segment ist derzeit der größte und einzige Wachstumstreiber in Deutschland. Durch die Angebote der Low-Cost-Airlines werden nicht nur Kunden von traditionellen Fluggesellschaften abgeworben, sondern auch neue Kundengruppen erschlossen, die noch nie zuvor geflogen sind.[72] Verschiedene Studien erwarten, dass der Marktanteil der Low-Cost-Carrier in Europa im Jahr 2010 zwischen 20 und 35 % des Passagieraufkommens liegen wird.[73] Dies macht den Low-Cost-Bereich nicht nur für Airlines, sondern auch für Flughäfen interessant. Als Folge des harten, aggressiven Wettbewerbs um Marktanteile wird es jedoch mittel- bis langfristig zu einem Konsolidierungsprozess kommen.[74]
3.2.3 Privatisierung von Flughäfen
Der Staatseinfluss im Bereich der Flughäfen ist sehr hoch. Weltweit befinden sich ca. 98 % aller Flughäfen in Staatseigentum oder in der öffentlichen Hand. Damit obliegt dem Staat die Kontrolle über eine funktionierende Luftverkehrsinfrastruktur. Seit Mitte der 90er Jahre ist in Deutschland jedoch ein Trend zur Privatisierung zu erkennen, bei dem die staatlichen Beteiligungen schrittweise abgebaut werden.[75]
Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Flughäfen, aufgrund der zunehmenden Erhöhung der Flugbewegungen, ihre Kapazitätsgrenze erreicht haben oder in nächster Zeit erreichen werden.[76] Es besteht die „Notwendigkeit, privatwirtschaftliche Investitionsbereitschaft zu nutzen, um den (großen) Finanzbedarf beim bedarfsgerechten Ausbau aller Geschäftsbereiche von Flughafengesellschaften abzudecken“[77].
Es ist wichtig, zwischen der Eigentums-/Gesellschafterstruktur der Flughäfen und den privatwirtschaftlich organisierten Flughafenbetreibergesellschaften zu differenzieren.[78] Die deutschen Flughafenbetreibergesellschaften sind hauptsächlich Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), deren Gesellschafter Länder, Kreise, Städte und Gemeinden sind. Ausnahme ist die Fraport AG, die als einzige Flughafengesellschaft in Deutschland die Form einer Aktiengesellschaft gewählt hat. An den Berliner Flughäfen, in Frankfurt, München und Köln/Bonn ist auch der Staat als Gesellschafter beteiligt. Anhang A7 gibt einen Überblick über die Eigentumsstruktur an deutschen Flughäfen. Bis vor kurzem waren alle deutschen Flughäfen noch im Eigentum der öffentlichen Hand. Eine Reihe materieller (Teil-)Privatisierungen durch die Veräußerung von öffentlichen Flughafenanteilen an private Investoren ist jedoch geplant oder bereits vollzogen.[79]
Es können drei Arten der Privatisierung unterschieden werden:
- vollständige Privatisierung: Der einzige Flughafen in Deutschland, der als voll privatisiert bezeichnet werden kann, ist der Flughafen Niederrhein.[80] Für den Flughafen Berlin Brandenburg International wird eine vollständige Privatisierung angestrebt. In diesem Fall ziehen sich Bund, Länder, Städte und Gemeinden schrittweise zurück und überlassen ihre Gesellschafteranteile einem privaten Investorenkonsortium.[81]
- Börsengang als Form der (Teil-)Privatisierung: Die Fraport AG ist die einzige Flughafengesellschaft, die einen Teil ihrer Gesellschafteranteile an die Börse gebracht hat. Im Juni 2001 wurden 29 % der Anteile veräußert und befinden sich nun im Streubesitz.[82]
- klassische Public-Private Partnerships (PPP) im Sinne privatrechtlicher Gesellschaften öffentlicher Gebietskörperschaften und privater Unternehmen: Diese Form der Privatisierung ist bei den Flughäfen Düsseldorf und Hamburg zu beobachten. Bei beiden sind die Hochtief Airport GmbH und die Aer Rianta International als private Gesellschafter beteiligt.[83]
Alle weiteren deutschen Flughäfen befinden sich derzeit noch im Eigentum der öffentlichen Hand. Die Gesellschafter sind Bund, Länder, Städte, Kreise und Gemeinden sowie Unternehmen der öffentlichen Hand, deren Gesellschafter wiederum zu mehr als 50 % aus dem öffentlichen Sektor kommen.[84]
Vorteile einer Privatisierung sind:
- neue Finanzierungsmöglichkeiten über die Börsen, die die Realisierung von Unternehmenszielen und Investitionen erleichtern,
- eine größere Eigenkapitalbasis, die Fusionen, Kapitalbeteiligungen und strategische Allianzen im Ausland ermöglicht,
- flexiblere Anpassung an die Marktverhältnisse,
- Synergieeffekte durch den Betrieb mehrerer Flughäfen,
- neues Know-How (auch aus anderen Branchen) und
- Einführung privatwirtschaftlicher Unternehmensstrukturen, die den Flughäfen eine gewinnorientierte, privatwirtschaftliche Unternehmensführung erlauben und unternehmenspolitische Entscheidungen beschleunigen.[85]
Diesen stehen jedoch auch Nachteile gegenüber, wenn die strategischen und finanziellen Zielsetzungen der Investoren nicht mit den Unternehmenszielen des Flughafens übereinstimmen. Die mögliche Konsequenz wäre eine Degenerierung zum Zubringerflughafen. Zudem können Probleme bezüglich der Zusatzversorgungen öffentlicher Bediensteter entstehen, die Ausgleichszahlungen erforderlich machen.[86]
Die Entscheidung für oder gegen eine Privatisierung ist eine politische Entscheidung. „Privatisierung ist kein Selbstzweck, sondern dient der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie der Sicherung und Stärkung einer leistungsfähigen Infrastruktur und unterstützt damit die Politik der Bundesregierung zur Sicherstellung und Schaffung neuer Arbeitsplätze.“[87] Eng verknüpft mit diesem Thema ist die Subventionierung von Flughäfen, die in letzter Zeit ein viel diskutiertes Thema in den Medien ist und stark in der Kritik steht.
3.3 Subventionierung von Flughäfen
Grundsätzlich wird der Begriff „Subventionierung“ in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und im Bereich der statistischen Berichterstattung sehr unterschiedlich definiert und hat meist einen negativen Beigeschmack. Einig ist man sich jedoch darüber, dass Subventionen generell alle direkten und indirekten Transferzahlungen des Staates an ausgewählte Wirtschaftsobjekte sind, die unterstützt werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, welches im öffentlichen Interesse steht.[88]
3.3.1 Möglichkeiten der Subventionierung
Im Folgenden wird von einer sehr weiten Definition von Subventionierung ausgegangen, die sich auf allen politischen Ebenen (EU, Bund, Länder, Städte, Gemeinden, Kreise) abspielen kann und zu einer Zunahme der Kosten oder einer Minderung der Einnahmen des öffentlichen Budgets führt.[89] Für Flughäfen können direkte Subventionen, indirekte Subventionen und Subventionen für die landseitige Anbindung des Flughafens unterschieden werden.
„Direct subsidies can be defined as a government expenditure, which is directly paid to the economic subject in question without any market-based return-service of the recipient. It decreases the cost of producing a specific good or service and thus supports the production sale or purchase of a good or service.”[90] Direkte Subventionen werden überwiegend von den öffentlichen Gesellschaftern der Flughäfen für Investitionen in die Flughafeninfrastruktur gewährt.[91] In Bayern gibt es zudem die Möglichkeit über das Bayerische Wirtschaftsministerium einen Zuschuss für Investitionen in Regionalflughäfen zu beantragen.[92] Auch über die EU kann ein Flughafen direkte Fördermittel beziehen, unter anderem für den Ausbau von Gewerbeflächen.[93]
Eine weitere direkte Unterstützung ist die Übernahme der laufenden Kosten oder der Ausgleich von Fehlbeträgen durch öffentliche Organe bzw. die öffentlichen Gesellschafter. Vor allem kleinere Flughäfen sind häufig nicht in der Lage, ihre kompletten Betriebskosten durch die Flughafenentgelte zu decken und sind damit auf staatliche Subventionen angewiesen, die meist durch das Argument gerechtfertigt werden, dass Flughäfen ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur sind.[94]
Des weiteren kann alleine die Beteiligung von Bund, Ländern, Städten, Gemeinden und Kreisen an den Flughäfen als eine Form der staatlichen Subventionierung gesehen werden, denn diese stellen dem Flughafen Stammkapital für dessen Infrastruktur zur Verfügung. Bei Stammkapitalerhöhungen zur Finanzierung von Investitionsvorhaben kann man ebenfalls von einer Subventionierung durch die öffentlichen Gesellschafter sprechen.[95]
Unter indirekten Subventionen versteht man alle „[...] governmental interventions and regulations which favour selected economic agents by reducing their costs or by guaranteeing purchases of their products.”[96] Zu diesen indirekten Subventionen zählen für Flughäfen Steuerermäßigungen, Preisvergünstigungen im Sinne von Zinsermäßigungen, Zinserlass oder günstigeren Grundstückspreisen sowie Bürgschaften.
In Deutschland sind Zinsermäßigungen oder ein kompletter Zinserlass durch die Gesellschafter nachzuweisen. Diese werden auch als sogenannte „Schuldendiensthilfe“ bezeichnet.[97] Aber auch reine Bürgschaften als Form der indirekten Subventionierung sind durchaus geläufig. Die öffentlichen Gesellschafter bürgen bei Fremdfinanzierungsvorhaben für den Flughafen.[98] Steuerermäßigungen gibt es für deutsche Flughäfen nicht und ob den deutschen Flughäfen die Option auf günstigere Grundstückspreise offen steht, ist fraglich.[99]
Als weitere Form der Subventionierung kann die finanzielle Unterstützung zur landseitigen Anbindung des Flughafens gesehen werden, denn eine gute infrastrukturelle Anbindung macht einen Flughafen attraktiver und ist Voraussetzung für dessen Funktionieren. Hierzu zählen die Förderung des Ausbaus von Straßen- und Schienennetzen sowie die Bereitstellung und finanzielle Unterstützung von öffentlichen Verkehrsmitteln, die den Flughafen anbinden.[100] Tab. 1 gibt einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Subventionierung und veranschaulicht diese anhand von Beispielen.
Es gibt folglich sehr viele Subventionsmöglichkeiten für Flughäfen. Häufig beruhen diese auf der Gesellschafterbeteiligung des öffentlichen Sektors an den Flughäfen und werden auch durch diese gerechtfertigt. Man kann davon ausgehen, dass jeder deutsche Flughafen staatliche Subventionen (im Sinne dieser sehr weiten Definition) erhält. Da der Begriff Subventionierung inzwischen einen sehr negativen Beigeschmack hat, wird dies jedoch häufig abgestritten.[101] Staatliche Subventionen sind jedoch nicht grundsätzlich als negativ zu betrachten.
Tab. 1: Arten der Subventionierung von Flughäfen in Deutschland
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Erstellung. Informationen aus: Air Transport Group (2002a), S. „5-19“ ff., Hartmann, Anhang B1, Huckestein (2003), S. 13 ff., im Wolde, Anhang B3, Jung, Anhang B4, Landtag Rheinland-Pfalz (2002a), S. 1 f., Müller, Anhang B7, ÖPNV-Verbindung nach Hahn (2003), o. S. und Treber/Kirchmair/Kier (2003), S. 11 ff.
3.3.2 Quersubventionierung von Low-Cost-Airlines durch die Flughäfen in Deutschland?
Über eine vorhandene Quersubventionierung von Low-Cost-Airlines durch staatliche Zuschüsse an Flughäfen wird in der letzten Zeit viel spekuliert. Es gibt jedoch nur wenige Fakten. Anhang A9 gibt einen Einblick in die Thematik und zeigt Auszüge aus dem Vertrag zwischen Ryanair und dem französischen Flughafen Straßburg. Anhand von Rechenbeispielen werden die Ausmaße einer staatlichen Subventionierung von Ryanair dargestellt. Demnach hat Ryanair im ersten Jahr ein Recht auf über fünf Millionen Euro öffentlicher Zuschüsse. Grundsätzlich kann man im Hinblick auf eine Quersubventionierung von Low-Cost-Airlines durch Flughäfen drei Bereiche der Subventionierung unterscheiden: niedrige Flughafenentgelte, Marketingzuschüsse und sonstige Leistungen des Flughafens.
Niedrige Flughafenentgelte sind ein wichtiges Kostenelement im Geschäftsmodell der Low-Cost-Carrier.[102] Flughäfen können diese Entgelte jedoch nicht selbst festsetzen und dürfen somit offiziell auch keine Preissegmentierung für unterschiedliche Kundengruppen vornehmen. Die Flughafenentgelte müssen veröffentlicht werden und gelten für alle Kunden eines Flughafens gleichermaßen.[103] So bestätigen auch die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn oder Stuttgart, dass jeder, sowohl Low-Cost-Carrier als auch Full-Service-Carrier, die vollen Entgeltsätze bezahlt.[104]
Das lässt sich nicht widerlegen. Dennoch ist es nicht ungewöhnlich, dass einige Airlines gesonderte Bedingungen mit den Flughafengesellschaften aushandeln und Preise bezahlen, die unter den veröffentlichten Entgelten liegen.[105] „For small regional airports with high fixed costs, there is effectively a financial and economic requirement to offer incentives, which involve heavily discounted aeronautical charges especially since over the past few years low cost airlines have managed to achieve significant traffic growth at these airports which should have a major economic boost to regional economies. As many of these airports are owned and in some cases operated directly by the public sector, there is no alternative but to use state aid or public funds to cover deficits incurred from below average-cost pricing.”[106]
Der Flughafen Hahn berechnet beispielsweise für eine Boing 737-300, die typische Maschine seines Low-Cost-Carriers Ryanair, null Euro Landeentgelt.[107] Aufgrund dieser unterdurchschnittlichen Preisgestaltung entgehen dem Land Rheinland-Pfalz, als Gesellschafter des Flughafens Hahn, Einnahmen und es muss zusätzlich die operativen Fehlbeträge übernehmen, die der Flughafen erwirtschaftet. Nach der oben genannten weiten Definition von Subventionen (vgl. Kapitel 3.3.2) ist dies eindeutig eine Art der Subventionierung. Der Flughafen Hahn argumentiert natürlich andersherum und definiert Subventionierung enger.[108]
Das Thema „ Marketingzuschüsse “ hat in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen. Einige Flughäfen, z. B. der Flughafen Köln/Bonn, stehen inzwischen auch offiziell dazu, dass sie den Low-Cost-Carriern Werbekostenzuschüsse zahlen, denn diese bewerben auch den Flughafen als solchen. Die Höhe dieser Zuschüsse wird jedoch nicht bekannt gegeben.[109] Auch der Flughafen Hahn zahlt Marketingzuschüsse für neue Strecken, die jedoch nach etwa einem halben Jahr auslaufen sollen.[110]
Ob Low-Cost-Carrier durch weitere Leistungen der Flughäfen, wie z. B. Bereitstellung von Shuttle-Bussen, Anbindung an öffentliche Verkehrsnetze, etc. unterstützt werden, wie dies in Straßburg der Fall war, kann an dieser Stelle nicht nachgewiesen werden, ist aber durchaus vorstellbar.[111] Hierdurch würden die Low-Cost-Airlines indirekt durch öffentliche Gelder subventioniert werden.
Inzwischen ermittelt die EU-Kommission an einigen europäischen Flughäfen, um eine Wettbewerbsverzerrung durch staatliche Beihilfen zu verhindern. In Straßburg ist bereits ein Urteil gefallen. Die Straßburger Industrie- und Handelskammer darf Ryanair keine weiteren Zuschüsse zahlen.[112] Auch am belgischen Flughafen Charleroi wurde im Dezember 2002 eine formelle Untersuchung von der EU-Kommission eingeleitet und vielleicht wird auch der Flughafen Hahn demnächst von dieser unter die Lupe genommen werden.[113]
Eine ganz andere Ausgangssituation findet man am Flughafen Niederrhein, der vollständig bzw. zu 99 % privatisiert ist. „Wenn wir sagen würden, Ryanair kann bei uns umsonst landen, ist das unser Problem, aber es ist kein Bürger davon betroffen, der dafür seine Steuern zahlt.“[114], so Thomas Thielmann, kaufmännischer Leiter der Flughafen Niederrhein GmbH.
3.3.3 Trend und zukünftige Entwicklung der Subventionierung in Deutschland
„In Germany, where federal, regional and municipal levels of government are shareholders of the majority of airports, then it is inevitable that public sector finance, whether it is loans or grants will be made available to finance airport development. […] Privatisation of airports […] may to some extent allow for or encourage the use of private sector finance and lessen the dependency on public sector sources.”[115]
Trotzdem wird der öffentliche Sektor bei der Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen der kleineren, unwirtschaftlichen Flughäfen weiterhin eine wesentliche Rolle spielen. Dort sind private Unternehmen häufig nicht bereit oder nicht in der Lage die Finanzierung zu übernehmen. Die Verkehrsinfrastruktur des Flughafens ist aber lebenswichtig für die Region.[116] Schwierig wird es, wenn sich die Einzugsgebiete der Flughäfen überschneiden. Eine staatliche Unterstützung nur eines Flughafens wäre dann nicht zu rechtfertigen, weil sie den Wettbewerb zerstören und damit eine Wettbewerbsverzerrung darstellen würde.[117]
Es ist fraglich, ob Flughäfen, die sich durch Marketing-Zuschüsse in den Low-Cost-Markt eingekauft und den Airlines günstige Konditionen eingeräumt haben, von dieser Situation langfristig profitieren werden.[118] Die öffentlichen Haushalte (Länder und Gemeinden), die als Gesellschafter an vielen Flughäfen beteiligt sind, werden zudem, aufgrund der schlechten Kassenlage, nicht mehr in der Lage oder willens sein, weiterhin Gelder in die Flughäfen bzw. Low-Cost-Airlines zu investieren.[119] Die einzige Lösung in diesem Fall wäre eine noch intensivere Privatisierung der Flughäfen.
Ein weiterer Grund für eine zukünftige Abnahme der staatlichen Subventionen ist die zunehmende Kontrolle durch die EU-Kommission. Wenn die ersten Zuschüsse zurückgezahlt werden müssen, was auch jetzt schon der Fall ist, werden Low-Cost-Carrier wie Ryanair leisertreten müssen und dies führt zweifelsfrei zu Korrekturen.[120]
Grundsätzlich stellt sich die Frage, für wie lange Flughäfen überhaupt subventioniert und ab welchem Punkt die Subventionen oder Entgeltermäßigungen für Low-Cost-Airlines eingestellt werden sollten.[121] Zudem muss auch betrachtet werden, ab wann staatliche Subventionen zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. Es ist allgemein „[...] bedenklich, wenn regionale Flughäfen staatlich subventioniert werden, um Niedrigpreis-Airlines günstige Konditionen zu bieten.“[122], so Michael Kerkloh, Geschäftsführer, Flughafen München GmbH.
3.4 Konsequenzen dieser Entwicklung für die Flughäfen
„Die veränderten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für den internationalen Luftverkehr stellen an die Leistungsfähigkeit der Flughäfen als Schnittstelle zwischen Luft- und Landtransport hohe Anforderungen: Einerseits erfordern die zunehmenden Kapazitätsengpässe enorme Investitionen in die Flughafeninfrastruktur. Andererseits stehen die Flughäfen mittlerweile unter erheblichem Wettbewerbs- und Rentabilitätsdruck und müssen in der Lage sein, auf die wechselnden Anforderungen des Marktes und die Bedürfnisse ihrer Kunden kurzfristig zu reagieren. Viele Flughafenbetreiber haben sich angesichts dieser neuen Herausforderungen in den letzten Jahren von reinen Infrastrukturanbietern zu modernen Dienstleistern gewandelt, die ein breites und qualitativ hochwertiges Leistungsspektrum anbieten.“[123] Abb. 6 veranschaulicht zusammenfassend die äußeren Einflüsse auf das Flughafenmanagement.
Die Flughäfen, wie auch die Luftverkehrsbranche insgesamt, befinden sich derzeit in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Der Druck von außen und der immer größer werdende Kostendruck zwingen die Flughäfen bzw. das Flughafenmanagement weltweit zum Umdenken. Es müssen neue, innovative und kreative Geschäftsmodelle entstehen, die wertorientiert sind und nachhaltiges Wachstum in verschiedenen Geschäftsbereichen erzeugen.[124]
Abb. 6: Äußere Einflüsse auf das Flughafenmanagement
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Sulzmaier (2001), S. 4.
4 Zum Verständnis des Begriffs Geschäftsmodell – State of the Art
Das Konzept des Geschäftsmodells erhält in Theorie und Praxis immer mehr Aufmerksamkeit. Durch die Globalisierung und die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie verändert sich der Wettbewerb. Es entstehen neue Kunden- und Leistungssysteme und Branchengrenzen lösen sich auf. Damit verändert sich die Reichweite der Unternehmen und neue Kooperationen werden notwendig. Häufig kann im eigentlichen Kerngeschäft nicht mehr ausreichend Wertschöpfung erzielt werden und neue Kommerzialisierungsmodelle sind gefragt.[125]
4.1 Unterschiedliche Definitionen in der gängigen Literatur
Das Konstrukt des Geschäftsmodells wird grundsätzlich als Analyseeinheit für die unternehmerische Wertschaffung angesehen.[126] Es kann definiert werden als „Versuch, eine einfache Beschreibung der Strategie eines gewinnorientierten Unternehmens zu erzeugen, die sich dazu eignet, potenziellen Investoren die Sinnhaftigkeit ihres Engagements deutlich zu machen“[127]. Traditionelle Geschäftsmodelle sind gekennzeichnet durch relativ enge Geschäftsfeldbereiche. Dagegen zeichnen sich neue Geschäftsmodelle durch einen breiten horizontalen Geschäftsfeldbereich und eine geringe Fertigungstiefe, d. h. schmale vertikale Geschäftsfeldbereiche, aus. Dies bedeutet, dass alle Bereiche, außer den spezifischen Kernkompetenzen des Unternehmens, ausgelagert werden.[128]
Es gibt keine einheitliche Definition von „Geschäftsmodell“ in der Literatur. Die verschiedenen Ansätze unterscheiden sich im Ansatzpunkt und vor allem im Umfang der Beschreibung. Dennoch sind Gemeinsamkeiten zu erkennen. So beruhen die Ansätze von Timmers, Tomczak/Schögel/Birkhofer und Amit/Zott weitgehend auf dem Wertkettenansatz von Porter[129]. Zu Knypenhausen-Aufseß/Meinhardt und Rüegg-Stürm gehen dagegen eher vom Strategiefokus aus und Wölfle von informationstheoretischen Gesichtspunkten. Die Modelle von Nehls/Baumgartner, Wölfle und Rüegg-Stürm kann man als die umfassendsten beschreiben. Dagegen beziehen sich die Modelle von Timmers, Traecy/Wiersema oder Amit/Zott jeweils nur auf Teilbereiche einer Unternehmung.[130]
4.2 Kombination verschiedener Ansätze von Bieger
Bieger hat ein achtstufiges Geschäftsmodell als Synthese der vorgenannten Ansätze entwickelt. Ein Geschäftsmodell kann demnach vereinfacht als eine „Darstellung der Art und Weise, wie ein Unternehmen, ein Unternehmenssystem oder eine Branche am Markt Werte schafft“[131], beschrieben werden. Dabei sind Antworten auf folgende Fragen notwendig:
- Für welche Kunden welcher Nutzen? (Leistungssystem)
- Wie wird die Leistung im Markt kommunikativ verankert?
(Kommunikationskonzept)
- Wie werden Einnahmen erzielt? (Ertragskonzept)
- Welches Wachstumsmodell wird verfolgt? (Wachstumskonzept)
- Welche Kernkompetenzen sind notwendig? (Kompetenzkonfiguration)
- Welches ist die Reichweite der eigenen Unternehmung?
(Organisationsform)
- Mit welchen Kooperationspartnern wird zusammengearbeitet?
(Kooperationskonzept)
- Welches Koordinationsmodell wird angewendet?
(Koordinationskonzept).[132]
Ein Unternehmen muss, ausgehend von seinen Produkten, ein Leistungssystem schaffen, um einen spürbaren Mehrwert für die jeweilige Zielgruppe zu erzielen. Es sollte eine lang- bzw. längerfristige Kundenbeziehung entstehen. Ein Unternehmen muss ausreichend Aufmerksamkeit für seine Produkte erzeugen und ein konsequentes Kommunikationskonzept verfolgen. Zudem müssen Unternehmen ihre Erträge erhöhen. Das Ertragskonzept soll durch den Ausbau, die Integration von Nebengeschäften oder die Implementierung neuer Verrechnungsmodelle optimiert werden. Wichtig ist ferner die Sicherstellung des Unternehmenswachstums. Das Wachstumskonzept sollte berücksichtigen, in welchem Markt (eigener oder neuer Markt) und warum (durch Verkauf von Kompetenzen, durch Multiplikation, etc.) die Unternehmung wächst. Die Kompetenzkonfiguration sollte im Hinblick auf das gewählte Leistungsmodell und das Kommunikationskonzept erfolgen und die Kernkompetenzen klar herausstellen. Die Organisationsform eines Unternehmens kann anhand der Positionierung in der Wertschöpfungskette erfolgen. Dabei sollten die Transaktionsschnittstellen mit einem adäquaten Aufwand beherrschbar sein. Das Kooperationskonzept legt die Auswahl der Kooperationspartner (viele/wenige, starke/schwache) und die Dauer der Partnerschaften (befristet/unbefristet, kurz/lang) fest. Inwieweit die Partnerschaften durch den Marktmechanismus, aufgrund impliziter und expliziter Verträge oder durch Hierarchie koordiniert werden, wird im Koordinationskonzept geregelt.[133]
Ausgehend von dieser Kombination der Ansätze, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit und zur Darstellung der Geschäftsmodelle von Flughäfen intensiver auf die Wertschöpfung von Flughäfen eingegangen. Anhand der Darstellung der klassischen Wertkette von Porter werden die Wertschöpfungsstufen eines „traditionellen Flughafens“ und die Erlös- und Kostenstruktur untersucht. Dieses Geschäftsmodell eines „traditionellen Flughafens“ wird erweitert durch die zunehmende Bedeutung von Kooperationen und Beteiligungen zum Geschäftsmodell einer „Global Airport Company“. Nach einer Darstellung des speziellen Geschäftsmodells eines „Low-Cost-Airports“ werden diese drei Geschäftsmodelle anhand des Ansatzes von Bieger zusammenfassend miteinander verglichen (Vgl. Kapitel 7).
5 Geschäftsmodell eines traditionellen Flughafens unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation
Traditionelle Flughäfen sind „reine[.] Verkehrsstationen mit einem Minimum an Serviceleistungen“[134]. Sie sind für die Bereitstellung der Infrastruktur verantwortlich, vergleichbar mit einem Bahnhof.[135] Diese Infrastrukturbereitstellung erfolgt sowohl im Aviation-Bereich als auch im Non-Aviation-Bereich.[136] Das Kapitalvermögen und die Basisinfrastruktur jedes (traditionellen) Flughafens sind jedoch die Start- und Landebahn(en).[137]
Ein traditioneller Flughafen bietet alle Infrastruktureinrichtungen und Services, d. h. alle Stufen der Wertschöpfungskette, als Flughafengesellschaft selber an. Der einzige Flughafen in Deutschland, der noch als traditionell – im eigentlichen Sinn – bezeichnet werden kann, ist der Flughafen Düsseldorf. Er hat bis auf seine Cargo-Tochter noch keine Geschäftsbereiche ausgegliedert.[138]
Die wichtigsten Kunden eines traditionellen Flughafens sind die Fluggesellschaften. „Traditionally airports have viewed airlines as their primary customers partly because of the legally binding agreements between the two parties and because airlines pay a variety of charges such as landing fees and charges per passenger or tonne of freight handled.”[139] In letzter Zeit werden jedoch, aufgrund der sinkenden Einnahmen in den Bereichen Aviation und Groundhandling, sowohl Passagiere, Anwohner und Flughafenmitarbeiter, als auch lokal und weltweit agierende Unternehmen zu wichtigen Kundengruppen eines Flughafens.[140] Es kommt folglich zu Verschiebungen innerhalb der Wertkette eines Flughafens.
5.1 Wertschöpfungskette
Diese Kapitel stellt zunächst die verschiedenen Aufgaben- und Funktionsbereiche eines traditionellen Flughafens anhand der Wertschöpfungskette nach Porter dar. Anschließend wird auf die Veränderungen der Wertkette eingegangen, die sich aus den aktuellen Entwicklungen und Tendenzen am Markt ergeben.
5.1.1 Traditionelle Wertkette
Basierend auf dem Modell der Wertkette von Porter (vgl. Anhang A10), können für einen traditionellen Flughafen vier Primärfunktionen unterschieden werden: die Wegsicherungsfunktion (Geschäftsbereich Aviation), die Abfertigungsfunktion (Geschäftsbereich Groundhandling), Marketing & Vertrieb und der Geschäftsbereich Non-Aviation. Um diese Primärfunktionen zu gewährleisten, sind folgende Hilfs- bzw. unterstützende Funktionen notwendig: Unternehmensinfrastruktur, Personalwirtschaft, Technik / IT und Bereitstellung / Sicherheit. In Abb. 7 wird die Wertkette eines traditionellen Flughafens dargestellt, welche die Primär- und Hilfsfunktionen veranschaulicht, die im Folgenden näher erläutert werden.
Abb. 7: Wertkette eines „traditionellen Flughafens“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Erstellung. Grundlage: Porter (1999), S. 66 ff. Informationen aus: Doganis (1992), S. 7 ff., Pompl (2002), S. 167 ff., Schnitzler, Anhang B11, Sterzenbach/Conrady (2003), S. 129 ff. und Wulf, Anhang B13.
Da ein Flughafen ein Dienstleistungsunternehmen ist, fallen die Bereiche Ein- und Ausgangslogistik zusammen und werden durch die Wegsicherungsfunktion eines Flughafens beschrieben. Diese, und damit der Geschäftsbereich Aviation, ist das Kerngeschäft eines traditionellen Flughafens.[141] Ein Flughafen „finanziert seine Wegekosten durch Gebühren und Entgelte selbst, ist also ein in sich geschlossenes System – im Gegensatz zum Auto und der Bahn, wo der Staat durch Steuern die Kosten der Infrastruktur trägt“[142], so Walter Vill, ADV-Direktoriums-Vorsitzender. Ein Flughafen erzielt im Bereich der Wegsicherungsfunktion Einnahmen durch Start- und Lande-, Passagier- und Abstellentgelte.[143] Die Sicherheitsgebühren, die ebenfalls in diesem Bereich erhoben werden, sind nur ein durchfließender Posten, der direkt an die Bezirksregierungen weitergegeben wird.[144]
Die eigentlichen Operationen eines Flughafens werden durch die Abfertigungsfunktion, d. h. den Geschäftsbereich Groundhandling, beschrieben.[145] In diesem Bereich erzielt der Flughafen Einnahmen durch sogenannte Handlinggebühren oder Abfertigungsentgelte. Marketing & Vertrieb sind an einem traditionellen Flughafen zwar vorhanden, spielen aber nur eine unwesentliche Rolle. Die Flughäfen sind in öffentlicher Hand und als reine Infrastruktureinrichtungen nicht gezwungen, profitabel zu wirtschaften, d. h. etwaige Fehlbeträge werden von den staatlichen Gesellschaftern übernommen. Zu diesem Bereich kann der Kontakt zu Reisebüros und Reiseveranstaltern, die den Flughafen nutzen, gezählt werden.
Der Non-Aviation-Bereich dient vor allem der Bedürfnisbefriedigung der Passagiere und Besucher. Durch das Angebot verschiedener Serviceleistungen soll die Wartezeit am Flughafen für die Passagiere angenehm gestaltet werden. Neben diesen Services fallen aber auch Vermietung und Verpachtung sowie Konzessionsgeschäfte in diesen Bereich, wodurch die Flughäfen zusätzliche Einnahmen erzielen.[146]
Voraussetzung für die Erfüllung der geschilderten Primärfunktionen eines Flughafens sind eine funktionierende Unternehmensinfrastruktur und Personalwirtschaft, die als Querschnittsfunktionen in allen Bereichen benötigt werden. Als weitere Hilfsfunktion dient der Bereich Technik / IT. Hierunter fallen die Bereitstellung von Informations- und Kommunikationssystemen, Telekommunikation, etc., die eine effiziente Bürokommunikation ermöglichen. Des weiteren müssen die flugbetrieblichen Anlagen und Einrichtungen gewartet und instandgehalten werden, um den Betriebszustand der Flughäfen sicherzustellen und den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten.[147]
Da ein Flughafen ein Dienstleistungsunternehmen ist, gibt es keine Beschaffung im herkömmlichen Sinn. Es müssen jedoch in allen Bereichen der Primärfunktion Infrastrukturbereitstellung und Sicherheit gewährleistet werden. Die Flugsicherungskontrolle und staatliche Stellen wie Zoll-, Einreise, Gesundheits- und Sicherheitsdienste benötigen Flächen und Räume. Auch Fluggesellschaften müssen für ihre nicht unmittelbar flugbezogenen Aktivitäten, z. B. für Lounges oder Verwaltung, Flächen und Räume zur Verfügung gestellt bekommen. Hierdurch erzielt der Flughafen Einnahmen, ebenso wie durch Versorgungsleistungen mit Strom, Wasser, Energie, etc., für dessen Bereitstellung er verantwortlich ist. Zur Gewährleistung von Sicherheit am Flughafen muss u. a. eine Gebäudesicherung vorhanden sein, wie z. B. die Überwachung der Zugänge zu nicht-öffentlichen Bereichen. Im Fracht-, Gepäck- und Postbereich muss eine Diebstahlsicherung gewährleistet sein und für den gesamten Flughafenbereich eine Flughafenfeuerwehr bereitgestellt werden.[148]
Im folgenden Kapitel wird die beschriebene Wertkette eines Flughafens unter Berücksichtigung der veränderten Marktbedingungen weiterentwickelt.
5.1.2 Weiterentwicklung der traditionellen Wertkette
Durch die äußeren Einflüsse, die auf einen Flughafen einwirken (vgl. Abb. 6), verändert sich auch das Flughafen-Geschäftsmodell und dessen strategische Ausrichtung. „Airports are no longer passive infrastructure providers. They have developed into complex enterprises requiring business expertise and management structures.“[149]
Die Wertkette selbst hat sich von der Struktur her in den letzten Jahren nicht verändert und wird dies auch in Zukunft nicht tun. Es kommt jedoch zu Verschiebungen, d. h. einige Bereiche gewinnen enorm an Wichtigkeit, andere treten in den Hintergrund (vgl. Abb. 8).[150]
Abb. 8: Veränderung der traditionellen Flughafen-Wertkette
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Erstellung. Grundlage: Porter (1999), S. 66 ff. Informationen aus: Doganis (1992), S. 7 ff., Graham (2001), S. 9, Pompl (2002), S. 167 ff., Schnitzler, Anhang B11, Sterzenbach/Conrady (2003), S. 129 ff. und Wulf, Anhang B13.
Diese Verschiebung innerhalb der Wertschöpfungsstufen begründet sich darin, dass die Einnahmen aus dem Aviation-Geschäft zunehmend geringer werden. Die Airlines setzen die Flughäfen unter Druck und erwarten Zugeständnisse und Entgegenkommen im Hinblick auf die Flughafenentgelte, einen der größten Kostenfaktoren der Fluggesellschaften. Heutzutage kann ein Flughafen im Aviation-Bereich kaum noch Gewinne erwirtschaften, sondern muss versuchen, möglichst kostendeckend zu operieren. Einige Flughäfen erwirtschaften hier sogar nicht einmal ihre Kosten.[151]
Durch die Deregulierung der Bodenverkehrsdienste (vgl. Kapitel 3.1.2) wurde zudem im Bereich Groundhandling eine Zunahme des Wettbewerbs ausgelöst, welcher dazu führt, dass die Einnahmen hier ebenfalls zurückgehen.[152]
Die Flughäfen sind folglich gezwungen, nach anderen Bereichen zu suchen, in denen sie Gewinne erwirtschaften können. Der Finanzwirtschaft, d. h. dem finanziellen Management eines Flughafens, muss eine größere Aufmerksamkeit zukommen, vor allem im Hinblick auf eine weitere Privatisierung der Flughäfen.[153] „Value in the airport industry has increasingly flowed from traditional business design, serving traditional customers (airlines or passengers) in traditional ways, to new business design better matched to the shifting priorities of current and new customers. Airport managers today face the choice of continuing to operate as usual – something they do at their peril – or reinventing their business in a way that will generate sustainable growth.”[154]
Im Zuge dieses Wandels kommt den Bereichen außerhalb des traditionellen, luftverkehrsbezogenen Geschäfts eine immer größere Bedeutung zu.[155] Das Non-Aviation-Geschäft eines Flughafens muss aufgewertet werden, um den Rückgang der Einnahmen aus den Geschäftsbereichen Aviation und Groundhandling durch eine Zunahme der Einnahmen in diesem Geschäftsbereich zu kompensieren.[156] Ob dies wirklich möglich ist, ist fraglich und wird in Kapitel 5.2.2 näher erläutert.
Flughafen-Manager haben im Geschäftsbereich Non-Aviation einen sehr großen Gestaltungsspielraum. Neben den traditionellen Duty-Free-Läden, Restaurants und Cafés gibt es inzwischen auch Supermärkte, Geschäfte (für Textilien, Schuhe, Schmuck, Lederwaren, Erotikartikel, etc.), Friseure, Banken, Hotels, Fitness-Studios, Saunas, Kasinos, Spielhallen, Bowling-Bahnen, Diskotheken, Hundepensionen und vieles mehr.[157]
Flughäfen werden dadurch zunehmend auch für andere, neue Kundengruppen interessant. Neben den traditionellen Kunden (Airlines und Passagiere) sollen auch Anwohner, Besucher, Flughafenmitarbeiter, Airline-Crews sowie lokale und weltweit agierende Unternehmen angesprochen werden, die den Flughafen nutzen. Diese benötigen jedoch zum Teil sehr unterschiedliche Einrichtungen und Services[158], die der Flughafen zur Verfügung stellen muss. Da es keinen Durchschnittskunden gibt, auf den die verschiedenen Services und Einrichtungen zugeschnitten werden können, müssen die Flughäfen versuchen, sich stärker auf einzelne Kundengruppen, wie z. B. Geschäftsreisende, Familien mit Kindern oder Gruppenreisende, zu spezialisieren. Erst dadurch wird eine höhere Effizienz und Wirtschaftlichkeit erzielt.[159]
Neben dem Non-Aviation-Geschäft ist auch die Bedeutung des Bereichs Marketing & Vertrieb gestiegen.[160] Bedingt vor allem durch die zunehmende Privatisierung der Flughäfen und den enormen Wettbewerbsdruck, müssen Flughäfen durch Marketingaktivitäten gezielt versuchen, sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten und ihre speziellen Kompetenzen zu vermarkten. Dies können z. B. Terminal- und Sicherheitsdienstleistungen oder Groundhandling-Aktivitäten sein.[161] Auch eine Corporate Identity gewinnt zunehmend an Bedeutung, um sich im Wettbewerb mit anderen Flughäfen zu behaupten und eine Signalwirkung auf die Kunden auszuüben.[162] Durch die Entwicklung von IT-Dienstleistungen, die für die Flughafenbranche ebenso wichtig ist wie für andere Branchen, können auf diesem Gebiet zusätzlich spezielle Kompetenzen vertrieben werden.[163]
Des weiteren gewinnen Bereiche wie Kunden- und Partnermanagement, Management von Flughafenmodernisierungen und -neubauten sowie Consultingmaßnahmen (in den Gebieten konzeptionelle Planung, Projektentwicklung und Personaltraining) an Bedeutung. Gründe dafür sind die zunehmende Konkurrenzsituation unter den Flughäfen, ein immer intensiverer Wettbewerb um Kunden, sowie die vorhanden Kapazitätsengpässe an einigen Flughäfen, die neue, innovative Lösungswege erforderlich machen.[164]
Die strategische Ausrichtung von Flughäfen entlang der Wertschöpfungskette hat sich folglich verändert. Vor allem der Bereich Non-Aviation gewinnt an Bedeutung. Es müssen neue Kundengruppen berücksichtigt und kreative Lösungsmöglichkeiten gesucht werden, um dem zunehmenden Kostendruck standzuhalten.
5.2 Kosten- und Erlösstruktur
Diese Problematik des steigenden Kostendrucks und der sinkenden Einnahmen aus den Bereichen Aviation und Groundhandling werden in diesem Kapitel untersucht und anhand der Kosten- und Erlösstruktur von Flughäfen detaillierter dargestellt.
5.2.1 Kostenstruktur
Die Kostenstruktur kann von Flughafen zu Flughafen stark variieren.[165] Man kann jedoch einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten erkennen. Abb. 9 veranschaulicht die durchschnittlichen Kostenstrukturen europäischer Flughäfen in den Jahren 1983 und 1993.[166]
Die Personalkosten (staff) stellen den größten Kostenblock eines Flughafens dar. Grundsätzlich sind diese Kosten bei Flughäfen, die viele Bereiche selbst anbieten, höher als bei Flughäfen, die personalintensive Bereiche an Konzessionäre oder Fluggesellschaften ausgegliedert haben.[167]
Abb. 9: Durchschnittliche Kostenstruktur europäischer Flughäfen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an: Doganis/Lobbenberg/Graham (1995), S. 18 f.
Das zweitgrößte Kostenelement sind die Kapitalkosten (capital). Hierunter fallen zu zahlende Zinsen und Abschreibungen, d. h. Kosten, die zur Bereitstellung von Infrastruktur anfallen und über viele Jahre in der Flughafenbilanz mitgeführt werden. Hat ein Flughafen hohe Investitionen getätigt, ist auch der Anteil der Kapitalkosten hoch. In einigen Fällen kann es jedoch sein, dass Flughäfen trotz hoher Investitionen nur relativ niedrige Kapitalkosten haben, weil sie keine Abschreibungen – im eigentlichen Sinn – ausweisen. Dies ist der Fall, wenn Flughäfen für Investitionsvorhaben (staatliche) Subventionen erhalten.[168]
Alle weiteren Kostenbereiche sind weniger signifikant und machen zusammen etwa ein Drittel der Gesamtkosten aus. Hierzu zählen Material- und Sachkosten (services, equipement, supplies), Instandhaltungs- und Reparaturkosten (maintenance, repairs) und sonstige operative Kosten (other), z. B. für die Verwaltung.[169]
Die Kostenstruktur der europäischen Flughäfen hat sich 1993 im Vergleich zu 1983 nur leicht verschoben (vgl. Abb. 9). Der Anteil der Kapitalkosten an den Gesamtkosten ist gestiegen, dagegen ist der Anteil der Personalkosten gesunken. Grund dafür waren vor allem die hohen Investitionen, die viele Flughäfen in dieser Zeit getätigt haben, um mit dem starken Verkehrswachstum standhalten zu können. An manchen Flughäfen ist die Verschiebung der Kostenstruktur auch auf die Umstellung von öffentlichen auf kommerzielle, privatwirtschaftliche Strukturen zurückzuführen, die zu einem Anstieg der Kapitalkosten führte.[170]
Personal- und Kapitalkosten zusammen umfassen an vielen europäischen und deutschen Flughäfen etwa zwei Drittel der Gesamtkosten. Daran hat sich bis heute nichts geändert und es wird sich auch zukünftig nicht viel ändern.[171]
5.2.2 Erlösstruktur
Bei den Erlösen, die ein Flughafen generiert, kann grundsätzlich zwischen Erlösen aus dem Verkehrsbereich (Aviation, Groundhandling) und kommerziellen Erlösen aus dem Non-Aviation-Bereich unterschieden werden. Abb. 10 stellt die durchschnittlichen Erlösstrukturen europäischer Flughäfen in den Jahren 1983 und 1993 dar.[172]
Abb. 10: Durchschnittliche Erlösstruktur westeuropäischer Flughäfen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an: Doganis/Lobbenberg/Graham (1995), S. 15 f.
[...]
[1] Doganis (1992), S. XII.
[2] Im Verlauf der Arbeit werden die Begriffe Low-Cost- („niedrige Kosten“), No-Frills- („kein Schnickschnack“) und Low-Fare- („niedrige Preise“) Carrier oder Airline synonym verwendet. Darunter werden Linienfluggesellschaften mit einem eingeschränkten Service und niedrigen Flugpreisen verstanden. Vgl. dazu ADV Jahresbericht 1999 (2000).
[3] Vgl. Francis/Fidato/Humphreys (2003), S. 267.
[4] Die Abschriften der Expertengespräche befinden sich in Anhang B. Die Expertengespräche werden im Verlauf der Arbeit wie Literaturangaben zitiert, mit dem Verweis auf den jeweiligen Anhang.
[5] Der Begriff „Wertkette“ wird in dieser Arbeit synonym verwendet mit dem Begriff „Wertschöpfungskette“.
[6] Doganis (1992), S. 7.
[7] Vgl. ICAO Annex 14 (1999), S. 11.
[8] Vgl. LuftVG (2001), § 6.
[9] Vgl. LuftVG (2001), § 12.
[10] Vgl. Pompl (2002), S. 165 und Sterzenbach/Conrady (2003), S. 127. Allgemeine Luftfahrt oder General Aviation sind zusammenfassende Begriffe für Flüge der Privat- und Sportluftfahrt, Werksverkehr, Taxi-, Agrar- und Ausbildungsflüge. Vgl. dazu ADV Glossar (2003), o. S.
[11] Vgl. LuftVZO (2003), §§ 38, 49.
[12] Vgl. ADV Glossar (2003), o. S. und Sterzenbach/Conrady (2003), S. 127.
[13] Vgl. Sterzenbach/Conrady (2003), S. 126.
[14] Vgl. ADV Glossar (2003), o. S.
[15] Maurer (2002), S. 64.
[16] ADV Glossar (2003), o. S.
[17] Vgl. Sterzenbach/Conrady (2003), S. 127 f. Zu den internationalen Flughäfen zählen Berlin-Schönefeld, Berlin-Tegel, Berlin-Tempelhof, Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, München, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Saarbrücken und Stuttgart.
[18] Vgl. Statistisches Bundesamt (2003c), o. S.
[19] Vgl. Maurer (2002), S. 64. In Europa gibt es insgesamt nur vier Megahubs. Dies sind neben Frankfurt/Main: London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schipol.
[20] Vgl. Anhang A1 zur räumlichen Verteilung der internationalen Verkehrsflughäfen und aufkommensstärksten Regionalflughäfen in Deutschland. Zu den aufkommensstärksten Regionalflughäfen in Deutschland zählten im Jahr 2002: Altenburg-Nobitz, Augsburg, Braunschweig, Friedrichshafen, Frankfurt-Hahn, Heringsdorf, Hof-Plauen, Karlsruhe/Baden-Baden, Kiel, Lübeck, Mönchengladbach, Neubrandenburg, Paderborn/Lippstadt, Rostock-Laage, Schwerin-Parchim, Siegerland und Zweibrücken. Vgl. dazu ADV-Statistik Regionalflughäfen (2003), o. S.
[21] Vgl. Doganis (1992), S. 7, Römer, Anhang B9 oder Schnitzler, Anhang B11. Zum Teil werden nur die Bereiche „Aviation“ und „Non-Aviation“ unterschieden. „Groundhandling“ wird in diesem Fall zum Bereich „Aviation“ hinzugezählt. Vgl. dazu Honerla, Anhang B2 oder im Wolde, Anhang B3.
[22] Vgl. Doganis (1992), S. 7 ff.
[23] Vgl. Pompl (2002), S. 167 und Sterzenbach/Conrady (2003), S. 129.
[24] Vgl. Fraport AG GB 2002 (2003), S. 60, Pompl (2002), S. 167 f., Sterzenbach/Conrady (2003), S. 129 und Wulf, Anhang B13.
[25] Vgl. Kapitel 2.3 zu den verschiedenen Flughafenentgelten und -gebühren, die den Fluggesellschaften in Rechnung gestellt werden.
[26] Vgl. Doganis (1992), S. 7.
[27] Vgl. Fraport AG GB 2002 (2003), S. 60.
[28] Vgl. Doganis (1992), S. 9 und Pompl (2002), S. 168.
[29] Vgl. Pompl (2002), S. 168.
[30] Vgl. Sterzenbach/Conrady (2003), S. 142.
[31] Vgl. Doganis (1992), S. 53 f., Fraport AG GB 2002 (2003), S. 61 und Pompl (2002), S. 171.
[32] Vgl. Doganis (1992), S. 9 und 55.
[33] Vgl. Rothfischer (2003), S. 38. Gesetzliche Regelungen über Flughafenentgelte finden sich sowohl im nationalen als auch im internationalen Recht. Vgl. dazu LuftVZO (2003), § 43, Chicagoer Abkommen (1944) und Warschauer Abkommen (1955).
[34] Vgl. Rothfischer (2003), S. 39.
[35] Vgl. Rothfischer (2003), S. 39. Bis 1997 gab es zusätzlich noch ein Entgelt für die Nutzung der Gepäckbänder, das jedoch mit der Deregulierung der Bodenverkehrsdienste entfiel. Zur Deregulierung der Bodenverkehrsdienste vgl. Kapitel 3.1.2.
[36] Vgl. ACI Airport Charges (2003), S. 8, Fraport AG Flughafenentgelte (2003), S. 3 und Sterzenbach/ Conrady (2003), S. 142.
[37] Vgl. Fraport AG Flughafenentgelte (2003), S. 6 und Rothfischer (2003), S. 38.
[38] Vgl. Fraport AG Flughafenentgelte (2003), S. 6. Ein Transferfluggast ist ein Passagier, der seine Reise unterbricht und noch am gleichen Tag mit einem anderen Fluggerät weiterfliegt. Abflugort und Zielort müssen verschieden sein. Ein Transitfluggast ist ein Passagier, der seine Flugreise unterbricht und den Flug mit demselben Flugzeug, mit dem er gekommen ist, wieder fortsetzt.
[39] Vgl. ACI Airport Charges (2003), S. 8 und Sterzenbach/Conrady (2003), S. 142.
[40] Vgl. Fraport AG Flughafenentgelte (2003), S. 3 und Rothfischer (2003), S. 38 f.
[41] Vgl. Römer, Anhang B9.
[42] Vgl. Burke (2003), S. 1 f. Ein „Hub“ ist ein Flughafen, der als Drehscheibe und zentraler Verteiler unter den Flughäfen dient. Vgl. dazu ADV Glossar (2003), o. S.
[43] Vgl. Maurer (2002), S. 12. Auf die Entwicklung in den USA, die als Grundlage für die europäische Entwicklung gilt, wird nicht ausführlicher eingegangen. Einen kurzen Überblick über die Deregulierungsphasen in den USA gibt Anhang A3.
[44] Vgl. Wiezorek (1998), S. 103.
[45] Vgl. Pompl (2002), S. 411 und Jung (1999), S. 13. Detailliertere Informationen zu den jeweiligen Auswirkungen dieser Richtlinien und Verordnungen finden sich in Anhang A4.
[46] Vgl. Anhang A5 gibt einen Überblick über die acht Freiheiten der Luft.
[47] Vgl. Sterzenbach/Conrady (2003), S. 81.
[48] Vgl. Europäischer Rat (1996).
[49] Vgl. BADV (2001) und Pompl (2002), S. 442.
[50] Vgl. Maurer (2002), S. 21 und Pompl (2002), S. 442 f.
[51] Vgl. Korschinsky (2003), S. 14 und Grotrian/Ickert/Limbers/Rommerskirchen (2003), S. 43.
[52] Vgl. Statistisches Bundesamt (1999), o. S. und Statistisches Bundesamt (2002b), o. S. Die Passagier-Wachstumsraten beziehen sich ausschließlich auf die internationalen Flughäfen in Deutschland, auf welche ein Anteil von ca. 97 % am gesamten Passagieraufkommen entfällt. Vgl. hierzu Korschinsky (2003), S. 15.
[53] Vgl. Janisch (2002), S. 9 und Grotrian/Ickert/Limbers/Rommerskirchen (2003), S. 43.
[54] Vgl. Statistisches Bundesamt (2003a), o. S. und Statistisches Bundesamt (2003b), o. S.
[55] Vgl. Grotrian/Ickert/Limbers/Rommerskirchen (2003), S. 43. Diese Zahlen werden durch die Halbjahreszahlen des Statistischen Bundesamtes bestätigt. Demzufolge wachsen der innerdeutsche Verkehr um 9,3 % und der Verkehr mit dem Ausland um 0,8 %. Insgesamt beträgt die Wachstumsrate der einsteigenden Passagiere im ersten Halbjahr 2003 in Deutschland 3,4 %. Vgl. hierzu Statistisches Bundesamt (2003c), o. S.
[56] Vgl. Grotrian/Ickert/Limbers/Rommerskirchen (2003), S. 43 f. Airbus erwartet, dass sich der weltweite Passagierverkehr bis 2020 verzweieinhalbfachen wird. Vgl. hierzu Airbus (2002), S. 4.
[57] Vgl. Statistisches Bundesamt (1999), o. S., Statistisches Bundesamt (2000), o. S. und Statistisches Bundesamt (2001), o. S.
[58] Vgl. Janisch (2002), S. 9, Statistisches Bundesamt (2002a), o. S. und Statistisches Bundesamt (2003a), o. S.
[59] Vgl. Grotrian/Ickert/Limbers/Rommerskirchen (2003), S. 30 f. Airbus erwartet, dass sich der weltweite Frachtverkehr bis zum Jahr 2020 verdreifachen wird. Vgl. hierzu Airbus (2002), S. 4.
[60] Hartung (2003), S. 118.
[61] Vgl. Ryanair Unternehmensgeschichte (2003). Anhang A6 gibt einen Überblick über das Geschäftsmodell nach dem Prinzip „Low-Cost/No-Frills“ von Southwest Airlines aus den USA. Dieses wurde in Europa von vielen Fluggesellschaften kopiert – allen voran Ryanair.
[62] Vgl. Doganis (2001), S. 136 f.
[63] Vgl. Ryanair Unternehmensgeschichte (2003), o. S.
[64] Vgl. SkyEurope Firmenprofil (2003), o. S.
[65] Vgl. Special LCC (2003), S. „Intersky”.
[66] Vgl. Special LCC (2003), S. „Air Berlin” und „dba”.
[67] Vgl. Special LCC (2003), S. „Germanwings” und Germanwings Expansion (2003), o. S.
[68] Vgl. Hapag-Lloyd Express Historie (2003), o. S.
[69] Vgl. Volareweb.com ab Hahn (2003), o. S. und Volareweb.com Vision (2003), o. S.
[70] Vgl. Troendle (2003a), o. S.
[71] Vgl. Germania Express (2003), o. S. und Nobel-Sagolla/Puppel (2003), S. 20.
[72] Vgl. Korschinsky (2003), S. 14 und Mierzwiak/Vogel (2003), S. 40.
[73] Die European Cockpit Association prognostiziert einen Marktanteil von 35,7 %. Die Unternehmensberatung MorganStanley erwartet einen Anteil von 28,3 %. Mercer Management Consulting sieht bereits im Jahr 2010 einen Marktanteil von 25 % und McKinsey prognostiziert einen Anteil von 14 % im Jahr 2007. Vgl. European Cockpit Association (2002), S. 11, Borghetto/Berthelot/ Gibbons (2002), S. 16, Mercer-Studie (2002), o. S. und Binggeli/Pompeo (2002), S. 87.
[74] Vgl. Korschinsky (2003), S. 14.
[75] Vgl. Gerstlberger/Sack (2003), S. 132 und Maurer (2002), S. 21.
[76] Vgl. Maurer (2002), S. 21.
[77] BMVBW (2000), S. 47.
[78] Vgl. Air Transport Group (2002a), S. „3-2”.
[79] Vgl. ADV Jahresbericht 1999 (2000), S. 20.
[80] Vgl. Thielmann, Anhang B12 und Flughafen Niederrhein Unternehmenspräsentation (2003),
S. 13. Die Gesellschafter des Flughafens Niederrhein sind zu 99 % drei private holländische Unternehmensgruppen, eine aus dem Flughafenbereich und zwei aus dem Immobilienbereich. Der Kreis Kleve und die Gemeinde Weeze sind jeweils noch zu 0,5 % beteiligt.
[81] Vgl. Gerstlberger/Sack (2003), S. 134. Das private Investorenkonsortium des Flughafens Berlin Brandenburg International setzt sich zusammen aus dem Baukonzern Hochtief AG, der IVG Immobilen AG, den Flughafengesellschaften Wien und Fraport AG, der französischen Bank Caisse des Dépôt et Consignations, der Bankgesellschaft Berlin und der Ingenieurgesellschaft Dorsch Consult.
[82] Vgl. Gerstlberger/Sack (2003), S. 134 f.
[83] Vgl. Gerstlberger/Sack (2003), S. 135 f. Die Hochtief Airport GmbH und Aer Rianta International halten am Flughafen Hamburg 49 % der Gesellschafteranteile. Der Mehrheitsgesellschafter bleibt die Stadt Hamburg. In Düsseldorf sind die Anteile der Stadt Düsseldorf und der beiden privaten Gesellschafter jeweils 50 %. Vgl. auch Anhang A7 zur Gesellschafterstruktur.
[84] Vgl. Anhang A7.
[85] Vgl. Maurer (2002), S. 22 und ADV Jahresbericht 1999 (2000), S. 21.
[86] Vgl. ADV Jahresbericht 1999 (2000), S. 21.
[87] BMVBW (2000), S. 48.
[88] Vgl. Huckestein (2003), S. 7.
[89] Vgl. Huckestein (2003), S. 13.
[90] Huckestein (2003), S. 13.
[91] Vgl. Schlegel, Anhang B10, Müller, Anhang B7, im Wolde, Anhang B3, Jung, Anhang B4 und Landtag Rheinland-Pfalz (2002a), S. 1.
[92] Vgl. Müller, Anhang B7 und Hartmann, Anhang B1. Diese Zuschüsse werden unter der Auflage gewährt, dass der Flughafen über lange Zeiträume (25 Jahre) keinen Gewinn erwirtschaften darf.
[93] Vgl. Thielmann, Anhang B12.
[94] Vgl. Huckestein (2003), S. 13 ff., Air Transport Group (2002a), S. „5-24“, Niermann, Anhang B8 sowie Anhang A8, der einen Überblick über die Größenordnung dieser finanziellen Unterstützung durch das Land anhand ausgewählter rheinland-pfälzischer Flughäfen gibt.
[95] Vgl. Huckestein (2003), S. 13, Air Transport Group (2002a), S. „5-20“ und Landtag Rheinland-Pfalz (2002a), S. 2. Zur Gesellschafter- und Beteiligungsstruktur der deutschen Flughäfen vgl. Anhang A7.
[96] Huckestein (2003), S. 14.
[97] Vgl. im Wolde, Anhang B3, Wulf, Anhang B13 und Air Transport Group (2002a), S. „5-20”.
[98] Vgl. Hartmann, Anhang B1.
[99] Vgl. Huckestein (2003), S. 26. Es kann auch zu Situationen kommen, wie man am Beispiel Berlin-Schönefeld sehen kann, dass die Flughafengesellschaft Grundstückspreise über dem Marktwert zahlen muss. Vgl. dazu Huckestein (2003), S. 14.
[100] Vgl. Air Transport Group (2002a), S. „5-20”.
[101] Vgl. Honerla, Anhang B2, Kearsley, Anhang B5, Kunz, Anhang B6, Niermann, Anhang B8, Römer, Anhang B9, Schnitzler, Anhang B11 und Wulf, Anhang B13.
[102] Vgl. Berninger (2002), S. 32 und Anhang A6 zum Geschäftsmodell Southwest Airlines.
[103] Vgl. Wulf, Anhang B13.
[104] Vgl. Honerla, Anhang B2, im Wolde, Anhang B3 und Römer, Anhang B9.
[105] Vgl. Air Transport Group (2002a), S. „5-3”.
[106] Air Transport Group (2002a), S. „5-9”.
[107] Vgl. Flughafen Frankfurt-Hahn Flughafenentgelte (2001), S. 5. Am Flughafen Hahn werden für Passagier-Luftfahrtzeuge bis zu einem Höchstabfluggewicht (MTOW) von 90 Tonnen in der Zeit von 5:00 bis 23:00 Uhr keine Landeentgelte verlangt. Vgl. auch Anhang A2 zur Übersicht über die Landeentgelte an deutschen Flughäfen für die typischen Flugzeuge der Low-Cost-Airlines.
[108] Vgl. Kunz, Anhang B6.
[109] Vgl. Berninger (2002), S. 32.
[110] Vgl. Wulf, Anhang B13.
[111] Vgl. zum Beispiel des Flughafens Straßburg UECNA (2003), o. S. und Anhang A9.
[112] Vgl. FAZ.NET (2003), o. S. Die Subventionen der IHK beliefen sich jährlich auf 560.000 Euro. Aufgrund des Urteils hat Ryanair sich von Straßburg zurückgezogen und fliegt vom Baden Airpark.
[113] Vgl. Spaeth (2003), S. 30 und Römer, Anhang B9.
[114] Thielmann, Anhang B12.
[115] Air Transport Group (2002a), S. „5-22”.
[116] Vgl. Air Transport Group (2002a), S. „5-22”.
[117] Vgl. Air Transport Group (2002a), S. „5-22” und Hartmann, Anhang B1.
[118] Vgl. Mierzwiak/Vogel (2003), S. 40 und Air Transport Group (2002a), S. „5-33”.
[119] Vgl. Wulf, Anhang B13.
[120] Vgl. Wulf, Anhang B13.
[121] Vgl. Air Transport Group (2002a), S. „5-33“.
[122] Spaeth (2003), S. 32.
[123] ADV Jahresbericht 2000 (2001), S. 13.
[124] Vgl. Feldman/Schneiderbauer/Zea (2002), S. 5 f. und Römer, Anhang B9.
[125] Vgl. Bieger/Jäger (2001), S. 135.
[126] Vgl. Bieger/Rüegg-Stürm/von Rohr (2002), S. 35.
[127] Bieger/Bickhoff/zu Knyphausen-Aufseß (2002), S. 4.
[128] Vgl. Bieger/Jäger (2001), S. 137.
[129] Zum Wertkettenansatz vgl. Porter (1999), S. 63 ff. und das Modell einer Wertkette in Anhang A10.
[130] Vgl. Bieger/Rüegg-Stürm/von Rohr (2002), S. 46 f. Die Autoren vergleichen verschiedene Ansätze zur Definition von „Geschäftsmodell“ miteinander und geben einen Überblick über die aktuelle Entwicklung des Begriffs „Geschäftsmodell“, auf welche hier nicht näher eingegangen werden soll.
[131] Bieger/Jäger (2001), S. 144.
[132] Vgl. Bieger/Jäger (2001), S. 144.
[133] Vgl. Bieger/Rüegg-Stürm/von Rohr (2002), S. 48 ff.
[134] Pompl (2002), S. 169.
[135] Vgl. Jung, Anhang B4.
[136] Vgl. im Wolde, Anhang B3.
[137] Vgl. Hartmann, Anhang B1 und Schlegel, Anhang B10.
[138] Vgl. Thielmann, Anhang B12 und Honerla, Anhang B2.
[139] Francis/Fidato/Humphreys (2003), S. 267.
[140] Vgl. Schneiderbauer/Feldmann/Zea (2002), S. 7 und Anhang A11.
[141] Vgl. Sterzenbach/Conrady (2003), S. 129, Thielmann, Anhang B12 und Kapitel 2.2.1.
[142] Röben (2003), S. 35.
[143] Zudem gibt es weitere Entgelte, wie z. B. Lärm- und Emissionsentgelte, die hier jedoch vernachlässigt werden, da sie nur einen sehr geringen Anteil an den Einnahmen aus dem Aviation-Bereich haben. Vgl. dazu Kapitel 2.3 zu den Flughafenentgelten und -gebühren. Zu den Erlösen aus dem Aviation-Bereich vgl. Kapitel 5.2.2.
[144] Vgl. Thielmann, Anhang B12.
[145] Vgl. Kapitel 2.2.2.
[146] Vgl. Pompl (2002), S. 169 und Müller (2003), Anhang B7.
[147] Vgl. Sterzenbach/Conrady (2003), S. 130.
[148] Vgl. Pompl (2002), S. 169, Schnitzler (2003), Anhang B11 und Wulf (2003), Anhang B13.
[149] ACI Airport Charges (2003), S. 13.
[150] Vgl. im Wolde, Anhang B3, Jung, Anhang B4, Römer, Anhang B9 und Wulf, Anhang B13.
[151] Vgl. Römer, Anhang B9 und Wulf, Anhang B13.
[152] Vgl. Hartmann, Anhang B1, Römer, Anhang B9 und Wulf, Anhang B13.
[153] Vgl. Graham (2001), S. 12 und Schneiderbauer/Feldmann/Zea (2002), S. 5.
[154] Schneiderbauer/Feldmann/Zea (2002), S. 1.
[155] Vgl. ADV Jahresbereicht 2000 (2001), S. 13.
[156] Vgl. Honerla, Anhang B2, Jung, Anhang B4, Kearsley, Anhang B5, Müller, Anhang B7, Römer, Anhang B9 und Schnitzler, Anhang B11.
[157] Vgl. Sulzmaier (2001), S. 43 und Pompl (2002), S. 169.
[158] Anhang A11 gibt einen Überblick über die benötigen Einrichtungen und Services der unterschiedlichen Kundengruppen eines Flughafens.
[159] Vgl. Schneiderbauer/Feldmann/Zea (2002), S. 7 und Sulzmaier (2001), S. 32.
[160] Vgl. Graham (2001), S. 12 und Schneiderbauer/Feldmann/Zea (2002), S. 7.
[161] Vgl. Pompl (2002), S. 171.
[162] Der Flughafen Köln/Bonn präsentiert sich seit Mai 2003 beispielsweise mit einem komplett neuen Corporate Design. Vgl. Flughafen Köln/Bonn GB 2002 (2003), S. 26 f.
[163] Vgl. Pompl (2002), S. 171.
[164] Vgl. Pompl (2002), S. 171.
[165] Vgl. Doganis (1992), S. 46.
[166] Für die Analyse der durchschnittlichen Kostenstrukturen wurden 25 ausgewählte, europäische Flughäfen herangezogen. Vgl. dazu Doganis/Lobbenberg/Graham (1995), S. 20.
[167] Vgl. Doganis (1992), S. 46. Personalintensive Bereiche sind z. B. Passagier-, Gepäck- oder Frachthandling, Catering oder der eigene Betrieb von Restaurants und Geschäften.
[168] Vgl. Doganis (1992), S. 47.
[169] Vgl. Doganis (1992), S. 47 und Doganis/Lobbenberg/Graham (1995), S. 18.
[170] Vgl. Doganis/Lobbenberg/Graham (1995), S. 19.
[171] Vgl. Doganis (1992), S. 47 und Schnitzler, Anhang B11.
[172] Für die Analyse der durchschnittlichen Erlösstrukturen wurden 25 ausgewählte, europäische Flughäfen herangezogen. Vgl. dazu Doganis/Lobbenberg/Graham (1995), S. 17.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832475130
- ISBN (Paperback)
- 9783838675138
- DOI
- 10.3239/9783832475130
- Dateigröße
- 1.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Trier – Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Dezember)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- geschäftsmodell wertkette low-cost-airline luftverkehr flughafen
- Produktsicherheit
- Diplom.de