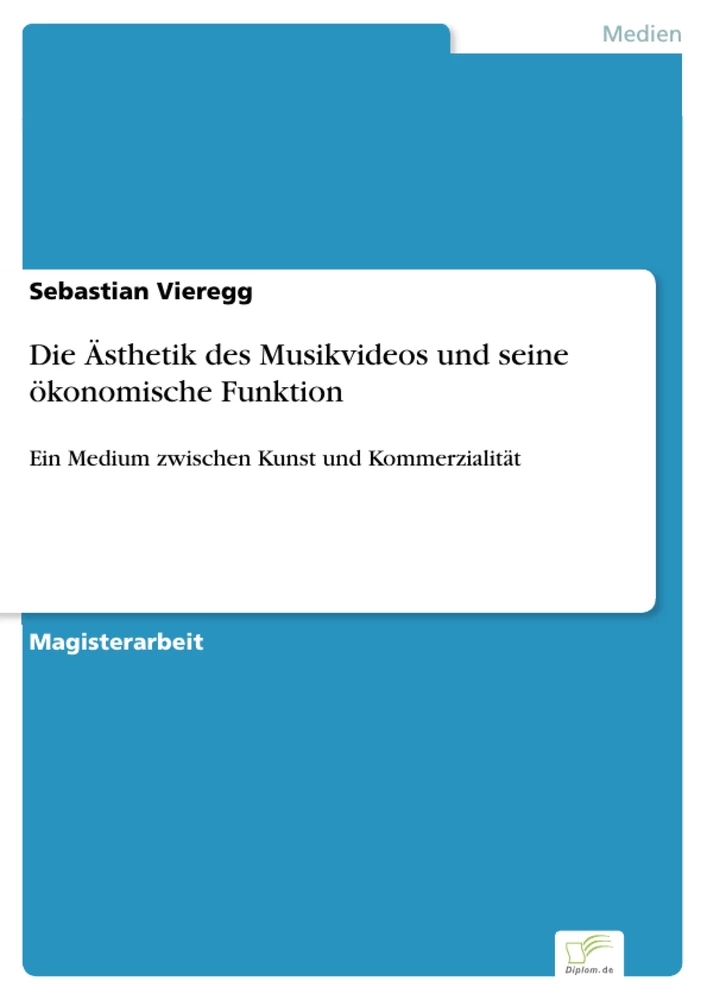Die Ästhetik des Musikvideos und seine ökonomische Funktion
Ein Medium zwischen Kunst und Kommerzialität
©2003
Magisterarbeit
125 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Musikvideos, auch Video- oder Musikclips genannt, sind zu einem immanenten Bestandteil unserer Populärkultur geworden. Bereits seit Mitte der 80er Jahre sind zahlreiche Publikationen in mehreren wissenschaftlichen Disziplinen erschienen, die sich den diversen Aspekten und Thematiken des Phänomens Musikfernsehen und seinem Inhalt, den Musikvideos, annähern. In der vorliegenden Arbeit werden zwei Themenkomplexe untersucht, die für das Verständnis und die Einordnung von Videoclips von Bedeutung sind: zum einen die Ästhetik des Musikvideos und zum anderen seine ökonomische Funktion.
Das erste Kapitel konzentriert sich auf die historischen Aspekte des Musikclips. Untersucht werden Einflussfaktoren für die Genese einer Ästhetik und der ökonomischen Funktion des Musikvideos. Die ersten Bemühungen um eine Verknüpfung von Bild und Ton, als Basis für die Entstehung des Videoclips, sind in diesem Kontext ebenso zu nennen wie die Entstehungsgeschichte des Musikfernsehens.
Da das Verständnis der Ästhetik des Musikvideos die Kenntnis um seine Ökonomie voraussetzt, widmet sich das zweite Kapitel zunächst einer Untersuchung der ökonomischen Funktion des Videoclips und damit einem speziellen Bereich der Musikwirtschaft. Dabei stehen Fragen nach den Zusammenhängen und Strukturen der Musikwirtschaft, insbesondere der Tonträgerindustrie und der Musiksender im Vordergrund. Die Musikvideosender, und somit die distributive Infrastruktur, stellen einen wichtigen Themenbereich dar, da seit der Einführung der Videoclips deren Entwicklung untrennbar mit der Geschichte der Clip-Sendungen und -sender verbunden ist. Abschließend wird die Rolle der Videoclips als Werbeträger und -instrument für unterschiedliche Interessengruppen, insbesondere für die Plattenindustrie, analysiert.
Im dritten Kapitel ist die Ästhetik von Musikvideos Gegenstand der Untersuchung. Welche grundlegenden ästhetischen Prinzipien liegen Videoclips zu Grunde, wie sind diese entstanden und in welchem Kontext können sie betrachtet werden? Eine primäre Aufgabe ist die Analyse der ästhetischen Strategien von Musikclips, um ihren Stellenwert im Kontext von Musik und audio-visuellen Medien zu verdeutlichen. Analogien zur Werbeästhetik werden hierbei ebenso untersucht wie die spezifischen ästhetischen Strategien der Videoclips im Allgemeinen. Unter ästhetischen Gesichtspunkten wird ein Klassifikationsmodell eruiert, das erlauben soll, Musikvideos nach unterschiedlichen […]
Musikvideos, auch Video- oder Musikclips genannt, sind zu einem immanenten Bestandteil unserer Populärkultur geworden. Bereits seit Mitte der 80er Jahre sind zahlreiche Publikationen in mehreren wissenschaftlichen Disziplinen erschienen, die sich den diversen Aspekten und Thematiken des Phänomens Musikfernsehen und seinem Inhalt, den Musikvideos, annähern. In der vorliegenden Arbeit werden zwei Themenkomplexe untersucht, die für das Verständnis und die Einordnung von Videoclips von Bedeutung sind: zum einen die Ästhetik des Musikvideos und zum anderen seine ökonomische Funktion.
Das erste Kapitel konzentriert sich auf die historischen Aspekte des Musikclips. Untersucht werden Einflussfaktoren für die Genese einer Ästhetik und der ökonomischen Funktion des Musikvideos. Die ersten Bemühungen um eine Verknüpfung von Bild und Ton, als Basis für die Entstehung des Videoclips, sind in diesem Kontext ebenso zu nennen wie die Entstehungsgeschichte des Musikfernsehens.
Da das Verständnis der Ästhetik des Musikvideos die Kenntnis um seine Ökonomie voraussetzt, widmet sich das zweite Kapitel zunächst einer Untersuchung der ökonomischen Funktion des Videoclips und damit einem speziellen Bereich der Musikwirtschaft. Dabei stehen Fragen nach den Zusammenhängen und Strukturen der Musikwirtschaft, insbesondere der Tonträgerindustrie und der Musiksender im Vordergrund. Die Musikvideosender, und somit die distributive Infrastruktur, stellen einen wichtigen Themenbereich dar, da seit der Einführung der Videoclips deren Entwicklung untrennbar mit der Geschichte der Clip-Sendungen und -sender verbunden ist. Abschließend wird die Rolle der Videoclips als Werbeträger und -instrument für unterschiedliche Interessengruppen, insbesondere für die Plattenindustrie, analysiert.
Im dritten Kapitel ist die Ästhetik von Musikvideos Gegenstand der Untersuchung. Welche grundlegenden ästhetischen Prinzipien liegen Videoclips zu Grunde, wie sind diese entstanden und in welchem Kontext können sie betrachtet werden? Eine primäre Aufgabe ist die Analyse der ästhetischen Strategien von Musikclips, um ihren Stellenwert im Kontext von Musik und audio-visuellen Medien zu verdeutlichen. Analogien zur Werbeästhetik werden hierbei ebenso untersucht wie die spezifischen ästhetischen Strategien der Videoclips im Allgemeinen. Unter ästhetischen Gesichtspunkten wird ein Klassifikationsmodell eruiert, das erlauben soll, Musikvideos nach unterschiedlichen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7507
Vieregg, Sebastian: Die Ästhetik des Musikvideos und seine ökonomische Funktion - Ein
Medium zwischen Kunst und Kommerzialität
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Universität Lüneburg, Universität, Magisterarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
2
Einleitung: Definitionen, Thematik und Vorgehensweise ... 4
1. Geschichte und historische Vorläufer des Musikvideos ... 10
2. Die ökonomische Funktion des Musikvideos ... 18
2.1 Strukturen der Musikwirtschaft ... 20
2.2 Produktion ... 22
2.2.1 Die Rolle der Plattenfirmen... 22
2.2.2 Die Rolle der Regisseure... 23
2.2.3 Die Rolle der Produzenten ... 24
2.3 Distribution Strukturen der Musikfernsehlandschaft ... 25
2.3.1 Die Entwicklung konzeptueller Strukturen des Musikfernsehens am
Beispiel von MTV ... 26
2.3.2 Musikfernsehen in Deutschland ... 28
2.3.3 Die Position der Musikvideosender in der Wirtschaft ... 30
2.3.3.1 MTV ... 30
2.3.3.2 VIVA... 31
2.3.4 Die Ökonomie der Musikvideosender... 33
2.3.5 Playlist und Rotation... 36
2.4 Die Marketingfunktion des Musikvideos ... 38
2.4.1 Ein Marketinginstrument der Musikwirtschaft ... 39
2.4.2 Ein Werbemedium für Konsumgüter ... 44
3. Die Ästhetik des Musikvideos ... 46
3.1 Das Klassifikationsmodell... 49
3.1.1 Klassifikation durch Darstellungsebenen... 50
3.1.1.1 Performance ... 50
3.1.1.2 Konzeptperformance... 52
3.1.1.3 Der Konzeptclip mit Interpreten ... 54
3.1.1.4 Der ,,reine" Konzeptclip ohne Interpreten... 54
3.1.1.5 Kombination der Darstellungsebenen... 55
3.1.2 Die visuelle Binnenstruktur ... 55
3.1.3 Klassifikation durch Musikstile... 57
3.2 Ästhetische Strategien ... 59
3.2.1 Strukturen der Synästhesie ... 59
3.2.2 Spezifische ästhetische Strategien der Musikstile... 62
3.2.3 Ästhetische Mittel Techniken und Effekte... 65
3.2.3.1 Musikvideoschnitt... 65
3.2.3.2 Visuelle Effekte ... 67
3.2.3.3 Mimik und Gestik ... 70
3.3 Clipästhetik Musikclips und Werbespots ... 71
3
4. Die Bedeutung des Musikvideos als kulturelle Produktion im
Spannungsfeld von Kunst und Kommerzialität... 76
4.1 Pierre Bourdieu Kulturelle Produktionen ... 78
4.1.1 Die Feldtheorie ... 78
4.1.2 Das Feld der kulturellen Produktion ... 80
4.1.3 Das Feld der kulturellen Produktion im Feld der Macht... 84
4.2 Der künstlerische Wert von Musikvideos... 86
4.2.1 Bourdieus Kriterien im Kontext der Musikvideoproduktion ... 86
4.2.2 Diskussion über den künstlerischen Wert von Musikvideos... 89
Fazit... 97
Bibliographie... 104
4
Einleitung: Definitionen, Thematik und Vorgehensweise
Musikvideos, auch Video- oder Musikclips genannt
1
, sind seit dem Jahr 1981,
als der Fernsehsender MTV mit ,,Video Killed the Radio Star" von den Buggles
2
erstmals auf Sendung ging, zu einem immanenten Bestandteil unserer Populär-
kultur geworden. Bereits seit Mitte der 80er Jahre sind zahlreiche Publikationen
in mehreren wissenschaftlichen Disziplinen erschienen, die sich den diversen
Aspekten und Thematiken des Phänomens ,,Musikfernsehen" und seinem In-
halt, den Musikvideos, annähern. Unter verschiedenen Fragestellungen und mit
unterschiedlichen Methoden beschäftigen sich Soziologie, Medienpädagogik
und -psychologie wie auch Film-, Kultur- und Musikwissenschaften mit dem
Forschungsgegenstand ,,Musikvideo", um Hypothesen und Theorien unter Zu-
hilfenahme jeweils spezifischer Betrachtungsweisen zu formulieren. Mittlerweile
ist ein distanzierter Blick auf die Strukturen und Inhalte des Musikfernsehens
möglich.
Eine einheitliche Begriffsdefinition für das Musikvideo erweist sich aufgrund der
Komplexität des untersuchten Gegenstands und der Vielzahl an unterschiedli-
chen Formen von Videoclips allerdings als schwierig.
3
Neumann-Brauns Defini-
tion besagt: ,,Videoclips sind in der Regel drei- bis fünfminütige Videofilme, in
denen ein Musikstück (Pop- und Rockmusik in allen Spielarten) von einem
Solointerpreten oder einer Gruppe in Verbindung mit unterschiedlichen
visuellen Elementen präsentiert wird."
4
Die Verbindung einer musikalisch-
auditiven und einer visuellen Komponente kann also als grundlegendes Prinzip
beschrieben werden. Die Kombination von Musik und Bild ist bei der Definition
eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, da sonst jede Form von
1
Mitunter werden auch die kurzen Formen ,,Clip" oder ,,Video" verwandt. Diese Termini werden
im Folgenden synonym verwendet.
2
Englisches Pop-Duo, bestehend aus Geoff Downes und Trevor Horn, gegründet 1978.
3
Vgl. Quandt, Thorsten (1997): Musikvideos im Alltag Jugendlicher. Umfeldanalyse und qualita-
tive Rezeptionsstudie, Wiesbaden, S. 13.
4
Neumann-Braun, Klaus (Hg.) (1999): VIVA MTV! Popmusik im Fernsehen, Frankfurt/M, S. 10.
5
visualisierter Musik als Musikvideo bezeichnet werden müsste.
5
Nach Quandt
muss eine Beschreibung so weit eingeschränkt werden, dass ,,zunächst eine
Minimaldefinition, also ein ,kleinster gemeinsamer Nenner'"
6
gefunden werden
kann. Seiner Definition zufolge ist ein Musikvideo ,,eine mit Hilfe technischer
bzw. elektronischer Mittel hergestellte vorproduzierte Verbindung von Bildern
und Musik, deren musikalische Komponente ein einzelnes Musikstück umfasst
und deren Vermittlung und Rezeption über audiovisuelle Medien abläuft"
7
. Die-
se Definition umfasst die formalen Aspekte des Videoclips, sagt aber nichts ü-
ber seine Funktion aus. Da Musikvideos bestimmte Kommunikationsziele ver-
folgen, sind sie ,,in der Regel nichts anderes als Werbefilme, sog. ,Promos', d.h.
Absatzförderer"
8
, weshalb sie im Englischen auch als ,,promotional clip"
9
oder
,,promotional video" bezeichnet werden.
10
Angesichts der Vielzahl und Komplexität der verschiedenen Ansätze und Theo-
rien, die in den vergangenen Jahren bei der wissenschaftlichen Betrachtung
des Musikvideos entstanden sind, müssen eine wissenschaftstheoretische Po-
sition und eine entsprechende Fragestellung formuliert werden. In dieser Arbeit
werden zwei Themenkomplexe untersucht, die für das Verständnis und die Ein-
ordnung von Videoclips von Bedeutung sind: zum einen die Ästhetik des Musik-
videos und zum anderen seine ökonomische Funktion. In diesem Zusammen-
hang ist auch auf die Schwierigkeiten und die Bedingungen bei der wissen-
schaftlichen Analyse des Forschungsgegenstands hinzuweisen: Da es sich bei
Musikvideos nicht um ein zeitlich-epochal abgeschlossenes Phänomen handelt,
sondern sie in einer Kontinuität kultureller, technischer und ökonomischer Ent-
wicklung stehen und somit die Strukturen oder auch die absoluten Zahlen des
Themenbereichs ständigen Umwälzungen und Veränderungen unterliegen,
5
Vgl. Quandt, Thorsten (1997): S. 13.
6
Ebd.: S. 13.
7
Ebd.: S. 13.
8
Neumann-Braun, Klaus (Hg.) (1999): S. 11.
9
Hier und im Folgenden wird das Wort ,,Promotion" entsprechend der aus dem Englischen
stammenden Wortbedeutung verwendet.
10
Da in den USA ein Großteil populärer Unterhaltungsmusik dem Bereich ,,Rock" zugerechnet
wird, findet sich in der angloamerikanischen Literatur auch oft der Terminus ,,rock video".
6
können sich Darstellungen und Rückschlüsse immer nur auf gegebene Fakten
beziehen und Aussagen nur anhand von bereits veröffentlichter Literatur getrof-
fen werden. Ein Forschungsteil ist in der vorliegenden Arbeit nicht vorgesehen.
Detaillierte Produktanalysen, also die gezielte Untersuchung der Musikvideos
bestimmter Künstler
11
, wie sie bereits vielfach angestellt wurden (vgl. Altrogge
(1990), Mercer (1999), Doderer/Neumann-Braun (1999)), sind ebenfalls nicht
Aufgabe oder Ziel dieser Arbeit. Diese Fallanalysen erweisen sich in der Regel
als wenig hilfreich, da die Vielseitigkeit in der Videoclip-Kultur eine induktive
Methode bei der Beschreibung des untersuchten Phänomens kaum zulässt.
Weiterhin werden weder rezipientenorientierte Wirkungsforschung noch psy-
chologische Studien unternommen. Gerade die Untersuchung des Konsumver-
haltens Jugendlicher in Bezug auf Videoclips und des Einflusses von sexuell-
expliziten oder gewaltkonnotierten Inhalten war schon Gegenstand zahlreicher
Publikationen, in denen im Rahmen experimenteller Untersuchungen und Empi-
rie versucht wurde, die Mediennutzung und -wirkung des Musikfernsehens beim
Publikum im Allgemeinen und bei Jugendlichen im besonderen zu erfassen
(vgl. Schorb (1988), Hansen (1990), Altrogge/Amann (1991), Hall-
Hansen/Krygowski (1994)). Dennoch kann die Frage, ,,welchen Stellenwert [...]
die Jugendlichen den Videoclips und dem Musikfernsehen einräumen [...], der-
zeit kaum spezifisch beantwortet werden"
12
, was nicht zuletzt auf Defizite im
Bereich der Rezeptionsforschung zurückzuführen ist. So haben sich vor allem
im inhaltsanalytischen Bereich Untersuchungen mehr durch willkürlich erschei-
nende Merkmalsaufzählungen als durch konzise Analysen hervorgetan.
13
Selbst jüngere Inhaltsanalysen, auch in experimentellen Studien, setzen undis-
kutiert voraus, dass die (fiktive) Masse der Rezipienten den ,,Text" identisch
liest, obwohl die angestellten Einzelfalluntersuchungen kaum repräsentativ sein
dürften. Auch die Wirkungsforschung, die u.a. den Einfluss der Bilder oder de-
11
Zugunsten einer flüssigen Lesbarkeit wird hier und im Folgenden auf die femininen Formen
der Begriffe Künstler bzw. Musiker sowie ihrer Pluralformen verzichtet.
12
Neumann-Braun, Klaus (Hg.) (1999): S. 24.
13
Vgl. Altrogge, Michael (1996
1
): Das Feld und die Theorie, Berlin, S. 4.
7
ren Präsentation auf die Akzeptanz der Musik analysiert, stößt aufgrund der
Komplexität des untersuchten Materials mit ihren stichprobenartigen Experi-
menten an ihre Grenzen und soll daher im Folgenden nicht vertieft werden (vgl.
Schank (1990)).
Um das Phänomen ,,Musikvideo" verstehen zu können, muss zunächst seine
Entwicklungsgeschichte untersucht werden, wobei Ereignisse in der Geschichte
der populären Musik ebenso wichtig sind wie die audiovisuellen Vorläufer des
Musikclips. Das erste Kapitel konzentriert sich auf deren historische Aspekte,
die für die genannten Schwerpunkte der Arbeit elementar sind. Untersucht wer-
den Einflussfaktoren für die Genese einer Ästhetik und der ökonomischen
Funktion des Musikvideos. Die ersten Bemühungen um eine Verknüpfung von
Bild und Ton, als Basis für die Entstehung des Videoclips, sind in diesem Kon-
text ebenso zu nennen wie die Entstehungsgeschichte des Musikfernsehens.
Schon weit vor dem Programmstart von MTV existierten unterschiedliche Me-
dien, die eine Synthese von Ton und Bild anstrebten, eine Voraussetzung und
Grundlage für die Ästhetik des Videoclips. Es entwickelten sich unterschiedliche
Arten von formalen und funktionalen Vorläufern der Videoclips sowie verschie-
dene Fernsehsendungen und -formate, die in ihrem Wesen Musiksendern gli-
chen und die Voraussetzungen für Musikvideos in ihrer heutigen Form schufen.
Da das Verständnis der Ästhetik des Musikvideos die Kenntnis um seine Öko-
nomie voraussetzt, widmet sich das zweite Kapitel zunächst einer Untersu-
chung der ökonomischen Funktion des Videoclips und damit einem speziellen
Bereich der Musikwirtschaft. Dabei stehen Fragen nach den Zusammenhängen
und Strukturen der Musikwirtschaft, insbesondere der Tonträgerindustrie und
der Musiksender im Vordergrund. Die Musikvideosender, und somit die distribu-
tive Infrastruktur, stellen einen wichtigen Themenbereich dar, da seit der Einfüh-
rung der Videoclips deren Entwicklung untrennbar mit der Geschichte der Clip-
Sendungen und -sender verbunden ist. Neben dem Produktionsprozess der
Musikvideos werden die Musikvideosender als funktionale und inhaltliche Ver-
mittlungsinstanz gesondert beschrieben. Abschließend wird die Rolle der Vi-
8
deoclips als Werbeträger und -instrument für unterschiedliche Interessengru-
pen, insbesondere für die Plattenindustrie
14
, analysiert.
Im dritten Kapitel ist die Ästhetik von Musikvideos Gegenstand der Untersu-
chung. Welche grundlegenden ästhetischen Prinzipien liegen Videoclips zu
Grunde, wie sind diese entstanden und in welchem Kontext können sie betrach-
tet werden? ,,Dass Videoclips Werbefilme sind, schließt nicht aus, dass in ihnen
entsprechend den jeweils zur Verfügung stehenden Ressourcen ein ästheti-
sches Ideal verwirklicht wird."
15
Eine primäre Aufgabe ist die Untersuchung der
ästhetischen Strategien von Musikclips, um ihren Stellenwert im Kontext von
Musik und audio-visuellen Medien zu verdeutlichen. Analogien zur Werbeästhe-
tik werden hierbei ebenso analysiert wie die spezifischen ästhetischen Strate-
gien der Videoclips im Allgemeinen. Unter ästhetischen Gesichtspunkten wird
ein Klassifikationsmodell eruiert, das erlauben soll, Musikvideos nach unter-
schiedlichen musikalischen, formalen und inhaltlichen Gesichtspunkten zu ka-
tegorisieren.
Im vierten Kapitel wird das Produkt ,,Videoclip" im kulturtheoretischen Kontext
betrachtet. Hierbei handelt es sich nicht um die Erforschung der postmodernen
Aspekte und Charakteristika von Musikvideos, die bereits einen wichtigen Be-
reich bei der kulturwissenschaftlichen Analyse von Videoclips kennzeichnet.
Untersuchungen dieser Art wurden vielfach angestellt und kontrovers diskutiert.
Sie sind zu umfangreich und vielfältig, als dass im Rahmen dieser Arbeit Er-
gebnisse im einzelnen dargelegt werden können (vgl. Kaplan (1987), Goodwin
(1993b), Neumann-Braun (1999)). Auch eine Betrachtung von Videoclips im
Kontext der Gender-Studies findet nicht statt (vgl. Kaplan (1987), Signorelli et
al. (1994), Neumann-Braun (1999)). Da in dieser Arbeit die ökonomische Funk-
tion der Musikclips und ihre Ästhetik untersucht wird, soll diese Ambivalenz er-
örtert und diskutiert werden. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu unter-
sucht künstlerisches Schaffen im sozialen Kontext seiner Produktion und Distri-
14
Hier und im Folgenden wird der Begriff ,,Plattenindustrie" synonym für ,,Tonträgerindustrie"
verwendet.
15
Neumann-Braun, Klaus (Hg.) (1999): S. 13.
9
bution.
16
Er versucht, den ,,künstlerischen Wert" einer kulturellen Produktion zu
erfassen und damit ihren Anspruch darauf, objektiv als Kunstwerk zu gelten.
Ihm scheint ,,die Logik der Geschwindigkeit und des Gewinns, die im Streben
nach größtmöglichem kurzfristigen Profit zum Ausdruck kommt [...], unvereinbar
mit der Idee der Kultur"
17
. Demnach muss aufgrund seiner kommerziellen Aus-
richtung der ontologische Status des Musikvideos hinsichtlich seines künstleri-
schen Werts kritisch hinterfragt werden. Die Meinungen über die begriffliche
Eingrenzung und Einordnung des Musikvideos als Kunstgattung auch im Hin-
blick auf seine Kommerzialität
18
sind vielfältig. Bódy/Weibel etwa konstatieren:
,,Avantgarde und Kommerz stehen [...] nicht mehr in einem Gegensatz zueinan-
der: Das Musikvideo stellt vielmehr einen neuen Kunsttypus dar."
19
Bódy erklärt:
,,Ursprünglich dienten die Musikvideos dazu, Produkte verkaufen zu helfen,
nämlich Schallplatten. Nun sind sie selbst das Produkt, [...]"
20
und Weibel stellt
eine ,,nicht marketingmäßig manipulierte Produktionsweise und die freie An-
wendung von Poesie und Komposition einer eigenen Bildsprache"
21
für die Pro-
duktion von Musikvideos in Aussicht.
Einen Schwerpunkt dieser Arbeit stellt die Frage nach dem künstlerischen Wert
von Musikvideos und ihrer Bedeutung als kulturelle Produktion im Spannungs-
feld von Kunst und Kommerzialität dar. Es wird untersucht, ob Videoclips als
eigenständige Ausdrucksform und somit als Kunstgattung anzuerkennen sind
oder ihnen dieser Status aufgrund ihrer ökonomischen Funktion abzusprechen
ist.
16
Vgl. Bourdieu, Pierre (1992): Die Regeln der Kunst: Genese und Struktur des Literarischen
Feldes, Paris;
Vgl. Bourdieu, Pierre (1993): The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature,
Cambridge.
17
Bourdieu, Pierre (1999): Die Überlebenschancen der Kultur, in: Tages Anzeiger, Zürich
08.12.1999, S. 65.
18
Im Folgenden wird der Begriff ,,Kommerzialität" für die Überordnung von wirtschaftlichem Inte-
resse und Gewinnstreben verwandt.
19
Bódy, Veruschka/Weibel, Peter (Hg.) (1987): Clip, Klapp, Bum. Von der visuellen Musik zum
Musikvideo, Köln, S. 7.
20
Bódy, Veruschka/Bódy, Gabor (1986): Video in Kunst und Alltag. Vom kommerziellen zum
kulturellen Videoclip, Köln, S. 25.
21
Bódy, Veruschka/Weibel, Peter (Hg.) (1987): S. 15.
10
1. Geschichte und historische Vorläufer des Musikvideos
Der Wunsch nach einer Verknüpfung von Klang und Bild bzw. der Illustration
akustischer Darbietungen wird bereits bei der Betrachtung von kostümierten
Choreographien, Chortänzen und Opernaufführungen deutlich, wie sie in Form
von musikalischen Renaissancedarbietungen als Intermezzi, Masques und
Madrigal-Komödien schon seit dem späten 16. und frühen 17. Jahrhundert üb-
lich waren. Das ,,optische Cembalo", das Mitte des 18. Jahrhunderts von Pater
Castel entwickelt wurde, übersetzte Musik von Bach, Händel und Vivaldi unter
Zuhilfenahme von Kerzenlicht und eines komplexen Spiegelsystems in optische
Muster, eine Kreation, die in den nachfolgenden 200 Jahren viele Komponisten
und Erfinder (Aleksandr Skjabin (18721915), Alexander Burnett Hector (1866
1958), Mary Hallock Greenewalt (18741950)) zur Entwicklung ähnlicher ,,Farb-
orgeln" inspirierte, mit denen sie eine Abstimmung von Bild und Ton anstreb-
ten.
22
Als eine der künstlerisch-ästhetischen Wurzeln des Musikvideos ist die so
genannte ,,visuelle Musik" zu nennen, bei der visuelle Gestaltung und Musik als
dynamische Kunstform kombiniert wurden. Durch das Prinzip der ,,Synästhe-
sie", der Interaktion zwischen Ton und Bild, soll eine Wirkung erzielt werden, die
ohne diese Kombination nicht zu erreichen ist.
23
Das Spiel mit Farbe, Klang und
Licht hat sich im Bereich der ,,Klangkunst"
24
im 20. Jahrhundert zu einem eigen-
ständigen Zweig künstlerischen Schaffens entwickelt.
25
Der eigentliche Ursprung des Musikvideos liegt bei den ersten Verknüpfungen
des Tons und dem Medium ,,Film". Seit 1895 wurden Stummfilme, wie die der
Brüder Lumière oder Georges Méliès, musikalisch begleitet. Im Jahr 1915 wur-
de D.W. Griffiths ,,The Birth of a Nation" mit Orchesterbegleitung am Broadway
uraufgeführt: der erste Film, für den eigens eine Filmmusik komponiert worden
war. Der erste abendfüllende Spielfilm mit synchronem Ton, der auch Musik
22
Vgl. Ebd.: S. 20 ff.
23
Vgl. Weibel, Peter (1987a): Von der visuellen Musik zum Musikvideo, in: Bódy, Verusch-
ka/Weibel, Peter (Hg.): S. 110 ff.
24
Vgl. Ebd.: S. 53 ff.
25
Für eine weiterführende Beschreibung der ,,Musiker der Synästhesie" und der ,,opto-
phonetischen Maschinen" siehe: Bódy, Veruschka/Weibel, Peter (Hg.) (1987): S. 56 ff.
11
beinhaltete, war ,,The Jazz Singer" (1927) von Jean Crosland und den Warner
Brothers. Bereits in den 20er und 30er Jahren entstanden abstrakte Filme, in
denen Musik durch Farben und Formen nach ästhetischen Gesichtspunkten als
,,optische Musik" umgesetzt werden sollte. Die bekanntesten dieser Künstler
waren Walter Ruttmann, Viking Eggeling und Oskar Fischinger. Im Jahr 1921
begann Fischinger mit der Produktion abstrakter Filme, die synchron zu Jazz
und klassischer Musik geschnitten waren. Diese Arbeiten waren bereits darauf
angelegt, für die entsprechenden Platten zu werben und hatten somit eine öko-
nomische Funktion. Fischinger kooperierte auch mit Walt Disney für den Musik-
film ,,Fantasia" (1940), bei dem er die Animationsbewegungen in der Bach-
Sequenz ,,Toccata und Fuge" auf die Musik abstimmte. Murphy Dudley, ,,ein
Pionier der abstrakten Montage"
26
, entwickelte in den frühen 40er Jahren zehn
Tonfilme, die als Prototypen der Ästhetik späterer Videoclips bezeichnet werden
können: Sänger und Bands wirkten in ihnen bei einer szenischen Dramaturgie
mit, die sich synchron zum Rhythmus der Musik entwickelte.
27
Erheblichen Ein-
fluss auf die Art der Visualisierung der späteren Videoclips hatte ,,wegen seiner
alogischen Montage von unzusammenhängenden Einstellungen, wegen seiner
extremen Kamerawechsel von oben und unten, wegen seines schnellen
Rhythmus'"
28
auch der französische Avantgardefilm der 20er Jahre (vor allem
,,Entr'acte" (1924)): ,,Die meisten aller formalen Innovationen dieser Filme sind
als Effekte in die Ästhetik und Geschichte des Musikvideos eingegangen."
29
In den 30er und 40er Jahren entstand das Hollywood-Musical, das der filmi-
schen Umsetzung von Musik gepaart mit Tanz und Schauspielerei den Eingang
in die Populärkultur ebnete. Das Film-Musical beeinflusste das Musikvideo so-
wohl hinsichtlich seiner Ästhetik als auch seiner funktionalen Ausrichtung: Die
Visualisierung orientierte sich an Liedtexten, der Musik und der Person des
Künstlers. Intention des Musicals war es, Werbung für seine Protagonisten zu
26
Moritz, William (1994): Bilder-Recycling. Die Wurzeln von MTV im Experimentalfilm, in: Haus-
heer, Cecilia/Schönholzer, Annette (Hg.): Visueller Sound: Musikvideos zwischen Avantgarde
und Populärkultur, Luzern, S. 30.
27
Vgl. Ebd.: S. 32.
28
Weibel, Peter (1987a): S. 80 f.
29
Ebd.: S. 81.
12
betreiben: ,,[...] the function of videos is not just to represent performers, but to
sell them, as Hollywood sold its own singing stars in musicals."
30
Der wohl be-
kannteste Choreograph und Regisseur von Hollywood-Musicals, Busby Berke-
ley, wird häufig als einer der Väter des Musikvideos genannt.
31
In ,,The Gold
Diggers of 1935" (1935) beispielsweise setzte er bewegliche Kameras, Trickef-
fekte und Hunderte von Tänzern ein, um mit den visuellen Mitteln heutiger Vi-
deoclips abstrakte, halb narrative Tanzaufführungen zu schaffen.
32
In den spä-
ten 40er Jahren wurde in den USA das ,,Panoram Soundie", eine visuelle Juke-
box, eingeführt. Diese Maschinen, die über einen Schwarz-Weiß-Bildschirm
simple Visualisierungen einzelner Songs vermittelten, wurden, aufgestellt im
öffentlichen Raum, von Künstlern zur Distribution ihrer Musik genutzt. Nach ei-
ner Phase großer Popularität wurde das ,,Panoram Soundie" in den frühen 50er
Jahren ebenso wie seine französische Weiterentwicklung, das ,,Scopitone", das
Farbfilme zeigen konnte, wieder aus dem Verkehr gezogen und geriet schnell in
Vergessenheit.
33
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Entwicklung von Videoclips waren Musik-
filme. Nach dem großen Erfolg von Richard Brooks' ,,Blackboard Jungle" (1955),
der mit dem Erfolgshit ,,Rock around the Clock" von Bill Haley and the Comets
eröffnete und endete und in dem erstmals ,,jugendliche Rebellion" thematisiert
wurde, begann in Hollywood die Produktion einer Vielzahl der so genannten
,,Jukebox Musicals".
Mehrere Sänger und Bands, u.a. Chuck Berry, Little Ri-
chard und Fats Domino spielten Hauptrollen in Filmen wie ,,Rock around the
Clock", ,,Don't Knock the Rock", ,,Let's Rock" und ,,Rock, Rock, Rock" Hauptrol-
len.
34
Elvis Presleys ,,Jailhouse Rock" (1957) beeinflusste im Gegensatz zu den
meisten dieser ,,Rock-Musicals", insbesondere durch seine Tanzszene zum Ti-
telsong, die Ästhetik heutiger Musikvideos.
30
Zit. n.: Quandt, Thorsten (1997): S. 119.
31
Vgl. Quandt, Thorsten (1997): S. 40 f.
32
Vgl. Moritz, William (1993): Visuelle Musik: Höhlenmalereien für MTV? in: Deutsches Filmmu-
seum Frankfurt (Hg.): Sound &Vision - Musikvideo und Filmkunst. Schriftenreihe des deut-
schen Filmmuseums, Frankfurt/M., S.137.
33
Vgl. Shore, Michael (1985): The Rolling Stone Book of Rock Video, New York, S. 21 f.
34
Vgl. Ebd. S. 41.
13
In den 60er und 70er Jahren entstanden mehrere Musikfilme, die das Bild von
Videoclips erheblich beeinflussten. Der erste wirklich populäre Film dieser Art
war Richard Lesters ,,A Hard Day's Night" (1964), der nicht nur die Beatles bei
Auftritten in Szene setze und portraitierte, sondern auch filmtechnische Ästheti-
ken wie ,,Jump Cuts" verwendete, die von französischen Filmemachern der
,,Novelle Vague" entwickelt worden waren und heute eine gängige Form der
Montage in Musikclips darstellen. Es folgten Stephen Binders ,,The T.A.M.I.
Show" (1965), die erste ,,Rockumentary"
35
, Michael Wadleighs ,,Woodstock"
(1970), Ken Russells ,,Tommy" (1975) und Alan Parkers ,,Pink Floyd: The Wall"
(1982). ,,Woodstock" steht für eine ganze Reihe von Konzertfilmen, die in einer
dokumentarischen Form Auftritte von Musikern in Verbindung mit der entspre-
chenden Bildästhetik zeigen. Viele der heutigen Performance-Videos
36
unterscheiden sich in ihrer Visualität nicht grundlegend von den ,,Woodstock"-
Aufnahmen.
37
Adrian Lynnes ,,Flashdance" (1983), eine Adaption von John
Badhams gleichermaßen erfolgreichem ,,Saturday Night Fever" (1977), hatte
nach Aussage des Regisseurs stilistisch und visuell bereits viele Elemente aus
dem Repertoire des gerade initiierten Musikfernsehens aufgenommen.
38
Ab den späten 40er Jahren traten Musiker in speziellen Sendungen live im
Fernsehen auf. Einige der bekanntesten Shows dieses Formats waren: ,,Paul
Whiteman's TV Teen Club" (19491954), ,,Face the Music" (19481949), ,,Your
Hit Parade" (19501959), ,,The Peter Potter Show" (19531954), ,,Upbeat"
(1955) und ,,The Big Record" (19571958).
39
Erst einige Jahre später setzte
sich das Playback als gängige Praxis in den entsprechenden Sendungen durch.
In ,,American Bandstand", erstmals ausgestrahlt 1952 auf WFIL in Philadelphia,
benotete ein jugendliches Studiopublikum die populärsten Platten der Woche;
zusätzlich traten pro Folge zwei Gruppen zu Playbacks auf. In den späten 50er
Jahren entstanden in England äquivalente Fernsehformate: ,,Top of the Pops"
35
Shore, Michael (1985): S. 44.
36
Vgl. Kapitel 3.1.1.
37
Vgl. Quandt, Thorsten (1997): S. 45 f.
38
Vgl. Shore, Michael (1985): S. 50.
39
Vgl. Ebd. S. 23.
14
richtete seine Auswahl der Lieder nach den ,,Top Thirty" der englischen Charts.
Es folgten weitere Musikendungen in den USA (,,Shinding!" (1964)) und ,,Hulla-
baloo" (1965)) und England (,,Ready Steady Go!" (1963)).
Angesichts der Vielzahl an Musiksendungen und dem hieraus resultierenden
wachsenden Distributionspotential begannen viele Musikgruppen, eigene Pro-
motion-Filme (,,Promos") zu produzieren, die ausgestrahlt wurden, wenn die
Künstler nicht persönlich auftreten konnten, ein Konzept, das sich insbesondere
in England durchsetzte. Die meisten dieser Filme, in denen die Gruppen in der
Regel beim Live-Auftritt und anfangs nur selten außerhalb der Bühne gezeigt
wurden, entstanden mit minimalem Kostenaufwand und meist ohne professio-
nelle Regie. Auch diejenigen Musikliebhaber, die nicht in der Lage waren, Kon-
zerte zu besuchen, sollten zumindest durch das Fernsehen einen visuellen Ein-
druck von bestimmten Musikgruppen bekommen und so als potentielle Ziel-
gruppe erschlossen werden. Diese Vorgehensweise verhalf insbesondere
Künstlern, die bewusst visuelle Effekte einsetzten, wie etwa Alice Cooper, zu
vermehrter Popularität.
40
Um über eine Gruppe oder einen Interpreten zu infor-
mieren und sie beim Live-Auftritt zu sehen, wurden in den 70er Jahren außer-
dem vermehrt ,,Demo"-Filme gedreht, die in der Regel nicht für die massenme-
diale Vorführung hergestellt, sondern zu Präsentationszwecken in den internen
Besprechungen der Plattenfirmen, so genannten ,,Company Conventions", vor-
gestellt wurden. Ken Waltz, der von 1972 bis 1974 selbst ,,Demo"-Filme gedreht
hat, misst ihnen eine zentrale Bedeutung für die Entstehung der Musikvideos
bei: ,,I could be wrong, but I consider those the beginning of rock video."
41
1975 erschien der Videoclip ,,Bohemian Rhapsody" der Gruppe Queen unter
der Regie von Bruce Gowers. Ein großer Teil der Autoren stimmt darin überein,
dass es sich um das allererste Musikvideo nach heutigem Verständnis der Me-
dienform handelt. Im Gegensatz zu den meisten vorproduzierten Filmen für Mu-
siksendungen wie ,,Top of the Pops", in denen die Künstler noch immer fast
40
Vgl. Kapitel 2.4.
41
Shore (1985): S. 49.
15
ausschließlich in persona erschienen, enthielt ,,Bohemian Rhapsody", das für
nur 7.000 US-$ produziert worden war, eine Mischung aus Live-Auftritten und
(technisch relativ primitiven) Special Effects wie Blenden und visuellen Echos:
eine neue Ästhetik, die sich schnell als erfolgreich erweisen sollte. ,,Bohemian
Rhapsody" ist ein frühes Beispiel für einen Song, der nach Ausstrahlung seines
Musikvideos in den Charts ganz nach oben schnellte und als Konsequenz
enorme Plattenverkäufe verzeichnen konnte. Gower führte auch bei dem Video
für ,,Robbery, Assault and Battery" von Genesis Regie, in dem weder Gesang
noch Gitarrenspiel gezeigt, sondern die Geschichte eines Banküberfalls darge-
stellt wird: eines der ersten narrativen Konzeptvideos.
42
Besonders in Großbri-
tannien entstand durch psychedelische Bands wie Pink Floyd, Genesis oder
Yes, die theatralische Elemente und umfangreiche Lichteffekte in ihre Bühnen-
shows integrierten, ein neues Verständnis von der Verbindung des Hörens und
Sehens.
In den 70er Jahren schaffte die Verbreitung des Kabelfernsehens in den USA
die Voraussetzung für eine Reihe weiterer Musikprogramme, die sich zum Teil
auf bestimmte Musikstile spezialisierten. Gegen Ende des Jahrzehnts ging die
amerikanische Plattenindustrie trotz der Platin-Erfolge einzelner Bands wie
Rush, Foreigner, Journey oder Kansas durch eine Depression. Die Umsätze
der verkauften Tonträger fielen in den USA von 726,2 Millionen im Jahr 1978
auf 575,6 Millionen US-$ im Jahr 1982, die Bruttoeinnahmen sanken im glei-
chen Zeitraum von 4,31 Mrd. auf 3,59 Mrd. US-$.
43
Die Musikindustrie benötigte
effektivere Formen der Produktwerbung. Darüber hinaus führte der Umstand,
dass die amerikanischen Radiosender bereits eingehend marktanalysiert und
demographisch untersucht worden waren, zur Anpassung vieler Bands an die
Hörgewohnheiten weißer Jugendlicher, die als die größte Zielgruppe der Plat-
tenindustrie ausgemacht worden waren. Tatsächlich gab es jedoch viele poten-
tielle Konsumenten aus unterschiedlichen Gruppen und Schichten, die von den
Künstlern über das Radio, das seine Bandbreite an Musikstilen stark ein-
42
Vgl. Kapitel 3.
43
Vgl. Schmidt, Axel: Sound and Vision Go MTV: Die Geschichte des Musiksenders bis heute,
in: Neumann-Braun, Klaus (Hg.) (1999): S. 98.
16
schränkte, nicht mehr erreicht wurden. Auch der Konzertauftritt, selbst ein Pro-
motioninstrument und Mittel zur Selbstdarstellung, war nunmehr selten möglich,
da Tourneen zu Zeiten der finanziellen Misere nur noch den Gruppen ermög-
licht wurden, bei denen der Erfolg garantiert war.
44
Ob als Substitut für Konzert-
tourneen oder als Supplement in der Vermarktungsstrategie eines Künstlers,
Videos wurden verstärkt als ein Medium erkannt, das Musikern die Gelegenheit
eröffnete, kosteneffizient Millionen von potentiellen Konsumenten zu erreichen.
Die Verbreitung dieser ersten Musikvideos war in Europa und vor allem in Aust-
ralien, wo nur in seltenen Fällen amerikanische Musikgruppen auf Tournee gin-
gen, weiter fortgeschritten als in den USA. Auch in Deutschland existierten mit
,,Beat Club" (ab 1965) und ,,Formel Eins" (ab 1982) Sendungen, in denen Vi-
deoclips präsentiert wurden. In den achtziger Jahren stellte dies weitgehend die
einzige Möglichkeit dar, internationale Musikvideos im deutschen Fernsehen zu
empfangen. Zuvor beschränkte sich die optische Begleitung der Populärkultur
auf Kunstfilme oder Dokumentationen über Musik (wie etwa ,,Woodstock" oder
,,Tommy"). Ende der 70er Jahre wurden Video-Tanzclubs wie der New Yorker
Rockclub ,,Hurrah", in dem Musikvideos als Hintergrundbegleitung ausgestrahlt
wurden, sehr populär. Bald begannen viele Bands, bei ihren Konzerten hinter
der Bühne Live-Videos oder vorproduzierte Clips zu präsentieren.
Am 1. August 1981 begann MTV mit dem Song ,,Video Killed the Radio Star"
von den Buggles den Sendebetrieb: ein 24-stündig sendendes visuelles Radio,
das zunächst von nur 4 Millionen Haushalten empfangen werden konnte. Der
Sender verfügte anfangs über ein Budget von 20 Millionen US-$ und war von
Beginn an ein werbeorientiertes Unternehmen. Die Tonträgerindustrie blieb zu-
nächst abwartend, war doch nicht absehbar, welche positiven oder negativen
Impulse MTV auf den Markt ausüben würde.
Das Programm von MTV besteht bis heute vorwiegend aus Videoclips, die von
der Musikindustrie zu Werbezwecken kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
Viele Plattenfirmen (Plattenlabels) vermehrten die Produktion von Musikvideos
44
Vgl. Shore, Michael (1985): S. 71 f.
17
erheblich, als ihnen MTV eine neue Plattform offerierte: Wurden in Europa be-
reits in den 80er Jahren etwa 20 Musikvideos im Monat produziert, sind es heu-
te ca. 2.000.
45
Als Konsequenz des neuen Senders wurden die Stücke vieler
Gruppen, die früher ausgegrenzt waren, auch im Radio gesendet, was sich po-
sitiv auf deren Plattenverkäufe auswirkte. Duran Duran, eine Band, die in Euro-
pa bereits sehr populär war, konnte in den USA dort gesteigerte Plattenverkäu-
fe verzeichnen, wo MTV besonders verbreitet war. EMI entschied sich als ers-
tes Plattenunternehmen, aus Gründen des Marketings eine größere Summe
(200.000 US-$) zur Verfügung zu stellen, um mit Duran Duran für drei ihrer Lie-
der Videos zu produzieren. Zwei von ihnen gelangten innerhalb kurzer Zeit in
die ,,Top Ten" der US-Charts, so dass sich die Investition schnell amortisierte.
46
Am 1. August 1983 wurde MTV erstmals in New York und Los Angeles ausge-
strahlt und erreichte nunmehr 14 Millionen Haushalte. Die Qualität und Quanti-
tät der Musikvideos sowie die investierten Summen begannen, sich noch
schneller zu steigern. Erst im Jahr 1987 entstand mit MTV Europe ein europäi-
scher und 1993 mit VIVA ein deutscher Musikkanal. Die meisten Plattenlabels
sichern ihren Musikern heute vertraglich ein bestimmtes Kontingent an Video-
produktionen zu. Das Musikvideo ist in ihrer Vermarktungsstrategie zu einem
tragenden Element geworden.
45
Vgl. Gehr, Herbert (1993a): The Gift of Sound & Vision, in: Deutsches Filmmuseum Frankfurt
(Hg.): Sound & Vision - Musikvideo und Filmkunst. Schriftenreihe des deutschen Filmmuse-
ums, Frankfurt/M., S. 8.
46
Vgl. Shore, Michael (1985): S. 73.
18
2. Die ökonomische Funktion des Musikvideos
Ein Musikvideo knüpft an die Idee der Live-Performance von Popmusik bzw.
ihrer prinzipiellen Aufführbarkeit an, wobei der Auftritt des Künstlers zu Werbe-
zwecken inszeniert und stilisiert wird. Die Inszenierung des Künstlers ist Auftritt
und Werbung zugleich. Damit ist eine Waren- und zugleich eine Werbeform ge-
schaffen, die das Produkt ,,Popmusik" nicht nur erweitert, sondern auch in höhe-
rem Maße manipulierbar, reproduzierbar und distribuierbar macht. Im Vergleich
zu Tourneen stellt der Videoclip eine kostengünstige, globale und
durch das Fernsehen weitreichende Form der Promotion dar.
Das folgende Kapitel widmet sich einer Untersuchung der ökonomischen Funk-
tion des Musikvideos und damit einem speziellen Bereich der Musikwirtschaft.
Dabei steht die Darstellung der Zusammenhänge und Strukturen der Musikwirt-
schaft, insbesondere der Tonträgerindustrie und der Musiksender, im Vorder-
grund, da diese die ,,Ökonomie des Musikvideos" besser verstehen lassen: ,,[...]
The major record companies and program services dominate the video music
business."
47
Musikvideos können als Phänomen nicht isoliert betrachtet werden.
Sie sind im Rahmen eines Kreislaufs Teil einer Struktur
48
, deren Organisationen
im Bereich der Produktion und Distribution ein Austausch zwischen verschiede-
nen Gruppen und Parteien zu Grunde liegt, dessen komplizierte wechselseitige
Vorgänge nicht vollständig erfasst werden können, da pauschalisierende Mo-
delle nicht der Komplexität und Individualität Rechnung tragen können. Auf der
Basis grundlegender, größerer Systeme in Form von Organisationen im Bereich
der Musikwirtschaft und der Musikvideosender ist es jedoch möglich, Aussagen
über Zusammenhänge zu treffen.
Der Einfluss der Plattenindustrie auf die Musikvideos ist weitreichend. Die gro-
ßen Plattenfirmen haben heute in der Regel spezielle Abteilungen, die sich mit
der Koordination von Musikvideoproduktionen befassen. Finanziell aufwändige
47
Banks, Jack (1996): Monopoly Television. MTV's Quest to Control the Music, Boulder/Oxford,
S. 195.
48
Vgl. Quandt, Thorsten (1997): S. 22 ff.
19
Tonträger- und Videoclipproduktionen können meist nur von wirtschaftlich po-
tenten, international agierenden Unternehmen getragen werden und sind nicht
selten erst durch das Geschäft auf den großen Musikmärkten wie den USA, Ja-
pan, Deutschland oder England refinanzierbar. Angesichts der Kostenintensivi-
tät der Videoclips ist das industrielle Interesse an einem mitbestimmenden Ein-
fluss bei der Musikvideoproduktion nachvollziehbar. Auch wenn renommierten
Regisseuren und Produzenten in Einzelfällen gewisse Freiheiten bei der künst-
lerischen Gestaltung eingeräumt werden, liegt die Entscheidungsgewalt durch
die Möglichkeit der ökonomischen Steuerung bei der Musikindustrie, deren Ein-
fluss über die Produktion hinausgeht. Am deutschen Sender VIVA sind Konzer-
ne der Musikwirtschaft und Videoproduktionsfirmen sogar finanziell beteiligt,
wodurch eine Bevorzugung bestimmter Videos anzunehmen ist. Diese Verflech-
tungen gilt es, genauer zu untersuchen.
49
Historisch konnte nachgewiesen werden, dass schon in den Anfängen der au-
diovisuellen Kommunikation mittels bildlicher Darstellung für Musik geworben
wurde, was in den folgenden Jahrzehnten professionalisiert und institutionali-
siert wurde. Dabei wurde festgestellt, dass Musikclips in ihrer Funktion Werbe-
mittel sind und das Musikvideo zu einem essentiellen Element im ,,Marketing-
Mix"
50
der Plattenindustrie geworden ist: ,,Music video has since become an in-
dispensable means of promotion for recording artists, who are expected to have
accompanying videos for their songs in order to become successful."
51
Die Mu-
siksender als private Fernsehanstalten, die ihren Fokus auf bestimmte Ziel-
gruppen richten, dienen als Werbeplattform für verschiedene Interessengrup-
pen und Parteien, die es zu identifizieren und zu analysieren gilt.
49
Vgl. Kapitel 2.3.3.
50
Der Begriff ,,Marketing-Mix" hat sich in der Wirtschaftsliteratur für das absatzpolitische Instru-
mentarium einer gewinnorientiert wirtschaftenden Institution durchgesetzt. Dieses beinhaltet
nach Wöhe u.a. die Kommunikationspolitik, die sich aus den Bereichen Werbung, Verkaufs-
förderung und Öffentlichkeitsarbeit zusammensetzt. Diese Definition wird hier und im Folgen-
den auf den Begriff Marketing(funktion) angewandt (vgl. Wöhe, Günter: Einführung in die All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre, München 2002, S. 501 f.).
51
Banks, Jack (1996): S. 1.
20
Im Folgenden werden zunächst die Konzerne der Musikwirtschaft näher be-
trachtet, um anschließend die Funktion des Musikvideos als Marketinginstru-
ment eingehend analysieren zu können.
2.1 Strukturen der Musikwirtschaft
Das globale Musikgeschäft wird von einigen wenigen Medien- und Musikkon-
zernen kontrolliert. Die Verkaufszahlen für Tonträger und die damit verbunde-
nen Einnahmen bewegen sich jährlich im mehrfachen Milliardenbereich. Allein
die amerikanische Plattenindustrie, die durch die ,,Recording Industry Associati-
on of America" (RIAA) repräsentiert wird, erwirtschaftete im ersten
Geschäftshalbjahr des Jahres 2002 einen Gewinn von ca. 5,2 Mrd. US-$.
52
Die weltweiten Umsätze verteilen sich auf eine Vielzahl von Unternehmen, wo-
bei fünf Konzerne den globalen Markt mehrheitlich unter sich aufteilen und
mehr als 2/3 des Weltumsatzes mit bespielten Tonträgern erreichen.
53
Diese
sogenannten ,,Majors" sind:
·
die Warner Music Group, Teil des weltweit größten Medienunternehmens
Time-Warner,
·
BMG (Bertelsmann Music Group), die Musik-Abteilung von Bertelsmann,
des zweitgrößten Medienkonzerns weltweit,
·
Sony Music, bzw. CBS, dem japanischen Konzern Sony angeschlossen,
der an fünfter Stelle der weltweit größten Medienkonzerne liegt,
·
Polygram, der niederländischen Unternehmensgruppe Philips zugehörig,
·
EMI Music, Teil des britischen Thorn-EMI-Konzerns.
Daneben existieren noch weitere international agierende Labels, die zwar oft
als ,,Independents" bezeichnet werden, aber nicht ,,unabhängig" von finanziellen
Großkonzernen funktionieren. Hier sind u.a. Geffen/MCA zu nennen, die 1990
von dem japanischen Matushita aufgekauft wurden, sowie Virgin Records, das
mittlerweile zu EMI gehört. Traditionell sind die Independents stärker an der
52
Vgl. Black, Jane (2003): Big Music's Broken Record, in: Business Week Online, 13.02.2003,
http://yahoo.businessweek.com/technology/content/feb2003/tc20030213_9095_tc078.htm
(03.08.03).
53
Vgl. Quandt, Thorsten (1997): S. 82.
21
Einführung neuer Musikstile und Künstler beteiligt als die Majors: ,,[...] indepen-
dents develop new forms of music [and] the majors tame them."
54
Der weltweite Musikmarkt wird mehr und mehr konzentriert. Erfolgreich agie-
rende Labels werden von größeren Unternehmen, meist den in der Musikwirt-
schaft gut positionierten Majors, aufgekauft. Diese Konzentrationsvorgänge ge-
schehen auf horizontaler Ebene (bei der Zusammenfassung gleichartiger Me-
dien), auf vertikaler Ebene (bei der Zusammenfassung hintereinander stehen-
der Produktions- und Vermarktungsstufen, wie im Fall der Verlagsgesellschaf-
ten Chapel und SBK durch Warner bzw. EMI oder auch im Fall des Senders
VIVA, bei dem große Plattenfirmen beteiligt sind) sowie auf diagonaler Ebene
(beim Einstieg medienfremder Konzerne in die Musikwirtschaft). Es ist eine
Tendenz zu Zusammenschlüssen immer größerer Unternehmensstrukturen un-
terschiedlicher Sektoren feststellbar. Medienvermittelte Musik ist vorwiegend
industriell kontrolliert, eine Konstellation, die sich seit dem Beginn der techni-
schen Reproduzierbarkeit und damit der massenhaften Vermarktung immer
stärker ausgeprägt hat. Jede erfolgreiche musikalische Neuentwicklung, sei es
Rock, Punk oder HipHop, weckt das Interesse industrieller Vermarktung. Um
der wachsenden Spezialisierung und Differenzierung populärer Musikstile und
deren Zielgruppen gerecht zu werden, vereinigen die großen Konzerne mehrere
auf einzelne Musikstile spezialisierte Labels unter einem Dach.
Der deutsche Musikmarkt
Deutschland hat in Europa, dem weltweit umsatzstärksten Musikmarkt, eine
Spitzenposition bei den Tonträgerverkäufen: Im Jahr 1997 belief sich der Um-
satz von Tonträgern auf 4,91 Mrd. DM.
55
Für internationale Medienkonzerne ist
die Bundesrepublik daher ein interessanter und lukrativer Handelsplatz. Da der
Anteil an nationalen Veröffentlichungen nur 30% gegenüber 70% internationaler
54
Zit. n.: Banks, Jack (1998): Video in the Machine. The Incorporation of Music Video into the
Recording Industry, in: Popular Music 16, 3, S. 305.
55
Vgl. Hachmeister, Lutz/Lingemann, Jan (1999): Das Gefühl VIVA. Deutsches Musikfernsehen
und die neue Sozialdemokratie, in: Neumann-Braun, Klaus (Hg.): VIVA MTV! Popmusik im
Fernsehen, Frankfurt/M., S. 139.
22
Titel beträgt,
56
haben international produzierte Produkte gute wirtschaftliche
Chancen. 80% des Marktes werden daher von den genannten global agieren-
den Majors erwirtschaftet. Deren Gesamtanteil am deutschen Tonträgerhandel
liegt sogar über dem weltweiten Vergleich. Die Gründe hierfür sind vielfältig.
Insbesondere der Einfluss angloamerikanischer Musik während der Besat-
zungszeit wird in diesem Zusammenhang oft angeführt. Seit mehreren Jahren
wird eine Diskussion über eine gesetzlich vorgeschriebene Mindestquotierung
für deutschsprachige Musik in den Medien nach französischem Vorbild geführt,
die bisher in der Praxis keine Auswirkungen hat.
2.2 Produktion
An der Produktion eines Videoclips ist meist eine Vielzahl unterschiedlicher
Personengruppen beteiligt. Somit sind Musikvideos das Resultat der Kooperati-
on mehrerer Instanzen des Produktionsbereichs. Dabei muss die Musik, selbst
ein eigenständiges Produkt aus der Zusammenarbeit mehrerer Beteiligter, als
Basis für das Video ebenso bedacht werden wie die eigentliche Clipproduktion.
Zunächst sind daher die Musiker und Interpreten zu nennen, die nicht mit den
Komponisten der entsprechenden Lieder identisch sein müssen. Da die Musik
der Videos in der Regel mit Einsatz von technischen Mitteln in einem Studio
produziert und aufgenommen wird, geht in den musikalischen Teil auch die Ar-
beit der Tontechniker und Produzenten ein, die nicht unwesentlich den Charak-
ter eines Musikstücks bestimmen können.
2.2.1 Die Rolle der Plattenfirmen
Die Finanzierung von Studioproduktionen geschieht nur selten durch die Musi-
ker selbst, sondern wird in fast allen Fällen professioneller Studioarbeit, sowohl
im Fall der großen Majors als auch bei den kleineren Labels, von der Platten-
firma getragen. Diese koordiniert nicht nur die Herstellung des Tonträgers, un-
ternimmt PR-Maßnahmen und organisiert den Vertrieb, sondern ist in den meis-
ten Fällen maßgeblich bei der Auswahl von Regisseur und Produzent (auch
56
Diese Angaben beziehen sich auf das Jahr 1992 (vgl. Quandt, Thorsten (1997): S. 86).
23
Producer genannt) des Musikvideos beteiligt. Da die Labels außerdem teilweise
oder vollständig die Produktion der Videoclips finanzieren,
57
ist der Einfluss der
Plattenindustrie auf die Herstellung von Musikvideos weitreichend: ,,The labels
greatly influence the content of music videos."
58
Auch die direkte Gestaltung der
Videos ist von den Labels beeinflusst, zumal bestimmte Genres von populärer
Musik meist mit spezifischen Darstellungen und einer eng begrenzten Bildspra-
che einhergehen.
59
Auf diese Weise nehmen Plattenfirmen direkten Einfluss auf
das Erscheinungsbild einer Band oder eines Musikers, um ein Image als
Markenprodukt zu prägen.
2.2.2 Die Rolle der Regisseure
Die selbständigen oder mit Produktionsfirmen assoziierten Regisseure erhalten
Zeitverträge, in denen sie sich verpflichten, innerhalb eines bestimmten, oft
knapp bemessenen Zeitraums und Budgets ein Video zu produzieren. Die Plat-
tenfirmen machen hierbei inhaltlich und konzeptuell auf die jeweiligen Künstler
abgestimmte Auflagen. Die Regisseure von Videoclips erhalten bis auf wenige
Ausnahmen mit 10% des Budgets eine vergleichsweise geringe Bezahlung und
haben bisher nur begrenzten Einfluss auf Inhalt und Ablauf der Produktion.
60
Sie bleiben in der Regel unbekannt, sieht man von einigen Hollywood-
Regisseuren ab, die sich in diesem Bereich betätigt haben.
61
Dieser Umstand
wird von Seiten der Plattenfirmen meist gefördert, da hierdurch die Kreativleis-
tung des Videos dem Interpreten zugeschrieben wird und weitere Aufmerksam-
keit auf ihn lenkt. Dennoch bestimmt der Regisseur zu weiten Teilen den visuel-
len Gehalt des Endprodukts: ,,If anything, rock video is a director's medium."
62
In den letzten Jahren begannen die Plattenfirmen teilweise damit, die Namen
bekannter Regisseure bewusst in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, um den
57
Vgl. S. 17 f.
58
Banks, Jack (1996): S. 195.
59
Vgl. Kapitel 3.2.2.
60
Vgl. Schmidt, Axel (1999): S. 120.
61
Für das Video von Michael Jacksons ,,Bad" aus dem Jahr 1987 wurde zum Beispiel Holly-
wood-Starregisseur Martin Scorsese verpflichtet.
62
Shore, Michael (1985): S. 97.
24
künstlerischen Anspruch eines Musikers bzw. einer Band hervorzuheben. Der
Einfluss des Regisseurs auf den Ablauf der Produktion sowie Inhalt und
Ästhetik des Videos steht somit in ursächlichem Zusammenhang mit dem Grad
seiner Bekanntheit: ,,Record company executives severely limit the creative
freedom of producers and directors by providing strong direction about the con-
tent of music videos, although certain established directors infrequently have
more creative latitude."
63
2.2.3 Die Rolle der Produzenten
Die meisten Produktionen werden von Unternehmen ausgeführt, die sich auf
die Herstellung von Musikvideos spezialisiert haben. Einige dieser Firmen sind
unabhängig und arbeiten für verschiedene Labels, während andere Produkti-
onsfirmen Teil einer Plattenfirma sind und ausschließlich für diese produzieren.
Der Produzent übernimmt alle wirtschaftlichen Aufgaben einer Produktion. Das
beinhaltet auch die Bezahlung der Crew, die Anschaffung der Ausstattung und
der Kostüme. Die Produzenten sind außerdem an die Zeit- und Finanzrahmen
der Plattenfirmen gebunden und darüber hinaus der Auftragsvergabepraxis der
dominanten Labels unterworfen: Im Verfahren des so genannten ,,Fixed-
Biddings" schreiben Plattenfirmen Aufträge für Clipproduktionen aus und warten
auf Angebote der Produktionsfirmen.
64
Die Produktionsfirmen müssen als un-
bezahlte Vorleistung kreative Konzepte entwickeln und an die Labels herantra-
gen, die diese annehmen oder ablehnen können, ohne dafür eine Aufwands-
entschädigung zu entrichten. Clipregisseur Jon Roseman sagt hierzu: ,,[...] pro-
duction companies often submit a script for a video solicited by a label and hear
nothing from the record company until we see it on TV and there's an idea we
submitted."
65
Die Plattenfirmen bedienen sich also aus dem Pool der professio-
nell erarbeiteten Ideen, um sie als Ganzes oder in Teilen an anderer Stelle kos-
tengünstiger zu produzieren oder für andere Produktionen zu verwenden. In
den 90er Jahren gab es auf Seiten der Produktionsfirmen einen Konzentrati-
onsschub, bei dem die Tochterfirmen großer Medienkonglomerate kleinere Fir-
63
Banks, Jack (1996): S. 195.
64
Vgl. Schmidt, Axel (1999): S. 120.
65
Zit. n. Ebd.: S. 120.
25
men aufkauften. Infolgedessen wurde ihre Zusammenarbeit mit den Plattenfir-
men zunehmend enger. Der Hauptteil der Aufträge wurde an die großen Pro-
duktionsfirmen vergeben, die im Verbund mit global agierenden Mediengigan-
ten genügend Finanzkraft hatten, um die Bedingungen der Labels zu erfüllen.
66
2.3 Distribution Strukturen der Musikfernsehlandschaft
Neben dem Produktionssektor ist die Distributionsebene eine Voraussetzung
für die Musikvideos in ihrer bestehenden Form. Sie wird vornehmlich durch die
Musik(video)sender definiert, da sie als Vermittlungsinstanz die Clips verbrei-
ten. Die Entwicklung der Musikvideos ist seit ihrer Einführung untrennbar mit
der Geschichte des Musikfernsehens verbunden. Ihm kann eine weitreichende
Rolle im ökonomischen Bereich der Musikwirtschaft beigemessen werden. Zu
nennen sind zunächst MTV und in Deutschland auch VIVA, aber auch bestimm-
te Musiksendungen, wie die inzwischen eingestellte ARD-Clipshow ,,Formel
Eins". In diesem Kapitel sollen skizzenhaft die Entwicklung und die Struktur der
Musikfernsehlandschaft beschrieben werden, um die Bedeutung der Clipkanäle
für die ökonomische Funktion der Videoclips zu erläutern. Dabei muss MTV, der
als erster und weltweit führender Sender eine besondere Position einnimmt und
maßgeblich die Entwicklung heutiger Programmformate bestimmt hat, beson-
ders herausgestellt werden. Ausführliche Arbeiten zur Geschichte des Musik-
senders MTV sowie Analysen, die sich den technologischen und medienöko-
nomischen Zusammenhängen der Musik- und Fernsehindustrie widmen, wur-
den bereits publiziert (vgl. Denisoff (1988), Banks (1996), Schmidt (1999)).
Neben den Musikkanälen existieren auch andere Formen der Distribution, die
den kommerziellen Aspekt verdeutlichen: So werden Clips an Orten des Kon-
sums oder der Gastronomie eingesetzt, um als Dekoration auf einen bestimm-
ten ,,Lifestyle" zu verweisen.
67
Ferner muss auch die Möglichkeit der Distribution
via Internet erwähnt werden, die allerdings bisher kaum kommerziell genutzt
wird. Musik und auch Musikvideos werden dabei durch so genannte ,,File-
66
Vgl. Ebd.: S. 121.
67
Vgl. Quandt, Thorsten (1997): S. 33.
26
Sharing-Programme" meist unter Nichtbeachtung vertriebs- und urheberrechtli-
cher Ansprüche im Internet getauscht, nur selten finden sich Angebote für das
gebührenpflichtige Herunterladen. Letztere Methode verspricht jedoch, in den
nächsten Jahren mehr an Einfluss zu gewinnen.
2.3.1 Die Entwicklung konzeptueller Strukturen des Musikfernsehens am
Beispiel von MTV
Im amerikanischen Kabelfernsehen hatten sich nach anfänglicher Skepsis über
die Fernsehtauglichkeit von Musik
68
bereits Vorläufer des Musikfernsehens
etabliert.
69
Insbesondere die Sendungen ,,America's Top Ten" mit dem populä-
ren Radio-DJ Casey Casem und ,,Popclips" zeigten bereits einige konzeptuelle
Merkmale von MTV: ,,Popclips was basically MTV before there was MTV."
70
Der
Impuls, den Musiksender MTV zu initiieren, dessen technische Realisierung von
einer auf Kabel- und Satellitenprogramme spezialisierten Tochterfirma des
Warner-Amex-Konzerns übernommen wurde, kam weniger von Seiten der Mu-
sik- als vielmehr aus der Fernsehindustrie.
Die Inspiration für die konzeptuellen Strukturen von MTV lieferte jedoch ein an-
deres Medium: ,,Unumstrittenes Vorbild für MTV war [...] keine andere Sendung,
sondern ein anderes Massenmedium, nämlich das Radio."
71
Der Musikvideo-
sender sollte Eigenschaften des Radios mit denen des Fernsehens verbinden.
MTV zeigte bereits bei Programmstart viele konzeptuelle Parallelen zum Radio,
etwa eine Playlist, nach deren Vorgabe Titel mit verschiedener Häufigkeit mehr-
fach täglich wiederholt wurden, einen Programmfluss ohne erkennbar abge-
grenzte Sendungen (,,Flow")
72
sowie das Konzept der VJs (der Videojockeys,
auch Veejays genannt) und der ,,light" und ,,heavy Rotation" (vereinzelte bzw.
häufige Wiederholung). Da MTV von Beginn an auf eine klar definierte haupt-
sächlich jugendliche Zielgruppe abzielte (,,Narrowcasting"), war der Sender für
68
Vgl. Kopf, Biba (1987): ,,If it moves, they'll watch it". Popvideos in London 1978-1987, in:
Bódy, Veruschka/Weibel, Peter (Hg.) (1987): S. 196.
69
Vgl. Kapitel 1.
70
Shore, Michael (1985): S. 76.
71
Quandt, Thorsten (1997): S. 56.
72
Vgl. Ebd.: S. 57.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832475079
- ISBN (Paperback)
- 9783838675077
- DOI
- 10.3239/9783832475079
- Dateigröße
- 730 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Leuphana Universität Lüneburg – Angewandte Kulturwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Dezember)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- plattenindustrie werbeästhetik pierre bourdieu videoclip
- Produktsicherheit
- Diplom.de