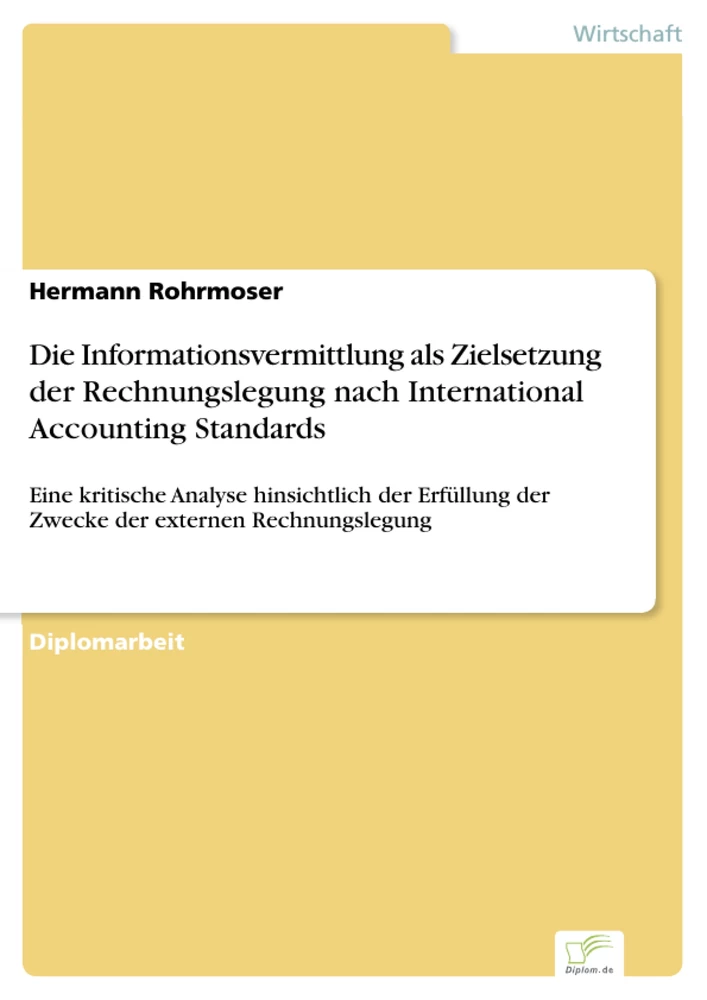Die Informationsvermittlung als Zielsetzung der Rechnungslegung nach International Accounting Standards
Eine kritische Analyse hinsichtlich der Erfüllung der Zwecke der externen Rechnungslegung
©2003
Diplomarbeit
90 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Globalisierung der Kapitalmärkte und die dadurch ausgelöste verstärkte Orientierung der Unternehmen an den Kapitalmarkterfordernissen haben dazu geführt, daß immer mehr deutsche Unternehmen ihren Konzernabschluß auf Basis von IAS oder US-GAAP erstellen. Durch eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2002 werden alle kapitalmarktorientierten Unternehmen verpflichtet ab 2005 ihre Konzernabschlüsse nach IAS aufzustellen. Außerdem stellt diese Verordnung den Mitgliedstaaten frei, vorzuschreiben oder zu gestatten, daß diese Gesellschaften auch ihre Einzelabschlüsse sowie andere Gesellschaften ihre Konzern- und Einzelabschlüsse nach den IAS aufstellen. Die IAS gewinnen daher bei der Diskussion um die Harmonisierung der Rechnungslegung immer mehr an Bedeutung.
Die Intensität, mit der die vom IASC entwickelten Rechnungslegungsregeln in Deutschland zur Zeit diskutiert werden, ist darauf zurückzuführen, daß sie erheblich von den noch geltenden handelsrechtlichen Regeln abweichen. Der einzige vom IASC angestrebte Jahresabschlußzweck ist es, die Investoren mit entscheidungsnützlichen Informationen zu versorgen. In der Literatur wird teilweise die Meinung vertreten, daß die IAS (und auch die US-GAAP) besonders geeignet sind, global agierende Anleger mit entscheidungsrelevanten, zuverlässigen und vergleichbaren Unternehmensinformationen für fundierte Investitionsentscheidungen zu versorgen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu untersuchen, ob diese angestrebte Informationsleistung von einer IAS-Bilanz tatsächlich erbracht werden kann. Ein synoptischer Vergleich verschiedener Rechnungslegungssysteme, bspw. des deutschen HGB mit den IAS, ist dabei wenig hilfreich, weil die Zielsetzungen beider Systeme nicht übereinstimmen. Vielmehr gilt es zu analysieren, welche Bilanzierungsregeln die Zielsetzung der Informationsvermittlung erfüllen und welche ihr zuwiderlaufen. Letztlich müßte man alle Ansatz-, Bewertungs-, Gliederungs- und Ausweisregeln im Detail untersuchen. Eine solche umfassende Analyse würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die Analyse beschränkt sich daher auf ausgewählte Ansatz- und Bewertungsregeln hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit.
In den IAS wird nicht zwischen Einzel- und Konzernabschlüssen unterschieden; die Regelungen gelten für beide Arten von Jahresabschlüssen gleichermaßen (IAS 1.2). Es gibt nur ganz wenige Standards, in denen auf Regeln in Einzel- und Konzernabschlüssen Bezug genommen wird. In der vorliegenden […]
Die Globalisierung der Kapitalmärkte und die dadurch ausgelöste verstärkte Orientierung der Unternehmen an den Kapitalmarkterfordernissen haben dazu geführt, daß immer mehr deutsche Unternehmen ihren Konzernabschluß auf Basis von IAS oder US-GAAP erstellen. Durch eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2002 werden alle kapitalmarktorientierten Unternehmen verpflichtet ab 2005 ihre Konzernabschlüsse nach IAS aufzustellen. Außerdem stellt diese Verordnung den Mitgliedstaaten frei, vorzuschreiben oder zu gestatten, daß diese Gesellschaften auch ihre Einzelabschlüsse sowie andere Gesellschaften ihre Konzern- und Einzelabschlüsse nach den IAS aufstellen. Die IAS gewinnen daher bei der Diskussion um die Harmonisierung der Rechnungslegung immer mehr an Bedeutung.
Die Intensität, mit der die vom IASC entwickelten Rechnungslegungsregeln in Deutschland zur Zeit diskutiert werden, ist darauf zurückzuführen, daß sie erheblich von den noch geltenden handelsrechtlichen Regeln abweichen. Der einzige vom IASC angestrebte Jahresabschlußzweck ist es, die Investoren mit entscheidungsnützlichen Informationen zu versorgen. In der Literatur wird teilweise die Meinung vertreten, daß die IAS (und auch die US-GAAP) besonders geeignet sind, global agierende Anleger mit entscheidungsrelevanten, zuverlässigen und vergleichbaren Unternehmensinformationen für fundierte Investitionsentscheidungen zu versorgen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu untersuchen, ob diese angestrebte Informationsleistung von einer IAS-Bilanz tatsächlich erbracht werden kann. Ein synoptischer Vergleich verschiedener Rechnungslegungssysteme, bspw. des deutschen HGB mit den IAS, ist dabei wenig hilfreich, weil die Zielsetzungen beider Systeme nicht übereinstimmen. Vielmehr gilt es zu analysieren, welche Bilanzierungsregeln die Zielsetzung der Informationsvermittlung erfüllen und welche ihr zuwiderlaufen. Letztlich müßte man alle Ansatz-, Bewertungs-, Gliederungs- und Ausweisregeln im Detail untersuchen. Eine solche umfassende Analyse würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die Analyse beschränkt sich daher auf ausgewählte Ansatz- und Bewertungsregeln hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit.
In den IAS wird nicht zwischen Einzel- und Konzernabschlüssen unterschieden; die Regelungen gelten für beide Arten von Jahresabschlüssen gleichermaßen (IAS 1.2). Es gibt nur ganz wenige Standards, in denen auf Regeln in Einzel- und Konzernabschlüssen Bezug genommen wird. In der vorliegenden […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7504
Rohrmoser, Hermann: Die Informationsvermittlung als Zielsetzung der Rechnungslegung
nach International Accounting Standards - Eine kritische Analyse hinsichtlich der
Erfüllung der Zwecke der externen Rechnungslegung
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: FernUniversität - Gesamthochschule Hagen, Universität - Gesamthochschule,
Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
I
Inhaltsverzeichnis
Seite
Abbildungsverzeichnis ... IV
Tabellenverzeichnis ... IV
Abkürzungsverzeichnis ... V
1 Einleitung ...1
1.1 Problemstellung
und Themeneingrenzung ...1
1.2 Gang
der
Untersuchung...2
2 Grundlagen informationsorientierter Rechnungslegung...3
2.1 Externe
Rechnungslegung...3
2.1.1 Definition ...3
2.1.2 Adressaten externer Rechnungslegung und ihre
Interessen ...3
2.1.3 Zwecke
externer Rechnungslegung...5
2.2 Entscheidungstheoretische Grundlagen ...5
2.2.1 Das
Entscheidungsproblem bei Risiko...5
2.2.2 Rechnungslegung und Entscheidungsprobleme ...6
2.3 Problematisierung
der
Informationsfunktion...7
3 Grundlagen der Informationsvermittlung nach IAS...8
3.1 Vermittlung entscheidungsnützlicher Informationen als
einziger Zweck ...8
3.2 Bestandteile
des
Jahresabschlusses ...9
3.3 Kriterien für eine entscheidungsnützliche Informations-
vermittlung nach Framework bzw. IAS 1...9
3.3.1 Überblick ...9
3.3.2 Grundlegende
Annahmen ...10
3.3.3 Qualitative Anforderungen an den Abschluß...11
3.3.4 Einschränkende Merkmale...14
3.3.5 Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechenden Bildes...14
3.4 Entscheidungsrelevante Informationen als
Analysekriterium ...15
II
4 Ansatz und Bewertung ausgewählter Bilanzpositionen ...16
4.1 Sachanlagevermögen ...16
4.1.1 Begriffsbestimmung ...16
4.1.2 Bilanzansatz...17
4.1.3 Bewertung ...18
4.1.3.1 Erstmalige Bewertung...18
4.1.3.2 Folgebewertung ...19
4.1.3.2.1 Grundsatz ...19
4.1.3.2.2 Planmäßige Abschreibung ...22
4.1.3.2.3 Niederstwerttest ...23
4.1.3.3 Bewertung
von
Investment Property...26
4.2 Immaterielles
Anlagevermögen...27
4.2.1 Definition ...27
4.2.2 Bilanzansatz...28
4.2.2.1 Überblick...28
4.2.2.2 Erworbene
immaterielle
Anlagegüter ...28
4.2.2.3 Selbsterstellte
immaterielle Anlagegüter 31
4.2.2.4 Firmenwert...33
4.2.3 Bewertung ...33
4.2.3.1 Erstmalige Bewertung...33
4.2.3.2 Folgebewertung ...34
4.2.3.3 Abschreibungen...36
4.3 Vorratsvermögen ...37
4.3.1 Bewertung bei "normaler" Vorratsfertigung ...37
4.3.1.1 Klassifizierung
und
Bewertungsgrundsätze ...37
4.3.1.2 Anwendung des Niederstwertprinzips...39
4.3.2 Bewertung
bei
langfristiger Fertigung...40
4.3.2.1 Anwendungsbereich ...40
4.3.2.2 Gewinnrealisierung ...42
4.3.2.2.1 Gewinnrealisierung nach dem
Fertigstellungsgrad ...42
4.3.2.2.2 Ertragsrealisierung im Ausmaß
der erzielbaren Kosten...45
III
4.4 Finanzinstrumente ...46
4.4.1 Definitionen
und
Kategorisierung ...46
4.4.2 Bilanzansatz und Bewertung...47
5 Analyse der Informationsvermittlungsfunktion der
Rechnungslegung ...50
5.1 Analyse des Zweckes und der Grundsätze der
Rechnungslegung ...50
5.1.1 Zum Zweck der Rechnungslegung...50
5.1.2 Zu den Grundsätzen der Rechnungslegung...51
5.2 Analyse der Aktivierungskonzeption ...53
5.3 Analyse der Bewertungskonzeption...55
5.3.1 Bewertung mit den (fortgeführten)
Anschaffungskosten...55
5.3.2 Bewertung
mit
dem Fair Value ...57
5.3.3 Bewertung
mit
dem
erzielbaren Betrag ...61
5.4 Analyse ausgewählter Ansatz- und Bewertungsregeln ...62
5.4.1 Langfristige
Auftragsfertigung ...62
5.4.2 Wahlrechte ...64
6 Zusammenfassung
der Ergebnisse ...65
Literaturverzeichnis ...68
Verzeichnis verwendeter Gesetze, Standards und Verordnungen...81
Eidesstattliche Erklärung...82
IV
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Rechnungslegungsgrundsätze nach IAS...10
Abb. 2: Bilanzansatzentscheidung im IAS-Abschluß ...18
Abb. 3: Verbuchung von Neubewertungen in IAS-Abschlüssen ...21
Abb. 4: Impairment Test nach IAS 36 ...24
Abb. 5: Bilanzierung immaterieller Werte ...28
Abb. 6: Folgebewertung von aktiven Finanzinstrumenten...48
Abb. 7: Folgebewertung von passiven Finanzinstrumenten...49
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Anschaffungskosten von Vorräten ...38
Tab. 2: Bestandteile von Herstellungskosten ...39
Tab. 3: Gewinnrealisierung bei langfristiger Auftragsfertigung...63
V
Abkürzungsverzeichnis
Abb. ... Abbildung
AdEG ... Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
BB ... Betriebs-Berater (Zeitschrift)
BFuP ... Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (Zeit-
schrift)
BGBl. ... Bundesgesetzblatt
Bil-Komm. ... Bilanzkommentar
bspw. ... beispielsweise
bzw. ... beziehungsweise
DAX ... Deutscher Aktienindex
Dr. ... Doktor
DStR ... Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
EG ... Europäische Gemeinschaft
et al. ... et alii
etc. ... et cetera
EU ... Europäische Union
f. ... folgend
F. ... Framework
FB ... Finanz Betrieb (Zeitschrift)
F.+ E. ... Forschung und Entwicklung
GoB ... Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GuV ... Gewinn- und Verlustrechnung
h. c. ... honoris causa
HGB ... Handelsgesetzbuch
hrsg. ... herausgegeben
Hrsg. ... Herausgeber
IAS ... International Accounting Standards
IASC ... International Accounting Standards Committee
IASCF ... International Accounting Standards Committee
Foundation
i.d.R. ... in der Regel
IFRS ... International Financial Reporting Standards
i.V.m. ... in Verbindung mit
VI
KoR ... Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung (Zeit-
schrift)
MDAX ... Mid Cap DAX
m. E. ... meines Erachtens
Mio. ... Million(en)
Nr. ... Nummer
Prof. ... Professor
RGBl. ... Reichsgesetzblatt
S. ... Seite(n)
sog. ... sogenannte(n)
Tab. ... Tabelle
Tz. ... Textziffer
u.a. ... und andere
URL ... Uniform Resource Locator
US-GAAP ... United States Generally Accepted Accounting
Principles
vgl. ... vergleiche
WiSt ... Wirtschaftswissenschaftliches Studium (Zeitschrift)
WPg ... Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift)
z.B. ... zum Beispiel
ZfB ... Zeitschrift für Betriebswirtschaft
1
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Themeneingrenzung
Die Globalisierung der Kapitalmärkte und die dadurch ausgelöste
verstärkte Orientierung der Unternehmen an den Kapitalmarkterfor-
dernissen haben dazu geführt, daß immer mehr deutsche Unterneh-
men ihren Konzernabschluß auf Basis von IAS
1
oder US-GAAP er-
stellen.
2
Durch eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2002 werden alle
kapitalmarktorientierten Unternehmen verpflichtet ab 2005 ihre
Konzernabschlüsse nach IAS aufzustellen.
3
Außerdem stellt diese
Verordnung den Mitgliedstaaten frei, vorzuschreiben oder zu gestat-
ten, daß diese Gesellschaften auch ihre Einzelabschlüsse sowie
andere Gesellschaften ihre Konzern- und Einzelabschlüsse nach den
IAS aufstellen. Die IAS gewinnen daher bei der Diskussion um die
Harmonisierung der Rechnungslegung immer mehr an Bedeutung.
Die Intensität, mit der die vom IASC entwickelten Rechnungsle-
gungsregeln in Deutschland zur Zeit diskutiert werden
4
, ist darauf
zurückzuführen, daß sie erheblich von den noch geltenden handels-
rechtlichen Regeln abweichen. Der einzige vom IASC angestrebte
Jahresabschlußzweck ist es, die Investoren mit entscheidungsnützli-
chen Informationen zu versorgen. In der Literatur wird teilweise die
Meinung vertreten, daß die IAS (und auch die US-GAAP) besonders
geeignet sind, global agierende Anleger mit entscheidungsrelevan-
ten, zuverlässigen und vergleichbaren Unternehmensinformationen
für fundierte Investitionsentscheidungen zu versorgen.
5
Ziel der vor-
liegenden Arbeit ist es, zu untersuchen, ob diese angestrebte Infor-
1
Zukünftig IFRS (International Financial Reporting Standards).
2
Vgl. Glaum, Internationalisierung 2001, S. 124.
3
Vgl. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des europäischen Parlamentes und des
Rates vom 19.7.2002, AdEG L 243, S. 1 f.; für Gesellschaften, deren Wertpa-
piere zum öffentlichen Handel in einem Nichtmitgliedstaat zugelassen sind ,
gilt eine Übergangsregelung bis 2007.
4
Vgl. statt vieler: Busse von Colbe, Vorschlag 2002, S. 1530-1535; Böcking,
Einzelabschluß 2001, S. 1433-1445; Niehues, EU-Rechnungslegungsstrategie
2001, S. 1209-1222.
5
Vgl. bspw. Breker/Gebhardt/Pape, Fair-Value-Projekt 2000, S. 729; Spanhei-
mer/Koch, Bilanzierungspraxis 2000, S. 301.
2
mationsleistung von einer IAS-Bilanz tatsächlich erbracht werden
kann. Ein synoptischer Vergleich verschiedener Rechnungslegungs-
systeme, bspw. des deutschen HGB mit den IAS, ist dabei wenig
hilfreich, weil die Zielsetzungen beider Systeme nicht übereinstim-
men.
6
Vielmehr gilt es zu analysieren, welche Bilanzierungsregeln die
Zielsetzung der "Informationsvermittlung" erfüllen und welche ihr
zuwiderlaufen. Letztlich müßte man alle Ansatz-, Bewertungs-, Glie-
derungs- und Ausweisregeln im Detail untersuchen. Eine solche
umfassende Analyse würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die
Analyse beschränkt sich daher auf ausgewählte Ansatz- und Bewer-
tungsregeln hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit.
In den IAS wird nicht zwischen Einzel- und Konzernabschlüssen
unterschieden; die Regelungen gelten für beide Arten von Jahresab-
schlüssen gleichermaßen (IAS 1.2). Es gibt nur ganz wenige Stan-
dards, in denen auf Regeln in Einzel- und Konzernabschlüssen Be-
zug genommen wird.
7
In der vorliegenden Arbeit wird auf spezielle
Regelungen des Konzernabschlusses nicht eingegangen.
1.2 Gang der Untersuchung
Im Anschluß an die Einleitung werden im zweiten Kapitel der Arbeit
die grundsätzlichen Zwecke der Rechnungslegung dargestellt, bevor
auf entscheidungstheoretische Gundlagen im Hinblick auf das Infor-
mationsziel der Rechnungslegung eingegangen wird.
Zur Beurteilung, inwieweit die derzeit geltenden IAS ihre vom IASC
selbst gestellte Aufgabe der Informationsvermittlung erfüllen, werden
im dritten Kapitel die Grundsätze nach dem Framework bzw. IAS 1
als Beurteilungsmaßstab dargelegt.
Es folgt der Hauptteil der Arbeit, der sich in die Kapitel vier und fünf
aufteilt. Im deskriptiven vierten Kapitel werden Ansatz- und Bewer-
tungsvorschriften von ausgewählten Bilanzpositionen vorgestellt. Im
darauf folgenden analytischen Teil der Arbeit (Kapitel fünf) werden
die Vorschriften der IAS im Hinblick auf die Informationsvermittlungs-
6
Vgl. Ballwieser, Grenzen 1997, S. 380.
7
Vgl. Wagenhofer, Standards 2002, S. 94.
3
funktion untersucht. Abschließend erfolgt im Kapitel sechs eine kurze
Zusammenfassung der Ergebnisse.
2 Grundlagen informationsorientierter Rechnungslegung
2.1 Externe
Rechnungslegung
2.1.1 Definition
Das Rechnungswesen ist ein Subsystem des Informationsversor-
gungssystems eines Unternehmens. Durch die externe Rechnungs-
legung wird das Unternehmensgeschehen insbesondere durch die
Abbildung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge nach bestimmten
Regeln dokumentiert.
8
Externe Rechnungslegung erfüllt das Bedürf-
nis der Adressaten nach Informationen. Es besitzt demnach als
Kommunikationsinstrument eine Schutzfunktion.
9
Der externen
Rechnungslegung wird die allgemeine Aufgabe zugewiesen, Rech-
nung gegenüber internen und externen Adressaten zu legen und die
für die Besteuerung benötigten Informationen bereitzustellen. Der
Zweck der Rechnungslegung und die Ausgestaltung dieser Regeln
ist von den Interessen der Rechnungslegungsadressaten abhängig.
Die Festlegung dieses Zweckes und der entsprechenden Gestal-
tungsregeln bleibt i.d.R. den Gesetzesorganen eines Staates vorbe-
halten.
10
2.1.2 Adressaten externer Rechnungslegung und ihre Interes-
sen
Rechnungslegungsadressaten sind jene Personen und Institutionen,
an die die Bilanzinformationen gerichtet sind bzw. die eine Möglich-
keit des Einblicks erhalten können. Neben den Anteilseignern und
Gläubigern kommen insbesondere die Arbeitnehmer, Marktpartner
8
Vgl. Busse von Colbe, Rechnungswesen 1998, S. 599.
9
Vgl. Baetge/Thiele, Gesellschafterschutz 1997, S. 16.
10
Vgl. Bossert/Manz, Unternehmensrechnung 1997, S. 1-3.
4
(Lieferanten und Abnehmer) und die allgemeine Öffentlichkeit als
Rechnungslegungsadressaten in Betracht.
11
Die einzelnen Adressatengruppen richten folgende typischen Inte-
ressen an die Rechnungslegung
12
:
Die Anteilseigner benötigen dann, wenn ihr Eigentum am Unter-
nehmen und die Verfügungsgewalt darüber getrennt sind, Infor-
mationen zur Entscheidung, ob sie ein finanzielles Engagement
eingehen, beibehalten, erweitern oder aufgeben sollen. Der Jah-
resabschluß soll ihnen hinsichtlich der finanziellen Entwicklung
der Unternehmung entscheidungsrelevante Informationen lie-
fern.
13
Darüber hinaus brauchen sie Informationen zur Überwa-
chung der Geschäftsleitung.
Die Gläubiger benötigen Informationen für die von ihnen zu tref-
fende Entscheidung über die Fortsetzung oder Beendigung eines
Kreditgeschäftes. Insbesondere sind sie an der derzeitigen und
zukünftigen Schuldendeckungsfähigkeit des Unternehmens, an
vorhandenen Sicherheitsreserven sowie an der Entwicklung der
Liquidität des Unternehmens interessiert.
14
Die Arbeitnehmer interessieren sich für die Höhe ihres Lohnes
oder Gehaltes (insbesondere bei Gewinnabhängigkeit eines Tei-
les des Arbeitsentgeltes), für die Lohnzahlungsfähigkeit des Ar-
beitgebers sowie für die Sicherheit und Entwicklungschancen ih-
res Arbeitsplatzes.
15
Die Marktpartner (Lieferanten und Abnehmer) sind an der künfti-
gen Entwicklung der Geschäftsbeziehungen und an der Be-
standsfestigkeit des Unternehmens interessiert.
Die allgemeine Öffentlichkeit hat sehr unterschiedliche Informati-
onsinteressen an einem Unternehmen. Besonders bedeutend
sind dabei Informationen über den künftigen Beitrag zur Wirt-
11
Vgl. Bauch/Oestreicher, Handelsbilanzen 1993, S. 45; Hinz, Konzernabschluß
2002, S 50 f.
12
Vgl. Baetge/Thiele, Gesellschafterschutz 1997, S. 15 f.
13
Vgl. Bieg/Kußmaul, Rechnungswesen 2003, S. 49 f.
14
Vgl. Bossert/Manz, Unternehmensrechnung 1997, S. 29.
15
Vgl. Federmann, Bilanzierung 2000, S. 43 f.
5
schaftskraft einer Stadt, einer Region oder eines Staates sowie
über die Entwicklung der Beschäftigtenzahl.
2.1.3 Zwecke externer Rechnungslegung
Aus den Interessen der Adressaten lassen sich folgende Zwecke und
Aufgaben ableiten, die dem Jahresabschluß in der Praxis üblicher-
weise zukommen. Diese können in zwei große Aufgabenblöcke
unterteilt werden:
16
Der Jahresabschluß hat die Aufgabe, den verschiedenen Adres-
satengruppen bestimmte Informationen über das betrachtete Un-
ternehmen in standardisierter Form zur Verfügung zu stellen. Man
spricht in diesem Zusammenhang auch von der Informationsfunk-
tion des Jahresabschlusses.
Daneben kommt dem Jahresabschluß die Aufgabe zu, in Rechts-
vorschriften und Verträgen allgemein umschriebene Rechte und
Pflichten bestimmter Personengruppen für den jeweils vorliegen-
den Einzelfall in ihrem quantitativen Ausmaß zu konkretisieren.
Dabei handelt es sich vor allem um Ansprüche oder Verpflichtun-
gen, die auf Zahlungen gerichtet sind. Man spricht in diesem Zu-
sammenhang auch von der Zahlungsbemessungsfunktion des
Jahresabschlusses.
2.2 Entscheidungstheoretische
Grundlagen
2.2.1 Das Entscheidungsproblem bei Risiko
Informationen entfalten ihren Wert nicht dadurch, daß sie von einer
Person unmittelbar konsumiert werden. Der Wert einer Information
liegt dagegen in der Eigenschaft, die Qualität der von einem Akteur
zu treffenden Entscheidungen zu verbessern.
17
Eine ökonomische
Analyse von Informationen erfordert daher eine systematische Ein-
bettung der Informationsverwendung in Entscheidungsprobleme von
Individuen.
18
16
Vgl. Bitz/Schneeloch/Wittstock, Jahresabschluß 2000, S. 27.
17
Vgl. Schildbach, Jahresabschluß 2000, S. 54.
18
Vgl. Wagenhofer/Ewert, Unternehmensrechnung 2003, S. 56.
6
Bei der allgemeinen Lösung dieses Problems bietet sich die Orientie-
rung am sogenannten Grundmodell der Entscheidungstheorie
19
an.
Der Entscheider steht vor dem Problem, aus einer Menge möglicher
Aktionen eine Aktion so auszuwählen, daß seine subjektive Zielerrei-
chung maximiert wird. In der Realität herrschen praktisch immer
unsichere Erwartungen über die Konsequenzen der Aktionen, weil es
zahlreiche Entwicklungen gibt, die zwar Einfluß auf die Konsequen-
zen der Aktionen haben, die man selbst aber nicht beeinflussen
kann. Die Ergebnisse einer Aktion hängen daher auch vom eintre-
tenden Umweltzustand ab. Kann man den einzelnen Zuständen
Wahrscheinlichkeiten zuordnen, spricht man von einem Entschei-
dungsproblem bei Risiko. Das Optimalitätskriterium kann in einer
solchen Situation durch die Maximierung des Erwartungsnutzens
(Bernoulli-Prinzip)
20
repräsentiert werden.
2.2.2 Rechnungslegung und Entscheidungsprobleme
In der Betrachtungsweise der Informationsökonomie stellt die Rech-
nungslegung ein spezielles Informationssystem dar, das von Indivi-
duen in bestimmten Entscheidungssituationen neben anderen Infor-
mationssystemen genutzt werden kann und mit diesen entsprechend
konkurriert. Ein Nutzen dieser Systeme ist dann gegeben, wenn
durch die vermittelten Informationen und unter Berücksichtigung der
Kosten der Erwartungswert des Nutzens einer Entscheidung erhöht
wird.
21
Bezüglich der Vorteilhaftigkeit des Einsatzes von Informationssyste-
men lassen sich nur wenige allgemeine Aussagen treffen. Zu diesen
gehört insbesondere das Feinheitstheorem. Ein Informationssystem
ist genau dann feiner als ein anderes, wenn sich seine Partitionie-
rung quasi als weitere Partitionierung des anderen Systems darstel-
len läßt. Man weiß beim feineren System mindestens ebensoviel wie
beim anderen, in manchen Fällen aber mehr. Dann gilt allgemein,
19
Vgl. dazu etwa Bamberg/Coenenberg, Entscheidungslehre 2002, S. 13-42.
20
Vgl. dazu ausführlich Bitz, Bernoulli-Prinzip 1997, S. 1-27.
21
Vgl. Krönert, Rechnungslegung 2001, S. 23 f.
7
daß ein Entscheider unabhängig vom konkreten Entscheidungskon-
text stets das feinere System vorzieht, falls keine Informationskosten
zu beachten sind. Die Informationskosten begrenzen daher den
Umfang der zu beschaffenden Informationen. Es lassen sich aber
nicht alle Informationssysteme gemäß der Feinheitsrelation ordnen.
In solchen Fällen geben verschiedene Informationssysteme grund-
sätzlich unterschiedliche Informationen. In diesen Fällen läßt sich
nicht sagen, das eine System gebe mehr Information als das ande-
re.
22
Die Rechnungslegung ist ein Informationssystem, das gleichzeitig
vielen Adressaten zugeht. Für die Beurteilung solcher Systeme ist
daher der Mehrpersonenkontext die relevante Betrachtungsweise.
Weil sich der individuelle Entscheidungskontext von Nutzer zu Nutzer
unterscheidet, läßt sich keine Variante der Rechnungslegung finden,
die für alle Adressaten gleichzeitig optimal ist. Man wird regelmäßig
mit Distributionseffekten konfrontiert, weil die einzelnen Varianten der
Rechnungslegung manche Nutzer begünstigen, andere dagegen
benachteiligen. Außerdem sollte die Funktion der Rechnungslegung
sorgfältig beachtet werden, denn Informationen, die für die Entschei-
dungsunterstützung geeignet sind, können für andere Funktionen
weniger geeignet sein.
23
2.3 Problematisierung der Informationsfunktion
Information kann als zweckorientiertes Wissen definiert werden.
24
Die
Adressaten der Rechnungslegung benötigen Informationen, um
Entscheidungen über die Aufnahme oder Aufrechterhaltung der
Geschäftsbeziehungen, insbesondere über die Bereitstellung oder
den Abzug von Kapital, und die Entlastung bzw. Weiterbeschäftigung
der Geschäftsführung zu treffen.
25
Die Rechnungslegung kann aber
niemals in der Lage sein, Prognosen für diese zukunftsgerichteten
22
Vgl. Wagenhofer/Ewert, Unternehmensrechnung 2003, S. 96.
23
Vgl. Wagenhofer/Ewert, Unternehmensrechnung 2003, S. 76-97.
24
Vgl. Wittmann, Information 1959, S. 14; zur Kritik an dieser Definition vgl.
Schneider, Entscheidungstheorie 1995, S. 49.
25
Vgl. Ballwieser, Rechnungslegung 1996, S. 17 f.
8
Entscheidungen selbst zu geben.
26
Der Begriff "Informationsfunktion"
ist so zu verstehen, daß Rechnungslegung nicht unbedingt entschei-
dungsrelevantes Wissen vermittelt, sondern vor allem die notwendi-
gen Daten dafür liefern kann, die mittels Hypothesen bzw. ange-
nommenen Gesetzesmäßigkeiten in entscheidungsrelevante Infor-
mationen überführt werden können.
27
3 Grundlagen der Informationsvermittlung nach IAS
3.1 Vermittlung entscheidungsnützlicher Informationen als
einziger Zweck
Im Framework bzw. in IAS 1 trifft das IASC klare Aussagen zu den
Zwecken der Rechnungslegung. Die Zielsetzung der Rechnungsle-
gung ist danach die Vermittlung entscheidungsrelevanter Informatio-
nen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unterneh-
mens, damit die Jahresabschlußadressaten ihre ökonomischen Ent-
scheidungen treffen können.
28
Als Infomationsadressaten kommen nach dem Framework Investo-
ren, Arbeitnehmer, Kreditgeber, Lieferanten, Kunden, der Staat und
die allgemeine Öffentlichkeit in Betracht. Angesichts des weiten
Adressatenkreises geht das IASC davon aus, daß die divergierenden
Informationsbedürfnisse der Jahresabschlußadressaten nicht ab-
schließend befriedigt werden können. Vom IASC wird daher die
Prämisse gesetzt, daß ein Jahresabschluß, der den Anforderungen
der Investoren zur Bereitstellung des unternehmerischen Risikokapi-
tals gerecht wird, auch die Mehrzahl der Informationswünsche der
übrigen Bilanzadressaten bestmöglich deckt. Die Rechnungslegung
nach IAS richtet sich damit primär an den Informationsbedürfnissen
der Investoren aus.
29
Jahresabschlüsse nach IAS haben eine reine
Informationsfunktion und dienen in keiner Weise der Zahlungsbe-
26
Vgl. Stützel, Bilanztheorie 1967, S. 34.
27
Vgl. Schneider, Betriebswirtschaftslehre 1994, S. 241.
28
Vgl. Pellens, Rechnungslegung 2001, S. 437.
29
Vgl. KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Standards 1999, S. 18 f.
9
messung.
30
Der einzige Zweck ist es, die Eigen- und Fremdkapital-
geber über die Managementleistung des abgelaufenen Geschäftsjah-
res und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zu informie-
ren.
31
3.2 Bestandteile des Jahresabschlusses
Erreicht werden soll dieser Zweck durch die folgenden im Framework
genannten unterschiedlichen Teile des Jahresabschlusses:
32
Bilanz (balance sheet),
Gewinn- und Verlustrechnung (income statement),
Kapitalflußrechnung (statement of changes in financial position),
Anhang (notes) und
weitere Rechnungen und erläuternde Angaben, sofern sie inte-
graler Bestandteil des Jahresabschlusses sind.
Die zahlreichen zusätzlichen Elemente stellen aber nicht den Kern
des Jahresbschlusses dar. Im Zentrum des IAS-Abschlusses stehen
die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
33
3.3 Kriterien für eine entscheidungsnützliche Informations-
vermittlung nach Framework bzw. IAS 1
3.3.1 Überblick
Damit ein Jahresabschluß gemäß IAS das Ziel der Vermittlung ent-
scheidungsnützlicher Informationen erreichen kann, muß der Jahre-
sabschluß neben der Beachtung der Grundannnahmen der Rech-
nungslegung (underlying assumptions) verschiedene qualitative
Merkmale aufweisen.
34
Abbildung 1 gibt einen Überblick über diese grundlegenden Kriterien
30
Vgl. Coenenberg, Jahresabschluß 2001, S. 42.
31
Vgl. Streim/Bieker/Leippe, Anmerkungen 2001, S. 179.
32
Vgl. Pellens, Rechnungslegung 2001, S. 437.
33
Vgl. Streim, Informationen 2000, S. 115.
34
Vgl. Achleitner/Behr, Standards 2003, S. 99.
10
der Rechnungslegung nach IAS.
Abb. 1: Rechnungslegungsgrundsätze nach IAS
35
3.3.2 Grundlegende Annahmen
Als grundlegende Annahmen (underlying assumptions) bezeichnet
das Framework die beiden Postulate der periodengerechten Erfolgs-
ermittlung (accrual basis) und der Unternehmensfortführung (going
concern).
36
Nach dem Grundsatz der periodengerechten Erfolgser-
mittlung erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses auf der Basis
der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen
unabhängig von den jeweiligen Zahlungsströmen in der Berichtsperi-
ode. Ein- und Auszahlungen sind demnach nicht im Zeitpunkt ihres
Zu- oder Abflusses erfolgswirksam zu verrechnen, sondern werden
der Periode zugeordnet zu der sie wirtschaftlich gehören.
37
Konkreti-
siert wird die periodengerechte Erfolgsermittlung durch das Realisa-
tionsprinzip und das Matching Principle. Das Realisationsprinzip ist
im Rahmen der IAS so gefaßt, daß für die erfolgswirksame Berück-
35
Vgl. Coenenberg, Jahresabschluß 2001, S. 78.
36
Vgl. Pellens, Rechnungslegung 2001, S. 441.
37
Vgl. Achleitner/Behr, Standards 2003, S. 98.
Accrual Basis
Going Concern
Underlying Assumptions
Prudence
Completeness
Relevance
Understandability
Materiality
Comparability
Reliability
Faithful Representation
Substance over Form
Neutrality
Qualitative Characteristics
Constraints on Relevant
and Reliable Information
Balance between
Benefit and Cost
Balance between
Qualitative
Characteristics
Timeliness
Decision
Usefulness
11
sichtigung von Erträgen bereits die jederzeitige Realisierbarkeit bzw.
eine hinreichend sichere Einschätzung der Realisierbarkeit ausreicht
(F.85).
38
Das Matching Principle schreibt eine perioden- und sachge-
rechte Zuordnung von Aufwendungen zu den entsprechenden Erträ-
gen vor (F. 95, IAS 1.26).
Nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung müssen die
Jahresabschlüsse grundsätzlich unter der Annahme erstellt werden,
daß das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in absehbarer Zu-
kunft weiter fortführt. Sofern die Fortführung der Unternehmenstätig-
keit nicht geplant oder nicht möglich ist, müssen die der Bilanzierung
zugrundeliegenden Prämissen offengelegt werden.
39
3.3.3 Qualitative Anforderungen an den Abschluß
Gemäß F.24 müssen Abschlußinformationen bestimmte qualitative
Anforderungen (qualitative characteristics) aufweisen, damit sie für
die Abschlußadressaten im Sinne des Abschlußzwecks entschei-
dungsrelevant sind:
Verständlichkeit (understandability),
Relevanz (relevance),
Verläßlichkeit (reliability) und
Vergleichbarkeit (comparability).
Verständlichkeit
Nach dem Grundsatz der Verständlichkeit müssen die Informationen
so aufbereitet werden, daß sie für einen fachkundigen Leser nach-
vollziehbar sind. Dabei kann davon ausgegangen werden, daß der
Abschlußadressat über angemessene Wirtschafts- und Bilanzie-
rungskenntnisse verfügt.
40
Relevanz
Eine zentrale Stellung im Regelwerk der IAS nimmt das Kriterium der
38
Vgl. Mujkanovic, Fair Value 2002, S. 59.
39
Vgl. KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Standards 1999, S. 21.
40
Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen 2002, S. 119.
12
Entscheidungsrelevanz ein. Diese bezieht sich auf den Informations-
gehalt des Abschlusses für Entscheidungen der Adressaten. Durch
die Art (nature) der Information soll die Einschätzung vergangener,
gegenwärtiger und zukünftiger Ereignisse ermöglicht werden (F.26).
41
Eine Information ist nach Auffassung des IASC nur dann als relevant
zu qualifizieren, wenn sie Entscheidungen des Empfängers zu beein-
flussen vermag, weil sie etwas über die zukünftige Entwicklung des
Unternehmens aussagt oder weil sie früher getroffene Annahmen
über die Unternehmensentwicklung bestätigt oder korrigiert.
42
Kon-
kretisiert wird die Entscheidungsrelevanz durch den Grundsatz der
Wesentlichkeit (materiality). Informationen, die nicht schon durch ihre
Art entscheidungsrelevant sind, müssen nur dann gegeben werden,
wenn sie für die Entscheidungsfindung aufgrund ihres Umfanges
(quantitativ) von Bedeutung sind. Es soll vermieden werden, daß
durch die Nichtangabe oder durch die falsche Angabe einer Informa-
tion Entscheidungen der Adressaten beeinflußt werden könnten.
43
Verläßlichkeit
Damit Anleger auf die Informationen eines Unternehmens vertrauen
können, müssen diese verläßlich sein. Verläßlichkeit ist dann gege-
ben, wenn die Information frei von wesentlichen Fehlern und subjek-
tiver Verzerrung ist (F.31). Konkretisiert wird der Grundsatz der Ver-
läßlichkeit durch die folgenden fünf untergeordneten Prinzipien (F.33-
F.38):
Glaubwürdige Darstellung (faithful representation): Die Darstel-
lung soll nicht etwas vorgeben, was vernünftigerweise nicht er-
wartet werden kann. Aus diesem Grund dürfen unsichere Positio-
nen, wie etwa ein originärer Firmenwert, nicht angesetzt wer-
den.
44
41
explizite Prognosen sind dadurch aber nicht eingeschlossen; vgl. auch Wa-
genhofer, Standards 2002, S. 84 f.
42
Vgl. Streim/Bieker/Leippe, Anmerkungen 2001, S. 184.
43
Vgl. Raffournier, Standards 2000, S. 99.
44
Vgl. Wagenhofer, Standards 2002, S. 85.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832475048
- ISBN (Paperback)
- 9783838675046
- DOI
- 10.3239/9783832475048
- Dateigröße
- 661 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Dezember)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- rechnungswesen internationale rechnungslegung bilanzierung
- Produktsicherheit
- Diplom.de