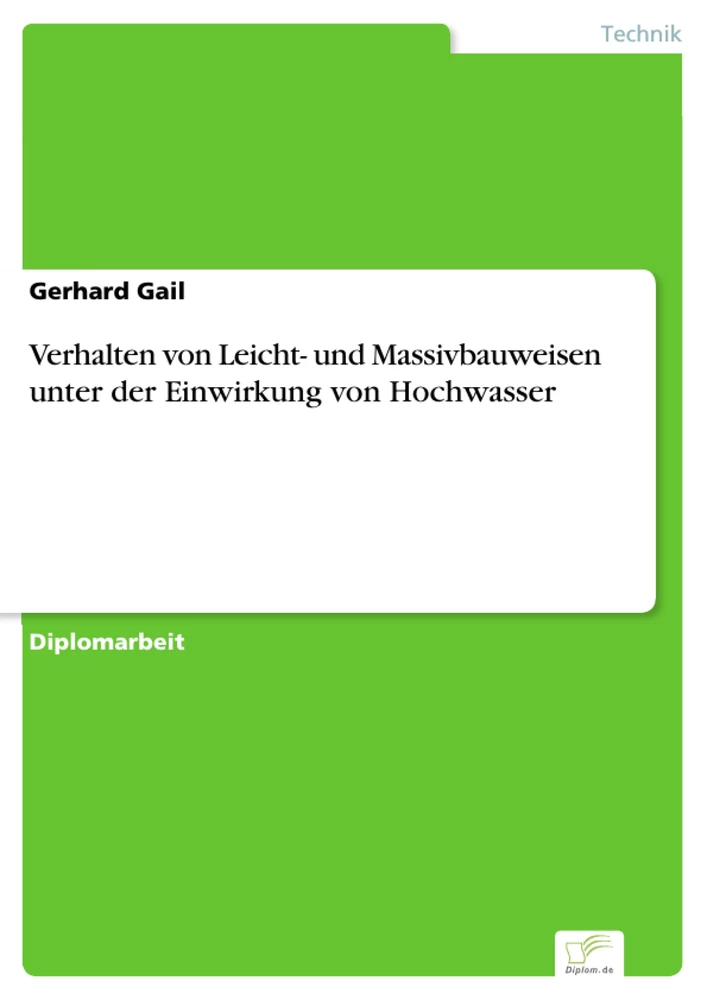Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
©2003
Diplomarbeit
125 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Durch das Hochwasser vom August 2002 in Mitteleuropa (Österreich, Deutschland, Tschechien) bekamen die Begriffe Hochwasserschutz, Hochwasservorsorge und Hochwasserschadensbeseitigung eine neue Bedeutung.
Derartige Naturkatastrophen können entscheidende Hinweise für Neuplanungen und Sanierungen einzelner Bauprojekte in Hochwassergebieten liefern.
Diese Diplomarbeit sollte ein erster Ansatzpunkt sein, wie man Gebäude in verschiedener Bauweise in Zukunft hochwassersicher baut, bzw. wie man die aufgetretenen Schäden bei Hochwasser analysiert und kostengünstig und vor allem zur vollsten Zufriedenheit der Bewohner saniert, ohne dass Folgeschäden auftreten können.
Ich versuche in dieser Arbeit die Leichtbauweise mit der Massivbauweise zu vergleichen, deren Vor- und Nachteile darzustellen, die aufgetretenen Schäden zu analysieren und jeweils dazu sinnvolle Lösungsvorschläge aufzuzeigen. Da die Untersuchungen über das Verhalten von Leichtbauweisen und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser noch in den Kinderschuhen stecken, sind die Daten meiner Arbeit vorwiegend aus praktischen Erfahrungen an den hochwasserüberfluteten Gebäuden abgeleitet, da wissenschaftliche Messungen zum Beispiel in Bezug auf die Austrocknungsdauern noch fehlen.
Um dies umzusetzen, werde ich versuchen jede der beiden Bauweisen mit Hilfe von Fotos anhand ihrer verwendeten Baumaterialien und deren Feuchteverhalten zu analysieren, um so die jeweiligen Vorteile herauszuarbeiten.
Berücksichtigt werden neben den statischen Schäden vor allem Schäden an der Struktur, sowie offenkundige Oberflächenschäden an den Fassaden und den Innenverkleidungen.
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt im Vergleich der Bauweisen anhand ihrer Wandkonstruktionen, jedoch werden relevante Schäden an Fußbodenaufbauten, Deckenkonstruktion, sowie an Vorsatzkonstruktionen mit behandelt. Am Ende der Arbeit werden in einer leicht vergleichbaren Tabelle alle von mir in dieser Arbeit herausgearbeiteten Vergleichskriterien dargestellt und beurteilt. Gleichzeitig sollen auch Gründe für die starken Auswirkungen des Hochwassers vom August 2002 aufgezeigt werden, da die katastrophalen Auswirkungen der Hochwasserschäden mit Sicherheit auch ein vorhergehendes menschliches Versagen zur Ursache hatten. Weiters möchte ich Hochwasserschutzmaßnahmen aufzeigen, welche in Zukunft derart gravierende Auswirkungen auf die Bauwerke vermindern oder vielleicht sogar vermeiden […]
Durch das Hochwasser vom August 2002 in Mitteleuropa (Österreich, Deutschland, Tschechien) bekamen die Begriffe Hochwasserschutz, Hochwasservorsorge und Hochwasserschadensbeseitigung eine neue Bedeutung.
Derartige Naturkatastrophen können entscheidende Hinweise für Neuplanungen und Sanierungen einzelner Bauprojekte in Hochwassergebieten liefern.
Diese Diplomarbeit sollte ein erster Ansatzpunkt sein, wie man Gebäude in verschiedener Bauweise in Zukunft hochwassersicher baut, bzw. wie man die aufgetretenen Schäden bei Hochwasser analysiert und kostengünstig und vor allem zur vollsten Zufriedenheit der Bewohner saniert, ohne dass Folgeschäden auftreten können.
Ich versuche in dieser Arbeit die Leichtbauweise mit der Massivbauweise zu vergleichen, deren Vor- und Nachteile darzustellen, die aufgetretenen Schäden zu analysieren und jeweils dazu sinnvolle Lösungsvorschläge aufzuzeigen. Da die Untersuchungen über das Verhalten von Leichtbauweisen und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser noch in den Kinderschuhen stecken, sind die Daten meiner Arbeit vorwiegend aus praktischen Erfahrungen an den hochwasserüberfluteten Gebäuden abgeleitet, da wissenschaftliche Messungen zum Beispiel in Bezug auf die Austrocknungsdauern noch fehlen.
Um dies umzusetzen, werde ich versuchen jede der beiden Bauweisen mit Hilfe von Fotos anhand ihrer verwendeten Baumaterialien und deren Feuchteverhalten zu analysieren, um so die jeweiligen Vorteile herauszuarbeiten.
Berücksichtigt werden neben den statischen Schäden vor allem Schäden an der Struktur, sowie offenkundige Oberflächenschäden an den Fassaden und den Innenverkleidungen.
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt im Vergleich der Bauweisen anhand ihrer Wandkonstruktionen, jedoch werden relevante Schäden an Fußbodenaufbauten, Deckenkonstruktion, sowie an Vorsatzkonstruktionen mit behandelt. Am Ende der Arbeit werden in einer leicht vergleichbaren Tabelle alle von mir in dieser Arbeit herausgearbeiteten Vergleichskriterien dargestellt und beurteilt. Gleichzeitig sollen auch Gründe für die starken Auswirkungen des Hochwassers vom August 2002 aufgezeigt werden, da die katastrophalen Auswirkungen der Hochwasserschäden mit Sicherheit auch ein vorhergehendes menschliches Versagen zur Ursache hatten. Weiters möchte ich Hochwasserschutzmaßnahmen aufzeigen, welche in Zukunft derart gravierende Auswirkungen auf die Bauwerke vermindern oder vielleicht sogar vermeiden […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7446
Gail, Gerhard: Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von
Hochwasser
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Technische Universität Wien, Technische Universität, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
Unterschiedliches Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
1 EINLEITUNG
1
2 ALLGEMEINES ÜBER HOCHWASSER
3
2.1 Begriffsdefinition
2.1.1 Gründe für ein Hochwasser
2.1.2
Erste
Gegenmaßnahmen
2.1.3
Gefahrenarten
4
2.1.4
Einwirkungsparameter
5
2.2 Das Hochwasser vom August 2002
6
2.2.1 Entstehung des Hochwassers
2.2.2
Wetterlage
7
2.2.3 Ablauf des Hochwassers
8
2.2.4
Zusammenfassung
9
3 ENTSTANDENE SCHÄDEN INFOLGE DES HOCHWASSERS
11
3.1 Allgemeine Schäden
3.2 Schadenstypen
12
3.2.1 Statisch relevante Schäden
3.2.1.1 Schäden im Gründungsbereich
13
3.2.1.2 Schäden durch mechanische Einwirkungen
16
3.2.1.3 Schäden durch Überbeanspruchung infolge durchnässter Bauteile
3.2.1.4 Fazit und Bilder
17
3.2.2 Allgemeine Feuchteschäden
19
3.2.3
Schadstoffkontamination
4 VERHALTEN VON BAUSTOFFEN BEI FEUCHTEEINWIRKUNG
21
4.1
Allgemeines
4.2 Feuchtetechnische Größen
4.2.1 Begriffe
4.2.2 Relative Luftfeuchte
23
4.2.3 Mittlere Stofffeuchte
4.2.4
Wasserdampfdiffusion
24
4.3 Sorptionsvermögen von Baustoffen
26
4.4 Feuchtigkeitsaufnahme von Baustoffen
27
4.4.1 Arten des Feuchtetransportes
Gail Gerhard
9625755
II
Unterschiedliches Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
4.4.2 Kapillare Leitung von Baustoffen
4.4.3 Feuchtigkeitsaufnahme von Baustoffen
29
4.5 Feuchtedehnungen
30
5 LEICHTBAUWEISE
31
5.1
Holzriegelbauweise
5.1.1 Beschreibung der Bauweise
5.1.1.1 Nicht hinterlüftete Holzriegelbauweise
32
5.1.1.2 Hinterlüftete Holzriegelbauweise
35
5.2 Feuchteeigenschaften von Holz
36
5.2.1 Einfluss der Holzfeuchte auf die mechanischen Eigenschaften von Holz
5.2.2 Quellen und Schwinden von Holz
37
5.2.3 Weitere Feuchteeigenschaften von Holz
38
5.2.3.1
Sorption
5.2.3.1 Diffusion im Holz
39
5.3 Analyse aufgetretener Schäden an der Leichtbauweise
40
5.3.1 Allgemeines zu den Schäden
5.3.2 Sanierung der Schäden
41
5.3.2.1 Öffnen der Innenverkleidung
5.3.2.2 Tragfähigkeit der Holzsteher
49
5.3.2.3 Trocknung der Wandkonstruktion
5.3.2.4 Schließen der Innenverkleidung
51
5.3.2.5
Fazit
52
5.4 Schäden infolge von Pilzbefall
53
5.4.1 Allgemeines
5.4.2 Entstehung der Pilzbelastung
5.4.3 Arten von Pilzen
55
5.5 Schäden an Decken- und Fußbodenkonstruktionen
58
5.5.1 Allgemeines
5.5.2 Gips- und Zementestriche
5.5.3
Gussasphaltestriche
59
5.5.4
Holzbalkendecke
60
5.6 Schäden an Fassaden
61
5.6.1 Allgemeines und Bilder
5.6.2
Wärmedämmsysteme
63
5.6.2.1
Mechanismen der Wasseraufnahme und Durchfeuchtungsgrad
5.6.2.2
Schädigungsvorgänge
5.6.2.3
Festigkeitsverluste an geschädigten WDVS
5.6.2.4 Versuchsreihe der technischen Universität Berlin
64
Gail Gerhard
9625755
III
Unterschiedliches Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
6 MASSIVBAUWEISEN
69
6.1 Ziegelmauerwerk
6.1.1 Arten von Wandaufbauten
6.1.2 Der Kapillareffekt bei Mauerwerk
71
6.2 Analyse der Schäden am Mauerwerk
72
6.2.1 Allgemeines
6.2.2 Auswirkungen der Feuchtigkeit auf den Ziegel
6.2.3 Salze im Mauerwerk
73
6.2.4 Auswirkungen des Wassers auf den Mörtel
75
6.2.5 Eindringen des Hochwassers in Mauerwerk
76
6.2.6 Wasserandrang bei zweischaligem Mauerwerk
77
6.2.7 Trockenlegung von Mauerwerk
78
6.3 Beispiele von Mauerwerkschäden
82
6.4 Putzschäden durch Wasserangriff
86
6.4.1
Allgemeines
6.4.2 Sanierung von Putzschäden
6.5 Wasserandrang auf WU-Beton
89
6.2.1 Feuchteeigenschaften von WU-Beton
6.2.2 Wassertransportmechanismen beim Wassereintritt in WU-Beton
90
6.2.3 Wasserdichte Bauweisen aus Beton
93
6.2.4 Schäden an Betonbauwerken
94
6.2.5 Sanierung von Betonbauwerken
6.6 Hochwasserschäden an Lehmbauten
95
6.6.1 Allgemeines über Lehmbauten
6.6.2 Sanierung von Feuchteschäden an Lehmbauwerken
7 HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN
97
7.1 Allgemeine Problematik
7.2 Hochwasserschutz am Gewässer
98
7.2.1 Computersimulierung von Hochwässern
7.2.2 Bauliche Maßnahmen
7.3 Maßnahmen durch Flächenvorsorge
99
7.3.1 Allgemeine Problematik
7.3.2
Gefahrenzonen
100
7.4 Hochwasserschutz an den Bauwerken
102
7.4.1 Bauliche Maßnahmen am Gebäude
7.4.2 Schutzstrategien bei Gebäuden
103
Gail Gerhard
9625755
IV
Unterschiedliches Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
8 VERGLEICH DER BAUWEISEN 104
8.2 Vergleich der Baustoffe
8.1 Tabellarischer Vergleich
105-107
9 ZUSAMMENFASSUNG
108
10 VERZEICHNISSE
109
10.1 Abbildungsverzeichnis
10.2
Tabellenverzeichnis
111
10.3
Literaturverzeichnis
112
10.4 Weiterführende Literatur
117
Gail Gerhard
9625755
V
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
1 EINLEITUNG
Durch das Hochwasser vom August 2002 in Mitteleuropa (Österreich, Deutschland,
Tschechien) bekamen die Begriffe Hochwasserschutz, Hochwasservorsorge und
Hochwasserschadensbeseitigung eine neue Bedeutung.
Derartige Naturkatastrophen können entscheidende Hinweise für Neuplanungen und
Sanierungen einzelner Bauprojekte in Hochwassergebieten liefern.
Da die Schäden an Objekten in hochwassergefährdeten Gebieten durch unsachgemäße
Bebauung europaweit in die Milliarden Euro gehen, wird nun versucht, vorbeugende
Maßnahmen zu treffen, um diese Schäden so gering wie möglich zu halten, oder sie
überhaupt zu vermeiden.
Diese Diplomarbeit sollte ein erster Ansatzpunkt sein, wie man Gebäude in verschiedener
Bauweise in Zukunft hochwassersicher baut, bzw. wie man die aufgetretenen Schäden bei
Hochwasser analysiert und kostengünstig und vor allem zur vollsten Zufriedenheit der
Bewohner saniert, ohne dass Folgeschäden auftreten können.
Ich versuche in dieser Arbeit die Leichtbauweise mit der Massivbauweise zu vergleichen,
deren Vor- und Nachteile darzustellen, die aufgetretenen Schäden zu analysieren und
jeweils dazu sinnvolle Lösungsvorschläge aufzuzeigen. Da die Untersuchungen über das
Verhalten von Leichtbauweisen und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
noch in den Kinderschuhen stecken, sind die Daten meiner Arbeit vorwiegend aus
praktischen Erfahrungen an den hochwasserüberfluteten Gebäuden abgeleitet, da
wissenschaftliche Messungen zum Beispiel in Bezug auf die Austrocknungsdauern noch
fehlen.
Daher möchte ich anhand von Fotos betroffener Häuser die Schäden darstellen, Fehler in
der Konstruktion aufzeigen, sowie die in der Wirtschaft und laut ÖNORMEN vorhandenen
Sanierungsmaßnahmen vorstellen.
Um dies umzusetzen, werde ich versuchen jede der beiden Bauweisen anhand ihrer
verwendeten Baumaterialien und deren Feuchteverhalten zu analysieren, um so die
jeweiligen Vorteile herauszuarbeiten.
Gail Gerhard
9625755
1
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
Berücksichtigt werden neben den statischen Schäden vor allem Schäden an der Struktur,
sowie offenkundige Oberflächenschäden an den Fassaden und den Innenverkleidungen.
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt im Vergleich der Bauweisen anhand ihrer
Wandkonstruktionen, jedoch werden relevante Schäden an Fußbodenaufbauten,
Deckenkonstruktion, sowie an Vorsatzkonstruktionen mit behandelt.
Am Ende der Arbeit werden in einer leicht vergleichbaren Tabelle alle von mir in dieser Arbeit
herausgearbeiteten Vergleichskriterien dargestellt und beurteilt.
Gleichzeitig sollen auch Gründe für die starken Auswirkungen des Hochwassers vom August
2002 aufgezeigt werden, da die katastrophalen Auswirkungen der Hochwasserschäden mit
Sicherheit auch ein vorhergehendes menschliches Versagen zur Ursache hatten.
Weiters möchte ich Hochwasserschutzmaßnahmen aufzeigen, welche in Zukunft derart
gravierende Auswirkungen auf die Bauwerke vermindern oder vielleicht sogar vermeiden
könnten.
Gail Gerhard
9625755
2
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
2 ALLGEMEINES ÜBER HOCHWASSER
2.1. BEGRIFFSDEFINITION
Hochwasser ist als Teil eines Wasserkreislaufes zu sehen, ein Naturereignis, hervorgerufen
von lang anhaltenden Niederschlägen oder Schneeschmelzen.
Folge eines Hochwassers ist nicht nur ein sichtbarer Anstieg des Wasserspiegels der
einzelnen Flüsse, sondern auch ein Ansteigen des Grundwasserspiegels, was ebenfalls eine
Schädigung von Gebäuden zur Folge haben kann.
2.1.1 GRÜNDE FÜR EIN HOCHWASSER
Es sind für die in letzter Zeit immer häufiger werdenden Naturkatastrophen zwei Gründe
anzuführen:
· die natürlichen Klimaschwankungen, die statistisch bewiesen, von der Natur ohne
menschliches Einwirken regelmäßig auftreten,
· die vom Menschen verursachten Einflüsse, wie der CO
2
Anstieg, der
Treibhauseffekt, Oberflächenversiegelungen oder die Begradigung der natürlichen
Flussläufe.
In Folge dieser Faktoren werden immer häufiger Starkregenereignisse beobachtet, welche
das Hochwasser, das sich im Meterbereich bewegen kann, entstehen lassen.
Doch die Natur kennt keine Hochwasserschäden, diese entstehen erst, wenn der Mensch
betroffen ist. Je intensiver die ausgewiesenen Hochwassergebiete genutzt bzw. bebaut
werden, desto größer der finanzielle und auch psychologische Schaden.
Schuld an diesen Hochwässern ist also unter anderem auch der Mensch, doch das
tatsächliche Ausmaß der Schäden erkennen meist nur jene Personen, die durch diese
Ereignisse ihr ganzes Hab und Gut verlieren.
2.1.2 ERSTE GEGENMAßNAHMEN
Man kann die Wetterkapriolen nicht verhindern, doch der Mensch sollte versuchen, mit allen
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Auswirkungen von Hochwasser so gering wie
möglich zu halten.
Daher sollten die Verantwortlichen in Bund und Land Hochwasserschutzmaßnahmen treffen,
aber auch jeder einzelne Bewohner im Hochwassergebiet muss selbst für sein Eigentum
Vorsorge treffen.
Gail Gerhard
9625755
3
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
Diese Diplomarbeit soll dabei helfen, die Hochwasserschäden genau zu erkennen und
geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen.
Erster Schritt nach der Überflutung jedes Bauwerks ist das Entfernen des anstehenden
Wassers. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass die Absenkung des Wasserspiegels im
Gebäude möglichst korrespondierend mit dem Rückgang des Oberflächen- und
Grundwasserspiegels erfolgt. Der Abpumpvorgang sollte also nicht vor dem vollständigen
Abfluss des anstehenden Wassers erfolgen, um das Gebäude infolge einer
Überbeanspruchung des Fundaments und der aufgehenden Wände durch den Wasserdruck
nicht zusätzlich zu schädigen.
2.1.3. GEFAHRENARTEN
Als ersten Schritt, um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können, müssen die
Gefahrenarten des Hochwassers und die jeweils wirkenden Kräfte quantitativ bekannt sein.
Die Maßnahmen müssen sich der Art der Gefahr und den jeweils wirkenden Kräften
anpassen.
Die statische Überschwemmung zeichnet sich durch geringe Fließgeschwindigkeit (kleiner
als 1 m/s) aus. Die Einwirkung ergibt sich durch den hydrostatischen Druck, der mit
zunehmender Wasserhöhe steigt.
Die dynamische Überschwemmung ist gekennzeichnet durch mittlere bis hohe
Fließgeschwindigkeiten (größer als 1 m/s). Als Einwirkung muss neben der hydrostatischen
auch die hydrodynamische Kraft des fließenden Wassers berücksichtigt werden.
Die Ufererosion ereignet sich in Form einer Verlagerung des Gewässerlaufs oder einer
Rutschung. Diese Einwirkung gefährdet Bauten durch direkten Strömungsangriff oder durch
den Verlust der Standfestigkeit infolge Unterspülung.
Ein Grundwasseranstieg gefährdet Bauten in Form eines hydrostatischen Drucks an den
aufgehenden Wänden und der Bodenplatte. Er tritt bei Hochwasser auf, selbst wenn keine
Ausuferung eintritt [Hwvor02/1/]. Diese Problematik ist auf Seite 14 Abb. 8 genau dargestellt.
Gail Gerhard
9625755
4
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
2.1.4. EINWIRKUNGSPARAMETER
Die Überschwemmungstiefe bestimmt den vertikalen Einflussbereich über der
Geländehöhe. Meist erfolgt der Anstieg kontinuierlich mit einem Maximum beim oder kurz
nach dem Hochwasserscheitel
1)
.
Die Überschwemmungsdauer beginnt zum Zeitpunkt der Benetzung mit Wasser und endet
zum Zeitpunkt des Trockenfallens. Sie schwankt zwischen Stunden und Tagen, in manchen
Fällen kann die Überschwemmung über Wochen anhalten.
Die Fließgeschwindigkeit erreicht in steilerem Gelände (5 - 10%) etwa 3 bis 5 m/s, wenn
die Überschwemmungshöhe größer als 0,5 m ist. Derart hohe Geschwindigkeiten treten
zudem entlang kanalisierter Bereiche auf (Straßenzüge). In flacherem Gelände (kleiner 2%)
reduziert sich die Fließgeschwindigkeit allgemein unter 2 m/s. Bei Dammbrüchen treten in
der Nähe der Bresche
2)
sehr hohe Geschwindigkeiten auf. Die Fließgeschwindigkeit könnte
ein Ansatz für die Beurteilung des Widerstandsverhaltens für die Wandkonstruktionen sein.
Die Anstiegsgeschwindigkeit beschreibt die Schnelligkeit des Wasseranstieges bei einer
Überschwemmung. Dieser Parameter bestimmt die Bedrohung von Personen in und
außerhalb von Gebäuden. Eine hohe Anstiegsgeschwindigkeit ist insbesondere bei
Überschwemmungen infolge Verklausung (Gerinneverstopfung und folgender lokaler
Ausuferung) oder Dammbruch zu erwarten [Hwvor02/1/].
1)
Der Hochwasserscheitel ist der höchste Punkt der Überschwemmung.
2)
Als Bresche bezeichnet man die Bruchstelle des Dammes.
Gail Gerhard
9625755
5
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
2.2. DAS HOCHWASSER VOM AUGUST 2002
2.2.1. ENTSTEHUNG DES HOCHWASSERS
Das Hochwasserereignis vom August 2002 war geprägt durch zwei massive
Starkregenereignisse, welche innerhalb einer Woche auf Mitteleuropa niedergingen.
Die erste Schlechtwetterfront, welche zu den ersten Überschwemmungen führte, war vom 6.
und 7. August 2002. Es entstanden vor allem an der Alpennordseite (siehe Abb.1)
außergewöhnliche Niederschlagsmengen, wobei das Mühl- und Waldviertel, sowie das
Gebiet um die Stadt Salzburg am stärksten betroffen waren.
Zur Größenordnung: die Niederschlagshöhe 1 mm entspricht 1 Liter/m²
mm
Abb. 1 Zweitagesniederschlagssummen in mm vom 6. und 7. August 2002 [2]
Der größte Wert wurde in Weikertschlag (NÖ) mit 246mm gemessen, welcher als größte je
gemessene Zweitagesniederschlagssumme gilt.
Die zweite ungewöhnliche Niederschlagssituation erreichte Österreich am 11. und 12.
August 2002. Diesmal war ganz Österreich von den starken Regenfällen betroffen, jedoch
waren, wie schon bei der ersten Schlechtwetterfront, das Mühl- und Waldviertel am stärksten
betroffen (siehe Abb.2).
Für diesen Zeitraum war der Niederschlag im steirischen Salzkammergut und im Ennsgebiet
außergewöhnlich. Die am Pegel des Flusses Loser beobachtete Zweitagesnieder-
schlagssumme von 242 mm ist hier besonders zu erwähnen.
Gail Gerhard
9625755
6
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
mm
Abb. 2 Zweitagesniederschlagssummen in mm vom 11. und 12. August 2002 [2]
2.2.2. WETTERLAGE
Um einen Eindruck zu gewinnen, wie solche Unwetter aus meteorologischer Sicht entstehen,
ist nachfolgend die Erklärung der Wetterlage beschrieben:
Die Wetterlage, die zu den Hochwasserereignissen im August 2002 geführt hat, war
durch eine einseitige Ausbildung eines Hochdrucksystems über dem nördlichen
Atlantik und der Entstehung einer Tiefdruckrinne von England bis nach Süditalien
geprägt, wobei sich in weiterer Folge ein sekundäres Tiefdrucksystem über
Norditalien abspaltete [Hydroana02/2/].
Im Vergleich zu den vorherigen Jahren kann man erkennen, dass solche
Schlechtwettersituationen nicht außergewöhnlich und einzigartig sind, sondern lediglich die
Intensität und die Auswirkung der vorjährigen Regenbelastung verheerend waren.
Solche Wetterlagen haben bereits in der Vergangenheit sowohl im Frühjahr und
Herbst (z.B. Mai 1991), aber vor allem im Sommer (August 1991, August 1966,
September 1965, August 1959) zu außergewöhnlichen Hochwasserereignissen
geführt [Hydroana02/2/].
Bei den hohen Temperaturen im Sommer können die Luftmassen erheblich mehr
Wassermassen aufnehmen und somit noch größere Starkniederschläge verursachen.
Gail Gerhard
9625755
7
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
2.2.3. ABLAUF DES HOCHWASSERS
Im Zuge des Starkregens entstanden an den Flüssen in diesen Regionen natürlich
außergewöhnliche Durchflussmengen, die schließlich zu den Hochwässern führten.
Um das Ausmaß der Überschwemmungen besser erfassen zu können, sind nachstehend
einige Bemessungshochwassermarken angeführt.
Diese dienen vorwiegend zur Planung von Hoch- und Grundwasserschutzmaßnahmen.
Ein solches Bemessungshochwasser kann z. B. sein:
· ein extremes Hochwasserereignis aus der Vergangenheit,
· die Annahme eines Hochwassers auf der Basis einer statistischen Auswertung.
Ein 100-jähriges Hochwasser, das mit großer Wahrscheinlichkeit nur einmal innerhalb
von 100 Jahren erreicht bzw. überschritten wird, wird als HQ
100
bezeichnet. Dieses
100-jährliche Hochwasser kann allerdings in wenigen Jahren mehrfach auftreten
[HWSF02/6/].
Das Zusammenspiel der beiden Flutwellen vom 9. August und vom 13. August 2002 ist die
Ursache für die verheerenden Hochwasserschäden an den Gebäuden. Statistisch sind die
Abflussmengen im oberösterreichischen Donauabschnitt im Bereich eines 20-jährlichen
Hochwassers einzuordnen. Die Zuflüsse von Traun und Enns bewirkten unterhalb der
Mündung eine Hochwasserwelle mit 65- bis 80-jährlichen (HQ
65-80
) Scheitelwerten, die
Salzach erreichte Werte von HQ
80
-100
.
Abb. 3 Beispiel für den hochwasserführenden Fluss Steyr [3]
Gail Gerhard
9625755
8
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
Jedoch sind die Hochwässer im Zeitraum vom 7. bis 14. August 2002 der Flüsse Naarn,
Krems und vor allem des Kamp im Mühl- und Waldviertel als außergewöhnlich anzusehen,
da Abflüsse in dieser Größenordnung bisher noch nie beobachtet wurden.
Um dies zu verdeutlichen, soll die Abbildung 4 dienen. Die erste Abflussspitze erreichte
800m³/s und die zweite Flutwelle immerhin noch 400m³/s. Zum Vergleich wurde bis jetzt das
HQ
100
mit 250 m³/s angegeben.
Die Wiederkehrzeit für ein derartiges Starkregenereignis in dieser Region wurde mit 500
Jahren geschätzt.
Anhand dieser Werte ist es zu erklären, dass manche Gebäude in den Hochwassergebieten,
insbesondere im Kamptal, bis zu 2,5 m unter Wasser standen und somit enorm geschädigt
wurden.
HQ
100
=250m³/s
Abb. 4 Abflüsse am Kamp vom 6. bis 17. August 2002 [2]
2.2.4. ZUSAMMENFASSUNG
Bemerkenswert an den abgelaufenen Ereignissen ist, dass großflächig in weiten Teilen
Österreichs vom Westen bis in den Osten 50- bis 100-jährliche Ereignisse beobachtet
werden konnten. Bisher beobachtete Höchstwerte in den einzelnen Regionen wurden häufig
erreicht und zum Teil sogar weit übertroffen.
Abbildung 5 gibt einen Überblick über die Flüsse in den Hochwassergebieten Österreichs,
in denen es zu den im Anschluss beschriebenen Hochwasserschäden kam [Hydroana02/2/].
Gail Gerhard
9625755
9
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
Abb. 5 Übersicht der Hochwasserspitzen vom 6.-13.August 02 [2]
Man kann davon ausgehen, dass Flüsse etwa ab jährlichen Hochwasserspitzen von 30 bis
50 über die Ufer treten und Hochwasserschäden an den Bauwerken in den umliegenden
Gebieten verursachen können.
Neben den Schäden in Österreich waren insbesondere Tschechien (Prag) und Deutschland
(Sachsen, Bayern) am stärksten betroffen, da die Flüsse Elbe und Moldau ebenfalls stark
über die Ufer traten und so die ,,Jahrhundertflut" ihren Lauf nahm. Einen Eindruck über die
Überschwemmungen vermittelt Abbildung 6.
Abb. 6 Beispiel für ein stark überflutetes Gebäude im Hochwassergebiet bei Rosenburg (Kamptal) [3]
Gail Gerhard
9625755
10
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
3 ENTSTANDENE SCHÄDEN INFOLGE DES
HOCHWASSERS
3.1 ALLGEMEINE SCHÄDEN
Neben den bislang schon erwähnten Schäden an Gebäuden privater Bauherrn, die sicherlich
einen Großteil der Schäden darstellen, darf man Hochwasserschäden an der Infrastruktur
und den öffentlichen Einrichtungen nicht vergessen.
Die Zerstörung der Hochwässer an Brücken, Straßen oder Gartenanlagen waren
verheerend. Auch die Landwirtschaft und das Gewerbe sind stark vom Hochwasser
betroffen. Vor allem dort, wo Flüsse in Städten stark über die Ufer getreten sind, entstanden
Schäden an historischen Gebäuden oder Industrieanlagen in Milliarden-Euro-Höhe.
Beispiele hierfür sind u.a. die Stadt Dresden in Deutschland, aber auch Prag in Tschechien.
Diese mussten wegen ihrer zu geringen Hochwasserschutzmaßnahmen einen hohen Preis
der Zerstörung zahlen [Detail02/35/].
Im Allgemeinen unterscheidet man direkte und indirekte Schäden, welche an den
betroffenen Gebäuden zu verzeichnen sind:
· Direkte Schäden:
Der Schaden tritt durch die direkte Einwirkung des Wassers und den mitgeführten Stoffen
ein. Vernässung und Schmutzeinlagerung führen zu teilweisem bis vollständigem
Wertverlust an der Gebäudestruktur
3)
(Böden, Wände, Decken, Installationen) und am
Gebäudeinhalt. In Einzelfällen kann auch die Tragstruktur betroffen sein (Auftrieb, Erosion).
Mit Öl oder Fäkalien kontaminiertes Wasser kann bei Objekten allein durch die ein-
gelagerten Geruchsstoffe zu einem Totalschaden führen.
Insbesondere sind die Schäden an elektrischen oder mechanischen Apparaten,
Einrichtungen sowie Mobilar der einzelnen Gebäude meist irreversibel. EDV-Anlagen sind
selbst nach vollständiger Trocknung unbrauchbar.
Dazu gehören auch im landwirtschaftlichen Bereich auch die Verluste an Viehbestand und
der Ernte.
3)
Unter der Gebäudestruktur versteht man die Konstruktionsweise des Bauwerks.
Gail Gerhard
9625755
11
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
· Indirekte Schäden
Als indirekte Schäden ökonomischer Art werden Betriebsunterbrechungen, unterbrochene
Infrastruktur (Ver- und Entsorgung), die Kosten für Provisorien sowie der erlittene
Marktverlust bezeichnet. Diese können in finanzieller Hinsicht, insbesondere im Gewerbe-
und Industriebereich, die direkten Schäden übersteigen.
Weitere Beispiele hierfür sind Reinigungskosten, Produktionsausfall, Unterbringungskosten
während der Renovierung oder auch Grundstückspreisverluste [Hwvor02/1/].
3.2 SCHADENSTYPEN
Dieses Kapitel zeigt mögliche Schadensbilder auf, ohne jedoch auf eine Unterscheidung der
Verwendung der Baustoffe der beiden in dieser Arbeiten behandelten Bauweisen
(Leichtbauweise und Massivbauweise) einzugehen, da beispielsweise in der Gründung keine
Unterschiede zwischen den Bauweisen festzustellen sind.
In der Bauschadensanalyse unterscheidet man bei Hochwasser drei große Gruppen von
Schadenstypen:
· statisch relevante Schäden (vgl. Abschnitt 3.2.1)
· allgemeine Feuchteschäden (vgl. Abschnitt 3.2.2)
· Schadstoffkontaminationen (vgl. Abschnitt 3.2.3)
Wichtig bei jeglicher Art von aufgetretenen Schäden, ist deren genaue Erfassung und
Dokumentation. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass möglichst viel Bildmaterial und
Zeichnungen angefertigt werden, um eine detaillierte Bauschadensanalyse durchführen zu
können [Rahn02/4/].
3.2.1 STATISCH RELEVANTE SCHÄDEN
Diese Schäden haben sicherlich die größte Bedeutung bei der Bauschadensanalyse, da
diese Schäden die Standsicherheit des Gebäudes und somit die Bewohner und auch
Nachbargebäude gefährden können.
Man könnte sie wie folgt einteilen:
· Schäden im Gründungsbereich
· Schäden durch mechanische Einwirkung
· Schäden durch Überlastung durchnässter Bauteile
Gail Gerhard
9625755
12
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
3.2.1.1 SCHÄDEN IM GRÜNDUNGSBEREICH
Für Schäden im Gründungsbereich sind mehre Faktoren verantwortlich. Dazu zählt in erster
Linie die Unterspülung der Fundamente oder Bodenplatten.
Dies ist vor allem bei Streifenfundamenten sehr problematisch, da diese dadurch punktweise
versagen können, und so den Gebäudelasten schneller nachgeben, als eine durchgehend
aufliegende Bodenplatte.
Dieses Schadensbild kann natürlich leichter bei flach gegründeten Bauwerken auftreten oder
bei Gebäuden in Hanglage. Besonders einsturzgefährdet sind jene Bauwerke, deren
Gründungen einer starken Strömung auf nichtbindigen Kies- oder Sandböden ausgesetzt
sind. Die Strömungen bewirken ein Auswaschen einzelner Bodenteilchen, und es entstehen
dadurch Hohlräume unter den Fundamenten, welche in jedem Fall zu Setzungen, oder im
schlimmsten Fall auch zum Einsturz führen können.
Abhilfe könnte da eine stabile aber leichter durchströmbare Filterschicht unter den
Fundamenten schaffen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Schädigung durch drückendes Grundwasser, welches
das ,,Aufschwimmen" des Gebäudes verursachen kann, falls die Gebäudelasten geringer
sind, als die Auftriebskräfte des Wassers.
Auch die seitlichen Kellerwände sind durch den Anstieg des Grundwassers und den daraus
resultierenden hohen hydrostatischen Druck einsturzgefährdet. Diese Gefahr besteht jedoch
eher bei älteren Gebäuden, die noch keine Stahlbetonunterkellerung aufweisen, da die alten
Mauerwerksgewölbe diesen Lasten nicht gewachsen sein könnten. Bei neueren Gebäuden
mit Stahlbetonwänden stellt der erhöhte Wasserdruck keine oder nur eine geringe
Gefährdung dar.
Erklärung ,,Auftriebskraft"
Steigt das Grundwasser über das Niveau der Gründungssohle, entstehen Wasserdruck und
Auftriebskräfte. Die Größe der Auftriebskraft hängt von dem durch das Gebäude verdrängten
Wasservolumen und somit von der Höhe des Wasserstandes ab. Die Auftriebskraft nimmt
mit dem verdrängten Wasservolumen zu [HWSF02/6/].
Folgende Abbildungen (Abb. 7 und Abb. 8) verdeutlichen diese Problematik:
Gail Gerhard
9625755
13
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
Abb. 7 Anstieg des Grundwassers [6]
Folgende Zahlenwerte stellen den
Druck auf die Wände und der
Bodenplatte dar.
Annahme:
Überschwemmungshöhe: 1,5 m
Wasserstandshöhe: 5m
Hydrostatischer Druck p auf die
Wand und die Bodenplatte:
p=h*g*
w
= 5*9,81*1=49,05 kN/m²
oder 0,05 N/mm²
p
Abb. 8 Resultierende hydrostatische Drücke [6]
Die meisten Einfamilienhäuser weisen jedoch nicht das ausreichende Eigengewicht auf, um
der Auftriebskraft zu widerstehen. Falls die Gefahr besteht, dass die Gebäudelast den
Auftriebskräften nicht widerstehen kann, ist eine Teilflutung des Gebäudes die einzige
Möglichkeit, einem Schadensfall, der wahrscheinlich den Abriss des Gebäudes bedeuten
würde, entgegen zu wirken. Diese Flutung sollte dann, wenn möglich, gezielt durchgeführt
werden. Das heißt, nur in Räume, die keine besondere Schädigung durch Hochwasser zu
Gail Gerhard
9625755
14
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
erwarten haben. Weiters sollte versucht werden, die Flutung nur mit sauberem Wasser
durchzuführen; grobe Verunreinigungen sollten aus dem Wasser entfernt werden.
Weitere Problematiken in Bezug auf ein Fundamentversagen können die Plastifizierung von
bindigen Böden, hydraulischer Grundbruch, sowie ein großflächiger Geländebruch (im
Speziellen bei Hanglagen), sein.
Erklärung ,,Hydraulischer Grundbruch"
Unter einem hydraulischen Grundbruch wird der Aufbruch eines Bodenkörpers bei
überwiegend aufsteigender Grundwasserströmung verstanden, wenn das Eigengewicht
eines unter Auftrieb stehenden Körpers zuzüglich der Reibungskräfte kleiner als die
Grundwasserströmungskraft wird [Hwhb98/7/].
Der Anstieg des Grundwasserspiegels hat dort, wo ein Gebäude schon im Grundwasser
gebaut wurde, weniger Folgen als bei jenen Bauwerken, bei denen der Grundwasserspiegel
weit unter der Fundamentsohle liegt, da hier meistens auf eine wasserdichte Gründung
verzichtet wurde. Aus diesem Grund ist es dem Wasser ungehindert möglich, in das
Bauwerksinnere zu gelangen.
SCHADENSBILDER
Folgen dieser bisher angeführten Schäden sind in den meisten Fällen sichtbar und können
aus diesem Grund eventuell auch nach einer Bestandsaufnahme behoben werden.
Mögliche Schadensbilder können sein:
· Bodenverformungen im unmittelbaren Gebäudebereich
· teilweise freigelegte Gründungsbauteile (Fundamente, Bauwerkssohle, Kellerfuß-
böden etc.)
· Schäden, Verformungen oder Risse an Gründungsbauteilen (Fundamentbereiche
oder Bauwerkssohlenbereiche)
· Schiefstellung oder Setzungen des Gebäudes
· Rissbildungen (in Außenwänden vom Dach bis zum Keller etc.)
· Schiefstellungen von Bauteilen innerhalb des Gebäudes (Fensterkonstruktionen,
Türkonstruktionen, Deckenkonstruktionen)
Gail Gerhard
9625755
15
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
Mit Hilfe einfachster Mittel wie Lot, Wasserwaage oder professionellen Messgeräten, welche
Setzungen oder Baugrundverformungen messen, können derartige Schäden quantifiziert
werden.
3.2.1.2 SCHÄDEN DURCH MECHANISCHE EINWIRKUNGEN
Diese Schäden schließen nahtlos an das vorherige Kapitel an, wenn man deren
Auswirkungen auf das Gebäude heranzieht.
Sie entstehen infolge des enormen Wasserdrucks bei einer überwiegend dynamisch
auftretenden Überschwemmung oder durch den Anprall von mitgeschwemmten
Gegenständen in der Flut (z.B. Autos, Gebäudeteile, Äste, Baumstämme, etc.).
Es entstehen Risse oder Verformungen an tragenden und/oder nichttragenden Bauteilen,
welche das Bauwerk erheblich schädigen.
Weiters fallen in diesen Bereich der Bauschäden die beschädigten, sich lösenden oder
bereits herabgefallenen Bauteile, wie Dachziegel, Dachrinnen, Verglasungen oder
Fassadenbauteile.
3.2.1.3 SCHÄDEN DURCH ÜBERBEANSPRUCHUNG DURCHNÄSSTER
BAUTEILE
In diesem Fall handelt es sich um Verformungen oder Rissbildungen von Wand- oder
Deckenkonstruktionen infolge einer ständigen Durchfeuchtung bei Hochwasser. Die
Zunahme des Gewichts einer wassergesättigten Geschoßdecke kann deren Tragfähigkeit
beeinflussen, weil das Eigengewicht deutlich steigt und die Tragfähigkeit durch
Feuchteeinflüsse eventuell geringer wird. Das Aufweichen von Wand- oder
Deckenbaustoffen kann ebenfalls eine Beeinträchtigung der statischen Standsicherheit
darstellen. Besonderes betroffen sind in diesem Fall Bauten aus Holz oder Lehm, auf deren
Schäden aber im Kapitel 5 und 6.6 noch ausführlicher eingegangen wird. Gerade
Holzbalkendecken mit ihren Füllstoffen, wie z.B Lehm oder Bauschutt sind besonders stark
von diesem Schadensfall betroffen. Ausführlicher behandle ich das Thema speziell unter
Punkt 5.5.4.
Gail Gerhard
9625755
16
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
3.2.1.4 FAZIT UND BILDER
Die meisten dieser angesprochenen Hochwasserschädigungen führen eigentlich
anschließend zum Abriss der betroffenen Gebäude. In jedem Fall sollte ein Statiker oder
Bausachverständiger diese Schäden begutachten.
Folgende Bilder (Abbildungen 9-13) sollen einen Eindruck der Wasserkräfte an zerstörten
Gebäuden vermitteln [Dokuhw02/8/].
Abb. 9 und 10 Einsturz eines Gebäudes durch Versagen des Fundaments infolge Unterspülung [8].
Abb. 11 Setzungsgefährdetes Gebäude infolge Fundamentunterspülung [8]
Gail Gerhard
9625755
17
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
Abb. 12 Risse im Mauerwerk infolge Fundamentversagens [8]
Abb. 13 Riss im Mauerwerk infolge Setzungen [8]
Gail Gerhard
9625755
18
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
3.2.2 ALLGEMEINE FEUCHTESCHÄDEN
Nach dem Abpumpen oder dem natürlichen Abfluss des Hochwassers werden die
Auswirkungen des Wassers an Wand- und Deckenverkleidungen sichtbar.
Offensichtliche Oberflächenschäden können sein:
· Durchfeuchtungen (dunkle Verfärbungen)
· Abtrocknungsspuren (Wasserstandslinien)
· Ausblühungen (Putz, Gipskarton, Mauerwerk)
· Abplatzungen von Beschichtungen (Anstriche etc.)
· Abplatzungen an Putzen
· Verfärbungen, Aufquellen von Bauteilen (z. B. Fenster, Türen, Parkett,
Wandbekleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen)
· Algen- und Pilzansiedlungen (Schimmelpilze, Algen etc.)
· Korrosion metallischer Verkleidungen oder Verbindungen
Besonders an den Wänden und Fußbodenkonstruktionen wird das Schadensausmaß
sichtbar, daher empfiehlt es sich, die in den folgenden Kapiteln angeführten
Sanierungsmaßnahmen einzuhalten, um etwaige Folgeschäden zu verhindern.
3.2.3 SCHADSTOFFKONTAMINATIONEN
Da der Zufluss von Oberflächenwasser nie frei von Verunreinigungen aller Art ist, muss
dieser Punkt gesondert behandelt werden. Durch die Zerstörung bzw. durch den Überlauf
der umliegenden Kanalisation können Fäkalien in das Hochwasser gelangen, was zu
irreversiblen Feuchteschäden führen kann.
Selbst schon die vorhandene Verschmutzung des Flussgewässers, sowie jeglicher ähnlicher
Verschmutzung des Wassers, wie z.B. Schlammablagerungen, können zu einer lang
anhaltenden Geruchsbeeinträchtigung, z.B. in den Wandkonstruktionen führen.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die sichtbaren Ölfilme auf der Wasseroberfläche, welche
unter anderem durch das Auslaufen von Öltanks verursacht werden. Das in vielen vom
Hochwasser betroffenen Wohngebäuden zum Heizen verwendete Öl kann in weiterer Folge
enorme Schäden am Bauwerk verursachen, da im Fall des Auslaufens ein Austausch ganzer
Gail Gerhard
9625755
19
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
Wände erforderlich werden könnte. Im Extremfall kann es zu einem Abbruch der Gebäude
aufgrund geruchsbelästigter Öldämpfe kommen, ohne dass statisch relevante Abrissgründe
vorliegen.
Daher gilt es, diese Öltanks in Zukunft extra zu sichern, um ihr Auslaufen bei Hochwasser zu
verhindern. Eine Alternative wäre, in Hochwassergebieten völlig auf diese Heizform zu
verzichten, da unmittelbar nicht nur das Haus selbst betroffen ist, sondern Gebäude in der
Nachbarschaft ebenfalls gefährdet sind.
In jedem Fall ist ein etwaiger Kontaminierungsgrad der Bauteile von Sonderfachleuten
festzustellen, bevor die Sanierung des Gebäudes beginnt (Abb. 14).
Abb. 14 Schlammbelastete Innenwand [8]
Nachstehend werden in den Kapiteln 5 und 6, unterteilt in Leichtbauweise und
Massivbauweise Schäden dieser Arten, deren Auswirkungen und deren Sanierung
beschrieben.
Weiters werden in diesen Kapiteln nicht nur die oberflächlichen Schäden aufgezeigt, sondern
es werden auch Veränderungen in der Struktur behandelt.
Gail Gerhard
9625755
20
Verhalten von Leicht- und Massivbauweisen unter der Einwirkung von Hochwasser
4 VERHALTEN VON BAUSTOFFEN BEI
FEUCHTEEINWIRKUNG
4.1 ALLGEMEINES
Dieses Kapitel gibt den Überblick über das Feuchteverhalten einzelner Baustoffe. Im
Speziellen werden natürlich die für diese Diplomarbeit relevanten Baustoffe Holz, Ziegel und
Beton behandelt, jedoch sind dazu zum Vergleich die feuchtetechnischen Größen anderer
Baustoffe in den Tabellen 2 bis 4 ebenfalls angeführt.
Die feuchtetechnischen Eigenschaften von Baustoffen haben immer eine große
bautechnische Bedeutung, da bereits unter Normalbedingungen durch ungewollte
Baufeuchte ein großes Maß an Bauschäden festzustellen sind. Feuchte kann in
unterschiedlicher Form wie Schnee, Regenwasser oder Wasserdampf auf das Bauwerk und
dessen Baustoffe einwirken.
Die durch das Hochwasser verursachten Wasseranfälle übersteigen die herkömmlichen
Feuchtewerte um ein Vielfaches.
Da der Feuchtigkeitsschutz in der Bauphysik eng mit dem Wärmeschutz zusammenhängt, ist
bei einer Durchfeuchtung einzelner Bauteile deren Wärmedurchlasswiderstand gemindert.
Auch die Festigkeit und Dauerhaftigkeit der Baustoffe sind durch die Feuchte in der Regel
beeinträchtigt.
4.2 FEUCHTETECHNISCHE GRÖßEN
4.2.1 BEGRIFFE
Die wesentlichsten Begriffe sollen zum besseren Verständnis der Wirksamkeit von Wasser in
Baustoffen dienen:
· Feuchtigkeitsgehalt [M-%]:
Dieser bezeichnet die Feuchtigkeit, die in einem Baustoff enthalten ist, bezogen auf
das Trockengewicht des Stoffes.
· Durchfeuchtungsgrad [%]
Dieser gibt an, wie viel an Feuchtigkeit, bezogen auf die maximale Wasseraufnahme,
bereits im Baustoff vorhanden ist.
· Wasseraufnahmekoeffizient A [kg/m²h
0.5
]:
Dieser ist ein Kennwert, der das baustoffspezifische Vermögen, Wasser
aufzunehmen, angibt. Er beschreibt die Wassermenge, die beim Eintauchen von
Baustoffen aufgesaugt wird, bezogen auf die Saugfläche in kg/m² und die Tauchzeit.
Gail Gerhard
9625755
21
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832474461
- ISBN (Paperback)
- 9783838674469
- DOI
- 10.3239/9783832474461
- Dateigröße
- 3.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Wien – Bauingenieurwesen, Baustofflehre, Bauphysik und Brandschutz
- Erscheinungsdatum
- 2003 (November)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- schäden wandkonstruktionen leichtbauweise massivbauweise vergleich bauweisen hochwasserschutz
- Produktsicherheit
- Diplom.de