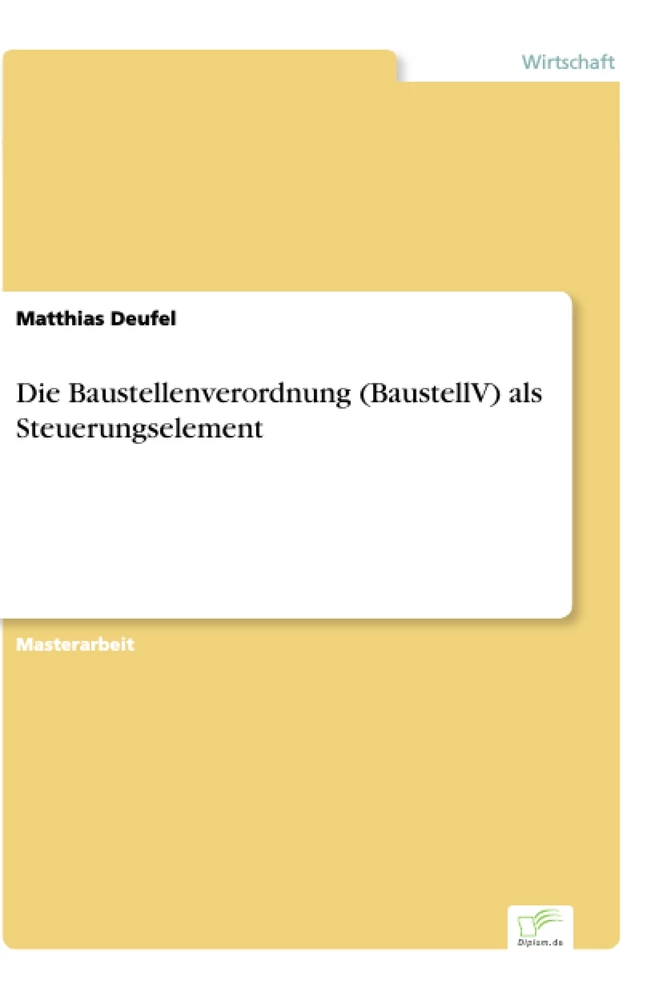Die Baustellenverordnung (BaustellV) als Steuerungselement
Zusammenfassung
Die vorliegende Master Thesis befasst sich mit den Steuerungseigenschaften und Umsetzungsherausforderungen der Baustellenverordnung (BaustellV).
In seinem chronologischen Vorgehen widmet sich der Verfasser zunächst einer Vergangenheitsbetrachtung, in der er die Notwendigkeit des gesetzgeberischen Eingreifens verdeutlicht, den europäischen und nationalen Weg zur BaustellV aufzeigt und den Inhalt der BaustellV beschreibt.
In der Gegenwartsbetrachtung differenziert der Verfasser in einen Praxis- und Theorieteil.
Aus den Ergebnissen einer gezielten Umfrageaktion, einer umfangreichen Literatur- und Internetrecherche und eigener Erfahrungen kommt der Verfasser zu einem fundierten Praxisbericht.
Im theoretischen Teil überprüft der Verfasser die BaustellV bezüglich ihrer Steuerungseigenschaften, wozu er tätigkeits- und eigenschaftsbeschreibende Attribute untersucht sowie Auswirkungen auf die originären Steuerungsgrößen analysiert.
Widersprüche aus Theorie und Praxis erfordern eine grundlegende Zukunftsbetrachtung. Darin entwickelt der Verfasser ein ganzheitliches und nachhaltiges Integrationsmodell für die BaustellV, das der Angleichung von theoretischem Ansatz und praktischer Auswirkung dient und der BaustellV zu einem wirksamen Anwendungsgrad verhilft.
In der abschließenden Diskussion nimmt sich der Verfasser den Übertragbarkeiten der Ergebnisse an und zeigt zahlreiche Schwachstellen der BaustellV auf.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
0.Einführung1
1.Die BaustellV3
2.Die BaustellV in der Anwendung23
3.Die BaustellV als Steuerungselement31
4.Integrationsmodell44
5.Diskussion71
6.Zusammenfassung78
7.Anhang81
0.Einführung1
0.1Problemfeststellung1
0.2Zielformulierung1
0.3Vorgehen1
1.Die BaustellV3
1.1Notwendigkeit der BaustellV3
1.1.1Einführung3
1.1.2Unfallzahlen der Industriebranchen3
1.1.3Unfallarten4
1.1.4Unfallursachen5
1.1.5Unfallopfer6
1.1.6Folgerung7
1.2Weg der BaustellV7
1.2.1Zuständigkeit7
1.2.2Umsetzung in Europa9
1.2.3Umsetzung in Deutschland10
1.3Inhalt der BaustellV10
1.3.1Allgemeines10
1.3.2Grundsätze nach § 4 ArbSchG13
1.3.3Vorankündigung14
1.3.4Koordinator15
1.3.5SiGe-Plan19
1.3.6Unterlage19
1.3.7Zusammenfassung20
2.Die BaustellV in der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
0. Einführung
0.1 Problemfeststellung
0.2 Zielformulierung
0.3 Vorgehen
1. Die BaustellV
1.1 Notwendigkeit der BaustellV
1.1.1 Einführung
1.1.2 Unfallzahlen der Industriebranchen
1.1.3 Unfallarten
1.1.4 Unfallursachen
1.1.5 Unfallopfer
1.1.6 Folgerung
1.2 Weg der BaustellV
1.2.1 Zuständigkeit
1.2.2 Umsetzung in Europa
1.2.3 Umsetzung in Deutschland
1.3 Inhalt der BaustellV
1.3.1 Allgemeines
1.3.2 Grundsätze nach § 4 ArbSchG
1.3.3 Vorankündigung
1.3.4 Koordinator
1.3.5 SiGe-Plan
1.3.6 Unterlage
1.3.7 Zusammenfassung
2. Die BaustellV in der Anwendung
2.1 Einführung
2.2 Umfrage
2.2.1 Methodik
2.2.2 Adressaten
2.3 Ergebnisse
2.3.1 Beratung
2.3.2 Bestellung
2.3.3 Vorankündigung
2.3.4 SiGe-Plan
2.3.5 Unterlage
2.3.6 Erwartung
2.3.7 Akzeptanz
2.3.8 Einfluss und Beeinflussung
2.4 Zusammenfassung
3. Die BaustellV als Steuerungselement
3.1 Einführung
3.2 Der Steuerungsbegriff
3.3 Der Bauprozess
3.3.1 Allgemeines
3.3.2 Steuerungsgrößen
3.3.3 Steuerungsmittel
3.4 Steuerungsanalyse der BaustellV
3.4.1 Allgemeines
3.4.2 SiGeKo-Attribute
3.4.3 Auswirkungen auf die Steuerungsgrößen
3.5 Zusammenfassung
4. Integrationsmodell
4.1 Einführung
4.2 Struktur
4.2.1 Koordinationsverantwortlichkeiten
4.2.2 Organigramm
4.2.3 Folgerung
4.3 Inhalt
4.3.1 Einführung
4.3.2 Die Steuerungsmittel des SiGeKo
4.3.3 Einbindung der SiGeKo-Steuerungsmittel
4.3.4 Folgerung
4.4 Person
4.4.1 Einführung
4.4.2 Anforderungsprofil
4.4.3 Potentielle SiGeKo-Personengruppen
4.4.4 SiGeKo Planungsphase
4.4.5 SiGeKo Ausführungsphase
4.5 Zusammenfassung
5. Diskussion
5.1 Ergebnis
5.2 Übertragbarkeiten
5.3 Ausblick
6. Zusammenfassung
7. Anhang
7.1 Literaturverzeichnis
7.2 Abkürzungsverzeichnis
7.3 Abbildungsverzeichnis
7.4 Tabellenverzeichnis
7.5 Frage-/Interviewbogen
7.6 Eidesstattliche Erklärung
0. Einführung
0.1 Problemfeststellung
Seit dem 01. Juli 1998 ist die „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV)“ in Kraft.
Seit diesem Zeitpunkt gibt es mit dem „Koordinator“ einen neuen am Baugeschehen Beteiligten und geistern Schlagworte wie „Vorankündigung“, „Dritter“, „SiGe-Plan“ und „Unterlage“ durch den Blätterwald der Bau- und Immobilienbranche.
Seit ihrer Einführung begleiten Un- und Halbwissenheit sowie die Stimmenvielfalt derer die BaustellV, die dabei von einem hinzunehmenden Übel bis hin zu einem revolutionären Instrument sprechen.
Zwar erfreut sich die BaustellV – allein schon aufgrund der Zeitachse – inzwischen wachsender Bekanntheit, aber erfreut sie sich auch wachsender Bedeutung?
Es mehren sich die Fragen, ob eine wachsende Bekanntheit und ggf. eine wachsende Bedeutung ausreichen, um mit der BaustellV ein wirksames und damit steuerndes Instrument zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz zu haben.
0.2 Zielformulierung
Der Verfasser will ein halbe Dekade nach Einführung der BaustellV deren Eignung als Steuerungselement überprüfen und ein ganzheitliches und nachhaltiges Integrationsmodell für die BaustellV entwickeln.
0.3 Vorgehen
Den Bogen vom festgestellten Problem – der Bedeutung der Baustellenverordnung und Ihre Eignung als Steuerungselement – zum formulierten Ziel – der Überprüfung der Steuerungseigenschaft der BaustellV und der Entwicklung eines Integrationsmodells – spannt der Verfasser zunächst durch eine Vergangenheits- und Gegenwartsbetrachtung.
Darin spielen Hintergründe und Notwendigkeiten für eine BaustellV ebenso eine Rolle wie ein Praxis- und Erfahrungsbericht aus fünf Jahren gelebter Anwendung der BaustellV.
Eine sich daran anschließende Analyse der BaustellV liefert dem Verfasser die Erkenntnisse zur Entwicklung eines Integrationsmodells für eine wirksame, ganzheitliche und nachhaltige zukünftige Anwendung der BaustellV.
Im methodischen Vorgehen konzentriert sich der Verfasser auf die Säulen
- Literatur- und Internetrecherche
- Analyse der BaustellV sowie bestehender Prozesse
- Umfrageaktion
Das breit und mannigfaltig gefächerte Feld des Bauens bedingt eine Eingrenzung des dieser Master Thesis zugrundeliegenden Betrachtungsrahmens.
Den nachfolgend dargestellten Ausführungen liegen demnach grundsätzlich Objekte des Hochbaus zugrunde.
Dabei kann es sich um
- Neubauten
- Um- und Anbauten
- Sanierungen, Renovierungen, Instandsetzungen
handeln, solange sie unter den Anwendungsbereich der BaustellV fallen.
Auf eine gegebenenfalls notwendig werdende weitere Differenzierung wird an geeigneter Stelle detailliert eingegangen.
1. Die BaustellV
1.1 Notwendigkeit der BaustellV
1.1.1 Einführung
Die BaustellV – ausführlich „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen“ – stellt explizit auf die Begriffe „Sicherheit“ und „Gesundheitsschutz“ ab.
Kapitel 1.1 soll die Notwendigkeit der BaustellV aufzeigen und sich den vorgenannten Begriffen „Sicherheit“ und „Gesundheitsschutz“ annehmen.
Ein erstes und grobes Maß für diese beiden Begriffe kann dabei mit Hilfe statistisch erfasster Unfallzahlen gefunden sowie nach Branchen, Arten und Ursachen strukturiert werden.
1.1.2 Unfallzahlen der Industriebranchen
Die folgende Abbildung stellt die Industriebranchen in Deutschland ihren Unfallzahlen nach gegenüber. Die zugrundeliegenden Daten entstammen Angaben des Hauptverbandes der Berufsgenossenschaften aus dem Jahr 1998, dem Jahr der Einführung der BaustellV.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1-1: Unfallzahlen nach Industriebranchen
Aus Abb. 1-1 ist die rapide Steigerung der Zahl der Arbeitsunfälle je 1 Mio. Arbeitsstunden vom Gesundheitsdienst, der seinem Namen gewissermaßen alle Ehre erweist, bis zur Baubranche erkennbar.
Einerseits unterscheiden sich die einzelnen Branchen hinsichtlich Art, Komplexität, Vielfalt, Struktur, Personal, Ausbildung etc. voneinander, was einen direkten Vergleich nur bedingt erlaubt.
Andererseits ist jedoch auffällig, dass
- in Branchen anspruchsvoller, komplexer und gefährlicher Tätigkeiten (z. B. Chemie) deutlich geringere Unfallzahlen vorherrschen und
- die Unfallzahlen am Bau im Mittel mehr als doppelt so hoch sind wie in der „übrigen“ gewerblichen Wirtschaft.
Ein Abgleich mit den Statistiken anderer europäischer Länder hat ein ähnliches Verhältnis der dortigen Baubranche zur gewerblichen Wirtschaft ergeben.
1.1.3 Unfallarten
Nach [1] können schwere Unfälle auf Baustellen nach folgenden Arten differenziert werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1-2: Hauptarten schwerer Unfälle auf Baustellen
Abb. 1-2 lässt erkennen, wonach zwei Drittel aller schweren Unfälle auf nur drei Ursachen – Stürze, Transportvorgänge und Massen in Bewegung – zurückzuführen sind und überhaupt die Stürze den mit Abstand größten Einzelanteil aller Unfallarten haben.
1.1.4 Unfallursachen
In [1] wurden neben den schweren Unfällen auch die tödlichen Unfälle einer gesonderten Betrachtung unterzogen. Den tödlichen Unfällen macht [1] drei Quellen verantwortlich.
Abb. 1-3: Ursachen tödlicher Unfälle
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mängel und Fehler bei Planung, Organisation und Ausführung bedingen Unfälle. Dabei sind über 60 Prozent aller tödlicher Baustellenunfälle auf Entscheidungen und Maßnahmen vor Beginn der Bauausführung zurückzuführen.
Hierbei werden in [1] unter „Planung“ Maßnahmen wie eine durchdachte architektonische Planung, eine frühzeitige Montage von Sicherheitseinrichtungen, eine gezielte Auswahl der Ausführungsart und der verwendeten Baustoffe, eine günstige Gestaltung der Arbeitsstätten und eine gezielte Planung wie Bereitstellung gemeinsam genutzter sicherheitstechnischer Einrichtungen verstanden.
Unter „Organisation“ wird in [1] auf die zeitliche und/oder örtliche Trennung nicht miteinander zu vereinbarenden Tätigkeiten, der wirkungsvollen Abstimmung zwischen verschiedenen Arbeitgebern, der Festlegung einer Personalobergrenze und einer Beachtung der Wechselwirkungen von und zwischen Technologien abgehoben.
Eine fundierte Ausbildung, die Beachtung von Vorschriften, das Erteilen und Befolgen von Anweisungen, keine Druckausübung durch Vorgesetzte u. a. leitet sich aus [1] zum Segment der „Ausführung“ ab.
1.1.5 Unfallopfer
Nach [1] sind die häufigsten Unfallopfer
- Ausländische Arbeitnehmer (1,5 mal öfter als Arbeitnehmer im Durchschnitt)
- Junge Arbeitnehmer
- Im Unternehmen oder auf der Baustelle neu Eingestellte
- Arbeitnehmer über 45 Jahren
- Zeitarbeitnehmer
- Selbstständige
- Beschäftigte von Unternehmen, die kurzfristig auf Baustellen arbeiten bzw. die wenige Arbeitnehmer beschäftigen (weniger als 10 Arbeitnehmer).
[2] bezifferte die Kosten aus Unfällen auf Baustellen im Jahr 1998 auf 13.000 DM im Durchschnitt. Die Kosten für einen tödlichen Unfall belaufen sich mit 700.000 DM auf über das 50fache eines durchschnittlichen Unfalls.
In [2] wird zur Situation von Sicherheit und Gesundheit auf dem Bau in Deutschland weiter ausgeführt:
- Durchschnittlich 18 Tage Arbeitsunfähigkeit je Beschäftigter und Jahr
- 40 Prozent aller Arbeitsunfähigkeiten dauern länger als sechs Wochen
- Nur vier Prozent aller Arbeitsunfähigkeiten sind Fehlzeiten bis zu drei Tagen
- 50 Prozent aller Bauarbeiter müssen aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Rente
- Durchschnittliches Renteneintrittsalter (Frühinvalidität) liegt bei 53 Jahren
1.1.6 Folgerung
Dem hohen Unfallstand in der Baubranche liegt die Charakteristik
- höchster Ausländeranteil (mit einer weiteren Zunahme der ausländischen Arbeitnehmer ist innerhalb des Binnenmarktes der EU zu rechnen),
- Kostendruck und dadurch Einsatz von billigen, ungelernten und angelernten Arbeitnehmern, die Technologien nicht beherrschen und Gefahren unterschätzen,
- unterentwickeltes sicherheitsgerechtes Verhalten und Wissen von Arbeitnehmern und Verantwortlichen sowie
- Bauen unter Kosten- und Termindruck (baubegleitende Planung)
zugrunde.
„Bauen ist gefährlich“, könnte die prägnante Kurzform der vorangegangenen Ausführungen sein, ergänzt um die Bemerkung „Unfälle sind teuer“.
Der jährlich durch Unfälle entstehende humanitäre wie volkswirtschaftliche Schaden, von Auswirkungen auf Image und Attraktivität einer Branche ganz zu schweigen, ist immens.
Der Missstand höchster Unfallzahlen und großer Schäden bildete die Handlungsaufforderung an den Gesetzgeber, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
1.2 Weg der BaustellV
1.2.1 Zuständigkeit
In Kapitel 1.1 wurde die Gefährlichkeit des Bauens und die humanitäre wie volkswirtschaftliche Notwendigkeit des Eingreifens durch den Gesetzgeber dargestellt.
Hierbei stellt sich die grundsätzliche Frage nach dem zuständigen Gesetzgeber.
Durch die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union (damals, 1998, noch Europäische Gemeinschaft) treten in Teilbereichen Organe der Europäischen Union (EU) an die Stelle bisheriger nationaler Souveränität.
Eine der Aufgaben der EU findet sich in der Angleichung (Harmonisierung) bisher unterschiedlicher Regelungen und Verhältnissen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Die europäische Harmonisierungspolitik ist im EU-Vertrag festgeschrieben und wird durch den Erlass von Verordnungen und Richtlinien vollzogen.
Dabei gelten Verordnungen der EU unmittelbar, während Richtlinien der EU einer Umsetzung in nationales Recht bedürfen.
Im EU-Vertrag finden sich zwei Artikel, die im Zusammenhang mit der Gefährlichkeit des Bauens einer näheren Betrachtung bedürfen:
Artikel 95
Darin wird ein Aktionsprogramm für einen einheitlichen Binnenmarkt und die Beseitigung steuerlicher, materieller und technischer Schranken beschrieben.
Regelungsgegenstand ist die Harmonisierung der technischen Vorschriften und Normen. Die auf Grundlage Artikel 95 EU-Vertrag erlassenen Harmonisierungsrichtlinien sind ohne Abweichungen dem nationalen Recht zuzuführen.
Artikel 137
Beschreibt das Sozialprogramm für Sicherheit, Hygiene und Gesundheit am Arbeitsplatz und die schrittweise Angleichung im sozialpolitischen Bereich bei gleichzeitiger Fortschreibung.
Regelungsgegenstand sind Mindestvorschriften für die Gestaltung der Arbeitsumwelt.
Die auf Grundlage Artikel 137 EU-Vertrag erlassenen Harmonisierungsrichtlinien enthalten Mindestvorschriften, über die jeder EU-Mitgliedsstaat bei der Umsetzung in nationales Recht hinausgehen kann.
Insbesondere aus Artikel 137 (Arbeitsumwelt) geht die EU als der zuständige Gesetzgeber hervor.
Wird das Problem der Gefährlichkeit des Bauens losgelöst von der EU-vertragsrechtlichen und gesetzgeberischen Situation betrachtet, so erzeugt das Ergebnis der EU-Zuständigkeit auch die dafür erforderliche Akzeptanz und vermittelt deren Richtigkeit.
Der Grund für diese Aussage liegt in den Symptomen des Problems:
Der Baubereich besitzt hinsichtlich Markt, Ausschreibungen, Vergaben, Beschäftigten etc. zahlreiche grenzüberschreitende Komponenten und zugleich in allen EU-Mitgliedsstaaten ähnlich frappierende Unfallzahlen. D. h eine Lösung kann sinnvoll nur Landesgrenzen überschreitend und einheitliche Vorgaben machend durch die EU erfolgen.
1.2.2 Umsetzung in Europa
Basierend auf Artikel 137 des EU-Vertrages wurde die „Richtlinie über die Durchführung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit“, auch als Rahmenrichtlinie 89/391/EWG bezeichnet, erlassen.
Die Zahlen- und Buchstabenfolge weist diese Richtlinie als die mit der Nummer 391 im Jahr 1989 der Europäischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft aus.
Auf Grundlage der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG wurden 14 Einzelrichtlinien (ERL) erlassen, davon folgende für die Bauwirtschaft besonders relevanten ERL:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1-1: Einzelrichtlinien der Rahmenrichtlinie (Auszug)
Bei der Baustellenrichtlinie 92/57/EWG, achte ERL der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG, handelt es sich um die gesetzgeberische Antwort auf die in Kapitel 1.1 dargestellte Gefährlichkeit des Bauens.
In ihrer ausführlichen Fassung lautet die Baustellenrichtlinie „Richtlinie über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz“.
Diese Richtlinie schreibt somit Mindestvorschriften vor, die auf Baustellen für Sicherheit und Gesundheitsschutz anzuwenden sind.
Bei Baustellen handelt es sich um zeitlich begrenzte Baumaßnahmen oder auch um ortsveränderliche Baumaßnahmen wie Linienbauten (u. a. Straße, Brücke, Tunnel, Kanal).
1.2.3 Umsetzung in Deutschland
Die in Kapitel 1.2.2 beschriebenen Richtlinien wurden auf Grundlage von Artikel 137 EU-Vertrag erlassen. Dadurch sind die Mindestvorschriften gegeben, welche die EU-Mitgliedsstaaten – in welcher Form (Gesetz, Verordnung, Richtlinie, ...) auch immer – in nationales Recht transferieren müssen.
In der Bundesrepublik Deutschland erfolgte die Umsetzung der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG auf der Gesetzesebene durch ein neugefasstes Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG).
Die europäische Baustellenrichtlinie wurde in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1998 durch den Erlass der „Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV)“ umgesetzt.
Dabei bediente sich der nationale Gesetzgeber (Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates, siehe [3], Seite 7 und [4], Seite 173) der in § 19 ArbSchG vorbehaltenen Möglichkeit, dem ArbSchG nachrangige Verordnungen zu erlassen.
Daraus – und auch aus dem europarechtlichen Ursprung – wird offensichtlich, dass die BaustellV das deutsche Arbeitsschutzrecht und nicht etwa das deutsche Baurecht ergänzt.
Auf die Darstellung der Umsetzung der weiteren Einzelrichtlinien kann im Zusammenhang mit dem Thema und Inhalt der BaustellV verzichtet werden.
1.3 Inhalt der BaustellV
1.3.1 Allgemeines
Am 18. Juni 1998 wurde die BaustellV [5] verkündet, mit Wirkung vom 01. Juli 1998 trat sie in Kraft.
Adressat der BaustellV ist der Bauherr.
Die BaustellV ergänzt das deutsche Arbeitsschutzrecht um folgende fünf Pflichten für den Bauherrn:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1-2: Pflichten des Bauherrn nach der BaustellV
Eine nähere Erläuterung dieser fünf Pflichten und der den Pflichten 2, 3, 4 und 5 vorangestellten Formulierung „ggf.“ wird in den Kapiteln 1.3.2 bis 1.3.6 vorgenommen.
Die BaustellV besitzt neben acht Paragraphen den Anhang I „Vorankündigung“ und den Anhang II „Besonders gefährliche Arbeiten“.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1-3: Die Paragraphen der BaustellV
Das damalige Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (seit Ende 2002 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) hat unter Beteiligung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, den obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder, der Berufsgenossenschaften, der Bauindustrie, des Baugewerbes und verschiedener Verbände Erläuterungen zu BaustellV erarbeitet.
Mit Fassung vom 15. Januar 1999 erfolgte die Veröffentlichung der Erläuterungen zur BaustellV im Bundesarbeitsblatt 3/1999.
Im Dezember 1999 wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung ein „Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen“ – kurz: ASGB – eingerichtet, dem Vertreter von Bauherren, Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Unfallversicherungsträger und Sachverständigenorganisationen angehören.
Aufgabe und Ziel des ASGB ist die Erstellung von „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen“ – kurz RAB –, welche an die Stelle der Erläuterungen vom 15. Januar 1999 treten und eine Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutzvorschriften für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen auf Baustellen darstellen sollen.
Erste Teile der RAB wurden im Januar 2001 im Bundesarbeitsblatt (BarbBl.) veröffentlicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1-4 zeigt den aktuellen Stand (Juni 2003) der veröffentlichten Fassungen der RAB.
Tab. 1-4: Aktueller Stand der RAB
Die RAB reklamieren für sich „den Stand der Technik bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen“ wiederzugeben.
Der Rechtscharakter der RAB´s ist derzeit Gegenstand umfangreicher, breitgefächerter und konträrer Diskussionen.
Übereinstimmend wird in der Literatur (vgl. auszugsweise [3], Seite 10 und [4], Seite 174) allerdings die Berücksichtigung der RAB empfohlen, um dadurch die von den Arbeitsschutzbehörden zugrundegelegten Maßstäbe zu berücksichtigen.
Das Ziel der BaustellV und damit auch das Grundfundament des ASGB und der RAB wird in § 1 (1) BaustellV definiert. Wörtlich heißt es darin (vgl. [5]):
„Diese Verordnung dient der wesentlichen Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen.“
Unter „Beschäftigte“ wird in [6] auf § 3 (2) ArbSchG abgestellt. Danach handelt es sich um alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines Betriebes.
Durch § 6 BaustellV werden jedoch auch Unternehmer ohne Beschäftigte (Selbstständige) und Arbeitgeber, die selbst auf der Baustelle tätig sind, einbezogen.
Das Einbeziehen von Selbstständigen und Arbeitgeber stellt eine fundamentale Neuerung des deutschen Arbeitsschutzrechtes dar, welches im ArbSchG ausschließlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, jedoch keine Arbeitgeber und Selbstständige kannte.
In § 1 (3) BaustellV wird eine Definition der in § 1 (1) BaustellV auftauchenden Begrifflichkeit „Baustelle“ vorgenommen.
Nach [6] handelt es sich bei einer „Baustelle“ um den Ort, „an dem ein Bauvorhaben ausgeführt wird, bei dem eine oder mehrere bauliche Anlagen auf Veranlassung eines Bauherrn errichtet, geändert oder abgebrochen und die dazugehörigen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten durchgeführt werden.“
Zur Erläuterung der Begriffe „Bauliche Anlage“ und „Änderung“ wird auf [6] verwiesen.
Hervorzuheben bleibt an dieser Stelle, dass die BaustellV nur bei Vorliegen einer Baustelle im Sinne von [5] bzw. [6] gilt.
1.3.2 Grundsätze nach § 4 ArbSchG
§ 2 (1) BaustellV fordert die Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 ArbSchG bereits bei der „Planung der Ausführung“ eines Bauvorhabens.
Unter „Planung der Ausführung“ ist dabei die Planungsphase eines Bauvorhabens zu verstehen.
Die allgemeinen Grundsätze nach § 4 ArbSchG ziehen sich wie ein Roter Faden durch das ArbSchG und die BaustellV und kommen einer sicherheits- und gesundheitstechnischer Bibel nahe, weshalb eine explizite Erwähnung dieser Grundsätze zwingend erforderlich erscheint.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1-5: Allgemeine Grundsätze nach § 4 ArbSchG
Die Grundsätze nach § 4 ArbSchG sind durch die Verantwortlichkeit des Bauherrn bereits in der Planungsphase (z. B. Entwurf, Baubeschreibung, Ausschreibung, ...) des Bauvorhabens zu berücksichtigen und finden auch in den §§ 3, 5 und 6 BaustellV Erwähnung
1.3.3 Vorankündigung
§ 2 (2) BaustellV fordert, der zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine sogenannte „Vorankündigung“ mit Angaben nach Anhang I der BaustellV in den Fällen zu übermitteln, in denen auf einer Baustelle
- die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage beträgt und dabei mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig sind, oder
- der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet.
Die Vorankündigung trifft eine Aussage über die „Größe“ des Bauvorhabens, wobei „Größe“ im Sinne von Dauer gepaart mit Beschäftigtenzahl zu verstehen ist.
Das Arbeitsschutzrecht ist Landesrecht. Die „zuständigen Behörden“ können daher von Bundesland zu Bundesland verschieden bezeichnet, strukturiert und organisiert sein.
In Baden-Württemberg sind die Gewerbeaufsichtsämter die zuständigen Behörden, z. B. in Hessen sind es die Ämter für Arbeitsschutz.
Nähere Angaben zur Vorankündigung sind [6] zu entnehmen.
1.3.4 Koordinator
§ 3 BaustellV beschreibt den Prozess der sogenannten „Koordinierung“ und führt dabei den „Koordinator“ ein.
Bei allen Bauvorhaben, die unter die BaustellV (vgl. Kapitel 1.3.1) fallen, sind demnach beim Tätigwerden von mehr als einem Arbeitgeber ein Koordinator oder auch mehrere Koordinatoren zu bestellen.
Nachfolgend wird nur noch von dem „Koordinator“ gesprochen, was grundsätzlich impliziert, dass es sich dabei auch um mehrere „Koordinatoren“ handeln kann.
Dabei kann der Bauherr oder der von ihm nach § 4 BaustellV beauftragte „Dritte“ die Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen.
Unter „mehr als einem Arbeitgeber“ werden mindestens zwei verschiedene Arbeitgeber/Firmen verstanden, die in den Konstellationen
- alles Hauptauftragnehmer
- Hauptauftragnehmer und Nachauftragnehmer
auftreten können und zeitgleich, teilweise gleichzeitig oder nacheinander auf der Baustelle tätig werden.
Insbesondere bei größeren Baumaßnahmen kommt die Vergabe der Arbeiten an einen Hauptauftragnehmer in der Form eines Generalunternehmers (GU) häufig vor.
Führt dabei der GU nicht alle Arbeiten mit eigenen Beschäftigten sondern durch die Beschäftigten von Nachunternehmern durch, so handelt es sich im Sinne der BaustellV um mehrere Arbeitgeber, die dann wiederum die Existenz eines Koordinators bedingen.
Führt der GU hingegen alle Arbeiten mit eigenen Beschäftigten durch, so handelt es sich nur um einen Arbeitgeber.
Diese Erkenntnis lädt zu einem kleinen Exkurs BaustellV versus VOB/B ein:
Während die VOB/B auf „Auftragnehmer“ abstellt, kennt die BaustellV hingegen nur „Arbeitgeber“. Mindestens ein vorhandener Nachunternehmer ist – in Bezug auf den Bauherr – kein „Auftragnehmer“, sehr wohl aber ein „Arbeitgeber“ und erfüllt somit nach der BaustellV die Voraussetzung zur Bestellung eines Koordinators.
Die Aufgaben des Koordinators werden in § 3 BaustellV in die Phasen während der
- „Planung der Ausführung des Bauvorhabens“ (§ 3 (2) BaustellV) und
- während der „Bauausführung des Bauvorhabens“ (§ 3 (3) BaustellV)
unterteilt.
Während der Planung der Ausführung des Bauvorhabens (auch als „Planungsphase“ bezeichnet) hat der Koordinator nach § 3 (2) BaustellV
- die in § 2 (1) BaustellV vorgesehenen Maßnahmen zu koordinieren,
- den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) auszuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen und
- eine Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen späteren Arbeiten an der baulichen Anlage zu berücksichtigenden Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz zusammenzustellen.
Während der Bauausführung des Bauvorhabens (auch als „Ausführungsphase“ bezeichnet) hat der Koordinator nach § 3 (3) BaustellV
- die Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 ArbSchG zu koordinieren,
- darauf zu achten, dass die Arbeitgeber und die Unternehmer ohne Beschäftigte ihre Pflichten nach dieser Verordnung erfüllen,
- den SiGe-Plan bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anzupassen oder anpassen zu lassen,
- die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu organisieren und
- die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber zu koordinieren.
Zur Definition der Planungsphase wird in [6] vage und interpretierbar formuliert:
„Die Phase der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens beginnt somit spätestens dann, wenn der Entwurf für die Ausführung eines Bauvorhabens hinreichend konkret erarbeitet und dargestellt ist und endet in der überwiegenden Zahl der Fälle mit der jeweiligen Vergabe.“
Dabei kann laut [6] die Planungsphase bei Nebenangeboten, Sondervorschlägen oder bei funktionaler Ausschreibung auch bis zum Beginn der Bauausführung dauern.
Hinsichtlich des Endes der Planungsphase in Form von Vergabe bzw. Baubeginn ist damit Klarheit hergestellt.
Hinsichtlich des konkreten Beginns der Planungsphase liefert auch eine umfangreiche Literaturrecherche nur wenig klare und übereinstimmende Anhaltspunkte.
In [3], Seite 30, wird dazu zurückhaltend formuliert: „Es ist davon auszugehen, dass regelmäßig nach Vorliegen der Baugenehmigung die Vorraussetzungen vorliegen, um die Aufgaben nach der BaustellV anzugehen und damit die Planungsphase beginnt.“ Dies hieße somit in HOAI-Leistungsphase 5.
In [4], Seite 68, heißt es dazu: „Die Tätigkeit des Koordinators beginnt bereits nach der Entwurfsplanung und Erteilung der Baugenehmigung.“
Offen bleibt hierbei, ob denn danach die Planungsphase nach der Entwurfsplanung und somit in HOAI-Leistungsphase 4 oder nach Erteilung der Genehmigung und somit in HOAI-Leistungsphase 5 beginnt.
In [10], Seite 35, wird der Beginn der Planungsphase mit „nach der Genehmigung und vor der Ausschreibung“ und somit in HOAI-Leistungsphase 5 beschrieben.
Die in [11], Seite 13, aufgelisteten Grundleistungen des Koordinators enthalten in Punkt 1.1 die „Analyse der Entwurfs- und Genehmigungsplanung ...“.
Daraus geht jedoch nicht eindeutig hervor, wann denn diese Analyse der Entwurfsplanung zu erfolgen hat. Wird unterstellt, dass eine Analyse einer Entwurfsplanung nicht begleitend sondern erst nach deren Fertigstellung erfolgt, dann kann nach [11] die Planungsphase frühestens – aber nicht zwingend – in HOAI-Leistungsphase 4 beginnen. [11] konkretisiert auf Seite 32, wonach eine Beratungsleistung durch den Koordinator „im Rahmen der Vorplanung und/oder des Prozesses mehrerer Entwurfsplanungen“ keine Grundleistungen sondern besondere Leistungen darstellen.
Zusammenfassend kann aus [6], [3], [4], [6], [10] und [11] der Beginn der Planungsphase mit HOAI-Leistungsphase 4 bzw. HOAI-Leistungsphase 5 festgehalten werden.
Der Verfasser bedauert den Mangel an Eindeutigkeit und Übereinstimmung. Er behält sich eine eigene Interpretation für den Beginn der SiGeKo-Planungsphase im Rahmen des in Kapitel 4 zu entwickelnden Integrationsmodells vor.
Über den Beginn und das Ende der Ausführungsphase schweigt sich [6] aus.
Übereinstimmend wird jedoch in [3], Seite 31, und [4], Seite 115, der Beginn der Ausführungsphase mit dem Einrichten der Baustelle bezeichnet.
Für das Ende der Ausführungsphase kann [3] zugestimmt werden, wenn darin die Fertigstellung im Sinne von mangelfreier Abnahme oder abgestellter Mängel nach der Abnahme (Anmerkung des Verfassers: So es während der Mängelbeseitigung noch Koordinierungsbedarf gibt z. B. hinsichtlich besonders gefährlicher Arbeiten nach Anhang II der BaustellV oder des Tätigwerdens mehrerer Arbeitgeber) genannt wird.
Ähnlich einer konkreten Definition der Planungs- und Ausführungsphase hält es [6] auch mit dem Begriff „Koordinator“.
In [6] wird weder eine Beschreibung des Personenkreises noch die eines Anforderungsprofiles für den „Koordinator“ vorgenommen.
In der Konkretisierung der Begrifflichkeit des „geeigneten Koordinator“ nach § 3 (1) BaustellV wird in [6] lediglich auf [7] verwiesen.
In [7] wird neben den Aufgaben auch das qualifikative Wesensmerkmal des Koordinators umrissen. Danach muss der Koordinator über
- baufachliche Kenntnisse,
- arbeitsschutzfachliche Kenntnisse,
- spezielle Koordinatorenkenntnisse und
- Berufserfahrung
verfügen.
Die darunter zu verstehenden Bestandteile werden in [7] umfangreich erläutert.
Eine weitere, intensiv und kontrovers diskutierte Frage ist die der Honorierung der Leistungen nach der BaustellV, die weder in der Verordnung selbst noch in den Kommentierungen und Konkretisierungen durch die RAB beantwortet wird.
Vertiefende Ausführungen zu Honorierungsfragen bedürften einer separaten Betrachtung. Da sie in diesem Zusammenhang auch im Detail nicht von weiterer Bedeutung für die vorliegende Master Thesis sind, beläßt es der Verfasser mit einem allgemeinen Verweis auf [11].
Nach Auffassung des Verfassers kann mit guten Grund und stellvertretend für wenige etablierte Praxishilfen zur Honorarermittlung auf [11] verwiesen werden, da dort erstmalig eine Differenzierung der Honorarermittlung nicht nur nach anrechenbaren Kosten und einem Schwierigkeitsgrad sondern zusätzlich nach dem Gefährdungsgrad und dem Gefährdungspotential vorgenommen wird.
1.3.5 SiGe-Plan
In der BaustellV wird der SiGe-Plan erstmalig in § 3 Absatz 2 und 3 erwähnt. Der SiGe-Plan ist in der Planungsphase vom Koordinator zu erstellen bzw. erstellen zu lassen und in der Ausführungsphase durch den Koordinator fortzuschreiben bzw. fortschreiben zu lassen.
In [6] erfolgt der Verweis auf [8], worin sich Anforderungen an den Inhalt und die Form eines SiGe-Planes finden.
An späterer Stelle und in einem anderen Zusammenhang wird in der Master Thesis auf den SiGe-Plan eingegangen.
1.3.6 Unterlage
In § 3 (2) BaustellV wird die sogenannte „Unterlage“ genannt. Die Unterlage hat alle erforderlichen Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz zu enthalten, die bei möglichen späteren Arbeiten an der baulichen Anlage zu berücksichtigen sind und ist in der Planungsphase vom Koordinator zu erstellen.
In [6] wird dazu auf [9] und die dort enthaltenen näheren Angaben verwiesen.
Zusätzlich gilt es an dieser Stelle auf zwei Gegebenheiten aufmerksam zu machen:
Zum einen bedingt allein die Existenz eines Koordinators (unabhängig von der Existenz eines SiGe-Planes) die Erstellung einer Unterlage.
Zum anderen ist die Unterlage nach § 3 (2) BaustellV in der Planungsphase „zusammenzustellen“ – im Sinne von fertig zustellen –, da in der Ausführungsphase nach § 3 (3) BaustellV die Unterlage nicht mehr erwähnt wird.
Die in der Literatur (vgl. [4], Seite 97 und [10], Seite 40) oftmals erwähnte „Fortschreibung und Anpassung“ der Unterlage in der Ausführungsphase mag zwar in der Praxis relevant sein, ist aber damit weder dem Wortlaut noch der Intension der BaustellV konform.
Auf die Unterlage wird an späterer Stelle der Master Thesis zurückgekommen.
1.3.7 Zusammenfassung
Mit der BaustellV hat die Bundesrepublik Deutschland die zwingenden europäischen Mindestvorgaben für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen in nationales Recht – genauer: Arbeitsschutzrecht – umgesetzt.
Mit dem Bauherrn findet sich in der BaustellV nicht nur der explizite Adressat und Verantwortliche für die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle wieder, sondern auch die Person/Institution, die von Anfang an mit dem Bauvorhaben verbunden ist.
Mit der BaustellV erfolgt das erstmalig Einbeziehen von Selbstständigen und Arbeitgebern in das deutsche Arbeitsschutzrecht, was eine fundamentale Neuerung darstellt.
Mit dem „Koordinator“ trat dem Baugeschehen ein neuer Beteiligter bei, und mit dem „SiGe-Plan“ und der „Unterlage“ Ausdrucksformen für Leistungsbestandteile des Koordinators und mit der „Vorankündigung“ ein Gratmesser für die Größe eines Bauvorhabens.
Mit der Differenzierung in eine Planungs- und Ausführungsphase entspricht die BaustellV der in Kapitel 1.1.1 dargestellten und den Bereichen „Planung“, „Ausführung“ und „Organisation“ entspringenden Ursachen von Unfällen auf Baustellen.
Mit der bereits in der Planungsphase für das spätere Betreiben der baulichen Anlage zu erstellenden „Unterlage“ spannt die BaustellV den Bogen von der Planung über die Ausführung in die Nutzung und trägt damit erstmalig im Baugeschehen einem nachhaltigen und ganzheitlichen Prozess in ausdrücklicher Form Rechnung.
Mit § 5 BaustellV und in [6] wird das Fortbestehen bisheriger Verantwortlichkeiten der Arbeitgeber (z. B. nach dem ArbSchG) in expliziter Form festgehalten.
Insofern fügt die BaustellV mit dem Bauherrn bzw. dem Koordinator einen weiteren Verantwortlichen hinzu.
Die sich in der BaustellV über verschiedene Paragraphen erstreckenden „wenn-dann-und-oder“-Kombinationen wurden auf der nachfolgenden Seite in Abb. 1-4 mit Hilfe eines Flussdiagrammes der schnelleren Lesbarkeit und einfacheren Anwendbarkeit halber visualisiert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1-4: Flussdiagramm zur Umsetzung der BaustellV
2. Die BaustellV in der Anwendung
2.1 Einführung
Im vorangegangenen Kapitel 1 wurde mit der Erläuterung von Hintergründen und Inhalten der BaustellV gewissermaßen ein „gestriger“ Zustand abgebildet.
Nachdem die BaustellV seit dem 01. Juli 1998 in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft ist, widmet sich dieses Kapitel 2 einem Praxis- und Erfahrungsbericht der „BaustellV in der Anwendung“ und somit der Abbildung eines „heutigen“ Zustandes.
Die nachfolgend aufgezeigte Datenbasis wurde aus drei Hauptquellen erschlossen:
A) Eigene Erfahrungen
Der Verfasser verfügt seit knapp vier Jahren über vielschichtige und umfangreiche Erfahrungen aus seiner Tätigkeit als Koordinator nach der BaustellV, aus einem intensiven Erfahrungsaustausch mit zahlreichen internen und externen Fachkollegen und aus seiner Dozententätigkeit bei Ausbildungen nach [7], Teil C (Spezielle Koordinatorenkenntnisse).
B) Literaturrecherche
Recherche, Studium und Auswertung umfangreicher Literatur (u. a. [3], [4], und [10]), diverser Tagungsunterlagen verschiedener Seminare zum Erfahrungsaustausch unter Koordinatoren sowie zahlreicher Publikationen aus der Fachpresse und dem Internet, wozu stellvertretend auf die Interviewreihe „Erfahrungen mit der Baustellenverordnung“ von Rechtsanwalt Guido Meyer, Rechtsanwälte Kapellmann und Partner, verwiesen wird.
C) Umfrage
Zur Ergänzung, Verbreiterung und Vertiefung eigener und recherchierter Erfahrungen sowie zur gezielten Hinterfragung der sich aus der speziellen Themenstellung der Master Thesis ergebenden Komplexe wurde als dritte Datenquelle auf eigene Umfrageergebnisse zurückgegriffen.
In den nächsten Unterkapiteln erfolgt eine Beschreibung der Umfrageaktion und eine differenzierte Ergebnisbetrachtung.
2.2 Umfrage
2.2.1 Methodik
Die Umfrageaktion erfolgte durch einen standardisierten Fragebogen. Die dabei zugrundeliegende Methodik lässt sich wie folgt charakterisieren:
- Alle 40 Fachfragen zum Ankreuzen
- 16 der 40 Fragen in Ja-/Nein-Antwortform
- Sechs der 40 Fragen zum Ankreuzen in einer Wertungsskala
- 18 der 40 Fragen mit bereits drei bis acht vorgeschlagenen Antworten. Dabei bestand die Möglichkeit, sowohl Mehrfachankreuzungen vorzunehmen als auch Antworten hinzuzufügen
- Bearbeitungszeit ca. 10 bis 15 Minuten
Gründe für dieses Vorgehen lagen in den Grundregeln der Fragebogenmethodik wie „Messbarkeit“, „Vergleichbarkeit“ und „Absehbarkeit“.
Mit „Absehbarkeit“ wurde die voraussichtliche Bearbeitungszeit aus Sicht des Adressaten gesehen. Motivation und Anreiz zur Beantwortung sind dabei vom erwarteten Zeitaufwand und der Art der Fragen/Antworten abhängig.
Dabei animieren Zeitaufwendungen von mehr als 10 bis 15 Minuten und Fragen des Wortlautes „Begründen Sie ...“, „Erläutern Sie ...“, „Erörtern Sie ...“ kaum zu einer durchgängig überzeugten und ernsthaften Beantwortung.
Die Grundregel der „Messbarkeit“ wurde vor allem durch die Antwortformen von Ja/Nein und über Wertungsskalen verwirklicht.
„Vergleichbarkeit“ wird sowohl durch Wertungsfragen als auch durch die Streubreite der Antworten erzielt, weshalb eine Vorgabe von verschiedenen Antworten und die Einräumung von zusätzlichen Antworten die Streubreite und die Bearbeitungszeit minimiert und die Zahl der Fragen maximiert.
Kapitel 7.5 enthält die Originalfassung des Fragebogens.
2.2.2 Adressaten
Die Auswahlmethodik der Adressaten des Fragebogens unterlag einer sensiblen und gezielten Betrachtung und der Prämisse, alle im Umfeld der BaustellV Beteiligten einzubinden.
Dazu wurden an jeweils fünf Personen der sieben Bereiche
- Projektsteuerer
- Architekten
- Bauherrn
- Behörden, Berufsgenossenschaften
- Hochschulen
- Verbände
- Weitere (Generalunternehmer, Koordinatoren nach BaustellV, ...)
insgesamt 35 Fragebogen verteilt.
Allein schon aus zeitlichen wie inhaltlichen Gründen konnten damit keine statistisch repräsentativen Ergebnisse erreicht sondern sollten Fundierungen und Ergänzungen der Datenbasis erzielt werden.
Aufgrund von persönlichen/geschäftlichen Beziehungen zum jeweiligen Adressaten konnte dabei ein hoher Rücklauf erwartet und mit 32 Antworten auch realisiert werden.
2.3 Ergebnisse
2.3.1 Beratung
Die erstmalige Beratung „kleinerer“ Bauherrn (z. B. Einmalbauherr, Ein- und Mehrfamilienhausbau) erfolgt i. d. R. durch seinen Architekten. „Größere“ Bauherrn (eigene Bauabteilung, vielfältige und häufige Bautätigkeiten) haben sich inzwischen selbst darüber aufgeklärt bzw. wurden und werden durch den Projektsteuerer aufgeklärt.
Nach den Erfahrungen des Verfassers hat sich die Beratung des Bauherrn über die letzten Jahre hinweg stetig verbessert. Zurückzuführen ist dies auf die wachsende Bekanntheit (allein schon durch die zunehmende Existenzdauer bedingt) der BaustellV, einen stark verbesserten Kenntnisstand der „Berater“ (z. B. Projektsteuerer, Architekt) des Bauherr und eine aktivere Informations- und Aufklärungspolitik (z. B. mit einem der Baugenehmigung beigelegten Informationsblatt zur BaustellV, auch wenn diese Information für die Planungsphase bereits etwas spät kommt) durch die zuständige Behörde (in Baden-Württemberg die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter).
Über die Tiefe der Beratung gibt es keinen einheitlichen Erfahrungstand. Während die Umfrage ein Gleichgewicht aus der beiläufigen, der detaillierten und der strategischen Beratung ans Licht führt, weiß der Verfasser überwiegend von nur beiläufiger, zur Kenntnis gebender und Pflicht erfüllender Beratung des Bauherrn.
2.3.2 Bestellung
Die Bestellung des Koordinators nach BaustellV erfolgt in aller Regel zwei bis null Wochen vor Baubeginn und somit praktisch zum Ende der Planungsphase.
In erster Linie erfolgt die Auswahl des „geeigneten“ Koordinators über das Honorar. Als weiterer Auswahlparameter wurden „Referenzen“ angeführt.
Strategische Auswahlkriterien wie z. B. bewusst einen internen oder bewusst einen externen Beteiligten als Koordinator auszuwählen wurden selten genannt.
Nachgewiesene bzw. explizit eingeforderte Qualifikationen des Koordinators nach [7] finden nach dem Umfrageergebnis bei der Auswahl keine Beachtung.
Die Bildung und Prüfung der Honorarangebote für die Koordinatorentätigkeit erfolgt in aller Regel über den Wettbewerb und den Erfahrungsschatz.
Einschlägige Honorarempfehlungen werden nach dem Umfrageergebnis selten gebraucht.
Der Verfasser weiß jedoch um die große Verbreitung aller in Frage 3.3, Kapitel 7.5, aufgelisteten Publikationen bei der Öffentlichen Hand und institutionellen Bauherren. Dies trifft insbesondere auf die Empfehlung der AK NRW zu, jedoch nicht weil diese Empfehlungen den fundiertesten oder aktuellsten Sachverhalt wiedergäben, sondern weil sie bereits wenige Wochen nach dem Inkrafttreten der BaustellV erschienen sind und bis heute die mit Abstand geringsten Honorare ausweisen.
2.3.3 Vorankündigung
Deckungsgleiche Schilderungen aus der Umfrage, der Literatur und des Verfassers besagen, wonach Aufgabe, Funktion und Verantwortung des sogenannten „Dritten“ nach der BaustellV überwiegend unbekannt sind/waren.
Die Übermittlung der Vorankündigung an die zuständige Behörde erfolgte i. d. R. rechtzeitig und ein ordnungsgemäßer Aushang der Vorankündigung fand in der Mehrzahl der Fälle statt.
2.3.4 SiGe-Plan
Die Erstellung des SiGe-Planes erfolgte meist zum Baubeginn bzw. zwei bis vier Wochen nach Baubeginn. Dies korrespondiert mit dem in Kapitel 2.3.2 dargestellten Zeitpunkt der Bestellung.
Häufig wird durch den Koordinator eine Baustellenordnung erstellt, während allein schon aufgrund der Erkenntnisse aus Kapitel 2.3.3 der SiGe-Plan, die Baustellenordnung und weitere Tools kaum den Ausschreibungsunterlagen beigelegt noch werkvertraglicher Bestandteil waren und der Koordinator nicht an den Vergabeprozessen beteiligt wurde bzw. werden konnte.
Der Bedeutung des SiGe-Plans wurde auf einer von –3 bis +3 reichenden Bewertungsskala im Mittel eine „+0,2“ zugesprochen.
2.3.5 Unterlage
Die Erstellung der Unterlage geschieht – auch als Folge von Kapitel 2.3.2 – selten in der Planungsphase sondern meist erst mit bzw. nach der Baufertigstellung.
Die Übergabe der Unterlage erfolgte generell nach Baufertigstellung und die Erkenntnisse aus der Unterlage (allein schon durch den Erstellungszeitpunkt bedingt) flossen seltenst in die Ausschreibung mit ein.
Die Bedeutung der Unterlage wurde auf einer von –3 bis +3 reichenden Bewertungsskala im Mittel mit einer „-0,2“ ausgedrückt.
2.3.6 Erwartung
In der Erwartungshaltung an die BaustellV und den Koordinator wurden ausschließlich positive und konstruktive Antworten angekreuzt und von den negativ besetzten Antworten keinerlei Gebrauch gemacht.
Die größte Erwartungshaltung gilt der Vermeidung von Unfällen. Sehr häufig wurde die Beeinflussung von Abläufen und häufig die Gestaltung der Schnittstelle zum Betreiben (FM) genannt.
2.3.7 Akzeptanz
Grundsätzlich kann in den letzten Jahren eine zunehmende Akzeptanz des Koordinators beobachtet werden.
Auf einer Skala von –3 bis +3 wurde die derzeitige Akzeptanz des Koordinators im Durchschnitt mit „1,6“ eingestuft.
Für die Akzeptanz des Koordinators sprechen nahezu gleichgewichtet die bau- und arbeitsschutzfachlichen Kenntnisse sowie seine Erfahrung und kommunikative Kompetenz.
2.3.8 Einfluss und Beeinflussung
Unter absoluter Übereinstimmung aus allen Datenquellen kann konstatiert werden, wonach die BaustellV nicht schlüssig in die bestehenden Planungs- und Bauprozesse integriert ist.
In großer Übereinstimmung wird die BaustellV dabei als ein Steuerungselement im Sinne von Organisations-, Koordinations- und Kontrollleistungen gesehen.
Gemäß dem Umfrageergebnis und der Auffassung des Verfassers findet durch den Koordinator vor allem eine Beeinflussung von Sicherheit und Organisation, etwas abgeschwächt eine Beeinflussung von Terminen und Kosten und seltener eine Beeinflussung von Qualitäten/Quantitäten statt.
Der Beeinflussungsgrad durch den Koordinator auf die Prozesse, Kosten, Termine, Qualitäten und Sicherheiten wird dabei auf einer von –3 bis +3 reichenden Skala im Durchschnitt mit „0,4“ gesehen.
Die Hälfte der Befragten sieht in der je nach Prioritäten bei Kosten, Terminen und Qualitäten unterschiedlichen Vergabeart zugleich auch unterschiedliche Sicherheitslevels.
Eine Relevanz der firmeninternen Unfallstatistik und Sicherheitsorganisation spielt mit Ausnahme der befragten Bauherrenvertreter aus der Chemie- und Pharmaindustrie keine Rolle.
Als die häufigsten Probleme bei der Umsetzung der BaustellV werden fast immer die des „geeigneten“ Koordinators, die der zu späten Beauftragung und die der Integration in die Prozesse genannt.
Weniger oft werden die Aussagekraft von SiGe-Plan und Unterlage und Probleme grundsätzlicher und allgemeiner Natur genannt, während beim „Dritten“, dem Leistungsumfang und den Honorarfragen keine Probleme gesehen werden.
Die bereits erfolgte bzw. in Zukunft erfolgende Etablierung des Koordinators als eigenständiger Sonderfachmann wird in der Umfrage und der Literatur unentschieden beantwortet.
2.4 Zusammenfassung
Fünf Jahre nach Einführung der BaustellV in der Bundesrepublik Deutschland kann folgendes zusammenfassendes Fazit gezogen werden:
- Die BaustellV und der Koordinator erfreuen sich wachsender Bekanntheit – aber nicht zunehmender Bedeutung
- Die BaustellV ist nicht schlüssig in die bestehenden Prozesse integriert
- Die Bestellung des Koordinator erfolgt zu spät, viele seiner Tätigkeiten und der durch die BaustellV intendierten Effekte verpuffen wirkungslos
- Die BaustellV wird als Steuerungselement mit Auswirkungen auf den ganzen Bauprozess und damit über die reine Sicherheit hinaus gesehen
- Die Bedeutung und die Nützlichkeit der Instrumente „SiGe-Plan“ und „Unterlage“ werden als neutral eingestuft
- Eine gewichtete Betrachtung des Themenfeldes „Sicherheit“ erfolgt i. d. R. weder bei der Vergabeart noch bei der Firmenauswahl
- Die Bezeichnung für den Koordinator nach BaustellV differiert regional etwas. In großer literarischer und anwendungsbezogener Breite findet sich jedoch die Bezeichnung „SiGeKo“ als Abkürzung für „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator“.
Im Streben nach einer klaren und einheitlichen Sprachregelung wird zukünftig für den Koordinator nach der BaustellV die Bezeichnung „SiGeKo“ übernommen und verwendet werden.
3. Die BaustellV als Steuerungselement
3.1 Einführung
Nach der in Kapitel 1 durchgeführten Betrachtung eines „gestrigen“ Zustandes, der in Kapitel 2 vollzogenen Betrachtung praktizierter „heutiger“ Verhältnisse greift Kapitel 3 die Themenstellung der Master Thesis wörtlich auf und untersucht den theoretischen Aspekt sowie die Eignung der BaustellV als Steuerungselement.
Dazu erfolgt eine allgemeine Darstellung des Steuerungsbegriffes, die Beschreibung des Bauprozesses und die Analyse der BaustellV unter steuerungstechnischen Gesichtspunkten.
3.2 Der Steuerungsbegriff
Die Begriffe „Steuerung“ und „Management“ werden vielfach gleichbedeutend gebraucht. Im Alltag kommt der Managementbegriff sehr häufig und vielschichtig vor, weshalb eine allgemeine Herleitung des Steuerungsbegriffes über den Managementbegriff vorstellungsnah erscheint.
„Management“ ergibt sich abgeleitet von dem lateinischen Wort „manus“ (die Hand) in das zum englischen Verb entwickelte „to manage“.
„to manage“ bedeutet, etwas geschickt bewerkstelligen, zustandebringen und organisieren.
Allgemein bedeutet Management Leitung und Führung von Betrieben und allen sozialen Systemen.
Steuerung ist demnach eine Leitungs- und Führungsaufgabe, die alle zukunftsgerichteten Maßnahmen zur Abwendung von Störungen des Projektablaufes beinhaltet.
Nach [12], Rdn. 74, betrifft die Steuerung
- die Organisation,
- die Koordination,
- die Anordnung und
- die Kontrolle
von Planung und Ausführung.
Den vier vorgenannten Indizien der Steuerung entspringen direkt und indirekt tätigkeitsbeschreibende Attribute wie:
Diese allgemeine Fassung von „Steuerung“ gilt es im Zusammenhang mit der BaustellV auf Bauvorhaben zu übertragen und zunächst den Bauprozess zu betrachten.
3.3 Der Bauprozess
3.3.1 Allgemeines
Die Begrifflichkeit des „Prozesses“ charakterisiert eine ablaufbezogene Unterteilung von Projekten in sogenannten Phasen oder Stufen.
Unter einer Phase ist nach [12] „der Zeitabschnitt zu verstehen, der notwendig ist, um bestimmte Aufgabenstellungen im Projekt abzuarbeiten.“
[12] fügt weiter an: „Diese zeitlich ablaufbezogene Unterteilung und Differenzierung projektbezogener Aufgaben und Tätigkeiten hat bereits die Erstellung der HOAI maßgeblich beeinflusst (z. B. die Leistungsphasen des § 15 HOAI).“
Dabei wird jedoch der Bauprozess im Allgemeinen und ein Bauvorhaben im Speziellen durch seine Einmaligkeit charakterisiert. Faktoren wie u. a. Standortbedingungen, Marktsituationen, Beteiligte, Materialien, Technologien, Witterungen und Nutzungen tragen dazu bei.
Unterschiedliche Konstellationen bei allen vorgenannten Faktoren und verschiedene Ziele des Bauherrn/Investors schaffen ein breites Spektrum einzelner wie konkreter Bauprozesse.
Allen Bauprozessen haftet jedoch die Gemeinsamkeit weniger und gleicher – wenn auch unterschiedlich gewichteter – Steuerungsgrößen an, deren grundsätzliche Betrachtung im folgenden Kapitel vorgenommen wird.
3.3.2 Steuerungsgrößen
Den Bauprozess prägen drei wesentliche Steuerungsgrößen. Die folgende Tabelle zeigt auf, was im Bauprozess gezielt gesteuert wird und worüber sich die drei Steuerungsgrößen definieren können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3-1: Steuerungsgrößen
Tab. 3-1 beschreibt mit den Kosten, Terminen und den Qualitäten/Quantitäten die drei wesentlichen Steuerungsgrößen des Bauprozesses mit Auszügen möglicher zugehöriger Parameter zur jeweiligen Definition der Steuerungsgröße.
Im Zusammenhang mit diesen drei Größen wird oftmals auch vom sogenannten „magischen Dreieck am Bau“ gesprochen. Grund dafür liefert die innere Verflechtung und große gegenseitige Abhängigkeit der Steuerungsgrößen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3-1: Magisches Dreieck am Bau
Je nach Zielen und Gewichtungen von Kosten, Terminen und Qualitäten/Quantitäten ergeben sich unterschiedliche Formen von z. B. Ausschreibung/Vergabe, Baubeteiligten und Steuerung.
Eine fundierte Betrachtung solcher Zusammenhänge muss jedoch an anderer Stelle außerhalb dieser Master Thesis erfolgen.
Die Steuerung von Kosten, Terminen und Qualitäten/Quantitäten bedingt den Einsatz von Steuerungsmitteln, deren näheren Betrachtung sich das nächste Kapitel widmet.
3.3.3 Steuerungsmittel
Die den Bauprozess prägenden Steuerungsgrößen erfordern Instrumentarien – nachfolgend als Steuerungsmittel bezeichnet – mit deren Hilfe die Steuerung vorgenommen und aufgezeigt werden kann, wie und wo gezielt gesteuert wird.
Dabei können die Steuerungsmittel in die Hauptgruppen
- Vertragsmanagement,
- Organisationsmanagement und
- Ablaufmanagement
differenziert werden, die wiederum bei einer wirksamen und ganzheitlichen Steuerung eine enge Verzahnung untereinander aufweisen.
Vertragsmanagement
Darunter wird aus steuerungstechnischer Sicht die vertragliche Vereinbarung von Terminen und Fristen (Zwischen-, End-, Lieferterminen, ...), Vertragsstrafen, Zahlungsplänen, Verpflichtungen (z. B. Meldewesen, Besprechungsteilnahme, ...), EDV-Tools (IT-Plattform, Programme, Programmversionen, Lese- und Schreibrechte, ...) und weiterer sich aus dem Organisationsmanagement ergebender Besonderheiten verstanden.
Organisationsmanagement
Unter das Organisationsmanagement fällt z. B. die Implementierung eines Projekthandbuches und einer Baustellenordnung, die Regelung von Zuständigkeiten und Befugnissen, das Melde-, Berichts-, Planfreigabe-, Bemusterungs- und Entscheidungswesen.
Ablaufmanagement
Das Ablaufmanagement erstreckt sich über fünf Schritte und wird in der Literatur oft als sogenannter „Regelkreis“ bezeichnet.
Die fünf Schritte beinhalten im Einzelnen:
- ZielsetzungFestlegung der Ziele i. d. R. über die Steuerungsgrößen Kosten, Termine und Qualitäten/Quantitäten.
- PlanungFestlegung der Vorgehensweise und der verfügbaren Mittel um die gesetzten Ziele zu erreichen. Dies kann durch Aufgabenverteilung, Informationskreislauf, Projektstrukturplan, Ablaufstruktur, Dauerwerte, Termine, Budgetplan und Einsatzmittel geschehen.
- AusführungDurchführung der in der Planung vorgesehenen Maßnahmen mittels Information (Listen, Tabellen, Terminplänen, Berichte) und Koordination (Besprechungen).
- KontrolleFeststellung, ob die in der Planung festgelegte Vorgehensweise eingehalten wurde. Dies geschieht u. a. über Informationsrückfluss, Soll-Ist-Vergleiche und Fortschrittsberechnungen.
- SteuerungFeststellung, ob die festgeschriebenen Ziele erreicht sind. Bei Abweichungen sind die Soll-und-Ist-Werte zu analysieren und eine Anpassung der Planung bzw. in extremen Ausnahmesituationen der Ziele vorzunehmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3-2: Ablaufsteuerung (Regelkreis)
Bei den Schritten „Zielsetzung“, „Planung“, „Kontrolle“ und „Steuerung“ handelt es sich um Managementfunktionen, während der Schritt „Ausführung“ keine Managementfunktion darstellt.
Den in diesem Kapitel aufgezeigten Hauptgruppen der Steuerungsmittel bzw. direkt aus dem Ablaufmanagement ergeben sich tätigkeitsbeschreibende Attribute ähnlich den in Kapitel 3.2 aufgezeigten wie
3.4 Steuerungsanalyse der BaustellV
3.4.1 Allgemeines
„Die BaustellV als Steuerungselement?“ liefert nicht nur das zentrale Thema der vorliegenden Master Thesis sondern leitet – verstärkt mit dem abschließenden Fragezeichen – zugleich die in diesem Kapitel erfolgende steuerungstechnische Analyse der BaustellV ein.
Das Vorgehen gliedert sich in zwei Schritte.
In einem ersten, in die Planungs- und Ausführungsphase zweigeteilten, Schritt sollen die anhand des Verordnungstextes entwickelten Leistungen dargestellt und Attribute für die Tätigkeit des SiGeKo gefunden werden.
In einem zweiten Schritt erfolgt eine Betrachtung möglicher Auswirkungen und Beeinflussungen der drei Steuerungsgrößen des Bauprozesses durch die BaustellV.
3.4.2 SiGeKo-Attribute
Der Ursprung zur Entfaltung der BaustellV zu ihrer vollen Wirkungskraft liegt in § 3 BaustellV, der die Koordinierung beschreibt. Darin werden in Absatz zwei die Planungsphase (ausführlich „Planung der Ausführung“) und in Absatz drei die Ausführungsphase behandelt.
Planungsphase
Die drei in § 3 (2) BaustellV dazu enthaltenen Aufgaben und Leistungen des SiGeKo (BaustellV: „Koordinator“) wurden in [7] konkretisiert. Tab. 3-2 listet die Aufgaben des SiGeKo nach [7] auf und leitet daraus die zentralen, tätigkeitsbeschreibenden Attribute ab.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3-3: SiGeKo-Attribute Ausführungsphase
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3-2 und Tab. 3-3 ergeben für die Planungs- und Ausführungsphase ähnliche, die SiGeKo-Tätigkeit und damit auch die BaustellV beschreibende Attribute, weshalb eine gemeinsame Auswertung vorgenommen werden kann.
Werden unter Nichtbeachtung der ggf.-Nennungen von den dann noch verbleibenden 25 Nennungen die Häufigkeiten ermittelt, ergibt sich folgende Verteilung (in Klammer die Anzahl der Nennungen):
- Koordinieren (3)
- Beraten (3)
- Hinwirken (3)
- Anpassen/Fortschreiben (3)
- Informieren/Erläutern/Bekanntmachen (3)
- Überwachen (1)
- Organisieren (1)
- Einfordern (1)
- Berücksichtigen (1)
- Zusammenstellen (1)
- Ausarbeiten (1)
- Aufzeigen (1)
- Feststellen (1)
- Auswerten (1)
- Dokumentieren (1)
Werden in einem nächsten Schritt die Attribute auf Substantive zurückgeführt, so kann konstatiert werden:
- Leistungsbeschreibender Schwerpunkt bilden die Koordination, die Beratung, die Hinwirkung und die Anpassung/Fortschreibung.
Dabei setzt die Anpassung z. B. Soll-Ist-Vergleiche und somit Kontrolle und Überwachung voraus.
- Worte wie „Beratung“ und „Hinwirkung“ bezeichnen eine zurückhaltende Form von Anordnung.
- Nennungen wie „Organisieren“, „Einfordern“, „Informieren“, „Dokumentieren“ etc. fallen unter den Aspekt der Organisation.
Zudem ist eine den Steuerungsbegriff mit charakterisierende Differenzierung in Planung und Ausführung gegeben.
Als Fazit kann aus dem Schritt des Analysierens und Vergleichens der SiGeKo-Attribute gezogen werden:
Gemäß der in Kapitel 3.2 durch zahlreiche Eigenschaftswörter und die Substantive „Koordination“, „Organisation“, „Anordnung“ und „Kontrolle“ aufgezeigten Definition für Steuerung und Management handelt es sich bei der BaustellV um ein Steuerungs- und Managementelement und folglich beim SiGeKo um einen Steuerer und Manager.
Augenfällig ist dabei auch die Übereinstimmung der nach Definition explizit erwähnten „Planung“ und „Ausführung“ mit der „Planungsphase“ und „Ausführungsphase“ nach der BaustellV.
3.4.3 Auswirkungen auf die Steuerungsgrößen
Aus dem Vorkapitel kristallisierten sich die tätigkeits- und eigenschaftsbeschreibenden Schlagworte für den SiGeKo und damit auch für die BaustellV heraus, die eine steuernde Stellung des SiGeKo und eine steuerungswirksame Funktion der BaustellV offensichtlich machten.
Mathematisch betrachtet entspricht dies einem notwendigen, nicht aber einem hinreichenden Kriterium zur Beurteilung der BaustellV als Steuerungselement der Bauprozesse.
Ein hinreichendes Kriterium ergibt sich aus folgender Überlegung:
Wenn denn die BaustellV – auch nach Kapitel 3.4.2 – ein Steuerungselement sein soll, dann muss die BaustellV Auswirkungen auf die originären Steuerungsgrößen „Kosten“, „Termine“ und „Qualitäten/Quantitäten“ haben.
In Tab. 3-4 werden daher aus den in Tab. 3-2 und Tab. 3-3 beschriebenen Leistungen des SiGeKo drei wesentliche Ergebnisse und Folgen entwickelt sowie deren Auswirkungen auf die Steuerungsgrößen untersucht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3-4: Auswirkungen der BaustellV auf die Steuerungsgrößen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3-4 zeigt Auswirkungen der Leistungen des SiGeKo nach der BaustellV auf die zentralen Steuerungsgrößen des Bauprozesses.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832474195
- ISBN (Paperback)
- 9783838674193
- DOI
- 10.3239/9783832474195
- Dateigröße
- 974 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt; Würzburg – Architektur und Bauingenieurwesen
- Erscheinungsdatum
- 2003 (November)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- projektmanagement europäische union sigeko bauprozess immobilien
- Produktsicherheit
- Diplom.de