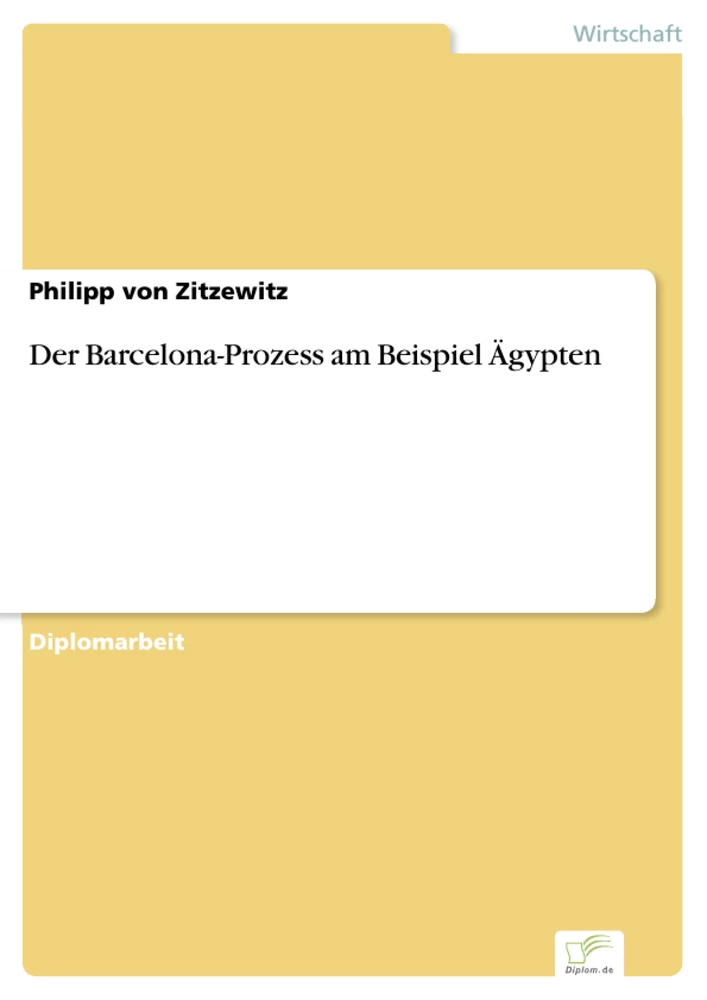Der Barcelona-Prozess am Beispiel Ägypten
Zusammenfassung
Der im November 1995 von der EU ins Leben gerufene Barcelona Prozess verfolgt das ehrgeizige Ziel, Europa und den Mittelmeerraum auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene in eine Partnerschaft zu integrieren. Mit Europa ist hier das politische Gebäude der Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft gemeint, das sich beginnend mit dem Vertrag von Maastricht 1993 zu der Europäischen Union entwickelt hat. Der Mittelmeerraum wird im folgenden von den Anrainerstaaten repräsentiert, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Jedoch sind die Balkanstaaten und Libyen aus der Betrachtung ausgeschlossen, da sie nicht in die Euro-Mediterrane Partnerschaft einbezogen wurden. Gegenstand der Analyse sind also die Anrainerstaaten des südlichen und östlichen Mittelmeers, beginnend mit Marokko im Westen bis hin zur Türkei im Osten unter Einschluss der Inseln Malta und Zypern. Diese Staaten werden im folgenden als Mittelmeer-Drittländer (MDL) bezeichnet.
Die Ziele der Partnerschaft sind die wirtschaftliche Entwicklung und die Demokratisierung des Mittelmeerraums um Frieden und Stabilität zu gewähren.
Die Einleitung des Prozesses wurde enthusiastisch als Beginn einer neuen Ära der Kooperation zwischen den Staaten nördlich und südlich des Mittelmeers gefeiert, aber seine Ziele sind bis heute nicht erreicht worden und der Prozess erweist sich als komplexer und schwieriger als anfangs angenommen. Trotzdem wird an ihm festgehalten. EU-Kommissar Chris Patten begründet dies in einer Rede fünf Jahre nach der Initiierung, indem er seine Überzeugung ausdrückt: the present and the future of the European Union and of the Southern Mediterranean countries is inextricably interwoven.
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Zielstellungen des Prozesses in Bezug auf ihre Durchführbarkeit und zeigt wovon sie abhängig sind. Weiterhin wird die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der EU und den Mittelmeeranrainern bewertet und versucht einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung zu geben. Die Arbeit argumentiert, dass die Partnerschaft asymmetrisch aufgebaut ist und sich nur erfolgreich entwickeln wird wenn die MDL stärker untereinander kooperieren.
Gang der Untersuchung:
Das zweite Kapitel behandelt frühere Initiativen in der historischen Entwicklung der Beziehungen zwischen Europa und der Mittelmeerregion und stellt im Anschluss den Barcelona Prozess vor. Die Unterschiede in den Ansätzen werden hierbei hervorgehoben.
Das […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Entwicklung der Beziehungen Europas zum Mittelmeerraum
2.1 Einführung
2.2 Bilaterale Abkommen
2.3 Die Globale Mittelmeerpolitik
2.4 Multilaterale Initiativen
2.5 Die neue Mittelmeerpolitik
2.6 Die Euro-Mediterrane Partnerschaft
2.7 Das MEDA Programm der EMP
2.8 Zusammenfassung
3 Motivation für die Teilnahme am Barcelona Prozess
3.1 Einführung
3.2 Änderung der Weltordnung
3.3 Gründe der EU die Partnerschaft aufzubauen
3.3.1 Sicherheitsgründe
3.3.1.1 Einwanderung
3.3.1.2 Islamischer Fundamentalismus
3.3.1.3 Terrorismus
3.3.2 Wirtschaftliches Interesse
3.4 Gründe der MDL die Partnerschaft zu akzeptieren
3.4.1 Risiken und Chancen der EMFZ
3.4.2 Wirtschaftliche Abhängigkeit
3.4.3 Politische Motive
3.4.4 Notwendigkeit einer Neuorientierung
4 Hindernisse des Barcelona Prozesses
4.1 Einführung
4.2 Der Nahost Friedensprozess
4.3 Interne Verfahrensprobleme der EU
4.4 Mangelhafter Geldfluss
4.5 Unzureichend ausgeprägter Süd-Süd Handel
5 Die Umsetzung der EMP am Beispiel Ägypten
5.1 Die Kooperation der EU mit Ägypten
5.2 Das Assoziierungsabkommen
5.3 Die Umsetzung des Assoziierungsabkommens
5.4 Opposition gegen das Abkommens
5.4.1 Widerstand des Agrarsektors
5.4.2 Widerstand des Industriesektors und der Privatwirtschaft
5.4.3 Weitere Argumente in der Diskussion
6 Zusammenfassung und Bewertung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhang
Text- und Literaturverzeichnis
Ehrenwörtliche Versicherung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Europa-Mittelmeer Karte
Abb. 2 EU-Handel mit den MDL
Abb. 3 Die wichtigsten Handelsgüter im Verkehr zwischen der EU & den MDL
Abb. 4 Anteil der MDL am Gesamthandel mit der EU
Abb. 5 Auslandsverschuldung & Tilgungsrate der MDL
Abb. 6 MEDA Zusagen & Auszahlung 1995 - 1999
Abb. 7 Ausländische Direktinvestitionen der EU nach Regionen
Abb. 8 Schutzzölle in den MDL
Abb. 9 Kosten der interarabischen Dispute
Abb. 10 Finanzielle Mittelbindungen im Rahmen des Nationalen Richtprogramms
1 Einleitung
Der im November 1995 von der EU ins Leben gerufene Barcelona Prozess verfolgt das ehrgeizige Ziel, Europa und den Mittelmeerraum auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene in eine Partnerschaft zu integrieren. Mit Europa ist hier das politische Gebäude der Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft gemeint, das sich beginnend mit dem Vertrag von Maastricht 1993 zu der Europäischen Union entwickelt hat. Der Mittelmeerraum wird im folgenden von den Anrainerstaaten repräsentiert, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Jedoch sind die Balkanstaaten und Libyen aus der Betrachtung ausgeschlossen, da sie nicht in die Euro-Mediterrane Partnerschaft einbezogen wurden. Gegenstand der Analyse sind also die Anrainerstaaten des südlichen und östlichen Mittelmeers, beginnend mit Marokko im Westen bis hin zur Türkei im Osten unter Einschluss der Inseln Malta und Zypern[1]. Diese Staaten werden im folgenden als Mittelmeer-Drittländer (MDL) bezeichnet. (Siehe Abb. 1)
Die Ziele der Partnerschaft sind die wirtschaftliche Entwicklung und die Demokratisierung des Mittelmeerraums um Frieden und Stabilität zu gewähren.
Die Einleitung des Prozesses wurde enthusiastisch als Beginn einer neuen Ära der Kooperation zwischen den Staaten nördlich und südlich des Mittelmeers gefeiert, aber seine Ziele sind bis heute nicht erreicht worden und der Prozess erweist sich als komplexer und schwieriger als anfangs angenommen. Trotzdem wird an ihm festgehalten. EU-Kommissar Chris Patten begründet dies in einer Rede fünf Jahre nach der Initiierung, indem er seine Überzeugung ausdrückt: „ the present and the future of the European Union and of the Southern Mediterranean countries is inextricably interwoven “.[2]
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Zielstellungen des Prozesses in Bezug auf ihre Durchführbarkeit und zeigt wovon sie abhängig sind. Weiterhin wird die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der EU und den Mittelmeeranrainern bewertet und versucht einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung zu geben. Die Arbeit argumentiert, dass die Partnerschaft asymmetrisch aufgebaut ist und sich nur erfolgreich entwickeln wird wenn die MDL stärker untereinander kooperieren.
Die Untersuchung gliedert sich folgt:
Das zweite Kapitel behandelt frühere Initiativen in der historischen Entwicklung der Beziehungen zwischen Europa und der Mittelmeerregion und stellt im Anschluss den Barcelona Prozess vor. Die Unterschiede in den Ansätzen werden hierbei hervorgehoben.
Das dritte Kapitel untersucht die Motivation der Partnerländer sich auf die Partnerschaft einzulassen. Es wird gezeigt, dass beide Seiten von unterschiedlichen Motiven geleitet werden. Auf der europäischer Seite sind dies vor allem Sicherheitsinteressen. Die Partnerschaft soll Lösungen der Probleme der zunehmenden Zahl von Immigranten, des stärker werdenden islamischen Fundamentalismus und des Terrorismus schaffen. Bei den MDL hingegen stehen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Letztere gehen mit der Partnerschaft im Gegensatz zur EU auch erhebliche Risiken ein.
Seit Beginn der Partnerschaft sind verschiedene Probleme aufgetreten, die den Prozess in seiner Entwicklung behindern. Diese werden in Kapitel vier vorgestellt. Zuerst wird auf die Herausforderungen auf politischer Ebene eingegangen. Es wird gezeigt, dass eine Kluft zwischen der formulierten Darstellung der Kooperation und der Realität existiert. Im Anschluss werden die wirtschaftlichen Herausforderungen behandelt. Obwohl der wirtschaftlich ausgerichtete Teil der Partnerschaft am erfolgsversprechendsten für schnellen Fortschritt ist, bleibt er von verschiedenen noch zu erfüllenden Bedingungen abhängig.
Das fünfte Kapitel betrachtet beispielhaft die Entwicklung auf bilateraler Ebene zwischen der EU und Ägypten. Es wird die Vorgehensweise in den Verhandlungen der EU mit Ägypten erläutert und der Verlauf bis zum Abschluss des Assoziierungsabkommens aufgezeigt, das in Ägypten umstritten ist. Im Anschluss wird die Opposition gegen das Abkommen dargestellt.
Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und eine Bewertung mit Ausblick auf die weitere Entwicklung gegeben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 Europa-Mittelmeer Karte
Quelle: European Communities, The Barcelona process, Five years on 1995 - 2000
2 Die Entwicklung der Beziehungen Europas zum Mittelmeerraum
2.1 Einführung
Dieses Kapitel betrachtet die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen Europa und dem Mittelmeerraum.
Dargestellt werden soll die Entwicklung beginnend mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft 1957 bis zur Ratifizierung der Deklaration von Barcelona im November 1995. Wir werden sehen, dass mit dem engeren Zusammenwachsen Europas auch die Struktur der euro-mediterranen Beziehungen immer komplexer wurde. Die Euro-Mediterrane Partnerschaft stellt, wie später dargelegt, den Höhepunkt dieser Entwicklung dar.
2.2 Bilaterale Abkommen
In den ersten Verträgen von 1951(Gründung der Montanunion) und 1957 (Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft), die den Weg zur Europäischen Gemeinschaft ebneten, war die Schaffung einer Zollunion und damit einer gemeinsamen Außen handelspolitik angestrebt worden. Eine eigentliche gemeinsame Außenpolitik der Mitgliedstaaten war nicht vorgesehen.
Frankreich, als einer der großen Partner der neugegründeten Wirtschaftsgemeinschaft, besaß damals noch Algerien als Departement und hatte Marokko und Tunesien erst kurz zuvor in die Unabhängigkeit entlassen. Diese ehemaligen Protektorate bekamen durch die besondere Verbindung zu Frankreich automatisch eine privilegierte Stellung zu der EG, die auch in den Gründungsverträgen (Römische Verträge) verankert wurde. 1962 und 1963 folgten Assoziierungsabkommen mit Griechenland und der Türkei. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges spielten hierbei vor allem sicherheitspolitische Erwägungen eine Rolle. Diese beiden NATO-Partner sollten durch Integration in die Zollunion wirtschaftlich gestärkt und an die EG gebunden werden.
Aus den gleichen Erwägungen wurden aufgrund ihrer strategischen Lage zu Beginn der siebziger Jahre Assoziierungsverträge mit Malta und Zypern geschlossen. Das Besondere an diesen Verträgen war, dass sie eine Perspektive für den Beitritt in die EG enthielten.
In den sechziger Jahren wurden weiterhin eine Reihe von bilateralen Abkommen mit verschiedenen MDL aus unterschiedlichen Gründen geschlossen. Die Assoziierungsverträge mit Griechenland und der Türkei relativierten die privilegierte Beziehung mit Tunesien und Marokko. Auf französisches Betreiben hin wurden 1969 Teilassoziierungsabkommen mit beiden Staaten abgeschlossen um ihnen erneut eine verbesserte Stellung zu verschaffen. Spanien und Israel hatten beide Assoziierungsverträge mit der EG beantragt, aber aufgrund der Missbilligung des Franco-Regimes und des Sechs-Tage-Krieges lediglich präferenzielle Handelsabkommen erhalten. Um politische Ausgewogenheit zu wahren bot die EG auch den arabischen Staaten des Maschrek präferenzielle Handelsabkommen an. Dieses Angebot wurde von Ägypten, Jordanien, Syrien und dem Libanon angenommen.[3]
Somit wurden die Außenverträge und somit die Außenbeziehungen der EG zu Drittstaaten von unterschiedlichen Interessen bestimmt. Zum einen durch Interessen einzelner
EG-Mitglieder, wie im Fall von Frankreich, zum anderen durch sicherheitspolitische Interessen wie die Einbindung Griechenlands und der Türkei oder, wie im Falle der Mashrekstaaten, um wirtschaftliche Ausgewogenheit zu wahren. Ein umfassendes außenwirtschaftliches Konzept, wurde allerdings erst ab den siebziger Jahren geschaffen.
2.3 Die Globale Mittelmeerpolitik
1970 wurde auf dem Gipfel in Luxemburg durch die Einführung der „Europäischen Politischen Zusammenarbeit“ (EPZ)[4] die Grundlage einer gemeinsamen Außenpolitik ins Leben gerufen. Die Regierungen der Gemeinschaft vereinbarten zum einen eine regelmäßige gegenseitige Beratung über Probleme der Außenpolitik. Zum anderen sollte, sofern möglich, ein gemeinsames Vorgehen gegenüber Drittländern abgestimmt werden. Das von Francois Duchêne entworfene Konzept einer „Zivilmacht Europa“ wurde geschaffen. Dieses sollte eine Zusammenarbeit ohne Abhängigkeitsverhältnisse begründen. Das friedliche Verhältnis der Mitgliedsstaaten untereinander sollte zum Ausgangspunkt weiterführender Reflexionen über die internationale Rolle der EG herangezogen werden.[5] Außenbeziehungen sollten nicht mehr nur durch wirtschaftlich motivierte Handels- und Assoziierungsverträge determiniert werden, sondern zusätzlich durch eine von politischem Interesse geleitete gemeinsame Außenpolitik. Bezogen auf den Mittelmeerraum wurde vor diesem Hintergrund die Idee der „Globalen Mittelmeerpolitik“ (GMP) geschaffen, unter der die bisher bilateralen Vereinbarungen vereinheitlicht werden sollten. Gemäß dem Konzept der „Zivilmacht Europa“ sollte das ökonomische Potenzial der EG so genutzt werden, dass mit Regionen Partnerschaften auf gleichberechtigter Ebene erreicht würden. Unter der GMP konnten zahlreiche bilaterale Abkommen für Handel und Zusammenarbeit mit den MDL abgeschlossen werden. Sie beinhalteten freien Marktzugang für Mittelmeerprodukte, Präferenzzölle und Quoten für Agrarprodukte sowie finanzielle Unterstützung. Nichtsdestoweniger hatte dieser Ansatz. aus folgenden Gründen keinen Erfolg: Der „Allgemeinen Agrarpolitik“ (AGP)[6] folgend schützte die EG nämlich nach wie vor ihre sensitiven Produkte wie Olivenöl, Wein und bestimmte Früchte. Hauptsächlich bei diesen Produkten besaßen die MDL jedoch Handelsvorteile. Das Konzept litt noch mehr im Verlauf der Ölkrisen von 1973 und 1979, da die Mitgliedstaaten der EG sich primär um Konsolidierung ihrer nationalen Volkswirtschaften kümmerten. Weiterhin wertete die amerikanische Regierung aufgrund ihres besonderen Verhältnisses zu Israel den europäischen Vorstoß für einen Ausgleich mit den arabischen Staaten als Verletzung ihrer eigenen Interessen. Schließlich sorgten darüber hinaus die unterschiedlichen Standpunkte auf europäischer Seite für ein endgültiges Scheitern des Konzepts.[7]
Parallel zu der GMP wurde 1974 ein multilateraler euro-arabischer Dialog ins Leben gerufen. Mit ihm erreichte die arabische Seite, dass sich Europa intensiver um den israelisch-arabischen Konflikt kümmerte. Im Gegenzug sollte eine Absicherung der Energieversorgung Europas gewährt werden. Zahlreiche Sitzungen über wirtschaftliche, kulturelle und politische Zusammenarbeit, bis in die achtziger Jahre hinein, brachten jedoch keine nennenswerten Ergebnisse. Der Dialog scheiterte gänzlich an ungünstigen Umständen wie dem Iran-Irak Krieg, der Ermordung des ägyptischen Präsidenten Sadat und unterschiedlicher Prioritätensetzung beider Seiten.
In den achtziger Jahren zeichnete sich die anstehende Süderweiterung der EG auf die Länder Griechenland, Spanien und Portugal ab und beunruhigte die MDL zunehmend. Durch die Präferenz- und Assoziierungsabkommen mit der EG waren sie bisher relativ gut gegen die Konkurrenz der südeuropäischen Staaten geschützt gewesen. Durch den schrittweisen Abbau der Handelszölle bei Aufnahme in die EG würden die neuen Mitgliedsländer jedoch beim Absatz ihrer Produkte gegenüber denen der MDL Vorteile genießen. Um diese negativen Auswirkungen abzuschwächen wurden 1987 / 88 Zusatzprotokolle unterzeichnet, die sich jedoch nur auf landwirtschaftliche Produkte beschränkten. Der für die MDL ebenso wichtige Textilsektor blieb jedoch unberücksichtigt. Die MDL unterlagen daraufhin zumindest im Agrarsektor den gleichen Zöllen wie die Südeuropäer. Diese hatten jedoch die kürzeren Transportwege und somit trotzdem den Marktvorteil, der dazu führte, dass Agrarexporte der MDL in die EG zurückgingen. Dem Ziel, die neuen EG Staaten Griechenland, Spanien und Portugal[8] möglichst schnell an das ökonomische Durchschnittsniveau der übrigen EG anzugleichen, wurde schlichtweg Priorität vor den Interessen der MDL eingeräumt.
Der Mittelmeerraum rückte erst wieder mit dem sich auflösenden Ost-West Konflikt stärker in das Interesse der Europäer. Sicherheitsbedenken richteten sich nun auf die südliche Peripherie, deren wirtschaftliche und politische Destabilisierung zuerst von den Italienern als „Südbedrohung“ wahrgenommen wurde. Diese Bedrohung setzte sich aus verschiedenen Phänomenen zusammen wie Gefährdung der Energiezufuhr, Ausbreitung des Islamismus, sich verschärfende Regionalkonflikte, die Zunahme von Drogenhandel, internationaler Terrorismus und vor allem steigende Immigrationsraten. In Europa wuchs die Erkenntnis, dass Abschottung alleine als Schutz nicht ausreichen würde, sondern dass man die politischen Beziehungen zum Mittelmeerraum statt dessen intensivieren und erneuern müsse um die gemeinsamen Probleme zu bewältigen.
2.4 Multilaterale Initiativen
Frankreich, Spanien und Italien befürchteten die ökonomischen Lasten der Beziehungen zum Mittelmeerraum alleine tragen zu müssen und waren deshalb bestrebt sie in die gemeinschaftliche Politik zu integrieren um eine gerechte Verteilung auf alle Mitglieder zu erzielen. Weiterhin wollten sie mit einer neuen Mittelmeerraumpolitik ihren Einfluss auf die EG-Politik wahren und eine Gegenbewegung zu einer möglichen Vormachtstellung des wiedervereinigten Deutschlands in Mittel- und Osteuropa schaffen. Zuletzt war es aber auch für die gesamte EU wichtig, im Zeichen der Globalisierung ebensolche Wirtschaftsblöcke zu kreieren, wie dies in Amerika mit der NAFTA und in Asien mit der ASEAN gelungen war. Ein nach Osten erweitertes Europa, ergänzt durch den Mittelmeerraum, würde als Wirtschaftsregion die Konkurrenzfähigkeit auf internationaler Ebene erhalten[9]. Daher wurde von Spanien und Italien die Idee einer „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelmeerraum“ (KSZM). nach dem Vorbild der Konferenz für „Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ (KSZE)[10] initiiert. Die KSZM sollte die wirtschaftlichen und sozialen Differenzen zu den arabischen Staaten, vor allem den Maghrebstaaten, überbrücken. Weiterhin sollte sie die EG für die Probleme des Mittelmeerraumes sensibilisieren und alle Mitgliedstaaten mit in die Verantwortung ziehen. Gleich der KSZE sollten „Körbe“ wie „Regionale Sicherheit“, „Wirtschaftliche Zusammenarbeit“ und „Menschliche Dimension“ bearbeitet werden. Diese Initiative scheiterte jedoch vor dem Hintergrund des israelisch-arabischen Konflikts und dem Ausbruch der Golfkrise. Ein weiterer ehrgeiziger Versuch der Italiener, zu vermitteln und die KSZM geographisch von Mauretanien bis zum Iran zu erweitern, schlug ebenso fehl. Es war unter dieser forcierten geographischen Ausweitung der Initiative nicht einmal möglich alle potenziellen Parteien der Konfliktregionen an einen Tisch zu bekommen. Weiterhin wurde dieser Vorstoß von den USA und den nordeuropäischen Staaten Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland abgelehnt und führte nicht zum gewünschten südeuropäischen Erfolg, mit dem sich Italien und Spanien profilieren wollten.
Frankreich nahm die Idee Ende 1990 in den sogenannten 5+5 Gesprächen erneut auf, beschränkte die Teilnehmer des Projekts jedoch auf die Arabische Maghreb Union[11] und auf europäischer Seite auf Italien, Portugal, Spanien und Malta. Doch auch dieser Vorstoß scheiterte und ging nicht über einige Treffen auf Ministerebene hinaus. Dies lag zum einen an der uneinheitlichen Haltung der EU gegenüber Libyen, das der Unterstützung des Terrorismus bezichtigt wurde. Zum anderen kam die Krise in Algerien und die Nachfolgen des Golfkrieges dazu, die in ihrer Summe die Fortführung dieser ansonsten bemerkenswerten Initiative verhinderten.[12]
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die vorher beschriebenen Initiativen hauptsächlich an dem politischen Willen der Europäer scheiterten, die die Notwendigkeit einer wirksamen Neugestaltung der euro-mediterranen Beziehungen erst im Laufe der neunziger Jahre erkannten. Sie scheiterten aber auch an dem schwelenden Nahostkonflikt.
Dennoch waren wichtige Ideen vorangetrieben worden, die auf der späteren Konferenz von Barcelona Verwendung fanden.
2.5 Die neue Mittelmeerpolitik
Parallel zu diesen oft von nationalen Interessen geprägten Initiativen begann die EU-Kommission Ende der achtziger Jahre ebenfalls Konzepte für eine europäische Mittelmeerpolitik unter dem Namen „Neue Mittelmeerpolitik“ (NMP) auszuarbeiten. Sie löste die Globale Mittelmeerpolitik offiziell ab. Eckpfeiler sollten eine Politik der Partnerschaft und Unterstützung für soziale und ökonomische Entwicklung sein. Die NMP bezog sich anfangs nur auf die maghrebinischen Staaten und sollte zum ersten Mal sicherheitspolitische Aspekte in die Kooperation mit einbeziehen. Diese sollten allerdings im bilateralen Rahmen vereinbart werden. 1993 wurde die Idee der NMP auf den Nahen Osten übertragen. Zum ersten Mal sollten Verhandlungen auf einen regionalen Raum bezogen und der bilateralen Kooperation übergeordnet werden. Der Ansatz sollte weiterhin die regionale Zusammenarbeit in Bereichen der Ausbildung von Arbeitskräften fördern, Anreize für Privatinvestitionen schaffen und den Umweltschutz unterstützen.[13]
Vor dem Hintergrund der Destabilisierung der Nachbarn im Süden, bedingt durch anhaltende ökonomische Verarmung und soziale Verelendung, und den daraus resultierenden Problemen für Europa rief der Europäische Rat im Sommer 1994 zu einer Intensivierung der europäischen Mittelmeerpolitik auf: „Today Europe is not threatened by the power, but on the contrary, by the weakness of the Arab world. … It was finally perceived that stability in the region and thus security could only be achieved by greater political and economical engagement.”[14]
Ein weiteres Kommissionspapier von 1994 schlug vor, das Partnerschaftsmodell auf den gesamten Mittelmeerraum auszudehnen und eine „euro-mediterrane Zone des Friedens und der Stabilität“ zu schaffen. Letztere sollte unter den Primat der im Maastrichter Vertrag vereinbarten „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP)[15] gestellt werden. Die Bedingungen für die Ausweitung auf den gesamten Mittelmeerraum schienen günstig, da der Friedensprozess im Nahen Osten eine positive Entwicklung gezeigt hatte[16] und die GASP zur praktischen Umsetzung drängte. Auf den europäischen Gipfeln in Essen im gleichen Jahr und in Cannes im Frühjahr 1995 akzeptierte der Rat den Vorschlag der Kommission[17]. Somit wurde die Idee der euro-mediterranen Partnerschaft geboren. Ihre endgültige Umsetzung bedurfte jedoch weiterer Vermittlungsarbeit der Kommission. Innereuropäische Differenzen und konkurrierende Interessen mussten zuerst ausgeglichen werden. Einigkeit konnte erst dann erzielt werden nachdem Frankreich und Spanien bereit waren, ihre Einflussinteressen hinter die der Gemeinschaft zu stellen, und Deutschland, Holland und Großbritannien durch die südeuropäischen Mitgliedstaaten von der Wichtigkeit der Partnerschaft überzeugt worden waren. Der Kommission gelang es nach einem Jahr der Verhandlungen, ein Paket eines innereuropäischen Kompromisses auszuhandeln, welches erst dann den zwölf ausgewählten MDL vorgelegt wurde. Die EG gewährte diesen keine Möglichkeit auf die Verträge Einfluss zu nehmen. Die MDL konnten diese nur akzeptieren oder ablehnen[18]. Diese akzeptierten trotz der demütigen Einseitigkeit. Auf die Gründe wird im zweiten Kapitel, das die Interessen der Partner darlegt, näher eingegangen.
2.6 Die Euro-Mediterrane Partnerschaft
Am 27/28 November 1995 wurde die euro-mediterrane Partnerschaft auf der Konferenz von Barcelona aus der Taufe gehoben. Die fünfzehn Mitglieder der Europäischen Union und die Vertreter der zwölf Mittelmeeranrainerstaaten[19] unterzeichneten die sogenannte Barcelona Deklaration, die die euro-mediterranen Beziehungen einem neuen Höhepunkt zuführten. Sie kamen darin überein eine Zone des Friedens, der Stabilität und des gemeinsamen Wohlstandes im Mittelmeerraum errichten zu wollen.
Die Deklaration besteht aus einer Präambel und drei Körben.
Korb 1) Politische – und Sicherheitspartnerschaft
Korb 2) Wirtschafts- und Finanzpartnerschaft
Korb 3) Partnerschaft im kulturellen, sozialen und menschlichen Bereich
Der erste Korb behandelt das gegenseitige Interesse aller Unterzeichner an Frieden, Stabilität und Sicherheit sowie am politischen Dialog. Weiterhin verpflichtet er die Unterzeichner zu der Einhaltung von demokratischen Werten wie Achtung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus und das Recht auf Selbstbestimmung. Ein langfristiges Ziel ist die Verfassung einer Charta für Frieden und Stabilität. Der erste Korb ist vage gestaltet, da er mehr ehrgeizige Intentionen als konkretes Engagement beinhaltet. Betont werden die Entwicklung demokratischer Strukturen, die Achtung der Menschenrechte und das Recht auf Selbstbestimmung[20], Werte, die in den MDL bislang wenig oder gar nicht beachtet werden.
Der zweite Korb stellt eine Reform der traditionellen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen der EU und dem Mittelmeerraum dar. Diese Partnerschaft ist das Kernstück der neuen Initiative. Sie verfolgt drei miteinander verbundene Ziele: die Schaffung einer euro-mediterranen Freihandelszone bis zum Jahr 2010, EU Unterstützung für die Umstrukturierungsphase und eine Zunahme der Investitionen in den Mittelmeerländern, die aus dem Freihandel und wirtschaftlicher Liberalisierung generiert werden sollen.
Ziel der Freihandelszone ist eine verbesserte wirtschaftliche Lage, welche zu erhöhter Stabilität im Mittelmeerraum führen soll. Um dieses zu erreichen, sollen die MDL ihre Wirtschaftssysteme durch Strukturanpassung liberalisieren. Um die schwierige Phase der Umstrukturierung zu überbrücken, wird wirtschaftliche Kooperation gefördert und finanzielle Unterstützung durch die EU gewährt. Für einige dieser Länder stellen derartige ökonomische Umstrukturierungen aber ein Risiko dar. Kurzfristig können diese Arbeitslosigkeit bedeuten, weil Handelsbarrieren wegfallen und europäische Konkurrenz auf die bisher geschützten Märkte dringt. Ein solches Ergebnis könnte soziale Unruhen fördern und den Prozess behindern.
Finanzielle Unterstützung wird im Rahmen des MEDA Programms geleistet, auf das im nächsten Kapitel eingegangen wird. Die Unterstützung wird im bilateralen Rahmen mit den jeweiligen Partnern in den Assoziierungsabkommen[21], vereinbart. Im Kernpunkt jedes Abkommens steht die Freihandelszone. Somit soll über die bilaterale Schiene ein Übergang zu multilateralem Freihandel geschaffen werden. Eine wichtige Voraussetzung von Seiten der MDL ist daher die Bereitschaft, sich nicht ausschließlich auf den europäischen Markt zu konzentrieren, sondern vor allem Handel untereinander auszubauen. Hiervon erhofft man sich auch Domino-Effekte auf die politische Situation. Durch steigenden Wohlstand soll radikalen Kräften in den MDL der Boden entzogen werden.
Der dritte Korb zielt auf die Förderung eines gegenseitigen Dialogs und Verständnisses der Partner ab. Demokratische Prinzipien sollen vor allem durch Förderung von nicht staatlich getragenen Vereinigungen (Civil Societies) gestärkt werden. Das Kapitel unterstreicht ebenso die Bedeutung gegenseitigen Respekts der verschiedenen Kulturen und Religionen. Ergänzend zu der wirtschaftlichen Kooperation in Korb 2 soll die Ausbildung von Arbeitskräften und besonders von jungen Menschen gefördert werden.[22]
Ein zentrales Interesse Europas wird jedoch im letzten Teil des Kapitels deutlich, in dem es um den Bereich der sogenannten „soft security“ geht. “In the area of illegal immigration they decide to establish closer cooperation. In this context, the partners, aware of their responsibility for readmission, agree to adopt the relevant provisions and measures, by means of bilateral agreements or arrangements, in order to readmit their nationals who are in an illegal situation.”[23]
Weiterhin wird gemeinsamer Kampf gegen Terrorismus, Drogenhandel und organisiertes Verbrechen vereinbart. "This “negative” part of Basket three seems to be given more emphasis for implementation than the social and cultural aspect,” kommentiert Jünemann zu diesem Thema.[24] Wie in Kapitel 2 ausführlicher erläutert, hat die EU ein besonderes Interesse daran durch die EMP zuerst ihre Sicherheitsvorstellungen durchzusetzen.
2.7 Das MEDA Programm der EMP
Das MEDA Programm (Mesures D’accompagnement financières et techniques à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen) ist das wichtigste Finanzierungsinstrument für die Implementierung der EMP. Unter MEDA wird Geld in Form von Zuwendungen der EU und in Form von Krediten der Europäischen Investitionsbank (EIB) für bilaterale und regionale Kooperation zur Verfügung gestellt. Maßgebend für die Verteilung sind die in den Kooperationsabkommen mit den jeweiligen Partnern vereinbarten Zielstellungen in Bezug auf die drei Körbe. Die Geldmittel werden jährlich bemessen und ihr Erfolg ist für die Höhe erneuter Zuwendungen maßgeblich. Im Vergleich zu den Finanzprotokollen früherer Initiativen, die für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgegeben wurden, und nicht nach effektiver Verwendung bewertet wurden, ist diese Methode erfolgsorientierter und verhindert, dass die Höhe von Leistungen politisch ausgehandelt werden kann. Erfolgreiche Umsetzung wird bemessen an: eingetretener wirtschaftlicher Liberalisierung, erfolgreicher Verwendung früherer Mittel, dem Demokratisierungsprozess und der Einhaltung der Menschenrechte.
MEDA I (1995 – 1999) verfügte über ein Budget von 3.4 Mrd. Euro, die gänzlich für Projekte der EMP zur Verfügung gestellt worden waren. Davon gingen 85% in bilaterale und der Rest in regionale Aktivitäten. MEDA II ist für den Zeitraum von 2000 bis 2006 angesetzt und stellt ein höheres Budget von 5,35 Mrd. Euro zur Verfügung. Zusätzlich stellt die EIB Kredite in Höhe von 6,4 Mrd. Euro bereit
MEDA II hat eine ähnliche Ausrichtung wie MEDA I. Der Schwerpunkt liegt auf der Vorbereitung der Partnerländer zur Implementierung des Freihandels und der Integration untereinander (Süd-Süd Integration)[25].
2.8 Zusammenfassung
Die Barcelona Deklaration hat einige Gedanken früherer Initiativen erneut aufgegriffen. Neu ist jedoch der multilaterale Ansatz der Partnerschaft, der sich insbesondere bei der Errichtung der Freihandelszone zeigt. Die Einbeziehung einer politischen Dimension ergänzt die früheren bilateralen, rein kommerziell orientierten Abkommen.
Obwohl die Partnerschaft auf Betreiben der EU ins Leben gerufen wurde ist, ist der Charakter einer Partnerschaft an sich hervorzuheben.
Die EMP stellt den Versuch dar, ein komplexes Instrumentarium für die ineinander verstrickten Probleme der Mittelmeerregion zu finden. Die Voraussetzung für ihr Funktionieren ist aber eine konsequente Zusammenarbeit bei der Umsetzung aller drei Körbe.
Schließlich ist nicht zu vergessen, dass der Barcelona Prozess zu einer Zeit ins Leben gerufen wurde, als der Friedensprozess im Nahen Osten versprechend aussah. Die negativen Entwicklungen seither haben auch den Barcelona Prozess erheblich behindert. Auf die vielfältigen Schwierigkeiten wird in Kapitel 3 eingegangen.
3 Motivation für die Teilnahme am Barcelona Prozess
3.1 Einführung
Dieses Kapitel untersucht warum es zur Gründung der EMP kam und welche Ziele die jeweiligen Partner damit verfolgen. Es wird gezeigt, dass die Unterzeichnerstaaten mit ihrer Teilnahme bestimmte Vorteile für ihre Länder erwarten und dass die Partnerschaft asymmetrisch aufgebaut ist.
3.2 Änderung der Weltordnung
Der Ursprung des Barcelona Prozesses fällt nicht nur in die Zeit des sich auflösenden Ost-West Konflikts, sondern auch in das Zeitalter der Globalisierung. Seit den neunziger Jahren ist die Weltwirtschaft zunehmend globaler geworden, und somit auch der Wettbewerb. Zusammenschlüsse von Ländern in unterschiedlichen Entwicklungsstufen wie zum Beispiel geschehen bei Gründung von NAFTA, MERCOSUR oder ASEAN stärken ihre Position im internationalen Wettbewerb. Thompson definiert Regionalismus als einen Prozess, der zu Kooperation und der Annahme gemeinsamer Gesetze und Politik zwischen Staaten und Gruppen führt. Der Prozess kann entweder entstehen um wirtschaftliche Vorteile der geographischen Nähe auszunutzen oder aus Sicherheits- oder umweltpolitischen Gründen, die gleichermaßen Länder einer Region betreffen.[26]
Die nachfolgende Analyse zeigt, dass es der EU primär um Sicherheit, den MDL jedoch um wirtschaftliche Vorteile geht.
3.3 Gründe der EU die Partnerschaft aufzubauen
Im folgenden werden die Motive der EU für die Gründung der EMP dargelegt.
[...]
[1] Die Türkei, Zypern und Malta befinden sich zusätzlich zu der Euro-Mediterranen Partnerschaft in Beitrittsverhandlungen mit der EU.
[2] Patten zitiert in Euromed, External Policy, 2000.
[3] Vgl. Jünemann, Europas Mittelmeerpolitik, 1999, S.37 f.
[4] Vgl. Fritzler and Unser, Europäische Union, 2001, S. 117.
[5] Vgl. Duchêne, Europe´s Role, 1972, S. 31 –47.
[6] Vgl. Medea Institute, Euro-Mediterranean Cooperation, 2001.
[7] Vgl. Rhein, Mittelmeerraum, 2002, S. 701f.
[8] Griechenland trat 1981 in die EG ein. Spanien und Portugal 1986.
[9] Vgl. Jünemann, Europas Mittelmeerpolitik, a.a.O. S. 42.
[10] 1975 Unterzeichnet auf der Konferenz von Helsinki. Zielstellung war der Spannungsabbau im Ost-Westkonflikt und die Zusammenarbeit auf allen Ebenen zwischen den Unterzeichnern. Seit dem 01.01.1995 in Organisation for Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE) umbenannt.
[11] Marokko, Mauretanien, Algerien, Tunesien and Libyen.
[12] Vgl. Bin, Mediterranean Diplomacy, 1997.
[13] Vgl. Constas, Southern European Countries, 1995, S. 133.
[14] Vgl.Jünemann, Europe´s interrelations, 1996, S.5.
[15] Vgl. Renner, Außenbeziehungen, 2000, S. 49f.
[16] Vgl. Whitman, Five Years, 2001.
[17] Vgl. Bundestag, Die Mittelmeerpolitik der EU, 2002.
[18] Vgl. Jünemann, Europas Mittelmeerpolitik, a.a.O., S. 48.
[19] Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Palästinensische Verwaltungsbehörde, Israel, Libanon, Syrien, Türkei, Cypern, Malta und Jordanien. Obwohl Jordanien keinen Zugang zum Mittelmeer besitzt wurde es wegen seiner engen Einbindung an die Region und seiner wichtigen Rolle im Israel-Palestina Konflikt aufgenommen. Libyen war vom Barcelona Prozess wegen der gegen das Land verhängten Sanktionen der UN ausgeschlossen worden. Erst mit Aufhebung der Sanktionen 1999 wurde Libyen ein Beobachterstatus gewährt.
[20] Vgl. European Commission, Barcelona Declaration, 1995.
[21] Die gesetzliche Grundlage der Assoziierungsabkommen ist im Artikel 310 zur Gründung Europäischen Gemeinschaft verankert. “The Community may conclude with one or more states or international organisations agreements establishing an association involving reciprocal rights or obligations, common action and special procedures.”
[22] Vgl. European Commission, The Barcelona process, 2000, S. 10.
[23] Barcelona Declaration.
[24] Vgl. Jünemann, Europe´s interrelations, a.a.O. S. 14.
[25] Vgl. Whitman, Five years, a.a.O.
[26] Vgl. Thompson, Globalisation, 1999, S. 62 f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832472917
- ISBN (Paperback)
- 9783838672915
- DOI
- 10.3239/9783832472917
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Bremen – Wirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Oktober)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- europäische union euro-mediterrane-partnerschaft assoziierungspolitik freihandelszone ägypten
- Produktsicherheit
- Diplom.de