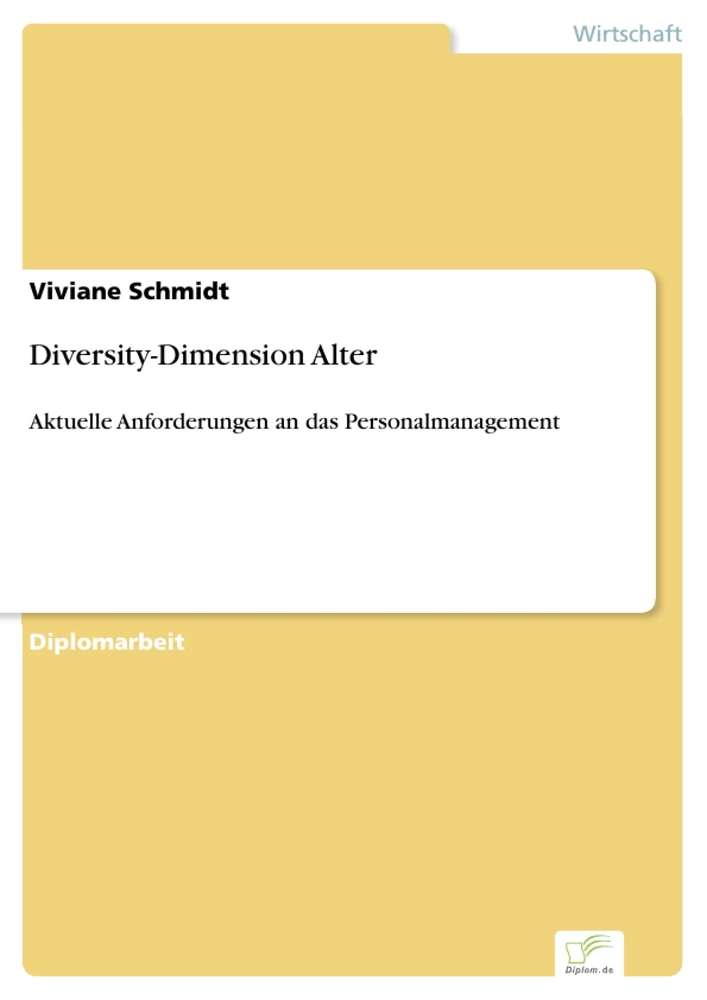Diversity-Dimension Alter
Aktuelle Anforderungen an das Personalmanagement
©2003
Diplomarbeit
99 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Leere Rentenkassen, private Absicherung des Lebensabends, alternde Belegschaftsstrukturen, lebenslanges Lernen, die Förderung der Integration sehr junger und älterer Mitarbeiter in das Unternehmen all diese Themen werden aktuell in der Wirtschaft und in der Politik heiß umstritten diskutiert. Neue Gesetze und Regelungen werden in Zukunft auf uns treffen. Besonders die Unternehmen werden davon betroffen, die die neuen Herausforderungen aufgrund der demographischen Veränderungen zu Nutze ziehen können und müssen, um weiterhin am nationalen und internationalen Markt wettbewerbsfähig bleiben zu können.
Diversity-Management ist ein us-amerikanisches Unternehmenskonzept, das insbesondere die Kerndimensionen Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung, die Religion, die Ethnizität und das Alter fokussiert. Aufgrund der demographischen Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Belegschaftsstrukturen der Unternehmen, der veränderten Kundenstrukturen und -bedürfnisse sowie auf die Sozialsysteme unseres Staates rückt die Kerndimension Alter immer zentraler in das Geschehen der Unternehmen und ihres Personalmanagements. In dieser Arbeit werden die demographischen Entwicklungen (z. B. der steigende Anteil der älteren Menschen in der Gesellschaft, sinkende Geburtenraten) sowohl national als auch in einem internationalen Vergleich beleuchtet und analysiert. Mit der altersspezifischen Untersuchung der Menschen in der Gesellschaft und ihren sich stets ändernden Bedürfnisse, Herausforderungen und Verhaltensweisen wird die wachsende Bedeutung der Altersdimension sowohl für die Gesellschaft als auch für die Unternehmen (und ihre Kundenstrukturen) herausgestellt. Die altersspezifische Untersuchung der Personalmanagementfelder (nach Ch. Scholz) zeigt zielgenau den Unternehmen, wo die Potenziale und der zentrale Nutzen für alle Beteiligten des Unternehmens in diesem Personalkonzept stecken.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
AbkürzungsverzeichnisIV
AbbildungsverzeichnisV
1.Einleitung1
2.Grundlegende Definitionen3
2.1Diversity zum allgemeinen Verständnis3
2.1.1Diversity in Organisationen4
2.1.2Die Diversity-Dimensionen4
2.1.3Managing Diversity6
2.1.4Schlussbetrachtung des Diversity-Begriffs7
2.2Das Alter9
2.2.1Das Alter und seine Ansätze zur Abgrenzung9
2.2.2Die Altersabgrenzungen und ihre Verknüpfungen10
2.3Das Personalmanagement11
2.3.1Begriffsbestimmung und historische Herleitung11
2.3.2Die Felder des […]
Leere Rentenkassen, private Absicherung des Lebensabends, alternde Belegschaftsstrukturen, lebenslanges Lernen, die Förderung der Integration sehr junger und älterer Mitarbeiter in das Unternehmen all diese Themen werden aktuell in der Wirtschaft und in der Politik heiß umstritten diskutiert. Neue Gesetze und Regelungen werden in Zukunft auf uns treffen. Besonders die Unternehmen werden davon betroffen, die die neuen Herausforderungen aufgrund der demographischen Veränderungen zu Nutze ziehen können und müssen, um weiterhin am nationalen und internationalen Markt wettbewerbsfähig bleiben zu können.
Diversity-Management ist ein us-amerikanisches Unternehmenskonzept, das insbesondere die Kerndimensionen Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung, die Religion, die Ethnizität und das Alter fokussiert. Aufgrund der demographischen Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Belegschaftsstrukturen der Unternehmen, der veränderten Kundenstrukturen und -bedürfnisse sowie auf die Sozialsysteme unseres Staates rückt die Kerndimension Alter immer zentraler in das Geschehen der Unternehmen und ihres Personalmanagements. In dieser Arbeit werden die demographischen Entwicklungen (z. B. der steigende Anteil der älteren Menschen in der Gesellschaft, sinkende Geburtenraten) sowohl national als auch in einem internationalen Vergleich beleuchtet und analysiert. Mit der altersspezifischen Untersuchung der Menschen in der Gesellschaft und ihren sich stets ändernden Bedürfnisse, Herausforderungen und Verhaltensweisen wird die wachsende Bedeutung der Altersdimension sowohl für die Gesellschaft als auch für die Unternehmen (und ihre Kundenstrukturen) herausgestellt. Die altersspezifische Untersuchung der Personalmanagementfelder (nach Ch. Scholz) zeigt zielgenau den Unternehmen, wo die Potenziale und der zentrale Nutzen für alle Beteiligten des Unternehmens in diesem Personalkonzept stecken.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
AbkürzungsverzeichnisIV
AbbildungsverzeichnisV
1.Einleitung1
2.Grundlegende Definitionen3
2.1Diversity zum allgemeinen Verständnis3
2.1.1Diversity in Organisationen4
2.1.2Die Diversity-Dimensionen4
2.1.3Managing Diversity6
2.1.4Schlussbetrachtung des Diversity-Begriffs7
2.2Das Alter9
2.2.1Das Alter und seine Ansätze zur Abgrenzung9
2.2.2Die Altersabgrenzungen und ihre Verknüpfungen10
2.3Das Personalmanagement11
2.3.1Begriffsbestimmung und historische Herleitung11
2.3.2Die Felder des […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7265
Schmidt, Viviane: Diversity-Dimension Alter - Aktuelle Anforderungen an das
Personalmanagement
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Fachhochschule Gelsenkirchen, Fachhochschule, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
I
Inhaltsverzeichnis
Seite
Abkürzungsverzeichnis IV
Abbildungsverzeichnis V
1. Einleitung
1
2. Grundlegende Definitionen
3
2.1 Diversity zum allgemeinen Verständnis
3
2.1.1 Diversity in Organisationen
4
2.1.2 Die Diversity-Dimensionen
4
2.1.3 Managing Diversity
6
2.1.4 Schlussbetrachtung des Diversity-Begriffs
7
2.2 Das Alter
9
2.2.1 Das Alter und seine Ansätze zur Abgrenzung
9
2.2.2 Die Altersabgrenzungen und ihre Verknüpfungen
10
2.3 Das Personalmanagement
11
2.3.1 Begriffsbestimmung und historische Herleitung
11
2.3.2 Die Felder des Personalmanagements
13
2.3.3 Schlussbetrachtung
13
3. Aktuelle Entwicklungen für die Diversity-Dimension Alter
14
3.1 Die Demographie Deutschlands im Wandel
15
3.1.1 Rückläufige Bevölkerungszahlen
15
3.1.2 Alte werden immer älter
18
II
Seite
3.2 Die Generationen gestern und heute
18
3.2.1 Die neuen Alten unserer Gesellschaft
19
3.2.2 Junge Menschen in der Gesellschaft
20
3.3 Die Regierung reagiert
22
3.3.1 "50 plus die können das"
23
3.3.2 Staatliche Regelungen zum Renteneintrittsalter
24
3.4 Exkurs: Der internationale Vergleich Deutschland, Japan, Schweiz und USA
26
3.4.1 Demographische Gemeinsamkeiten und Unterschiede
26
3.4.2 Ältere Menschen in der Gesellschaft
29
3.4.3 Bilder des Alters
31
3.4.4 Exkurs-Zusammenfassung
32
3.5 Schlussbetrachtung der aktuellen Entwicklungen
33
4. Altersspezifische Leistungsfähigkeiten
35
4.1 Die körperlichen Leistungsfähigkeiten
36
4.2 Die geistigen Leistungsfähigkeiten
38
4.2.1 Die fluide und kristalline Intelligenz
39
4.2.2 Die Erfahrung
41
4.3 Die Kommunikation
44
4.4 Zusammenfassende Ergebnisse der altersspezifischen Leistungsfähigkeiten
46
5. Die Diversity-Dimension Alter in der Unternehmenspraxis
47
5.1 Die Implementierung der Diversity-Dimension Alter in das Unternehmen
47
5.1.1 Implementierungsvoraussetzungen
47
III
Seite
5.1.2 Der Implementierungsprozess nach J. P. Kotter
49
5.2 Die Zusammenarbeit von jungen und älteren Mitarbeitern
55
5.2.1 Generationskonflikte am Arbeitsplatz
55
5.2.2 Die erfolgreiche altersheterogene Zusammenarbeit am Praxisbeispiel
"Mentoring bei der Landesbank in Kiel"
57
5.3 Exkurs Managing Diversity bei der Deutschen Bank
59
5.3.1 Die Diversity des Unternehmens Vision, grundlegende Leitgedanken und Ziele 59
5.3.2 Age Diversity bei der Deutschen Bank
60
5.4 Zusammenfassende Ergebnisse der Unternehmenspraxis
63
6. Instrumente des Personalmanagement für die Diversity-Dimension Alter
63
6.1 Die klassischen Personalmanagementfelder und ihre Anwendbarkeit auf die
Diversity-Dimension
Alter
64
6.2 Anforderungen und Maßnahmen des Managements der Diversity-Dimension
Alter für die Zukunft
79
6.3 Zusammenfassende Erkenntnisse der Anwendbarkeitsprüfung sowie zukünftiger
Anforderungen und Maßnahmen
81
7. Schlussbetrachtung
82
7.1 Zusammenfassende Ergebnisse und Ausblick
82
7.2 Empfehlungen für zukünftige Forschungsfelder
84
Literaturverzeichnis 85
Eidesstattliche Versicherung
89
IV
Abkürzungsverzeichnis
bagso
Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-
tion
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
f.
folgende
ff
fortfolgende
Hrsg.
Herausgeber
HSH Nordbank Hamburgschleswigholsteinische Nordbank
IAB
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
LB
Landesbank
OECD
Organization for Economic Cooperation Develop-
ment
o. V.
ohne Verfasserangabe
u. M.
unveröffentlichtes Manuskript
URL
Uniform Resource Locator
us/USA
United States (of America)
Vgl.
Vergleiche
z. B.
zum Beispiel
V
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abbildung 1: Die Diversity-Deutungsmöglichkeiten
3
Abbildung 2: Das Vier-Schichten-Modell der Diversity
6
Abbildung 3: Die Entwicklungsstufen und der Sichtweisenumfang
der Diversity
8
Abbildung 4: Bevölkerungsentwicklung Deutschlands 1950 bis 2025
(in Millionen Einwohnern)
15
Abbildung 5: Geburtenzahlenentwicklung 1952 bis 2025 (Lebend-
geborene je 1.000 Frauen) in Deutschland
16
Abbildung 6: Altersstruktur der Erwerbstätigen (in Prozent)
22
Abbildung 7: Bevölkerungsentwicklung im Ländervergleich
(in Millionen Einwohnern)
27
Abbildung 8: Lebenserwartung von Männern und Frauen im Länder-
vergleich
28
Abbildung 9: Bevölkerung nach Altersgruppen im Ländervergleich
(in Prozent für das Jahr 2000)
29
Abbildung 10: Einflussfaktoren und altersspezifische Herausforde-
rungen der Menschen in der Gesellschaft
34
Abbildung 11: Betrachtungsentwicklung des Arbeitsverlaufes
36
Abbildung 12: Veränderungsrichtungen geistiger Leistungsfähig-
keiten mit zunehmendem Alter
38
Abbildung 13: Leistungsverläufe der fluiden und kristallinen
Intelligenz im Altersverlauf
40
VI
Seite
Abbildung 14: Das Modell der Erfahrungskompetenzen
43
Abbildung 15: Bildhaftes Beispiel für die Implementierung der Di-
versity-Dimension Alter an die bestehende Unterneh-
mensvision
51
Abbildung 16: Veranstaltungen und Projekte zur Verbreitung des
Konzeptes
52
Abbildung 17: Erfolge des Mentorings bei der LB Kiel
58
Abbildung 18: Beispiel für den Prozess einer altersgerechten Perso-
nalbedarfsplanung und Personalbestandsanalyse
65
Abbildung 19: Die drei Felder des Veränderungsmanagements
Zusammenspiel und Auswahlkriterien
71
1
1. Einleitung
Das Personalmanagement befindet sich in einem stetigen Wandel. Trei-
ber der Entwicklungen sind in den Veränderungen der unternehmensex-
ternen Umwelt zu sehen wie z. B. die Globalisierung, die europäische In-
tegra-tion, multinationale Kooperationen und Fusionen sowie demogra-
phische Entwicklungen. Aber auch die wachsende Komplexität, Vielfalt
und Dynamik von Prozessen sowie Fortschritte im Informations-, Tech-
nologie- und Kommunikationsbereich prägen die Personalarbeit der heu-
tigen Zeit. Diversity im Sinne von Vielfältigkeit der Belegschaftsstruktu-
ren, der Markt- und Kundenstrukturen aber auch der Arbeits- und Orga-
nisationsformen gewinnt in diesem Kontext immer mehr an Bedeutung
für die Unternehmungen.
Das Management-Konzept ,,Diversity" entstammt der us-amerikanischen
Gleichstellungsdiskussion. Zur Bewältigung sozialer Unterschiede (bei-
spielsweise das Geschlecht, das Alter und die soziale Herkunft) in Orga-
nisationen wird es in den USA seit über zehn Jahren erfolgreich propa-
gandiert und praktiziert und hält seit einigen Jahren auch Einzug in deut-
sche Unternehmen.
[Vgl. Koall 2002: 1]
Die einzelnen Diversity-Themen fanden in vergangener Zeit unterschied-
lich hohe Beachtung. Während Geschlecht, Ethnizität und Rasse stark
berücksichtigt wurden, erhielt das Alter eher mittlere Aufmerksamkeit.
[Vgl. Stuber 2002: 153] Dabei spielt dieser Aspekt aktuell eine ganz be-
sondere Rolle. Aufgrund demographischer Entwicklungen wie z. B. der
steigende Anteil älterer Mitarbeiter in den Unternehmen und der von Ex-
perten prognostizierte Mangel an Führungskräftenachwuchs verändern
sich nicht nur die Unternehmensstrukturen der Belegschaften, sondern
auch die Bedürfnisse der Kunden, Lieferanten und Shareholder. Das be-
deutet: Neue Herausforderungen öffnen sich der Unternehmensführung
und dem Personalmanagement. Aus den aktuellen Diskussionen um die
Notwendigkeit des Umdenkens deutscher Unternehmen bezüglich der
demographischen Veränderungen stellt sich hier allerdings die Frage, ob
eine Diversity hinsichtlich des Alters in Verbindung mit den jeweiligen
Unternehmenszielen praktikabel und synergetisch gestaltet werden kann.
2
Ziel dieser Arbeit ist festzustellen,
· wie das Management der Diversity-Dimension Alter im Unter-
nehmen implementiert, gestaltet und erfolgreich genutzt werden
kann,
· welche altersgerechten Potenziale in den klassischen Personalma-
nagementfeldern stecken und
· welche Anforderungen und Maßnahmen das Management der Di-
versity-Dimension Alter in Zukunft prägen.
Dabei werden zunächst die Begriffe Diversity, Alter und Personalmana-
gement umfassend verdeutlicht.
Auf der Grundlage dieser Definitionen werden daraufhin im Gliede-
rungspunkt 3 die aktuellen Entwicklungen für die Diversity-Dimension
Alter aufgezeigt. Dabei wird zu Beginn die aktuelle soziologische Aus-
gangslage in Deutschland bestimmt, die später in einem Exkurs mit ande-
ren internationalen Daten und Informationen verknüpfend analysiert
wird.
Im Gliederungspunkt 4 werden die altersspezifischen Leistungsfähigkei-
ten von Mitarbeitern kritisch untersucht.
Die Diversity-Dimension Alter in der Unternehmenspraxis wird im Glie-
derungspunkt 5 näher beleuchtet. Es werden Empfehlungen für den Imp-
lementierungsprozess erteilt, Herausforderungen und Schwierigkeiten
des Konzeptes aufgezeigt sowie Beispiele für eine erfolgreiche altershe-
terogene Zusammenarbeit aufgeführt.
Im Gliederungspunkt 6 werden die klassischen Felder des Personalmana-
gements auf eine altersgerechte Anwendbarkeit geprüft sowie neue An-
forderungen und Maßnahmen für die Zukunft entwickelt.
3
Gliederungspunkt 7 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zeigt
mögliche Forschungsschwerpunkte für die Zukunft auf.
4
2. Grundlegende Definitionen
Im zweiten Gliederungspunkt werden die Begriffe Diversity, Alter und
Personalmanagement näher eingegrenzt und ihre verschiedenen Sicht-
weisen aufgezeigt und geprüft. Weiterhin sollen zum eingängigen Ver-
ständnis die begrifflichen Entwicklungen und Abgrenzungen vorgenom-
men werden.
2.1 Diversity zum allgemeinen Verständnis
Das englische Wort ,,diversity" bedeutet in der deutschen Übersetzung
Vielfalt und beschreibt die Situation, dass sich Dinge egal ob sichtbar
oder unsichtbar voneinander unterscheiden. Dabei wird Vielfalt als ei-
ne Summe von subjektiven Wahrnehmungen und Einstellungen von In-
dividuen unterschiedlich aufgenommen, und es kommt zu zahlreichen
Deutungsmöglichkeiten:
Abbildung 1 zeigt nicht nur die Komplexität der Sichtweisen von Diver-
sity, sondern auch die polarisierende Betrachtungsweise des Begriffs, die
R. R. Thomas wie folgt beschreibt: ,,Diversity refers to any mixture of i-
tems characterized by differences and similarities."
[1996: 5] Diversity
umfasst also eine breite Palette von Deutungen, die sowohl die Zusam-
mengehörigkeit im positiven Sinn als auch die Abweichung im negativen
Sinn fokussieren.
Abbildung 1: Die Diversity-Deutungsmöglichkeiten
Diversity im positiven Sinn Diversity im negativen Sinn
Buntheit
Andersartigkeit
Facettenreichtum
Außenseitertum
Reichhaltigkeit Divergenz
Variationsreichtum
Unanpassbarkeit
Vielschichtigkeit
Ungleichheit
Vielseitigkeit
Unstimmigkeit
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Aretz/Hansen 2002: 10
5
2.1.1 Diversity in Organisationen
Diversity wird von vielen Autoren wie z. B. Loden und Rosener im Kon-
text vielfältiger Belegschaftsstrukturen definiert
[Vgl. Sepehri 2002: 80].
R. R. Thomas unterteilt dabei die Menschen bei der Arbeit in zwei Ty-
pen: in die dominante und die dominierte Partei. Die Mitglieder der do-
minanten Komponente die so genannte Ingroup sind die entschei-
dungsbefugten Leute. Sie bestimmen die Politik und das Procedere, sie
entscheiden über grundlegende Voraussetzungen für den Erfolg. Die
Mitglieder der untergeordneten Komponente die so genannte Outgroup
besitzt wenig oder gar keine Macht. Sie sind in der Organisation die
Außenseiter, und ihre Bedürfnisse werden vom Umfeld ihrer Organisati-
on nicht befriedigt. Im Rahmen dieser polarisierenden Betrachtungsweise
sieht Thomas die Diversity als eine Art komplexes Phänomen. Er weist
auf eine Diversity in Organisationen hin, die nicht nur auf Führungsebe-
ne propagiert wird, sondern durch die Überzeugung und das Verhalten
aller Mitarbeiter entwickelt werden kann.
[Vgl. 2001: 30 f.]
Im erweiterten Verständnis endet Diversity jedoch nicht bei der Vielfalt
der Mitarbeiterschaft, sie bezieht sich auch auf die Vielfalt unterschiedli-
cher Kulturen, Strategien, Funktionen und Regelungen, die in Organisa-
tionen nebeneinander stehen und bewusst oder unbewusst gelebt wer-
den.
[Vgl. Aretz/Hansen 2002: 45] Diese Sichtweise betrachtet nicht nur
die interne Diversity auf Personalmanagementebene, sie implementiert
auch weitere interne Organisationseinheiten und das externe Unterneh-
mensumfeld, die im Rahmen einer erfolgreichen Unternehmensführung
berücksichtigt werden müssen. Aufbauend auf diese Sichtweise werden
die weiteren Untersuchungen dieser Arbeit vorgenommen.
2.1.2 Die Diversity-Dimensionen
Je nach Anlass bzw. Dringlichkeit ob regionaler, gesellschaftlicher o-
der wirtschaftlicher Natur thematisiert(e) man im Rahmen von Diversi-
ty unterschiedliche Aufgabenstellungen. In den Anfängen von Diversity
vor ca. zehn Jahren in den USA standen zunächst Rasse/Ethnizität
und Geschlecht im unternehmerischen Blickfeld, da besonders Menschen
6
,,anderer" Hautfarbe und Herkunft sowie Frauen am Arbeitsplatz Be-
nachteiligungen und Diskriminierungen ausgesetzt waren.
Heute werden sechs Kerndimensionen und weitere externe Faktoren an-
gesprochen, und die Sichtweise hinsichtlich der Diversity-Aufgaben-
stellungen wurde komplexer. Nach M. Loden bildet dabei die ,,primary
dimension" mit ihren sechs Komponenten Alter, Rasse/Ethnizität, Ge-
schlecht, sexuelle Orientierung, Religion und Behinderung den Kern des
Dimensionenmodells, die von der zweiten Dimension wie z. B. Kultur,
Sprache, Arbeitserfahrung und (Aus-)Bildung umgeben werden.
[Vgl.
1996: 14 ff
] Im Gegensatz zu den fest definierten Kerndimensionen, die
dem Menschen angeboren sind, handelt es sich bei der zweiten Dimensi-
on um eine offene Liste externer Diversity-Faktoren gemeint sind indi-
viduelle willentliche Maßnahmen, die Menschen im Laufe ihres Lebens
treffen. Beide Dimensionen die Kerndimension und die Dimension der
externen Faktoren spiegeln Erklärungen und Ansichten des vielfältigen
Menschen in einer integrierenden Gesamtheit wider, die Loden folgen-
dermaßen beschreibt: ,,Together, the primary and secondary dimensions
give definition and meaning to our lives by contributing to a synergistic,
integrated whole the diverse person."
[1996: 16]
Gardenswartz und Rowe beschreiben die Dimensionen der Diversity je-
doch in einem erweiterten Modell ,,The Four Layers of Diversity" in
Form einer vierschichtigen Baumscheibe, das in Abbildung 2 dargestellt
ist.
[Gardenswartz/Rowe 1998: 25] Diese Abbildung zeigt im Kern des
Modells die Persönlichkeit des Menschen, die Personality, die unmittel-
bar von den inneren Dimensionen (internal dimensions) umgeben wird.
Sie sind den Kerndimensionen nach dem Modell von Loden gleichzuset-
zen. Diese werden wiederum von den externen Dimensionen eingebettet.
Die organisationalen Dimensionen bilden die äußerste Schicht des Mo-
dells und beziehen sich auf die Arbeitssituation bzw. auf das Unterneh-
mensumfeld des Menschen wie z. B. die Strukturen der Abteilungen, die
Position und Dauer der Zugehörigkeit (Seniorität) des Menschen im Un-
ternehmen.
7
So stellt dieses Modell die Vielfältigkeit von festen und steuerbaren Ein-
flussfaktoren dar, von denen Menschen in der Gesellschaft und im Un-
ternehmen geprägt werden. Gleichzeitig soll dieses Modell aber auch als
Konstrukt von Unterschieden und Gemeinsamkeiten verstanden werden,
die Menschen in der Gesellschaft und in Organisationen zusammenfüh-
ren und verbinden.
2.1.3 Managing Diversity
Wie vielseitig und erweiterbar die Ansichten von Diversity sind, und wie
schwer es fällt, ein komplexes Verständnis rund um diesen Begriff zu
Abbildung 2: Das Vier-Schichten-Modell der Diversity
1=innere Dimension, 2=externe Dimension, 3=organisationale Dimension
Quelle: In Anlehnung an Gardenswartz/Rowe 1998: 25
Kultur
Sprache (Aus-)Bildung
Geschlecht Ethnizität
sexuelle Orientierung
Persön-
lichkeit
B
ehind
erung
Reli-
gion
Alter
Arbeitserfahrung
Eltern-
schaft
Ein-
kom-
Arbeitsinhalt/Arbeitsumfang
Seniorität
Position
Status
Arbeits-
umfeld
Abteilungs-
strukturen
OD³
ED²
ID
¹
8
vermitteln, konnte in den letzten Abschnitten vermittelt werden. Auch
anhand der Definition von ,,Managing Diversity" wird die Komplexität
und Verschiedenartigkeit des Begriffs deutlich. So empfiehlt die Mana-
ging Diversity-Strategie nach Aretz und Hansen, die Vielfalt der Be-
schäftigten zu schätzen und effektiv durch den Aufbau einer multikultu-
rellen Organisation zu nutzen
1
[Vgl. 2002: 11]. Eine weitere Definiti-
onsvariante sei von Stuber an dieser Stelle genannt: ,,Managing Diversity
wird als Instrument verstanden, mit dessen Hilfe der Unternehmenserfolg
durch die gezielte Wertschätzung und aktive Nutzung von Unterschied-
lichkeit gesteigert wird"
[03/2002: 48]. Worauf bzw. auf wen sich diese
Unterschiedlichkeit bezieht, wird hier generalisiert. Stuber schließt die
Diversity-Dimensionen mit ihren teilweise differenten Komponenten al-
ler vergangenen, aktuellen und künftigen Sichtweisen ein und verleiht
seiner Definition somit eine bleibende Aktualität. Diese Definitionsform
dient als Grundlage weiterer Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit.
2.1.4 Schlussbetrachtung des Diversity-Begriffs
Da Diversity ausgehend von den USA aktuell auch in Europa diskutiert
wird, und globale wirtschaftliche Trends eine tragende Rolle hinsichtlich
von Diversity spielen, wird der Begriff um ständig neue Sichtweisen er-
weitert. Eine standardisierte Definition bezüglich von Diversity kann es
daher nicht geben.
[Vgl. Sepehri 2002: 76]
In Abbildung 3 werden zusammenfassend die Entwicklungsstufen des
Diversity-Begriffs dargestellt. Die Form dieses Modells ähnelt einer Ei-
eruhr um zu verdeutlichen, dass aus einer einfachen aber breiten Sicht-
weise gemeint ist die Verschiedenartigkeit von Dingen das Personal-
konzept des Managing Diversity wuchs und somit der Begriff spezifiziert
wurde. Dies wird an der zentralen Einengung der Abbildungsform deut-
lich. In der praktischen Umsetzung wurde jedoch festgestellt, dass Ma-
naging Diversity unternehmensspezifisch von vielen Faktoren umgeben
wird. Um die Kerndimensionen bilden sich weitere Diversity-Schichten,
1
Eine solche multikulturelle Organisation wird durch die formelle und informelle Integ-
ration von Minderheitskulturen, geringe Intergruppen-Konflikte und das Fehlen von
Vorurteilen und Diskriminierungen charakterisiert [Vgl. Aretz/ Hansen 2002: 11].
9
und Managing Diversity wuchs zu einem komplexen und dynamischen
Organisationskonzept. Diese Entwicklung wird als Verbreiterung im un-
teren Bereich der Abbildung dargestellt.
Ein Zusammenhang von Diversity und Managing Diversity besteht nach
Sepehri darin, dass die Vielfältigkeit von Belegschaftsstrukturen als eine
notwendige Voraussetzung für die konzeptionelle Anwendung von Ma-
naging Diversity betrachtet werden kann. Das bedeutet, dass Menschen
in Organisationen, abhängig von den Belegschaftsstrukturen, in unter-
schiedlichem Maß mit Diversity konfrontiert werden und dies das Ver-
ständnis im eigenen Umfeld für Managing Diversity prägt.
[Vgl. 2002:
77
]
Abbildung 3: Die Entwicklungsstufen und der Sichtweisenumfang
der Diversity
Quelle: Eigene Zusammenstellung in Anlehnung an Sepehri 2002: 77
Verschiedenartigkeit von Dingen
Verschiedenartigkeit von Menschen
Managing Diversity als
Personalkonzept
Managing Diversity als komplexes und
dynamisches Organisationskonzept
Managing Diversity als
Personalkonzept mit
Einbezug externer Faktoren
Umfang der Sichtweisen
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
s
s
t
u
f
e
n
10
2.2 Das Alter
Wenn im allgemeinen Sinn vom Begriff Alter die Rede ist, wird meist
das kalendarische bzw. chronologische Alter angesprochen. Dieses Alter
ist ein zeitliches Maß für die Dauer der Existenz einer Person oder eines
Gegenstandes. Das kalendarische bzw. chronologische Alter misst die
vergangene Zeit und dient als absolute Größe zur Unterscheidung von
Älterem und Jüngerem.
[Vgl. Bruggmann 2000: 6 f.]
2.2.1 Das Alter und seine Ansätze zur Abgrenzung
In diesem Gliederungspunkt werden weitere Ansätze zur Altersabgren-
zung vorgestellt; im Gliederungspunkt 2.2.2 werden Verknüpfungen zu
den Abgrenzungen hergestellt und erklärt.
2
Das biologische Alter bezieht sich auf die anatomischen Eigenschaften
und Veränderungen, welche mit einem bestimmten Alter verbunden sind.
Beispielsweise sind die Entwicklung der Muskelkraft oder die Gebärfä-
higkeit der Frau biologische Alterserscheinungen.
Ein weiterer Ansatz der Altersabgrenzung ist das soziale Alter. Basis für
soziale Definitionen des Alters sind die sozialen Wahrnehmungen und
Einstellungen der Gesellschaft. Dabei spielt das Alter, ab welchem die
Gesellschaft als Ganzes jemanden als jünger oder älter betrachtet, eine
Rolle. Aber auch gesellschaftliche Einstellungen gegenüber Jüngeren
und Älteren sowie daraus resultierende Konsequenzen liefern einen ent-
scheidenden Beitrag. Ebenfalls sozialer Natur ist das wahrgenommene
Alter, das bedeutet das Alter eines Menschen im Verhältnis zu einer
normativen Gruppe, an deren Durchschnittsalter man sich orientiert.
Das psychologische Alter richtet sich nach den Bedürfnissen, Erwartun-
gen oder dem Verhalten des Menschen. So können veränderte Bedürfnis-
2
Die Gliederungspunkte 2.2.1 und 2.2.2 beziehen sich ebenfalls auf Bruggmann 2000:
7 ff und werden nicht näher gekennzeichnet.
11
se und/oder Leistungserwartungen z. B. zu veränderten Karriereperspek-
tiven führen.
Menschen werden auch aufgrund ihres funktionalen Alters beschrieben.
Maßgebend ist hier das Erfüllen der Leistungsanforderungen. Dahinter
verbirgt sich die Erkenntnis, dass Menschen mit zunehmendem chrono-
logischen Alter verschiedene biologische und psychologische Verände-
rungen sowohl zunehmender als auch abnehmender Art durchlaufen.
Daraus ergibt sich eine individuelle Variation in der Leistungsfähigkeit
auf allen Altersstufen.
Das subjektive Alter bezieht sich auf die Wahrnehmung des eigenen Al-
ters. Im Gegensatz zum sozialen Alter, welches auf die Fremdwahrneh-
mung beruht, basiert das subjektive Alter auf die Selbstwahrnehmung.
Menschen in Rollen von Mitarbeitern werden auch aufgrund ihres orga-
nisationalen Alters definiert, wobei hier die Betriebszugehörigkeitsdauer
die so genannte Seniorität oder die Dauer in einer bestimmten Stel-
lung ausschlaggebend sind.
2.2.2 Die Altersabgrenzungen und ihre Verknüpfungen
Wenn von einem bestimmten kalendarischen Alter die Rede ist, werden
gewisse Merkmale oder Umstände damit verbunden. Gemeint ist hier die
Verknüpfung des kalendarischen Alters mit anderen Abgrenzungen, wel-
che das Unterscheidungsmerkmal für jünger oder älter liefert. Diese Zu-
ordnungen können jedoch nur tendenziell erfolgen, da individuelle geis-
tige und körperliche Differenzen selbst zwischen kalendarisch gleichalt-
rigen Menschen bestehen. Biologisch determinierte Entwicklungen
können beispielsweise nicht genau einem bestimmten chronologischen
Alter zugeordnet werden und umgekehrt. Ein weiterer Grund, warum
Feinbestimmungen über das Alter nicht präzise getroffen werden können
ist, dass die Verknüpfungen von Altersabgrenzungen oftmals in Relatio-
nen erfolgen. Das subjektive Alter beruht auf der Selbstwahrnehmung
des eigenen Alters, und dies erfolgt beispielsweise in Relation zum eige-
nen chronologischen Alter, zu einer anderen Person oder zu einer be-
12
stimmten Altersgruppe. Letztendlich spielen also die Verknüpfungsvaria-
tionen der Abgrenzungen, das Alter zu normativen Gruppen aber auch
die subjektive (eigene und fremde) Alterswahrnehmung eine wichtige
Rolle, wenn Aussagen über das Alter getroffen werden.
2.3 Das Personalmanagement
In den folgenden Abschnitten wird der Begriff des Personalmanagements
näher aufgezeigt, das heißt, mehrere Definitionsvarianten sowie die his-
torische Entwicklung des Begriffs und der Inhalte werden beleuchtet.
Anschließend wird die Strukturierung des Personalmanagements nach
Ebenen und Feldern vorgestellt.
2.3.1 Begriffsbestimmung und historische Herleitung
Das betriebliche Personalmanagement häufig ist auch von Personalwe-
sen, Personalwirtschaft und seit einigen Jahren auch vom Human Re-
source Management die Rede beschäftigt sich im Allgemeinen mit dem
Menschen und seiner Arbeit. Die vielen Definitionen des Begriffs unter-
liegen aufgrund von neuen Erkenntnissen und Sichtweisen einem stetigen
Veränderungsprozess. So bezeichnet H. Wagner das Personalmanage-
ment als bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal und dessen zielori-
entierten Einsatz. Als Personal werden dabei alle in der Organisation im
Hinblick auf die zielsetzungsgerechte Aufgabenerfüllung abhängig be-
schäftigten Menschen bezeichnet.
[Vgl. 1995: 1] Aktuelle Sichtweisen
des Begriffs wie z. B. nach Ch. Scholz sind jedoch weit komplexer und
beschreiben Personalmanagement als aktiven und integrierten Teil des
gesamten Managementprozesses.
[Vgl. 2000: 1] Er beschreibt in diesem
Kontext die neuen Herausforderungen des Personalmanagements anhand
eines Spannungsfeldes der treibenden Kräfte Markt-, Technologie-, Or-
ganisations- und Wertedynamik, in dem das Personalmanagement ope-
riert.
3
[Vgl. 2000: 7 ff]
3
Operiert heißt in diesem Zusammenhang, dass Wechselwirkungen zwischen den trei-
benden Kräfte und dem Personalmanagement bestehen.
13
Die historische Herleitung des Personalmanagement-Begriffs geht bis in
die 50-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück. Damals gestaltete
sich die so genannte Personalarbeit als reine Personalverwaltung, das
heißt Lohn- und Gehaltsbuchhaltung sowie erste Ansätze für eine Perso-
naleinsatzplanung. In den folgenden zwei Jahrzehnten gewannen neue
Führungsmittel wie die Stellenbeschreibung und formalisierte Zielver-
einbarungen ihren Höhepunkt. Auch die Personalentwicklung und -
betreuung gewannen im Rahmen der Personalarbeit an Bedeutung die
Personalaktivierung und die Karriereplanung wurden erstmalig prakti-
ziert.
[Vgl. Scholz 2000: 32 ff]
Seit den 80-er Jahren ist die Personalarbeit zu einem strategischen Wett-
bewerbsfaktor aufgestiegen und der Begriff des Personalmanagements
wurde geprägt. Es entstanden die ersten Ansätze einer Personalstrategie.
Diese Entwicklung rührte vor allem durch das hohe Lohnniveau in
Deutschland, den strukturellen Problemen der Beschäftigungslandschaft
und einer immer komplexeren und dynamischeren Umwelt.
[Vgl. Wag-
ner 1995: 7
] Bedingt durch die wechselseitige Wirkung zwischen dem
Personalmanagement und den externen Triebkräften wurde auch die Per-
sonalarbeit im Laufe der Zeit immer dynamischer und komplexer. Im
Rahmen von dramatischen Umstrukturierungsprozessen aufgrund der
Rezession in den 90-er Jahren wurden Personalaufgaben allmählich über
das gesamte Spektrum der betrieblichen Funktionsbereiche verteilt. Es
fand eine Bewegung zur Personalinterfunktionalität statt, in der jede Füh-
rungskraft zu einem gewissen Grad die Rolle des Personalmanagers
wahrnimmt.
[Vgl. Scholz 2000: 32]
Das Personalmanagement der heutigen Zeit stellt sich immer dynami-
scheren und komplexeren Herausforderungen, die eine Personal-Profes-
sionalisierung in allen Unternehmensbereichen fordert. Fokussiert wer-
den hierbei die personalwirtschaftlichen Kernkompetenzen, die im Un-
ternehmen verteilt und differenziert praktiziert, jedoch unter einem ge-
meinsamen Nenner zusammengeführt werden müssen. Eine solche Integ-
ration von Kompetenz bzw. Professionalität kann dann trotz wachsender
14
Dynamik und Komplexität zu einer Optimierung der personalwirtschaft-
lichen Wertschöpfung führen.
[Vgl. Scholz 2000: 32]
Für die Zukunft wird das Bild des proaktiv handelnden Personalmana-
gements gesehen, das strategisch und vorausschauend die Personalarbeit
plant und zusammen mit allen Beteiligten umsetzt. Aufgrund der dyna-
mischen Umweltbedingungen wird das Personalmanagement nicht mehr
langfristig gestaltbar sein: Es wird dringender denn je vor Ort und ziel-
genau benötigt.
[Vgl. Ehmann/Eisele 05/2003: 34 f.]
2.3.2 Die Felder des Personalmanagements
Da dem Personalmanagement recht komplexe und immer wieder neue
Herausforderungen gestellt werden, wird es zwecks besserer Operationa-
lisierung seiner Funktionen und Prozesse in Felder und Ebenen differen-
ziert. Die inhaltlichen Aufgaben der Personalarbeit sind unter anderem
bei Scholz in neun Felder strukturiert. Sie unterteilen sich in Personalbe-
darfsbestimmung, Personalbestandsanalyse, Personalbeschaffung, Perso-
nalentwicklung, Personalfreisetzung, Personalveränderung, Personalein-
satz, Personalkostenmanagement sowie Personalführung
[2000: 83 ff].
Da die Personalmanagementfelder die Untersuchungsgrundlage dieser
Arbeit hinsichtlich der Anwendbarkeit und Ausbaufähigkeit der Diversi-
ty-Dimen-sion Alter bilden, werden im Gliederungspunkt 6 in einer um-
fassenden Analyse ihre Inhalte und zentralen Ziele näher dargelegt. Die
Ebenen des Personalmanagements (die strategische, die taktische und die
operative Ebene) nach Scholz
[2000: 88 ff] werden an dieser Stelle kurz
genannt, jedoch wegen der Umfangbegrenzung dieser Arbeit nicht näher
erläutert.
2.3.3 Schlussbetrachtung
Das Personalmanagement entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten zu einem komplexen Beziehungsgeflecht zu anderen
Organisationseinheiten innerhalb und außerhalb des Unternehmens
[Vgl.
Wagner 1995: 362
]. Voraussetzung für die Bewältigung dieses
vielschichtigen Systems war und ist die Verteilung der Personalaufgaben
auf die entsprechenden betrieblichen Funktionsbereiche und eine
zunehmende multikulturelle Orientierung. Mit diesem Trend ergeben
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832472658
- ISBN (Paperback)
- 9783838672656
- DOI
- 10.3239/9783832472658
- Dateigröße
- 699 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen; Gelsenkirchen – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Oktober)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- demographie belegschaft diversity management generationen alterspyramide
- Produktsicherheit
- Diplom.de