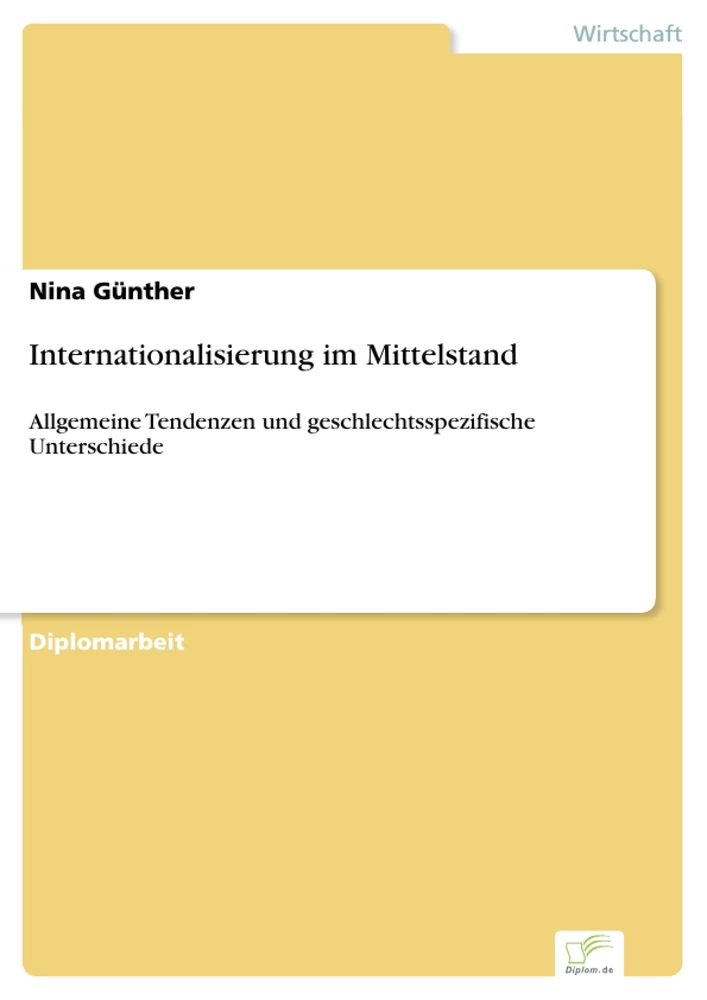Internationalisierung im Mittelstand
Allgemeine Tendenzen und geschlechtsspezifische Unterschiede
©2003
Diplomarbeit
125 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die gesellschaftliche und wettbewerbsorientierte Situation hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch gewandelt. Das Wettbewerbsumfeld unterlag einem breiten Spektrum an Kräften und Entwicklungen, die in den verschiedenen Ländern, den Branchen und den einzelnen Unternehmen ein Aufbrechen alter Strukturen und eine Verschiebung der Grundlagen des Wettbewerbs bewirkten. Insbesondere die zunehmende Globalisierung stellt immer wachsendere Anforderungen an die Unternehmensführung und zwingt viele Unternehmen ihr internationales Engagement zu überdenken. Gerade mittelständische Unternehmen scheinen aufgrund ihrer Unternehmensgröße, auf den sich liberalisierenden Märkten benachteiligt zu sein.
Neben diesen wirtschaftlichen veränderten Rahmenbedingungen haben sich zudem wesentliche Wandlungen in der Gesellschaft vollzogen. Insbesondere die Position der Frau und deren berufliche Rolle unterlag gerade in den letzten Jahrzehnten großen Veränderungen. Die Modalitäten sich von der Hausfrau zur Karrierefrau und Unternehmerin zu entwickeln, wuchsen und eröffneten nie da gewesene Chancen und Potentiale für das weibliche Geschlecht. Diese gravierenden strukturellen Veränderungen auf wettbewerbsorientierter und gesellschaftlicher Basis, sind vielfach Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen im Bereich des internationalen Management und der geschlechtsspezifischen Unternehmerforschung. Eine Verbindung dieser wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutungsvollen Untersuchungsgegenstände wurde jedoch bisher nur in Ansätzen versucht. Vorrangiges Ziel dieser Arbeit ist es, die Herausforderungen für die Unternehmensleitung unter geschlechtsspezifischen Aspekten für international agierende Unternehmen zu untersuchen und möglicherweise Besonderheiten in den Betrieben, die durch Unternehmerinnen geleitet werden, aufzudecken. Neben diesem geschlechterorientierten Untersuchungsgegenstand werden die gegenwärtige Situation und die Erfolgspotentiale einer Internationalisierung gerade für den Mittelstand unter allgemeinen Aspekten analysiert.
Der Aufbau der Arbeit leitet sich durch die beschriebenen Zielsetzungen ab. Zunächst werden im ersten Teil der Arbeit theoretische Grundlagen des internationalen Managements und der Geschlechterforschung für ein basisorientiertes Wissen erörtert. Dabei wird der Blick zum einen neben Begriffsdefinitionen auf die strukturellen Entwicklungen, die gegenwärtige Situation der Internationalisierung und deren […]
Die gesellschaftliche und wettbewerbsorientierte Situation hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch gewandelt. Das Wettbewerbsumfeld unterlag einem breiten Spektrum an Kräften und Entwicklungen, die in den verschiedenen Ländern, den Branchen und den einzelnen Unternehmen ein Aufbrechen alter Strukturen und eine Verschiebung der Grundlagen des Wettbewerbs bewirkten. Insbesondere die zunehmende Globalisierung stellt immer wachsendere Anforderungen an die Unternehmensführung und zwingt viele Unternehmen ihr internationales Engagement zu überdenken. Gerade mittelständische Unternehmen scheinen aufgrund ihrer Unternehmensgröße, auf den sich liberalisierenden Märkten benachteiligt zu sein.
Neben diesen wirtschaftlichen veränderten Rahmenbedingungen haben sich zudem wesentliche Wandlungen in der Gesellschaft vollzogen. Insbesondere die Position der Frau und deren berufliche Rolle unterlag gerade in den letzten Jahrzehnten großen Veränderungen. Die Modalitäten sich von der Hausfrau zur Karrierefrau und Unternehmerin zu entwickeln, wuchsen und eröffneten nie da gewesene Chancen und Potentiale für das weibliche Geschlecht. Diese gravierenden strukturellen Veränderungen auf wettbewerbsorientierter und gesellschaftlicher Basis, sind vielfach Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen im Bereich des internationalen Management und der geschlechtsspezifischen Unternehmerforschung. Eine Verbindung dieser wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutungsvollen Untersuchungsgegenstände wurde jedoch bisher nur in Ansätzen versucht. Vorrangiges Ziel dieser Arbeit ist es, die Herausforderungen für die Unternehmensleitung unter geschlechtsspezifischen Aspekten für international agierende Unternehmen zu untersuchen und möglicherweise Besonderheiten in den Betrieben, die durch Unternehmerinnen geleitet werden, aufzudecken. Neben diesem geschlechterorientierten Untersuchungsgegenstand werden die gegenwärtige Situation und die Erfolgspotentiale einer Internationalisierung gerade für den Mittelstand unter allgemeinen Aspekten analysiert.
Der Aufbau der Arbeit leitet sich durch die beschriebenen Zielsetzungen ab. Zunächst werden im ersten Teil der Arbeit theoretische Grundlagen des internationalen Managements und der Geschlechterforschung für ein basisorientiertes Wissen erörtert. Dabei wird der Blick zum einen neben Begriffsdefinitionen auf die strukturellen Entwicklungen, die gegenwärtige Situation der Internationalisierung und deren […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7198
Günther, Nina: Internationalisierung im Mittelstand - Allgemeine Tendenzen und
geschlechtsspezifische Unterschiede
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Fachhochschule Gelsenkirchen, Fachhochschule, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis
der
Abbildungen
IV
Verzeichnis
der
Tabellen
V
Verzeichnis
der
Abkürzungen
VI
I. Einleitung
1
II. Theoretische
Vorüberlegungen
2
1.
Der Stellenwert der mittelständischen Unternehmen in
Deutschland
2
1.1.
Der Mittelstand und seine politische Bedeutung
2
1.2.
Der Mittelstand und seine wirtschaftliche
Bedeutung
2
1.2.1. Die Definition eines mittelständischen
Unternehmens
3
1.2.2.
Der
Mittelstand
in
Deutschland
5
2. Die
Internationalisierung
5
2.1.
Die Entwicklung der internationalen Geschäftstätigkeit
5
2.2.
Die Definition der Internationalisierung und deren Bedeutung
für
mittelständische
Unternehmen 8
2.3.
Formen der Internationalisierung
9
2.3.1. Der
Export
2.3.2. Die
Lizenz
2.3.3. Die
Auslandskooperation
2.3.4. Die Auslandsniederlassung und Tochtergesellschaft
2.4.
Stand der Forschung
2.4.1. Theoretische
Erklärungsansätze
2.4.2. Stand der empirischen Forschung
2.4.2.1. Der ressourcenbasierte Ansatz
2.4.2.2. Die Globalisierungstendenzen im Mittelstand
2.4.2.3. Die Internationalisierungstendenzen der mittelständischen
Unternehmen
2.4.2.4. Motive und Hemmnisse für die Auslandsmarktbearbeitung
2.4.2.5. Die Planung internationaler
Aktivitäten
2.4.3. Fazit über den Stand der Forschung
3. Die
Unternehmerinnen
3.1.
Unternehmerinnen im Blickfeld des statistischen Hintergrunds
3.2.
Stand der geschlechtsspezifischen Unternehmerforschung
3.2.1. Theoretische
Grundüberlegungen und Erklärungsversuche
3.2.2. Stand der empirischen Forschung
3.2.2.1. Die betrieblichen
Ressourcen
3.2.2.2.
Das
Humankapital
3.2.2.3. Die Finanzierung und Risikobereitschaft
3.2.2.4.
Die
Expansion
3.2.3. Fazit über den Stand der Forschung
III.
Die empirische Erhebung internationalisierender
Unternehmerinnen
und
Unternehmer
1.
Ziel der Studie
2. Methodische
Konzeption
3.
Die Betrachtung allgemeiner Internationalisierungstendenzen
3.1.
Ziel und Gegenstand der ersten
Teilerhebung
3.2. Ausgewählte
empirische
Ergebnisse
3.2.1. Die Struktur der teilnehmenden mittelständischen Unternehmen
3.2.1.1. Die allgemeine Branchenstruktur
3.2.1.2. Größenabgrenzung durch die Mitarbeiterzahl und den Umsatz
3.2.1.3.
Die
Alterstruktur
3.2.2. Tendenzen der Globalisierung
3.2.3. Die Untersuchung der Markteintrittsformen
3.2.4. Die geographische Ausdehnung internationaler Aktivitäten
3.2.5. Die
funktionale
Einbindung in die Internationalisierung
3.2.6. Motive und Hemmnisse für eine internationale Betätigung
3.2.7. Die Planung einer Auslandsmarktbearbeitung
3.2.8. Die Finanzierungsquellen im Internationalisierungsprozess
3.2.9. Ausbau und Prozess der Internationalisierung
3.2.10.
Die
Erfolgsfaktoren
3.3.
Fazit und Ausblick der ersten
Teilerhebung
4.
Die Internationalisierung betrachtet unter geschlechtsspezifischen
Gesichtspunkten
4.1.
Ziel und Gegenstand der zweiten Teilerhebung
4.2. Ausgewählte
empirische
Ergebnisse
4.2.1. Die Struktur der untersuchten
Unternehmen
4.2.1.1. Die Branchenstruktur
4.2.1.2.
Die
Alterstruktur
4.2.1.3. Größendeterminierung durch die Mitarbeiterzahl und des
Umsatzes
4.2.2. Einfluss und Vorbereitung auf die Globalisierung
+
4.2.3.
Die
Markteintrittsformen
4.2.4. Die geographische Ausdehnung internationaler Aktivitäten
4.2.5. Motive und Hemmnisse für eine internationale Betätigung
4.2.6.
Die
Informationsbeschaffung
4.2.7. Die Planung von internationalen
Aktivitäten
4.2.8. Die Finanzierungsquellen im Internationalisierungsprozess
4.2.9. Die Expansion der Unternehmen
4.2.10. Die Faktoren für eine erfolgreiche Internationalisierung
4.3.
Fazit und Ausblick der zweiten Teilerhebung
IV. Zusammenfassendes
Ergebnis
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche
Versicherung
Anhang
Verzeichnis der Abbildungen
IV
Verzeichnis der Abbildungen:
Seite
Abb. 1:
Handel der Motor der Weltwirtschaft
(Reale Entwicklung Index 1950=100)
7
Abb. 2:
Exportquoten des Mittelstands 1999
ausgesuchte
Branchen
7
Abb. 3:
Alternative Formen der Auslandsmarktbearbeitung
nach
Meissner
9
Abb.
4: Die
allgemeine
Branchenstruktur
35
Abb. 5:
Die Internationalisierungsformen
(Mehrfachnennungen
möglich)
38
Abb. 6:
Die Finanzierungsquellen im einzelnen
(Mehrfachnennungen
möglich)
45
Abb. 7:
Die geschlechtsspezifische Branchenverteilung
51
Abb. 8:
Die Altersstruktur
der
Unternehmen
53
Abb. 9:
Die Beschäftigtenverteilung der Unternehmerinnen
und
Unternehmer
54
Abb. 10
Die Umsatzstruktur der Geschlechter
Abb. 11:
Unterschiede in der Wahl der Auslandsmarkt-
bearbeitung
(Mehrfachantworten
möglich)
57
Abb.
12:
Die
geographische
Ausdehnung
60
Abb. 13:
Die bevorzugten Informationsquellen der
Geschlechter
64
Verzeichnis der Tabellen
V
Verzeichnis der Tabellen
Seite
Tabelle 1:
Abgrenzungskriterien für mittelständische
Unternehmen 4
Tabelle 2:
Betriebsgrößenstruktur 2001 in Deutschland
5
Tabelle 3:
Die Bedeutung des Exportes für mittelständische
Unternehmen 11
Tabelle 4:
Die Bedeutung der Lizenz für mittelständische
Unternehmen 12
Tabelle 5:
Die Bedeutung der Auslandskooperation für
mittelständische
Unternehmen
13
Tabelle 6:
Die Bedeutung der Auslandsniederlassung für
mitteständische
Unternehmen
14
Tabelle 7:
Kurzübersicht über die Internationalisierungsstudien im
Mittelstand
Tabelle 8:
Kurzübersicht über die Studien der geschlechts-
spezifischen
Unternehmerforschung
24
Tabelle 9:
Die prozentuale Verteilung der Umsätze
36
Tabelle10: Die
Planungsbereiche: Ihre Bewertung und die
tatsächliche
Realisation
44
Tabelle 11: Determinanten einer erfolgreichen
Internationalisierung 46
Tabelle 12: Einfluss der Globalisierung und die Vorbereitung
Des
Mittelstandes
57
Tablelle13: Die geschlechterspezifische Bewertung einzelner
Planungsbereiche
66
Verzeichnis der Abkürzungen
V
Verzeichnis der Abkürzungen:
AHK
Ausländische
Handelskammer
ASU
Arbeitsgemeinschaft
selbstständiger Unternehmer
DL
Dienstleitung
FPB
Forum of Private Business
FSB
Federation
of
Small
Business
IAB
Institut
für
Arbeitsmarkt-
und
Berufsforschung
IHK
Industrie
und
Handelskammer
IFM
Institut
für
Mittelstandsforschung
Bonn
RDC
Rural
Development
Commission
RWI Rheinisch-Westfälisches
Institut für Wirtschaftsforschung
Essen
SBA
U.S. Small Business Adminstration
Internationalisierung im Mittelstand
I.
Einleitung
Die gesellschaftliche und wettbewerbsorientierte Situation hat sich in den letzten
Jahrzehnten drastisch gewandelt. Das Wettbewerbsumfeld unterlag einem
breiten Spektrum an Kräften und Entwicklungen, die in den verschiedenen
Ländern, den Branchen und den einzelnen Unternehmen ein Aufbrechen alter
Strukturen und eine Verschiebung der Grundlagen des Wettbewerbs bewirkten.
Insbesondere die zunehmende Globalisierung stellt immer wachsendere
Anforderungen an die Unternehmensführung und zwingt viele Unternehmen ihr
internationales Engagement zu überdenken. Gerade mittelständische
Unternehmen scheinen aufgrund ihrer Unternehmensgröße, auf den sich
liberalisierenden Märkten benachteiligt zu sein.
Neben diesen wirtschaftlichen veränderten Rahmenbedingungen haben sich
zudem wesentliche Wandlungen in der Gesellschaft vollzogen. Insbesondere die
Position der Frau und deren berufliche Rolle unterlag gerade in den letzten
Jahrzehnten großen Veränderungen. Die Modalitäten sich von ,,der Hausfrau zur
Karrierefrau und Unternehmerin" zu entwickeln, wuchsen und eröffneten nie
dagewesene Chancen und Potentiale für das weibliche Geschlecht. Diese
gravierenden strukturellen Veränderungen auf wettbewerbsorientierter und
gesellschaftlicher Basis, sind vielfach Gegenstand wissenschaftlicher
Forschungen im Bereich des internationalen Management und der
geschlechtsspezifischen Unternehmerforschung. Eine Verbindung dieser
wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutungsvollen Untersuchungsgegenstände
wurde jedoch bisher nur in Ansätzen versucht. Vorrangiges Ziel dieser Arbeit ist
es, die Herausforderungen für die Unternehmensleitung unter
geschlechtsspezifischen Aspekten für international agierende Unternehmen zu
untersuchen und möglicherweise Besonderheiten in den Betrieben, die durch
Unternehmerinnen geleitet werden, aufzudecken. Neben diesem
geschlechterorientierten Untersuchungsgegenstand werden die gegenwärtige
Situation und die Erfolgspotentiale einer Internationalisierung gerade für den
Mittelstand unter allgemeinen Aspekten analysiert.
Der Aufbau der Arbeit leitet sich durch die beschriebenen Zielsetzungen ab.
Zunächst werden im ersten Teil der Arbeit theoretische Grundlagen des
internationalen Managements und der Geschlechterforschung für ein
basisorientiertes Wissen erörtert. Dabei wird der Blick zum einen neben
Begriffsdefinitionen auf die strukturellen Entwicklungen, die gegenwärtige
Situation der Internationalisierung und deren Ausgestaltung in mittelständischen
Unternehmen gelegt. Zum anderen wird der momentane Stand der Forschung im
Bereich der Theorieentwicklung und in der praxisorientierten Forschung, durch
1
Internationalisierung im Mittelstand
ausgewählte empirischer Daten, intensiver betrachtet. Der zweite Teil der Arbeit
widmet sich der eigenen empirischen Erhebung. In der Analyse werden zunächst
die allgemeinen Entwicklungen von sich internationalisierenden
mittelständischen Unternehmen analysiert. Danach richtet sich der Blick auf
eventuell existierende geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Führung
dieser sich internationalisierenden Unternehmen.
II.
Theoretische Vorüberlegungen
1.
Der Stellenwert der mittelständischen Unternehmen in Deutschland
1.1. Der Mittelstand und seine politische Bedeutung
Dem Mittelstand wird von der Politik gegenwärtig und auch zukünftig ein großer
Stellenwert in der wirtschaftlichen Umgebung Deutschlands beigemessen.
So ist von dem ,,...Fundament und Eckpfeiler der Nationalökonomie" im Bericht
,,Politik für den Mittelstand" zu lesen.
1
Dr. Werner Müller, ehemaliger
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, berichtete in seiner
Eröffnungsrede zum Mittelstandstag 2002, der Mittelstand werde ,,...maßgeblich
die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschlands prägen und gestalten"
2
und
auch in dem Endbericht ,,Zukunft von Selbstständigkeit und Mittelstand" ist von
der ,,...Unverzichtbarkeit der Stärkung des Mittelstandes" und von ,,...Motoren für
Beschäftigung und Innovation" die Rede.
3
Diese Äußerungen zeigen, dass der Mittelstand in politischen Diskussionen und
Erörterungen ein wichtiges Themengebiet darstellt. Fraglich ist allerdings, ob die
reale wirtschaftliche Bedeutung des Mittelstandes mit dem Stellenwert, dem die
Politik ihm beimisst, konform ist.
1.2. Der Mittelstand und seine wirtschaftliche Bedeutung
Ausführungen von Walter zufolge, verkörpert der Mittelstand den Kern der
pluralistischen Wirtschaftsstruktur in Deutschland.
4
Die Bedeutung kleiner und
mittlerer Unternehmen geht über das Füllen von rentablen Marktnischen oder
von Angebotslücken großer Unternehmen hinaus. Seine spezifischen Stärken
1
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2002b), S. 5
2
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2002a), S. 4
3
Projektgruppe des SPD Parteivorstandes (2001), S. 8
4
vgl. Walter (1998), S.16
2
Internationalisierung im Mittelstand
- hohe Marktnähe, hohe Flexibilität und Innovationsfähigkeit - tragen zu dem
permanenten Strukturwandel und Erneuerungsprozess der Marktwirtschaft bei.
5
1.2.1. Die Definition eines mittelständischen Unternehmens
Zunächst ist der Begriff Mittelstand abzugrenzen. Hierzu existiert weder auf
nationaler noch auf internationaler Ebene eine einheitliche allgemein gültige
Definition. Vielmehr werden mittelständische Unternehmen von der Wissenschaft
in vielfältiger Weise beschrieben. Gantzel will bereits in den 60er Jahren über
200 Definitionen und Umschreibungen für den Begriff ,,mittelständisches
Unternehmen" zusammengetragen haben und bis heute sind die Kriterien der
Abgrenzung vielfältig und breit gestreut.
6
Die Literatur grenzt den Begriff
,,Mittelstand" sowohl durch quantitative als auch durch qualitative Merkmale ab
und umfasst als Definition ökonomische, gesellschaftliche und psychologische
Aspekte.
Unter den qualitativen Charakteristiken für ein mittelständisches Unternehmen ist
als wesentliches Kriterium die wesentliche Prägung der Unternehmens- und
Leitstruktur durch den Inhaber oder Inhaberin zu betonen. Diese enge
Verbindung zwischen Unternehmensleitung und Unternehmen definiert
wesentlich den Erfolg eines Betriebes, da das gesamte wirtschaftliche Verhalten,
wie die Organisationsstruktur, Entscheidungsfindung und Finanzierung diesem
Aspekt unterworfen ist. Demnach determiniert insbesondere dieses qualitative
Kriterium den Erfolg des Unternehmens entscheidend und oft treten die
gebräuchlichen quantitativen Abgrenzungskriterien hinter der Bedeutung der
qualitativen zurück.
7
Aus quantitativer Sicht umfasst der Begriff ,,Mittelstand" über alle Branchen
hinweg die Gesamtheit der Unternehmen und freien Berufe, soweit sie eine
bestimmte Größe nicht überschreiten.
8
Eine Vielzahl von Größenindikatoren, wie
Umsatz, Gewinn, Eigenkapital, Bilanzsumme, Wertschöpfung
Produktionsmengen, Maschinenstunden, Stellung am Markt oder die Zahl der
Beschäftigten, stehen hier der Wissenschaft für eine Abgrenzung zur Verfügung.
Jedes dieser Kriterien bedarf jedoch, gerade wenn es zu Vergleichszwecken
herangezogen wird, einer sorgfältigen Diskussion. Problematisch ist zudem,
dass amtliche Statistiken zu den oben genannten Kriterien nicht ausreichende,
vergleichbare Untersuchungsergebnisse liefern können und sich meist nur auf
bestimmte Wirtschaftsbereiche oder Größenklassen beziehen.
9
5
vgl. Karagozoglu/Lindell (1998), S.44-45
6
vgl. Gantzel (1962), S.7
7
vgl. IFM Bonn (2002), S. 3-4
8
vgl. IFM Bonn (2002), S.1
9
vgl. IFM Bonn (2002), S.2
3
Internationalisierung im Mittelstand
Aufgrund der breiten Vielfalt von Abgrenzungsmöglichkeiten zum Begriff
,,Mittelstand", erfolgt eine Abgrenzung meist abhängig vom Untersuchungsziel.
So auch Frank: ,, Welche Abgrenzungsmöglichkeit schließlich gewählt wird, ist
eine Frage der Zweckmäßigkeit und nicht eine Frage der Richtigkeit."
10
Das
Institut für Mittelstandsforschung legte seine Abgrenzungskriterien in Form
quantitativer Aspekte nach der Beschäftigungszahl und des Umsatzvolumens
fest. Danach werden als kleine und mittelständische Unternehmen Betriebe
definiert, die bis zu 499 Mitarbeiter beschäftigen und deren Umsatz bis zu 50
Millionen Euro beträgt.
11
Tabelle 1: Abgrenzungskriterien für mittelständische Unternehmen
Unternehmensgröße
Zahl der Beschäftigten
Umsatz Euro/ Jahr
klein
bis 9
bis 1 Million
mittel
10 bis 499
1 Million bis 50 Millionen
groß
500 und mehr
50 Millionen und mehr
Quelle: IFM Unternehmensgrößenstatistik 2002 - Daten und Fakten
Auch in den empirischen Studien hat sich die Abgrenzung nach quantitativen
Aspekten insbesondere durch die Beschäftigtenanzahl durchgesetzt.
12
Wird die internationale Ebene betrachtet, erkennt man, dass bislang keine
einheitliche Größenklassifizierung existiert. Während die Kommission der
Europäischen Union Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl bis zu 249
Beschäftige zum Mittelstand zählt, definiert das Office of Advocacy der U.S.
Small Business Administration (SBA) ein Unternehmen in den USA als
mittelständisch, wenn weniger als 500 Mitarbeiter beschäftigt werden. Die
einzelnen Mitgliedsstaaten der europäischen Union verwenden unterschiedliche
Beschäftigtenzahlen zur Eingrenzung mittelständischer Unternehmen.
13
Es zeigt
sich, dass gegenwärtig noch keine international standardisierte
Mittelstandsabgrenzung erfolgt ist. Die heterogenen Größenklassifizierungen
sind auf die divergierenden Größen- und Strukturunterschiede in den einzelnen
Volkswirtschaften zurückzuführen.
1.2.2. Der Mittelstand in Deutschland
Unter Zugrundelegung der Größenklassifikation des Bonner Instituts für
Mittelstandsforschung lassen sich die vorherigen politischen Statements über
10
Frank (1994), S. 18
11
im folgenden werden aus Vereinfachungsgründen kleine und mittelständische Unternehmen als
mittelständische Unternehmen bezeichnet
12
vgl. Bamberger/Wrona (1997), S. 719; Bamberger/Eßling/Evers/Wrona (1995a); Weber/Kabst, S. 29;
Koller/Raithel/Wagner, S. 17; Zentes/Swoboda, S. 50
13
vgl. IFM Bonn, S. 14-19
4
Internationalisierung im Mittelstand
den Mittelstand statistisch präzisieren. Das wirtschaftliche Umfeld Deutschlands
wird von 3,3 Millionen mittelständischer Unternehmen geprägt, die gemäß
Betriebsgrößenstruktur 99,8 % aller agierenden Unternehmen in Deutschland
darstellen.
Tabelle 2: Betriebsgrößensstruktur 2001 in Deutschland
Betriebe
2001
1 -5
6 -9
10 - 19
20 - 49
50 - 99
100499 500 u.m.
absolut 1.457.809 256.498
202.871
128.738
46.531
35.318
5.046
in %
68,40%
12,00%
9,50%
6,00%
2,20%
1,70%
0,2%
Quelle: IFM Unternehmensgrößenstatistik 2001/2002 - Daten und Fakten -
78,30% aller Arbeitnehmer werden vom deutschen Mittelstand beschäftigt.
Mittelständische Unternehmen tragen mit 43,50% zur gesamten
Bruttowertschöpfung - einschließlich der des Staates - bei.
14
Volkswirtschaftlich
betrachtet ist die Gesamtheit der mittelständischen Unternehmen ein wichtiger
Faktor für die Wirtschaftlichkeit und Innovationsfähigkeit Deutschlands.
Die den Mittelstand betreffenden Aussagen ,,Kern der pluralistischen
Wirtschaftsstruktur Deutschlands"
15
und ,,Das Fundament und die Eckpfeiler der
Nationalökonomie"
16
sind nach Sichtung des statistischen Materials
wissenschaftlich nachzuvollziehen.
2.
Die Internationalisierung
Mit der permanenten Zunahme von weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen,
beherrschen Begriffe wie ,,Internationalisierung" und ,,Globalisierung" mit ihren
vielfältigen Aspekten und Problemstellungen direkt und indirekt die Diskussion in
Politik und Wirtschaft auch und gerade am Beginn dieses Jahrhunderts.
17
2.1. Die Entwicklung der internationalen Geschäftstätigkeit
Dülfer hat in einem geschichtlichen Rückblick zur internationalen
Unternehmenstätigkeit aufgezeigt, dass Ansätze zu grenzüberschreitenden
Aktivitäten bereits in der Antike mit dem Handel von Gewürzen, orientalischen
Stoffen oder Edelsteinen zu finden sind und sie sich in den einzelnen
14
vgl. IFM Bonn (2002), S. 22
15
vgl. Walter (1998), S. 16
16
vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2002b), S. 5
17
vgl. Krystek/Zur (2002), S. 3
5
Internationalisierung im Mittelstand
nachfolgenden geschichtlichen Epochen stetig fortentwickelt und intensiviert
haben.
18
Basis und Grundlage für ein verstärkte Handelsentwicklung bot die von den
Nationalökonomen Adam Smith (1723-1790) und David Ricardo (1772-1823)
entwickelte Theorie des Wirtschaftsliberalismus, der Arbeitsteilung und des
Freihandels.
19
Es ist jedoch unumstritten, dass gerade in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts und zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die
grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Verflechtungen überproportional
zugenommen haben.
Ursachen hierfür sind in der zunehmenden Globalisierung der Märkte zu finden,
die auf revolutionäre Umbrüche in und zwischen den Volkswirtschaften
zurückzuführen sind. Eine zentrale Bedeutung kam dabei dem General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT), in dem ein umfassender Abbau von
Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen vereinbart wurden, zu. Des
Weiteren konkretisierte sich die Globalisierung in den weltweiten politischen
Initiativen, einheitliche Wirtschaftsblöcke in der Weltwirtschaft zu schaffen. Dies
wurde unter anderen durch die Schaffung eines einheitlichen Europäischen
Binnenmarktes, durch die auf dem amerikanischen Kontinent entstandenen
Freihandelszone NAFTA (North American Free Trade Agreement) und durch den
Zusammenschluss in der südostasiatischen Region in Form der ASEAN-Staaten
(Association of South-East Asian Nations) verwirklicht.
20
Die nahezu obsolet
gewordene bipolare Teilung in westlich und sozialistisch orientierte Länder trug
zur weltweiten Verbreitung eines marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystems bei.
21
Durch die rasante Entwicklung der Informations- und
Kommunikationstechnologie, konnten die Geschäftsprozesse und deren
Koordination wesentlich erleichtert und beschleunigt werden.
Jede einzelne dieser Komponenten führte immer mehr zu einer Relativierung der
Ländergrenzen und zur Intensivierung des globalen Handels.
22
Zudem kamen
die sogenannten Schwellenländer als wettbewerbsstarke Akteure, aber auch als
neu zu eröffnende Marktpotentiale hinzu.
23
Mit dieser voranschreitenden
Liberalisierung wachsen ehemals getrennte und unabhängige Märkte immer
weiter zusammen und wandeln die Grundlagen im weltweiten Wettbewerb
fundamental.
18
vgl. Dülfer (2002), S. 71-93
19
vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2000), S. 9
20
vgl. Eden (2002) ,S. 39-40
21
vgl. Dülfer (2002), S.92
22
vgl. Berndt/Fantapie´Altobelli/Sander (2003), S. 1
23
vgl. Eden (2002) , S. 39
6
Internationalisierung im Mittelstand
Damit stellen grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten eine wesentliche
Chance zur Erreichung von Wachstumszielen dar und werden somit auch ein
immer wichtigerer Faktor zur Existenzsicherung von Unternehmen.
24
Die Folge dieses grenzüberschreitenden Handels für die Länder, Unternehmen
und Branchen können anhand einiger Entwicklungen der Weltwirtschaft
exemplarisch verdeutlicht werden. So lag die jährliche Wachstumsrate des
Welthandels zwischen 1950 und 1999 mit durchschnittlich 6,0% deutlich über
der des Weltsozialprodukts mit 3,9%.
25
A
bbildung 1: Handel Motor der Weltwirtschaft ( Reale Entwicklung Index 1950=100)
Entwicklung des Welthandels
0
500
1000
1500
2000
2500
1950
55
60
65
70
75
80
85
90
95
2000
Welthandel (Exporte)
Weltwirtschaftsleistung (BIP)
Quelle: Informationen zur politischen Bildung, Heft 263
Neben der Betrachtung des Welthandels lässt sich auch aus der Perspektive
Deutschlands die wirtschaftliche Bedeutung der Auslandstätigkeit für den
Mittelstand feststellen. Exemplarisch sind einige Branchen und deren
Exportquoten
26
in dem folgenden Diagramm aufgeführt.
Abbildung 2: Exportquoten des Mittelstands 1999 - ausgesuchte Branchen
Baugewerbe
Großhandel
Einzelhandel
Chemische
Industrie
Erbringung von
sonst. DL.
DL. für
Unternehmen
Landverkehr
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Quelle: IFM Unternehmensgrößenstatistik 2001/2002 - Daten und Fakten -
24
vgl. Perlitz (2000), S. 1
25
vgl. Welge/Holtbrügge (2001), S.16-17
26
Exportquote bedeutet der prozentuale Anteil des Exportumsatzes am Gesamtumsatz
7
Internationalisierung im Mittelstand
2.2. Die Definition der Internationalisierung und deren Bedeutung für
mittelständische Unternehmen
Nach Macharzina/Oesterle besteht im Bereich der Sprachregelung im
internationalen Management wenig terminologischer Konsens und er sei
aufgrund dessen von der Gefahr ,,babylonischer Sprachverwirrung" bedroht.
27
So verwundert es nicht, dass in der Literatur der Begriff Internationalisierung in
unterschiedlicher Weise gedeutet wird und als Sammelbegriff für eine Vielzahl
von Aktivitäten und Prozessen steht.
28
Das Spektrum der Betrachtung reicht über die Dichotomisierung zwischen
international tätigen und nicht international tätigen Unternehmen, zu den
verschiedenen Formen des Markteintritts, bis zu der problematischen Integration
und Koordination ausländischer Tochterunternehmen bei weltweiter Präsenz des
Unternehmens.
29
Eine unreflektierte Übertragung aller oben aufgeführten Betrachtungsweisen auf
mittelständische Unternehmen scheint jedoch aufgrund spezifischer
Eigenschaften und der Größe der Unternehmen wenig geeignet. Die U.S. Small
Business Administration zeigte auf, dass 2/3 der amerikanischen
mittelständischen Unternehmen lediglich ein Land international bearbeiten
30
und
auch die Europäische Kommission verweist darauf, dass mittelständische
Unternehmen aufgrund ihrer Größe tendenziell in kleineren geographischen
Marktbereichen tätig sind.
31
Internationalisierung unter dem Aspekt der
Steuerung, Koordination und Integration von Tochtergesellschaften, muss
demnach aufgrund der höheren Anzahl bearbeiteter Ländermärkte und damit
einer größeren Wertschöpfung, den sogenannten Global Players, typischerweise
multinationalen Unternehmen zugeordnet werden.
32
In der Betrachtung von mittelständischen Unternehmen tritt diese
Definitionsalternative in den Hintergrund. Weltumfassende Aktivitäten die die
Steuerung von Tochtergesellschaften und die damit verbundenen Probleme
umfassen sind für einen Großteil des Mittelstandes nicht von Bedeutung.
Demnach muss man sich bei der wissenschaftlichen Begriffsbestimmung zu dem
Terminus Internationalisierung, unter Berücksichtigung der Besonderheit des
Mittelstandes, auf die Analyse der Aufnahme grenzüberschreitender
Unternehmenstätigkeit und auf die Untersuchung der Form des
Auslandsengagements konzentrieren.
27
vgl. Macharzina/Oesterle (2002), S. 12
28
vgl. Krystek/Zur (2002), S. 5
29
vgl. Perlitz (2000), S. 8
30
vgl. U.S. Small Business Administration (1999), S. 6
31
vgl. Europäische Kommission (2002a), S. 8
32
vgl. Weber/Kabst (2000), S. 12
8
Internationalisierung im Mittelstand
2.3. Formen der Internationalisierung
Unter Zugrundelegung der oben erörterten Definitionen geschieht demnach die
Internationalisierung eines Unternehmens mit der Aufnahme einer
Auslandstätigkeit und der damit zusammenhängenden Wahl der
Markeintrittsform. Zur Klassifizierung von Internationalisierungsformen werden in
der Literatur diverse Ansätze genannt.
33
Sie können u.a. durch die Merkmale des
zu tragenden Risikos, der Eigentums- und Kontrollaspekte, der vermuteten
Dauerhaftigkeit der Auslandsbeziehung oder durch den Umfang der
übertragenen Ressourcen spezifiziert werden.
34
Wird die zunehmende
Ressourcenbindung im Ausland als wichtigstes Kriterium, dem
Internationalisierungsprozess zugrunde liegend, betrachtet, dann lassen sich die
diversen in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung entwickelten Formen in
einem Stufenmodell nach Meissner klassifizieren.
35
A
bbildung 3: Alternative Formen der Auslandsmarktbearbeitung nach Meissner
100%
100%
Kapital- und Managementleistungen im Gastland
Auslandskooperation
Auslandniederlassung
Kapital- und
Managmentleistungen im
Stammland
Lizenzen
Export
Quelle: Meissner/Gerber, Die Auslandsinvestition als Entscheidungsproblem
Die Klassifizierung reicht bei abnehmender Ressourcenbindung von einer
Niederlassung im Ausland, als höchste Stufe der Internationalisierung, zur
Kooperation, bis hin zur indirekten Marktbearbeitung in Form von Lizenzierung
und Export.
36
Diese Internationalisierungsformen können, wie in dem Stufenmodell gezeigt,
auch als ein sich steigernder Prozess in der Erweiterung und Intensivierung der
Auslandssegmentbearbeitung interpretiert werden. Erklärungen zu diesem
Prozess liefert der lerntheoretische Aspekt. Demnach erfolgt die internationale
Betätigung in kleinen, aufeinanderfolgenden, sich intensivierenden Schritten.
37
33
vgl. Müller-Stewens/Lechner (2002), S. 385
34
vgl. Schmidt/Menke/Hespe/Künzel (1995), S. 19
35
vgl. Kumar (1989), S. 915
36
vgl. Schenk (1994), S. 160
37
vgl. Kumar (1989), S. 919
9
Internationalisierung im Mittelstand
Das erstmalige Engagement des Unternehmens im internationalen Bereich, führt
zu einem Prozess des Lernens und damit zu einem Zuwachs des Wissens und
der Erfahrung innerhalb des Unternehmens. Dies erhöht die Bereitschaft, durch
intensivere und extremere Formen zu internationalisieren. Diese
voranschreitenden Korrelation zwischen Wissenserweiterung und Zunahme des
internationalen Engagement ist die Triebkraft einer kontinuierlichen,
inkrementalen Internationalisierung.
38
Jedoch ist die Theorie des kontinuierlichen
Engagement nach dem lerntheoretischen Ansatz kein Muss.
Internationalisierungsformen sind von den Bedingungskonstellationen aus den
Marktverhältnissen und unternehmenskennzeichnenden Situationen abhängig.
39
Und oft können die spezifischen Branchen, die einzelnen Auslandsegmente oder
die angebotenen Produkte und Dienstleistungen, das Wählen diskontinuierlicher
Stufen oder das Verweilen auf einer bestimmten Internationalisierungsstufe
verlangen.
40
Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Internationalisierungsformen nach
Meissner mit ihren jeweiligen spezifischen Merkmalen erörtert und analysiert.
2.3.1. Der Export
Als Export wird der gewerbsmäßige, grenzüberschreitende Absatz von Waren
und Dienstleistungen bezeichnet.
41
Im Rahmen der Exporttätigkeit kann
zwischen zwei Grundformen unterschieden werden, dem direkten und indirekten
Export. Beim indirekten Export bedient sich die Unternehmung in- oder
ausländischer Absatzmittler, die auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko
tätig werden.
42
Ein unmittelbarer Verkauf der Produkte oder Dienstleistungen an
den ausländischen Abnehmer durch den Hersteller erfolgt beim direkten Export.
Mit dieser Absatzmethode hat das Unternehmen größere Möglichkeiten zu
beeinflussen und geringere Transaktionskosten; es hat jedoch im Gegensatz
zum indirekten Export, der praktisch ohne eigenen Auslandseinsatz und ohne
Auslandserfahrung abgewickelt werden kann, ein höheres Risiko.
43
Tabelle 3
stellt die wesentlichen Vor- und Nachteile für mittelständische Unternehmen, die
Auslandsbearbeitung durch Exporttätigkeit aufzunehmen, dar.
38
vgl. Kutschker (2002), S. 54
39
vgl. Kebschull (1989), S. 975
40
vgl. Behnam (1998), S. 32
41
vgl. Dülfer (2002), S. 144
42
vgl. Welge (2001), S. 107
43
vgl. Kumar (1989), S. 922
10
Internationalisierung im Mittelstand
Tabelle 3: Die Bedeutung des Exports für mittelständische Unternehmen
Vorteile
Nachteile
·
geringe Ressourcenbindung insb. Kapital
und Personal
·
Gefahr von protektionistischen
Handelsbeschränkungen
·
nur geringe Auslandserfahrung nötig
·
Probleme beim Güterverkehr und beim
Zahlungsverkehr
·
schrittweise neue Auslandsmärkte erfahren
·
Informationsdefizite bei
Nachfrageänderungen
·
Massenproduktionsvorteil an einem oder
wenigen Standorten
·
Importzölle, nicht tarifäre
Einfuhrhemmnisse, Wechselkursrisiken
·
kein Enteignungsrisiko
·
Transportkosten
·
Exportsubventionen,
Exportfördermaßnahmen
·
Verzicht auf Faktorkostenvorteile u.
Subvention des Gastlandes
2.3.2. Die Lizenz
Als weitere Markteintrittsstrategie ins Ausland können neben dem Export
internationale Technologieverträge - insbesondere die Lizenzverträge -
abgeschlossen werden.
44
Der Begriff der Lizenz ist in der einschlägigen Literatur
nicht einheitlich abgegrenzt. Grundsätzlich wird durch eine Lizenz einem
Vertragspartner (Lizenznehmer) die Möglichkeit eröffnet, an einer Erfindung bzw.
einem Wissensvorsprung zu partizipieren,
45
um damit über transferierbare
immaterielle Ressourcen zu verfügen.
46
Ein Lizenzvertrag erfolgt durch die
Übertragung eines zumeist zeitlich begrenzten Nutzungsrechtes gewerblicher
Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen, Urheberrechte, u.a.)
oder die Weitergabe von nicht geschützten, wirtschaftlich verwertbaren
Kenntnissen und Erfahrungen, wie z.B. Verfahrenstechniken oder Management
Know-how.
47
Beschränkt werden Lizenzverträge im Wesentlichen durch
räumliche, sachliche und zeitliche Restriktionen.
48
Aufgrund einer meist
mehrjährigen Vertragslaufzeit, können zur Risikobegrenzung vertragliche
Geheimhaltungsklauseln für ungeschütztes Know-how und zusätzliche Klauseln
wie Überwachungsmodalitäten, Wettbewerbsverbote des Lizenznehmers u.ä.
vereinbart werden.
49
Die Vergütung der Bereitstellung erfolgt durch das
Lizenzentgelt, möglich in monetärer oder nicht monetärer Form und in vielfältiger
44
vgl. Perlitz (2000), S. 113
45
vgl. Berndt/Sander (2002), S. 603
46
vgl. Bamberger/Evers (1995b), S. 20
47
vgl. Welge/Holtbrügge (2001), S. 105
48
vgl. Welge/Holtbrügge (2001), S. 105
49
vgl. Berndt/Sander (2002), S. 609-610
11
Internationalisierung im Mittelstand
Weise kombinierbar.
50
Problembereiche und Chancen bei der Lizenzvergabe
können sich, wie Tabelle 4 beschrieben, ausdrücken.
Tabelle 4: Die Bedeutung der Lizenz für mittelständische Unternehmen
Vorteile
Nachteile
·
gesicherter Ertrag
·
Auswahl des Lizenznehmers
·
geringes Risiko
·
Kontrollprobleme
·
Verwertung des eigenen Know-hows in
geographischen., politisch o. kulturell schwer
zugängliche Gebieten
·
Begrenzter Einfluss auf die Geschäftspolitik
des Lizenznehmers
·
Schnelligkeit des Markteintritts
·
hohe Transaktionskosten
·
geringe finanzielle und personelle
Ressourcenbindung
·
Schaffung bzw. Förderung eines
Konkurrenten durch Wissensübertragung
·
Reduzierung des Wechselkursrisikos
·
Gefahr von Imageschädigung
·
Umgehung von Investitionsverboten
·
mangelnder Aufbau von Marktkenntnissen
·
Nutzung der Marktnähe des Lizenznehmers
·
Gefahr der Know-how-Diffusion
2.3.3. Die Auslandskooperation
Eine weitere Option der internationalen Geschäftstätigkeit ist die
Internationalisierungsform der Auslandskooperation. Unter einer Kooperation
versteht man die koordinierte, typischerweise auch vertraglich fixierte,
Zusammenarbeit zweier oder mehrerer rechtlich selbstständiger Unternehmen
zur gemeinsamen Zielerreichung.
51
Eine weitere Vorraussetzung für die
internationale Kooperation ist die unterschiedliche Länderzugehörigkeit der
kooperierenden Partnerunternehmen.
52
Ziel der freiwilligen
zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit ist die Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit durch die gemeinsame Bündelung betrieblicher
Ressourcen und der Kompensation der eigenen Schwächen durch die Potentiale
des Partnerunternehmens. Ein allgemeingültiger terminologischer Konsens bei
der Einteilung und der Beschreibung der unterschiedlichen Kooperationsformen
besteht bisher noch nicht.
53
Nach Perlitz reicht das Spektrum kooperativer
Internationalisierungsformen vom indirekten Export auf vertraglicher Basis, bis
hin zu Gemeinschaftsunternehmen in Form der Joint Venture.
54
Folgt man der
Klassifizierung nach Behnam, basierend auf dem Stufenmodell Meissners, treten
Kooperationen in zwei wesentlichen Formen auf, als Joint Venture und als
50
vgl. Berndt/Sander (2002), S. 610
51
vgl. Behnam (1998), S. 38
52
vgl. Börsig/Baumgarten (2002), S. 553
53
vgl. Macharzina/Oesterle (2002), S. 12
54
vgl. Perlitz (2002), S. 535
12
Internationalisierung im Mittelstand
strategische Allianz.
55
Joint Venture stellen aufgrund finanzieller Verflechtungen
und hohen Managementanforderungen die intensivste Form der Kooperation
dar.
56
Die beteiligten Partnerunternehmen gründen oder erwerben ein eigenes
juristisch selbstständiges Gemeinschaftsunternehmen und führen bei
gemeinsamen Risiko dieses Unternehmen paritätisch.
57
Betriebliche
Teilaufgaben werden nun gemeinsam im Joint Venture, mit dem Ziel
Synergieeffekte zu generieren, bearbeitet.
58
Die internationale strategische Allianz, mit dem Zweck Synergiepotentiale
auszuschöpfen, stellt ebenfalls eine Kooperationsform dar. Wesentlicher
Unterschied zu der Kooperationsform des Joint Venture ist jedoch, dass diese
Form der Kooperation keine eigenständige Rechtsform darstellt. Die
Unternehmen bleiben weiterhin rechtlich und in den von der Zusammenarbeit
nicht betroffenen Bereichen auch wirtschaftlich selbstständig.
59
Das gemeinsame
Wirken ist meist nicht auf Dauer angelegt, sondern auf die Erreichung eines
bestimmten Zieles ausgerichtet. Oft sind lediglich Teile der beteiligten
Organisationen in die Umsetzung des gemeinsamen Vorhabens direkt
einbezogen. Diese Kooperationsform beinhaltet meist keine wesentliche
Kapitalbeteiligung der Partner.
60
Die Kooperation als Internationalisierungsform
eignet sich bei der Realisation bestimmter Ziele, die allein aufgrund mangelnder
Kapazitäten nicht erreicht werden können. In der Tabelle 5 sind die Vor- und
Nachteile der Kooperation für mittelständische Unternehmen aufgeführt.
Tabelle 5: Die Bedeutung der Auslandskooperation für mittelständische Unternehmen
Vorteile
Nachteile
·
Verknüpfung knapper personeller und
finanzieller Ressourcen
·
Hohe Suchkosten , um den geeigneten
Partner zu finden
·
Marktvorteile durch Rückgriff auf lokales
Know-how des Partners
·
Ziel- und Verhaltenskonflikte mit dem
Partner
·
Kostendegressionsvorteile
·
Hohe Transaktionskosten
·
Umgehung von Investitionsbeschränkungen
·
Verzögerung der Entscheidungsfindung
·
Verringerung der Enteignungsgefahr
·
Gefahr der ungewollten Wissensdiffusion
·
Schaffung und Förderung eines
Konkurrenten durch Wissensübertragung
55
vgl. Behnam (1998), S. 38
56
vgl. Staudt (1995) , S. 720
57
vgl. Perlitz (2002), S. 547
58
vgl. Staudt (1995), S. 720
59
vgl. Ringlsetter (1995), S. 696-697
60
vgl. Perlitz (2002), S. 545
13
Internationalisierung im Mittelstand
2.3.4. Die Auslandsniederlassung und Tochtergesellschaft
Die Direktinvestitionen in Form der Auslandsniederlassung und
Tochtergesellschaft stellt den höchsten Grad der Internationalisierung dar und
fordert dementsprechend die höchsten Management- und Kapitalkapazitäten.
61
Diese Form der Marktbearbeitung ist gekennzeichnet durch einen
selbstständigen Eintritt in einen ausländischen Markt mit einem hohen
Ressourceneinsatz an Kapital, bei gleichzeitiger alleiniger Kontrolle des
Unternehmens.
62
Die Organisationsform kann unter rechtlichen und steuerlichen
Gesichtspunkten eine Tochtergesellschaft mit rechtlicher Selbstständigkeit oder
eine Betriebsstätte in rechtlich unselbstständiger Form sein
63
. Immer allerdings
ist es die langfristig angelegte Verlagerung von Wertaktivitäten und Ressourcen
ins Ausland. Die dabei verlagerten Wertschöpfungsaktivitäten können alle
Teilbereiche eines Unternehmens - wie Vertrieb, Forschung und Entwicklung,
Produktion, Einkauf - umfassen und können somit eine verkleinerte Form der
Muttergesellschaft im Ausland darstellen.
64
Oft allerdings werden nur bestimmte
Funktionsbereiche im Ausland eingebunden. Zum einen, aus Kostengründen, die
aus einer zentralen Organisation resultieren, zum anderen aus der Furcht vor
einem ungewollten Verlust von sensiblen Know-how. Aus diesen Gründen ist
gerade im Mittelstand der Bereich der Forschung und Entwicklung oft im
Heimatland zentralisiert und produzierende Niederlassungen, der Vertrieb oder
aber die Endfertigung im Ausland zu finden.
65
Die Direktinvestitionen in Form der Auslandsniederlassung und
Tochtergesellschaft stellen das höchste Erfordernis an Kapital und
Managementleistung in einem internationalisierenden Unternehmen dar.
In der nachfolgenden Tabelle 6 sind die spezifischen potentiellen Vor- und
Nachteilen der Direktinvestitionen für den Mittelstand beschrieben.
61
vgl. Behnam (1998), S. 41
62
vgl. Meckl (2002), S. 655
63
vgl. v. Hacht (1994), S. 705-706
64
vgl. Welge/Holtbrügge (2001), S. 109
65
vgl. Behnam (1998), S. 41
14
Internationalisierung im Mittelstand
Tabelle 6: Die Bedeutung der Auslandsniederlassung für mittelständische Unternehmen
Vorteile
Nachteile
·
unmittelbare Marktpräsenz und Nähe zum
relevanten Markt
·
in der Regel hoher Kapitaleinsatz, daher
hohes Risiko
·
leichtere Produktanpassung an lokale
Gegebenheiten
·
hohe Anforderung an das Management im
Stammland, wie auch im Auslandsmarkt
·
Aufbau marktspezifischen Know-hows
·
Verzicht auf Economics of Scale aufgrund
dezentraler Produktion
·
sehr gute Kontrollmöglichkeiten und
uneingeschränkte Entscheidungskompetenz
·
Erhöhung der Koordination zwischen
Niederlassung und Muttergesellschaft
·
Vermeidung exportspezifischer Kosten
(Transport, Zölle etc.)
·
Erhöhung der Enteignungsgefahr und
Probleme beim Gewinntransfer
·
weitgehende Reduzierung des
Wechselkursrisikos
·
organisatorische Probleme bei der
Integration
2.4. Stand der Forschung
Neben der praktischen Relevanz der Internationalisierung, mangelt es in der
vergleichenden Managementforschung und in der international orientierten
Betriebswirtschaftslehre an wissenschaftlich begründeten Aussagen im Bereich
der Theorieentwicklung und der Empirie.
66
2.4.1. Theoretische Erklärungsansätze
Fraglos ist Melin zuzustimmen, wenn er auf die Vielfalt und Verschiedenartigkeit
theoretischer Ansätze, die für Orientierungsschwierigkeiten im Bereich des
internationalen Management sorgen, hinweist.
67
Ähnlich wie Macharzina und
Oesterle, die neben dem unbefriedigenden Stand der empirischen Forschung,
ebenso entsprechendes in der Theorieentwicklung sehen. Als Hauptfaktor für
den unzureichenden Stand der Theorienbildung bestimmen sie die fehlende
sprachliche Normierung und die dadurch auftretenden Verständnis- und
Kommunikationsprobleme.
68
Dementsprechend finden sich in der gegenwärtigen
Theorienforschung diverse unterschiedliche theoretische Erklärungen zu dem
Realphänomen der internationalen Geschäftstätigkeit, die vor allem dem Bereich
der unterschiedlichen Markteintritts- und Marktbearbeitungsformen gewidmet
sind.
69
Dabei herrschen vornehmlich partialanalytische Modelle vor, die
66
vgl. Macharzina/Oesterle (2002), S. 5-12
67
vgl. Melin (1992), S. 99
68
vgl. Macharzina (1981), S. 37-38, Macharzina/Oesterle (2002), S. 11 - 12
69
vgl. Marachzina (1999), S. 684
15
Internationalisierung im Mittelstand
Teilbegründungen für Art und Umfang des internationalen Engagements liefern,
wie die Produktlebenszyklustheorie, Wettbewerbstheorie, Standorttheorie,
Internalisierungstheorie, Theorie des monopolistischen Vorteils und die
Kapitaltheorie.
70
Mit der Betrachtung nur einzelner, isoliert untersuchter
Einflussgrößen der Internationalisierung, liefern sie aber nur monokausale
Erklärungsansätze.
71
Dunning versuchte aus dieser Kritik heraus, ein integratives Konzept zu
entwickeln - das Eklektische Paradigma -. Diese Theorie soll im Wesentlichen
,,the ability and willigness of firms to serve markets, and the reason why they
choose to exploit this advantage through foreign production rather than by
domestic production" erklären.
72
Dabei handelt es sich um eine Synopse aus der
monopolistischen Vorteilstheorie, der Standorttheorie und der
Internalisierungstheorie.
73
Im Rahmen dieser Theorie wird unter
Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Vorteile analysiert, welche
internationale Markteintrittsstrategie von Unternehmen logisch gewählt wird.
Diese Wahl ist hauptsächlich von den nachfolgend beschriebenen
Vorteilskategorien des Eigentums, der Internalisierung und der Standortfaktoren
abhängig.
74
Eigentumsvorteile (Ownership Advantages) sind die erste
notwendige Bedingung der Theorie. Eigentumsvorteile werden größtenteils
durch immateriellen Assets präsentiert und stellen für einen bestimmten
Zeitraum das Exklusiveigentum des Unternehmens dar.
75
Existieren neben
Eigentumsvorteilen Internalisierungsvorteile (Internalization Advantages), die
gemessen an Transaktionskosten eine unternehmensinterne Abwicklung durch
Expansion der eigenen Geschäftstätigkeit kostengünstiger erscheinen lassen,
kommt es nach Dunning zum Export. Falls keine Internalisierungsvorteile
vorliegen erfolgt eine Externisierung durch Lizenzierung.
76
Wenn darüber hinaus
Standortvorteile (Locational Advantages), beispielsweise kostengünstigere
Rohstoff- und Arbeitskosten, Verbrauchernähe, oder Investitionsanreize am
jeweiligen Standort bestehen, werden aus ökonomischen Überlegungen
ausländische Direktinvestitionen vom Unternehmen getätigt.
77
Neben diesen drei
Einflussfaktoren hat Dunning bei dem Versuch der Spezifizierung, weitere
Variablen hinzugefügt, die den Realitätsgehalt zwar erhöhen, jedoch die
Aussagekraft beträchtlich relativieren. Ein weiterer Kritikpunkt behandelt die
grundsätzliche Fragestellung, ob dieser und andere theoretische Ansätze nicht
70
vgl. Macharzina/Oesterle (2002), S. 15
71
vgl. Kreikebaum (1998), S. 62
72
vgl. Dunning (1979), S. 275
73
vgl. Welge/Holtbrügge (2001), S. 78
74
vgl. Macharzina (1999), S. 686
75
vgl. Kreikebaum (1998), S. 63
76
vgl. Welge/Holtbrügge (2001), S. 78
77
vgl. Perlitz (2000), S. 128
16
Internationalisierung im Mittelstand
Erklärungsbeitrag sondern letztlich nur eine Aufzählung möglicher
Einflussfaktoren von Markteintrittsformen darstellen. Trotz dieser und anderer
Kritik, stellt die eklektische Theorie, mit dem Versuch konzeptionelle Lücken zu
schließen, die meist rezipierte Theorie in der Erklärung internationaler
Geschäftstätigkeit dar.
78
2.4.2. Stand der empirischen Forschung
In der praxisorientierten Forschung finden sich zwar zahlreiche empirische
Untersuchungen, diese können aber oft wegen mangelnder Repräsentativität
nicht verallgemeinert werden.
79
In diesem Kapitel wurden vornehmlich
empirische Untersuchungen ausgewählt, die sich mit dem Phänomen der
Internationalisierung im Mittelstand beschäftigen.
Zunächst sind die einzelnen
empirischen Untersuchungen in einem Gesamtüberblick tabellarisch
gegenüberstellt. Ausgesuchte wichtige Ergebnisse werden danach mit
Theorieelementen und anderen weiteren empirischen Erhebungen ausführlich
erläutert.
Tabelle 7: Kurzübersicht über die empirischen Internationalisierungsstudien im Mittelstand
Studie
Datenbasis/
Methodik
Alexander Bassen; Michael Behnam;
Durchführung: schriftlicher Fragebogen
Dirk Ulrich Gilbert Anzahl:
6000
Internationalisierung des Mittelstandes Stichprobe:
533,
8,9%
Ergebnisse einer empirischen Studie
Eingrenzung: 25-1000 Mio. DM
zum Internationalisierungsverhalten
Quelle:
keine Angabe
deutscher mittelständischer Unternehmen
Schwerpunkt: allgemeine Untersuchung mit Schwerpunkten auf Markteintrittsform, der
Strategieentwicklung, Finanzierung und Förderung mit dem Ziel einen, Gesamtüberblick über
den Entwicklungsstand in der Internationalisierung des Mittelstandes offenzulegen.
Fazit: Internationalisierung hauptsächlich durch Export, mit der Größe des Unternehmens
steigt die Intensität der Form, dabei relativ hohe Kooperationsquote
Hans Koller; Ulla Raithel; Eckhard Wagner Durchführung: Interviews
Internationalisierungsstrategien mittlerer Anzahl: keine
Angabe
Industrieunternehmen am Standort Stichprobe:
87
Deutschland
Eingrenzung: Mitarbeiter bis 5000 u.m.
Quelle: keine
Angabe
78
vgl. Welge/Holtbrügge (2001), S. 79
79
vgl. Macharzina (1981), S. 36
17
Internationalisierung im Mittelstand
Schwerpunkt: Befragung von Industrieunternehmen. Thesen: Auslandskooperationen sind
aufgrund ressourcenbedingter Restriktionen häufig im Mittelstand zu finden und schrittweises
Vorgehen bei internationalen Aktivitäten keine Befragung nach Export
Fazit: Kooperationen sind nicht wie erwartet von hoher Wichtigkeit, schrittweises sich
intensivierendes Vorgehen erfolgt. Defizite bei der Steuerung und Führung
Wolfgang Weber; Rüdiger Kabst Durchführung:
schriftlicher
Fragebogen
Internationalisierung mittelständischer Anzahl: 4229
Unternehmen Organisationsform und
Stichprobe
449 / 10,6%
Personalmanagement Eingrenzung:
100-1000
Beschäftigte
Quelle:
Hoppenstedt-Firmendatenbank
Schwerpunkt: Internationalisierung mit Spezialisierung auf Personalmanagement. Im Bereich der
Internationalisierung besondere Betrachtung des lerntheoretischen Ansatzes.
Fazit: Ein Prozessablauf des Markteintritts durch stufenweises Lernen kann im Mittelstand
nicht nachgewiesen werden.
Ingolf Bamberger; R. Eßling; M. Evers; Durchführung:
Fragebogen
Thomas Wrona Anzahl:
3000
Internationalisierung und strategisches Stichprobe:
206/
6,9%
Verhalten von Klein- und Mittelunternehmen Eingrenzung: bis 1000 Beschäftigte
- Ergebnisse einer empirischen Studie
Quelle:
Zufallsstichprobe IHK Mitglieder
Schwerpunkt: Erfolgsfaktoren und Produkt-/Marktaktivitäten; Internationalisierungsformen-
Themenschwerpunkt Kooperation und vertikale Integration
Fazit: Export ist die wichtigste Form der Internationalisierung; mit steigender Umsatzgröße
nimmt die Bedeutung von Kooperationsverträgen immer mehr zu.
Joachim Zentes; Bernhard Swoboda
Durchführung:Fragebogen
Motive und Erfolgsgrößen internationaler Anzahl: 800
Kooperation mittelständischer Unternehmen Stichprobe: 142
Eingrenzung: bis 500 Mitarbeiter
Quelle:
Firmen-Informationssystem der
IHK Bundesrepublik Deutschland
Schwerpunkt: Untersuchung insbesondere der Kooperationen auf Motive und Erfolgsgrößen mit
dem theoretischen Rahmen des Ressourcenansatzes und des Fit-Ansatzes
Fazit: Die absatzorientierten Motive dominieren bei internationalen Kooperationen. Als
Kernproblem zur Erreichung der Ziele erwiesen sich Differenzen in der Unternehmensstrategie.
18
Internationalisierung im Mittelstand
Neben dieser individuellen Betrachtung der Themenschwerpunkte und der
wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Studien, wird nun auf einzelne wichtige
Themengebiete unter Einbeziehung theoretischer Grundlagen im Bereich der
Internationalisierung eingegangen. Aufgrund der unterschiedlichen
Untersuchungsmethoden, den terminologischen Differenzen und der
unterschiedlichen Datenauswertung und -darstellung, können die empirischen
Untersuchungen untereinander nur annäherungsweise verglichen werden. Diese
kompakte Zusammenfassung hat den Anspruch, die Grundtendenzen
herauszufiltern und kurz darzustellen.
2.4.2.1. Der ressourcenbasierte Ansatz
Einige der bisher erläuterten Studien basieren auf der theoretischen Grundlage
des Ressourcenansatzes.
80
Der ressourcenbasierte Ansatz führt eine dauerhafte
Generierung von Wettbewerbsvorteilen auf alle tangiblen und intangiblen
Ressourcen innerhalb eines Unternehmens zurück.
81
Aus dieser Perspektive
können für mittelständische Unternehmen Nachteile aufgrund der
Ressourcenrestriktionen, gegenüber den Großunternehmen gefolgert werden.
Gerade Kapital und Personalressourcen stehen dem mittelständischen
Unternehmen nicht in dem Ausmaß zur Verfügung. Basierend auf diesem Ansatz
untersuchten die empirischen Erhebungen, ob die Internationalisierung im
Mittelstand problematischer als bei Großunternehmen ist.
2.4.2.2. Die Globalisierungstendenzen im Mittelstand
Mit zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtungen der Wirtschaft steigt, so die
Annahme, auch der Druck auf die einzelnen Unternehmen. Betroffen von der
zunehmenden Globalisierung fühlt sich ein Großteil der mittelständischen
Unternehmen durchschnittlich, ein großer Teil sogar stark betroffen.
82
Dabei
wurde ein Anstieg der Betroffenheit mit zunehmender Unternehmensgröße
nachgewiesen.
83
Die Einschätzung auf die Vorbereitung des Unternehmens auf
die Globalisierung fällt nicht vollständig positiv aus. Viele der befragten
Unternehmen zweifeln an ihrer optimalen Vorbereitung. So zeigt sich in der
80
vgl. Bassen/Behnam/Gilbert (2001), S. 414; Koller/Raithel/Wagner (1998), S. 176; Zentes/Swoboda
(1999), S. 45-49
81
vgl. Peteraf (1993), S. 179
82
vgl. Bassen/Behnam/Gilbert (2001), S. 416; Bamberger/Eßling/Evers/Wrona (1995a), S. 8-15;
Bamberger/Wrona (1997), S. 720
83
vgl. Bassen/Behnam/Gilbert (2001), S. 418; Bamberger/Eßling/Evers/Wrona (1995a), S. 10;
Bamberger/Wrona (1997), S. 720
19
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832471989
- ISBN (Paperback)
- 9783838671987
- DOI
- 10.3239/9783832471989
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen; Gelsenkirchen – Wirtschaftsrecht
- Erscheinungsdatum
- 2003 (September)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- globalisierung empirische studie unternehmer unternehmerinnen management
- Produktsicherheit
- Diplom.de