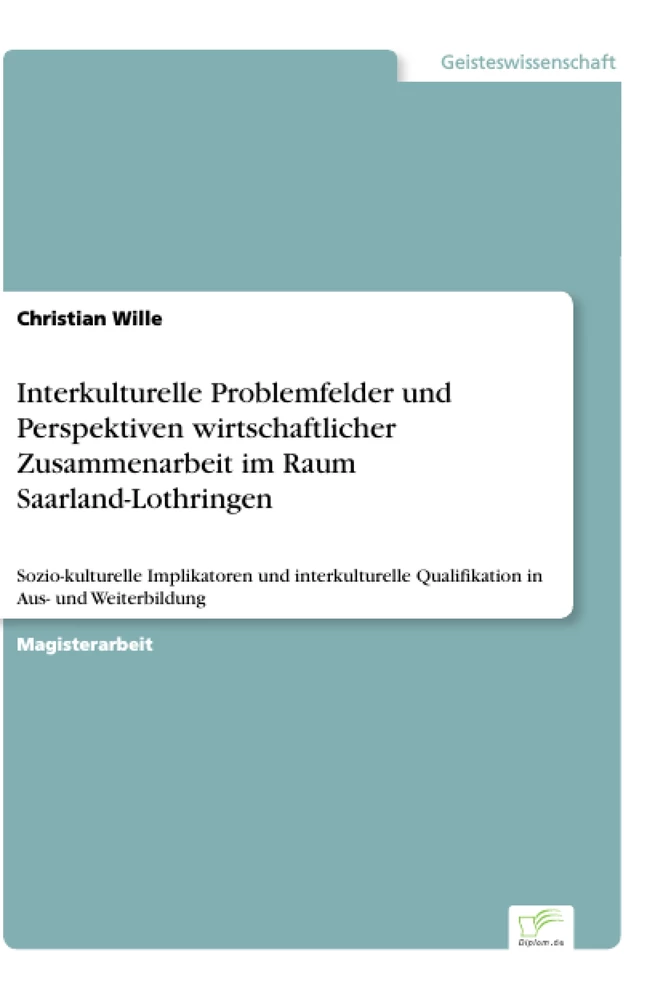Interkulturelle Problemfelder und Perspektiven wirtschaftlicher Zusammenarbeit im Raum Saarland-Lothringen
Sozio-kulturelle Implikatoren und interkulturelle Qualifikation in Aus- und Weiterbildung
©2003
Magisterarbeit
245 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Die vorliegende Arbeit verfolgt die Zielsetzung, zentrale interkulturelle Problemfelder in den deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen zu identifizieren und zu analysieren am Beispiel der saarländisch-lothringischen Wirtschaftsverflechtungen. Die umfangreiche, sehr gut strukturierte und stilistisch gut formulierte Arbeit untergliedert sich in drei Teile, in denen zum einen Gegenstandsbereich, Vorgehensweise und methodische sowie theoretische Grundlagen der Interkulturellen Kommunikation (Teil I), interkulturelle Problemfelder in den saarländisch-lothringischen Wirtschaftsbeziehungen (Teil II) und schließlich ein interkulturelles Qualifikationsprofil für grenzüberschreitend tätige Wirtschaftsakteure entwickelt werden einschließlich Handlungsvorschläge für dessen Integration in die Bildungsprogramme der staatlich anerkannten Einrichtung der Aus- und Weiterbildung im Saarland.
Im Einleitungsteil der Arbeit wird Theorie und Methodik der Interkulturellen Kommunikation in sehr überzeugender Weise in Verbindung gebracht mit dem Untersuchungsgegenstand sowie der empirischen Vorgehensweise des Verfassers, die auf einer eigenen empirischen Untersuchungen bei saarländischen Wirtschaftsakteuren mit Frankreichkontakt (mit freundlicher Unterstützung der IHK Saarland), auf Spezialisteninterviews und auf einer sehr gut recherchierten Analyse von einschlägiger Fachliteratur und weiteren empirischen Befunden mit ähnlichen Fragestellungen beruht.
Im zweiten Teil der Arbeit werden zentrale interkulturelle Problemfelder der grenzüberschreitend wirtschaftlichen Zusammenarbeit erläutert, die sowohl unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen, Ausbildungssysteme, Sozialisations-, Organisations- und Kommunikationsstile in Deutschland und Frankreich umfassen. Der Verfasser arbeitet die nationenspezifischen Unterschiede geradezu in exemplarischer Anschaulichkeit heraus und analysiert diese kontrastiv in synchronischer Perspektive mit dem Ziel, kulturelle Entwicklungen bzw. Kontinuitäten in beiden Ländern als Erklärungsansätze für die phänomenologische Ebene herauszustellen.
Im letzten Teil der Arbeit wird auf der Grundlage der herausgearbeiteten Problemfelder und Desiderata ein interkulturelles Qualifikationsprofil erarbeitet, das sich an den Erkenntnissen der Kooperationsforschung sowie der Forschung zur Internationalisierung der Berufsbildung orientiert. Zugleich werden Lösungsmöglichkeiten für die Integration des Profils sowie seiner […]
Die vorliegende Arbeit verfolgt die Zielsetzung, zentrale interkulturelle Problemfelder in den deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen zu identifizieren und zu analysieren am Beispiel der saarländisch-lothringischen Wirtschaftsverflechtungen. Die umfangreiche, sehr gut strukturierte und stilistisch gut formulierte Arbeit untergliedert sich in drei Teile, in denen zum einen Gegenstandsbereich, Vorgehensweise und methodische sowie theoretische Grundlagen der Interkulturellen Kommunikation (Teil I), interkulturelle Problemfelder in den saarländisch-lothringischen Wirtschaftsbeziehungen (Teil II) und schließlich ein interkulturelles Qualifikationsprofil für grenzüberschreitend tätige Wirtschaftsakteure entwickelt werden einschließlich Handlungsvorschläge für dessen Integration in die Bildungsprogramme der staatlich anerkannten Einrichtung der Aus- und Weiterbildung im Saarland.
Im Einleitungsteil der Arbeit wird Theorie und Methodik der Interkulturellen Kommunikation in sehr überzeugender Weise in Verbindung gebracht mit dem Untersuchungsgegenstand sowie der empirischen Vorgehensweise des Verfassers, die auf einer eigenen empirischen Untersuchungen bei saarländischen Wirtschaftsakteuren mit Frankreichkontakt (mit freundlicher Unterstützung der IHK Saarland), auf Spezialisteninterviews und auf einer sehr gut recherchierten Analyse von einschlägiger Fachliteratur und weiteren empirischen Befunden mit ähnlichen Fragestellungen beruht.
Im zweiten Teil der Arbeit werden zentrale interkulturelle Problemfelder der grenzüberschreitend wirtschaftlichen Zusammenarbeit erläutert, die sowohl unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen, Ausbildungssysteme, Sozialisations-, Organisations- und Kommunikationsstile in Deutschland und Frankreich umfassen. Der Verfasser arbeitet die nationenspezifischen Unterschiede geradezu in exemplarischer Anschaulichkeit heraus und analysiert diese kontrastiv in synchronischer Perspektive mit dem Ziel, kulturelle Entwicklungen bzw. Kontinuitäten in beiden Ländern als Erklärungsansätze für die phänomenologische Ebene herauszustellen.
Im letzten Teil der Arbeit wird auf der Grundlage der herausgearbeiteten Problemfelder und Desiderata ein interkulturelles Qualifikationsprofil erarbeitet, das sich an den Erkenntnissen der Kooperationsforschung sowie der Forschung zur Internationalisierung der Berufsbildung orientiert. Zugleich werden Lösungsmöglichkeiten für die Integration des Profils sowie seiner […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7079
Wille, Christian: Interkulturelle Problemfelder und Perspektiven wirtschaftlicher
Zusammenarbeit im Raum Saarland-Lothringen - Sozio-kulturelle Implikatoren und
interkulturelle Qualifikation in Aus- und Weiterbildung
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Universität, Magisterarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
1
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGS VER ZEIC HNIS ... 3
TABELLENVER ZEIC HNIS ... 4
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ... 5
I
EINLEITUNG... 6
1. GEGENSTANDSBEREICH, ZENTRALE FRAGESTELLUNGEN UND AUFBAU... 9
2. FORSCHUNGSLAGE UND THEORETISCHE KONZEPTE... 13
2.1 Erweiterter Kulturbegriff und seine integrierende Betrachtung... 14
2.2 Kulturerwerb und Sozialisationsinstanzen ... 18
2.3 Kulturelle Standardisierung und Individualität ... 22
2.4 Kulturelle Überschneidung und Interkulturalität ... 25
3. METHODIK UND UNTERSUCHUNGSDESIGN ... 30
3.1 Standardisierte Befragung ... 30
3.1.1 Fragebogenkonzeption Durchführung Auswertung...31
3.1.2 Stichprobenbeschreibung...34
3.2. Studienauswertung ... 36
3.2.1 Studienprofile...37
3.2.2 Überschneidungsbereiche Synoptischer Überblick ...40
II
INTERKULTURELLE PROBLEMFELDER IN SAARLÄNDISCH-
LOTHRINGISCHEN WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN ... 42
1. GRENZREGION SAARLAND-LOTHRINGEN... 42
1.1 Gemeinsame Wirtschaftsgeschichte... 43
1.2 Gemeinsamer Strukturwandel ... 45
1.3 Interregion Saarland-Lothringen ... 47
2. SYSTEMATISIERUNG UND POSITIONIERUNG VON PROBLEMFELDERN... 52
3. RECHTSVORSCHRIFTEN UND ADMINISTRATION ... 55
3.1 Staat, Wirtschaft und Administration in Deutschland und Frankreich ... 57
3.1.1 Nationalisierung und territoriale Zersplitterung ...58
3.1.3 Entwicklungen in Wirtschaft und Administration ...63
3.1.4 Zusammenführung: zentralistische Mentalitäten ...67
4. FREMDSPRACHE UND INTERPERSONALE KOMMUNIKATION ... 70
4.1 Fremdsprache, Fremdsprachenbedarf und Fremdsprachenkompetenz ... 72
4.1.1 Verhandlungs- und Korrespondenzsprache ...72
4.1.2 Französischbedarf nach Tätigkeitsbereichen ...74
4.1.3 Französischkenntnisse ...75
2
4.1.4 Französischbedarf und -kompetenz nach Mitarbeitergruppe und Hierarchieebene...76
4.1.5 Zusammenfassung ...78
4.2 Interpersonale Kommunikation in Deutschland und Frankreich ... 79
4.2.1 Gesprächsorganisation: Sprecherwechsel und Sequenzierung ...79
4.2.2 Kulturspezifische Werte: Diskursästhetik...83
4.2.3 Informationsübermittlung: Kontextorientierung...85
5. KULTUR- UND SOZIALISATIONSUNTERSCHIEDE ... 89
5.1 Arbeitsstil und Projektmanagement ... 89
5.2 Berufsbildung in Deutschland und Frankreich... 95
5.2.1 Geschichtlicher Rückblick ...96
5.2.2 Bildung und Education als kulturelle Schlüsselwörter ...99
5.2.3 Grundzüge der Berufsbildungssysteme ...103
5.2.4 Relevante Merkmale für die Zusammenarbeit...110
5.3 Zusammenführung ... 119
III
INTERKULTURELLE QUALIFIKATION UND PERSPEKTIVEN FÜR
VERBESSERTE WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT IM RAUM
SAARLAND-LOTHRINGEN ... 123
1. INTERKULTURELLES QUALIFIKATIONSPROFIL... 123
1.1 Fremdsprachenkompetenz... 126
1.2 Interkulturelle Kompetenz... 129
1.3 Fachliche Kompetenz ... 135
1.4 Zusammenfassung ... 136
2. INTERNATIONALISIERUNG VON AUS- UND WEITERBILDUNG ... 138
2.1 Internationalisierungstendenzen... 138
2.2 Frankreichorientierung saarländischer Berufsschulen ... 142
2.3 Frankreichorientierung saarländischer Weiterbildungseinrichtungen ... 145
3. INTEGRATION INTERKULTURELLER QUALIFIKATION IM SAARLAND ... 150
3.1 Handlungsmöglichkeiten in der beruflichen Ausbildung... 151
3.2 Handlungsmöglichkeiten in der Weiterbildung ... 164
4. STRATEGIE ZUR INTEGRATION INTERKULTURELLER QUALIFIKATION IM
SAARLAND ... 167
4.1 IQ-Kampagne: Handlungsbedarf signalisieren ... 167
4.2 IQ-Plakette: Handlungsanreize schaffen ... 168
IV
SCHLUSSBETRACHTUNG... 170
BIBLIOGR AP HIE ... 171
A N H A N G ... 183
3
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Strukturmodell der Sozialisationsbedingungen ...20
Abbildung 2: Ebenen kultureller Überschneidungssituationen bei der grenzüberschreitenden
wirtschaftlichen Zusammenarbeit ...30
Abbildung 3: Branchenverteilung (eigene Studie)...35
Abbildung 4: Bewertung des Frankreichgeschäfts (gesamte Stichprobe, eigene Studie)...36
Abbildung 5: Bewertung des Frankreichgeschäfts (Unternehmen mit Handelsbeziehungen, eigene
Studie) ...36
Abbildung 6: Thematische Überschneidungsbereiche der berücksichtigten Untersuchungen ...40
Abbildung 7: Besondere Herausforderung bei grenzüberschreitender Wirtschaftsaktivität (eigene
Studie) ...53
Abbildung 8: Zentrale Problemfelder der grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit...53
Abbildung 9: Sprachkategorien Verhandlungs- und Korrespondenzsprache (eigene Untersuchung)...73
Abbildung 10: Rangfolge Verhandlungs- und Korrespondenzsprache (eigene Studie) ...73
Abbildung 11: Ist die französische Sprache unverzichtbar für grenzüberschreitende
Geschäftskontakte? ...74
Abbildung 12: Französischbedarf zur Ausführung der Arbeit...75
Abbildung 13: Französischkenntnisse (eigene Studie) ...76
Abbildung 14: Französischkenntnisse nach Mitarbeitergruppen...77
Abbildung 15: Französischkenntnisse nach Hierarchieebene und Tätigkeitsbereich (eigene Studie)...77
Abbildung 16: Haben Sie den Eindruck, dass es lange dauert, bis das Hauptthema behandelt wird?
(eigene Studie) ...81
Abbildung 17: Können Sie immer das klären, was Sie sich vorgenommen haben? (eigene Studie)...81
Abbildung 18: Sequenzierung (Gesprächsorganisation)...82
Abbildung 19: Ermüden Sie rascher im Gespräch mit ihrem französischen Partner rascher als mit
deutschen Partnern? (eigene Studie) ...85
Abbildung 20: Haben Sie den Eindruck, dass in Gesprächen mit Ihrem französischen Partner oft
einiges unklar oder schwammig bleibt? (eigene Studie)...86
Abbildung 21: Bewertung des deutschen und französischen Arbeitsstils (eigene Studie) ...90
Abbildung 22: Bewertung des französischen Arbeitsstils ...90
Abbildung 23: Phasenmodell des Projektmanagements in Deutschland und Frankreich...92
Abbildung 24: Was wissen Sie über die französische Handwerkerausbildung? ...95
Abbildung 25: Ausbildungswege deutscher Jugendlicher im Jahr 2000 ...104
Abbildung 26: Bewertung der beruflichen Ausbildung in Deutschland und Frankreich (eigene Studie)
...110
Abbildung 27: Bewertung der beruflichen Ausbildung in Deutschland und Frankreich von
französischen Angestellten...110
Abbildung 28: Bewertung der beruflichen Ausbildung in Deutschland und Frankreich von deutschen
Angestellten...111
Abbildung 29: Entwicklung der Abiturientenzahlen in Frankreich (1980-2000)...117
4
Abbildung 30: Denken Sie, über ausreichende Kenntnisse zu verfügen hinsichtlich ...? (eigene Studie)
...124
Abbildung 31: Ich würde gerne mehr wissen zu ... (eigene Studie) ...124
Abbildung 32: Bewertung von Teilkompetenzen interkultureller Kompetenz (eigene Studie)...131
Abbildung 33: Ebenen und Teilkompetenzen interkultureller Kompetenz ...132
Abbildung 34: Dimensionen des Qualifikationsprofils zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 137
Abbildung 35: Frankreichorientierung beruflicher Schulen im Saarland ...143
Abbildung 36: Frankreichorientierung staatlich anerkannter Einrichtungen der beruflichen
Weiterbildung im Saarland ...147
Abbildung 37: Frankreichorientierung staatlich anerkannter Einrichtungen der allgemeinen und
politischen Weiterbildung im Saarland ...148
Abbildung 38: Handlungsmöglichkeiten zur Integration von Komponenten des interkulturellen
Qualifikationsprofils im Rahmen der schulischen Ausbildung...160
Abbildung 39: Handlungsmöglichkeiten zur Integration von Komponenten des interkulturellen
Qualifikationsprofils im Rahmen der betrieblichen Ausbildung ...164
Abbildung 40: Modulsystem der IQ-Weiterbildung zur Integration des interkulturellen
Qualifikationsprofils in das Weiterbildungsangebot staatlich anerkannter
Weiterbildungseinrichtungen ...166
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1: Frageformen im Fragebogen...32
Tabelle 2: Deutsche Niederlassungen in Lothringen ...50
Tabelle 3: Französische Unternehmen im Saarland...51
Tabelle 4: Unabhängige PME und PME in Gruppen (1990-1998)...69
Tabelle 5: Kann man vom deutschen oder französischen Partner etwas lernen?...91
Tabelle 6: Bildungswege Sekundarstufe II (Frankreich) ...105
Tabelle 7: Bildungsniveaus (Frankreich)...105
Tabelle 8: Bildungsverhalten im Spiegel französischer Berufsbildungsabschlüsse (1985-2000) ...106
Tabelle 9: Entwicklung der Lehrlingszahlen auf Hochschulniveau in Frankreich (1995-2000) ...108
Tabelle 10: Anzahl Lehrlinge nach Niveaustufen in Frankreich (2000-2001) ...109
Tabelle 11: Deutsche Studienanfänger mit abgeschlossener betrieblicher Berufsausbildung in den
Wintersemestern 1994/1996, 1996/1997 und 1998/1999...118
Tabelle 12: Grundtypen von beruflichem Sprachhandeln ...152
Tabelle 13: Projektideen für Berufsschulen...157
Tabelle 14: Beispiele von interkulturellen Lernzielen und ihre frankreichorientierte Erweiterung für
den Beruf des Kaufmanns im Groß- und Außenhandel ...159
5
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abb.
Abbildung
AK Saar
Arbeitskammer des Saarlandes
Bac pro
Baccalauréat professionnel
Bac techno
Baccalauréat technologique
BBiG
Berufsbildungsgesetz
Bd.
Band
BEP
Brevet d'études professionnelles
BiBB
Bundesinstitut für Berufsbildung
BMBF
Bundesministerium für Bildung und Forschung
bspw.
beispielsweise
BTS
Brevet technologique supérieur
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CAP
Certificat d'aptitude professionnelle
cedefop
Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung
dfi
Deutsch-Französisches Institut
DFJW
Deutsch-Französisches Jugendwerk
DFSFA
Deutsch-Französisches Sekretariat für den Austausch in der beruflichen Bildung
dt.
deutsch
ENA
Ecole Nationale d'Administration
Etc.
et cetera
f.
folgende
ff.
fortfolgende
frz.
französisch
ggf.
gegebenenfalls
Hg.
Herausgeber
HWK Saar
Handwerkskammer des Saarlandes
i.d.R.
in der Regel
IFB
Institut für praxisorientierte Forschung und Bildung e.V.
IfM
Institut für Mittelstandsforschung Bonn
IHK Saar
Industrie- und Handelskammer des Saarlandes
INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
IQ-
interkulturelle Qualifikation betreffend
Jh.
Jahrhundert
k.A.
keine Angaben
KMK
Kultusministerkonferenz
KMU
kleine und mittelständische Unternehmen
Nr.
Nummer
o.ä.
oder ähnlich(es)
o.g.
oben genannt
PME
Petites et moyennes entreprises
S.
Seite
Saar-Lor
Saarland-Lothringen
SaarLorLux
Saarland-Lothringen-Luxemburg
Saar-Wirtschaft
Wirtschaft des Saarlandes
SNCF
Société Nationale de Chemins de Fer Française
Tab.
Tabelle
u.a.
unter anderem
usw.
und so weiter
vgl.
vergleiche
WSAGR
Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion
z.B.
zum Beispiel
6
I
Einleitung
Globalisierung ist das Schlagwort der 1990er Jahre. Während die Internetsuchmaschine Alta-
Vista im Jahr 1997 noch 3.140 Einträge unter dem Suchbegriff aufführte,
1
sind es fünf Jahre
später bereits 113.808.
2
Die rasant angewachsene Popularität des Begriffs erstaunt, stellt Glo-
balisierung doch kein neues Phänomen dar.
3
Der enorme Entwicklungsschub von Kommuni-
kations- und Verkehrstechnologien hat in den letzten Jahrzehnten Raum- und Zeitbarrieren
schrumpfen lassen
4
und Impulse gesetzt für transnationale Verflechtungen. Daher auch die
Popularität von Globalisierung, die heute mit ihren Dimensionen und Kontroversen
5
zentrale
Fragen des menschlichen Zusammenlebens neu aufwirft, die in Politik und Wissenschaft 'glo-
bal' diskutiert werden. Wesentlichen Anstoß hierfür gab die von Internationalisierung gekenn-
zeichnete Wirtschaftswelt.
Die rapide Zunahme von Verflechtungen zwischen europäischen Volkswirtschaften ist neben
technologischen Entwicklungen vor allem auf die Triebkräfte des Europäischen Binnenmark-
tes und auf die Öffnung der osteuropäischen Märkte zurückzuführen. Somit verloren nationale
Grenzen ihre trennende Wirkung und die Zahl der Geschäftskontakte über Länder- und Kul-
turgrenzen hinweg wächst stetig. Eine transnationale Wirtschaftswelt öffnet aber nicht nur
neue Handlungsräume, sondern stellt auch neue Anforderungen an Wirtschaftsakteure. So
z.B. hinsichtlich der Fähigkeit, unter fremdkulturellen Bedingungen mit Angehörigen anderer
Kulturen kommunizieren, verhandeln und zusammenarbeiten zu können. Dies ist eine wichti-
ge Voraussetzung, denn Wirtschaftsakteure sind Menschen, die durch Sozialisationsprozesse
in einem nationalen Rahmen von ihrer (Landes)Kultur geprägt sind, sich in ihrem kulturellen
Wertesystem bewegen, bestimmte Standpunkte vertreten und auch danach handeln.
6
Vor die-
sem Hintergrund weisen Kühlmann und Stahl auf typische Schwierigkeiten bei grenzüber-
schreitender Wirtschaftstätigkeit hin und nennen u.a. unerwartete Reaktionen des fremdkultu-
rellen Partners, Bedeutungsverschiebungen vertrauter Signale, Ineffektivität gewohnter Ver-
1
Vgl.: Breidenbach, Joana / Zukrigl, Ina: Tanz der Kulturen. Kulturelle Identität in einer globalisierten Welt.
Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 2000, S. 9.
2
Vgl.: http://www.altavista.de [Stand: 18.06.2002].
3
Vgl.: Deller, Jürgen: Interkulturelle Eignungsdiagnostik. Zur Verwendbarkeit von Persönlichkeitsskalen. Wald-
steinberg, Heidrun Popp, 2000, S. 11f.
4
Vgl.: Beck, Ulrich: Was ist Globalisierung? (1997), Frankfurt/M., Suhrkamp,
6
1999, S. 63.
5
Weiterführend: Beck: Was ist Globalisierung? 1999, S. 37ff.
6
Vgl.: Barmeyer, Christoph I.: Interkulturelle Qualifikationen im deutsch-französischen Management kleiner
und mittelständischer Unternehmen (mit Schwerpunkt Saarland/Lothringen). (Reihe: Saarbrücker Studien zur
Interkulturellen Kommunikation mit Schwerpunkt Deutschland / Frankreich, Bd. 1), Röhrig Universitätsverlag,
St. Ingbert, 1996, S. 20.
7
haltensroutinen sowie Unklarheiten hinsichtlich des akzeptierten Verhaltensspielraums.
7
Wie
folgendes Zitat bestätigt, können solche problembehafteten Momente transnationaler Wirt-
schaftstätigkeit nicht mit Fachwissen allein gelöst werden:
Ich persönlich finde die kulturellen Kenntnisse genauso wichtig wie die sprachlichen. Es ist wichtig,
dass man auch die Mentalität der Leute kennt. Man kann nicht mit Franzosen verhandeln, wie man mit
Deutschen verhandelt. Wenn hier Defizite vorhanden sind, kann es leicht zu Missverständnissen füh-
ren.
8
Deutschland und Frankreich sind bereits seit den 1960er Jahren wechselseitig die wichtigsten
Handelspartner mit kontinuierlich steigender Tendenz.
9
Die Schaffung des Europäischen Bin-
nenmarkts eröffnete besonders für diese europäischen Nachbarn neue Möglichkeiten zur wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit; heute sind daher zwischen keinen anderen europäischen Län-
dern solche engen Wirtschaftsbeziehungen nachzuweisen: ,, Deutschland und Frankreich sind
wirtschaftlich so eng miteinander verflochten, dass Fehlentwicklungen und versäumte struktu-
relle Anpassungen in einem der beiden Länder auf längere Sicht zu negativen Konsequenzen
im Partnerland führen."
10
Das genannte Verhältnis zwischen beiden Volkswirtschaften wird
durch folgende Kernzahlen illustriert: Im Jahr 2001 war Deutschland der wichtigste Handels-
partner für Frankreich mit 14,3 Prozent aller Exporte und 16,6 Prozent aller Importe. Im glei-
chen Jahr rangierte Frankreich auf Platz eins der deutschen Außenhandelsstatistik.
11
Der Au-
tomobilindustrie kommt hierbei ein besonderer Stellenwert zu: 13,5 Prozent der französischen
Exporte nach Deutschland und 23 Prozent der französischen Importe aus Deutschland erfol-
gen im Automobilsektor.
12
Ferner weist Frankreich 2.200 deutsche Niederlassungen mit
116.000 Beschäftigten auf; im Gegenzug sind 1.200 französische Niederlassungen mit ca.
197.000 Personen in ganz Deutschland zu verzeichnen.
13
Während die europäische Integrati-
7
Vgl.: Kühlmann, Torsten M. / Stahl, Günter K.: ,, Diagnose interkultureller Kompetenz. Entwicklung und Eva-
luierung eines Assessment Centers". In: Barmeyer, Christoph I. / Bolten, Jürgen (Hg.): Interkulturelle Personal-
organisation. Sternenfels, Wissenschaft und Praxis, 1998, S. 213-224, hier S. 214.
8
Saarländischer Unternehmer mit Frankreicherfahrungen. Zitiert in: Kaiser, Barbara / Raasch, Albert: ,, Unter-
nehmen Fremdsprachen: ,,Fremdsprachenbedarf und bedürfnisse in saarländischen Unternehmen". In: Spra-
chenrat Saar (Hg.): Fremdsprachenbedarf in der Wirtschaft. Eine Dokumentation des Sprachenrats Saar zur Si-
tuation in der Bundesrepublik und speziell im Saarland. Saarbrücken, 1996, S. 25-41, hier S. 29.
9
Vgl.: Lüsebrink, H.-J.: Einführung in die Landeskunde Frankreichs. Wirtschaft Gesellschaft Staat Kultur
Mentalitäten. (Sammlung Metzler, Bd. 315), Stuttgart / Weimar, Metzler, 2000, S. 43. Und: Commissariat
Général du Plan/Deutsch-Französisches Institut (Hg.): Standortpolitik und Globalisierung: deutsch-französische
Perspektiven. Wirtschaftspolitik im Wandel. Opladen, Leske+Budrich, 2001, S. 9.
10
Hartmann, Peter: ,,Die deutsch-französische Partnerschaft und die Europäische Union vor den Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts". In: Dokumente. Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog. Nr. 1 (2000), S.
41-48.
11
Vgl.: http://www.destatis.de [Stand: 18.09.2002].
12
Vgl.: Ambassade de France en Allemagne / Mission Économique de Berlin: ,,Les échanges commeciaux entre
la France et l'Allemagne 2001. Fiche de Synthèse", S. 1. http://www.dree.org [Stand: 23.08.2002].
13
Vgl.: Chambre de Commerce et d'Industrie française en Allemagne / Service de l'expansion économique en
Allemagne (Hg.): Objectif Allemagne. Répertoire des implantations françaises en Allemagne. Edition 2000-
2001. Saarbrücken, S. 12 (nicht veröffentlicht).
8
on und die Globalisierung zu einer wachsenden Interdependenz beider Volkswirtschaften ge-
führt hat, dominieren bei den Akteuren dies- und jenseits des Rheins immer noch nationale
Denk- und Mentalitätsmuster, die die Zusammenarbeit nicht immer problemlos gestalten.
Zur Annäherung an deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen dienen zunächst Angaben
zur geographischen Verteilung der wechselseitigen Direktinvestitionen beider Länder. Deut-
sche Direktinvestitionen entfallen auf das Elsass mit 19,5 Prozent, auf Lothringen mit 14,4
Prozent, auf den Großraum Paris mit 13,3 Prozent und auf die Region Rhône-Alpes mit 9,2
Prozent. Französische Direktinvestitionen verteilen sich auf Nordrhein-Westfalen mit 26,3
Prozent, auf das Saarland mit 15,7 Prozent, auf Baden-Württemberg mit 15,4 Prozent, auf
Niedersachsen mit 13,3 Prozent und auf Hessen mit 12,6 Prozent.
14
Angesichts dieser Vertei-
lung ist festzuhalten, dass der Großteil der Direktinvestitionen im jeweils angrenzenden Aus-
land vorgenommen wird: Deutsche investieren vor allem in den französischen Regionen El-
sass und Lothringen, Franzosen hingegen zu großen Teilen im Bundesland Saarland.
Das wechselseitige wirtschaftliche Engagement in den jeweiligen grenznahen Regionen über-
rascht nicht, stellt die geographische Nähe doch einen zentralen Standortvorteil dar. Unter Be-
rücksichtigung der o.g. Fähigkeit, auch unter fremdkulturellen Bedingungen wirtschaftlich er-
folgreich zu sein, ist festzustellen, dass geographische Nähe oft auch mit kultureller Nähe
gleichgesetzt wird. Dies bestätigt eine französische Studie, die neben der Zweisprachigkeit
vor allem ähnliche Mentalitäten in den Grenzregionen Saarland und Lothringen als Grund für
die engen wirtschaftlichen Austauschbeziehungen in diesem Raum anführt.
15
Auch in unserer
Untersuchung gibt die Mehrheit der befragten saarländischen Wirtschaftsakteure an, keine
Mentalitätsunterschiede zwischen Saarländern und Lothringern zu sehen.
16
Dennoch wird die
andere Mentalität in unserer Studie als größte Herausforderung bei der grenzüberschreitenden
wirtschaftlichen Tätigkeit mit Lothringen betrachtet. Ebenso widersprüchlich gestalten sich
die Aussagen hinsichtlich der Fremdsprache: Saarländische Wirtschaftsakteure schätzen die
Fremdsprache zwar als nur geringfügig herausfordernd ein,
17
die AK Saar und die IHK Saar
konstatieren jedoch mangelnde Sprachkompetenzen
18
bzw. eine massiv vorhandene Sprach-
14
Vgl.: Französische Industrie- und Handelskammer in Deutschland: Vergleich von Wirtschaftsdaten und -
institutionen. Saarbrücken, 1999, S. 7 (nicht veröffentlicht).
15
Vgl.: ,,Les investissements allemands en France". In: Le Lien. Magazine économique France-Allemagne. Nr.
18 (1993), S.18. Zitiert in: Barmeyer: Interkulturelle Qualifikationen. 1996, S. 23.
16
Vgl.: Anhang B 23.
17
Vgl. Anhang B 17 und Barmeyer: Interkulturelle Qualifikationen. 1996, S. 23 und 60.
18
Vgl.: Arbeitskammer des Saarlandes (Hg.): Bericht an die Regierung des Saarlandes 1997. Zur wirtschaftli-
chen, ökologischen, sozialen und kulturellen Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Schwerpunktthe-
ma: Mehr Arbeitsplätze in kleinen und mittleren Unternehmen. Ottweiler, Ottweiler Druckerei und Verlag, 1997,
S. 25.
9
barriere
19
, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erschwert oder verhindert.
20
Mit Blick
auf wirtschaftliche Zusammenarbeit ist daher festzuhalten, dass geographische Nähe zwei-
felsohne einen Standortvorteil darstellt, jedoch werden zentrale Einflussfaktoren wie Sprache
und Mentalität unterschätzt. Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit Problem-
felder der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Saarländern und Lothringern analysiert,
die auf unterschiedliche politische Tradition und kulturelle Denk- sowie Verhaltensmuster zu-
rückzuführen sind.
1. Gegenstandsbereich, zentrale Fragestellungen und Aufbau
Der wirtschaftliche Aktionsradius der Grenzregionen Saarland und Lothringen wird von einer
nationalen Grenze eingeschränkt. Diese gilt es zu überschreiten, um ähnlich enge wirtschaftli-
che Verflechtungen zu schaffen wie dies zwischen Regionen eines Nationalstaates der Fall
ist.
21
Die Überwindung des Standortnachteils Grenzlage durch grenzüberschreitende Wirt-
schaftstätigkeit ist allerdings mit besonderen Herausforderungen verbunden, die vornehmlich
aus saarländischer Perspektive im Zentrum dieser Arbeit stehen. Grenzüberschreitung im
Rahmen überregionaler Wirtschaftsbeziehungen ist im Saarland ein bedeutendes Thema für
Wirtschaft und Politik. Von Seiten der IHK Saar, HWK Saar, AK Saar sowie der Saarländi-
schen Landesregierung wird in öffentlichen Stellungnahmen kontinuierlich die Bedeutung des
lothringischen bzw. französischen Marktes für die Saar-Wirtschaft unterstrichen und appel-
liert, die Hemmnisse grenzüberschreitender Wirtschaftstätigkeit abzubauen.
22
Vor diesem
Hintergrund sind bereits zahlreiche Initiativen ergriffen und durchgeführt worden, um durch
den Abbau von Hemmnissen transnationale bzw. interregionale Wirtschaftsbeziehungen zu
fördern. So verfolgt z.B. die Arbeitsgruppe Administrative Hemmnisse des 1997 gegründeten
Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion (WSAGR) das Ziel, die rechtlichen und
19
Vgl.: Industrie- und Handelskammer Saarland: ,,Die Chance Saar-Lor-Lux", S. 1. http://www.ihk-saarland.de
[Stand: 20.11.2001].
20
Vgl.: Krewer, Bernd / Kuntz, Lothar: Machbarkeitsstudie zu ,,Europäischen Dienstleistungen im Rahmen der
Eurozone". Saarbrücken, 2001, S. 17 (nicht veröffentlicht). Und: Gries, Marie-Luise / Ohnesorg, Sabine / West-
heide, Ronald: Ergebnisse der Befragung zum grenzüberschreitenden Qualifizierungsbedarf in saarländischen
Betrieben und Arbeitstätten. Durchgeführt im Rahmen von EURES Transfrontalier Lothringen-Saarland im Auf-
trag des Landesarbeitsamtes Rheinland-Pfalz-Saarland, gefördert durch die Europäische Kommission. Saarbrü-
cken, Institut für praxisorientierte Forschung und Bildung e.V., 1997, S. 44.
21
Vgl.: IHK Saar: ,,Die Chance Saar-Lor-Lux". S. 1. http://www.ihk-saarland.de [Stand: 20.11.2001].
22
Vgl.: Saarländische Landesregierung: ,,Ziele der SaarLorLux-Politik". http://www.saarlorlux.saarland.de
[Stand: 21.08.2002]. Und: Interregionaler Rat der Handwerkskammern Saar-Lor-Lux: ,,Memorandum. Zukunfts-
chance Handwerk der Großregion. Positionspapier des Interregionalen Rates der Handwerkskammern Saar-
Lor-Lux an die Politische Kommission ,,Zukunftsbild 2020" für die Großregion. 21. November 2002". S. 23f.
http://www.grossregion.net [Stand: 07.12.2002]. Und: Arbeitskammer des Saarlandes (Hg.): Bericht an die Re-
gierung des Saarlandes 2000. Zur wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und kulturellen Lage der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Schwerpunktthema: Saar-Lor-Lux aus Arbeitnehmersicht. St. Ingbert, 2000, S. 73.
Und: IHK Saar: ,,Die Chance Saar-Lor-Lux", S. 1. http://www.ihk-saarland.de, [Stand: 20.11.2001].
10
administrativen Hemmnisse bei grenzüberschreitender Wirtschaftstätigkeit aufzuheben.
23
Ferner informiert die HWK Saar in enger Zusammenarbeit mit der Chambre de Métiers de la
Moselle saarländische Unternehmen im Département Moselle und Unternehmen aus dem
Département Moselle im Saarland über einzuhaltende Formvorschriften bei grenzüberschrei-
tender Tätigkeit.
24
Außerdem engagierte sich die Regierung des Saarlandes in Zusammenar-
beit mit dem Sprachenrat Saar Ende der 1990er Jahre für die Förderung der Zweisprachigkeit
im Saarland.
25
In den genannten sowie weiteren Kontexten entstanden somit zahlreiche Be-
standsaufnahmen von Problemfeldern der grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit mit dem Ziel, diesen entgegenzuwirken.
Solche Bestandsaufnahmen sind jedoch problematisch in zweierlei Hinsicht: Einerseits wird
im Allgemeinen lediglich eine Listung von Hemmnissen grenzüberschreitender Wirtschaftstä-
tigkeit vorgenommen, was bedeutet, dass Problemfelder in ihrer bloßen Beschreibung verhar-
ren. Andererseits stehen in der Mehrzahl der Betrachtungen von Problemfeldern die rechtli-
chen Rahmenbedingungen grenzüberschreitender Wirtschaftsbeziehungen im Vordergrund.
Diese Arbeit wirkt dem entgegen und rückt die Interaktion zwischen Wirtschaftsakteuren in
den Blick, was die Berücksichtigung des Individuums einschließlich seiner Herkunft, also von
Kultur und Gesellschaft, erforderlich macht.
Es ist immer wieder festzustellen, [...] dass es bei der gemeinsamen Arbeit kulturelle Unterschiede gibt,
unterschiedliche Betrachtungsweisen, Arbeitsweisen [...], die sich aus nationalen politischen Traditio-
nen oder aus dem jeweiligen Bildungssystem ergeben. [...] Und wenn sich aus unterschiedlichen Ar-
beitsweisen, Kommunikationsstilen Probleme ergeben sollten, wie es immer wieder vorkommt, dann
sind wir [...] in der Lage, diese zu analysieren, zu entschärfen und konstruktiv mit ihnen umzugehen.
26
Das obige Zitat steht weitgehend im Einklang mit der vorliegenden Arbeit. Baasner stellt Kul-
tur als interaktionsrelevanten Faktor bei grenzüberschreitender Zusammenarbeit deutlich her-
aus; ferner werden kulturelle Unterschiede mit politischen Traditionen und zentralen Soziali-
sationsinstanzen des jeweiligen nationalen Kontextes in Verbindung gebracht. Dies bietet
Anknüpfungspunkte für Analysen, die Erklärungsansätze ermöglichen für interkulturelle
Problemfelder der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und somit helfen, diese zu ent-
schärfen sowie Wege zum konstruktiven Umgang mit ihnen aufzuzeigen. Vor diesem Hinter-
grund sind zunächst zwei Fragestellungen für die vorliegende Arbeit zentral:
23
Vgl.: http://www.wsagr.org [Stand: 12.12.2002].
24
Vgl.: Handwerkskammer des Saarlandes: ,,Fachinformationen". http://www.handwerksboerse.de [Stand:
12.12.2002].
25
Vgl.: Groß, Bernd / Hamard, Sylvie / Raasch, Albert: Wegweiser zur Zweisprachigkeit für den deutsch-
französischen Alltag. Saarbrücken, Sprachenrat Saar, 1998, S. 1ff. Und: Bohr, Kurt: ,, Vorwort". In: Sprachenrat
Saar: Fremdsprachen. 1996, S. 3-4, hier S. 3.
26
Prof. Dr. Frank Baasner (Direktor des deutsch-französischen Instituts Ludwigsburg): ,,Jenseits des Nationalen?
Deutsche und Franzosen in Europa". (Vortrag in der Musikhalle Ludwigsburg anlässlich der Mitgliederver-
sammlung des dfi am 19.11.2001). http://www.dfi.de [Stand: 04.10.2002].
11
- Welche interkulturellen Problemfelder treten bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im
Raum Saarland-Lothringen auf?
- Auf welchen kulturellen und gesellschaftlichen Unterschieden basieren diese interkultu-
rellen Problemfelder?
Zur Annäherung an die obigen Fragestellungen wurde eine empirische Untersuchung bei
grenzüberschreitend tätigen saarländischen Wirtschaftsakteuren durchgeführt. Die Ergebnisse
dieser Untersuchung werden durch sieben empirische Studien ergänzt, die Fragestellungen zu
saarländisch-lothringischen Wirtschaftsbeziehungen behandeln.
Die Schwierigkeit bei der Zusammenstellung des Materials bestand darin, Studien heranzu-
ziehen, die kulturelle Eigenheiten und deren Wirkungsmomente bei der saarländisch-
lothringischen Zusammenarbeit thematisieren, denn bisher wurde hierzu wenig unter kulturel-
lem Vorzeichen geforscht. Jedoch sind in diesem Zusammenhang die Arbeiten von Barmeyer
zu erwähnen, die Kultur als interaktionsrelevanten Faktor bei der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit in den Mittelpunkt stellen.
27
Ferner erwies es sich als schwierig, Untersuchun-
gen heranzuziehen, die sowohl die saarländische als auch die lothringische Perspektive glei-
chermaßen berücksichtigen. Im vorliegenden Datenmaterial überwiegen daher Angaben von
Saarländern, die lothringische Perspektive wird soweit erforderlich durch wissenschaftli-
che Literatur ergänzt.
Im Hauptteil der vorliegenden Arbeit wird zunächst der Raum Saarland-Lothringen unter
Einbezug seiner Wirtschaftsgeschichte, der politischen Grenzziehungen und wirtschaftlichen
Umstrukturierungen vorgestellt. Dem schließt sich die Systematisierung von interkulturellen
Problemfeldern der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie deren Positionierung im interak-
tionalen Handlungsfeld an. Neben der nachfolgenden Darstellung von zentralen Problemfel-
dern aus saarländischer und lothringischer Perspektive wie sie aus unserer und den berück-
sichtigten Untersuchungen sowie einschlägiger Literatur hervorgehen, wird hierbei der Tatsa-
che Rechnung getragen, dass beide Regionen in unterschiedliche Gesellschaften eingebunden
sind. Dies ermöglicht die Analyse von kulturellen Unterschieden, die auf einer synchronen
und diachronen Ebene ansetzt. In synchroner Perspektive werden konstatierte Eigenschaften
und Verhaltensmuster von Wirtschaftsakteuren u.a. vor dem Hintergrund der nationalen Bil-
dungssysteme reflektiert; in diachroner Perspektive wird der historische Entstehungskontext
von kulturellen Werten und Handlungsmustern in Deutschland und Frankreich betrachtet.
27
Vgl.: Barmeyer: Interkulturelle Qualifikation. 1996. Und: Barmeyer, Christoph I.: Mentalitätsunterschiede
und Marktchancen im Frankreichgeschäft. Zur interkulturellen Kommunikation im Handwerk (mit Schwerpunkt
Saarland/Lothringen). Studie und Handbuch. (Reihe: Saarbrücker Studien zur Interkulturellen Kommunikation
mit Schwerpunkt Deutschland/Frankreich, Bd. 4), St. Ingbert, Röhrig Universitätsverlag, 2000.
12
Nach dieser Analyse von interkulturellen Problemfeldern werden Perspektiven für die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit im Raum Saarland-Lothringen aufgezeigt. Angesichts der Situa-
tion, dass sich ,,[...] gerade in Grenzregionen Europas wie der unsrigen [dem Saarland] [...]
am ehesten nachbarschaftliche Unterschiede auf [...] wirtschaftlichem [...] Gebiet her-
aus[kristallisieren]."
28
und ,,In Grenzregionen [daher] interkulturelle und interregionale Fä-
higkeiten jeden Tag neu gefordert [werden]."
29
, steht hierbei folgende Leitfrage im Mittel-
punkt:
- Welche Qualifikationen sind notwendig, um grenzüberschreitend wirtschaftlich erfolg-
reich tätig zu sein?
Zur Bearbeitung dieser Fragestellung wird aus unseren Studien- und Arbeitsergebnissen ein
interkulturelles Qualifikationsprofil für grenzüberschreitend tätige Wirtschaftsakteure abgelei-
tet, das sich konzeptuell an den Forschungen des BiBB
30
und den Erkenntnissen der Interkul-
turellen Kommunikation orientiert. In Anknüpfung hieran wird weiterführend folgender Frage
nachgegangen:
- Werden solche Qualifikationen in staatlich anerkannten Einrichtungen der Aus- und Wei-
terbildung im Saarland angeboten bzw. vermittelt?
Mit der Betrachtung der Aus- und Weiterbildung im Saarland werden zwei Ziele verfolgt:
Zum einen soll überprüft werden, ob eine interkulturelle Nachqualifizierung von grenzüber-
schreitend tätigen Wirtschaftsakteuren möglich ist und zum anderen, ob eine interkulturelle
Qualifizierung von zukünftigen Wirtschaftsakteuren im Saarland sichergestellt ist, die per-
spektivisch eine Nachqualifizierung erübrigt. Zur Erhebung der Ist-Situation wurde das saar-
ländische Bildungsangebot in staatlich anerkannten Einrichtungen der Aus- und Weiterbil-
dung untersucht mit Blick auf die Frankreichorientierung bzw. auf das genannte Qualifikati-
onsprofil. Hierfür wurden eine E-Mail-Befragung und ein Interview durchgeführt, die durch
weitere Rechercheergebnisse ergänzt werden. Bei der Datenbeschaffung erwies es sich als
schwierig, einen erschöpfenden Überblick über grenzüberschreitende Bildungsangebote und
28
Müller, Peter: ,,Begrüßungsrede". In: Oppermann, Detlef (Hg.): Sprachen und Grenzräume. Partnersprachen
und interkulturelle Kommunikation in europäischen Grenzräumen. Dokumentation einer Fachtagung des Ver-
bandes der Volkshochschulen des Saarlandes am 7. Mai 2001 im Saarbrücker Schloss. St. Ingbert, Röhrig Uni-
versitätsverlag, 2002, S. 31-38, hier S. 37.
29
Ebd.
30
Vgl.: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.): Forschungsergebnisse 1999 des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung. Bonn, 2000, S. 15. Und: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.): Fremdsprachen und mehr. Internationale
Qualifikationen aus Sicht von Betrieben und Beschäftigten. Eine empirische Studie über Zukunftsqualifikationen
.
Bielfeld, Bertelsmann, 1997.
13
Projekte im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu erhalten, da die Mehrzahl
dieser Initiativen auf informellen Kontakten zwischen Einzelpersonen basieren.
31
Im darauf folgenden Kapitel ist nachstehende Frage zentral, die den Blick auf die Soll-
Situation in der saarländischen Aus- und Weiterbildungslandschaft lenkt:
- Inwiefern können die erarbeiteten Qualifikationen in die Aus- und Weiterbildung von
grenzüberschreitend tätigen Wirtschaftsakteuren integriert werden?
Zur Integration von Teilkompetenzen und Wissensbeständen unseres Qualifikationsprofils in
die saarländische Aus- und Weiterbildung werden praxisorientierte Handlungsmöglichkeiten
vorgestellt. Im Bereich der beruflichen Ausbildung finden die Bedingungen an den Lernorten
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb Berücksichtigung; im Bereich der Weiterbildung wird
ein inhaltlich ausgearbeitetes Modulsystem zur interkulturellen Qualifizierung von Wirt-
schaftsakteuren präsentiert. Abschließend wird eine Strategie entwickelt zur tatsächlichen Be-
rücksichtigung der erarbeiteten Integrationsmöglichkeiten unseres Qualifikationsprofils in
saarländischen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.
2. Forschungslage und theoretische Konzepte
Forschungen zum Kulturvergleich und Interkulturalität werden in zahlreichen wissenschaftli-
chen Disziplinen durchgeführt, vor allem in der Psychologie, Soziologie, Anthropologie, Lin-
guistik, Pädagogik, Betriebswirtschaftslehre und Kulturwissenschaft. Interessiert sich die
Psychologie in erster Linie für kulturgeprägte Verhaltensmuster des Individuums, so rückt die
Soziologie prägende gesellschaftliche Institutionen und Gruppen in den Blick. Die Kultur-
anthropologie beschäftigt sich mit kulturellen Ausdrucksformen einer Gruppe oder Gesell-
schaft; die Linguistik betrachtet verbale und nonverbale Kommunikationsformen zwischen
Angehörigen unterschiedlicher Kulturen. Die Pädagogik interessiert sich für interkulturelle
Lernprozesse und Vermittlungspraktiken, die Betriebswirtschaftslehre perspektivisiert den
Einfluss von Kultur mit Blick auf wertschöpfende Prozesse und die Kulturwissenschaft ver-
sucht, bei der Untersuchung kultureller Merkmale von Gesellschaften Methoden und Konzep-
te der o.g. Disziplinen aufzugreifen und sinnvoll zu integrieren.
32
Im Gegensatz zum Kulturvergleich, bei dem Variablen und Merkmale von Kulturen gegen-
übergestellt werden, rückt der Forschungsbereich Interkulturelle Kommunikation Interaktio-
nen und Beziehungen zwischen Menschen in den Blick. Es werden Kontaktsituationen zwi-
31
AK Saar: Bericht. 2000, S. 83.
32
Vgl.: Barmeyer, Christoph I.: Interkulturelles Management und Lernstile. Studierende und Führungskräfte in
Frankreich, Deutschland und Quebec. Frankfurt/M., Campus, 2000, S. 53.
14
schen verschiedenen Kulturen untersucht mit dem Ziel, unter Berücksichtigung der Erkennt-
nisse aus den o.g. Bezugswissenschaften Erklärungen und Vorhersagen für kulturbedingte
Probleme und Synergiepotentiale in interkulturellen Situationen zu erarbeiten. Methodisch
setzt die Interkulturelle Kommunikation auf Interdisziplinarität; demzufolge werden auch in
der vorliegenden Arbeit Methoden und theoretische Konzepte aus unterschiedlichen Diszipli-
nen herangezogen. Die relativ späte Herausbildung dieser Forschungsrichtung ist auf die erst
durch zunehmende wirtschaftliche Globalisierung erkannte Bedeutung des interaktionsrele-
vanten Faktors Kultur zurückzuführen, dessen Konzept nachfolgend präzisiert wird.
2.1 Erweiterter Kulturbegriff und seine integrierende Betrachtung
Erwartungen an einen 'richtigen' Kulturbegriff müssen zunächst enttäuscht werden. Die
Schätzungen zur Anzahl kursierender Kulturdefinitionen gehen weit auseinander: Slembek
spricht von über 300 Definitionen;
33
Kroeber und Kluckhohn tragen 170 Definitionen von
Kultur zusammen
34
. Auf die Bedeutungsvielfalt von Kultur wird an dieser Stelle nicht einge-
gangen,
35
jedoch wird angesichts der zahlreichen Definitionen zwischen zwei zentralen Be-
deutungsrastern von Kultur unterschieden: dem engen und erweiterten Kulturbegriff.
Der enge Kulturbegriff repräsentiert das Schöne, Wahre, Gute oder Edle und ist somit auf
zwei Bedeutungen von cultura begrenzt: Kunst und Geisteskultur.
36
Das enge Kulturver-
ständnis spielt in der Kulturwissenschaft jedoch kaum noch eine Rolle.
37
Ganz anders hinge-
gen der erweiterte Kulturbegriff, der ,,[...] die Lebenswelt, in der wir uns bewegen, die wir
uns durch unser Zusammenleben schaffen und ständig neu schaffen."
38
bezeichnet. Dieser
wird also auf den Alltag bezogen und ,,[...] schließt Wechselwirkungen mit der natürlichen
Umwelt ebenso ein wie [...] den Bereich des ,, Kultur"schaffens im engen Sinn."
39
Der erwei-
terte Kulturbegriff versucht somit, die Gesamtheit der Normen und Wertorientierungen alltäg-
lichen Handelns zu umfassen, was laut Ehlich allerdings dazu führt, dass diesem Kulturbegriff
33
Vgl.: Slembek, Edith: ,,Grundfragen der interkulturellen Kommunikation". In: Jonach, Ingrid (Hg.): Interkul-
turelle Kommunikation. (Reihe: Sprache und Sprechen. Beiträge zur Sprechwissenschaft und Sprecherziehung,
Bd. 34), München, Ernst Reinhardt Verlag, 1998, S. 27-36, hier S. 27.
34
Vgl.: Helmolt, Katharina v.: Kommunikation in internationalen Arbeitsgruppen. Eine Fallstudie über diver-
gierende Konventionen der Modalitätskonstituierung. (Reihe interkulturelle Kommunikation, Bd. 2) München,
Iudicium, 1997, S. 14 (Die Angaben über die von Kroeber/Kluckhohn gelisteten Kulturdefinitionen schwanken
in einschlägiger Literatur zwischen 170 und 250).
35
weiterführend: Hansen, Klaus P.: Kultur und Kulturwissenschaft. Eine Einführung. (1995) Tübingen / Basel,
Francke (UTB),
2
2000, S. 11-18.
36
Vgl.: Bolten, Jürgen: ,,Interkulturelle Wirtschaftskommunikation". In: Walter, Rolf (Hg.): Wirtschaftswissen-
schaften. Eine Einführung. Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh (UTB), 1997, S. 467-497, hier S. 471.
37
Vgl.: Ebd., S. 472.
38
Vgl.: Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. Erfurt, Landeszentrale für politische Bildung Thüringen,
2001, S. 12.
39
Vgl.: Ebd., S. 13.
15
inzwischen die Aufgabe einer Black Box, also eines Platzhalters, zukommt. Einerseits soll der
erweiterte Kulturbegriff möglichst viele, völlig unterschiedliche Aspekte der menschlichen
Lebenswelt unter einem Begriff subsumieren, ohne andererseits die Beziehungen und Inter-
dependenzen dieser einzelnen Aspekte untereinander erklären zu müssen.
40
Der genannten
Platzhalterfunktion kann jedoch entgegengewirkt werden durch unterschiedliche Betrach-
tungsweisen des erweiterten Kulturbegriffs. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um drei
methodologische Richtungen, die als materiale, mentalistische und funktionalistische be-
zeichnet werden.
41
- Materiale Ansätze orientieren sich an der Gesamtheit von Artefakten als hervorgebrachte
sinnrepräsentierende Leistungen einer Gesellschaft. Unter Artefakten werden bestimmte
Formen der Kleiderordnung, Arbeits- und Kommunikationsstile, Denkmäler, administra-
tive Strukturen sowie Strukturen von Bildungssystemen, Formen der Wirtschaftsförde-
rung oder Gesetze verstanden. Demnach handelt es sich bei Artefakten um Elemente einer
Kultur, die perzipiert, also wahrgenommen, werden können. Die genannten Identifikati-
onsmerkmale werden daher als kulturelle Perceptas bezeichnet.
42
- Mentalistische Ansätze fassen Kultur konsequent immateriell auf. Im Fokus stehen weni-
ger kulturelle Perceptas, sondern vielmehr kulturelle Konceptas, die kollektiv geteilte
Werte, Einstellungen und Normen umfassen und als Handlungs- und Verhaltensursachen
nicht unmittelbar beschrieben werden können. Konceptas und Perceptas sind eng mitein-
ander verknüpft, da über die beobachtete Realität (Perceptas) auf handlungsleitende Moti-
ve (Konceptas) zurückgeschlossen werden kann.
43
- Funktionalistische Ansätze rücken handlungstheoretische Aspekte von Kultur in den Mit-
telpunkt. Kultur wird hier als Orientierungssystem verstanden, das für die soziale Praxis
einer Gesellschaft, Organisation oder (Berufs)Gruppe notwendig ist. Kultur in funktiona-
listischer Perspektive stellt ein Regelwerk von Konventionen und Interaktionsmustern dar,
das kollektiv geteilt wird und an dem die Mitglieder einer Gruppe ihr alltagsweltliches
Handeln unbewusst und nicht hinterfragend ausrichten.
44
40
Vgl.: Ehlich, Konrad: ,,Interkulturelle Kommunikation". In: Goebl, Hans / Nelde, Peter, H. / Stary, Zdenk /
Wölck, Wolfgang (Hg.): Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. (1. Halb-
band), Berlin / New York, de Gruyter, 1996, S. 920-931, hier S. 921.
41
Vgl.: Bolten, Jürgen: ,,Interkulturelle Wirtschaftskommunikation". In: Walter, Rolf (Hg.): Wirtschaftswissen-
schaften. Eine Einführung. Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh (UTB), 1997, S. 467-497, hier S. 472f.
42
Vgl.: Ebd.
43
Vgl.: Ebd., S. 473.
44
Vgl.: Ebd., S. 473f.
16
Um u.a. die o.g. Kritik Ehlichs aufzulösen, wird in der Forschungspraxis eine integrierende
Betrachtung des erweiterten Kulturbegriffs bevorzugt, derzufolge Kultur als Orientierungs-
system verstanden wird, das über die Perceptas beschreibbar und als Konceptas erklärbar ist.
45
Dennoch wird Kultur je nach Forschungsdisziplin und Erkenntnisinteresse unterschiedlich
perspektivisiert.
Der Ethnologe Clifford Geertz z.B. vertritt eine kultursemiotische Position und hat mit Bar-
thes
46
diesen 'mainstream' der Kulturwissenschaft entscheidend mitgeprägt.
47
Geertz betrach-
tet Kultur als ein Komplex von Bedeutungen und stellt hierbei materiale und mentalistische
Aspekte von Kultur in den Vordergrund:
Der Kulturbegriff, den ich vertrete und dessen Nützlichkeit ich [...] zeigen möchte, ist wesentlich ein
semiotischer: Ich meine mit Max Weber, daß der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Be-
deutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher
keine experimentelle Wissenschaft, die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach
Bedeutungen sucht. Mir geht es um Erläuterungen, um das Deuten gesellschaftlicher Ausdrucksformen,
die zunächst rätselhaft erscheinen.
48
Nach Geertz bilden also gesellschaftliche Ausdrucksformen (Perceptas) und die hieran ge-
koppelten Bedeutungen (Konceptas) ein 'Gewebe' ein kulturelles System , das kollektive
Eindeutigkeiten schafft wie z.B. einheitliche Kommunikations- und Handlungsmuster im Sin-
ne der funktionalistischen Kulturtheorie.
Der Anthropologe Geert Hofstede betont in seiner Kulturdefinition vor allem mentalistische
Aspekte von Kultur. Analog zur Computerwelt bezeichnet er Kultur als ,, [...] mentale Soft-
ware [...]"
49
, die innere ,,[...] Muster des Denkens, Fühlens und potentiellen Handelns [sind],
die er [der Mensch] ein Leben lang gelernt hat."
50
Hierbei sieht Hofstede Kultur als ein kol-
lektiv geteiltes Phänomen an, das die ,,[...] Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Men-
schen von anderen unterscheidet."
51
Der Psychologe Alexander Thomas betrachtet Kultur in Anknüpfung an Goodenough
52
eben-
falls unter mentalistischem Vorzeichen, stellt hierbei allerdings den funktionalistischen As-
pekt deutlich heraus:
45
Vgl.: Ebd., S. 474.
46
Vgl.: Barthes, Roland: Mythen des Alltags. (1964), Frankfurt/M., Suhrkamp,
8
1983.
47
Vgl.: Hansen: Kultur und Kulturwissenschaft. 2000, S. 297 und 299.
48
Vgl.: Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. (1987) Frank-
furt/M., Suhrkamp,
4
1995, S. 9.
49
Hofstede, Geert: Lokales Denken, globales Handeln. Kulturen, Zusammenarbeit und Management. München,
dtv, 1997, S. 3.
50
Ebd., S. 2.
51
Ebd., S. 4.
52
Vgl.: Goodenough, Ward H.: ,,Cultural anthropology and linguistics". In: Hymes, Dell H. (Hg.). Language in
Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology. New York: Harper & Row, 1964, S. 36-40. Zi-
tiert in: Helmolt: Kommunikation in internationalen Arbeitsgruppen. 1997, S. 14.
17
Kultur ist ein universelles, für eine Gesellschaft, Organisation und Gruppe [...] sehr typisches Orientie-
rungssystem. Dieses Orientierungssystem wird aus spezifischen Symbolen gebildet und in der jeweili-
gen Gesellschaft usw. tradiert. Es beeinflusst das Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln aller ihrer
Mitglieder und definiert somit deren Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Kultur als Orientierungssystem
strukturiert ein für die sich der Gesellschaft zugehörig fühlenden Individuen spezifisches Handlungsfeld
und schafft damit die Voraussetzung zur Entwicklung eigenständiger Formen der Umweltbewälti-
gung.
53
In der vorliegenden Arbeit wird mit dem erweiterten Kulturbegriff in integrierender Perspek-
tive gearbeitet. Das bedeutet, Kultur wird hier definiert als die von Angehörigen einer Kultur
kollektiv geteilten Werte, Einstellungen und Normen (Conceptas), die eine regulative Funkti-
on für das soziale Miteinander übernehmen (Orientierungsfunktion). Sie beziehen sich auf
Formen des Wahrnehmens, Glaubens, Bewertens und Handelns, die sich in der sozialen Inter-
aktion manifestieren (Perceptas). Kultur bezeichnet demzufolge auch die Art und Weise, wie
Kommunikationssituationen oder Abwicklungen von Projekten in Deutschland und Frank-
reich verlaufen.
Ungeachtet der Vielschichtigkeit des erweiterten Kulturbegriffs wird dieser je nach wissen-
schaftlicher Disziplin und Erkenntnisinteresse auf Kulturkreise, Nationen oder Gesellschaften
bezogen. Der vorliegende erweiterte Kulturbegriff orientiert sich an den Eingrenzungen von
Knapp und Bolten:
Eine Kultur wird üblicherweise gleichgesetzt mit
einer Gesellschaft, die durch nationalstaatliche
Grenzen oder eine Menge von konstanten [...]
Merkmalen [...] von anderen Gesellschaften unter-
scheidbar ist.
54
Für den Kulturbegriff der Interkulturellen Wirt-
schaftskommunikation ist [...] eine pragmatische
Eingrenzung notwendig, die in der Regel dazu
führt, Kultur- und politische Ländergrenzen
gleichzusetzen.
55
Die pragmatische Gleichsetzung von Kultur mit einer Gesellschaft ist nicht unproblematisch,
können sich politische Ländergrenzen doch verändern, ohne dass dies einen unmittelbaren
Einfluss auf die Kultur haben muss. Jedoch ist dies für die Operationalisierung des Kulturbeg-
riffs ,,[...] als die beste aller schlechten Lösungen [...]"
56
anzusehen, weil somit zum einen
definitorisch klar unterschieden werden kann zwischen Prozessen innerhalb eines kulturellen
Systems und zwischen kulturellen Systemen. Zum anderen lenkt die nationale Grenzziehung
den Blick auf sozio-kulturelle Merkmale einer Gesellschaft, die in der vorliegenden Arbeit
zentral sind.
Ferner erfordert der vorliegende Kulturbegriff eine Präzisierung im Hinblick auf seine Archi-
tektur. Das Konzept der Nationalkultur soll kein Bild einer heterogenen Gesellschaft sugge-
53
Thomas, Alexander: ,,Analyse der Handlungswirksamkeit von Kulturstandards". In: ders. (Hg.): Psychologie
interkulturellen Handelns. Göttingen, Hogrefe, 1996, S. 107-135, hier S. 112.
54
Knapp, Karlfried: ,,Interpersonale und interkulturelle Kommunikation". In: Bergmann, Niels / Sourisseaux,
Andreas L. J. (Hg.): Interkulturelles Management. (1992), Heidelberg, Physica,
2
1996, S. 60-80, hier S. 60.
55
Bolten: ,,Interkulturelle Wirtschaftskommunikation". In: Walter: Wirtschaftswissenschaften. 1997, S. 467-497,
hier S. 475.
56
Ebd., S. 475.
18
rieren, sondern vielmehr aufzeigen, dass diese ein soziales System darstellt, in dem Individu-
en leben, die wiederum gemeinsame Gruppierungen im Sinne eines Kollektivs bilden. Dem-
zufolge schließen Nationalkulturen Unterkollektive bzw. Subkulturen ein.
57
Hansen beschäftigt sich mit dem Verhältnis dieser Unterkollektive untereinander und deren
Bezug zur Nationalkultur. Er kommt zu dem Ergebnis, ,,[...] dass die Kollektivformen in ei-
ner interaktiven Dialektik aufeinander bezogen sind, bei der jede auf jede einwirkt und jede
von jeder abhängt."
58
Mit Blick auf die übergreifende Nationalkultur hält Hansen fest, dass
[...] viele Gruppierungen unterhalb der nationalen Großformation einerseits durch sie geprägt werden,
durch ihre Geschichte, durch ihre Mentalität, durch ihre besonderen Institutionen [...], andererseits prä-
gend auf sie zurückwirken.
59
Die von Hansen genannten Verknüpfungen, Durchdringungen und der somit entstehende
,,[...] gemeinsame Kern an Weltbildern, Werten, Normen und Handlungsmustern [...]"
60
legi-
timiert das vorliegende Konzept der Nationalkultur, das einen kulturellen Pluralismus enthält.
Die genannten Wechselwirkungen auf der Ebene der Unterkollektive sowie deren prägendes
Verhältnis zur nationalen Großformation bwirken, dass eine Nationalkultur kein in sich ge-
schlossenes, homogenes und statisches Gebilde darstellt, sondern vielmehr ein dynamisches
und veränderbares System.
2.2 Kulturerwerb und Sozialisationsinstanzen
Zur Betrachtung von interkulturellen Problemfeldern mit dem Ziel, über deren Beschreibung
hinauszugehen und für ein besseres Verständnis Erklärungsansätze anzuführen, ist es nicht
unerheblich, Prozesse des Kulturerwerbs zu betrachten.
Als Quelle von Kultur nennt Hofstede das soziale Umfeld:
61
,, Die Programmierung beginnt in
der Familie und setzt sich fort in der Nachbarschaft, in der Schule, in Jugendgruppen, am Ar-
beitsplatz, in der Partnerschaft."
62
Hiermit stellt Hofstede heraus, dass der Mensch nicht als
Kulturwesen auf die Welt kommt, sondern erst durch die Interaktion mit seinem sozialen Um-
feld zu diesem wird. Die Begriffe Sozialisation und Enkulturation basieren auf dieser Auffas-
sung und werden in den Sozialwissenschaften oft synonym verwendet; dennoch grenzen sie
sich voneinander ab.
57
Vgl.: Hansen: Kultur und Kulturwissenschaft. 2000, S. 215.
58
Ebd., S. 216.
59
Ebd.
60
Knapp: ,,Interpersonale und interkulturelle Kommunikation". 1996. In: Bergmann/Sourisseaux: Interkulturel-
les Management. 1996, S. 60-80, hier S. 60.
61
Vgl.: Hofstede: Lokales Denken, globales Handeln. 1997, S. 3.
62
Ebd.
19
Als Enkulturation wird die Gesamtheit aller bewussten und unbewussten Prozesse bezeichnet, durch die
ein Individuum die grundlegende Elemente der Kultur, in der es lebt, aufnimmt und verinnerlicht (inter-
nalisiert). Wenn der Einzelne diese Elemente (wie Tradition, Werte und Normen) erfolgreich in seine
Persönlichkeit integrieren kann, wird er zum aktiven Mitglied seiner Kultur, auf die er dann auch gestal-
terisch einwirkt.
63
Sozialisation bezeichnet auch die oben beschriebene 'Vergesellschaftung' des Individuums,
setzt jedoch einen anderen Akzent:
Sozialisation ist die Gesamtheit der Prozesse, durch die ein Mensch Teil einer Gesellschaft wird und de-
ren Kultur mitträgt und mitbestimmt; Hineinwachsen in soziale Rollen und Übernahme von sozialen
Werten und Normen; beides ermöglicht dem einzelnen soziale Handlungsfähigkeit. Die Sozialisation
eines Menschen kann einmal durch absichtliche Einwirkungen (wie z.B. Erziehung oder Bildung) un-
terstützt werden. Zum anderen finden Sozialisationsprozesse durch das gemeinsame Leben in der Ge-
sellschaft statt. Der Einzelne lernt, welches Verhalten erfolgreich oder erwünscht ist und welches nicht.
Die Normen und Werte einer Gesellschaft können vom Individuum so verinnerlicht (internalisiert) wer-
den, dass es immer noch seine Persönlichkeit beibehält und als aktives Mitglied die Gesellschaft mit-
prägt.
64
Im Gegensatz zur Enkulturation, die Traditionen, Werte und Normen in den Blick rückt, ste-
hen bei der Sozialisation die Interaktionsprozesse mit der sozialen Umwelt im Vordergrund.
Enkulturation meint daher eher den Gegenstand der Verinnerlichung, also die grundlegenden
Elemente von Kultur; Sozialisation hingegen bezeichnet die Prozesse selbst, in deren Rahmen
das Individuum vergesellschaftlicht wird. Demzufolge benennt Sozialisation die formale In-
teraktion der Individuen in einem gesellschaftlichen System und Enkulturation die Kultur-
muster, die diese Interaktion inhaltlich mitprägt. Beide Begriffe zeichnen sich durch semanti-
sche Nähe zueinander aus, wobei der eine vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Sys-
tems und der andere vor dem Hintergrund des kulturellen Systems zum Tragen kommt.
65
Zur
Analyse von kulturellen Unterschieden in der vorliegenden Arbeit ist die sozialisatorische In-
teraktion des Individuums mit dem jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld zentral. Kulturmus-
ter, die bei diesen Sozialisationsprozessen ihre Vermittlung erfahren, werden im Verlauf die-
ser Arbeit u.a. am Beispiel von Kommunikationskonventionen und Arbeitsformen im
deutsch-französischen Vergleich erläutert.
Bei der Betrachtung von Sozialisationsprozessen steht zunächst die Entwicklung und Verän-
derung der menschlichen Persönlichkeit im Mittelpunkt.
66
Persönlichkeit konstituiert sich
durch Individualität, aber auch durch einen Sozialcharakter. Als Sozialcharakter wird der Teil
der Persönlichkeit verstanden, ,,[...] der [einer] signifikanten sozialen Gruppe gemeinsam ist
63
http://www.sociologicus.de [Stand: 28.05.02].
64
http://www.sociologicus.de [Stand: 28.05.02].
65
Vgl.: Mintzel, Alf: ,, Kultur und Gesellschaft. Der Kulturbegriff der Soziologie". In: Hansen, Klaus P. (Hg.):
Kulturbegriff und Methode. Tübingen, Günther Narr, 1993, S. 171-199, hier S. 192.
66
Vgl.: Popp, Ulrike / Tillmann, Klaus-Jürgen: Sozialisation Eine Einführung. (Doppelkurseinheit). Hagen,
Fernuniversität, 1996, S. 24.
20
und der [...] das Produkt der Erfahrung dieser Gruppe darstellt [...]."
67
In Bezug auf Kultur-
erwerb ist diese Schnittmenge an gemeinsamen Erfahrungen von Bedeutung, die durch inter-
aktive Austauschprozesse zwischen Individuum und gesellschaftlicher Umwelt erworben
wird. Geulen und Hurrelmann operationalisieren dieses komplexe und ineinander verwobene
gesellschaftliche Sozialisationsfeld mit dem Strukturmodell der Sozialisationsbedingungen.
Ebene
Komponenten (beispielhaft)
D
Gesamtgesellschaft
Ökonomische, soziale, politische, kulturelle Struktur
C
Institutionen
Betriebe, Massenmedien, Schulen, Universitäten, Mi-
litär, Kirchen
B
Interaktion und Tätigkeiten
Eltern-Kind Beziehung; schulischer Unterricht;
Kommunikation zwischen Gleichaltrigen, Freunden,
Verwandten
A
Individuum
Erfahrungsmuster, Einstellungen, Wissen, emotionale
Strukturen, kognitive Fähigkeiten
Abbildung 1: Strukturmodell der Sozialisationsbedingungen
68
Sie unterscheiden vier Ebenen wobei Ebene A die Betrachtungsebene darstellt, die Erfah-
rungsmuster, Einstellungen, Wissen usw. umfasst, die dem Individuum Handlungsfähigkeit
innerhalb seines kulturellen Systems verleihen (Abb. 1). Die Bedingungsebenen des Soziali-
sationsprozesses sind hierarchisch angeordnet, d.h. die jeweils höhere Ebene setzt die Rah-
menbedingungen für die nächst niedrigere (Abb. 1). Die Gesamtgesellschaft (Ebene D) als
ökonomische, soziale, politische und kulturelle Struktur ist hierbei von übergreifendem Cha-
rakter und beeinflusst direkt bzw. indirekt Institutionen (Ebene C), Tätigkeiten und Formen
der Interaktion (Ebene B) und somit den Sozialisationsverlauf des Individuums (Ebene A).
Das Verhältnis zwischen gesellschaftlichem Sozialisationsfeld und Individuum ist jedoch von
Reziprozität gekennzeichnet, denn beide Pole wirken gegenseitig aufeinander ein. An dieser
Stelle kommt die o.g. Individualität der Einzelpersönlichkeit zum Tragen, die
[...] in jedem von uns weiterlebt, nachdem die Gesellschaft und Kultur ihr Äußerstes getan haben. Als
Teil des Sozialorganismus hält der Einzelmensch den gesellschaftlichen Status Quo aufrecht. Als Indi-
viduum hilft er mit, diesen Status Quo zu verändern, wenn das notwendig wird.
69
Die genannte Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Individuum bekräftigt die These,
dass Nationalkulturen nicht als statische Gebilde, sondern als dynamische Systeme aufzufas-
sen sind.
67
Vgl.: Riesmann, D.: Die einsame Masse. Hamburg, 1958, S. 20. Zitiert in: Ebd.
68
Vgl.: Tillmann, Klaus-Jürgen: Einführung in die Sozialisationstheorie Über den Zusammenhang von Sozial-
struktur und Persönlichkeit. Weinheim / Basel, Beltz, 1989, S. 17.
69
Linton, R.: Gesellschaft, Kultur und Individuum. Tübingen, 1974, S. 25. Zitiert in: Geier, Bernd: ,,Der Erwerb
interkultureller Kompetenz. Ein Modell auf Basis der Kulturforschung". (Dissertation, Universität Passau, 2001),
http://elib.ub.uni-passau.de [Stand: 27.05.02].
21
Für die vorliegende Arbeit sind die Ebenen B und C zentral, denn gesellschaftliche Institutio-
nen wie Bildungsinstitutionen, in denen Angehörige von modernen Gesellschaften ihre se-
kundäre Sozialisationsphase durchlaufen, stellen neben Familienstrukturen die wichtigste
Form der individuellen Sozialisation dar.
70
In Bildungseinrichtungen ,,[...] findet zwischen
den Akteuren Kommunikation und Interaktion statt, werden also Denk- und Verhaltensweisen
konditioniert und reproduziert, die für die jeweilige Gesellschaft charakteristisch ist."
71
Die Sozialisationsfunktionen von Schule sind [...] vor allem darin zu sehen, der heranwachsenden Ge-
nerationen diejenigen Werthaltungen, Gefühlsdispositionen und Verhaltensbereitschaften zu vermitteln,
die jeweils von Berufswesen und Gesellschaft erwartet werden.
72
Die obigen Zitate geben wieder, dass gesellschaftliche Verhältnisse vor allem über Bildungs-
institutionen auf die Sozialisation des Individuums wirken und hier generiert, reproduziert
und somit tradiert werden.
73
Französische Staatsmänner wussten diese Mechanismen bereits
im 18. Jh. zu nutzen: ,,Frankreichs zentralistischer Staat schuf sich seit dem 18. Jahrhundert
sein öffentliches Bildungssystem [...] zur sprachlichen und kulturellen Vereinheitlichung der
Nation."
74
Deutlich wird damit, dass Bildungsinstitutionen und -inhalte, in denen Kultur ihre
Vermittlung erfährt, zur Ermittlung von kulturellen Unterschieden wichtige Anknüpfungs-
punkte bieten. In der vorliegenden Arbeit werden daher berufliche Ausbildungsstrukturen und
Konzepte von Berufsausbildung in Verbindung mit unterschiedlichen Arbeitsweisen in
Deutschland und Frankreich gegenübergestellt. Durch die Betrachtung von Sozialisationsbe-
dingungen im deutsch-französischen Vergleich, hier also von beruflicher Ausbildung, werden
Erklärungsansätze für kulturelle Unterschiede aufgestellt. Diese Methode wird auch von Pa-
teau bei Wiecha angewandt:
Der ,,schlagartige" und zwanghafte Übergang von Arbeit in Freizeit (das Wort Feierabend gibt es im
Französischen bekanntlich nicht) stellt eben kein Naturgesetz dar. Pateau erklärt die Herkunft der in
Frankreich zu beobachtenden Nicht-Trennung beider Bereiche mit der frühen Sozialisation der Kinder
in Ganztagseinrichtungen, der längeren Arbeitszeit und Erfordernissen des ,,starken" kulturellen Kon-
textes, etwa der primären Personenorientiertheit der (Unternehmens-)Kommunikation.
75
Vor dem Hintergrund ,,[...] daß französische Kinder von der Vorschule bis zum Abitur eine
Ganztagsschule besuchen, deutsche dahingegen auf sich selbst beziehungsweise ihre Famili-
70
Vgl.: Lüsebrink: Einführung in die Landeskunde Frankreichs. 2000, S. 58.
71
Vgl.: Barmeyer: Interkulturelles Management. 2000, S. 149.
72
Vgl.: Pekrun, Reinhard: ,, Schule als Sozialisationsinstanz". In: Schneewind, Klaus, A. (Hg.): Psychologie der
Erziehung und Sozialisation. (Enzyklopädie der Psychologie, Bd. 1), Göttingen, Hogrefe, 1994, S. 465-485, hier
S. 467.
73
Vgl.: Ebd., S. 480.
74
Vgl.: Picht, Robert: ,,Bildungswesen". In: Picht, Robert / Hoffmann-Martinot, Vincent / Lasserre, René / Thei-
ner, Peter (Hg.): Fremde Freunde. Deutsche und Franzosen vor dem 21. Jahrhundert. München, Piper, 1997, S.
92-96, hier S. 93f.
75
Vgl.: Wiecha, Eduard A.: ,,Interkulturelle Kommunikation und Frankreich-Studien". In: Dokumente. Zeit-
schrift für den deutsch-französischen Dialog. Nr. 2 (2002), S. 47-51, hier S. 48.
22
en, Freunde und vielerlei außerschulische Aktivitäten gestellt sind."
76
, wird einsichtig, dass
sich durch die unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen verschiedene kultur- bzw. gesell-
schaftsspezifischen Verhaltens- und Einstellungsmuster herausbilden, die sich im späteren be-
ruflichen Handeln manifestieren und bei wirtschaftlicher Tätigkeit über Kultur- und Länder-
grenzen hinweg zu Problemsituationen führen können.
2.3 Kulturelle Standardisierung und Individualität
Die Tatsache, in einem bestimmten gesellschaftlichen Systems aufgewachsen zu sein und kul-
turelle Vorgaben durch die Interaktion mit dem sozialen Umfeld internalisiert zu haben, wirft
verschiedene Fragen auf, die bei der Betrachtung von Situation grenzüberschreitender Zu-
sammenarbeit wesentlich sind. Zum einen ist zu klären, ob die Gesamtheit der Angehörigen
einer Kultur nach standardisierten Mustern handelt und zum anderen, welches Gewicht hier-
bei der Individualität des Einzelnen sowie weiteren Einflussfaktoren in Interaktionssituatio-
nen zukommt. Hofstede deutet bereits die Dringlichkeit der genannten Fragestellungen an:
Das Verhalten eines Menschen ist nur zum Teil durch seine mentale Programmierung vorbestimmt: er
hat grundsätzlich die Möglichkeit, von ihnen abzuweichen und auf eine neue, kreative, destruktive oder
unerwartete Weise zu reagieren. Die mentale Software [...] gibt lediglich an, welche Reaktionen ange-
sichts der persönlichen Vergangenheit wahrscheinlich und verständlich sind.
77
Zur Bestimmung dieser 'wahrscheinlichen Reaktionen' wurden zahlreiche Forschungen durch-
geführt. Hierzu zählt u.a. die von Hofstede zwischen 1968 und 1972 in 53 Ländern unter
116.000 Mitarbeitern des Unternehmens IBM durchgeführte Studie. Hofstede ging davon aus,
dass alle Gesellschaften mit den gleichen Grundproblemen konfrontiert seien, nur die Ant-
worten, die sie auf diese Probleme geben, seien unterschiedlich. Zu diesen Grundproblemen
zählt Hofstede das Verhältnis zur Autorität, das Selbstverständnis von Individuum-
Gesellschaft und Maskulinität-Feminität, die Art und Weise, mit Konflikten umzugehen so-
wie die Dominanz langfristiger bzw. kurzfristiger Handlungsorientierungen. Hieraus leitet er
fünf Dimensionen kulturellen Denkens ab, an denen er seine Befragung orientiert. Die Ergeb-
nisse wurden für alle Länder in Punktwerte umgerechnet und graphisch dargestellt, so dass
verschiedene Länder hinsichtlich eines Aspekts verglichen werden können.
78
Hall und Hall erarbeiten zum Kulturvergleich raum- und zeitbezogene (Polychro-
nie/Monochronie) sowie kommunikationsbezogene (explizit/implizit) Variablen.
79
76
Vgl.: Picht: ,,Bildungswesen". In: ders. et al.: Fremde Freunde. 1997, S. 92-96, hier S. 95f.
77
Hofstede: Lokales Denken, globales Handeln. 1997, S. 3.
78
Vgl.: Hofstede, Geert: Interkulturelle Zusammenarbeit. Kulturen-Organisationen-Management. Wiesbaden,
Gabler, 1993.
79
Vgl.: Hall, Edward T. / Hall, Mildred Reed: Understanding Cultural Differences: Germans, French and
Americans. Yarmouth, Intercultural Press, 1990, S. 6ff.
23
Trompenaars erweitert die Liste der o.g. Grundprobleme um folgende Dimensionen: Umgang
mit Problemsituationen (Universalismus/Partikularismus), Berücksichtigung sozialer Bindun-
gen (neutral/emotional), Trennung zwischen Dienstlichem und Privatem (speziell-diffus),
Umgang mit Statusfragen (Leistung/Zuschreibung), Einstellungen zur Zeit (Vergangenheits-,
Gegenwarts- und Zukunftsorientierung) sowie um die Einstellung zur (sozialen) Umwelt
(Kontrolle/Einklang).
80
Obwohl Trompenaars Forschungsergebnisse durch Hofstede hinsicht-
lich methodischer und konzeptioneller Schwächen kritisiert wurden, ist die Studie dennoch
eine häufig rezitierte Referenz.
81
Alternativ zu Hofstedes Kulturdimensionen entwickelte Thomas das Konzept der Kulturstan-
dards.
82
Sie umfassen
[...] alle Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns [...], die von der Mehrzahl der
Mitglieder einer bestimmten Kultur für sich persönlich und andere als normal, selbstverständlich, ty-
pisch und verbindlich angesehen werden. Eigenes und fremdes Handeln wird auf der Grundlage dieser
Kulturstandards beurteilt und reguliert.
83
Kulturstandards sollen also kulturgebundenes Handeln erklären und werden analog zu
Hofstede als kulturspezifische Antworten auf Grundprobleme des menschlichen Lebens ver-
standen. Hinsichtlich der sozialen Distanzregulation unterscheidet Thomas z.B. zwischen dem
Standard Distanzminimierung für Amerikaner und Distanzdifferenzierung für Deutsche (nach
Bekanntheitsgraden usw.).
84
Ein Festhalten an den genannten Kategorien zur Analyse von interkulturellen Problemfeldern
würde bedeuten, dass ungeachtet der Veränderbarkeit von Kultur stereotype und völkerpsy-
chologische Verhaltensweisen festgeschrieben und vorausgesagt werden und das Individuum
somit als 'Gefangener' seiner Kultur betrachtet wird. Im Zusammenhang mit Sozialisations-
prozessen wurde bereits darauf verwiesen, dass sich die menschliche Persönlichkeit durch ei-
nen kulturellen Basischarakter und durch Individualität konstituiert, was verdeutlicht, dass das
Individuum nur bis zu einem bestimmten Grad von Kultur bzw. Gesellschaft beeinflussbar ist.
Bei der Betrachtung von kulturellen Überschneidungssituationen müssen daher ergänzend
Persönlichkeitsmerkmale und situative Bedingungen berücksichtigt werden.
80
Vgl.: Trompenaars, Fons: Handbuch globales Management. Düsseldorf, Econ, 1993.
81
Vgl.: Hofstede, Geert: " Riding the Waves of Commerce: A Test of Trompenaars " Modell" of National Culture
Differences". In: International Journal of Intercultural Relations. Nr. 2 (1996), S. 189-198.
82
Vgl.: Thomas, A.: ,,Psychologische Wirksamkeit von Kulturstandards im interkulturellen Handeln". In: ders.
(Hg.): Kulturstandards in der internationalen Begegnung. (Sozialwissenschaftlicher Studienkreis für Internatio-
nale Probleme: SSIP Bulletin Nr. 61), Saarbrücken / Fort Lauderdale, Breitenbach, 1991, S. 55-69.
83
Thomas, Alexander: ,, Analyse der Handlungswirksamkeit von Kulturstandards". In: ders (Hg.): Psychologie
interkulturellen Handelns. 1996, S. 107-135, hier S. 112.
84
Vgl.: Thomas, Alexander: ,,Psychologische Wirksamkeit von Kulturstandards im interkulturellen Handeln".
In: ders. (Hg.): Kulturstandards in der internationalen Begegnung. 1991, S. 55-69, hier S. 62.
24
Hierfür entwickelt Geier in Anlehnung an Keller ein Persönlichkeitsmodell in Form einer
Zwiebel mit vier Schichten.
85
Die Schicht der kulturellen Grundpersönlichkeit stellt in diesem
Modell vor biologischen Konstanten die tiefliegendste dar. Diese kennzeichnet sich durch ho-
he Resistenz gegenüber Veränderbarkeit sowie durch einen maßgeblichen Einfluss auf die
Persönlichkeitsstruktur. Nach außen hin überlagert die Schicht der kulturellen Prägung jene
Schicht der Persönlichkeit, die von rollen- und statusspezifischen Einflüssen geprägt ist: der
Statuspersönlichkeit. Die äußerste Schicht repräsentiert individuelle Eigenheiten und Persön-
lichkeitsmerkmale, die einer hohen Veränderbarkeit unterliegen und dem Individuum einzig-
artige Merkmale verleihen. Das beschriebene Modell bestätigt zunächst, dass menschliches
Handeln nicht ausschließlich von kulturellen Standardisierungen bestimmt wird. Ebenso wir-
ken rollen- und statusspezifische Einflüsse auf menschliches Handeln, die je nach Situation,
Interaktionspartner und Rolle neu zu bestimmen und neben den Rahmenbedingungen von In-
teraktionssituationen auch subkulturellen Merkmalen verhaftet sind. Persönlichkeitsmerkmale
im engeren Sinne, also individuelle Eigenschaften und Kompetenzen, beeinflussen ebenfalls
die Wahl von Verhaltensdispositionen bzw. Reaktionsweisen. Dennoch unterstreicht das be-
schriebene Modell, dass die kulturelle Grundpersönlichkeit gegenüber anderen Persönlich-
keitskomponenten von zentraler Bedeutung ist und die Wahrnehmung, den Glauben, das Be-
werten und Handeln eines Individuums stark beeinflusst. Die Berücksichtigung der angedeu-
teten Komplexität menschlichen Handelns bei der Betrachtung von kultureller Interaktion be-
zeichnet Demorgon als strategischen Ansatz. Auch er hebt das Gewicht von kulturellen Stan-
dardisierungen hervor:
D'une part, il y a, déjà proposée par la culture une réponse habituelle organisée. D'autre part, il y a des
contraintes nouvelles, résultant de changements particuliers de l'environnement, changement souvent
impossible à prévoir et auxquels il faut dès lors "s'adapter". C'est qu'il faut encore noter [...] c'est que
les modalités stratégiques vont-elles-mêmes prises dans des tentatives de les produire sous forme de ré-
ponse déjà prêtes, c'est-à-dire de réponse culturelles.
86
Die von Demorgon genannten Prozesse im Spannungsfeld zwischen kulturell standardisierten
Handlungs- und Verhaltensmustern sowie individuellen und situativen Einflussfaktoren greift
Barmeyer vor dem Hintergrund der o.g. Kulturstandards bzw. kulturellen Dimensionen auf
und relativiert deren bipolare Determiniertheit durch das Konzept der oszillierenden Adapta-
tionsprozesse menschlichen Handelns zwischen kulturellen Dimensionen.
87
Somit verdeutlicht
Barmeyer die vage Aussagekraft von kulturellen Standardisierungen, die in der vorliegenden
Arbeit zwar als Mittel zur Klassifizierung von Handlungs- und Verhaltensformen herangezo-
85
Vgl.: Geier: ,,Erwerb interkultureller Kompetenz". http://elib.ub.uni-passau.de [Stand: 27.05.02].
86
Demorgon, Jacques: Complexités des cultures et de l'interculturel. Paris, Anthropos, 1996, S. 19 (Hervorhe-
bungen im Original).
87
Vgl.: Barmeyer: Interkulturelles Management. 2000, S.125 ff.
25
gen werden, jedoch lediglich als Orientierungsrahmen und als ,,[...] Mittel zur Selbst- und
Fremdreflexion [...]"
88
zu betrachten sind. Der o.g. Komplexität wird durch die Integration
des strategischen Ansatzes Rechnung getragen, der durch eine differenzierte Betrachtungs-
weise von kulturellen Überschneidungssituationen in dieser Arbeit realisiert wird.
2.4 Kulturelle Überschneidung und Interkulturalität
Grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit wird in der vorliegenden Arbeit als
kulturelle Überschneidungssituation betrachtet. Dieses Konzept geht auf den Psychologen
Kurt Lewin zurück, der es zur Beschreibung von konflikthaften Konstellationen des psychi-
schen Feldes entwickelte.
89
In funktionalisitischer Perspektive dient Kultur zur Orientierung und ermöglicht den Mitglie-
dern einer Gruppe in kohärenter Weise miteinander zu interagieren. Sie verleiht dem Indivi-
duum Handlungssicherheit, wenn es sich in dem ihm bekannten kulturellen Regelsystem be-
wegt. Bei grenzüberschreitender Wirtschaftstätigkeit jedoch interagieren Deutsche und Fran-
zose mit dem jeweils fremdkulturellen Ordnungssystem. So zum Beispiel im den Konstellati-
onen:
- deutscher Anbieter-französischer Käufer bei der Abwicklung eines Geschäfts (oder umge-
kehrt),
- deutscher Auftraggeber-französischer Auftragnehmer bei der Erteilung/Ausführung eines
Auftrags (oder umgekehrt),
- deutscher Partner-französischer Partner bei der Realisierung eines gemeinsamen Vorha-
bens.
In den genannten Interaktionssituationen werden fremdkulturelle Handlungs- und Verhal-
tensmuster (Perceptas) zumeist auf der Basis des eigenkulturellen Bedeutungssystems inter-
pretiert (Conceptas). Diese Interaktion zwischen Perceptas und Conceptas aus unterschiedli-
chen kulturellen Systemen bewirkt, dass die Eindeutigkeit von Handlungs- und Verhaltens-
mustern nicht mehr gewährleistet ist. Diese für den Wirtschaftsakteur von Orientierungsver-
lust gekennzeichnete Situation wird als kulturelle Überschneidungssituation bezeichnet, denn
die jeweilige Person befindet sich ,,[...] zur gleichen Zeit in mehr als einer Situation."
90
Die
88
Vgl.: Krewer, Bernd: ,, Kulturstandards als Mittel zur Selbst- und Fremdreflexion". In: Thomas: Psychologie
interkulturellen Handelns. 1996, S. 147-164, hier S. 159f.
89
Vgl.: Winter, Gerhard: ,, Was eigentlich ist eine kulturelle Überschneidungssituation?". In: Thomas, Alexander
(Hg.): Psychologie und multikulturelle Gesellschaft. Göttingen, Hogrefe, 1994, S. 221-227, hier S. 221.
90
Lewin, Kurt: Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Bern, Huber, 1963, S. 301. Zitiert in: Ebd.
26
genannte fehlende Eindeutigkeit bzw. die ,,[...] kognitiv unstrukturierte Region [...]"
91
er-
schwert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wie Hansen bestätigt:
Die Verständigung über politische und kulturelle Grenzen hinweg wird insofern erschwert, als die Basis
des Gemeinsamen schmaler ausfällt [...]. Es fehlt der Kitt der gemeinsamen Sprache, der gemeinsamen
Geschichte, der gemeinsamen Standardisierungen und der gemeinsamen gesellschaftlichen Institutio-
nen.
92
Die fehlende gemeinsame Basis, die der Interaktion von Perceptas und Konzeptas unter-
schiedlicher kultureller Systeme verhaftet ist, kann zum Abbruch der Zusammenarbeit führen,
jedoch auch Formen interkultureller Provenienz erzeugen:
In der Tat ist doch für das multinationale Unternehmen die kulturelle Vielfalt nicht nur eine Quelle zu-
sätzlicher Schwierigkeiten und potentieller Probleme, sondern auch ein echter Wettbewerbsvorteil ge-
genüber inländischen [...] Konkurrenten. Denn durch die Kombination verschiedener Sicht- und Vor-
gehensweisen sollten Problemlösungen und Innovationen möglich werden, die ohne sie nicht denkbar
gewesen wären.
93
Die Interferenz verschiedener kultureller Systeme eröffnet also neue Räume, die in einschlä-
giger Literatur als ,,Interkultur"
94
, ,,culture de contact"
95
, ,,Zwischenwelt" ,,intermonde"
96
oder
,,third culture"
97
bezeichnet werden. Trotz der Begriffspluralität bezeichnen die Autoren
hiermit lediglich das dynamische Interaktionsverhältnis zwischen Kulturen, das neue interkul-
turelle Räume generiert.
Die dadurch entstehende partielle Gemeinschaft ist weder als bloße Addition der kulturellen Identitäten
zu verstehen noch als Selektion von Teilen aus ihnen, sondern stellt sich als eine neue Welt für sich dar,
die zerfällt, sobald das gemeinsame Handeln endet.
98
91
Lewin: Feldtheorie. 1963, S. 175. Zitiert in: Dadder, Rita: Interkulturelle Orientierung. Analyse ausgewählter
interkultureller Trainingsprogramme. (Sozialwissenschaftliche Studien zu internationalen Problemen, Bd. 121),
Saarbrücken / Fort Lauderdale, Breitenbach, 1987, S. 46.
92
Vgl.: Hansen: Kultur und Kulturwissenschaft. 2000. S. 318.
93
Bergmann, Alexander: ,,Interkulturelle Managemententwicklung". In: Haller, Matthias / Bleichner, Knut /
Brauchlin, Emil / Pleitner, Hans-Jobst / Wunderer, Rolf / Zünd, André (Hg.): Globalisierung der Wirtschaft.
Einwirkungen auf die Betriebswirtschaftslehre. Bern / Stuttgart / Wien, Paul Haupt, 1993, S. 193-216, hier S.
197.
94
Bolten, Jürgen: ,,Grenzen der Internationalisierungsfähigkeit. Interkulturelles Handeln aus interaktionstheore-
tischer Perspektive". In: ders. (Hg.): Cross Culture Interkulturelles Handeln in der Wirtschaft. Sternenfels,
Wissenschaft und Praxis, 1995, S. 24-42, hier S. 29.
95
Tabouret-Keller, A.: ,, De la culture idéale aux culture de contact". In: Labat, C./Vermes, G. (Hg.): Cultures
ouvertes, sociétés interculturelles. Paris, L'Harmattan, 1993. Zitiert in: Krewer: ,, Kulturstandards als Mittel zur
Selbst- und Fremdreflexion". In: Thomas: Psychologie interkulturellen Handelns. 1996, S. 147-164, hier S. 151.
96
Hu, Adelheid: ,, Warum ,,Fremdverstehen"? Anmerkungen zu einem leitenden Konzept innerhalb eines ,,inter-
kulturell" verstandenen Sprachunterrichts". In: Bredella, Lothar / Christ, Herbert / Legutke, Michael K. (Hg.):
Thema Fremdverstehen. Arbeiten aus dem Graduiertenkolleg ,, Didaktik des Fremdverstehens". Tübingen, Narr,
1997, S. 34-54, hier S. 49.
97
Müller-Jacquier, Bernd: Interkulturelle Kommunikation und Fremdsprachendidaktik. Studienbrief Kulturwis-
senschaft. (Studienbrief- und Materialienreihe: Fremdsprachen in Grund- und Hauptschulen), Universität Kob-
lenz-Landau, Abt. Landau, 1999, S. 38 (nicht veröffentlicht).
98
Hausstein, Alexandra: ,,Interkulturalität". In: Schnell, Ralf (Hg.): Metzler-Lexikon. Kultur der Gegenwart:
Themen und Theorien, Formen und Institutionen seit 1945. Stuttgart / Weimar, Metzler, 2000, S. 232.
27
Die genannte Interkultur konstituiert sich laut dem obigen Zitat durch ein Ordnungssystem,
das von den einzelnen Systemen der beteiligten Kulturen nicht beschrieben werden kann.
99
Festzuhalten ist, dass die Qualität der kulturellen Überschneidung durch das Präfix inter ver-
deutlicht wird; dieses hat semantisch die Bedeutung von zwischen, miteinander, reziprok
100
und setzt voraus, dass die Kontaktkulturen den durch kulturelle Überschneidung erzeugten
Orientierungsverlust konstruktiv aufgreifen und als Chance wahrnehmen, um gemeinsam
neue, bisher unbekannte Wege zu gehen. Vor diesem Hintergrund ist nicht jede kulturelle Ü-
berschneidungssituation als interkulturell aufzufassen, denn ungleiche Kräfteverhältnisse zwi-
schen Interaktionspartnern bei grenzüberschreitender wirtschaftlicher Tätigkeit können Do-
minanzen erzeugen, die ggf. einen Kulturtransfer bewirken, jedoch keine interkulturellen Räu-
me eröffnen.
Interkulturalität ist laut Hansen das populärste und umstrittenste aller Themen, die mit Kultur
zu tun haben.
101
In zahlreichen Publikationen zur Interkulturellen Kommunikation ist festzu-
stellen, dass häufig unterschiedliche Konzepte von Interkulturalität zu Grunde gelegt werden.
Hierbei sind im Allgemeinen zwei Auffassungen auszumachen: 1) Interkulturalität, bei der
die an einer Interaktion von verschiedenen Kulturen beteiligten Vertreter betrachtet werden
und 2) Interkulturalität, bei der die sich in diesem Prozess bildende Interkultur im Mittelpunkt
steht. Das Konzept der kulturellen Überschneidungssituation berücksichtigt beide Sichtwei-
sen, denn der Begriff kulturelle Überschneidung stellt zum einen deutlich heraus, dass sich
verschiedene Kulturen 'überlagern' und zum anderen, dass an diesem Prozess mindestens zwei
verschiedene Kulturen beteiligt sein müssen.
102
Somit wird der Blick sowohl auf die Interfe-
renz bzw. Interaktion als auch auf die hieran beteiligten kulturellen Systeme gelenkt. In Be-
zug auf grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit ist daher zu unterscheiden zwi-
schen den an der Zusammenarbeit beteiligten Wirtschaftsakteuren als Angehörige eines sozio-
kulturellen Systems und dem Prozess der Interaktion. Die Betrachtung des Interaktionspro-
zesses hat zum Ziel, Problemfelder zu erhellen und Synergiepotentiale aufzuzeigen; hingegen
dient die kontrastive Gegenüberstellung der kulturellen Systeme bzw. deren Vertreter zur I-
dentifikation von kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die den Interaktionspro-
zess beeinflussen.
103
Somit ergibt sich eine kulturvergleichende und interkulturelle Betrach-
99
Vgl.: Müller-Jacquier: Interkulturelle Kommunikation und Fremdsprachendidaktik. 1999, S. 38.
100
Vgl.: Wierlacher, Alois: Architektur interkultureller Germanistik. München, Iudicium, 2001, S. 324.
101
Vgl.: Hansen: Kultur und Kulturwissenschaft. 2000, S. 317.
102
Ferner verdeutlicht der Begriff kulturelle Überschneidungssituation, dass keine interkulturellen Unterschiede
bei der Betrachtung von Kulturkontakt auszumachen sind, von denen in der Alltags- und Fachkommunikation
oft gesprochen wird. Interkulturelle Unterschiede, die sich auf eine Interkultur beziehen, sind höchstens beim
Vergleich von verschiedenen kulturellen Überschneidungssituationen auszumachen.
103
Vgl.: Barmeyer: Interkulturelles Management. 2000.S. 117.
28
tung von Situationen grenzüberschreitender wirtschaftlicher Zusammenarbeit, die eng mitein-
ander verknüpft sind.
Um eine solche Betrachtung zu realisieren sowie um dem Fehler zweiter Art vorzubeugen,
der die Kulturalisierung von Problemfeldern der Zusammenarbeit bezeichnet,
104
werden kul-
turelle Überschneidungssituationen im vorliegenden Kontext anhand von vier zentralen Ebe-
nen operationalisiert.
105
- Ebene der Rahmenbedingungen: Grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit
wird von rechtlichen und administrativen Vorgaben bestimmt wie z.B. bestimmte Forma-
litäten, Vertragsformen, Zahlungsmodalitäten oder technische Standards und Normen.
Hierbei sind Unterschiede zwischen den beteiligten sozio-kulturellen Systemen zu be-
rücksichtigen, aber auch Bestimmungen des EU-Rechts o.ä., die übergreifende Rahmen-
bedingungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und somit für den Interakti-
onsprozess setzen. Weitere Faktoren, die den Interaktionsprozess nachhaltig beeinflussen,
stellen Rahmenbedingungen dar wie konkurrierende vs. gemeinsame Zielsetzungen, Do-
minanz vs. Gleichstellung der Interaktanten oder wie die Dauer und Intensität der Zu-
sammenarbeit.
- Kulturelle Ebene: Die an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beteiligten Wirt-
schaftsakteure begegnen sich als Vertreter ihres kulturellen Systems einschließlich ihrer
Handlungs- und Verhaltensstandards. Im Interaktionsprozess verlieren diese jedoch ihre
Gültigkeit, was Orientierungsverlust bewirkt und den Verlauf der Zusammenarbeit beein-
flusst. Daher sind kulturspezifische Standardisierungen wie Kommunikationskonventio-
nen u.ä. vergleichend gegenüberzustellen, um problembehaftete Interaktionsprozesse zu
erhellen bzw. hierfür Voraussagen zu treffen.
- Gruppale Ebene: Die an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beteiligten
Wirtschaftsakteure begegnen sich nicht nur als Vertreter einer Nationalkultur, sondern
auch als Angehörige von Subkulturen. Als solche werden regionale Kulturen, soziale
Klassen, Organisationen, aber auch Berufskulturen bezeichnet.
106
Analog zur o.g. sozi-
alisatorischen Interaktion des Individuums mit seinem sozialen Umfeld erfolgen beim Er-
werb und der Ausübung eines Berufs berufsspezifische Sozialisationsprozesse, welche die
Herausbildung von gruppen- bzw. berufsspezifischen Standardisierungen bewirken. Diese
104
Vgl.: Krewer, Bernd: ,,Interkulturelle Trainingsprogramme Bestandsaufnahme und Perspektiven". In: Nou-
veaux Cahiers d'allemand. Nr. 2 (1994), S. 139-149, hier S. 145f.
105
In Anlehnung an Krewers Modell der Problemebenen interkultureller Kommunikation und Kooperation; vgl.:
Krewer: ,, Kulturstandards als Mittel zur Selbst- und Fremdreflexion". In: Thomas: Psychologie interkulturellen
Handelns. 1996. S. 147-164, hier S. 160.
106
Weiterführend: Hofstede: Lokales Denken, globales Handeln. 1997, S. 11f. Und: Barmeyer: Interkulturelles
Management. 2000, S. 140ff.
29
dung von gruppen- bzw. berufsspezifischen Standardisierungen bewirken. Diese haben
Leit- bzw. Orientierungsfunktion für das berufliche Handeln und sind als fester Bestand-
teil von Berufsbildern anzusehen. Bei grenzüberschreitender Wirtschaftstätigkeit treffen
verschiedene ,,[...] strukturell vorgegebene Entwicklungsschablonen [...]"
107
bzw. Be-
rufsbilder aufeinander, deren Orientierungsmarken in Interaktionssituationen ihre Gültig-
keit verlieren.
Die Unterschiedlichkeit der Bildungssysteme und die damit bedingten Ausbildungs- und Karrierewege,
die die kultureigenen Denk- und Verhaltensmuster prägen, führen gerade in der deutsch-französischen
Kooperation häufig zu Problemen.
108
Vor diesem Hintergrund sind Berufsbilder bzw. Ausbildungskulturen in Deutschland und
Frankreich einschließlich der generierten Standardisierungen und Wertekonzepte kontra-
stiv gegenüberzustellen, um problembehaftete deutsch-französische Interaktionsprozesse
aufzuklären.
- Personale Ebene: Die an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beteiligten Wirt-
schaftsakteure begegnen sich des Weiteren nicht nur als Vertreter ihres kulturellen Sys-
tems, sondern ebenso als Individuen mit eigener Persönlichkeit. Der Erfolg der deutsch-
französischen Zusammenarbeit wird stark beeinflusst von Persönlichkeitsmerkmalen der
Akteure zu denen neben Sprache vor allem Fähigkeiten zählen, die im Bereich der Sozial-
und interkulturellen Kompetenz anzusiedeln sind. Bei der Analyse von interkulturellen
Problemfeldern sind daher auch die individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten der Ak-
teure einzubeziehen.
Die genannten Ebenen dienen dem Erkenntnisinteresse dieser Arbeit und dürfen nicht unab-
hängig voneinander betrachtet werden. Kultur nach dem vorliegenden erweiterten Verständnis
bildet eine allumfassende Klammer und beeinflusst sowohl die Rahmenbedingungen als auch
kultur- und gruppenspezifische Merkmale sowie Persönlichkeitsstrukturen auf der Akteurs-
ebene. Daher ist die Gesamtheit der Ebenen in kulturkontrastiver Perspektive als ein komple-
xes 'Gewebe' aufzufassen, das bei der interkulturellen Betrachtung mit einem ebensolchen in-
teragiert. Durch den Einbezug des jeweiligen gesellschaftlichen Kontextes wird dieser Kom-
plexität in der vorliegenden Arbeit Rechnung getragen. In Abb. 2 sind die o.g. Ebenen vor
dem Hintergrund des Konzepts der kulturellen Überschneidungssituation aufgeführt.
107
Fischer, Astrid: Schulische Berufsausbildung im Handwerk. Eine international ausgerichtete wirtschaftspä-
dagogische Betrachtung. Dissertation, Universität Köln, 2000, S. 24.
108
Breuer, Jochen P./de Bartha, Pierre: Deutsch-französischer Kooperationsmanagement. München, Becker,
1996. Zitiert in:
Barmeyer: Interkulturelles Management. 2000, S. 35.
30
Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen
(Berufs)Gruppe
(Berufs)Gruppe
K
U
L
T
U
R
A
Persönlichkeit
Persönlichkeit
K
U
L
T
U
R
B
Abbildung 2: Ebenen kultureller Überschneidungssituationen bei der grenzüberschreitenden wirtschaftli-
chen Zusammenarbeit
3. Methodik und Untersuchungsdesign
Zur Annäherung an grenzüberschreitende Wirtschaftsbeziehungen im Raum Saarland-
Lothringen wurde ein zweidimensionales Untersuchungsdesign gewählt:
- Befragung von grenzüberschreitend tätigen Wirtschaftsakteuren in saarländischen Unter-
nehmen,
- Auswertung von Untersuchungen zu saarländisch-lothringischen Wirtschaftsbeziehungen.
Die berücksichtigten Untersuchungen beinhalten qualitatives und quantitatives Datenmaterial,
das in der vorliegenden Arbeit systematisch aufgegriffen wird, um Konturen von Problemfel-
dern der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu zeichnen. Neben quantifizierbaren As-
pekten erweisen sich hierfür besonders Kommentare und Aussagen von Wirtschaftsakteuren
hilfreich, die in die nachfolgenden Kapitel eingebunden werden.
3.1 Standardisierte Befragung
Zur Identifikation und Analyse von interkulturellen Problemfeldern wurde eine schriftliche
Befragung bei saarländischen Unternehmen durchgeführt. Nicht- bzw. teilstandardisierte In-
terviews per Telefon oder in face-to-face Situationen schieden aus, um eine standardisierte
Datengrundlage sicherzustellen sowie um den zeitlichen Aufwand für die Unternehmen ge-
ring zu halten. Zur Durchführung der schriftlichen Befragung wurde ein Untersuchungsin-
strument zur Erhebung von quantitativen und qualitativen Daten konzipiert.
31
3.1.1 Fragebogenkonzeption Durchführung Auswertung
Die Befragung bei saarländischen Unternehmern mit Frankreichkontakt erfolgte in Zusam-
menarbeit mit der IHK Saar, Abteilung Ausbildung. Dies setzte allerdings voraus, dass der
Fragebogen sowohl Interessensfelder der IHK Saar als auch der vorliegenden Arbeit abdeckt.
Fragebogenkonzeption
Der dreiseitige Fragebogen beinhaltet insgesamt 63 Fragen. Bei der Konzeption mussten in
Absprache mit der IHK Saar bestimmte Themenbereiche ausgewählt und eingegrenzt werden,
so dass sich das vorliegende Erhebungsinstrument
109
thematisch folgendermaßen gliedert:
- Strukturmerkmale der befragten Unternehmen (Branche, Größe, Frankreichbezug, Auszu-
bildende),
- Kontaktperson (Alter, Funktion, Sprachkenntnisse, Frankreichbezug),
- Fakten bzgl. der Geschäftsbeziehungen zu Frankreich (Verhandlungs- bzw. Korrespon-
denzsprache, Kooperationshemmnisse (Normen)),
- Erfahrungen und Einschätzungen bzgl. der Geschäftsbeziehungen zu Frankreich (besonde-
re Herausforderungen, Ausbildung, Arbeitsstil, Kommunikation, Mentalität / Kultur, Per-
sönlichkeitsmerkmale, Qualität und Termintreue),
- Qualifizierungsbedarf für grenzüberschreitende Wirtschaftsaktivitäten (Recht / Administ-
ration, Berufsausbildung, Wirtschaftsentwicklung, Mentalität, Sprache),
- Wirtschaftliche Entwicklung in Saar-Lor Einschätzungen und Perspektiven (Standort
Saarland, Initiativen zur Erleichterung grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Perspekti-
ven zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit),
- Zur Situation der Auszubildenden in Unternehmen mit Frankreichkontakt (Frankreichkon-
takt, Austausch, Motivation zum Frankreichkontakt, Rahmenbedingungen).
Zur Erhebung der genannten Themenbereiche wurden Fakt- und Wissensfragen sowie Items
eingesetzt, mit denen Bewertungen bzw. Einschätzungen erhoben werden konnten. Im Frage-
bogen fanden überwiegend geschlossene Fragen Verwendung, die den Befragten Antwortal-
ternativen in Form von einfachen Sachverhalten bieten und durch einfaches sowie zeitsparen-
des Ankreuzen bearbeitet werden können (Tab. 1). Mit dieser Vorgehensweise konnten aus-
führliche Fragestellungen vermieden werden, die oft zu einer Nichtbeantwortung des gesam-
ten Fragebogens führen.
110
109
Vgl.: Anhang B 1.
110
Vgl.: Gries et al.: Ergebnisse der Befragung zum grenzüberschreitenden Qualifizierungsbedarf. 1997, S. 7.
32
Der vergleichsweise geringe Anteil an qualitativen Daten wurde mit offenen und halboffenen
Fragen erhoben (Tab. 1). Bei offenen Fragen formuliert der Befragte selbst die Antwort, was
mit einer Erinnerungsleistung und höherem Zeitaufwand verbunden ist. Eine Alternative zu
dieser Frageform stellt die halboffene Frage dar: Der Befragte wählt zwischen verschiedenen
Antwortalternativen wie bei der geschlossenen Frage, diese wird jedoch um die Kategorie
Sonstige bzw. Welche o.ä. erweitert; der Befragte ergänzt hier also qualitativ wie bei einer of-
fenen Frage.
Frageform
Anzahl im Fragebogen
geschlossene Frage
50
offene Frage
10
halboffene Frage
3
Tabelle 1: Frageformen im Fragebogen
Ferner wurden im Fragebogen Nominal- und Ordinalskalen verwendet. Aufgrund der Domi-
nanz von geschlossenen Fragen und den damit verbundenen Antwortalternativen überwiegen
Nominalskalen, die sich insbesondere zur Ermittlung von Häufigkeitsverteilungen eignen.
111
Ordinalskalen wurden zur Erhebung von Bewertungen in Form der mehrstufigen Likert-Skala
mit fünf Skalenpunkten eingesetzt.
Die Formulierung der Fragen orientierte sich an fünf zentralen Kriterien, um eine rasche und
problemlose Bearbeitung des Fragebogens sicherzustellen:
- Syntaktische Komplexität: Die Fragestellungen sollten syntaktisch so einfach wie möglich
gehalten werden, um ein rasches und richtiges Verständnis zu garantieren.
- Sprachregister: Das Sprachregister sollte dem der Befragten angepasst werden und einer
Befragungssituation angemessen sein, um Widerstände seitens der Befragten auszuschlie-
ßen.
- Semantische Eindeutigkeit: Die Fragestellungen sollten semantisch so eindeutig wie mög-
lich gehalten werden, um Missverständnisse zu vermeiden und die Adäquatheit der Ant-
worten sicherzustellen.
- Satztyp: Die Fragestellungen sollten möglichst in Form eines Aussagesatzes formuliert
werden, um Zustimmung, Ablehnung bzw. Einschätzungen in Verbindung mit vorgege-
benen Antwortmöglichkeiten mit geringem Zeitaufwand erheben zu können.
- Persönliche Identifikationsmöglichkeit: Die Fragestellungen sollten durch Formulierung
und Inhalt den Befragten Identifikationsmöglichkeiten bieten, um die Zielgruppenorientie-
rung des Fragebogens sicherzustellen.
111
Vgl.: Paulus, Christoph: Statistik. Einführung für Sozialwissenschaftler. Saarbrücken, Softfrutti Verlag, 1997,
S. 11.
33
Im Hause der IHK Saar wurde der Fragebogen in Pretest mit Blick auf die genannten Krite-
rien überprüft.
Durchführung
Zielgruppe der schriftlichen Befragung waren saarländische Unternehmen mit Frankreichkon-
takt, vornehmlich mit Geschäftsbeziehungen nach Lothringen. Die Stichprobenziehung er-
folgte mit freundlicher Unterstützung der IHK Saar, die eine Liste von 94 saarländischen Un-
ternehmen mit Geschäftsbeziehungen nach Frankreich zur Verfügung stellte.
Die Schwierigkeit bestand jedoch darin, Unternehmen ausfindig zu machen, die die Bereit-
schaft zeigten, den Fragebogen tatsächlich zu bearbeiten. Daher musste zunächst eine Aus-
wahl in der Gesamtheit aller saarländischen Unternehmen mit Frankreichkontakt getroffen
und Überzeugungsarbeit bei den Ansprechpartnern in den Unternehmen geleistet werden.
Hierbei traten folgende Probleme auf: Viele Unternehmen lehnten die Bearbeitung des Frage-
bogens aus Zeitgründen ab, andere negierten ihre Frankreichkontakte und ein Großteil der
kontaktierten Unternehmen gab an, man könne zu Kooperationshemmnissen oder Problem-
feldern der Zusammenarbeit keine Auskunft geben, da es diese nicht gäbe. Außerdem musste
von Unternehmen Abstand genommen werden, die Franzosen zur Abwicklung der Frank-
reichgeschäfte beschäftigen, da der Fragebogen zur Erhebung von Aspekten aus deutscher
Perspektive konzipiert wurde. Somit reduzierte sich die Stichprobe auf 68 saarländische Un-
ternehmen, denen der Fragebogen schließlich zugesandt wurde. Um eine möglichst hohe
Rücklaufquote zu erzielen, wurde im Begleitschreiben eine Faxnummer angegeben, an die der
Fragebogen formlos zurückgesandt werden konnte. Nach sieben Tagen war bereits ein Rück-
lauf von 14 Fragebögen zu verzeichnen. Um diese vorläufige Rücklaufquote von 20 Prozent
zu erhöhen, wurde bei den Unternehmen telefonisch nachgefasst. Die Anzahl der zurückge-
sendeten Fragebogen konnte somit auf 32 erhöht werden, was einer Rücklaufquote von 47
Prozent entspricht.
Auswertung
Die Antworten bzw. die gewonnen Daten wurden in eine SPSS-Datenmatrix überführt. Hier-
bei erwies sich die hohe Anzahl von geschlossenen Fragen als vorteilhaft, da die Antwortal-
ternativen mit geringem Zeitaufwand numerisch kodiert und erfasst werden konnten. Durch
die relativ kleine Stichprobe konnten Antworten bei offenen und halboffenen Fragen ebenso
problemlos kategorisiert und kodiert bzw. qualitativ übernommen werden.
34
Die Auswertung der aufbereiteten Daten wurde mit dem Statistikprogramm Statistical Packa-
ge fort he Social Sciences (SPSS) Version 11.0 für Windows vorgenommen; hierbei stand die
deskriptive Datenanalyse im Vordergrund. Bei der Abbildung der Untersuchungsergebnisse
werden daher keine Punktwerte von Einzelpersonen wiedergegeben, sondern Häufigkeiten
und Mittelwerte. Demzufolge kann es vorkommen, dass der Mittelwert nicht mit dem wahren
Wert eines Befragten übereinstimmt,
112
allerdings zeigt der Mittelwert Tendenzen bzw.
Trends auf und eignet sich zur Charakterisierung von Einstellungen, Erfahrungen und Fakten.
3.1.2 Stichprobenbeschreibung
113
Im Folgenden werden Strukturmerkmale der befragten Unternehmen sowie das Profil der be-
fragten Wirtschaftsakteure erläutert.
114
Befragte Unternehmen
Saarländische Unternehmen mit Frankreichkontakt waren als Zielgruppe der Befragung vor-
definiert.
- Die geographische Verteilung der 32 befragten Unternehmen zeigt, dass die Mehrzahl in
Saarbrücken ansässig ist (40,63 Prozent, n=13), gefolgt von Unternehmen in Dillingen,
Homburg und Rehlingen-Siersburg.
115
- Hinsichtlich der Branchenverteilung führt die metallverarbeitende Industrie mit 22,88
Prozent (n=7) der befragten Unternehmen, gefolgt vom Diensleistungssektor mit den Ak-
tivitäten Unternehmensberatung / Planung (12,5 Prozent, n=4), (Abb. 3).
- Zur Größe der befragten Unternehmen ist festzuhalten, dass laut KMU-Definition des
IfM
116
78,13 Prozent der Kategorie kleine und mittelständische Unternehmen zuzurechnen
sind (bis 499 Mitarbeiter). Hierbei handelt sich zu 59,38 Prozent (n=19) um mittlere Un-
ternehmen (10-499 Mitarbeiter) und zu 18,75 Prozent (n=6) um kleine Unternehmen (bis
9 Mitarbeiter). 15,63 Prozent der befragten Unternehmen (n=5) sind große Unternehmen
mit 500 und mehr Mitarbeitern.
117
112
Vgl.: Hartung, Joachim: Statistik. Lehr- und Handbuch der angewandten Statistik. München / Wien, Olden-
bourg, 1995, S. 2.
113
Die Untersuchungsergebnisse sind ausführlich im Anhang B aufgeführt.
114
Summenfehler aufgrund von Rundungen.
115
Die geographische Verteilung ist im Anhang B 2 detailliert aufgeführt.
116
Vgl.: Mittelstandsdefinition des IfM Bonn (gültig seit Juni 2002). http://www.ifm-bonn.org [Stand:
05.09.2002].
117
6,25 Prozent (n=2) machen keine Angaben.
35
0
1
2
3
4
5
6
7
(metall)verarbeitende Industrie
Unternehmensberatung/Planung
Werkzeuge
Möbel
Feinmechanik
Lebensmittel
Automobil
Elektro
Erd- und Brennstoffe
Pharmazie
Kontrollwesen
Branchen
Anzahl Unternehmen
Abbildung 3: Branchenverteilung (eigene Studie)
- Bzgl. der Rechtsformen dominieren in der vorliegenden Stichprobe GmbH's (68,75 Pro-
zent, n=22); gefolgt von GmbH & Co. KG's (15,63 Prozent, n=5) sowie Einzelunterneh-
men und Aktiengesellschaften (jeweils 6,25 Prozent, n=2).
118
- 78 Prozent der befragten Unternehmen beschäftigen Auszubildende (n=25). Hierbei han-
delt es sich um 24 deutsche, um fünf französische und um zwei Auszubildende anderer
Nationalität.
119
- Was die Art der Geschäftsbeziehung nach Frankreich betrifft, so dominieren in der Stich-
probe Handelsbeziehungen (n=21), gefolgt von Produktion (n=10), Forschung (n=5) und
Sonstige (n=4).
120
- Zum Stellenwert des Frankreichsgeschäfts ist festzuhalten, dass dieses von den saarländi-
schen Unternehmen durchschnittlich als wichtig erachtet wird (n=31), (Abb. 4). Unter-
nehmen mit Handelsbeziehungen nach Frankreich (n=21) schätzen ihre transnationale Ge-
schäftstätigkeit geringfügiger stärker als wichtig ein (Abb. 5).
118
Ein Unternehmen (3,13 Prozent) macht keine Angaben.
119
Mehrfachnennungen möglich.
120
Mehrfachnennungen möglich.
36
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Mittelwert = 1,9; n=31
sehr wichtig
unwichtig
Abbildung 4: Bewertung des Frankreichgeschäfts (gesamte Stichprobe, eigene Studie)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Mittelwert = 1,8; n=21
sehr wichtig
unwichtig
Abbildung 5: Bewertung des Frankreichgeschäfts (Unternehmen mit Handelsbeziehungen, eigene Studie)
Wirtschaftsakteure
- Zur Altersverteilung der befragten Wirtschaftsakteure ist festzuhalten, dass diese über-
wiegend 30 bis 39 Jahre alt sind (47 Prozent, n=15), gefolgt von 25 Prozent, die der Kate-
gorie 40-49 Jahre (n=8) sowie 16 Prozent, die der Altersklasse 50-59 Jahre (n=5) zuzu-
ordnen sind. Die jüngste (22-29 Jahre) und die älteste Alterskategorie (über 60 Jahre) ist
jeweils mit 6 Prozent (n=2) vertreten.
- Bei Betrachtung der hierarchischen Stellung im Unternehmen sowie des Tätigkeitsbe-
reichs wird deutlich, dass die Bearbeitung des Fragebogens überwiegend von Geschäfts-
inhabern bzw. -führern vorgenommen wurde. Sie bilden 31 Prozent (n=10) der Grundge-
samtheit, gefolgt von 28 Prozent (n=9) derjenigen, die leitende Funktionen begleiten im
Export, Vertrieb, Marketing und Einkauf. 21 Prozent (n=7) geben an, auf der ausführen-
den Ebene im Bereich Export und Einkauf tätig zu sein.
121
3.2. Studienauswertung
Neben der oben beschriebenen Befragung wurde eine Auswertung von Studien vorgenom-
men, in denen saarländisch-lothringische Wirtschaftsbeziehungen behandelt werden. Da bis-
her sehr wenig und insbesondere unter Berücksichtigung kultureller Aspekte zu saarländisch-
lothringischen Wirtschaftsbeziehungen wissenschaftlich geforscht und publiziert wurde,
konnten bei der Studienauswertung nur Untersuchungen herangezogen werden, die von den
jeweiligen Institutionen bzw. Autoren nicht oder nur mit geringer Auflage publiziert wurden.
121
18 Prozent (n=6) der befragten Wirtschaftsakteure machen keine Angaben.
37
3.2.1 Studienprofile
Die nachstehenden Profile der berücksichtigten Studien beinhalten Angaben zum Zeitpunkt
der Durchführung, zur Datengrundlage, zur Methodik sowie zu den behandelten Themenbe-
reichen. Die für die vorliegende Arbeit relevanten Studienergebnisse werden in den nachfol-
genden Kapiteln genannt.
Interkulturelle Qualifikationen im deutsch-französischen Management
Die 1995 von Christoph I. Barmeyer unter Leitung von Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüsebrink
durchgeführte Studie zeigt die Bedeutung von interkultureller Kompetenz auf am Beispiel des
grenzüberschreitenden Arbeitsalltags kleiner- und mittelständischer Unternehmen im Saar-
land und in Lothringen. Hierfür wurden empirischen Daten in Interviews mit 15 deutschen
und 15 französischen Handwerkern unterschiedlichster Hierarchiestufen aus lothringischen,
saarländischen und pfälzischen Betrieben erhoben und durch wissenschaftliche Literatur er-
gänzt. Die Daten werden kontrastiv gegenübergestellt und Themen wie Kommunikation,
Landeskunde, Mentalität, Arbeitsstil/Management sowie Synergiepotentiale im deutsch-
französischen Arbeitsalltag werden mit Blick auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
erläutert.
122
Bedarf an Französischkenntnissen in der Wirtschaft
Zentrales Thema der von der IHK Saar im Jahr 1995 durchgeführten Studie sind Fremdspra-
chen- bzw. Französischkenntnisse von deutschen bzw. saarländischen Wirtschaftsakteuren.
An der standardisierten Befragung sind insgesamt 64 saarländische Betriebe mit ca. 21.000
Mitarbeitern beteiligt. Die erhobenen Daten wurden freundlicherweise von der IHK des Saar-
landes für die vorliegende Arbeit zur Verfügung gestellt. Folgende Aspekte werden in der Un-
tersuchung erhoben: Fremdsprachenbedarf, Qualität der Fremdsprachenkenntnisse, Fremd-
sprachenkenntnisse nach Mitarbeitergruppen, Französischkenntnisse von Auszubildenden und
Fremdsprachenbedarf nach Tätigkeitsbereichen. Ferner wird eine Bedarfsanalyse zu frank-
reichbezogenen Qualifikationen sowie eine Prognose zum zukünftigen Bedarf an Frankreich-
qualifikation in den befragten Betrieben vorgenommen.
123
122
Vgl.: Barmeyer: Interkulturelle Qualifikationen. 1996
123
Vgl.: Industrie- und Handelskammer des Saarlandes: Auswertung des Fragebogens zum Bedarf an französi-
schen Sprachkenntnissen in der Wirtschaft. Saarbrücken, 1995, (nicht veröffentlicht). Und: Götzinger, Hermann:
,,In saarländischen Unternehmen: Das französische gewinnt zunehmend an Bedeutung". In: Sprachenrat Saar:
Fremdsprachen. 1996, S. 12-14.
38
Arbeitsmarkt und Abbau administrativer Hemmnisse der interregionalen Zusammenarbeit
In dem 1996 erstellten Kurzbericht werden die Ergebnisse eines Gutachtens vom Institut für
Entwicklungsforschung, Wirtschafts- und Sozialplanung ISOPLAN zur Vorbereitung des
zweiten Gipfeltreffens der Großregion
124
dargestellt. Neben einer Bestandsaufnahme der Ar-
beitsmarktsituation und der Verflechtungen der regionalen Teilarbeitsmärkte gibt der Bericht
Analysen zum Abbau administrativer Hemmnisse bei grenzüberschreitender unternehmeri-
scher Tätigkeit im SaarLorLux-Raum wieder. Hierbei stehen besonders die Zugangsprobleme
kleiner und mittelständischer Unternehmen auf die Märkte der Nachbarregion im Mittelpunkt.
Die Daten werden aus Dokumentenanalysen, Gesprächen mit Vertretern von Gebietskörper-
schaften, Kammern, Verbänden und anderen Institutionen gewonnen. Für den Bereich admi-
nistrative Hemmnisse ist hervorzuheben, dass zahlreiche Expertengespräche im SaarLorLux-
Raum mit Vertretern von Kammern und Verbänden sowie schriftliche Befragungen in 444 re-
levanten Einrichtungen und Gebietskörperschaften stattfanden.
125
Frankreichbezüge und grenzüberschreitender Qualifizierungsbedarf im Saarland
In der 1996 im Rahmen von EURES Transfrontalier Lothringen-Saarland durchgeführten
Studie werden Frankreichorientierungen und grenzüberschreitender Qualifizierungsbedarf
kleiner und mittelständischer Unternehmen im Saarland ermittelt. Die empirische Erhebung
erfolgte mit einem standardisierten Fragebogen und ergab eine Datengrundlage auf der Basis
von 431 bearbeiteten Fragebögen aus saarländischen Unternehmen unterschiedlichster Wirt-
schaftszweige. Die Spanne der genannten Problemfelder deutsch-französischer Wirtschafts-
kooperation reicht von Sprachproblemen über Verschiedenheit der Rechtssysteme und Infor-
mationsdefizite bis hin zu kulturellen Verschiedenheiten. Hinsichtlich des Qualifizierungsbe-
darfs in den Unternehmen kristallisieren sich ein allgemeiner Qualifizierungsbedarf sowie ein
grenzüberschreitender Qualifizierungsbedarf heraus. Hierbei wird festgestellt, dass Rechts-
fragen im Allgemeinen für die Unternehmen weniger relevant aber in Bezug auf Frankreich
von erheblicher Bedeutung sind.
126
124
Weiterführend: http://www.grossregion.org [Stand: 02.12.2002].
125
Vgl.: Institut für Entwicklungsforschung, Wirtschafts- und Sozialplanung GmbH Isoplan: Arbeitsmarkt, sozi-
aler Dialog und Abbau administrativer Hemmnisse der interregionalen Zusammenarbeit in der Region Saar-
Lor-Lux-Trier/Westpfalz sowie der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Analyse und Empfehlungen zur
Vorbereitung des 2. Gipfeltreffens der Großregion am 7. November 1996 in Saarbrücken. (Im Auftrag des Chefs
der Staatskanzlei, gefördert aus Mitteln der Europäischen Kommission (Gemeinschaftsinitiative INTERREG II)
mit finanzieller Unterstützung durch das Land Rheinland-Pfalz, das Großherzogtum Luxemburg, die Region
Lothringen, das Departement Moselle sowie Meurthe-et-Moselle, die Region Wallonien sowie die Deutschspra-
chige Gemeinschaft Belgiens), Saarbrücken, 1996 (nicht veröffentlicht).
126
Vgl.: Gries et al.: Ergebnisse der Befragung zum grenzüberschreitenden Qualifizierungsbedarf. 1997.
39
Zur interkulturellen Kommunikation im Handwerk
Die von Christoph I. Barmeyer und Mitarbeitern durchgeführte und in 2000 publizierte Studie
rückt grenzüberschreitend tätige Handwerker in den Blick. Untersuchungsobjekte sind Hand-
werksunternehmen der Bau- und Ausbaubranche im Saarland und in Lothringen mit Erfah-
rungen im Frankreichgeschäft. Zur Identifizierung von Kooperations- und Kommunikations-
barrieren beim Grenzübertritt wurden qualitative und quantitative Daten durch Dokumenten-
analysen, schriftliche Befragungen, Interviews und teilnehmende Beobachtungen erhoben.
Bei der Befragung wurden 32 Betriebe in Frankreich und 83 Betriebe in Deutschland einbe-
zogen. Barmeyer untersucht die Themenbereiche Sprache, Kultur, rechtlich-normative Rah-
menbedingungen und Wissensdefizite der Wirtschaftsakteure und illustriert diese durch ge-
sellschaftliche Spezifika in Deutschland und Frankreich.
127
Interkulturelle Handlungskompetenz als zukunftorientierter Wirtschaftsfaktor (CIFA)
128
Im Rahmen des Interreg II-Projekts mit dem obigen Namen wurde im Jahr 2001 eine Studie
durchgeführt, die neben Erfahrungen und Einschätzungen zur grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit Unterschiede im Management und Arbeitsstil in Deutschland und Frankreich be-
handelt. 42 Unternehmer und leitende Angestellte in KMU's nahmen an der schriftlichen Be-
fragung im Saarland, in Lothringen und in der Westpfalz teil: 25 Deutsche und 17 Franzosen.
Zu berücksichtigen ist, dass die Stichprobe von Absolventen eines deutsch-französischen Stu-
diengangs mit integriertem Auslandsaufenthalt gebildet wird und die Befragten daher a priori
eine gewisse kulturelle Sensibilität aufweisen, die sich in den Untersuchungsergebnissen wi-
derspiegelt.
129
Europäische Dienstleistungen im Rahmen der Eurozone
Die im Jahr 2001 von Krewer und Kuntz erstellte Machbarkeitsstudie zu Europäischen
Dienstleistungen im Rahmen der Eurozone gibt eine Bestandsanalyse zur grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit wieder und identifiziert Problemfelder bzw. Hindernisse grenzüber-
schreitender unternehmerischer Tätigkeit. Als Datengrundlage dienen die Kommentare und
Antworten aus 43 strukturierten Telefoninterviews mit saarländischen (Berufs)Verbänden
bzw. Organisationen/Kammern sowie aus Interviews mit 80 Unternehmen und elf Verbänden
(Kammern, Vereinigungen, Gewerkschaften) auf lothringischer Seite. Neben einer Vielzahl
127
Vgl.: Barmeyer: Mentalitätsunterschiede. 2000.
128
CIFA steht für Compétence interculturelle franco-allemande und gibt den französischen Projektnamen wie-
der.
129
Vgl.: Compétence interculturelle franco-allemande (CIFA): Arbeitspapiere. Auswertung der Umfrage bei
kleinen und mittelständischen Unternehmen im Saarland, Lothringen und der Westpfalz. Interreg II-Projekt: In-
terkulturelle Handlungskompetenz als zukunftsorientierter Wirtschaftsfaktor, Saarbrücken, 2001, (nicht veröf-
fentlicht).
40
an Aspekten zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kommen Krewer und Kuntz für die
saarländische Seite zu dem Ergebnis, dass die Qualität des grenzüberschreitenden Kontakts
für die Mehrzahl der Verbandsmitglieder keinen idealtypischen Zustand darstellt. Problemfel-
der werden insbesondere in den Bereichen Recht, Sprache, kulturelle Differenzen sowie Lan-
des- und Marktkenntnisse gesehen.
130
Aufgrund der methodischen Vielgestaltigkeit der genannten Untersuchungen ist ein Vergleich
der Ergebnisse nur bedingt möglich. Jedoch können zentrale Überschneidungsbereiche he-
rausgegriffen und anhand der quantitativen sowie qualitativen Daten allgemeine Tendenzen
aufgezeigt werden.
3.2.2 Überschneidungsbereiche Synoptischer Überblick
Die o.g. Untersuchungen weisen für die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit relevante
thematische Überschneidungen auf, die in Abb. 6 in einer synoptischen Übersicht abgebildet
werden.
131
Studien
Überschneidungsbereiche
ei
g
ene
S
tudi
e
2002
K
re
w
er
/
K
unt
z
2001
C
IF
A
2001
B
ar
m
ey
er
2000
G
ri
es
e
t a
l. (
IF
B
)
1997
Is
opl
an 1996
B
ar
m
ey
er
1996
IH
K
S
aa
r 1995
Perspektiven grenzüberschreitender Wirtschaftstätigkeit
Herausforderungen im Frankreichgeschäft /
Hemmnisse grenzüberschreitender Zusammenarbeit
Problemfeld: Rechtsvorschriften
Problemfeld: Qualität und Termintreue
Verhandlungs- und Korrespondenzsprache
Französischkenntnisse von Wirtschaftsakteuren
Stellenwert der französischen Sprache bei der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Französischkompetenz bzw. bedarf nach Tätigkeitsbe-
reich, Mitarbeitergruppe und Hierarchieebene
Deutsch-französische Kommunikation(ssituationen)
Deutscher und französischer Arbeitsstil
Deutsche und französische Berufsausbildung
Frankreichorientierter / interkultureller
Qualifizierungsbedarf
Frankreichkontakt während der Berufsausbildung
= Themenbereich wird in den Studien berücksichtigt
Abbildung 6: Thematische Überschneidungsbereiche der berücksichtigten Untersuchungen
130
Vgl.: Krewer / Kuntz: Machbarkeitsstudie. 2001.
131
Die eigene Studie ist in Abb. 6 integriert, um die Komplementarität des vorliegenden zweidimensionalen Un-
tersuchungsdesigns zu verdeutlichen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832470791
- ISBN (Paperback)
- 9783838670799
- Dateigröße
- 5.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität des Saarlandes – Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- interkulturalität zusammenarbeit kompetenz europa
- Produktsicherheit
- Diplom.de