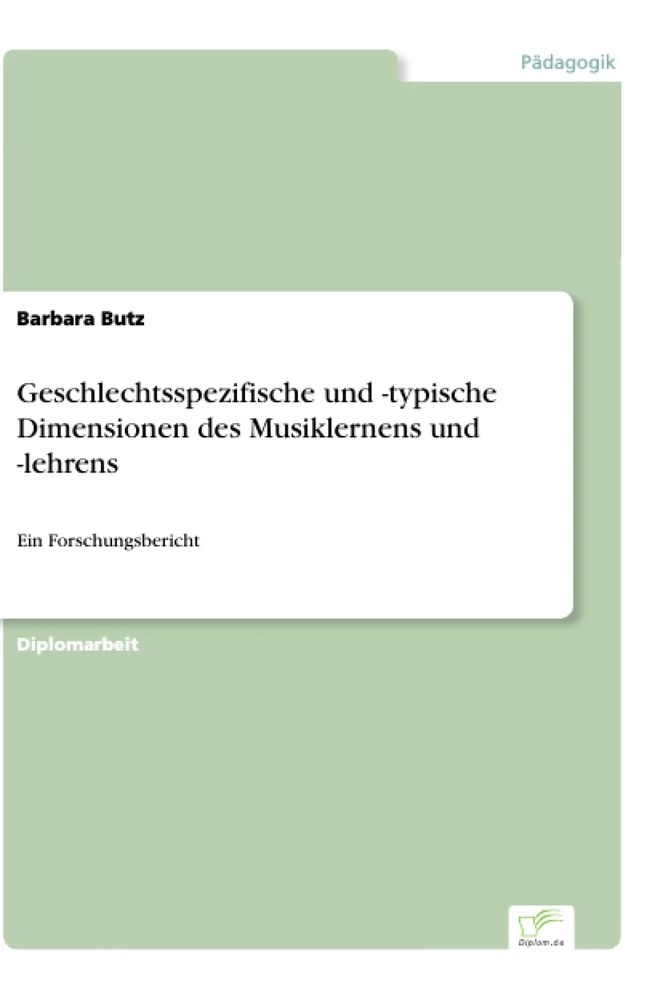Geschlechtsspezifische und -typische Dimensionen des Musiklernens und -lehrens
Ein Forschungsbericht
Zusammenfassung
Brave Mädchen kommen deswegen in den Himmel, weil sie gelernt haben, sich selbst daran zu hindern, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Mädchen, die Spaß haben wollen, sind die bösen Mädchen. Böse Mädchen gehen souverän damit um, dass andere hin und wieder böse auf sie sind, weil sie nicht tun, was man von ihnen erwartet, beispielsweise nachgeben. Oder weil sie tun, was man nicht von ihnen erwartet, beispielsweise an sich selbst denken (Ute Ehrhardt 1994).
Dieser Beginn meiner Arbeit mag recht provokativ wirken, aber genau dieses Phänomen hat mich dazu bewegt, der Unterschiedlichkeit von Jungen und Mädchen, von Männern und Frauen, näher auf den Grund zu gehen. Besonders interessant schien mir dies auf dem Gebiet des Musiklernens zu sein, da sich mir aufgrund bestimmter Phänomene verschiedene Frage stellten. Wie kommt es zur sichtbaren Dominanz von Männern in heutigen Orchestern, obwohl es keine offiziellen Restriktionen mehr gegen Frauen gibt? Wie lässt sich dies vereinbaren mit der Tatsache, dass das zahlenmäßige Verhältnis von Musikstudenten/-innen qua Geschlecht weitgehend ausgeglichen ist, an Musikschulen gar deutlich mehr Mädchen als Jungen unterrichtet werden?
Abgesehen von diesen trivialen Feststellungen habe ich mir die Frage gestellt, ob geschlechtstypische Verhaltensweisen und Eigenarten einen Einfluss auf Musiklernen darstellen. Was sind sie überhaupt, diese typisch männlichen und typisch weiblichen Eigenschaften und worin liegen sie begründet? Lernen Jungen anders als Mädchen?
Unter Geschlechtsspezifik versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch Merkmale, die typisch für das eine oder andere Geschlecht sind. Da die ursprüngliche Wortbedeutung von spezifisch jedoch eine andere ist, möchte ich eine Unterscheidung treffen. Spezifisch ist ein Merkmal, wenn es zum Wesen einer Person, Sache oder eines Stoffes gehört und diesen allein eigen ist (Brockhaus 1998). Die englische Sprache differenziert diesbezüglich, indem gender für kulturelles und soziales Geschlecht und sex für biologisches Geschlecht steht. Aus diesen Gründen möchte ich von Geschlechtsspezifik nur sprechen, wenn es sich um tatsächliche weibliche bzw. männliche Merkmale handelt. Konsequenterweise musste der Titel der Arbeit also um den Begriff der Geschlechtstypik erweitert werden.
Zum Schrifttum zählen musikpädagogische Zeitschriften und Forschungsberichte sowie Veröffentlichungen von Artikeln und Monographien aus den […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
1. Einleitung
1.1 Interesse und Fragenhorizont
1.2 Terminologie, Schrifttum und Verfahren
2. Theorien zur Geschlechtstypik/ -spezifik
2.1 Historische Hintergründe
2.2 Biologische Theorien
2.3 Soziologische Theorien
2.4 Psychologische Theorien
3. Musiklernen
3.1 Soziologische Aspekte
3.1.1 Elternhaus und familiäre Förderung
3.1.2 Peers
3.1.3 Medien (Videoclips) 38 3.1.4 Präferenzen
3.1.5 Lehrende, Schule, Unterrichtsmaterialien
3.2 Psychologische Aspekte
3.2.1 Wahrnehmung
3.2.2 Motivation
3.2.3 Die Intelligenz der Feldunabhängigkeit und räumlichen Begabung
3.2.4 Kreativität
3.2.5 Ausdrucksfähigkeit
3.3 Musikbezogene Handlungsweisen
3.3.1 Komponieren
3.3.2 Musikalische Reproduktion im Allgemeinen
3.3.3 Singen
3.3.4 Instrumentenwahl
3.3.5 Üben
3.3.6 Umgang mit neuen Medien
3.3.7 Dirigieren
4. Bilanz und Perspektiven 62
Literaturverzeichnis
Vorwort
Zur Entstehung dieser Arbeit haben folgende Personen mit beigetragen, denen ich herzlich für ihre Unterstützung während der letzten drei Monate danken möchte:
Herrn Prof. Dr. Peter W. Schatt für die Betreuung der Arbeit,
Herrn Prof. Till Engel für das Verständnis, das er meinem chronischen Zeit- und Kraftmangel hinsichtlich des Klavierspiels entgegenbrachte,
Frau Prof. Dr. Ursula Eckart-Bäcker, Frau Cornelia Ermold, Herrn Prof. Dr. Heiner Gembris, Herrn Chris Goodwin, Herrn Prof. Dr. W. Gruhn, Frau Prof. Dr. Marianne Hassler, Frau Katharina Herwig, Frau Prof. Dr. Eva Rieger, Frau E. Smith, Frau Andrea Stapper, Herrn Dr. Jan W. van Strien, Herrn Prof. Dr. Wolfgang-Martin Stroh und Frau Dr. Anke Westphal für die Übersendung von Manuskripten bzw. Hinweise auf themenrelevante Literatur,
Frau Solveig Dorsch, Frau Konstanze Ebel, Frau Mareike Franken, Frau Kathrin Münscher, Familie Bohnen und meinen Eltern für die freundschaftliche und emotionale Unterstützung,
Herrn Alexander Butz, Herrn Dr. Wofgang Butz, Herrn Gerard van der Wel und ganz besonders Frau Christina Giese für ihre inhaltlichen Anregungen und Korrekturen,
Herrn Jochen Butz und Herrn Sebastian Butz für ihre Hilfsbereitschaft beim „letzten Schliff“,
sowie Herrn Georg Friedrich Händel, der mich mit seinem letzten Oratorium „Jephtha“ unermüdlich musikalisch begleitete.
Meinen herzlichen Dank!
Essen, den 11. Mai 1999 Barbara Butz
1. Einleitung
1.1 Interesse und Fragenhorizont
„Brave Mädchen kommen deswegen in den Himmel, weil sie gelernt haben, sich selbst daran zu hindern, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Mädchen, die Spaß haben wollen, sind die bösen Mädchen. Böse Mädchen gehen souverän damit um, daß andere hin und wieder böse auf sie sind, weil sie nicht tun, was man von ihnen erwartet, beispielsweise nachgeben. Oder weil sie tun, was man nicht von ihnen erwartet, beispielsweise an sich selbst denken.“ (Ute Ehrhardt 1994)
Dieser Beginn meiner Arbeit mag recht provokativ wirken, aber genau dieses Phänomen hat mich dazu bewegt, der Unterschiedlichkeit von Jungen und Mädchen, von Männern und Frauen, näher auf den Grund zu gehen. Besonders interessant schien mir dies auf dem Gebiet des Musiklernens zu sein, da sich mir aufgrund bestimmter Phänomene verschiedene Frage stellten. Wie kommt es zur sichtbaren Dominanz von Männern in heutigen Orchestern, obwohl es keine offiziellen Restriktionen mehr gegen Frauen gibt[1] ? Wie läßt sich dies vereinbaren mit der Tatsache, daß das zahlenmäßige Verhältnis von Musikstudenten/-innen qua Geschlecht weitgehend ausgeglichen ist[2], an Musikschulen gar deutlich mehr Mädchen als Jungen unterrichtet werden[3] ? Andererseits ist zu beobachten, daß Gesangklassen an Musikhochschulen einen signifikant höheren Frauenanteil aufweisen und Chöre an „chronischem Männer-Mangel“ leiden. Des Weiteren findet man äußerst selten Dirigentinnen auf den Podien der Konzertsäle und die Vornamen der Komponisten/-innen in den Konzertprogrammen sind vorwiegend männliche.
Abgesehen von diesen trivialen Feststellungen habe ich mir die Frage gestellt, ob geschlechtstypische Verhaltensweisen und Eigenarten einen Einfluß auf Musiklernen darstellen[4]. Was sind sie überhaupt, diese „typisch männlichen“ und „typisch weiblichen“ Eigenschaften und worin liegen sie begründet? Lernen Jungen „anders“ als Mädchen?
1. 2 Terminolgie, Schrifttum und Vorgehensweise
Unter „Geschlechtsspezifik“ versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch Merkmale, die typisch für das eine oder andere Geschlecht sind. Da die ursprüngliche Wortbedeutung von „spezifisch“ jedoch eine andere ist, möchte ich eine Unterscheidung treffen. „Spezifisch“ ist ein Merkmal, wenn es „zum Wesen einer Person, Sache oder eines Stoffes gehört und diesen allein eigen ist“ (Brockhaus 1998). Die englische Sprache differenziert diesbezüglich, indem „gender“ für kulturelles und soziales Geschlecht und „sex“ für biologisches Geschlecht steht. Aus diesen Gründen möchte ich von Geschlechtsspezifik nur sprechen, wenn es sich um tatsächliche weibliche bzw. männliche Merkmale handelt. Konsequenterweise mußte der Titel der Arbeit also um den Begriff der „Geschlechtstypik“ erweitert werden.
Zum Schrifttum zählen musikpädagogische Zeitschriften und Forschungsberichte[5] sowie Veröffentlichungen von Artikeln und Monographien aus den Bereichen Pädagogik, Soziologie, Psychologie und Medizin (bes. Neurobiologie). Im Internet finden sich zu allen Teilbereichen „abstracts“, die von Forschungsergebnissen und -prozessen berichten und auf Organe verweisen, in denen die dazugehörigen Artikel publiziert sind. Zahlreiche Ergebnisse gibt es in Subtests von Untersuchungen, die sich mit entfernteren Themen beschäftigen, die Variable „Geschlecht“ jedoch mehr oder weniger mit einbeziehen.
Da die Forschungslage sich als eher kärglich erwies, habe ich Autorinnen und Autoren, die bereits im Gebiet der „geschlechtsspezifischen Dimensionen des Musiklernens“ geforscht oder veröffentlicht hatten, angeschrieben und nach neueren Studien gefragt. Die freundlichen Antworten, die ich erhielt, gaben jedoch fast ausnahmslos keinen positiven Ausblick: größtenteils hatte man nicht weitergeforscht und einhellig verkündete man mir, daß sich in der Tat äußerst wenig Literatur zum Thema finden ließe.
Man darf also daraus schließen, daß es keinen Forschungstrend in Richtung geschlechtstypischer/-spezifischer Aspekte des Musiklernens gibt, da seit der AMPF-Tagung 1995 nur wenige diesbezügliche Arbeiten zu verzeichnen sind[6]. Im September 1999 soll in Schweden eine Konferenz zu diesem Thema stattfinden; mit Spannung ist zu erwarten, ob es neue Forschungsansätze oder gar einen Aufwärtstrend in der Musikpädagogik geben wird, der sich mit der Thematik des geschlechtstypischen/-spezifischen Musiklernens befaßt. In vielen anderen pädagogischen Bereichen ist derzeit ein starkes Interesse an der Geschlechterforschung zu beobachten.
Ich ziehe also zunächst außermusikalische Theorien zur Geschlechtstypik/-spezifik heran, welche ich am Ende daraufhin prüfen werde, ob sie Übertragungsmöglichkeiten auf das Gebiet des Musiklernens bieten. Zuvor soll jedoch dem allgemeinen (= nicht geschlechtsspezifischen/-typischen) Musiklernen ein breiterer Raum eingeräumt werden, da eine meiner Fragen sich ja auf die Art und Weise des Musiklernens bezog. Ich gehe dann auf diejenigen soziologischen und psychologischen Aspekte und diejenigen musikbezogenen Handlungsweisen ein, die im Hinblick auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern eine Rolle spielen bzw. näher erforscht worden sind und hebe in meinen Schlußbetrachtungen solche hervor, die meiner Meinung nach aus musikpädagogischer Sicht näherer Betrachtung bzw. weiterer Forschung bedürfen.
2. Theorien zur Geschlechtsspezifik/-typik
2.1 Historische und anthropologische Sichtweisen
„Die allgemeine Bewußtseinsgeschichte kann ja heute –durchaus unpolemisch- als eine Bildungsgeschichte männlichen Bewußtseins gesehen werden, das sich von Anfang an als allgemeinmenschliches verstanden hat.“ (Hanna-Barbara Gerl 1989)
Angesichts dieser Tatsache verwundert es nicht, daß in Abhandlungen über unterschiedliche Erwartungen an Männer und Frauen entweder eine androzentrische Sichtweise vorherrscht, nämlich dann, wenn es sich um einen Autoren handelt, oder umgekehrt, wenn durch einen (zum Teil extrem) feministischen Hintergrund ein ebenso wenig objektiver Schreibstil einer Autorin vorzufinden ist.
Eine große Ausnahme bildet zunächst Pythagoras´ Geheimschule. Vor dem Hintergrund der Verbindung Weiblichkeit – Emotionalität ist sein ganzheitliches Menschenbild ein durchaus revolutionärer Vorstoß: Er sieht eine Einheit von Theorie und (Lebens-)Praxis unter Einbeziehung des Empfindens (musikalisch und sonstig sinnlich) und der Intuition. Laut Johannes Heinrichs wird dieses Konzept aber bald unterdrückt (Heinrichs 1989, S.222). Andererseits existiert die Pythagoreische Antagonismuslehre, die aber im Widerspruch zum zuvor genannten Ansatz steht: Hier wird in einer Gegenüberstellung von zehn Gegensatzpaaren in der Reihe des Vollkommenen das Männliche, in der Reihe des Unvollkommenen das Weibliche angeführt (Susanne Schunter-Kleemann 1990, S. 318).
Ein ähnliches Paradoxon findet sich bei Plato. In einem zur Veranschaulichung seiner Theorie des Eros dienenden Mythos zeichnet er ein Bild von Mann und Frau, welches keinerlei Hierarchie in sich birgt, sondern durchaus moderne Züge trägt (zum Beispiel in bezug auf die gleichgeschlechtliche Liebe)[7]. Hierzu im Widerspruch stehend werden in Platons Timaios die Frauen als Abfallprodukt degenerierter Männer gesehen. Sie sind nicht der Menschen- sondern der Tierwelt zugeordnet und entspringen einer „göttlichen Strafmetamorphose an Männern, die entweder „Feiglinge“ waren oder ihr Leben auf ungerechte Weise verbrachten“ (vgl. Schunter-Kleemann 1990, S. 318).
Auch bei Aristoteles wird der Frau keine besondere Ehre zuteil, wird sie doch als „verunglückter Mann“ und ihre physische Eigenart „als eine Art Mangelbildung, als etwas, dem es an Vollkommenheit fehlt“ angesehen (ebd.).
In der christlichen Lehre begegnet man ebenfalls einem Widerspruch: Einerseits wird die Frau zur Heiligen verklärt, andererseits wird ihr durch den Sündenfall Evas das Leid der Menschheit angelastet. Hier kommt es meines Erachtens stark auf die Auslegungsweise an (vgl. hierzu auch Klaus Kürzdörfer 1991).
Zur Entstehung des Menschen findet man zwei voneinander differierende Fassungen; Im ersten Kapitel der Genesis heißt es schlicht: „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau; Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen...“ In der jahwistischen Schöpfungsgeschichte wird Eva aus Adams Rippe erschaffen, was zumeist als Zeichen für die Unterdrückung der Frau gedeutet wird. Allerdings läßt sich auch diese „Szene“ aus einem anderen Blickwinkel betrachten; so weist Kürzdörfer auf die Interpretation des jüdischen Auslegers Lapide hin, der in der Frau die „Krone der Schöpfung“ sieht, weil sie als letztes Lebewesen geschaffen worden sei und sich vom Regenwurm über Säugetiere der Aufstieg bis zum Menschen vollziehe. Außerdem, und dies in Anlehnung an Ausleger/innen des Talmuds, sei die Frau deshalb aus der Seite (und nicht aus den Füßen oder aus dem Kopf) des Mannes erschaffen worden, um seine „gleichberechtigte Gefährtin“ zu werden (vgl. Kürzdörfer 1991, S. 26f.)
Thomas von Aquin leitet aus der „biologischen Verstümmelung“ der Frau, „ihrem ´Feuchtigkeitsüberschuß´ und ihrer ‘Untertemperatur´ ihre geistige Unzulänglichkeit ab“ (ebd.)
Den absoluten Kulminationspunkt patriarchalischer Oberherrschaft, in diesem Fall der Kirche und der (sexistischen) Unterdrückung der Frau, bilden dann die mittelalterlichen ‘Hexen’verfolgungen. An deren Ende stehen gravierende gesellschaftliche Nachteile für die Frau: Sie kann (zum Beispiel als Unverheiratete) niemals zu Selbständigkeit gelangen, da Einrichtungen wie Beginen-, Dirnen- und Frauenhäuser vielfach aufgelöst werden; somit bleibt eine unverheiratete Frau auf eine „abhängige Familienexistenz“ angewiesen (ebd.).
In der Epoche der Aufklärung lassen sich zahlreiche ergänzungstheoretische Auffassungen erkennen. Die Frau wird ihrem Wesen gemäß als Gegenpol und natürliche Ergänzung zum Mann gesehen. Ihre Aufgaben werden nicht als Arbeit bezeichnet, sondern als unmittelbar ihrem Trieb- und Gefühlsleben entspringende Notwendigkeiten.
Durch die aufkommenden Bilder von männlicher und weiblicher Polarität wird die Welt in aktiv-welterobernd (=männlich) und passiv-weltbewahrend (=weiblich) eingeteilt. Bei Rousseau zum Beispiel wird das Gesetz der Natur herangezogen, welches die Frauen dazu bestimmt, in völliger Abhängigkeit vom Mann zu leben: „...sie müssen beizeiten an Zwang gewöhnt werden. Dieses Unglück, wenn es für sie eines ist, ist vom Geschlecht untrennbar und sie befreien sich niemals davon, ohne noch grausameres Unglück zu erdulden... Man muß sie gleich anfangs üben, sich Zwang anzutun, damit es sie niemals schwer ankomme, alle ihre Launen zu bezähmen, um sie dem Willen anderer zu unterwerfen.“ (Rousseau, zit.n. ebd.; S. 319)
Bei Immanuel Kant gibt es eine deutliche Geschlechtertrennung; die Aufgabe der Frau liegt nicht auf intellektuellem Gebiet. Die Polarität liegt hier in den Attributen „wahrhaftig-kühn-erhaben“ und „schön-listig-eitel“ (ebd., S.320) Die einzige „Macht“ der Frau über den Mann bleibt ihre erotische Ausstrahlung, während alle übrige Macht dem männlichen Geschlecht zu eigen ist. Demnach kommt der Frau auch kein Stimmrecht zu, Voraussetzung hierfür ist die Selbständigkeit: „Die dazu erforderliche Qualität ist, außer der natürlichen (daß es kein Kind, kein Weib sei), die einzige, daß er sein eigener Herr sei, mithin irgendein Eigentum habe..., welches ihn ernährt.“ (Kant „Vom Verhältnis der Theorie zur Praxis im Staatsrecht“; zit.n. Hirsch 1991)
Bei Johann Gottlieb Fichte ist das Wesen der Frau, ihr angeborener Charakter ausschlaggebend für ihre „Funktion“ und Aufgaben. Sie ist „zum Leiden auserkoren“, für Passivität und Zweitrangigkeit prädestiniert (vgl. ebd.).
Einhergehend mit der Französischen Revolution werden auch vermehrt emanzipatorische Ideen verbreitet. Allerdings kritisiert Charles Fourier (1808), daß die emanzipatorischen Bemühungen der Französischen Revolution zwar auf vielen Gebieten fruchtbar gewesen seien, man aber an der Stellung der Frau nur wenig verändert habe. Als Ausdruck hierfür sieht er die Institution der Ehe, die es seines Erachtens aufzuheben galt (ebd., S. 323).
Zuvor hatte es revolutionäre Forderungen und Entlarvungen z.B. von Marie Condorcet (1789) oder Olympe de Gouges (1791) gegeben. Erstmals wurde öffentlich die patriarchalische Hierarchie angeklagt, wurden sämtliche Rollenerwartungen an die Frau gesellschaftlichen Strukturen angelastet, wurde gegen das Anführen vom „natürlich Weiblichen“ als Legitimation für Unterdrückung protestiert. So findet man bei Schunter-Kleemann einen Verweis auf Mary Wollstonecraft (1792), die schrieb, „wer die weibliche Erziehung betrachte, könne sich nicht wundern, daß Frauen unselbständig urteilen und zu blindem Autoritätsglauben neigten“ (ebd., S. 321). Unmißverständlich wird im Folgenden die unbedingte wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau vom Mann postuliert.
Ein Blick auf die Inhalte der emanzipatorischen Bewegung unseres Jahrhunderts, die ihren Höhepunkt in den 60-er Jahren fand, zeigt, wie lang und mühsam der Weg hin zu Verwirklichungen dieser Forderungen war und ist. Viele Jahrhunderte patriarchalischer Herrschaft, Philosophie und Lebensweise haben ihre Spuren hinterlassen und sind eben auch nicht in 200 Jahren „einfach“ auszulöschen.
Seit den emanzipatorischen Kämpfen Ende des 18. Jahrhunderts gab es noch zahlreiche „Versuche“, eine Minderwertigkeit der Frau zu manifestieren. So zum Beispiel Arthur Schopenhauer (1851): „Je edler und vollkommener eine Sache, desto später und langsamer gelangt sie zur Reife. Der Mann erlangt die Reife seiner Vernunft- und Geisteskräfte kaum vor dem 28. Jahr, das Weib mit dem 18. Aber es ist auch eine Vernunft danach: eine knapp gemessene. Daher bleiben die Weiber ihr Leben lang Kinder, sie sehen immer nur das Nächste, leben in der Gegenwart, nehmen den Schein der Dinge für die Sache und ziehen Kleinigkeiten den wichtigsten Angelegenheiten vor. Die Vernunft nämlich ist es, vermöge derer der Mensch nicht, wie das Tier, bloß in der Gegenwart lebt, sondern Vergangenheit und Zukunft übersieht und bedenkt; woraus dann seine Vorsicht, seine Sorge und häufige Beklommenheit entspringt. Der Vorteile wie der Nachteile, die dies bringt, ist das Weib infolge seiner schwächeren Vernunft weniger teilhaftig.“ (Zit.n. Lehr 1984, S. 264)
Noch zu Anfang unseres Jahrhunderts wird der Frau oftmals eine geringere Intelligenz zugeschrieben und zum Teil sogar jede Denkfähigkeit abgesprochen. So schreibt Otto Weininger: „...es ist also richtig, daß das Weib keine Logik besitzt“; es „läßt sich mit Sicherheit nun folgende abschließende Antwort auf die Frage nach der Begabung der Geschlechter geben: es gibt wohl Weiber mit genialen Zügen, aber es gibt kein weibliches Genie, hat nie ein solches gegeben...und kann nie ein solches geben...Wie könnte es nach diesen (vorher entwickelten Definitionen von Genialität – Anmerkung des Herausgebers) ein seelenloses Wesen Genie haben? Genialität ist identisch mit Tiefe; und man versuche nur, tief und Weib wie Attribut und Substantiv miteinander zu verbinden: ein jeder hört den Widerspruch.“ (Zit.n. ebd., S. 266)
Im Mittelpunkt anthropologischer und idealtypischer Betrachtungen stand und steht das Interesse am eigentlichen Wesen der Frau; mit ihm werden oft auch ein stark ausgeprägtes Maß an Emotionalität, Passivität und schließlich auch „Unterschiede bzw. Minderleistungen im intellektuellen Bereich“ (ebd., S. 265) in Verbindung gebracht. Weibliches Verhalten sei gekennzeichnet durch den Wunsch nach Geborgenheit und Hingabe und durch das Erfahren von „Sich-Unterwerfen“, „Sich-in-den-Griff-Geben“ und „Auf-sich-Nehmen von Unfreiheit“ als Lust und Wert . Für derartige Auffassungen führt Ursula Lehr (1980) zahlreiche Beispiele von Autoren/-innen unseres Jahrhunderts an.
Die Sichtweise der Andersartigkeit (im Gegensatz zur Minderwertigkeit) der Frau als Wert ist erst eine Errungenschaft der ersten emanzipatorischen Bewegungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts.
Die heutige Zeit bietet, gemessen an den vergangenen Jahrhunderten, zwar die Gleichberechtigung der Frau, jedoch noch stets keine Chancengleichheit[8].
Es bleibt abzuwarten, wie viele Jahrhunderte bis zu diesem Ziel noch vergehen werden.
2.2 Biologische Theorien
Wie zuvor bereits angesprochen, haben wir es hier nun mit dem Terminus Geschlechtsspezifik in seiner ursprünglichen Bedeutung zu tun. Das genetische oder chromosomale Geschlecht ist verantwortlich für das spezifisch Männliche und Weibliche. Bei der Verschmelzung des Spermiums mit der Eizelle entscheidet sich die Geschlechtszugehörigkeit des sich entwickelnden Menschen; im Falle des Männlichen enthält das 23. Chromosomenpaar ein X- und ein Y-Chromosom, im Fall des Weiblichen zwei X-Chromosomen. Da das Y-Chromosom eine langsamere Reifung des männlichen Organismus verursacht und eine größere Variabilität bestimmter Eigenschaften und Funktionen bei männlichen Individuen bewirkt, werden geschlechtsspezifische Unterschiede auch im Verhalten sichtbar. Hier anzuführen sind Untersuchungen von Lisa Dummer-Smoch (1991) oder von Heinz Dannhauer (1973), der Statistiken über Totgeburten und Unfallziffern aufstellt und die dort erlangten Daten auf eben jenen langsameren Reifungsprozeß, höhere Anfälligkeit und stärkere Verwundbarkeit männlicher Organismen zurückführt.
Der durch das Y-Chromosom bewirkten größeren Variabilität bestimmter Eigenschaften wurde auch das bessere Abschneiden von Jungen/Männern in Tests zur räumlichen Wahrnehmung zugeschrieben. Die Vermutung, diesem Faktor der Intelligenz liege eine X-rezessive Vererbung zugrunde, konnte jedoch nach Untersuchungen 1991 nicht mehr aufrechterhalten werden (vgl. Westphal 1996).
Bärbel Kerber (1998) stellt eine neuere Untersuchung eines britischen Forscherteams vor, der zufolge die Eigenschaften Einfühlsamkeit und Intuition durch ein Gen vererbt werden, welches sich nur im väterlichen X-Chromosom befindet. Demnach können Männer, die ja vom Vater mit einem Y-Chromosom ausgestattet werden, diese Fähigkeiten nicht vererbt bekommen, sondern müssen sie sich erst mühsam erlernen.
Die weitere gonodale Entwicklung geschieht bei männlichen Organismen nun durch die Einwirkung von Hormonen (Androgene), bei weiblichen ohne eine solche.
Die Sexualhormone, deren Ausschüttung weiter für die Ausbildung sekundärer Geschlechtsmerkmale und für gewisses geschlechtstypisches Verhalten sorgt, sind zwar eingeteilt in männliche (Androgene) und weibliche (Östrogene und Gestagene), kommen aber alle sowohl bei Männern als auch bei Frauen vor. Die vom Hypothalamus gesteuerte Ausschüttung geschieht bei weiblichen Individuen zyklisch (allerdings erst in der Pubertät ab Beginn des Menstruationszyklus), bei männlichen azyklisch; die daraus resultierende Tatsache, daß der Hormonhaushalt beim Mann im Gegensatz zu dem der Frau konstant bleibt, wirft die Frage auf, inwieweit bestimmte Teile des Gehirns geschlechtsspezifisch funktionieren (vgl. Degenhardt 1980, S. 383). Nach Günther Dörner (1985) kann man sich die geschlechtsspezifische Entwicklung des Gehirns in drei Schritten vorstellen:
1. Es entwickeln sich diejenigen Zellgruppen in männliche oder weibliche Richtung, die später für das Muster der Geschlechtshormonausschüttung verantwortlich sind.
2. Es entwickeln sich Zellgruppen in männliche oder weibliche Richtung, die für die sexuelle Orientierung zuständig sind; sie haben also Einfluß darauf, ob wir heterosexuell, bisexuell oder homosexuell werden.
3. Es gibt Zellgruppen, die für männliches und weibliches Geschlechtsrollenverhalten mitverantwortlich sind.
Hierbei ist nicht nur die absolute Menge der, sondern auch das Verhältnis von „männlichen“ und „weiblichen“ Geschlechtshormonen von Bedeutung. Diese wirken zusammen mit anderen Hormonen, Neurotransmittern und anderen chemischen Substanzen (vgl. Hassler 1998, S. 23ff.). Hassler (1998) erklärt hieran auch die Ursachen für Androgynie.
Geschlechtstypische Unterschiede, die in zahlreichen Untersuchungen bei Neugeborenen festgestellt wurden, werden ebenfalls auf hormonelle Einflüsse zurückgeführt. Man fand heraus, daß Jungen im Durchschnitt weniger schlafen, mehr Aktivität zeigen, irritabler sind, sich aber Umweltreizen dennoch stärker aussetzen als Mädchen. Auch reagieren sie mehr auf visuelle und akustische Reize, die auch über einige Entfernung von der Reizquelle funktionieren. Mädchen zeigen sich berührungsempfindlicher und reagieren mehr auf Nahreize (vgl. Bilden 1980, S. 787)
G.W. McRoberts und B. Sanders (1992) haben in einer Untersuchung, in der sie nonverbale Hörtests durchführten, signifikante „sex differences“ bezüglich der Koordination der beiden Hemisphären gefunden: Männliche Probanden schnitten deutlich besser ab bei Höraufgaben, die die Koordination der beiden Hirnhälften forderten als weibliche.
Hiscock et. al. (1994) untersuchten sechs neuropsychologische Zeitschriften auf Ergebnisse von Hörtests bezüglich geschlechtsspezifischer Unterschied im menschlichen Gehirn. In 11 von 49 Experimenten wurden signifikante Differenzen gefunden, wovon 9 die Hypothese, daß Männer eine ausgeprägtere Spezialisierung der Hemisphären haben als Frauen, stützten. 21 weitere Ergebnisse von diesbezüglichen Tests wiesen ähnliche geschlechtsspezifische Unterschiede auf, jedoch weniger signifikant.
Keine geschlechtsspezifischen und -typischen Unterschiede am Cortex und im Stoffwechselgeschehen innerhalb einzelner Einheiten im Gewebe des Gehirns konnten Bishop und Wahlsten (1997) konstatieren. Sie folgern aus ihren neurophysiologischenUntersuchungen: „The widespread belief that women have larger splenium than men and consequently think differently is untenable.“ (Abstract PubMed-Bibliographie, 1999)
Die Auswirkungen der kleineren Größe des weiblichen Gehirns auf unterschiedliche Bereiche sind verschiedentlich untersucht worden. so wurde in einer repräsentativen Studie festgestellt, daß die Gedächtnisleistung von Männern ab dem 20. Lebensjahr kontinuierlich abbaue, wo hingegen Frauen bis zum 55. Lebensjahr ihr Gedächtnisstärke, welche im Vergleich zu den Männern in dieser Studie deutlich bessere Leistungen aufwies, in vollem Umfang behalten. .
Im Laufe der Entwicklung zeigen sich deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede in der Motorik. So erreichen Jungen ab der Pubertät eine höhere Muskelkraft (Grobmotorik; hier steht der Energieaufwand im Vordergrund) und Mädchen eine ausgeprägtere Feinmotorik (Koordination v.a. der Hände), wobei letzteres schon bei Tests im Vorschulalter ersichtlich ist (vgl. Merz 1979).
Insgesamt läßt sich sagen, daß Mädchen alle Entwicklungsstufen früher abschließen als Jungen.
2.3 Soziologische Theorien
[9]
„Geschlechtsspezifik“ als Gegenstand existierte in der Sozialisationsforschung im deutschsprachigen Raum bis Mitte der 70-er Jahre überhaupt gar nicht (Breitenbach/Hagemann-White 1994). Erst im Rahmen des Feminismus begann man, vorrangig nach weiblicher Sozialisation zu fragen; „die männliche Sozialisation tauchte allenfalls als nachlässig hingeworfener Kontrast auf“ (ebd., S. 251). Die Diskussion seit Beginn der weiblichen Sozialisationsforschung zeigt verschiedene Phasen, in denen jeweils von einem anderen zu verwirklichenden Frauenbild ausgegangen wird. Eva Breitenbach und Carol Hagemann-White stellen diesen Weg ausführlich dar. Erst in den 90-er Jahren begann eine Forschungslinie, in der man verstärkt nach „typisch männlicher“ Sozialisation fragte (vgl. hierzu Pollack 1998). In seinem Aufsatz „Fehlt Jungen- und Männerforschung?“ konklusiert Berno Hoffmann 1997, daß an selbiger kein Mangel mehr bestünde.
Schon während der ersten Begegnungen des Neugeborenen mit seiner Umwelt sind stereotype Handlungsweisen deutlich zu verzeichnen. Alter und Geschlecht stellen zwei „greifbare“ Orientierungspunkte dar, die dankbar angenommen werden, wenn anfangs noch keine auffälligen Persönlichkeitsmerkmale ersichtlich sind, nach denen man das Neugeborene „einstufen“ könnte.
Helga Bilden (1980) geht (sich dabei auf Arbeiten aus der Frauenbewegung beziehend) davon aus, daß Jungen und Mädchen gleich nach ihrer Geburt mit völlig unterschiedlichen Welten konfrontiert werden. Dabei betont sie, daß „tätige Aneignung das zentrale Sozialisationskonzept“ sei und somit nicht die Rede sein könne von „simplen Vorstellungen abklatschhafter Imitation der Eltern“, wodurch geschlechtstypische Rollenverteilungen und -einstellungen übernommen werden (Bilden 1980, S. 786; vgl. auch Morf-Rohr 1989, S. 430f.). Sie fordert eine Korrektur der Vorstellung, daß Eltern die prägende Sozialisationsinstanz darstellen, „zugunsten des Arrangements sachlich-sozial teilweise sehr verschiedener Umwelten, des Einflusses der Geschwister, der unterschiedlichen Zugänglichkeit von Gleichaltrigengruppen, von Stereotypen in Kinderbüchern und Fernsehen usw.“ (ebd., vgl. auch Bilden 1991). Diese verschiedenen Umwelten zeigen sich in zwei Prinzipien, die überall in unserer Umwelt, wenn auch in vielerlei Hinsicht abnehmend, manifestiert sind, nämlich im „männlichen“ und „weiblichen Prinzip“. Verkürzt will ich dies hier darstellen:
Das „männliche Prinzip“ beinhaltet Kompetenz, Leistungsfähigkeit und die Idee, die Natur zu beherrschen bzw. sich mindestens von ihr abzusetzen. Überhaupt stehen Abgrenzung, Trennung, Icherhöhung, faustischer Wissensdrang und Aktivität im Zentrum des „männlichen Prinzips“.
Das „weibliche Prinzip“ setzt sich zusammen aus Wärme, emotionaler Ausdruckskraft (Anteilnahme, Sensibilität, Expressivität) und Nähe zur Natur. Letzteres zeigt sich auch in der reproduzierenden Fähigkeit der Frau, Kinder zu gebähren.
Diese Prinzipien, die Bilden im wesentlichen aus Schriften der 70-er Jahre herleitet, finden sich auch gegenwärtig noch in forschungsbezogenen Ansätzen. So findet auch die Kommunikationsforscherin Deborah Tannen (1990) eine in Teilen eindeutige Trennung von männlichen und weiblichen Eigenschaften, die zeigt, daß Männer in ihrem Denken, Handeln und somit auch Gesprächsstil eher auf Status, Frauen hingegen auf Bindung bedacht sind. Mit mannigfachen Beispielen aus Theorie und Praxis belegt sie diese Thesen.
Auch wenn, wie zuvor beschrieben, einige Unterschiede im Aktivitätsniveau bei Neugeborenen beobachtet wurden, was also Rückschlüsse auf hormonelle Einflüsse ziehen läßt, geht die Sozialisationsforschung von größten Einflüssen auf geschlechtstypische Verhaltensweisen aus der Umwelt aus. Aus zahlreichen (allerdings älteren) Studien geht hervor, daß Mädchen und Jungen gleich nach der Geburt verschieden behandelt werden, jeweils andere Erwartungen an sie gestellt werden, sie mit bestimmtem Spielzeug und Umgangsweisen damit vertraut gemacht werden etc. . Die Inhalte dieser Untersuchungsergebnisse lassen Bilden die These aufstellen, daß Mädchen mehr sozialisiert werden und Jungen sich stärker selber sozialisieren. So seien die Sozialisationsmodi eindeutig als „passiv“ und „aktiv“ zu charakterisieren (vgl. Bilden, 1980, S. 792). Renate Müller (1996) hingegen schreibt den Frauen durchaus die Mitverantwortung an ihrer Sozialisation zu, da kein Mensch sich einfach in Schablonen pressen lasse. So konstruieren auch Frauen ihre geschlechtsbezogene Identität selber. Müller beklagt, daß sich Menschen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten verbauen, indem sie sich nicht an speziell andersgeschlechtliche Bereiche heranwagen. Bei Frauen äußere sich dies in Sozialisationsmechanismen wie erlernte Hilflosigkeit („Selbstfesselung“) und ‘selffulfilling profecies’ von Mißerfolg („Selbstsabotage“). Weibliche Sozialisation führe zu:
- einem negativem Selbstbild
[...]
[1] Vgl. hierzu Cornelia Ermold (1992). In Befragungen, Interviews und Zeitungsanzeigen-Recherchen wird aufge zeigt, daß es sich hierbei um eine Tatsache handelt, die trotz fortgeschrittener Emanzipation Gültigkeit hat.
[2] Vgl. Ermold (1992); Stroh (1996); Westphal (1996)
[3] Vgl. z.B. Klausmeier (1968); Wiechell (1977); Ermold (1992); Sonderegger (1996) und meine eigene Umfrage bei 45 nordrhein-westfälischen Musikschulen, die ergibt, daß 57 % Mädchen und 43 % Jungen unterrichtet werden.
[4] Gespräche mit Kollegen/-innen und meine eigenen Unterrichtserfahrungen haben deutlich gezeigt, daß Mädchen im allgemeinen braveres, angepaßteres und Jungen frecheres und agressiveres Verhalten aufweisen
[5] Forschungsberichte finden sich in Sammelbänden und/oder als (un)veröffentlichte Dissertationen
[6] Zu nennen sind hier Marianne Hasslers neurobiologischen Forschungen, Anke Westphals unveröffentlichte Dissertation („Geschlechtsspezifische Aspekte der Leistungsmotivation im Instrumentalspiel Jugendlicher“) und Ursula Eckart-Bäckers Forschungen in der Erwachsenenpädagogik, die jedoch bezüglich des „gender“-Aspektes weiterer Arbeit bedürften, um veröffentlicht zu werden. Des weiteren ist von Lucy Green das Buch „Music, Gender, Education“ erschienen, welches mir aber leider -aufgrund der limitierten Bearbeitungszeit dieser Arbeit- nicht zugänglich war (Cambridge University Press, 1998)
[7] „Vor allem anderen habt ihr dies zu lernen: worin die menschliche Natur eigentlich besteht und was ihr widerfahren ist. Anfangs nämlich war unsere Natur ganz anders als jetzt. Da gab es nicht nur zwei Geschlechter, männlich und weiblich, sondern dazu noch ein drittes, welches beides zugleich war. Mannweiblich war es, der Gestalt wie dem Namen nach, aus beiden zusammengesetzt. Dieses Geschlecht ist verschwunden, nur der Name existiert noch und wird heute als Schimpfwort gebraucht.
Sodann war die Gestalt eines jeden Menschen kugelrund, Rücken und Brust gingen wie im Kreis herum. Sie alle hatten vier Hände und ebensoviele Schenkel, dazu zwei Gesichter auf einem runden Hals, einander ganz gleich, an einem gemeinsamen Kopf, einander gegenüber, und so auch vier Ohren, zweifache Schamteile - und so weiter-, wie man sich leicht ausmalen kann. Sie konnten also nicht nur aufrecht gehen wie jetzt, seitlich, wohin man will, sondern, wenn es eilig war, konnten sie sich auf Armen und Beinen fortdrehen, wie es heute noch die Radschläger machen, und sich, auf die acht Gliedmaße gestützt, sehr schnell im Rundlauf fortbewegen. An Kraft und Mut nun waren sie gewaltig, hatten auch große Pläne im Kopf, so daß zu sagen ist, daß sie den Himmel stürmen und die Götter angreifen wollten.
Zeus nun und die anderen Götter hielten Rat, was sie da tun sollten, wußten aber nicht recht, was. Einerseits war es nicht zweckmäßig, sie zu töten und, wie vorher die Giganten sie niederdonnernd, das ganze Geschlecht auszurotten, denn damit wären auch die Ehrungen und Opfer der Menschen hinfällig gewesen. Andererseits konnten sie den Frevel auch nicht weiter zulassen. Nach langem Grübeln hatte sich Zeus endlich etwas ausgedacht und sagte: „Mir scheint, ich weiß jetzt, wie es weiterhin Menschen geben kann und sie doch aufhören mit ihren Frechheiten: Sie müssen schwächer werden. Ich werde sie -sagte er- in zwei Hälften teilen, dann sind sie schwächer und zugleich noch nützlicher für uns, weil es dann doppelt so viele von ihnen gibt. Sie sollen auf zwei Beinen gehen, aufrecht. Wenn ich aber merke, daß sie auch weiterhin keine Ruhe geben, dann werde ich sie noch einmal teilen, und dann können sie sich auf einem Bein weiterdrehen wie ein Kreisel.“ Gesagt,, getan. Er zerteilte die Menschen in zwei Hälften, wie man Früchten zerschneidet, um sie einzumachen, oder wie man Eier mit einem Haar teilt. Sobald er nun einen aufgeschnitten hatte, befahl er Apollon, ihm das eine Gesicht und den halben Hals herumzudrehen nach der Schnittseite hin, damit der Mensch, seine Teilung vor Augen, bescheidener würde. Dabei sollte er auch alles übrige ärztlich versorgen. Apollon also drehte ihnen das Gesicht herum. Die Haut zog er ihnen von allen Seiten über das, was jetzt der Bauch ist, und, wie man einen Beutel zusammenbindet, faßte er es mitten auf dem Bauch zusammen, was wir jetzt den Nabel nennen.
Nachdem nun die Gestalten geteilt waren, sehnte sich ein jedes nach seiner anderen Hälfte, und so kamen sie zusammen, umfaßten sich mit den Armen und schlangen sich ineinander. Über dem Begehren zusammenzuwachsen starben sie aus Hunger und Nachlässigkeit, weil sie nichts voneinander getrennt tun mochten. Wenn dann eine Hälfte tot war, suchte sich die übriggebliebene eine andere und umschlang diese, egal, ob sie nun auf die Hälfte einer ehemaligen Frau traf oder auf die eines Mannes oder wie. Und so drohten sie auszusterben.
Da erbarmte sich Zeus und schaffte Abhilfe, indem er ihnen die Schamteile nach vorn verlegte. Vorher nämlich trugen sie diese nach außen und zeugten nicht ineinander, sondern in die Erde wie Zikaden. Nun aber verlegte er es ihnen nach vorn und ermöglichte so das Zeugen ineinander, im Weiblichen durch das Männliche. Er tat dies, damit in der Umarmung, wenn ein Mann auf eine Frau träfe, sie zugleich zeugten und so Nachkommenschaft entstünde, wenn aber eine Mann auf einen Mann träfe, sie doch eine Befriedigung hätten durch ihr Zusammensein und sich danach für eine Weile ihren Geschäften zuwenden könnten und alles tun, was zum Leben nötig ist. Seitdem ist die Liebe zueinander den Menschen eingepflanzt, um die ursprüngliche Natur wiederherzustellen, und sie trachtet, aus zweien eins zu machen und so die menschliche Natur zu heilen.
Jeder von uns ist also ein Stück von einem Menschen, da wir ja geteilt sind -aus einem zwei geworden. Also sucht nun jedes seine andere Hälfte.“ (Zit.n. Hirsch 1991, S. 15f.)
[8] Es sei an dieser Stelle auf das Themenheft „Frauen“ der Zeitschrift „Psychologie heute - compact“ (2/1998) verwiesen, wellches sich eingehend mit dieser Thematik befaßt.
[9] Kulturvergleichende Studien zeigen, daß Formen und Inhalte der zu beschreibenden Sozialisation „typisch westlich“ sind, es in anderen Kulturen zum Teil gar konträre Sozialisationsmuster gibt. Aiga Stapf (1984) zeigt das in bezug auf die Komponente der Feld(un)abhängigkeit, die mit Aktivität/Passivität und Abhängigkeit/Unabhängigkeit in Verbindung gebracht wird. (Vgl. auch Degenhardt 1984)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1999
- ISBN (eBook)
- 9783832470593
- ISBN (Paperback)
- 9783838670591
- DOI
- 10.3239/9783832470593
- Dateigröße
- 609 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Folkwang Universität der Künste – Musikpädagogik, Instrumentalpädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Juli)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- gender studies instrumentenwahl komponieren
- Produktsicherheit
- Diplom.de