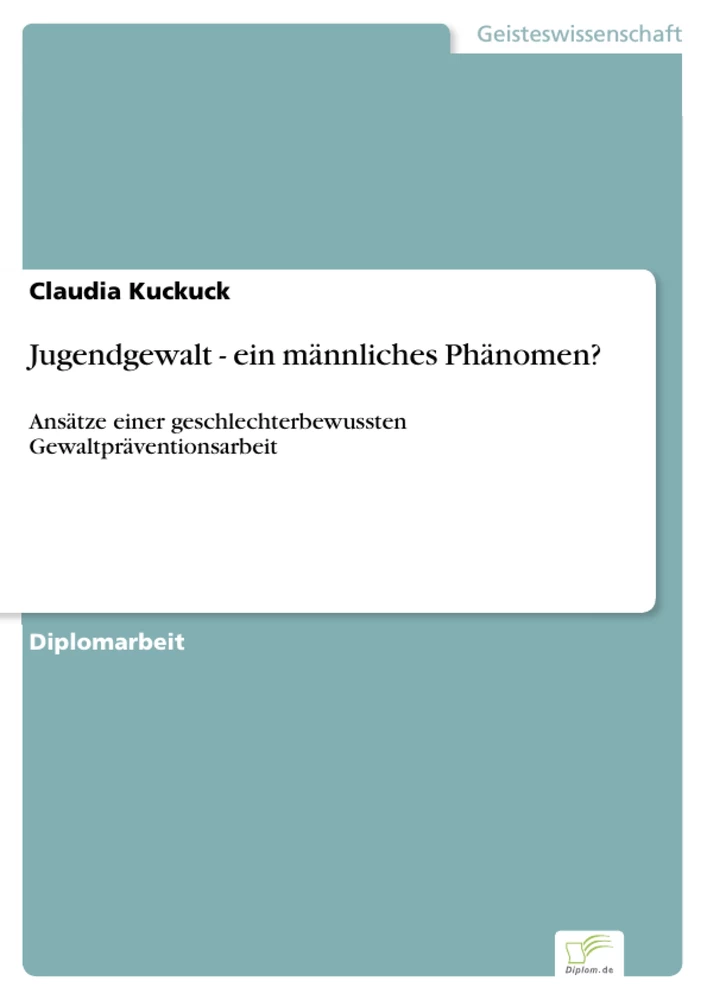Jugendgewalt - ein männliches Phänomen?
Ansätze einer geschlechterbewussten Gewaltpräventionsarbeit
Zusammenfassung
Wir haben uns in die Haare gekriegt und uns total verprügelt. Ich habe immer wieder an eine Stelle am Bein getreten und an den Haaren gezogen und habe sie herumgewirbelt. Ich hab echt büschelweise die Haare vom Kopf gerissen. Ja, und dann habe ich gewonnen.
Dieses Zitat stammt aus einem Interview mit einem 17jährigen Mädchen, welches im Rahmen einer Studie im Großraum Köln stattfand.
Seit Jahren wird die pädagogische Diskussion in zahlreichen Büchern und Zeitschriftenartikeln von der Klage über die zunehmende Gewaltbereitschaft von Jugendlichen in Schule, Jugendarbeit und öffentlichem Leben bestimmt. Entweder werden männliche und weibliche Jugendliche in dieser Diskussion unter dem Begriff ,Jugendliche zusammengefasst, oder es ist eine vermehrte Einigkeit in der Diskussion über Jugendgewalt darüber zu finden, dass gewalttätige Auseinandersetzungen von männlichen Jugendlichen ausgehen.
Aufgrund einiger Ergebnisse empirischer Untersuchungen, ist es auch nicht zu bestreiten, dass die Mehrzahl der Täter männlich sind. Der einseitige Blick auf die Jungen verdeckt jedoch den Blick auf die steigende, und nicht verschwindend geringe Zahl weiblicher Täterinnen. Bei einer näheren Beschäftigung mit dem Thema Geschlecht und Jugendgewalt stößt man darauf, dass Mädchen vermehrt körperlich gewalttätige Handlungsstrategien in ihr Verhaltensrepertoire einschließen. Mit dem, als neuartig anzusehenden, Phänomen der körperliche Gewalt ausübenden Mädchen, befasst sich diese Diplomarbeit. Es werden mögliche Verursachungszusammenhänge, die dazu führen, dass Mädchen vermehrt gewaltbereit werden, dargestellt und anschließend daraus resultierende Konsequenzen für die Gewaltpräventionsarbeit erläutert.
Festzuhalten ist, dass die meisten vorfindbaren Ansätze zur Erklärung von Gewalt selten oder gar keine Geschlechterdifferenzierung vornehmen. Ähnlich sieht es bei der pädagogischen Arbeit mit gewaltbereiten jungen Frauen aus: Zwar haben diese an entsprechenden Projekten der Gewaltprävention immer wieder teilgenommen, jedoch wurden ihre spezifischen Probleme und Bedürfnisse, die zu ihrem Verhalten führen, nur selten berücksichtigt.
Lange Zeit herrschte in der pädagogischen Diskussion der Konsens vor, dass Mädchen friedfertig seien und mit Gewalttaten nichts zu tun hätten. Doch scheinbar übernehmen mehr und mehr Mädchen ,männliche Argumentationsmuster und Verhaltensweisen als Konfliktlösungsmethode und zur Durchsetzung ihrer Interessen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Geschlechtsspezifische Sozialisation und Gewaltverhalten
2.1 Begriffe und Grundlagen
2.1.1 Sozialisation
2.1.2 Identität
2.1.3 Jugend
2.1.4 Geschlecht
2.1.5 Soziale Konstruktion von Geschlecht
2.1.6 Geschlechterstereotype
2.1.7 Gewaltverhalten und Geschlecht
2.1.8 Einordnung in die Arbeit
2.2 Symbolischer Interaktionismus
2.2.1 Grundlagen
2.2.2 Identitätsentwicklung im Symbolischen Interaktionismus
2.2.3 Geschlecht im Symbolischen Interaktionismus
2.3 Entwicklung von Geschlechtsidentität im Jugendalter
2.4 Zusammenfassung
3 Jugendgewalt
3.1 Aktualität der Jugendgewalt
3.2 Gewalt – männlich?
3.3 Zur Definition von Aggression und Gewalt
3.4 Ursprünge von Aggressionen
3.5 Angst
3.6 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Erklärung der Entwicklung
von Gewalt
3.6.1 Gesellschaftlicher Wandel
3.6.2 Verlust von Solidarität
3.6.3 Desintegration und Gewalt
3.6.4 Strukturwandel der Jugendphase
3.6.5 Sozialisationseinfluss auf die Gewaltbereitschaft: Die Peer-Group
3.7 Situative Faktoren: Auslöser von Gewalt
3.8 Zusammenfassung und pädagogische Konsequenzen
4 Weibliche Jugendgewalt
4.1 Individualisierung und Wandel der Geschlechterverhältnisse: Auflösung traditioneller Geschlechterkonzepte
4.2 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Erklärung weiblicher Jugendgewalt
4.3 Gewalt – Reaktion auf ungünstige Lebensumstände
4.4 Rückgriff auf traditionelle Geschlechterkonzepte
4.5 Exkurs: Männer als Modernisierungsverlierer
4.6 Formen und Ursachen weiblicher Gewalt
4.6.1 Bedeutung der Gleichaltrigengruppe: Suche nach Anerkennung
4.6.2 Physische Gewalt – ein Angleichungsprozess?
4.6.3 Gewalt aus Überforderung
4.6.4 Verstrickung in Gewaltsituationen
4.6.5 Psychische Gewalt
4.7 Zusammenfassung und pädagogische Konsequenzen
5 Mögliche Lösungsansätze
5.1 Definition von Gewaltprävention
5.2 Möglichkeiten und Grenzen
5.3 Grundlegende Vorüberlegungen zur geschlechterbewussten Gewaltpräventionsarbeit
5.3.1 Mögliche Ansätze für die Arbeit in Gleichaltrigengruppen
5.3.2 Ansätze einer geschlechterbewussten Arbeit mit gewalttauffälligen Jungen
5.3.3 Ansätze einer geschlechterbewussten Arbeit mit gewaltauffälligen Mädchen
5.4 Entscheidende Voraussetzungen zum gewaltfreien Handeln
5.4.1 Konstruktive Konfliktaustragung
5.4.2 Kompetenzen für einen konstruktiven Umgang mit Konflikten
5.4.3 Kooperation
6 Schlussbetrachtung
Literatur
Anhang
1 Einleitung
„Wir haben uns in die Haare gekriegt und uns total verprügelt. Ich habe immer an eine Stelle am Bein getreten und an den Haaren gezogen und habe sie herumgewirbelt. Ich hab‘ echt büschelweise die Haare vom Kopf gerissen. Ja, und dann habe ich gewonnen.“[1] (vgl. Hilgers 1997, S.15)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Gewaltverhalten von männlichen und weiblichen Jugendlichen in Deutschland, den dafür verantwortlichen Ursachen und Hintergründen, sowie abschließend mit den daraus resultierenden Möglichkeiten der Prävention und Intervention von Gewalt.
Seit Jahren wird die pädagogische Diskussion über Gewalt und Konflikte, in zahlreichen Büchern und Zeitschriftenartikeln, von der Klage über die zunehmende Gewaltbereitschaft von Jugendlichen in Schule, Jugendarbeit und öffentlichem Leben bestimmt. Entweder werden männliche und weibliche Jugendliche in dieser Diskussion unter dem Begriff ,Jugendliche‘ zusammengefasst, oder es ist eine vermehrte Einigkeit in der Forschung über Jugendgewalt festzustellen, dass gewalttätige Auseinandersetzungen von männlichen Jugendlichen ausgehen. Erklärt wird dies durch unterschiedlichste Ansätze mit geschlechtsspezifischem Verhalten, das – knapp formuliert – in der Sozialisation durch unterschiedliche gesellschaftlich vermittelte Anforderungen an das Verhalten von ,Männlichkeit‘ und ,Weiblichkeit‘ erworben wird (vgl. hierzu Dussa/Welz 2000; Hanssen/Micheel/Wagenblass 1998; Heitmeyer et al. 1998; Pfeiffer 2001). Jungen wird eher als Mädchen vermittelt, ihre Interessen in Konfliktsituationen zu behaupten. Gewalt als Durchsetzungsform wird dabei toleriert.
Gegenwärtig ist in Schulen und Jugendarbeit jedoch ebenso ein Trend zu beobachten, dass auch weibliche Jugendliche an Gewaltprozessen nicht mehr ganz unbeteiligt zu sein scheinen und sich in unterschiedlichster Weise aktiv und passiv bei Gewalttaten verantwortlich machen. So deuten auch empirische Untersuchungen darauf hin, dass einige junge Frauen vermehrt körperliche Gewalt als Handlungsstrategie in ihr Verhaltensrepertoire aufgenommen haben. Unterschiedliche ForscherInnen sprechen von einer ernstzunehmenden Aufholjagd und davon, dass die prozentuale Zunahme der Gewalttätigkeit weiblicher Heranwachsender höher sei als die männlicher (vgl. hierzu Hilgers 1997, S.16; Pfeiffer/Wetzels 1999, S.14). Zahlenmäßig liegen sie jedoch noch immer weit hinter den Jungen.
Ob Jugendgewalt angesichts neuerer Entwicklungen noch als ein ausschließlich männliches Phänomen erachtet werden kann, wird in meiner Arbeit erörtert.
Welche Konsequenzen und Ansatzpunkte ergeben sich daraus für eine geschlechterbewusste Gewaltpräventionsarbeit, die das Problem der Gewalt von männlichen und weiblichen Jugendlichen differenziert betrachtet und nicht pauschalisierend die Jungen als Täter und die Mädchen als Opfer versteht? Dieser Frage wird hier nachgegangen.
Die vorliegende Arbeit besteht aus insgesamt sechs Kapiteln. Am Ende der Kapitel 2 bis 4 finden sich jeweils Zusammenfassungen, in denen sich teils Extrakte des Ausgeführten, teils aber auch (vorläufige) Folgerungen des Geschriebenen finden.
Im zweiten Kapitel befasse ich mich mit Grundlegendem, wenn auch Ausgewähltem zum Thema Geschlecht und Sozialisation. Zudem gehe ich der Frage nach, inwiefern die theoretischen Überlegungen zur Geschlechtersozialisation die Auffassung untermauern, Jugendgewalt als ein männliches Phänomen zu erachten und inwiefern diese theoretischen Sichtweisen auch weibliches Gewaltverhalten zu erklären vermögen.
Im dritten Kapitel erläutere ich das Phänomen der Jugendgewalt, indem ich differenziert aufgeführte empirische Daten männlicher und weiblicher Gewalttaten darstelle, um mich anschließend einem für beide Geschlechter relevant erscheinenden Erklärungsmodell zuzuwenden. Vor dem Hintergrund zunehmender Gewaltbereitschaft von männlichen und weiblichen Jugendlichen ist auch die Frage nach den Verursachungszusammenhängen und den Bedingungen gewaltakzeptierender Legitimationsmuster von großer Bedeutung. Ich werde sowohl die strukturell veränderten Lebensbedingungen der Jugendlichen, als auch die sich daraus ergebenden Konflikte aufzeigen. Um das Phänomen der Jugendgewalt differenziert zu betrachten, arbeite ich zudem mit einem differenzierten Gewaltbegriff. Dieser schließt andere Formen der Involvierung an Gewalttaten mit ein und beinhaltet auch weniger sichtbare Verletzungen, wie u.a. psychische Schädigungen.
Im vierten Kapitel erkläre ich die zunehmende weibliche Gewaltauffälligkeit unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Veränderungstendenzen. Ein sich vollziehender gesellschaftlicher Wandel, und damit eingeschlossen ein Wandel der Geschlechterverhältnisse, der zu einer allmählichen Pluralisierung der Geschlechtsrollen führt, lässt vermuten, dass oben Dargestelltes als nicht mehr so rigide wie früher anzunehmen ist.
Das fünfte Kapitel stellt den Versuch dar, pädagogische Handlungsansätze aus dem vorher Beschriebenen zu gewinnen.
Die Arbeit abschließend, wird im sechsten Kapitel ein Ausblick gebendes Resümee präsentiert.
Habe ich mich bei der Wahl und Bearbeitung der verwendeten Literatur auch um Aktualität und um ein mir angemessen erscheinendes Quantum der Beiträge bemüht, erhebt diese Auswahl keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Forschungslage zu den nahezu unüberschaubaren Bereichen der Geschlechtersozialisation und der Jugendgewalt, entzieht sich meinem Zugriff.
Anzumerken ist, dass das Thema körperlicher Gewalt von Mädchen ein bisher nicht häufig bearbeitetes Thema in der pädagogischen Diskussion zu sein scheint. Aufsätze und Zeitschriftenartikel zu diesem Thema waren nur vereinzelt zu finden. Da die Forschungslage speziell zu diesem Thema steigerungsbedürftig ist, gehe ich davon aus, dass der diesbezügliche Teil der Arbeit vieles auszulassen droht. Weitere Forschungen zu diesem neuen Problembereich sind wünschenswert und notwendig, um fundierte Konzepte der Gewaltprävention für gewaltauffällige Frauen zu entwickeln.
Das Thema dieser Arbeit eingrenzend, finden Frauen als Opfer männlicher Gewalt hier keine Berücksichtigung, auch wenn dies ein bedeutsames Thema der Gewaltdiskussion darstellt. Ebenso wenig kann ich in dieser Arbeit die möglichen Auswirkungen der gesellschaftlichen Wandlungstendenzen für Jugendliche unterschiedlicher ethnischer Herkünfte differenziert beschreiben.
2 Geschlechtsspezifische Sozialisation und Gewaltverhalten
In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Sozialisation im Hinblick auf die Entwicklung einer Geschlechtsidentität dargestellt und der Annahme einer geschlechtsspezifischen Sozialisation sowie der Übernahme geschlechtsspezifischen Verhaltens nachgegangen. Einfließend wird dieses zu Gewaltverhalten von männlichen und weiblichen Jugendlichen in Bezug gesetzt.
Neben anderen Ursachen und Einflussfaktoren, die Gewaltverhalten hervorrufen und bedingen können, wird der Blick auf die Ursachenbetrachtung häufig auf spezifisch männliche Sozialisationsbedingungen gelenkt, wobei sich die physische Gewalt als Rückgriff auf körperliche Stärke als elementare Form überlieferter Männlichkeit interpretieren ließe. Behn (1994, S.13) behauptet, dass Jungen in gewalttätiges Verhalten hinein sozialisiert werden.
Ich erläutere in diesem Kapitel zunächst die Sozialisationsprozesse unter der geschlechtsspezifischen Perspektive. Im Weiteren gehe ich aber davon aus, dass damit inbegriffene, geschlechtsspezifische Verhaltensanforderungen nicht völlig determinierend auf die Individuen einwirken. Es ist meiner Ansicht nach nicht unbedingt anzunehmen, dass die geschlechtsspezifischen Sozialisationsbedingungen – eine Erziehung zu Männlichkeit und Weiblichkeit – Verwerfungen dieser bzw. individuelle Interpretations- und Bewertungsmöglichkeiten der Individuen ausschließen. Da in den letzten Jahren vermehrt weibliche Jugendliche durch körperliche Gewalttätigkeit auffällig geworden sind, werden Widersprüche erkennbar. Obwohl gewalttätiges Handeln unter der Perspektive geschlechtsspezifischer Sozialisation nicht zum vermittelten Verhaltensrepertoire von Mädchen gehört, treten sie als Gewalttäterinnen auf (vgl. hierzu Kap. 3.2).
Wir haben es heute mit einer komplexen Forschungssituation zum Erwerb geschlechtsspezifischen Verhaltens zu tun. Unterschiedliche, zum Teil konkurrierende, Ansätze und Theorien bemühen sich um Aufdeckung und Erklärung der damit einhergehenden intraindividuellen, interpersonellen und gesellschaftlichen Prozesse sowie deren Wechselwirkung miteinander.
Zunächst werde ich zur Einführung in das Thema wichtige Definitionen und Begriffe aufführen und anschließend theoretische Positionen darstellen, die für mein Thema relevant erscheinen. Nachfolgend komme ich auf ausgesuchte Probleme im Zusammenhang geschlechtsspezifischer Sozialisation und Gewaltverhalten zu sprechen, um schließlich eine zusammenfassende Stellungnahme zu diesen Punkten abzugeben.
2.1 Begriffe und Grundlagen
2.1.1 Sozialisation
Eingeführt wurde der Sozialisationsbegriff 1907 durch den französischen Soziologen Durkheim, der damit „den Vorgang der Vergesellschaftung des Menschen, die Prägung der menschlichen Persönlichkeit durch gesellschaftliche Bedingungen“ kennzeichnete (Gudjons 1999, S.153). Er benutzte den Begriff der Sozialisation für unser heutiges Verständnis von Erziehung[2]. Erziehung stellte für ihn eine methodische Sozialisation und wichtigstes Instrument zur Normenverinnerlichung dar (vgl. Tillmann 1999, S.35). Neuere Konzepte betrachten Sozialisation als einen wechselhaften Austausch zwischen Individuum und Gesellschaft.
Zunächst muss bedacht werden, dass es sich bei dem Begriff ,Sozialisation‘ um ein bloßes begriffliches Konstrukt handelt. Sozialisation ist, obwohl real vorhanden und wirksam, kein „dinghaft greifbarer Untersuchungsgegenstand“ (Gudjons 1999, S.153). Demnach sind es die sozialisationstheoretischen Fragestellungen, die die Frage nach der Individuation von Menschen beantworten können. Thematisch vorrangig ist dabei, wie der Mensch zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt wird (vgl. Gudjons 1999, S.154). Zentraler Sachverhalt sozialisationstheoretischer Fragestellungen ist daher das ,Mitglied-Werden’ in einer Gesellschaft (vgl. Hurrelmann/Ulich 1991, S.6).
Sozialisation ist gemeinhin als die „Entwicklung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen und sozialen Umwelt“ zu definieren (Lenzen 1994, S.1409). Der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Umwelt ist nicht deterministisch zu betrachten, sondern stellt sich als komplexe Wechselwirkung dar, in der das Subjekt selbst aktiv beteiligt ist und in der es sich zu einer individuellen Persönlichkeit herausbildet (vgl. Lenzen 1994, S.1409). Nach dieser Definition, die sich zunehmend durchgesetzt hat, lässt sich Sozialisation „als der Prozeß der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt“ begrifflich fassen (Hurrelmann 1989, S.51).
In dem „Modell des produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts“, in welchem dem Individuum eine aktive Rolle im Subjektwerdungsprozess zugestanden wird und welches intrapsychische Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung einerseits und gesellschaftliche Institutionalisierungsprozesse andererseits miteinander verbindet, finden sich konkrete Vorstellungen dieser Person-Umwelt-Beziehung und folglich eine Überwindung eindimensionaler Theoriekonstruktionen. Diesem Modell gemäß, vollzieht sich Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung im Schnittpunkt von Persönlichkeit und Gesellschaft (vgl. Hurrelmann/Ulich 1991, S.9).
Die wechselseitige Abhängigkeit von Individuum und Umwelt schließt ein, dass zwar sämtliche Umweltbedingungen auf die Entwicklung des Subjekts Einfluss haben, aber auch das Subjekt hat Einfluss auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse und kann auf unterschiedlichste gesellschaftliche Bedingungen aktiv mit einwirken. Dadurch ist das Individuum weder total von der Gesellschaft bestimmt, noch ist es völlig eigenständig handlungsfähig. Die Möglichkeit, sich zur Umwelt aktiv, individuell und situativ unterschiedlich zu verhalten, steht jedoch oft im starken Widerspruch zu gesellschaftlichen Anforderungen, in denen normative Verhaltensmuster und Erwartungen an Anpassungen enthalten sind (vgl. Tillmann 1999, S.12f.).
Sozialisation vollzieht sich nicht unmittelbar. Sozialisationsprozesse sind in Kleingruppen und Institutionen[3] eingebunden und werden durch diese beeinflusst. Die in einer Gesellschaft geltenden Normen und Erwartungen, die auch geschlechtsspezifische sein können, werden dem Subjekt früh durch Kommunikation und Interaktion durch die sog. Sozialisationsinstanzen vermittelt. Die Kleingruppen wiederum sind Bestandteil eines umfassenden gesellschaftlichen Gefüges und werden durch gesellschaftliche Prozesse modifiziert (vgl. Tillmann 1999, S.19). Gesellschaftliche Strukturveränderungen wirken daher indirekt auf die Interaktion in der Familie, gleichzeitig aber auch auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ein.
Zu beachten ist, dass Sozialisation nie abgeschlossen ist, sondern lebenslang andauert. Zwar ist sie gerade in der Kindheit besonders prägend, doch die Jugendphase stellt eine weitere Prägungsphase dar, denn hier erfolgt der Übergang von der Familiensozialisation zur öffentlichen, gesellschaftlichen Sozialisation (vgl. Prengel 1996, S.63). Darin liegt Chance und Bruch zugleich, wie in Kapitel 2.1.3 näher erläutert wird.
Festzuhalten ist hier für mein Thema, dass das Individuum nicht nur als ein gesellschaftlich determiniertes und ausnahmslos nach Verhaltensanforderungen der Gesellschaft agierendes Subjekt zu betrachten ist, sondern auch als eines, das aktiv an der Subjekt- und Umweltbildung beteiligt ist.
2.1.2 Identität
Der Erwerb von Identität ist unmittelbar an den Sozialisationsprozess angeschlossen. „An ,Identität‘ koppelt sich auch die Konnotation gelungener Sozialisation im Sinne von subjektiver Handlungsfähigkeit und Aneignung gesellschaftlicher Wirklichkeit ohne kritiklose Anpassung“ (Tzankoff 1995, S.9).
,Identität‘ und ,Selbst‘ nehmen innerhalb der Sozialisationsforschung eine wichtige Position ein. Als Identität bezeichnet man die als ,Selbst‘ erlebte innere Einheit einer Person, das Bestimmte und Unverwechselbare eines Menschen. In Abgrenzung zu Sozialisation als pure Übernahme vorgegebenen Verhaltens[4] beinhaltet der Begriff der Identität, sozusagen als Folge einer ,gelungenen‘ Sozialisation, die Ausbildung bestimmter Qualifikationen (z.B. der Fähigkeit sich mit gesellschaftlichen Anforderungen auseinandersetzen zu können), die es einer Person ermöglicht, trotz widersprüchlicher Normen und nur teilweiser Befriedigung der eigenen Bedürfnisse mit anderen zu interagieren (vgl. Lenzen 1994, S.716).
Identität kann jedoch nicht als ein für einen Menschen unverlierbaren und unveränderbaren Besitz betrachtet werden. Es ist ein dynamisches System, das nie abgeschlossen ist. Die Identität eines Menschen ist stets durch Konfrontation mit neuen, unstimmigen Erwartungen an die unterschiedlichen Rollen, die er ausfüllt, gefährdet. Diese Unterschiedlichkeiten müssen in der Weise bewältigt werden, dass die Individuen das Gefühl der Kohärenz[5] haben. Zur Identitätsfindung gehört es somit dazu, dass von Individuen Spannungen erkannt und ausgehalten werden. Hierbei sind eigene Standpunkte zu finden und zu verteidigen. Identität muss wegen des Anpassungsdrucks an soziale Normen gewahrt sowie aufrechterhalten und gegen den Anpassungsdruck an soziale Normen behauptet werden (vgl. Lenzen 1994, S.715). In diesem Sinne lässt sich Identität als ein spezifisches Resultat der gegenläufigen Prozesse der Vergesellschaftung und der Individuation des Individuums beschreiben. Einerseits müssen gesellschaftliche Normen, Werte und Erwartungen verinnerlicht werden, andererseits muss das Individuum auch in der Lage sein, sich von ihnen autonom zu distanzieren. Daher ist die Fähigkeit erforderlich, zwischen der sozialen und der personalen Identität eine Balance herzustellen (vgl. Struck 1994, S.170).
Die Identitätsbildung setzt ein, wenn das Individuum zwischen sich und anderen zu einer Unterscheidung fähig ist und die Wahrnehmung von eigenen Gedanken und Gefühlen beginnt. Identitätsbildung muss als ein vielschichtiger Reifungs- und Lernprozess auf emotionaler, kognitiver, psychischer und sozialer Ebene begriffen werden. Insbesondere in früheren Lebensabschnitten, aber auch in der Jugendphase machen Individuen ihre Identität weitestgehend an vorgegeben Verhaltensmuster fest (vgl. Lenzen 1994, S.715f.), zu denen auch Verhaltensmuster gemäß der bekannten Geschlechterstereotype gehören können.
2.1.3 Jugend
Sowohl aus psychologischer, als auch aus soziologischer Perspektive ist ,Jugend‘ als eine eigenständige Lebensphase zu betrachten (vgl. Hurrelmann 1995, S.36;49). Eine Festlegung vom Beginn und Ende der Jugendphase ist nicht möglich, da diese Pole historisch und kulturell variieren. Jedoch findet sich in einschlägiger Literatur ein Konsens darüber, dass mit ,Jugend‘ eine bestimmte Altersphase gemeint ist, die in der Regel, mit unscharfen Abgrenzungen, Menschen im Alter zwischen 13 und 25 Jahren einbezieht (vgl. Lenzen 1994, S.799; Gudjons 1999, S.132).
Kaum ein Lebensabschnitt ist so zentral von Veränderungen und Neuorientierungen bestimmt wie die Adoleszenz[6]. Laut psychoanalytischer Entwicklungspsychologie ist sie eine Zeit der Auflösung und Neuorganisation bisher gebildeter Persönlichkeitsstrukturen. Identitätsfindung wird hier zu einer bedeutsamen Aufgabe. Die Jugendlichen sind damit beschäftigt, ihre eigene soziale Rolle zu finden und bisherige Identifikationen umzustrukturieren[7] (vgl. Erikson 2001, S.106f.). Dieses erfolgt in spielerischer Erprobung der Extreme subjektiven Erlebens, der Alternativen ideologischer Ausrichtung und den Möglichkeiten von Verpflichtungen. Eigene Lebens- und Zielvorstellungen sowie Einstellungen werden getestet und mit denen von Erwachsenen verglichen, um sich so in eine soziale Identität hineinzuentwickeln (vgl. Erikson 2001, S.212).[8]
Neben dem Erwerb von Ich-Identität beschreibt Erikson (2001, S.137) außerdem die Kategorie des psychosozialen Moratoriums als ein Kennzeichen von Jugend in modernen Entwicklungsgesellschaften. Die Periode der Jugend kann als eine Art Schonraum oder Aufschub zwischen Kindheit und Erwachsensein beschrieben werden, „während dessen der Mensch durch freies Rollen-Experimentieren sich in irgendeinem der Sektoren der Gesellschaft seinen Platz sucht“ (Erikson 2001, S.137). Jugendzeit ist unter dieser Perspektive eine Schonzeit, in der Selbsterprobung und Selbstfindung stattfindet.[9]
Das gesellschaftlich gewährte Moratorium ist jedoch auch mit Anforderungen verbunden, die von den Jugendlichen erfüllt werden müssen. Zur Individuation und Identitätsentwicklung gilt es in der Jugendphase Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, zu denen u.a. die Ablösung vom Elternhaus, die Entwicklung einer eigenen Lebens- und Berufsperspektive, der Aufbau eines Werte- und Normensystems sowie eines ethischen Bewusstseins als Leitlinie für das eigene Handeln und Verhalten zu zählen sind (vgl. Havighurst 1972; zit. n. Gudjons 1999, S.135). Überdies gehören die Aneignung einer Geschlechtsidentität und der Aufbau eigenverantwortlicher Interaktionsmuster und Sozialbeziehungen zu den jugendlichen Entwicklungsaufgaben (vgl. Havighurst 1972; zit. n. Tzankoff 1992, S.124). Eine integrierte Bewältigung der von Havighurst genannten Entwicklungsaufgaben führt zu dem zentralen Lernziel ,Identität‘ in der Jugendphase.[10]
Zwar ist die Identitätsentwicklung als ein nie abgeschlossener Prozess zu betrachten, im Jugendalter zeigt sie jedoch eine ganz neue Qualität und Dynamik auf. Neben den oben genannten wesentlichen, im Zentrum der Identität stehenden Aspekte[11], muss bei Jugendlichen letztlich ein biographisches Bewusstsein des eigenen, individuellen Lebens entstehen (vgl. Gudjons 1999, S.141).
Da die Ich-Identität außerdem von der historisch-gesellschaftlichen Lage zeittypisch eingefärbt wird, ist gegenwärtig häufig von einer ,patchwork-Identität‘ die Rede: „Das Verschiedenartige, Widersprüchliche, ständig Sich-Verändernde muß zusammengehalten und stets neu ausbalanciert werden“ (vgl. Gudjons 1999, S.141). Falls dieses misslingt, könnte das Resultat eine unsichere Identität sein, die im hohen Maße delinquenzgefährdet ist (vgl. hierzu Kap. 3.6.4). Die erfolgreiche Bewältigung dieses Lebensabschnitts ist zugleich dessen Ende. Es erfolgt der Eintritt in das Erwachsenendasein.
2.1.4 Geschlecht
Ausgangspunkt für jede Überlegung über Unterschiede im Verhalten von Männern und Frauen ist das Vorhandensein von zwei biologischen Geschlechtern des Menschen.
Tillmann (1999, S.41) betont neben der Unablegbarkeit von Geschlechtszugehörigkeit, das Geschlecht sei „nicht nur eine biologische, sondern zugleich eine fundamentale soziale Kategorie“, da „kein anderes menschliches Merkmal so grundsätzliche Auswirkungen auf Erleben und Verhalten, gesellschaftliche Chancen und soziale Erwartungen“ habe.
Wo immer Begegnungen zwischen Menschen stattfinden, wird blitzartig schnell entschieden, ob das Gegenüber dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen ist. Obwohl es in der Mehrheit der Alltagssituationen unbedeutend erscheint, die Person in ihrem Geschlecht wahrzunehmen, scheint es, als wenn alle anderen vorhandenen Differenzen oder Gleichheiten von der Macht eines zweigeschlechtlichen Codes überlagert sind. Dieser Zwang zur Identifizierung von Geschlecht und zur Feststellung geschlechtsspezifischer Differenzen ist nicht einfach zu erklären. Das sicherheitsstiftende und identitätsstabilisierende Streben nach eindeutiger Zuordnung lenkt den Blick offensichtlich auf Differenzen. Es kann als ein Beispiel für die „Unterdrückung von Ähnlichkeit“ und dem Wunsch nach Ordnung in einer komplexen Welt angesehen werden (vgl. Scarbath et al. 1999, S.7f.).
Demnach ist die Kategorie Geschlecht die erste und wichtigste Kategorie, in die wir jeden Menschen sofort und automatisch einordnen. Darüber hinausgehende Eigenschaften werden vor dem Hintergrund dieser zunächst stattgefundenen Geschlechtsidentifikation, je nach Geschlechtszugehörigkeit in unterschiedlicher Art und Weise, bedeutsam.
Die soziale Geschlechtsrolle[12] formt sich entlang biologisch ausgerichteter Zuordnungskriterien heraus. Die Zuordnung zu einem Geschlecht erfolgt nicht aufgrund von Aktivitäten und Verhaltensweisen, sondern aufgrund des biologischen Status. Es werden dem Individuum Verhaltensweisen und Eigenschaften abverlangt, nach dessen Befolgung er als normal oder als von der Norm abweichend beurteilt wird (vgl. Glücks 1996, S.33).
Das Konzept der geschlechtsspezifischen Sozialisation fragt und forscht nach ,typisch‘ männlichen und ,typisch‘ weiblichen Handlungsformen und Sozialisationsmustern. Es wird davon ausgegangen, dass zwar jede Sozialisation unterschiedlich verläuft, dass es jedoch typische Muster für jedes Geschlecht gibt, die ähnliche Formen der Sozialisation hervorbringen (vgl. Prengel 1996, S.63f.). Das Konzept der geschlechtsspezifischen Sozialisation ist immer wieder in Kritik geraten. „Wenn die wissenschaftliche Verwendung der Kategorie Geschlecht, wenn bereits das Fragen nach ,weiblichen‘ und ,männlichen‘ Geschlechtscharakteren, Sozialisationsmustern oder Verhaltensweisen eine Reifikation des gesellschaftlichen Geschlechterdualismus bedeutet und die radikale Abschaffung derartiger Kategorien diskutiert wird, [...] so trifft das den Kern des Konzepts der geschlechtsspezifischen Sozialisation“ (Dausien 1999, S.217).
Angesichts neuerer feministischer Forschungsansätze wird von Bilden (1991, S.280) der Wechsel zu anderen Zugangsweisen vorgeschlagen, die im Kern auf einem sozialkonstruktivistischen Ansatz beruhen.
Gegenwärtig ist also eine zunehmende Einigkeit in der Geschlechterforschung über die Annahme zu finden, dass das Wesen der Geschlechter nicht von Natur aus gegeben, sondern sozial konstruiert ist. Demzufolge ist die – leider nur in englischer Sprache mögliche – Unterscheidung zwischen sex (biologisch abhängiges Geschlecht) und gender (sozial konstruierte Ausprägung des Geschlechts) sinnvoll (vgl. Dietzen 1993, S.12). Der nächste Abschnitt über die soziale Konstruktion von Geschlecht widmet sich diesem Thema ausführlicher.
2.1.5 Soziale Konstruktion von Geschlecht
Befunde der neueren empirischen Geschlechterforschung können die durchaus noch immer populären Annahmen über physiologische und biologische Ursachen unterschiedlichen Verhaltens von Jungen und Mädchen nicht belegen. Die These eines ,natürlichen‘ und damit unveränderbar angelegten ,Geschlechtscharakters‘ kann als ideologisch zurückgewiesen werden (vgl. Tillmann 1999, S.54). Ebenso lassen interkulturelle Vergleiche, die das Ziel verfolgen, Universalitäten von Verhalten in allen bekannten Kulturen zu beweisen, keine Rückschlüsse auf die These zu, dass das biologische Geschlecht das Verhalten bestimmt (vgl. Hagemann-White 1984, S.41; Tillmann 1999, S.48). Geschlechtsspezifisches Verhalten scheint nach Hagemann-White (1984, S.6) eher darin begründet zu sein, dass vom weitgehend gleichen Verhaltensrepertoire beider Geschlechter unterschiedliche Teile abgerufen würden. Sie vertritt die Auffassung, dass Kinder im Verlauf ihrer geschlechterbezogenen Sozialisation ein Normbewusstsein dafür entwickeln würden, dass gleiches Verhalten unterschiedliche Bedeutungen habe, je nachdem, ob ein Junge oder ein Mädchen es aufzeigt.
Geschlecht als soziale Kategorie rückt ins Blickfeld und damit eine unumgängliche Unterscheidung zwischen dem biologischen Geschlecht und dem Konstrukt ,soziales Geschlecht‘, welches das biologische Geschlecht als Merkmal oft erst zum Ausdruck bringt. Diese begriffliche Unterscheidung impliziert die Annahme, dass unterschiedliches Verhalten der Geschlechter nicht aus biologischen und körperlichen Differenzen resultiert, sondern historisch-kulturell bedingte soziale Konstruktionen sind (vgl. Dietzen 1993, S.12).
Basis des Netzes an Unterscheidungen, Zuordnungen und unterschiedlichen Erwartungen an Männern und Frauen ist das früh erlernte und von jedem Individuum übernommene symbolische System der Zweigeschlechtlichkeit; „daß alle Menschen unverlierbar (Konstanzannahme) und aus körperlichen Gründen (Naturhaftigkeit) entweder das eine oder das andere Geschlecht sind (Dichotomizität)“ (Knapp 2000, S.76; Hervorhbg. im Original). Das System der Zweigeschlechtlichkeit zeigt zudem gegenwärtig ein hierarchisches Verhältnis, in dem das männlich Charakterisierte eine höhere Wertung erlangt als das weibliche (vgl. Faulstich-Wieland 2000b, S.51). Überdies durchdringt es den Alltag mit polaren Deutungsmustern, Zuschreibungen sowie Erwartungen und erwirkt, dass gleiches Verhalten von Männern und Frauen unterschiedlich bewertet wird. Ebenso bedingt es, dass unterschiedliche Verhaltensmodalitäten notwendig sind, um die Geschlechtszugehörigkeit darzustellen (vgl. Bilden 1991, S.295).
Heranwachsenden wird das System der Zweigeschlechtlichkeit nicht in seiner vollen Komplexität erfahrbar gemacht, sondern es wird ihnen über die Sozialisationsinstanzen, etwa über die Familie, vermittelt. Kinder erfahren beispielsweise, dass es gemeinhin als anerkannt gilt, wenn Jungen sich aggressiv verhalten. Bei Mädchen dagegen wird dieses Verhalten eingeschränkt (vgl. Nyssen 1990, S.35).
Mädchen und Jungen eignen sich im Verlauf des Sozialisationsprozesses die Bedeutung der Zuordnungen zu einem Geschlecht an. Die dabei entstehende Verhaltenssicherheit ermöglicht es ihnen, durch die in Interaktionen stattfindende Inszenierung als Mädchen oder als Junge, ihrer Geschlechtszugehörigkeit Beständigkeit zu verleihen (vgl. Faulstich-Wieland 2000c, S.11). Der konstruktivistische Ansatz[13] geht davon aus, dass Geschlecht nicht etwas ist, was man hat oder ist, sondern etwas, was man tut. „Geschlecht wird permanent in jeder alltäglichen Interaktion durch den Prozess der Geschlechtsdarstellung, der Geschlechtswahrnehmung und der Geschlechtszuschreibung konstruiert, wobei das
wahrnehmende und einordnende Gegenüber den Hauptteil der Konstruktion leistet“ (Wartenpfuhl 1996, S.192). Geschlecht wird als „interaktive situationsspezifische Konstruktionspraxis“ verstanden (Knapp 2000, S.74).
Ebenso vor dem Hintergrund der neueren Sozialisationsforschung, die die interaktive Dimension und den interaktiven Charakter des Subjekts an seinem Sozialisationsprozess betont, kann geschlechtsspezifische Sozialisation als ein dauernder Prozess sozialer Interaktionen beschrieben werden, der Männlichkeit und Weiblichkeit (re-)produziert: Je nachdem, als welches Geschlecht man mit anderen interagiert, verhält man sich unterschiedlich. Diese Art der Wahrnehmung beeinflusst den Interaktionsprozess und wirkt so auf die Sozialisation und damit auch auf die Identitätsbildung ein (vgl. Müller-Heisrath/Kückmann-Metschies 1998, S.53). Weibliche und männliche Identität können als Produkte andauernder Konstruktionsprozesse verstanden werden (vgl. Bilden 1991, S.290).
Eine Zusammenfassung von Bilden (1991, S.279ff.) ordnet das Verhältnis der Geschlechter in vorzufindende Gesellschaftsstrukturen ein. Dabei wird die Dynamik des Geschlechterverhältnisses (Entstehung und Veränderung der Bedeutung von Geschlecht und geschlechtsbezogener Bedeutungen) als lebenslange Sozialisationsbedingung für Männer und Frauen betont und die oben umrissene Sichtweise verstärkt, die, in Anlehnung an den Symbolischen Interaktionismus, von der zentralen Annahme ausgeht, dass Menschen andauernd ihre soziale Wirklichkeit produzieren und reproduzieren – mit durchdringenden Auswirkungen auf geschlechtsbezogene Überzeugungen, Erwartungen und eigenes Verhalten. Auch hier findet sich der Gedanke wieder, dass das Geschlecht als soziale Kategorie zur Organisation von Informationen und damit zur Einordnung in die soziale Welt unerlässlich ist. Männlichkeits- und Weiblichkeitskonzepte sind demnach vorgezeichnete Deutungsmuster, denen schwer zu entkommen ist.
Wie diese Ausführungen zeigen, hat Geschlechtlichkeit über biologische Dimensionen hinaus Bedeutung, die über soziale Interaktionen angeeignet werden muss. Die beteiligten Akteure werden einer Geschlechterkategorie zugeordnet und lernen im Zuge der Sozialisation, die ihrem Geschlecht zugeschriebenen sozialen Praktiken anzuwenden. Gleichzeitig lernen sie, ihre Gegenüber als gleich- oder gegengeschlechtlich wahrzunehmen. Das bedeutet, dass deren Verhalten ebenfalls stets im Rahmen dieses Systems der Geschlechterverhältnisse bewertet wird, da es keine geschlechtslosen sozialen Praktiken gibt.
Gewalthandlungen von Mädchen werden erheblich stärker abgelehnt als die von Jungen (Pfeiffer/Wetzels 1999, S.14). Körperliche Auseinandersetzungen und das Durchsetzen von Interessen mit Hilfe von Gewalt gehört zum normalen Verhaltensrepertoire heranwachsender Jungen, während es bei Mädchen eher die Ausnahme bildet (vgl. Heitmeyer et al. 1998, S.265). Das Handeln eines jeden wird demnach auf Basis der Geschlechterordnung eingeschätzt. Am Beispiel aggressiven Verhaltens wird dieses eher Jungen zugestanden, während es bei Mädchen als unweiblich sanktioniert wird.
2.1.6 Geschlechterstereotype
Bezüglich psychologischer Geschlechterunterschiede zeigt die bisherige Forschung ein ambivalentes Bild. Einerseits bestehen große Ähnlichkeiten zwischen den Geschlechtern, wenn man sie auf der Grundlage individuell erhobener Daten in individuellen Merkmalen miteinander vergleicht. Auf der anderen Seite steht das Ergebnis, dass Geschlechterstereotype bedeutsame Unterschiede zwischen den Geschlechtern annehmen. Was auf dem ersten Blick widersprüchlich erscheint, hat jedoch mit unterschiedlichen Betrachtungsweisen zu tun: Geschlecht ist einerseits ein individuelles Merkmal, andererseits, wie oben ausgeführt, eine soziale Kategorie (vgl. Alfermann 1994, S.210f.).
Bevor hier Geschlechterstereotype thematisiert werden, ist vorangehend festzuhalten, dass Fragen nach Unterschieden im Verhalten zwischen den Geschlechtern Geschlechterstereotype zusätzlich bestärken. Zugleich laufen sie zwangsläufig auf die Konstruktion eines weiblichen und eines männlichen Sozialcharakters und somit auf die Konstruktion von Unterschiedlichkeiten hinaus. Die Annahme von Stereotypen ist demnach eine Blickrichtung, die die Differenz zwischen den Geschlechtern reifiziert.
Da jedoch männliche und weibliche Jugendliche mit ihren oft rigiden Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit häufig ,Opfer‘ dieser Kategorisierungsfalle sind, soll an dieser Stelle etwas ausführlicher auf das Problem eingegangen werden.
Das Konstrukt ,Stereotyp‘ steht für weit verbreitete, allgemeine und schematisierende kognitive Vorstellungen und Annahmen über Eigenschaften sowie Verhaltensweisen von Personengruppen, die im Verlauf der Sozialisation durch Kategorisierungsprozesse erworben werden. Diese Kategorisierung führt dazu, Unterschiede innerhalb einer Kategorie zu unterschätzen und die zwischen den Kategorien zu überschätzen. Personen der einen Kategorie sind innerhalb dieser als ähnlich und in Bezug zu anderen Kategorien als unähnlich zu betrachten. ,Geschlechterstereotyp‘ bezeichnet entsprechend ein relativ geschlossenes Konzept einer Alltagstheorie über männliche und weibliche Individuen. Als wichtige Mechanismen der Geschlechterstereotypisierung werden Dichotomisierung und Generalisierung angesehen (vgl. Alfermann 1994, S.211; Hilgers 1994, S.42 ff., 74).
Da die Stereotypen geschlechtsspezifische Rollenaufteilungen wiederspiegeln, haben sie darüber hinaus einen bipolaren und normativen Charakter. Denn sie legen fest, welches Verhalten bei welchem Geschlecht als wünschenswert, typisch oder normal gilt. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass die mit dem männlichen Stereotyp verbundene ,Rolle‘[14] in ihrer Wertigkeit höher eingeschätzt wird als die weibliche. Daraus ergeben sich Konsequenzen für das Fremd- bzw. das Selbstbild der Geschlechter sowie deren Interaktionen miteinander. Das männliche Stereotyp ist gekennzeichnet durch Eigenschaften wie Aktivität, Kompetenz, Durchsetzungsfähigkeit und Leistungsstreben, wie auch durch aggressives und raues Verhalten. Das weibliche Stereotyp zeichnet sich durch komplementäre Verhaltensattribute wie Emotionalität und Soziabilität aus (vgl. Dietzen 1993, S.76ff; Alfermann 1994, S.212 ff.).
Eine stereotypisierende Sichtweise erschöpft sich leider nicht nur darin, andere zu beschreiben, sondern hat zugleich enorme Auswirkungen auf soziale Handlungen und demzufolge auch auf Erziehungs- und Sozialisationsprozesse. Die unumgehbare Wahrnehmung einer Person als männlich oder weiblich führt, wie Kapitel 2.1.4 und 2.1.5 gezeigt haben, zu unterschiedlichen Erwartungen an das Verhalten, aber ebenfalls zu unterschiedlichen Verhaltensmodalitäten um seine Geschlechtszugehörigkeit darzustellen und auch zu unterschiedlichen Bewertungen des Verhaltens durch die Interaktionspartner. „Erwartungshaltungen beeinflussen die Deutung aller Lebensäußerungen eines Kindes, und diese Erwartungen sind durch das Geschlecht im Sinne der bekannten Stereotype ausgerichtet“ (Hagemann-White 1984, S.50).
Während unterschiedliche Verhaltensweisen als eher männlich oder weiblich gelten, werden sie bei dem anderen Geschlecht häufig als unangemessen erachtet. Gewalttätiges Verhalten als Konfliktlösungsstrategie und die Durchsetzung der eigenen Position durch körperliche Gewalt weist eine Nähe zum männlichen Geschlechterstereotyp auf. Die Ausübung von Gewalt wird bei Jungen und Mädchen unterschiedlich bewertet. Obwohl gewalttätiges Verhalten generell gesellschaftlich unerwünscht ist und sanktioniert wird, spielt es in der männlichen Sozialisation eine große Rolle.
So gehören spielerische körperliche Auseinandersetzungen zum Verhaltensrepertoire von heranwachsenden Jungen. Bei Mädchen wird dieses Verhalten eher gehemmt, sie werden zu kooperativem Verhalten erzogen (vgl. Bilden 1991, S.287). Sie handeln ihrem weiblichen Geschlechterstereotyp entgegen, wenn sie Gewalt ausüben und werden als ,Mannweib‘ disqualifiziert und reduziert (vgl. Heitmeyer et al. 1998, S.265f.).
2.1.7 Gewaltverhalten und Geschlecht
Wie ein roter Faden zieht sich die Thematik der geschlechtsspezifischen Sozialisation quer durch alle Lebensbereiche und damit durch alle Felder der Sozialisation hindurch. Die Thematisierung der geschlechtsspezifischen Sozialisation soll Antworten liefern auf die Frage, wie unterschiedliches Verhalten der Geschlechter zustande kommt, um daraus Konsequenzen für die praktische Arbeit zu gewinnen. Da die Forschungslage zur geschlechtsspezifischen Sozialisation kaum noch überschaubar ist, können Ergebnisse zu ihren Auswirkungen hier nicht im Detail beschrieben werden. Ich beschränke mich auf die Inhalte, die für mein Thema bedeutsam sind:
Ein Teil der Forschung zur geschlechtsspezifischen Sozialisation richtet sein Augenmerk auf die bedeutungsvolle Dimension der Emotionen, um die es im Folgenden geht.
„Im Kern von Geschlechtsrollenstereotypen bzw. kulturellen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit stehen Annahmen über Emotionalität und emotionale Expressivität: Frauen ,sind‘ emotional; sie ,sind‘ ängstlich und fühlen sich eher traurig oder hilflos als Männer. Diese ,sind‘ rational, d.h. weniger emotional; sie haben Probleme allenfalls mit Aggressionen“ (Bilden 1991, S.285). Diese überspitzt dargestellte und sehr pauschalisierend wirkende Beschreibung von Gefühlen bei Frauen und Männern finden wir heutzutage noch häufig in alltäglichen Aussagen und Annahmen wieder.
Geschlechterstereotype können die Sozialisation von Jungen und Mädchen beeinflussen, da sie häufig in Erziehungszielen und Leitbildern anzutreffen sind. Sie werden über Erwartungen von Interaktionspartnern an die Individuen herangetragen. Hinsichtlich ihrer emotionalen Verhaltensweisen werden Mädchen und Jungen oftmals mit Geschlechterstereotypen konfrontiert. Von Mädchen wird ein eher emotionales, ängstliches und hilfloses Verhalten gefordert, während Jungen dazu aufgefordert sind, sich aggressiv zu verhalten. Diese Erwartungen werden zu Sozialisationsfaktoren, geprägt durch die Vorstellungen über männliche und weibliche Gefühlsdarstellungen (vgl. Müller-Heisrath/Kückmann-Metschies 1998, S.53f.). Gefühlsäußerungen werden in der Familie bei Mädchen eher gefördert und unterstützt, bei Jungen, bis auf Wut- und Aggressionsdemonstrationen, gehemmt. Das Gefühlsrepertoire und damit eingeschlossen das Sich-Ausdrücken, Erfahren und Benennen von Gefühlen wird im Verlauf des Sozialisationsprozesses bei Mädchen somit erweitert und differenziert (vgl. Bilden 1991, S.286). Dass Mädchen häufig Verhaltensweisen aufzeigen, die sie konfliktfähiger[15] als Jungen machen, hat demnach ihren Ursprung in der familiären Sozialisation.
Daraus ist zu folgern, dass Gefühle füreinander und für sich selbst Jungen eher verwehrt sind als Mädchen. Auch die Arbeits- und Berufswelt verlangt meines Erachtens vom männlichen Geschlecht eher Rationalität und nicht Emotionalität. Männliche Jugendliche können also unter dem Druck stehen, ihre Männlichkeit auch damit unter Beweis stellen zu müssen, dass sie keine Gefühle äußern.
Eine geschlechterstereotype Erziehung kann damit Jungen den Zugang zu Gefühlen, zu einer erhöhten Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit sowie die Entwicklung notwendiger sozialer Kompetenzen vorenthalten und trägt somit zu einer defizitären und letztlich unbefriedigenden Sozialisation bei. Diese ermuntert dazu, erfahrene Gewalt aggressiv weiterzugeben. Tatsächlich aber haben Jungen sehr wohl Angst, etwa vor Niederlagen, körperlicher Gewalt, Verlusten und Schmerzen. Jedoch ist ihnen das Äußern dieser Ängste aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit verwehrt – und wenn sie es sich selbst verwehren, um ein ,echter Mann‘ sein zu können. Da die Angst jedoch irgendwo hin muss, wird sie oft in Aggressionen umgewandelt und kompensiert (vgl. Müller-Heisrath/Kückmann-Metschies 1998, S.53f.).
Das hier Dargestellte soll nicht den Eindruck erwecken, dass Jungen nicht oder weniger emotional sind. Die emotionalen Welten von Jungen und Mädchen sind nicht so unterschiedlich, wie häufig behauptet wird. Die Emotionen sind oft die gleichen – doch vorgezeichnete Deutungsmuster machen es ihnen nach dieser Sichtweise schwer, sich anders als ,typisch‘ und ,normal‘ zu verhalten (vgl. Müller-Heisrath/Kückmann-Metschies 1998, S.55). Es ist demnach davon auszugehen, dass der emotionale Zustand eines Menschen durch Übernahme des sozialen Geschlechts kanalisiert, wenn nicht verdeckt wird.
Abschließend lege ich dar, welche weiteren Argumente und Aussagen über einen Zusammenhang zwischen Geschlechtersozialisation und Gewaltverhalten in der Literatur präsentiert werden.
Das soziale Verständnis von Männlichkeit wird, anlehnend an das hierarchische System der Zweigeschlechtlichkeit, mit Überlegenheit und somit auch mit Macht und potentieller Gewaltbereitschaft gleichgesetzt. Daran anschließend kann Popp (1997a, S.9) zufolge Gewaltausübung als ein gesellschaftlich anerkannter Ausdruck von Männlichkeit betrachtet werden. Behn (1994, S.13) schließt sich dieser Annahme an, indem sie konstatiert, dass Gewaltausübung in unserer Gesellschaft zum Mann-Sein dazugehört und gewalttätige Jugendliche durch Gewalttaten ihre Männlichkeit einüben.
Jungen lernen in ihrem Sozialisationsprozess, wie es der vorangegangene Abschnitt verdeutlicht hat, nicht zu weinen, keinen Schmerz zu zeigen, Angst zu unterdrücken sowie Dominanz und Überlegenheit zu demonstrieren. Notfalls geschieht dieses auch durch die Ausübung von Gewalt (vgl. Popp 1997a, S.209). „Viele Männer“, so bestärken Schnack und Neutzling diese Annahme, „geben sich vor allem deshalb stark und überlegen, damit sie nicht schwach wirken“ (Schnack/Neutzling 1995, S.37).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass den gesellschaftlich geprägten Vorstellungen entsprechend Jungen eher Sozialisationsbedingungen ausgesetzt sind, in denen Gewalt eine adäquate Konfliktlösungsmöglichkeit darstellt, die gesellschaftlich auf eine breite Akzeptanz stößt. „Für sie hat die Ausübung von Gewalt eine Bedeutung – die Einübung zentraler Männlichkeitsfunktionen –, die sie für Mädchen nicht hat, nicht haben kann, denn für Frauen gelten andere Erwartungen und Sozialisationsmuster“ (Behn 1994, S.13).
Der Kerngedanke lässt sich hier wie folgt resümieren: Mädchen und Frauen lernen aufgrund der durch die Sozialisationsinstanzen an sie herangetragenen, geschlechtsspezifischen Erwartungen, die häufig einen Verzicht auf offene, aggressive Gewaltanwendungen beinhalten, einen anderen Umgang mit Konflikten und Aggressionen als Jungen und Männer. Eher als diese erlernen sie dadurch das Aushalten von Gewalt und das Unterdrücken von Aggressionen (vgl. Niebergall 1995, S.102f.).
Die Ursachen geringer weiblicher Gewalttätigkeit, allerdings mit Einschränkung auf körperliche Gewaltausübung, können also in der Sozialisation und in den Verhaltenserwartungen der Gesellschaft begründet liegen. Aufgrund dessen muss weibliche Gewalt auch immer im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Erwartungen an ihr Geschlechterverhalten betrachtet werden (vgl. Bütow 1997, S.20). Mädchen haben genügend Anlässe, um aggressive Gefühle zu empfinden. Ein an die ,typisch‘ weibliche Geschlechtsrolle angepasstes Verhalten, um diese Aggressionen offen auszuleben, wären psychische Formen der Gewaltaustragung, die bei Mädchen auch häufig vorzufinden sind und auf die ich im dritten und vierten Kapitel näher eingehe.
Die Friedfertigkeit der Mädchen in Frage stellend ist es, in Anlehnung an gesellschaftliche Erwartungen und Vorbilder, ebenfalls annehmbar, dass wenn körperliche Gewalt Männersache ist, dann ist Bestärkung, Bestätigung und Aufwertung der Männer und somit eine indirekte Beteiligung an Gewaltsituationen, Frauensache (vgl. Popp 1997b, S.85f.).
2.1.8 Einordnung in die Arbeit
Wie lässt sich nun vor diesem Hintergrund von gesellschaftlichen Erwartungen und Vorstellungen abweichendes Verhalten, nämlich die zunehmende körperliche Gewaltbereitschaft junger Frauen, erklären? Den bisher dargestellten Ansichten der geschlechtsspezifischen Sozialisation zufolge wäre das Verhalten sich prügelnder Mädchen nicht erklärbar. Die pure Ausrichtung des Verhaltens auf die sozialen Erwartungen an das weibliche Geschlecht lassen folgern, dass von ausschließlich friedfertigen jungen Frauen und Mädchen auszugehen ist, die sich, wenn überhaupt, im Rahmen ihrer Geschlechtsrolle aggressiv verhalten.[16]
Aber dieser Mythos zerfällt. „Auch unter Mädchen gibt es die lautstarken Angreiferinnen. Auch sie prügeln sich so, daß mal die Unterlippe aufplatzt“ (Schulte 1996, S.7). Hilgers (1997, S.16) spricht sogar davon, dass Mädchen eine ernstzunehmende Aufholjagd bezüglich körperlicher Gewalt beginnen.
An dieser Stelle möchte ich nicht leugnen, dass es Prozesse geschlechtsspezifischer Sozialisation gibt, die zudem zur Erklärung unterschiedlicher Verhaltensweisen im Umgang mit Gewalt herangezogen werden können. Die beschriebenen Sachverhalte sollten ebenfalls in die Konzeption einer geschlechterbewussten Gewaltpräventionsarbeit eindringen. Der Zusammenhang zwischen den Vorstellungen über die Darstellung von Männlichkeit und Gewalt besteht durchaus. Dieses Erklärungskonzept reicht jedoch nicht aus, um bewusst fremdverletzendes Verhalten weiblicher Jugendlicher erklären zu können.
Ich möchte hier der Überzeugung und der Annahme einer geschlechtsspezifischen Sozialisation etwas differenzierter entgegentreten und lehne mich an Nyssen (1990, S.33) an, die konstatiert, dass wenn von geschlechtsspezifischer Sozialisation die Rede sei, dann sei dieses immer idealtypisch gemeint. Es wird oft verallgemeinert und Ausnahmen werden nicht berücksichtigt.
Ausgehend von der Annahme der aktiven Auseinandersetzung des Subjekts mit seiner Umwelt können jedoch Widersprüche, Widerstände und Eigenaktivitäten von Frauen, Mädchen, Männern und Jungen in den Blick geraten. Das bedeutet, dass das Individuum nicht nur gesellschaftlich geprägt, sondern auch selbsttätig handelnd ist (vgl. Nyssen 1990, S.28). Die in Kapitel 2.1.1 beschriebene Konsensdefinition von Sozialisation beinhaltet somit Erklärungsgehalt dafür, dass trotz ziemlich eindeutiger geschlechterstereotyper Vorstellungen an die Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen, auch von den Erwartungen differierendes Verhalten auftritt. Demnach wird die Befolgung dieser Erwartungen aktiv und bewusst abgelehnt.
Bereits in Kapitel 2.1.4 wurde erörtert, dass das Konzept der geschlechtsspezifischen Sozialisation schon früh in die Kritik geriet. Dausien (1999, S.217) kritisiert unter anderem an diesem Konzept, dass es zwischen dem biologischen Geschlecht und dem Verhalten von Jungen und Mädchen Kausalbeziehungen herstellt, dass es deterministisch argumentiert und dass es dichotomische Differenzierungen vertritt. Eine notwendige Fokussierung der Geschlechterdifferenz hat zugleich zu einer Überfokussierung geführt und andere bedeutsame Differenzierungen ausgeblendet.
Die hier kurz umrissene Sichtweise erfordert nach meinem Ermessen eine individuelle Auseinandersetzung mit Jungen und Mädchen sowie mit ihren unterschiedlichen Lebenslagen, Belastungen und Problemen. Einheitliches, gleiches und ,typisches‘ Verhalten qua Geschlecht in Konfliktsituationen ist somit nicht voraussetzbar. Demzufolge ist auch in der pädagogischen Arbeit auf die Annahme zu verzichten, dass es homogene Geschlechtergruppen und damit gleiche Bedürfnisse von Jungen und gleiche von Mädchen gibt.
2.2 Symbolischer Interaktionismus
Der Prozess der Sozialisation umfasst sehr vielschichtige Prozesse und ist eingebunden in ein Netzwerk von gegenseitigen Bedingungen, so dass sich keine Sozialisationstheorie finden lässt, die alle Ausschnitte berücksichtigt. Verschiedene Auffassungen von Sozialisation stellen unterschiedliche Sichtweisen über das ,Mitglied-Werden‘ dar. Die in psychologischer Tradition stehenden Theorien beziehen sich eher auf die Wechselwirkung zwischen innerer Realität (Organismus/Psyche) und Persönlichkeitsentwicklung, während die soziologischen Theorien die Beziehung zwischen äußerer Realität (soziale und materielle gesellschaftliche Bedingungen) und Persönlichkeitsentwicklung thematisieren (vgl. Hurrelmann/Ulich 1991, S.9). Ich beschränke mich in meinen Erläuterungen auf eine dieser Theorien:
In den vorangegangenen Erläuterungen wurde erwähnt, dass sowohl gesellschaftliche als auch persönliche Komponenten in Wechselwirkung an dem Prozess der Sozialisation beteiligt sind. Die Entwicklung einer Geschlechtsidentität sowie geschlechtsspezifischen Verhaltens ist abhängig von gesellschaftlichen Strukturvorgaben und Vorstellungen, die über die Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule, Gleichaltrigengruppe und auch über die Medien vermittelt werden. Diese können, wie in Anlehnung an das Modell des produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts in Kapitel 2.1.1 gezeigt wurde, vom Individuum produktiv verarbeitet und umgesetzt werden. So kann widersprüchliches und von gesellschaftlichen Erwartungen differierendes Verhalten, wie offene aggressive Handlungsweisen junger Frauen, erst erklärbar werden.
Ich beziehe mich in meiner weiteren Ausführung auf den soziologischen Ansatz des Symbolischen Interaktionismus, der die komplexen Beziehungen zwischen Persönlichkeit und Gesellschaft betrachtet. Der Mensch wird in dieser Theorie, ähnlich des Modells des produktiv seine Realität verarbeitenden Subjekts, als ein kreativ und produktiv seine Umwelt zu eigen machendes und gestaltendes Individuum verstanden. Er ist schöpferischer Interpret und Konstrukteur seiner individuellen Entwicklung und seiner sozialen Lebenswelt (vgl. Hurrelmann 1995, S.67). Herausstellen möchte ich hier nicht die passive Anpassung, sondern die aktive und interpretative Leistung des Individuums im Sozialisationsprozess.
2.2.1 Grundlagen
Es soll ein Sozialisationskonzept vorgestellt werden, welches das Individuum nicht als ein determiniertes, gesellschaftliches Wesen auffasst, sondern als Wesen, welches sowohl seine Umweltbedingungen antizipiert als auch aktiv und interpretativ auf die Umwelt einwirkt.
Der Interaktionismus nach Mead, der als dessen Begründer und wichtigster Theoretiker gilt, geht von der Perspektive der an Sozialisationsprozessen Beteiligten aus, hat das Verständnis einer interaktiven Beziehung zwischen Individuum und seiner kommunikativen Umwelt und beschreibt und untersucht das Verhältnis derselben. Ausgangspunkt dieser Theorie ist die Perspektive der Teilnehmenden in täglichen Interaktionen. Ihre Konzentration liegt auf dem mikrosozialen Bereich (vgl. Tillmann 1999, S.133).
Zur Klärung der zentralen Frage, wie planvolles, aufeinander abgestimmtes und kooperatives Handeln zu erklären ist, steht im Kern dieser Handlungstheorie die Analyse der sozialen Funktion der Sprache: Erst durch das Symbolsystem der Sprache kann sich kooperatives, menschliches Handeln und planvolle Interaktion zwischen den Individuen entwickeln (vgl. Baumgart 1997, S.120). Mead unterscheidet deutlich zwischen Symbolen und Gesten bei Menschen und Tieren, um die Bedeutung von gemeinsamer Sprache und Gesten einer Gesellschaft zu thematisieren. Die menschliche Kommunikation ist tierischen Formen deshalb überlegen, weil sie mit Hilfe „signifikanter Symbole“ arbeitet (vgl. Joas 1991, S.138). Symbole sind Bedeutungsträger für die Teilnehmenden an Interaktionsprozessen.
Da Symbole samt ihrer Bedeutungen von Gesellschaftsmitgliedern geteilt werden und so ein Konsens darüber besteht, welche Symbole (ganz wichtig: Sprache) mit welcher Bedeutung versehen sind, sind Interaktionen möglich. „Wir nehmen immer an, daß das von uns verwendete Symbol in der anderen Person die gleiche Reaktion auslöst, vorausgesetzt, daß es ein Teil ihres Verhaltensmechanismus ist“ (Mead 1997, S.126).
Sozialisation vollzieht sich gemäß dieser Theorie im Rahmen von kommunikativen Interaktionen, in denen das Individuum zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit heranwächst. Sie kann zugleich als ein Prozess des Lernens von Rollen und Symbolen verstanden werden (vgl. Hillmann 1994, S.855).
Interessant für meine Arbeit an dieser Theorie ist der Aspekt, dass soziale und kulturelle Bedingungen die Handlungsstrukturen von Menschen zwar beeinflussen, jedoch nicht determinieren. So gesehen sind sie nicht lediglich das Abbild sozialer Strukturen, sondern bilden sich in wechselseitigen Beziehungen untereinander heraus (vgl. Hurrelmann 1995, S.67). Dies könnte erklären, warum sich männliche und weibliche Jugendliche zur Ausgestaltung ihrer Geschlechtsidentität zwar an Männlich- und Weiblichkeitskonzepten orientieren, deren Ausgestaltung aber doch sehr individuell erfolgt und es somit passieren kann, dass eine ,typisch‘ weibliche Identität, in Form einer friedfertigen Frau, bewusst abgelehnt wird.
2.2.2 Identitätsentwicklung im Symbolischen Interaktionismus
Im Folgenden wird erläutert, wie aus einzelnen Interaktionen ein Gesamtprozess der Entwicklung von Persönlichkeit, bezeichnet als Ich-Identität, erfolgt. Grundlegend ist hierbei die oben umrissene Annahme, dass das Individuum ohne soziale Beziehungen und ohne Interaktionen nicht in der Lage ist, Identität zu gewinnen.[17]
Mead unterscheidet zwischen zwei Stadien von Identitätsentwicklung. Seine Vorstellungen darüber sind im Kern in seiner Theorie über kindliche Spielformen enthalten (vgl. Joas 1991, S.139).
Zunächst lernt das Kind im nachahmenden Spiel (play) Rollen anderer zu übernehmen und diese nach zu spielen. Im Verlauf seiner Sozialisation lernt es im Gegenüber nicht nur den konkreten Menschen, sondern den Menschen überhaupt, den so genannten generalisierten Anderen (generalized other) zu sehen. Indem unterschiedliche und gleichzeitig vorhandene Haltungen dieser ,Anderen’ wahrgenommen und mit den eigenen Handlungen koordiniert werden, werden zugleich generalisierte Normen kennen gelernt. Die Verhaltenserwartungen des sog. generalisierten Anderen sind im Fall des game die Spielregeln, im Allgemeinen die Normen und Werte und zwar in einer auf die spezifische Funktion des einzelnen Handelnden spezifizierten Weise. In diesem Stadium der Identitätsentwicklung wird durch Organisation der Haltungen einer gesellschaftlichen Gruppe als Ganzer oder des generalisierten Anderen die Identität gebildet (vgl. Mead 1997, S.129).
Nach dieser Theorie kann es auch zu einem Misslingen von Identitätsbildung kommen. Abhängig ist dieses, so Henschel (1993, S.25), davon, ob dem Subjekt eine Teilhabe an Interaktionen und dem Aufbau an Beziehungen gelingt, oder ob dieses womöglich durch etwas oder durch andere behindert oder verhindert wird.
Identität (Self) besteht nicht nur aus verinnerlichten Haltungen und Rollenerwartungen, sondern entsteht durch das Zusammenspiel zweier voneinander abhängiger psychischer Instanzen, dem I und dem Me. Diese können als verschiedene Phasen des Selbst beschrieben werden. Ihr temporäres Zusammenspiel konstituiert das individuelle Handeln und die Identität von Individuen (vgl. Baumgart 1997, S.123).
Das I ist das Ich als Subjekt, welches spontan und kreativ ist. Im Me schlagen sich Bezugspersonen oder Bezugsgruppen (generalisierte Andere) nieder. Folglich ist es mit gesellschaftlichen Normen verknüpft. Es wirkt als Kontroll- und Bewertungsinstanz zur Strukturierung spontaner Impulse (vgl. Joas 1991, S.139). Aus dem Me ergeben sich somit die handlungsleitenden Orientierungen. Das Self, als Produkt des I und Me, ist folglich nicht nur bloßer Ausdruck gesellschaftlicher Normen und Erwartungen, sondern erhält durch das I ein Rest an Spontaneität und Kreativität, der sozialen Wandel begünstigt (vgl. Gudjons 1999, S.165). Nach dieser Theorie kommt erst im Jugendalter das erstarkte, hinterfragende I zu dem relativ reflexionslosen Me hinzu. Da Handlungen des I immer zu Reaktionen anderer Menschen führen, kann das Me aller Menschen geändert werden. Hierin liegt zugleich die Möglichkeit der Theorie, soziale Wandlungsprozesse zu beschreiben (vgl. Faulstich-Wieland 2000a, S.152).
Voraussetzung für eine glückende Interaktion und auch unerlässlich für die Entwicklung der Identität ist die Fähigkeit zu einer Perspektivübernahme: Die gedankliche Vorwegnahme von Sichtweisen und Verhalten des Interaktionspartners der eigenen Person gegenüber (vgl. Baumgart 1997, S.121). Um gemeinsam und abgestimmt handeln zu können, müssen Individuen dazu fähig sein, Empathie zu entwickeln, auch um die eigene Handlung in ihrer Bedeutung für den anderen einzuschätzen. Menschen lernen, sich mit Hilfe der übernommenen Symbolsysteme in die Rollen anderer hinein zu versetzen und mit deren Augen die Situation zu betrachten (vgl. Tillmann 1999, S.136). Dieses ist erst Jugendlichen möglich (vgl. Baacke 1994, S.200). Wechselseitiges Einbringen von Identitätsanteilen in den Kommunikationsprozess wird als role-taking und role-making bezeichnet. Die eigene Handlung wird in der Bedeutung für den anderen eingeschätzt, dessen Reaktion einkalkuliert und vorweggenommen (role-taking). Entsprechend wird dann vom Individuum seine Rolle, unter Einbringen eigener Identitätsanteile ausgestaltet (role-making). Dieses muss nicht deckungsgleich mit dem sein, was ihm das Gegenüber als Rolle ansinnt. Das Gegenüber muss sich nun auf das role-making des Individuums einstellen, und seinerseits reagieren (vgl. Tillmann 1999, S.136).
„Das Verhalten anderer zu antizipieren, bedeutet nicht, zu konformem Verhalten bereit zu sein“ (Joas 1991, S.143). Deutlich sind hier die Gestaltungsmöglichkeiten des Subjekts im Hinblick auf seine soziale Umwelt und seine eigene Entwicklung sichtbar und nonkonformes Verhalten Jugendlicher auf mikrosozialer Ebene wird erklärbar. Das Antizipieren von Verhaltensanforderungen wie beispielsweise, dass Gewalt keine gute Problemlösungsstrategie in Konflikten ist und dass dieses Verhalten nicht dazu dient, seine Geschlechtszugehörigkeit als junge Frau darzustellen, lässt noch lange nicht auf eine uneingeschränkte Erfüllung dieser schließen.
Es zeigt sich, dass in dieser Theorie Persönlichkeitsentwicklung als ein gemeinsames Wechselspiel von Vergesellschaftung und Individuation, bei dem die gesellschaftlichen Bedingungen die Bewusstseins- und Handlungsstrukturen des Menschen wohl beeinflussen, aber nicht determinieren, begriffen wird (vgl. Gudjons 1999, S.165). Das Menschenbild ist hier das eines Subjekts, welches seine Umwelt aktiv gestaltet und verarbeitet sowie vorgefundene Lebensbedingungen nicht einfach verinnerlicht, sondern individuell interpretiert und in das eigene Identitätskonzept aufnimmt.
Indem sich der Einzelne reflexiv die Sprachsymbole, Werte und Normen seiner sozialen Umgebung aneignet, wird aus ihm ein handlungsfähiges Mitglied der Gesellschaft und zugleich ein einmaliges und unverwechselbares Individuum. Eine so verstandene Ich-Identität muss immer wieder neu ausgehandelt, ausbalanciert, uminterpretiert und weiterentwickelt werden (vgl. Tillmann 1999, S.138). Identität ist auch nach diesem Konzept keine Dimension, die als ,erreicht‘ und ,abgeschlossen‘ betrachtet werden kann (vgl. Kap. 2.1.2).
2.2.3 Geschlecht im Symbolischen Interaktionismus
In Meads Annahmen über sozialisationstheoretische Prozesse der Rollenübernahme und Identitätsentwicklung lassen sich laut Tzankoff (1995, S.38), die sich ausführlich mit dem Symbolischen Interaktionismus in Bezug auf Geschlecht und Schule beschäftigt hat, keine Hinweise finden, dass die Prozesse bei Jungen und Mädchen grundsätzlich andere wären. Die Geschlechterfrage wird von Mead nicht thematisiert. „Sie ist jedoch über die Differenzierung der Spiele, [...] ebenso wie über die Bestimmung der ins Me eingehenden unterschiedlichen Erwartungen an die Geschlechter – manche Gesten sind nur Frauen gegenüber, andere nur Männern gegenüber ,erlaubt‘ – und mit den Begrifflichkeiten des Symbolischen Interaktionismus modellhaft erklärbar“ (Faulstich-Wieland 2000a, S.146).
Das Geschlechterverhältnis, welches als ein System von Symbolisierungen betrachtet werden kann, ist in Bezug zu Konzepten des Symbolischen Interaktionismus zu setzen: Man handelt „ in Interaktionen aufgrund von symbolischen Bedeutungen [...], mit Bezug auf die symbolischen Bedeutungen, die Dinge, Handlungen und Darstellungen im Geschlechterverhältnis haben “ (Bilden 1991, S.291; Hervorhbg. im Original). Diese symbolischen Bedeutungen können in einzelnen Interaktionen zwischen den Interaktionspartnern ausgehandelt und zum Teil verändert werden. Somit ist ebenfalls das Geschlechterverhältnis langfristig wandelbar (vgl. Bilden 1991, S.291).
Die Theorie des Symbolischen Interaktionismus ermöglicht es, Veränderungsprozesse in einzelnen Interaktionen zu erklären. Individuen sind nicht ausschließlich durch gesellschaftliche Rahmenvorgaben in ihren individuellen Handlungs- und Interpretationsmöglichkeiten begrenzt, wohl aber beeinflusst. Vorgegebene Spielregeln von Interaktionen können, wenn auch begrenzt, von den Interaktionsteilnehmenden interpretiert und somit das Selbst und die Identität zur Geltung gebracht werden.
Anzumerken sei hier aber die Kritik Bildens (1991, S.291), dass individualistische Illusionen sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass bestehende Machtgefälle und Hierarchien, wie die Ungleichheit von Mann und Frau, hier ausgeblendet würden, denn Veränderungs- und Aushandlungsmöglichkeiten schlössen immer auch die Frage von Macht und materiellen Ressourcen mit ein.
Da das Individuum laut dieser Theorie aktiv an seinem Sozialisationsprozess beteiligt ist, unterliegt der konkreten Ausgestaltung seiner Geschlechtsrolle einerseits der Ermittlung für ein bestimmtes gesellschaftliches Verständnis (generalisierter Anderer) sowie ebenso der individuellen Interpretation (vgl. Schmuck 1997, S.45).
Nach dieser Theorie wird in den sozialen Interaktionen eine Veränderung ermöglicht , da das Individuum als produktiv seine Realität verarbeitend betrachtet wird. Wiederum können auf diese Weise soziale Handlungen bestehende Geschlechterstereotype bei all ihrer Langlebigkeit beeinflussen. So könnten diese durch Lernprozesse modifiziert und verändert werden, was auf ein allmähliches ,Bröckeln’ traditioneller Geschlechterstereotype hoffen ließe.
Abweichungen und Veränderungen traditioneller Verhaltensstandards zeigen ebenfalls auf, dass die in der Gesellschaft praktizierten Geschlechterdifferenzierungen einem Wandel der Zeit unterliegen (vgl. Schmuck 1997, S.45). Auf die gesellschaftlichen Aspekte der Veränderung werde ich im vierten Kapitel detailliert eingehen.
Die Betonung der Individualität, trotz Beeinflussung durch die Gesellschaft, lässt männliche und weibliche Menschen nicht als homogene Gruppe erscheinen und gibt auch eine Erklärungsgrundlage dafür, dass in einzelnen Wechselbeziehungen Verhaltensmodalitäten zur Darstellung von Weiblichkeit variieren und sich verändern können. Die eher als negativ zu bezeichnende Variation einzelner Aushandlungen, wäre beispielsweise die offene Gewaltanwendung von Frauen.
Auch wenn Geschlecht nicht im Sinne einer austauschbaren Rolle betrachtet werden kann, sondern höchstgradig identitätsrelevant ist, so kann mit der Theorie des Symbolischen Interaktionismus doch die Möglichkeit eines Wandels von Verhalten, sowie Veränderungen und Abweichungen von allgemeinen Normen und Erwartungen an die Geschlechter erklärt werden.
2.3 Entwicklung von Geschlechtsidentität im Jugendalter
Jugendliche sind kognitiv so weit entwickelt, dass eine Auseinandersetzung mit ihrem Selbst- und Fremdbild stattfindet, sowie auch körperliche Veränderungen erneut zu einer Konfrontation mit ihrer Geschlechtszugehörigkeit führen (vgl. Gudjons 1999, S.140).
Die Identifikation mit dem eigenen Geschlecht und damit einhergehend der Erwerb einer Geschlechtsidentität, sind bedeutsame Komponenten der Persönlichkeitsentwicklung. Zu betrachten ist die Entwicklung von Geschlechtsidentität nicht als ein Entwicklungsprozess neben anderen, sondern in Verbindung mit allen anderen Sozialisationsdimensionen. Sie ist konstituierendes Moment des Sozialisationsprozesses insgesamt (vgl. Nyssen 1990, S.32). Identität ohne Geschlechtsidentität gibt es nicht. Die Verweigerung einer Geschlechtsidentität, so Hagemann-White (1984, S.32), kommt einem der schlimmsten sozialen Schicksale gleich, die man gegenwärtig erleben kann, da es in unserer Kultur keinen Zwischenraum zwischen den Geschlechtern gibt. Andererseits aber darf das Individuum auch nicht als ein auf seine Geschlechtsidentität reduziertes Wesen begriffen werden, sondern als eine Summe von Potentialen und Fähigkeiten, die durch Geschlechtsidentität allein nicht abgedeckt werden könnten (vgl. Nyssen 1990, S.32).
Zu dem in Kapitel 2.1.3 erwähnten ,freien Rollen-Experimentieren‘ während der Adoleszenz, gehört auch das Experimentieren mit der eigenen Geschlechtsrolle (vgl. Popp 1992, S.52). Eine relevante und zentrale Entwicklungsaufgabe für Jugendliche ist also die Entwicklung und Ausgestaltung einer geschlechtlichen Identität als Mann oder Frau. Bestehende Geschlechterverhältnisse – die herrschenden Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit – existieren nach Holzkamp (1994, S.73) und Popp (1997a, S.208) bei diesem Prozess als gesellschaftliche Vorgaben.
Da es keine Identität außerhalb des Geschlechts gibt, ist es für Jugendliche eine Grundvoraussetzung zur sozialen Interaktion und Identitätsbildung, eindeutig zu einem der beiden Geschlechter zu gehören und die daran geknüpften Erwartungen sowie subjektiven Aneignungsformen zu verinnerlichen. Der Druck auf geschlechtsrollenadäquates Verhalten wird verstärkt und von Jugendlichen oftmals durch Orientierung an Geschlechterstereotype bewältigt (vgl. Tzankoff 1992, S.124).
Die Entwicklung der Geschlechtsidentität ist demnach geprägt von unterschiedlichen Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern, die auf die Sozialisationsprozesse Jugendlicher Einfluss nehmen und zu geschlechtspezifischem Verhalten führen können (vgl. Hanssen/Micheel/Wagenblass 1998, S.573). So wird in Anlehnung an das Konzept der geschlechtsspezifischen Sozialisation angenommen, dass es bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen gibt, wie Männer und Frauen zu sein haben. „Männlichkeit – das wird Jungen von klein auf nahe gelegt – findet ihren Ausdruck in Dominanz, aggressiver Selbstbehauptung, Affektkontrolle, Erfolg, Abwertung des Weiblichen. Weiblichkeit – das wird Mädchen von klein auf nahe gelegt – findet ihren Ausdruck in der sexuellen Attraktivität für den Mann und in der Bezogenheit auf Männer, im Fürsorgeverhalten, in der ,Friedfertigkeit‘, in der Selbstabwertung“ (Holzkamp 1994, S.73). Unter dieser Perspektive ist wieder ein enger Zusammenhang zwischen Männlichkeitsvorstellungen und Gewalt zu erkennen. Hierin kann sicherlich ein Grund dafür liegen, warum männliche Jugendliche eher als weibliche dazu tendieren, Gewalt als Lösungsstrategie in heiklen Situationen einzusetzen.
Gegen diese Annahme spricht jedoch nach meiner Ansicht, dass nicht alle weiblichen Jugendlichen so friedfertig und harmonisch sind, wie es ihnen nach Holzkamps Erläuterungen nahe gelegt wird.
Aber auch Popp (1997a, S.208) bestärkt die Annahme, dass die Identitätsentwicklung in der Jugendsozialisation zunehmend von Geschlechtsrollenerwartungen geprägt sei.
Der Prozess der einseitigen Prägung durch gesellschaftliche Erwartungen gemäß des Geschlechts steht jedoch im Widerspruch zu den Vorstellungen des Sozialisationsvorgangs bei Jugendlichen nach dem Symbolischen Interaktionismus und der Auffassung der neueren Sozialisationsforschung, die das Individuum als eines nicht nur von seiner Umwelt geprägtes, sondern sich aktiv gestaltendes Wesen betrachtet. Die Persönlichkeit eines Menschen, zu der die Geschlechtsidentität als ein konstituierender Moment zu zählen ist, entwickelt sich nach der Konsensdefinition von Sozialisation wie auch nach der Theorie Meads aktiv im Austausch zwischen dem Subjekt und der gesellschaftlich vermittelten Umwelt durch Interaktionen. Das Individuum lernt, welche geschlechtsspezifischen Anforderungen an den Inhaber eines Geschlechts gestellt werden. Trotzdem sind Jugendliche den gesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungen nicht hilflos unterworfen und in der Lage, diese für sich und ihre Selbstdefinition abzulehnen.
Männer und Frauen weichen immer mehr von den ,Normalitätsstandards‘ von Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern ab. Sie übernehmen nicht einfach das, was gesellschaftlich als angemessen und passend für ihr Geschlecht erachtet wird. Nur partiell akzeptieren sie vorgeschriebene Rollen. Ansonsten ist ihre Geschlechtsidentität in ihren Widerständen, Zurückweisungen und Neuinterpretationen zu verstehen (vgl. Dietzen 1993, S.14).[18] So argumentiert auch Preuss-Lausitz (1996, S.192), wenn von dem Modell des Menschen ausgegangen wird, der produktiv seine Realität verarbeitet, aktiv eingreift und sich so seine ihn beeinflussende Umwelt selbst auswählt und strukturiert, dann muss dieses Konzept, „wenn es akzeptiert wird, auch auf die schon in der Kindheit stattfindende Aneignung und Auseinandersetzung mit geschlechterrelevanten Normen, Verhaltensaufforderungen, Signalen und Modellangeboten angewandt werden“ (Preuss-Lausitz 1996, S.192). Männliche und weibliche Jugendliche sind nicht hilflos Geschlechtsrollenerwartungen ausgesetzt, denen sie nicht entkommen können und denen sie sich zu fügen haben. Sie sind nicht nur Opfer von vorgegebenen Verhältnissen, sondern eignen sich ihre Umwelt aktiv an und wählen aus. Neben der Anpassung wird ebenfalls häufig Widerstand geleistet (vgl. Preuss-Lausitz 1996, S.192, 165).
2.4 Zusammenfassung
Im Anschluss möchte ich nun mir wesentlich Erscheinendes aus der Theorielandschaft zusammenfassen.
Mein Anliegen war es zu verdeutlichen, welche Bedingungsfaktoren Einfluss auf die Entwicklung von Jungen und Mädchen nehmen und die mehr oder minder starke Ausprägung stereotyper Geschlechtsrollen und Verhaltensweisen mit verursachen. Dabei betonte ich zudem, dass diese Strukturen Veränderungen durch die an der Gesellschaft teilhabenden Individuen erfahren können.
Geschlechtsspezifische Sozialisationsbedingungen können einschneidende Auswirkungen auf das Verhalten in Gewalt- und Konfliktsituationen haben. In den Beschreibungen zur Jungensozialisation hat sich gezeigt, dass in der Literatur häufig davon ausgegangen wird, dass Jungen von klein auf ein völlig anderer Umgang mit Konflikten und Emotionalität vermittelt wird als Mädchen. Sie erlernen im Verlauf ihrer Sozialisation eher konfliktverschärfende Verhaltensweisen, um ihre Interessen durchzusetzen. Mädchen dagegen lernen entweder ihre Aggressionen zu unterdrücken, auf subtilere Art zum Ausdruck zu bringen, oder Verhaltensweisen zu übernehmen, die gleichzeitig als Kompetenzen zur Konfliktdeeskalation gelten können.
Weiter kann festgehalten werden, dass von Jungen ausgehendes gewalttätiges Verhalten eher toleriert wird, als das von Mädchen. Heutzutage hat man es noch häufig mit stereotypen Ansichten und Vorstellungen über die Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun. Wie aufgezeigt wurde, ist hier ein Zusammenhang in Bezug auf Gewaltverhalten zu erkennen. Dass körperlich gewalttätiges Verhalten eher zum Verhaltensrepertoire männlicher Jugendlicher zu zählen ist und bei ihnen auch weniger sanktioniert wird, kann als ein Aspekt dafür gelten, dass männliche Jugendliche statistisch gesehen deutlich häufiger an Gewaltdelikten beteiligt sind als junge Frauen.
Ein Beitrag zu einer notwendigen Veränderung im geschlechterstereotypen Denken – um ebenfalls der Vorstellung entgegenzutreten, dass es zum Mann-Sein dazu gehört, Konflikte unter Zugriff von Gewalt zu lösen – könnte beispielsweise in der Reflexion der Verhaltenserwartungen an sich und andere Menschen liegen. Es muss auf jedem Fall darum gehen, einen Ausweg aus gesellschaftlich tradierten und auch geschlechtsspezifischen Diskriminierungen und Reduzierungen zu finden (vgl. Hilgers 1994, S.75, 79ff.).
Geschlechtszugehörigkeit ist höchstgradig identitätsrelevant. Sich als Junge oder als Mädchen zu identifizieren, darzustellen und zu inszenieren, gewinnt besonders in der Jugendphase an Bedeutung. Aber die Art der Ausrichtung der Inhalte zur Darstellung der Geschlechtszugehörigkeit kann durch Alternativen – durch neue Vorbilder – modifiziert werden. In Bezug auf die Entwicklung einer positiven männlichen Geschlechtsidentität kann nach Böhnisch (2001, S.78) die Jugendphase als eine Lebenszeit erachtet werden, in der die Chance besteht, die Zwangsläufigkeit des Mann-Werdens[19] zu unterbrechen. In Kapitel 2.3 wurde verdeutlicht, welche Relevanz der Entwicklungsaufgabe der Geschlechtsidentitätsfindung zukommt. Trotzdem muss dieses nicht unabwendbar zur Herausbildung einer ,typisch‘ männlichen oder ,typisch‘ weiblichen Geschlechtsidentität führen. Hier liegen ebenfalls Chancen für eine geschlechterbewusste Gewaltpräventionsarbeit. Wenn die Jugendphase, anlehnend an Erikson (2001, S.106f.), eine Phase des Ausprobierens unterschiedlicher Rollen darstellt, bietet sich hier für die pädagogische Arbeit die Möglichkeit, sich mit traditionellen Männlichkeitsvorstellungen auseinander zu setzen, diese zu überdenken und zu hinterfragen. Durch ein Angebot von Alternativen würde sich jugendlichen Männern die Möglichkeit bieten, sich fernab von körperlicher Stärke und Gewaltbereitschaft im Sinne männlichkeitsdarstellender Eigenschaften als Mann zu inszenieren.
Die These, dass Verhalten, darunter auch Verhalten in Konfliktsituationen, von männlichen und weiblichen Jugendlichen stark durch geschlechtsspezifische Erziehungs- und soziale Erwartungsmuster geprägt ist, behält für mich zwar Gültigkeit und Relevanz, jedoch nicht mit der Ausschließlichkeit, mit der sie vielfach vertreten wird. So habe ich im Verlauf dieses Kapitels angemerkt, dass diese Sichtweise hier etwas zu kurz fasst. Mittels der Theorie der geschlechtsspezifischen Sozialisation sind weder Widersprüche, Abweichungen und Ausnahmen, wie die zunehmende Gewaltbereitschaft weiblicher Jugendlicher, noch die nur bruchteilhafte Beteiligung männlicher Jugendlicher an Gewaltprozessen erklärbar. Es ist deutlich geworden, dass sie nicht als alleinige Erklärungsgrundlage für das Gewaltverhalten von jungen Männern und schon gar nicht für das zunehmende Gewaltverhalten junger Frauen dienen kann. Da die Theorie der geschlechtsspezifischen Sozialisation, wie sich gezeigt hat, sehr ,idealtypisch‘ argumentiert, sind von diesem Ideal differierende Phänomene durch sie schwer darzustellen. Der Eindruck entsteht, als bezöge sich die Theorie auf alle Individuen, somit läuft sie gleichzeitig in Gefahr, Variationsbreiten im Verhalten innerhalb der Geschlechtergruppen zu vernachlässigen. Meines Erachtens kann das Konzept der geschlechtsspezifischen Sozialisation auch bei der Ursachenbetrachtung von Gewalt männlicher Jugendlicher höchstens als integrative Erklärungsgrundlage dienen. Andere Faktoren haben gleichermaßen Auswirkungen auf die Gewaltbereitschaft, sowohl männlicher als auch weiblicher Jugendlicher, wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit dargestellt wird.
Die Kategorie Geschlecht muss, so hat sich gezeigt, einerseits als eine grundlegende Dimension sozialer Organisation verstanden werden. Andererseits werden in individuellen Umgangsweisen die genannten gesellschaftlich vorgeschriebenen Aspekte von Geschlechtlichkeit zwar sichtbar, sind in den individuellen Beziehungen zwischen den Geschlechtern jedoch auch aushandelbar (vgl. Dietzen 1993, S.11, 171f.).
[...]
[1] Auszug aus einem Interview mit einem 17jährigen Mädchen im Rahmen einer Studie im Großraum Köln.
[2] In Abgrenzung zu Sozialisation wird ,Erziehung‘ heute als eine geplante, gezielte Beeinflussung verstanden, in der Normen und Werte bewusst und zielstrebig an den Heranwachsenden herangetragen werden (vgl. Nyssen 1990, S.27).
[3] Beispielsweise in Familie und Schule.
[4] Im Sinne der Auffassung Durkheims von Sozialisation (vgl. Kap. 2.1.1).
[5] Wie ich in dem Abschnitt ,Strukturwandel der Jugendphase‘ aufzeigen werde, ist der gesellschaftliche Wandel z.Z. mit daran beteiligt, dass Jugendliche das Gefühl der Kohärenz nur schwer erreichen können. Ungleichheiten, Widersprüche und Ambivalenzen sind z.T. schwer zu bewältigen und können als ein Erklärungsansatz für Gewaltverhalten, auch von weiblichen Jugendlichen, dienen (vgl. Kap. 3.6.4).
[6] Der Begriff ,Adoleszenz‘ wird vor allem in entwicklungspsychologisch und psychoanalytisch orientierten Schriften benutzt (vgl. Lenzen 1994, S.800). ,Adoleszenz‘ meint eine zeitlich über die Pubertät hinausgehende Lebensphase, gemeinhin unter dem Terminus ,Jugend‘ zusammengefasst (Baacke 1994, S.37).
[7] Auf diesen Punkt werde ich noch später eingehen, wenn es darum geht, in welcher Altersphase geschlechterbewusste Gewaltpräventionsarbeit sinnvoll einzusetzen ist, und welche Vorteile das Jugendalter hier bietet (vgl. Kap. 5).
[8] Anzumerken ist hier, dass Theorien über das Jugendalter (z.B. Eriksons) zwar von der Jugend und den Jugendlichen sprechen, implizit und explizit aber doch junge Männer meinen. Mädchen werden dabei entweder subsumiert oder sie erscheinen als ,Abweichung‘ vom männlichen ,Normalfall‘ (vgl. Tillmann 1992, S.7).
[9] Ob in diesem Zusammenhang auch Jugendgewalt als eine Form der Ausgestaltung der Übungsphase ,Jugend’ erachtet werden kann, wird in Kap. 3.1. näher erläutert.
[10] Inwiefern die von Havighurst genannten Entwicklungsaufgaben auch nur die männlicher Jugendlicher illustrieren, ist in anderen Kontexten nachzugehen.
[11] Die Unterschiedlichkeiten der Rollen müssen so von ihnen bewältigt werden, dass sie das Gefühl der Kohärenz haben. Eine Vermittlung zwischen den persönlichen Wert- und Leitbildern muss stattfinden (vgl. Gudjons 1999, S. 141).
[12] Ein Hinweis zu dem in der Literatur häufig verwendeten Begriff der Geschlechtsrolle scheint mir an dieser Stelle angebracht. Die Kategorie der Geschlechtsrolle ist zwar zum einen hilfreich für die Annäherung an das Phänomen ,Geschlecht‘ und seine soziale Bedeutung, aber weiblich oder männlich sein hat eine derart große Identitätsrelevanz und wirkt derart persönlichkeitsstrukturierend, dass der auf Wechselbarkeit angelegte Rollenbegriff dem nicht genügend gerecht wird (vgl. Hilgers 1994, S.68f.; Faulstich-Wieland 1999, S.49). Aufgrund dieser Sichtweise muss Abschied genommen werden vom Begriff der Geschlechtsrolle, denn Frau-Sein oder Mann-Sein lässt sich nicht im Rollenbegriff des funktionalistischen Ansatzes fassen. So äußert sich auch Goffmann (1994, S.105) gegen die herkömmliche Auffassung, Geschlecht als ein „erlerntes diffuses Rollenverhalten“ zu verstehen. Bilden (1991, S.280) verweist darauf, dass das Konzept der Geschlechtsrolle zunehmend schärferer Kritik unterliegt: „Die Rollen-Metapher ist der psychischen Zentralität und der Nichtablegbarkeit von Geschlecht nicht angemessen; sie unterschlägt Macht- und Dominanzverhältnisse und ist ungeeignet, historische Veränderungen aus einer inneren Dynamik zu konzipieren; sie hat eine fatale Nähe zum vorherrschenden Denken von Geschlecht in polaren psychologischen Eigenschaften“. Jedoch werde ich, wenn es in der Literatur nicht anders angegeben ist, den Begriff der Rolle weiter verwenden. Aber, um die Dauerrelevanz des Geschlechts zu unterstreichen, erachte ich den Begriff der Geschlechtsidentität besser geeignet als den der Geschlechtsrolle.
[13] Der konstruktivistische Ansatz steht in der Theorietradition der Ethnomethodologie, deren Forschungsinteresse die Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit darstellt. Auf der Ebene von Alltagshandeln und Alltagswissen werden die (Selbst-)Konstruktionsprozesse von Geschlechtszugehörigkeit ermittelt (vgl. Wartenpfuhl 1996, S.192).
[14] Vgl. Fußnote 12.
[15] Gefühle verbalisieren und darstellen können sind wichtige Kompetenzen in der Konfliktdeeskalation, wie ich in Kapitel 5 darstellen werde.
[16] Ebenso ist sich, in Bezug auf die Sozialisation von Jungen, die Frage zu stellen, ob Gewalttätigkeit zu einem ,richtigen‘ Jungen wirklich dazugehört. Wie ist dann die Minderheit (vgl. dazu Kap. 3.2) der gewalttätig werdenden männlichen Jugendlichen zu erklären?
[17] Da Ich- Identität nicht, wie von Erikson dargestellt, als eine psychische Leistung der Individuen allein zu betrachten ist, sondern erst in Beziehungen zu Menschen aufgebaut werden kann, kann laut Baacke (1994) der Symbolische Interaktionismus zur Ergänzung Eriksons Schema herangezogen werden.
[18] Dieser Aspekt ist wichtig, denn so bleibt erklärlich, dass es keine vollständige Zuschreibung von Identität durch gesellschaftliche Rollen und Normen gibt (vgl. Dietzen 1993, S.14).
[19] Im Sinne eines archaischen Mannes, der all seine Konflikte mittels Gewalt zu lösen sucht und gewalttätiges Verhalten als Ausdruck des Mann-Seins erachtet.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832469993
- ISBN (Paperback)
- 9783838669991
- DOI
- 10.3239/9783832469993
- Dateigröße
- 983 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hamburg – Erziehungswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2004 (Januar)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- mädchengewalt geschlechtersozialisation deprivation geschlechterwandel jugendproblematik
- Produktsicherheit
- Diplom.de