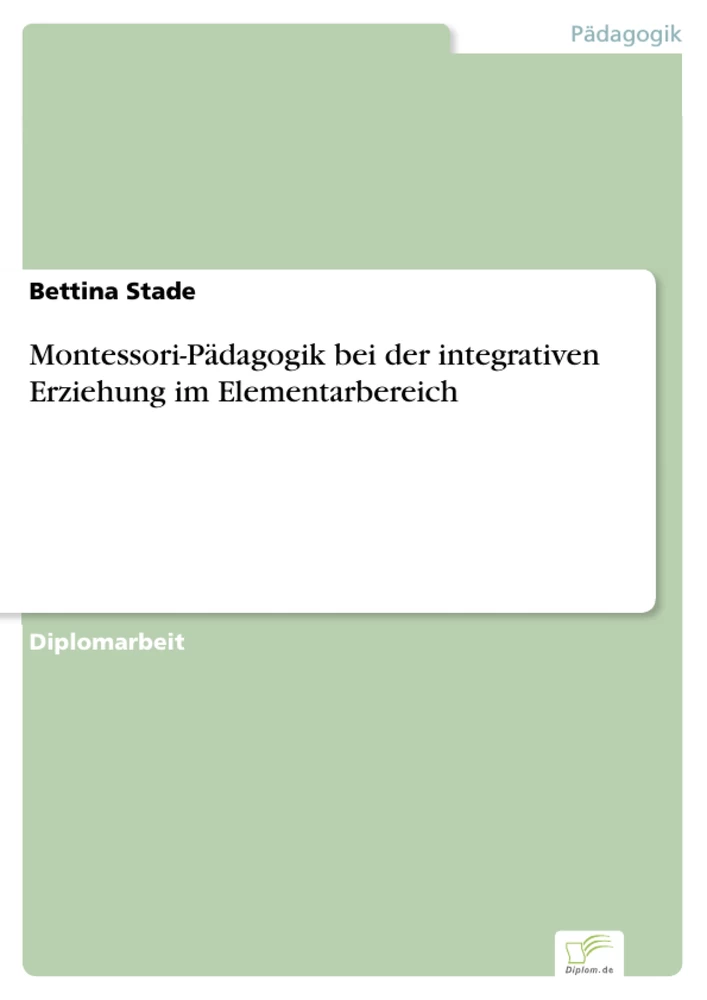Montessori-Pädagogik bei der integrativen Erziehung im Elementarbereich
Zusammenfassung
Der Umgang mit Menschen mit Behinderung(en) in unserer Gesellschaft ist insgesamt von der immer differenzierter gewordenen Ausgrenzung dieser Personengruppe in spezialisierte und zentralisierte Sondereinrichtungen bestimmt. Schon im Elementarbereich trifft man auf Sonderkindergärten für Geistigbehinderte, Sprachbehinderte, Sehgeschädigte, Hörgeschädigte, Körperbehinderte etc. Im schulischen Bereich gliedert sich dieses System von Sondereinrichtungen noch weiter auf. In den letzten Jahren jedoch wurde die Integration von Menschen mit Behinderung(en) zu einem immer häufiger diskutierten Thema, wesentliche Anstöße hierzu kamen aus dem Ausland (z.B. aus den skandinavischen Ländern, den USA). Ende der 70er Jahre gab es in der Bundesrepublik Deutschland nur vereinzelt integrativ arbeitende Kindergärten und auch heute verbreitet sich die integrative Erziehungsform eher langsam.
Das Deutsche Jugendinstitut e.V. hat über mehrere Jahre hinweg integrative Einrichtungen in den alten Bundesländern beobachtet und u.a. festgestellt, dass in verhältnismäßig vielen integrativ arbeitenden Einrichtungen die Montessori-Pädagogik zum Einsatz kam. Mit der Wiedervereinigung stieg auch in den neuen Bundesländern das Interesse an diesem pädagogischen Konzept - es entstanden Montessori-Kinderhäuser und Montessori-Schulen, die zum Großteil integrativ arbeiten. Gegenwärtig steigt noch immer die Zahl der national und international neu gegründeten unterschiedlichsten Montessori-Einrichtungen, daneben ist eine weltweite Aktualität der über Maria Montessori publizierten Literatur festzustellen.
Ausgangspunkt für Maria Montessoris pädagogisches Konzept sind Psychologie und Physiologie, sowie ihre Erfahrungen die sie als Ärztin mit geistig behinderten Kindern gesammelt hatte. Sie war am heilpädagogischen Institut in Rom angestellt wo es ihre Aufgabe war, sowohl zukünftige Lehrer auf die Arbeit mit behinderten Kindern vorzubereiten als auch selbst in unmittelbarem Kontakt mit geistig Zurückgebliebenen die geeigneten pädagogischen Methoden zu erforschen.
Sie beschäftigte sich mit den Werken der Ärzte Itard und Séguin und entwickelte auf dieser Grundlage ein didaktisches Material, um die Sinne behinderter Kinder zu schulen. Beim Einsatz des Materials erlebte Maria Montessori bei den behinderten Kindern solche Erfolge, dass sie beschloss, es auch bei nichtbehinderten Kindern anzuwenden
Sie setzte ihr Material in einem Kinderhaus in einem […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
1. Theoretische Grundlegung – Begriffe und Definitionen
1.1 Begriff der Behinderung
1.2 Zum Normalisierungsprinzip
1.3 Begriff der Integration
1.4 Begriff der gemeinsamen Erziehung
2. Die Entwicklung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder
2.1 Historische Entwicklung integrativer Pädagogik
2.1.1 Von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis zu Beginn der 60er Jahre
2.1.2 Die neue Integrationsbewegung ..25
2.2 Organisation gemeinsamer Erziehung im Elementarbereich
2.2.1 Rechtsgrundlagen
2.2.2 Rahmenbedingungen
2.2.3 Organisationsformen
2.2.4 Bedingungen für das Gelingen gemeinsamer Erziehung
2.3 Pädagogische Konzepte
2.3.1 Der Situationsansatz
2.3.2 Der Aneignungstheoretische Ansatz
2.3.3 Die Waldorfpädagogik
2.3.4 Psychotherapeutisch orientierte Konzeptionen
2.3.4.1 Verhaltenstherapeutisches Vorgehen
2.3.4.2 Psychoanalytisch orientierter Ansatz
3. Die Montessori-Pädagogik
3.1 Montessoris Weg zur Pädagogik
3.2 Das pädagogische Konzept
3.2.1 Anthropologische Grundlagen
3.2.1.1 Die Entwicklung des Kindes
3.2.1.2 Die sensiblen Perioden
3.2.1.3 Geistiger Embryo und absorbierender Geist
3.2.1.4 Deviation und Normalisation
3.2.2 Die wichtigsten Prinzipien der Montessori-Pädagogik
3.2.2.1 Die vorbereitende Umgebung
3.2.2.2 Die freie Wahl der Arbeit – Freiarbeit
3.2.2.3 Die didaktischen Materialien
3.2.3 Montessoris Verständnis kindlichen Lernens
3.2.3.1 Die Polarisation der Aufmerksamkeit
3.2.3.2 Die Struktur des Lernvorgangs
3.2.3.3 Der Lernrhythmus
3.2.4 Die Umsetzung der Montessori-Pädagogik
3.2.4.1 Kinderhaus und Schule
3.2.4.2 Die Montessori-Pädagogin
3.3 Die Kosmische Erziehung
3.3.1 Die Kosmische Theorie
3.3.2 Ziele der Kosmischen Erziehung
3.3.3 Methodische Prinzipien
4. Montessori-Pädagogik für Kinder mit Behinderungen.. 77
4.1 Die Wurzeln der Montessori-Pädagogik in der Heilpädagogik
4.1.1 Der besondere Einfluss Itards und Séguins auf Maria Montessori
4.1.2 Rezeption der physiologischen Methode
4.2 Die Entdeckung der Montessori-Pädagogik für Kinder mit Behinderung(en)
4.2.1 Die Entwicklung in Deutschland
4.2.2 Internationale Tendenzen
4.3 Rezeption und Weiterentwicklung der Montessori-Pädagogik
4.3.1 Die Montessori-Heilpädagogik
4.3.2 Die Montessori-Therapie
4.3.2.1 Die Montessori-Einzel- und –Kleingruppentherapie
4.3.2.2 Die Integration der Kinder mit Behinderung(en)
5. Integrative Erziehung unter Berücksichtigung der Pädagogik Maria Montessoris – dargestellt an ausgewählten Konzepten ..92
5.1 Das erste Montessori-Kinderhaus mit integrativer Erziehung am Kinderzentrum München
5.1.1 Aufbau des Montessori-Kinderhauses
5.1.2 Die Eingliederung der Kinder mit Behinderung(en)
5.1.3 Methodik und Adaption des Montessori-Materials
5.1.4 Soziale Lernprozesse
5.1.5 Elternarbeit
5.1.6 Weitere Entwicklung
5.2 Die integrative Montessori-Kindertagesstätte in Erfurt
5.2.1 Beschreibung des Kindergartens
5.2.2 Die Aufnahme in den Kindergarten
5.2.3 Der Tagesablauf
5.2.4 Elternarbeit
5.2.5 Teamarbeit
5.3 Inwiefern lässt sich die Montessori-Pädagogik heute für die integrative Erziehung einsetzen?
5.3.1 Die Vorteile der Montessori-Pädagogik für die integrative Erziehung
5.3.1.1 Vorteile der wichtigsten Prinzipien der Montessori- Pädagogik
5.3.1.2 Vorteile im Montessori-Material
5.3.1.3 Erfolge bei Kindern mit Behinderung(en)
5.3.2 Kritikpunkte
5.3.3 Ausblick
Resümee
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Einleitung
Der Umgang mit Menschen mit Behinderung(en) in unserer Gesellschaft ist insgesamt von der immer differenzierter gewordenen Ausgrenzung dieser Personengruppe in spezialisierte und zentralisierte Sondereinrichtungen bestimmt. Schon im Elementarbereich trifft man auf Sonderkindergärten für Geistigbehinderte, Sprachbehinderte, Sehgeschädigte, Hörgeschädigte, Körperbehinderte etc. Im schulischen Bereich gliedert sich dieses System von Sondereinrichtungen noch weiter auf. In den letzten Jahren jedoch wurde die Integration von Menschen mit Behinderung(en) zu einem immer häufiger diskutierten Thema, wesentliche Anstöße hierzu kamen aus dem Ausland (z.B. aus den skandinavischen Ländern, den USA). Ende der 70er Jahre gab es in der Bundesrepublik Deutschland nur vereinzelt integrativ arbeitende Kindergärten und auch heute verbreitet sich die integrative Erziehungsform eher langsam.
Das Deutsche Jugendinstitut e.V. hat über mehrere Jahre hinweg integrative Einrichtungen in den alten Bundesländern beobachtet und u.a. festgestellt, dass in verhältnismäßig vielen integrativ arbeitenden Einrichtungen die Montessori-Pädagogik zum Einsatz kam[1]. Mit der Wiedervereinigung stieg auch in den neuen Bundesländern das Interesse an diesem pädagogischen Konzept - es entstanden Montessori-Kinderhäuser und Montessori-Schulen, die zum Großteil integrativ arbeiten. Gegenwärtig steigt noch immer die Zahl der national und international neu gegründeten unterschiedlichsten Montessori-Einrichtungen, daneben ist eine weltweite Aktualität der über Maria Montessori publizierten Literatur festzustellen[2].
Ausgangspunkt für Maria Montessoris pädagogisches Konzept sind Psychologie und Physiologie, sowie ihre Erfahrungen die sie als Ärztin mit geistig behinderten Kindern gesammelt hatte. Sie war am heilpädagogischen Institut in Rom angestellt wo es ihre Aufgabe war, sowohl zukünftige Lehrer auf die Arbeit mit behinderten Kindern vorzubereiten als auch selbst in unmittelbarem Kontakt mit „geistig Zurückgebliebenen[3] “ die geeigneten pädagogischen Methoden zu erforschen.
Sie beschäftigte sich mit den Werken der Ärzte Itard und Séguin und entwickelte auf dieser Grundlage ein didaktisches Material, um die Sinne behinderter Kinder zu schulen. Beim Einsatz des Materials erlebte Maria Montessori bei den behinderten Kindern solche Erfolge, dass sie beschloss, es auch bei nichtbehinderten Kindern anzuwenden.
Sie setzte ihr Material in einem „Kinderhaus“ in einem Elendsviertel Roms ein, um den Kindern die Chance zur möglichst frühen Selbständigkeit zu geben. Hier wird nun der sozialpädagogische Akzent der Arbeit Montessoris sichtbar: sie wollte ihnen so die Möglichkeit auf ein besseres Leben vermitteln und ihnen eine Ganztagsbetreuung zukommen lassen. 1907 wurde die erste vorschulische Einrichtung „Casa dei bambini“ eröffnet. In diesem Kinderhaus erprobte Montessori in der Arbeit mit den Kindern die Methode, welche zur Grundlage ihrer gesamten vorschulischen Erziehungsarbeit wurde.
In Deutschland wurde das Konzept bereits 1914 praktisch umgesetzt, Montessori-Kinderhäuser entstanden und es gründete sich die „Deutsche Montessori-Gesellschaft“. 1933 wurde die Montessori-Bewegung verboten, die Kinderhäuser und Schulen wurden geschlossen. Nach 1945 breiteten sich reine Montessori-Kindergärten jedoch nur in verhältnismäßig geringer Zahl aus[4].
Theodor Hellbrügge gründete Ende der 60er Jahre den ersten Montessori-Kindergarten und die erste Montessori-Schule in der BRD, in denen neben nichtbehinderten Kindern auch Kinder mit Behinderung(en) systematisch gefördert wurden. Gleichzeitig wurde das vorhandene international verbreitete Montessori-Material zum Teil adaptiert, um es bestimmten Bedürfnissen behinderter Kinder anzupassen. Daraus entwickelten sich die Montessori-Heilpädagogik und die Montessori-Therapie.
Methodischer Aufbau
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich aus Gründen des Umfangs nur mit dem Elementarbereich, respektive dem Kindergarten. Wenn von Kindergarten die Rede ist, so wird diese Bezeichnung im folgenden als Oberbegriff verwendet, der die Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht in Tageseinrichtungen für Kinder allgemein umfasst[5]. Aus dem Textzusammenhang wird deutlich, wenn ausdrücklich eine andere Organisationsform der Kinderbetreuung gemeint ist.
Um eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaffen, möchte ich zu Beginn der vorliegenden Diplomarbeit die wichtigsten Begriffe und Definitionen erläutern. Das folgende Kapitel befasst sich dann mit der gemeinsamen Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen im Elementarbereich. Hier soll aufgezeigt werden, wie sich integrative Erziehung entwickelt hat und welche Organisationsmodelle bzw. Konzepte sich durchgesetzt haben. Neben vielen bestehenden Konzepten integrativer Erziehung hat sich auch die Montessori-Pädagogik bewährt, und aus diesem Grund möchte ich mich im dritten Kapitel näher mit diesem pädagogischen Konzept befassen.
Zu Beginn soll kurz auf Maria Montessoris Weg zur Pädagogik eingegangen werden, um anschließend ihr Konzept näher zu betrachten. Hierbei werde ich hauptsächlich auf ihr Verständnis kindlicher Entwicklung, kindlichen Lernens und die wichtigsten Methoden bzw. Prinzipien ihres Erziehungskonzeptes eingehen. An diesem Punkt ist es ebenfalls wichtig, auf den integrativen Aspekt der Montessori-Pädagogik hinzuweisen. Die Rezeption und Weiterentwicklung dieser Methode sollen jedoch erst Thema des nächsten Kapitels sein.
Während der Vorbereitungen zu dieser Arbeit und der Bearbeitung des Themas beschäftigten mich folgende Fragen:
Wie wurde bzw. wird integrative Montessori-Pädagogik praktisch umgesetzt, welche Konzepte gibt es und wie haben sie sich bewährt? Was sind die Vorteile der integrativen Montessori-Pädagogik und was sind Kritikpunkte?
War das pädagogische Konzept in seiner ursprünglichen Form (1909 als „Il Metodo della Pedagogica Scientificia applicato all‘ educazione infantile nelle Casa dei Bambini“ in Buchform herausgegeben[6] ) auf die heutige Zeit übertragbar oder musste es speziell für Kinder mit Behinderung(en) modifiziert werden? Gelangen Kinder mit Behinderungen in der gemeinsamen Erziehung mit sog. nichtbehinderten Kindern zu mehr Selbsttätigkeit, Selbständigkeit und Freiheit? Welche Bedingungen müssen berücksichtigt werden um das Gelingen einer gemeinsamen Erziehung zu erzielen?
Diese Fragen führen zum eigentlichen Anliegen der Diplomarbeit. Im fünften Kapitel möchte ich zwei Konzepte integrativer Montessori-Einrichtungen näher erläutern: das erste Konzept ist das des integrativen Montessori-Kindergartens in München, 1968 von Theodor Hellbrügge als Versuch gegründet.
Dem gegenüber möchte ich das Konzept des Erfurter Montessori-Kindergartens stellen, der sich erst seit kurzem "integrative Einrichtung" nennen darf. Dabei ist es wichtig zu schauen, inwieweit sich das Konzept Hellbrügges bewährt hat bzw. ob es weiterentwickelt und in modifizierter Form im Erfurter Kindergarten umgesetzt wurde.
Aus den gewonnenen Erkenntnissen der vorherigen Kapitel soll abschließend aufgearbeitet werden, inwiefern sich die Pädagogik von Maria Montessori für die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen einsetzen lässt. Dabei sollen Vor- und Nachteile aufgezeigt werden. Gern hätte ich mich auf mehrere Konzepte gestützt, jedoch zeigten sich viele Montessori-Einrichtungen sowie die Deutsche Montessori Gesellschaft nicht kooperativ, so dass ich außer den genannten keine weiteren Konzepte sichten konnte. Aus diesem Grund werde ich mich in diesem Abschnitt auf eine Untersuchung des DJI stützen, das integrative Montessori-Einrichtungen hinsichtlich der Vor- und Nachteile der Umsetzung des Konzeptes untersucht haben. Diese Untersuchung von 1989 ist nach dem Stand meiner Forschung die aktuellste auf diesem Gebiet, Kenntnisse über jüngere Untersuchungen liegen mir nicht vor.
Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass aus Gründen der Übersichtlichkeit und Leserfreundlichkeit in dieser wissenschaftlichen Arbeit auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung in der Schreibweise verzichtet wurde und bei der Nennung der männlichen Form automatisch auch die weibliche Form angesprochen ist sowie umgekehrt. Ferner wird an einigen Stellen von Kindern mit und ohne Behinderungen, von behinderten und nichtbehinderten Kindern, von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf etc. die Rede sein. Dabei ist jedes Mal der gleiche Personenkreis gemeint, jedoch wurde aus Gründen des besseren Leseflusses eine Variation der Begriffe vorgenommen.
1. Theoretische Grundlegung – Begriffe und Definitionen
Im folgenden Kapitel sollen wichtige Begriffe geklärt werden, um eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaffen.
1.1 Begriff der Behinderung
Obwohl „Behinderung“ heute zu einem zentralen Begriff der Wissenschaft geworden ist, gibt es noch immer keine einheitliche Definition. Der Grund dafür liegt zum einen darin, dass es nicht den Menschen mit Behinderung gibt. Die organische Schädigung und die daraus entstehenden Folgen sind bei jedem Betroffenen individuell verschieden. Zum anderen liegt die Schwierigkeit darin, dass die Definitionsversuche von unterschiedlichen Personen vorgenommen werden, die alle aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen stammen. Je nachdem aus welcher Profession heraus und mit welcher Intention definiert wird, ergeben sich unterschiedliche Ansätze.
Der Begriff Behinderung ist also ein mehrdimensionaler Begriff und vereint viele Definitionen und Auslegungen in sich. Aus diesem Grund möchte ich zu Beginn verschiedene Definitionen und Betrachtungsweisen vorstellen und anschließend zu einer für mich und dieser Arbeit gültigen Variante zusammenfassen.
Behinderung bezeichnet ganz allgemein jegliche Art von Einschränkung oder Hemmnis. In der Medizin findet dieser Terminus als Synonym für angeborene oder erworbene, langfristig bzw. dauerhafte Schädigungen Anwendung[7].
Dem Wortlaut des Sozialgesetzbuches (SGB IX) folgend gelten Menschen als behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist (§ 2 I 1,2 SGB IX)[8].
Besonders die Bestimmungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben in diesem Bereich die Diskussion um den Behinderungsbegriff geprägt.
Die Definition der WHO in ihrer Fassung von 1980 teilt den Begriff Behinderung in drei Ebenen[9]:
- Ebene der gesundheitlichen Schädigung („impairment“)
- Ebene der funktionellen Einschränkung („disability“)
- Ebene der daraus resultierenden sozialen und persönlichen
Beeinträchtigungen („handicap“)
Aufgrund der erfahrenen Schädigung in geistiger, körperlicher oder psychischer Hinsicht sind Menschen mit Behinderungen in ihren persönlichen Möglichkeiten stärker beeinträchtigt als Menschen, die keine Schädigung erfahren haben. An der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit sowie an einer selbstbestimmten und menschenwürdigen Lebensführung werden sie jedoch nicht in erster Linie aufgrund der Schädigung und der daraus resultierenden Beeinträchtigungen be- bzw. gehindert, sondern weil ihnen notwendige Hilfen zur Kompensation ihrer Beeinträchtigungen versagt bleiben oder nur in fremdbestimmter Form oder fremdbestimmten Strukturen bereitgestellt werden.
Auf der Basis einer veränderten Sichtweise von Behinderung[10] und ihren psychischen und sozialen Auswirkungen wurde 1998 eine modifizierte Fassung der WHO-Klassifikation herausgebracht:
Impairment Schädigung à körperliche (med.) Ebene (organisch, geistig, psychisch)
Activity Fähigkeits-, Aktivitätsmöglichkeiten à personale (psychol./ päd.) Ebene
Participation Teilhabe à gesellschaftlich - soziale Ebene (soziolog.)
Die Dreiteilung des Begriffs Behinderung wurde beibehalten, ebenso der Ausdruck „impairment“ (Schädigung). Der Terminus „disability“ (Unzulänglichkeit) wurde ersetzt durch „activity“ und meint nun Fähigkeiten und Möglichkeiten und die damit verbundene Tätigkeit bzw. Betätigung des Einzelnen. Er definiert die Aktivitäten, die auch Menschen mit Schädigungen ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten erlauben. Der Terminus „handicap“ (Benachteiligung) war demzufolge nicht mehr haltbar und wurde durch den Begriff „participation“ ersetzt. „Participation“ beschreibt die soziale Teilhabe am Leben der Gesellschaft und fragt danach, inwieweit sich die Beeinträchtigungen der Gesundheit auf die Teilnahme an öffentlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Aufgaben und Ereignissen auswirken[11]. Die ganzheitliche Förderung des Menschen mit Behinderung(en) muss auf allen drei genannten Ebenen stattfinden, in koordinierter Form bei interdisziplinärer Zusammenarbeit aller Fachkräfte.
Dominiert in der Fassung von 1980 deutlich eine individuumzentrierte Sichtweise mit einer defizitorientierten Bewertung der je individuellen Situation, so herrscht in der Neufassung von 1998 eine systemorientierte Betrachtung vor, die Behinderung immer auch im sozialen und institutionellen Kontext sieht, unter Herausstellung der positiven Möglichkeiten innerhalb des Lebensraumes eines behinderten Menschen[12].
Die sozialen Folgeerscheinungen von Behinderung sind meist differenziert: ob eine Behinderung als solche existent ist, hängt auch von der Reaktion des sozialen Umfelds auf etwaige Auffälligkeiten oder Schädigungen des Betroffenen ab. Letztendlich bestimmen gesellschaftliche Normvorstellungen, wer oder was als behindert gilt. „Der Behinderte“ ist somit eine Rollenzuschreibung auf die Person, an welcher ein Defekt abgelesen oder vermutet wird[13]. So argumentiert auch JANTZEN, er betrachtet Behinderung nicht als naturwüchsig entstandenes Phänomen: sie wird sichtbar und damit als Behinderung existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe eines Individuums aufgrund sozialer Interaktion und Kommunikation in Bezug zu gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten gesetzt werden. Indem festgestellt wird, dass ein Individuum aufgrund seiner Merkmalsausprägung diesen Vorstellungen nicht entspricht, wird Behinderung offensichtlich, sie existiert als sozialer Gegenstand erst von diesem Augenblick an[14].
Auch innerhalb der Pädagogik gibt es keine einheitliche Definition von Behinderung. Im erziehungswissenschaftlichen Sinn werden Behinderungen unter dem Aspekt der Erziehungsmöglichkeiten, Lernvoraussetzungen, Lernbedingungen, Lernziele, Lernmethoden und Institutionen gesehen. Aus rein pädagogischer Sicht beschreibt der Deutsche Bildungsrat sein Verständnis von Behinderung:
"Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit beeinträchtigt sind, dass ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. Deshalb bedürfen sie besonderer pädagogischer Förderung. Behinderungen können ihren Ausgang nehmen von Beeinträchtigungen des Sehens, des Hörens, der Sprache, der Stütz- und Bewegungsfunktionen, der Intelligenz, der Emotionalität, des äußeren Erscheinungsbilds sowie von bestimmten chronischen Krankheiten. Häufig treten auch Mehrfachbehinderungen auf ..."[15].
Betrachtet man den Terminus Behinderung aus dieser Sicht, spielt eine entscheidende Rolle, dass Behinderungen besondere Erziehungserfordernisse für die betreffenden Kinder nach sich ziehen, auf die die Erzieher reagieren müssen. Diese Erfordernisse sind für jedes Kind immer wieder neu zu bestimmen[16].
Ich möchte an dieser Stelle zu einer für mich und diese Arbeit zufriedenstellenden Formulierung kommen und kann also zusammenfassend festhalten: Eine Behinderung ist gekennzeichnet durch eine beeinträchtigte intellektuelle und soziale Entwicklung, so dass pädagogisch-soziale Hilfen zur Lebensbewältigung nötig werden[17]. Ob ein Mensch als behindert gilt, ist wesentlich von den gesellschaftlichen Bedingungen und den vorherrschenden Norm- und Wertvorstellungen abhängig. So kann ein Mensch als behindert gelten, wenn er in seinem Verhalten, geistigen und körperlichen Fähigkeiten von einer „Norm“ abweicht. Jedoch sollte man bei allen Versuchen der Definition und Begriffsbestimmung nicht vergessen, dass es in erster Linie um den Menschen geht. Den Menschen, der mit seinen Fähigkeiten und Eigenschaften einzigartig ist.
1.2 Zum Normalisierungsprinzip
Zum Ausgangspunkt des international wohl bedeutendsten Reformkonzeptes der Hilfen für Menschen mit Behinderungen wurde das Normalisierungs-prinzip, das in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in Skandinavien entstand und in den 70er Jahren in Kanada und den USA zu einer wissenschaftlichen Theorie weiterentwickelt wurde. Die Grundaussage des Normalisierungsprinzips lautet: „Normalisierung bedeutet: den geistig Behinderten ein so normales Leben wie möglich zu gestatten[18] “. Es geht dabei nicht darum, behinderte in „normale“ Menschen verwandeln zu wollen. Vielmehr wird bezweckt, normale, typische allgemeine Lebensverhältnisse auch für Menschen mit Behinderung(en) zu schaffen und ihnen alle für ihre Entwicklung und ihr Wohlbefinden notwendigen Hilfen zu gewähren.
Das Normalisierungsprinzip bezieht sich auf folgende Facetten der normalen Lebensbedingungen, die für Menschen ohne Behinderung(en) völlig selbstverständlich sind und an denen auch Menschen mit Behinderung(en) das Recht haben teilzunehmen:
- Einen normalen Tagesrhythmus: Schlafen, Aufstehen, Mahlzeiten, Wechsel von Arbeit und Freizeit - der Tagesablauf ist dem gleichaltriger Menschen ohne Behinderungen anzupassen.
- Einen normalen Wochenrhythmus: Tägliche Phasen von Arbeit und nicht nur einmal wöchentlich eine Stunde Beschäftigungstherapie sowie die Unterscheidung von Wochenende und Alltag.
- Einen normalen Jahresrhythmus: Den Jahresablauf durch Einhaltung von Feiertagen, Ferien und Familientagen von besonderer Bedeutung erleben zu können.
- Normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus: Gelegenheiten zu haben, die normalen Entwicklungserfahrungen eines Lebenszyklus machen zu können. Angebote und Betreuung sollten klar auf das Lebensalter bezogen sein.
- Normalen Respekt vor dem Individuum und dessen Recht auf Selbstbestimmung: Entscheidungen, Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sind zu respektieren und stets zu berücksichtigen.
- Normale sexuelle Lebensmuster ihrer Kultur: Möglichkeiten zu haben, in einer zweigeschlechtlichen Welt zu leben und Bedürfnisse nach (anders)geschlechtlichen Kontakten zu befriedigen.
- Normale ökonomische Lebensmuster und Rechte im Rahmen gesellschaftlicher Gegebenheiten: Einen normalen wirtschaftlichen Lebensstandard als Voraussetzung für ein möglichst normales Leben anwenden. Dieser ist durch die soziale Gesetzgebung zu sichern.
- Normale Umweltmuster und -standards innerhalb der Gemeinschaft: Der Standard für Einrichtungen (z.B. Schulen, Arbeitsstätten, Wohnstätten etc.) muß sich am Maßstab dessen messen, was man auch für Menschen ohne Behinderung für angemessen hält[19].
Normalisierung bedeutet also die Gleichstellung behinderter Menschen mit nichtbehinderten in allen Lebenslagen bei Bereitstellung aller erforderlichen Unterstützung. Integration stellt ein Mittel dar, die Normalisierung behinderter Menschen zu erreichen. Normalisierung gilt aber erst dann als verwirklicht, wenn Menschen mit Behinderungen an allen allgemeinen gesellschaftlichen Angeboten teilnehmen können[20].
1.3 Begriff der Integration
Integration ist nach SPECK ein ganzheitlicher Begriff, der Zusammengehörigkeit als Überwindung von Getrenntheit und von Isolation der Teile intendiert[21]. Dieser Terminus bezog sich in der Pädagogik anfangs noch auf rassische / ethische Minderheiten und erst später akzentuiert auch auf Behinderte[22]. Auf die Entwicklung der Integrationsbewegung soll im nächsten Kapitel noch ausführlich eingegangen werden.
Integration in allgemein sozialer Bedeutung zielt auf die Durchsetzung der uneingeschränkten Teilhabe und Teilnahme behinderter Menschen an allen gesellschaftlichen Prozessen. Jede Form der Ausgrenzung widerspricht den im Grundgesetz der BRD abgesicherten Grundrechten:
Art. 1 I GG „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ und Art. 3 III 2 GG „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ begründen diesen Anspruch[23]. Danach haben Menschen mit Behinderung(en) grundsätzlich und unabhängig von der Art und der Schwere ihrer Behinderung in allen Lebensbereichen unserer Gesellschaft die gleichen Chancen zur Teilhabe und Teilnahme wie alle Menschen ohne Behinderung(en) zu beanspruchen.
Die Integration behinderter Menschen im Sinne der uneingeschränkten Eingliederung in die Gesellschaft und der vollwertigen Teilnahme und Teilhabe an deren institutionellen Angeboten und materiellen Ressourcen beschreibt SCHÖNEBERGER[24] als eine grundsätzliche sonderpädagogische Aufgabe. 1973 beschloß der Deutsche Bildungsrat, dass die Integration Behinderter in die Gesellschaft eine der vordringlichen Aufgaben jedes demokratischen Staates ist und gibt ihr den Vorzug vor einer isolierten und isolierenden Sonderbeschulung.
Die Integration behinderter Menschen wurde jedoch lange Zeit in dem Sinne (miss-)verstanden, dass ein Behinderter im Rahmen von Rehabilitation all das neu oder wieder erwerben sollte, was er noch nicht oder nicht mehr konnte, und dass sozial unverträgliche Verhaltensweisen zu beseitigen waren. Integration in die Gesellschaft als ethisches und auf Grundrechten des Menschen beruhendes Ziel bedeutet aber weit mehr als Rehabilitation oder gar bloße Duldung. Während Rehabilitation die Wiederherstellung eines ursprünglichen Zustands bedeutet, meint Integration „die Herstellung oder Vervollständigung eines (unvollständigen) Ganzen“[25].
Eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Begriff Integration legt KOBI[26] vor. Er stellt fest, dass Integration keine Methode ist, die nach Erfolgskriterien evaluiert werden könne, sondern dass sie eine Lebens- und Daseinsform zwischen Behinderten und Nichtbehinderten bezeichne, für oder gegen die sich eine Gesellschaft und ihre Untersysteme (Elementarbereich, Schule etc.) entscheiden können, und die situativ und temporal frei wählbar bleiben müssen. Integration bedeutet nicht die Anpassung an das vorherrschende Leistungs- und Wertesystem, sondern Integration strebt eine Umorientierung von überbetontem Leistungs- und Konkurrenzdenken, in Richtung einer gemeinsamen Bewältigung anstehender Aufgaben an. Im Vordergrund stehen die Möglichkeiten und Kompetenzen der Menschen - nicht deren Defizite. Und hier gilt die pädagogische Regel: Integration ist nicht ein anzustrebender Zustand, sondern Weg und Ziel zugleich. Weg in dem Sinne, dass die Gemeinschaft Behinderter und Nichtbehinderter so früh wie möglich hergestellt wird – institutionell gesehen in Form von gemeinsamer Erziehung.
DICHANS[27] spricht hier von gelebter Integration und meint „integrative Prozesse“, die in der gemeinsamen Erziehung unter den entsprechenden Bedingungen entstehen.
1.4 Begriff der gemeinsamen Erziehung
Eine wichtige Voraussetzung für eine gemeinsame Erziehung ist das Zusammensein von nicht behinderten und behinderten Kinder in einem Raum oder unter einem Dach.. Von gemeinsamer Erziehung zu reden hat nur dann einen Sinn, wenn darüber hinaus gemeinsames Leben und Lernen ermöglicht und praktiziert wird[28]. Gemeinsame Erziehung sollte grundsätzlich allen Kindern mit Behinderung offen stehen. Das pädagogische Konzept einer integrativen Einrichtung muss sicherstellen, dass sich alle Kinder auf der Basis ihres jeweiligen Entwicklungsniveaus im gemeinsamen Handeln, Spielen und Lernen als kompetent erfahren können. Für die behinderten Kinder sollte gemeinsame Erziehung zum einen die behindertenspezifische Förderung leisten, wie sie bisher in den Sondereinrichtungen im Vordergrund stand. Zum anderen sollte sie größtmögliche Intensität der sozialen Interaktion mit den nicht behinderten Kindern herstellen.
Aufgrund der besonderen Heterogenität der Gruppe, die erzogen werden soll, setzt gemeinsame Erziehung besondere Akzente. So geht es im wesentlichen darum,
- die gegenseitige Akzeptanz zwischen Behinderten und Nichtbehinderten zu erhöhen und soziale Distanzen nicht aufkommen zu lassen bzw. abzubauen;
- die Negation des Andersein zu verhindern und zu lernen, dass es normal ist „verschieden“ zu sein;
- zur Entwicklung einer Identität in realitätsgerechter Auseinandersetzung mit den anderen beizutragen;
- den Behinderten nicht als Objekt fürsorgerischer und therapeutischer Bemühungen der Umwelt zu sehen, sondern als Subjekt mit Fähigkeiten;
- die Entwicklung der Behinderten durch die von den Nichtbehinderten ausgehenden Lernanreize zu unterstützen[29].
Eine klare Abgrenzung der Begriffe „Integration“ und „gemeinsame Erziehung“ habe ich bei der Recherche der sonderpädagogischen Literatur nicht feststellen können. Einigen Autoren (MÜHL 1987, DICHANS 1993) scheint der Begriff der „gemeinsamen Erziehung“ angemessen, da er pädagogische Sachverhalte in den Mittelpunkt rückt und nicht den hohen Anspruch der Integration, die jedoch als Ziel erhalten bleibt. Autoren wie KOBI (1993) und BIEWER (2001) verwenden eher den Begriff „Integration“ und sehen in der gemeinsamen Erziehung bzw. dem gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung(en) eine Methode, Integration als Ziel zu erreichen.
Andere Autoren (SPECK 1998, SCHÖLER 1999) legen sich in ihren Ausführungen nicht genau fest und verwenden sowohl den Begriff der „Integration“ bzw. „integrativen Erziehung“ wie auch den Begriff der „gemeinsamen Erziehung“.
Wo im folgenden Begriffe wie gemeinsame Erziehung, Integration und integrative Erziehung verwendet werden, geben sie den Sprachgebrauch des jeweiligen Autors wieder.
2. Die Entwicklung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder
In diesem Kapitel sollen nach einer historischen Betrachtung integrativer Pädagogik gegenwärtige Konzepte und Organisationsformen integrativer Einrichtungen im Elementarbereich vorgestellt und näher erläutert werden.
2.1 Historische Entwicklung integrativer Pädagogik
Wie bereits erläutert, versteht man unter dem Begriff der Integration einen gesellschaftlichen Prozess der bewusstseinsgemäßen und erzieherischen Eingliederung von Gruppen und Personen in allgemein verbindliche Wert- und Handlungsstrukturen. Im pädagogischen Bereich ist darunter die gemeinsame Erziehung (und Unterrichtung) von behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen in den Einrichtungen des Bildungswesens zu verstehen[30]. Um die historische Entwicklung der Integrationspädagogik lückenlos aufzeigen zu können, werde ich mich in den folgenden Ausführungen nicht nur auf den Elementarbereich, sondern auch auf den Primarbereich beziehen.
2.1.1 Von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis zu Beginn der 60er Jahre
Die Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft ist ein im Zeitalter der Aufklärung einsetzender und bis heute andauernder Prozess. Behinderte und verwahrloste Kinder hat es in der Geschichte schon immer gegeben, aber erst mit dem Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert nahmen sich vereinzelte Pädagogen ihrer ernsthaft an. Ihre Erziehung wurde zu einem öffentlichen Thema, es entstanden Anstalten, die die gesellschaftliche Integration geistig und körperlich behinderter und verwahrloster Kinder anstrebten.
Diese Form des Integrationsgedankens ist auch als Verallgemeinerungs-bewegung in die Geschichte der Pädagogik eingegangen[31].
Die Anfänge des Taubstummen- und Blindenunterrichts waren wegweisend für die Unterrichtung behinderter Kinder und markierten zugleich auch den Beginn einer Wende im gesellschaftlichen Umgang mit behinderten Menschen. Das Recht auf Bildung aller Menschen (auch der geschädigten) wurde gefordert. Deren Bildungsfähigkeit wurde mit der Gründung der ersten Taubstummenanstalt (1770) und der ersten Blindenschule (1784)[32] in Paris nachgewiesen. Johann Heinrich Pestalozzi war mit seiner Hingabe zu der Arbeit mit benachteiligten Kindern prägend für das weitere pädagogische Denken. Er war überzeugt von der Erziehbarkeit und Bildbarkeit behinderter Kinder, durch Erziehung sollte Menschenbildung bewirkt werden[33].
Im allgemeinen war das Verständnis für Behinderte jedoch sehr gering. So sahen es Lehrer und Pädagogen nicht als ihre Aufgabe, spezielle sonder-pädagogische Einrichtungen zu schaffen. Die Gründung erster spezieller Einrichtungen für behinderte Kinder ist auf die Arbeit von Armendirektoren und Geistlichen zurückzuführen. Die ersten Einrichtungen waren separierende Anstalten, die Schutz vor Verwahrlosung und wirtschaftlicher Ausbeutung gewähren sollten.
Anfang des 19. Jahrhunderts fanden geistig behinderte Kinder durch die Publikationen von J.M.G. Itard und E. Séguin erstmalig öffentliche Beachtung.
Séguin entwickelte auf der Grundlage der Arbeit Itards ein spezifisches Erziehungssystem für geistig behinderte Kinder, dass in einer Privatanstalt erprobt wurde. Im Zusammenhang mit der Rettungshausbewegung[34] wurde 1838 die erste „Rettungsanstalt für schwachsinnige Kinder“ gegründet, die auch als erste deutsche Unterrichtsanstalt für Geistesschwache bezeichnet wird.
In den einzelnen deutschen Staaten entstand Mitte des 19. Jahrhunderts ein regional begrenztes Sonderschulwesen. Die Schulen waren generell Erziehungsheime, nur vereinzelt und auf Privatinitiative erfuhren hauptsächlich körperbehinderte Kinder eine Erziehung in Diakonieanstalten. Anfang des 20. Jahrhunderts erließen die deutschen Staaten Schulgesetze, die eine Schulpflicht für behinderte Kinder vorsahen. Diese setzte sich sukzessive durch und sicherte formal die Bereitstellung von Schulplätzen, es entstand eine Reihe von Sondereinrichtungen[35]. In einigen dieser Einrichtungen wurde versucht, den Integrationsgedanken durchzusetzen, man erkannte und betonte die Bedeutung der sozialen Entwicklung von Kindern mit und ohne Behinderung(en). Aus schulorganisatorischen und ökonomischen Gründen hielt man jedoch eine homogene Erziehung erstrebenswert.
Die reformpädagogischen Ansätze zu gemeinsamer Erziehung in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts stellten die Integration und Sozialisation behinderter Kinder und Jugendlicher in den Vordergrund. Auf schulpolitischer Ebene gewannen vor allem die aus den Hilfsschulen hervorgegangenen Sammelklassen an Bedeutung, die eine individuelle Förderung vorwiegend geistig behinderter Schüler in kleinen Klassen ermöglichten.
Die Rolle der Hilfsschule während der Zeit des Nationalsozialismus war überschattet von der Ideologie und Praxis der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“.[36] Behinderte und psychisch kranke Menschen wurden vor einem Hintergrund aus rassenhygienischen Auslese- und Zuchtideen systematisch assimiliert oder ausgegrenzt, die Sammelklassen wurden infolge der Trennung in Schul- und Bildungsunfähige geschlossen.
Nach 1945 bildeten sich neue Einstellungen und Haltungen heraus: aufgrund der freien Entfaltung der Persönlichkeit, der Humanität, der Gleichheit, der Bildbarkeit, der Entwicklungsfähigkeit und Vernunft sollten Menschen mit Behinderung(en) eine besondere Beachtung in der Gesellschaft erfahren. Der Wiederaufbau von Sonderschulen und Sonderkindergärten ging zunächst nur langsam voran, vor allem für Kinder, die als geistig behindert oder schwer mehrfachbehindert bezeichnet wurden, gab es keine systematische Förderung, sie galten als „schulbildungsunfähig“[37]. Die Kultusministerkonferenz unterstrich in ihrem Gutachten von 1960 die Selbständigkeit der Sonderschulen. Dem lag das Prinzip zugrunde, für jede Beeinträchtigung eine spezielle Bildungseinrichtung zu etablieren[38]. Dies barg jedoch die Gefahr der Separation und gesellschaftlichen Isolation, daran übte vor allem die neue Integrationsbewegung Kritik.
2.1.2 Die neue Integrationsbewegung
Etwa seit Beginn der 70er Jahre entstanden in den alten Ländern der Bundesrepublik Deutschland Gruppierungen, die sich um eine gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder bemühten.
Diese Entwicklung im Elementarbereich ist ein Entwicklungsprozess auf der Praxisebene und lässt sich in drei Phasen unterscheiden. Die Phase der Einzelinitiativen ist dadurch gekennzeichnet, dass einzelne Personen und Institutionen integrative Erziehung in Angriff nahmen, den Beginn machte HELLBRÜGGE mit seiner Ende der 60er Jahre gegründeten „Aktion Sonnenschein“. Von wissenschaftlicher Seite erfuhr der Gedanke der gemeinsamen Erziehung besondere Unterstützung durch Empfehlungen der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates von 1973.
Integration wurde als eine der vordringlichsten Aufgaben jedes demokratischen Staates bezeichnet[39]. Der Deutsche Bildungsrat verblüffte die pädagogische Öffentlichkeit mit der Forderung, möglichst viel Gemeinsamkeit zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern zu erreichen und eine isolierte Förderung behinderter Kinder nur dort durchzuführen, wo es notwendig ist[40]. Die Beispiele der wenigen (Einzel-) Initiativen machten mit Unterstützung dieser Empfehlungen recht bald Schule, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre stieg die Zahl der integrativen Einrichtungen[41]. Für die Weiterentwicklung war bedeutsam, dass nun vor allem Eltern behinderter Kinder die Initiative ergriffen und sich massiv für integrative Einrichtungen einsetzten.
Ab 1978 begann die Phase der Modellversuche. Beim Deutschen Jugendinstitut wurde eigens dazu eine Projektgruppe eingerichtet, die zunächst die Aufgabe hatte, einen Überblick über die Situation und Entwicklung integrativer Erziehungsformen im Elementarbereich zu schaffen[42]. Es folgten umfangreiche Modellversuche im gesamten (Alt-) Bundesgebiet, 1987 konnte das DJI insgesamt 160 integrativ arbeitende Einrichtungen feststellen. Bereits nach Abschluss der ersten Modellversuche setzte die Phase des Ausbaus gemeinsamer Erziehung ein (seit 1985). Sie ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sich immer mehr Gremien für eine Ausweitung gemeinsamer Erziehung im Elementarbereich aussprachen.
Positive Stellungnahmen überörtlicher Erziehungsbehörden, von Wohlfahrts- und Behindertenverbänden haben zum Ausbau integrativer Einrichtungen beigetragen. Heute wird nicht mehr die Frage gestellt, ob eine gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder sinnvoll ist, sondern wie sie zu gestalten ist. Immer mehr Träger unterstützen diesen pädagogischen Gedanken, es entsteht eine Vielzahl von Einrichtungen und bestehende Regel- und Sonderkindergärten werden umgestaltet.
Zugleich zeichnet sich eine neue Tendenz ab: die Verlagerung gemeinsamer Erziehung von zentralen Kindergärten hin zu Kindergärten im Wohnbereich[43].
Die von den einzelnen Institutionen gewählten Strukturen reichen von der Betreuung verschieden konzipierter Gruppen unter einem Dach bis hin zu Einzelintegrationen und Integrationsgruppen in öffentlich als integrativ ausgewiesenen Kindertagesstätten[44]. Im folgenden Kapitel soll die Vielfalt der Angebotsformen in Bezug auf ihre Organisation näher betrachtet werden.
2.2 Organisation gemeinsamer Erziehung im Elementarbereich
Die Frage der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern hat sich zu einem beherrschenden Thema für den Bildungsbereich entwickelt. Der Integrationsgedanke hat sich besonders im Elementarbereich verbreitet und wurde hier in wesentlich stärkerem Umfang in die Praxis umgesetzt als im schulischen Bereich[45]. Rechtliche Konstellationen, vorhandene Rahmenbedingungen und Organisationsformen sind Bestandteil des folgenden Abschnitts. Abschließend sollen Voraussetzungen für das Gelingen gemeinsamer Erziehung im Elementarbereich aufgezeigt werden.
2.2.1 Rechtsgrundlagen
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bestimmt in den Artikeln 1 bis 20 die Grundrechte des Bürgers[46].
Das allgemeine Grundrecht auf Freiheit (Art. 2 II GG) garantiert die möglichst ungehinderte freie Entfaltung des Einzelnen, soweit nicht die Rechte anderer, sonstige Schutzgüter der Rechtsordnung oder sittliche Grundüberzeugungen der Gesellschaft gegenüberstehen. In Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip wird somit Kindern mit Behinderung(en) das Recht auf ihre vom Staat und Gesellschaft unterstützte freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit gesichert. Zur Realisierung dessen bedarf es jedoch eines Rechts auf Zugang zu den Bildungseinrichtungen, die vom Staat oder den Kommunen errichtet wurden. Dieses Recht ist im wesentlichen auf Art 3 I GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip entwickelt worden[47].
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) bleibt in seinen Aussagen zur Integration global und unbestimmt. Die Länderausführungsgesetze[48] enthalten überwiegend den Grundsatz der gemeinsamen Erziehung, weichen jedoch in der konkreten Ausgestaltung voneinander ab. Integration im Elementarbereich ist gegenwärtig nicht ausschließlich als Jugendhilfemaßnahme organisierbar und bedarf in jedem Fall der Ergänzung durch das Bundessozialhilfegesetz (BSHG). Die BSHG-Förderung gewinnt auf der Ebene der Rahmenbedingungen eine korrektive Funktion, da sie eine Verringerung der Gruppengröße und Qualifikationsstandards beim Personal festschreibt. Insofern scheint die einheitliche Rechtsgrundlage unter Überwindung der nach BSHG und KJHG getrennten finanziellen Förderung gemeinsamer Erziehung in absehbarer Zeit nicht erreichbar[49].
Wenn es darum geht, Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder nicht mehr nur und ausschließlich Sondereinrichtungen zu gewähren, sondern ebenfalls Einrichtungen, in denen auch nichtbehinderte Kinder betreut werden, dann handelt es sich bei integrativen Kindergärten institutionell um Tageseinrichtungen für Kinder im Sinne von § 22 KJHG, in denen zugleich auch Eingliederungshilfe für Behinderte im Sinne der §§ 39 ff. BSHG geleistet wird.
Dieses Recht der Eingliederungshilfe erweist sich bei näherer Betrachtung als integrationsfreundlich: die zentrale Vorschrift des § 39 III BSHG bestimmt als Aufgabe der Eingliederungshilfe
- eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und
- den Behinderten in die Gesellschaft einzugliedern.
Hierzu soll nach § 39 III 3 BSHG vor allem gehören, dem Behinderten die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Integrative Kindertageseinrichtungen sind strukturell in der Lage, rehabilitative Leistungen zu erbringen und gleichzeitig die Eingliederung in die Gesellschaft durch Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen[50].
Exkurs: Thüringen
Das Thüringer Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder enthält in § 5 eine grundlegende Vorschrift über besondere Angebote für Kinder mit Benachteiligungen, wobei integrative Tageseinrichtungen benannt werden. Für „Kinder mit schwerwiegenden Behinderungen“ schreibt das Gesetz die „Betreuung und Förderung in sonderpädagogischen Tageseinrichtungen vor, sofern keine Integration möglich ist“[51].
Diese Regelung geht von der Annahme aus, es gebe einen Personenkreis behinderter Kinder, für die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nur die Förderung und Betreuung in Sondereinrichtungen in Frage kommt. Dass dies nicht zutrifft ist eines der wesentlichen Ergebnisse der in den alten Bundesländern in den 80er Jahren durchgeführten Modellversuche, die durch vielfältige Praxiserfahrungen bestätigt worden sind[52].
2.2.2 Rahmenbedingungen
Gemeinsam ist allen Kindergärten, in denen behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam betreut werden, dass sie in der Form einer Mischfinanzierung nach KJHG und BSHG gefördert werden müssen. Einrichtungen, die außerhalb des Bereichs ausdrücklicher Regelungen begründet wurden, muss die Art der Finanzierung im Einzelfall zwischen dem Träger der Einrichtung und der Jugend- bzw. Sozialbehörde ausgehandelt werden[53].
Voraussetzung für integrative Erziehungsformen ist die Wohnortnähe, um eine Aussonderung von Kindern aus ihrem natürlichen sozialen Umfeld zu verhindern. Trotz der fortschreitenden Verbreitung integrativer Kindergärten wurde dieses Ziel bisher jedoch noch längst nicht verwirklicht[54].
Die Rahmenbedingungen[55] für die räumlichen und personellen Ausstattungen sind nicht einheitlich. Nach HEIMLICH[56] bilden sich zwei grundlegende Modelle auf der Basis des Mischfinanzierungsmodells heraus, die sich in der Praxis überwiegend durchgesetzt haben:
- 10+5 Modell ®10 nichtbehinderte und 5 behinderte Kinder werden in einer Gruppe betreut,
- 12+3 Modell ® 12 nichtbehinderte und 3 behinderte Kinder werden in einer Gruppe betreut.
Um die besonderen Bedürfnisse der behinderten Kinder adäquat gewährleisten zu können, ist ein höherer Personaleinsatz erforderlich. Das Personal der integrativen Gruppen besteht in der Regel aus zwei Fachkräften, von denen eine über eine heilpädagogische Zusatzausbildung verfügt. Eine kontinuierliche praxisbegleitende Fortbildung und Beratungen gehören in den meisten Einrichtungen zum Standard, wogegen Supervision und wissenschaftliche Begleitungen nur vereinzelt stattfinden.
Die räumliche Ausstattung ist behindertengerecht und variiert je nach Einrichtungsgröße. Die meisten Gruppen verfügen über einen großen Mehrzweckraum und einem zusätzlichen Raum für Kleingruppen- oder Einzelförderung.
Therapeutische Maßnahmen können zum Großteil in den Einrichtungen gewährleistet werden, daneben ermöglichen auch Frühförderzentren in Zusammenarbeit mit der Integrationseinrichtung die therapeutische Versorgung. Durch die überwiegende Anbindung der finanziellen Förderung gemeinsamer Erziehung an das BSHG ergibt sich eine Dominanz verlängerter Betreuung mit einer deutlichen Tendenz zum ganztägigen Angebot. Öffnungszeiten von weniger als fünf Stunden bilden eher die Ausnahme.
Entscheidend für das Gelingen der gemeinsamen Erziehung ist letztendlich auch die Einbeziehung der Eltern. Alle Beteiligte (Gruppenmitarbeiter, Fachdienste, Träger, Eltern) sollten in einem ständigen Informationsaustausch stehen, d.h. sich über Ziele und Inhalte ihrer Arbeit laufend verständigen[57].
[...]
[1] Miedaner 1991, 92 f.
[2] Berger 2002, 223
[3] Vgl. Schäfer 1987, 103.
[4] Ebenda.
[5] Münder 1998, 214.
[6] Nach Seitz / Hallwachs 2002, 21.
[7] Vgl. hierzu Enzyklopädie der Sonderpädagogik 1992, 71; Bundschuh u.a. 1999, 38 f.
[8] http://www.bma.de/download/gesetze_web/SGB09/sgb09xinhalt.htm
[9] WHO-Klassifikation zitiert nach Hensle 2000, 12
[10] Vgl. hierzu Speck 1998, 194 f.
[11] Vgl. Fornefeld 2000, 49.
[12] Fornefeld 2000, 13.
[13] Bundschuh 1999, 39.
[14] Jantzen zitiert nach Speck 1998, 237.
[15] Deutscher Bildungsrat zitiert nach Hensle 2000, 9 f.
[16] Dichans 1993, 52.
[17] Speck 1998, 267.
[18] Bank-Mikkelsen zitiert nach Thimm 1995, 4.
[19] Nach Fornefeld 2000, 136 f.
[20] Miedaner 1991, 29.
[21] Speck 1998, 286.
[22] Kobi 1993, 74.
[23] Bundschuh 1999, 144.
[24] Schöneberger 1999, 81.
[25] Pfluger-Jakob 2001, 6.
[26] Er stellt in der Diskussion um Integration Gegensatzpaare auf, vgl. hierzu Kobi 1993, 75.
[27] Dichans 1993, 54.
[28] Vgl. Mühl 1987, 5.
[29] Nach Dichans 1993, 54f.
[30] Muth 1990, 15.
[31] Liebermeister / Hochhuth 1999, 21.
[32] Sie markieren den Beginn des Sonderschulwesens in Europa; vgl. Mühl 1997, 9.
[33] Möckel 1988, 70 f.
[34] Möckel 1988, 75 f.
[35] Dies waren Sehbehinderten-, Schwerhörigen-, Sprachheil- und Hilfsschulen; Missmahl-Maurer 1994, 182.
[36] Mühl 1997, 15.
[37] Schöler 1999, 18.
[38] Missmahl-Maurer 1994, 183.
[39] Deutscher Bildungsrat 1973, zitiert nach Miedaner 1991, 25.
[40] Deutscher Bildungsrat zitiert nach Biewer 2001, 206.
[41] Im Vergleich zu Sonder- und Regelkindergärten war die Zahl der integrativen Einrichtungen jedoch sehr gering; vgl. Dichans 1993, 7.
[42] Koppold 2000, 233.
[43] Ebenda, 8.
[44] Vgl. Tietze-Fritz 1999, 19.
[45] Nach Hössl / Lipski 1988, 15.
[46] Münch 2000, 19.
[47] Stolleis 1988, 23;
[48] Für Thüringen gilt das Thüringer Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder als Landesausführungsgesetz zum KJHG (Kindertageseinrichtungsgesetz – KitaG).
[49] Heimlich 1995, 42. Einzig die Richtlinien zur gemeinsamen Erziehung in Hessen können
den Status einer einheitlichen Rechtsgrundlage für sich in Anspruch nehmen, da sie die verschiedenen Organisationsformen, die verschiedenen institutionellen Zusammenhänge und darüber hinaus das Netzwerk an begleitender Hilfe regeln. Außerdem wird hier eine flexible Handhabung von KJHG- und BSHG-Zuständigkeiten vorgelegt
[50] wenn man unter dieser Gemeinschaft nicht nur die Gemeinschaft Behinderter untereinander versteht, vgl. Ziller / Saurbier 1992, 17.
[51] § 5 I 3 KitaG
[52] Ziller / Saurbier 1992, 64.
[53] Stolleis 1988, 17 f.
[54] Koppold 2000, 234.
[55] Vgl. Ebenda; Heimlich 1995, 43 ff.
[56] Heimlich 1995, 43.
[57] Koppold 2000, 235.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832469405
- ISBN (Paperback)
- 9783838669403
- DOI
- 10.3239/9783832469405
- Dateigröße
- 738 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Erfurt – Erziehungswissenschaftliche Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Juni)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- integration behinderung kindergarten montessori heilpädagogik
- Produktsicherheit
- Diplom.de