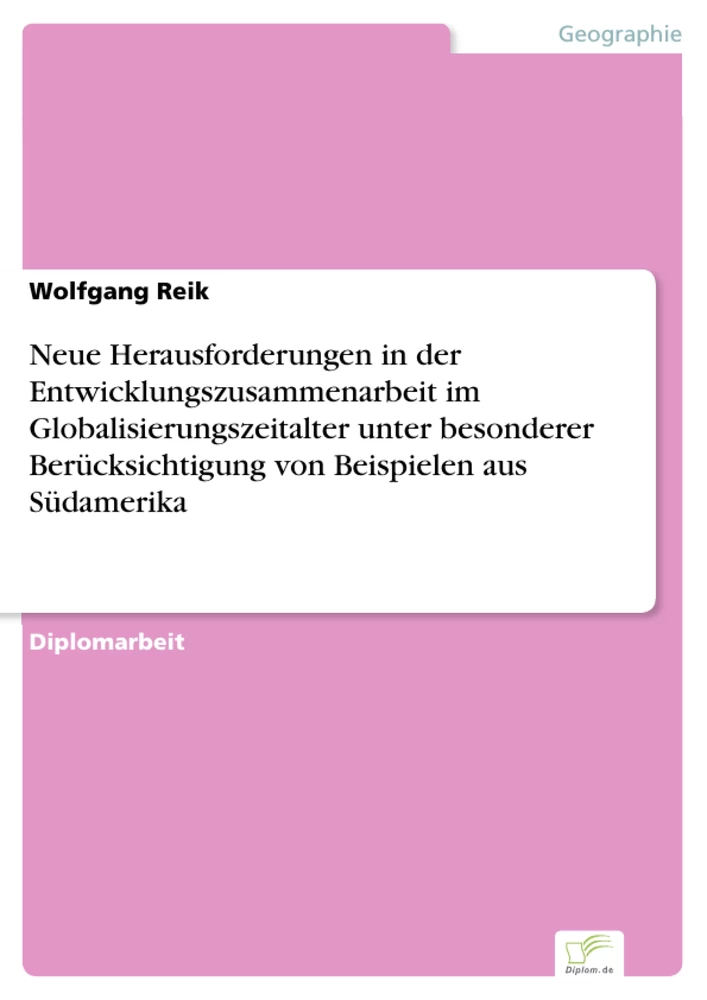Neue Herausforderungen in der Entwicklungszusammenarbeit im Globalisierungszeitalter unter besonderer Berücksichtigung von Beispielen aus Südamerika
©2002
Diplomarbeit
193 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Die breite Thematik der Entwicklungszusammenarbeit, die naturgemäß Entwicklungspolitik und Interdependenzen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern (EL) subsumiert, stellt auch die Geographie in die Verantwortung, einen Beitrag zur Lösung von Entwicklungsproblemen zu leisten. Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist, unter Berücksichtigung theoretischer Ansätze, die Strukturen, Ursachen und Gründe von differenzierten Entwicklungen zu beleuchten; ebenso die Darstellung und Beurteilung geeigneter Strategien, die als Grundlage für Lösungsansätze zur Bewältigung der Probleme und für Handlungsweisen entwicklungspolitischer Maßnahmen dienen.
Dabei steht ein ganzheitlicher Ansatz (»Holistic Approach«) im Mittelpunkt, der Maßnahmen in Richtung nachhaltiger, geschlechterspezifischer, auf den Menschen ausgerichteter Entwicklung einbezieht. Als übergeordnete Richtschnur finden verschiedene Prinzipien wie ausgleichende Gerechtigkeit, Partizipation, Verantwortlichkeit oder Verfügungsmacht Erwähnung. Ferner geht es darum, akteursspezifisch die Unterschiede der einzelnen Konzepte, Motive, Förderschwerpunkte und Instrumente der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu analysieren sowie die Wirkungen der Zusammenarbeit, soweit als möglich, zu erörtern und zu bewerten. Das Ende der Systemkonkurrenz zwischen Ost und West veränderte die Dimensionen und die Funktion von Entwicklungspolitik in der »Neuen Weltordnung«. Es wird vermutet, dass ein weltweit spürbarer Umverteilungsprozess der Entwicklungszusammenarbeit in die Transformationsländer zu Lasten der klassischen »Dritten Welt« geht, die über Jahrzehnte einen Nutzen aus dem Ost-West-Konflikt ziehen konnte. Sehr viele Themen unserer Zeit haben einen direkten oder indirekten Bezug zur Globalisierung. Dies gilt in besonderer Weise für Themen, die sich mit »Entwicklung« beschäftigen. Streitfragen um die beste Strategie zur Überwindung der Armut, über die Verschuldung der Entwicklungsländer oder über Klima- und Ressourcenschutz müssen heute im Zusammenhang der Globalisierung gesehen und diskutiert werden. Es ist auch Ziel meiner Diplomarbeit, Globalisierungseinflüsse und -effekte in den Gesamtkontext einzubringen. Mit der Globalisierung und der einhergehenden Beschleunigung des Strukturwandels verbinden sich bei den Menschen in allen Erdteilen Hoffnungen und Ängste. Der Grund für die unterschiedliche Sichtweise der Globalisierung liegt hauptsächlich darin, dass es sowohl Gewinner […]
Die breite Thematik der Entwicklungszusammenarbeit, die naturgemäß Entwicklungspolitik und Interdependenzen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern (EL) subsumiert, stellt auch die Geographie in die Verantwortung, einen Beitrag zur Lösung von Entwicklungsproblemen zu leisten. Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist, unter Berücksichtigung theoretischer Ansätze, die Strukturen, Ursachen und Gründe von differenzierten Entwicklungen zu beleuchten; ebenso die Darstellung und Beurteilung geeigneter Strategien, die als Grundlage für Lösungsansätze zur Bewältigung der Probleme und für Handlungsweisen entwicklungspolitischer Maßnahmen dienen.
Dabei steht ein ganzheitlicher Ansatz (»Holistic Approach«) im Mittelpunkt, der Maßnahmen in Richtung nachhaltiger, geschlechterspezifischer, auf den Menschen ausgerichteter Entwicklung einbezieht. Als übergeordnete Richtschnur finden verschiedene Prinzipien wie ausgleichende Gerechtigkeit, Partizipation, Verantwortlichkeit oder Verfügungsmacht Erwähnung. Ferner geht es darum, akteursspezifisch die Unterschiede der einzelnen Konzepte, Motive, Förderschwerpunkte und Instrumente der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu analysieren sowie die Wirkungen der Zusammenarbeit, soweit als möglich, zu erörtern und zu bewerten. Das Ende der Systemkonkurrenz zwischen Ost und West veränderte die Dimensionen und die Funktion von Entwicklungspolitik in der »Neuen Weltordnung«. Es wird vermutet, dass ein weltweit spürbarer Umverteilungsprozess der Entwicklungszusammenarbeit in die Transformationsländer zu Lasten der klassischen »Dritten Welt« geht, die über Jahrzehnte einen Nutzen aus dem Ost-West-Konflikt ziehen konnte. Sehr viele Themen unserer Zeit haben einen direkten oder indirekten Bezug zur Globalisierung. Dies gilt in besonderer Weise für Themen, die sich mit »Entwicklung« beschäftigen. Streitfragen um die beste Strategie zur Überwindung der Armut, über die Verschuldung der Entwicklungsländer oder über Klima- und Ressourcenschutz müssen heute im Zusammenhang der Globalisierung gesehen und diskutiert werden. Es ist auch Ziel meiner Diplomarbeit, Globalisierungseinflüsse und -effekte in den Gesamtkontext einzubringen. Mit der Globalisierung und der einhergehenden Beschleunigung des Strukturwandels verbinden sich bei den Menschen in allen Erdteilen Hoffnungen und Ängste. Der Grund für die unterschiedliche Sichtweise der Globalisierung liegt hauptsächlich darin, dass es sowohl Gewinner […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6844
Reik, Wolfgang: Neue Herausforderungen in der Entwicklungszusammenarbeit im
Globalisierungszeitalter unter besonderer Berücksichtigung von Beispielen aus
Südamerika
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Heidelberg, Universität, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
2
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT _______________________________________________6
1 EINLEITUNG ____________________________________________7
2 ENTWICKLUNG - UNTERENTWICKLUNG ___________________11
2.1 Klärung zentraler Begriffe ___________________________________11
2.2 Hauptkennzeichen der Entwicklungsländer ____________________18
2.2.1 Ökonomische Defizite _________________________________________ 18
2.2.2 Soziokulturelle und demographische Merkmale _____________________ 21
2.2.3 Politische Merkmale __________________________________________ 23
2.2.4 Ökologische Probleme ________________________________________ 24
2.2.5 Einseitige Handelsbeziehungen _________________________________ 26
2.3 Entwicklungstheorien ______________________________________30
2.3.1 Klassische »Große Theorien« ___________________________________ 32
2.3.1.1 Modernisierungstheorien _________________________________________ 33
2.3.1.2 Dependenztheorien _____________________________________________ 34
2.3.2 Neuere Theorien _____________________________________________ 36
2.3.2.1 Neoliberale »counter-revolution« ___________________________________ 36
2.3.2.2 Regulationstheorie ______________________________________________ 38
2.3.2.3 Neue Institutionen Ökonomie ______________________________________ 40
2.3.3 Zusammenfassende Bewertung _________________________________ 41
2.4 Entwicklungsstrategien_____________________________________41
2.4.1 Nachholende Industrialisierung und Modernisierung _________________ 43
2.4.2 Konzepte zur Grundbedürfnisbefriedigung _________________________ 45
2.4.3 Ländliche Entwicklung _________________________________________ 47
2.4.4 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit __________________________ 49
2.4.5 Orientierung an »good governance« und »global governance« _________ 51
2.4.6 Basisorientierung und Partizipation _______________________________ 55
2.4.7 Leitbild Nachhaltige Entwicklung _________________________________ 56
2.4.8 Resümee ___________________________________________________ 59
Inhaltsverzeichnis
3
3 ENTWICKLUNGSPOLITIK UND -ZUSAMMENARBEIT__________60
3.1 Motive Ziele Bedingungen________________________________60
3.2 Wandel in der Entwicklungszusammenarbeit ___________________63
3.2.1 Fünfziger und sechziger Jahre __________________________________ 63
3.2.2 Siebziger Jahre ______________________________________________ 64
3.2.3 Achtziger Jahre ______________________________________________ 66
3.2.4 Neuorientierung in den neunziger Jahren __________________________ 66
3.3 Formen, Kategorien und Instrumente _________________________67
3.3.1 Staatliche___________________________________________________ 68
3.3.2 Halbstaatliche nichtstaatliche __________________________________ 69
3.4 Akteure und Träger ________________________________________69
3.4.1 Nationalstaaten ______________________________________________ 69
3.4.2 Multilaterale Institutionen_______________________________________ 71
3.4.2.1 United Nations (UN) _____________________________________________ 72
3.4.2.2 Weltbankgruppe ________________________________________________ 76
3.4.2.3 Inter-American Development Bank (IDB) _____________________________ 80
3.4.3 Nichtregierungsorganisationen (NRO) ____________________________ 81
3.4.4 Privatwirtschaft und Privatkapital_________________________________ 82
4 DEUTSCHE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT ____________84
4.1 Ziele, Schwerpunkte und Instrumente _________________________85
4.2 Durchführungsorganisationen _______________________________90
4.3 Entwicklungsgang der Deutschen Zusammenarbeit _____________94
5 DEUTSCH- SÜDAMERIKANISCHE ZUSAMMENARBEIT________99
5.1 Wirtschaftliche und soziale Grundprobleme ___________________99
5.2 Determinanten der Entwicklungszusammenarbeit ______________113
5.2.1 Allgemeine Aspekte__________________________________________ 113
5.2.2 Lateinamerikakonzept des BMZ ________________________________ 115
5.2.3 Tendenzen der Zusammenarbeit _______________________________ 117
Inhaltsverzeichnis
4
6 ZUSAMMENARBEIT AUF LÄNDEREBENE: DAS BEISPIEL
CHILE _______________________________________________121
6.1 Nationale Rahmenbedingungen _____________________________121
6.2 Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes (SEK) e.V._____130
6.2.1 Allgemeines ________________________________________________ 130
6.2.2 Verbandsaufbau und Organigramm _____________________________ 131
6.2.3 Entwicklungspolitische Leitlinien, Ziele und Handlungsfelder __________ 133
6.2.4 Finanzierung _______________________________________________ 135
6.2.5 Umfang der weltweiten Projektarbeit_____________________________ 135
6.2.6 Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika ____________________ 138
6.2.7 Obra Kolping Chile __________________________________________ 139
6.2.8 Projektbeispiel: Handwerks- und Kleingewerbeförderung_____________ 145
6.3 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH__________________________________________________149
6.3.1 Allgemeines Profil des Unternehmens ___________________________ 149
6.3.2 Regionale Differenzierung _____________________________________ 151
6.3.3 Zusammenarbeit mit Chile_____________________________________ 153
6.3.4 Projektvorbereitung und Projektdurchführung ______________________ 155
6.3.5 Monitoring und Evaluierung____________________________________ 157
6.3.6 Projektbeispiele _____________________________________________ 157
6.3.6.1 Kontrolle der Luftverschmutzung und Umsetzung des__________________ 157
Luftreinhalteplans in Santiago ____________________________________ 157
6.3.6.2 Nachhaltige Naturwaldbewirtschaftung _____________________________ 164
6.3.7 Experteninterview ___________________________________________ 167
7 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK____________________171
7.1 Ergebnisse ______________________________________________171
7.2 Konsequenzen und Schlussfolgerungen______________________174
8 ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS ______________177
9 LITERATURVERZEICHNIS _______________________________179
Vorwort
6
VORWORT
Die vorliegende Diplomarbeit ist Ergebnis eines Versuchs, die Determinanten,
Gründe und Ursachen von Entwicklung beziehungsweise Unterentwicklung
vorzustellen sowie Konzepte und Motive der Entwicklungszusammenarbeit, deren
Umsetzung und Wirkung aufzuzeigen. Dabei werden verschiedene Träger, Akteure
und Bedingungen der Entwicklungszusammenarbeit einbezogen sowie der staatliche
und nichtstaatliche Bereich gleichermaßen berücksichtigt.
Neuere Tendenzen im Rahmen von Globalisierungsprozessen finden ebenso
Berücksichtigung wie historische, soziokulturelle, wirtschaftliche, ökologische und
politische Aspekte. Ich habe ferner versucht, verschiedene Maßstabsebenen sowie
differenzierte Faktoren der Raumbedingtheit und Raumwirksamkeit zu beachten.
Eine Arbeit wie diese ist ohne die ideelle Mithilfe und Unterstützung zahlreicher
Personen nur schwer vorstellbar.
Ich möchte mich daher an erster Stelle bei meinen Eltern Edith und Gerhard Reik
bedanken, die mich während meiner gesamten Studienzeit motivierend
unterstützten.
Besonderer Dank gebührt selbstverständlich Herrn Univ.-Prof. Dr. Werner Mikus, der
meine Diplomarbeit betreute und ermöglichte, mir Anregungen, Vorschläge und
Zugang zu Informationen anbot und stets zu Diskussionen bereit stand. Darüber
hinaus stellte er erste Kontakte zu Schlüsselpersonen und Institutionen her.
Abschließend sei namentlich insbesondere folgenden Einzelpersonen gedankt: Herrn
Univ.-Prof. Dr. Hans Gebhardt für das Zweitgutachten, Frau Thilo Schütz von der
GTZ und Herrn Hans Drolshagen vom Kolpingwerk.
1 Einleitung
7
1 EINLEITUNG
Begründung für das Thema
Erste Erfahrungen mit einem Entwicklungsland sammelte ich als Jugendlicher
während eines einjährigen Auslandsaufenthaltes auf Java, wo mein Vater als
Ingenieurgeologe mit Staudammprojekten beschäftigt war. Intensiviert wurde mein
Interesse während des Geographiestudiums im Rahmen von Vorlesungen wie
,,Südamerika" oder ,,Wirtschaftsgeographie" und in Hauptseminaren. Aber ich habe
mich erst im Verlaufe des Projektseminars ,,Entwicklungsplanung", das in Brasilien
stattfand, intensiv mit der Thematik der Entwicklungszusammenarbeit (EZ)
beschäftigt. Während der Vorbereitungen organisierte Herr Prof. Dr. Werner MIKUS
einen Besuch bei der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) in Eschborn, wo ich weitere Einblicke in diese Materie erlangte. Als
Exkursionsteilnehmer der ,,Großen Exkursion Chile 2001", die ebenfalls von Prof. Dr.
Werner MIKUS vorbereitet und durchgeführt wurde, fertigte ich ein Referat mit dem
Thema ,,Beispiele von Entwicklungsprojekten in Chile" an. Wichtige Fragestellungen
zu Entwicklungsproblemen und -projekten waren Zielsetzungen der Exkursion,
welche durch diverse Besuche bei Institutionen und Forschungsstätten nachdrücklich
betont wurde.
Die Studienreisen nach Chile und Brasilien sowie zwei private Reisen durch Kuba
haben meine Vorliebe für den lateinamerikanischen Raum weiter gestärkt.
So wurden durch diese persönlichen Erfahrungen mein Interesse und meine
Präferenzen an solch einem Thema geweckt, und es war nahezu eine logische
Konsequenz, mich damit im Rahmen einer Diplomarbeit noch intensiver zu
beschäftigen. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass dieser Themenbereich
weder in fachlicher noch in gesellschaftspolitischer Hinsicht an Aktualität verloren
hat.
Thema der Arbeit
Die breite Thematik der Entwicklungszusammenarbeit, die naturgemäß
Entwicklungspolitik und Interdependenzen zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern (EL) subsumiert, stellt auch die Geographie in die
Verantwortung, einen Beitrag zur Lösung von Entwicklungsproblemen zu leisten.
Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist, unter Berücksichtigung theoretischer Ansätze,
die Strukturen, Ursachen und Gründe von differenzierten Entwicklungen zu
beleuchten; ebenso die Darstellung und Beurteilung geeigneter Strategien, die als
Grundlage für Lösungsansätze zur Bewältigung der Probleme und für
Handlungsweisen entwicklungspolitischer Maßnahmen dienen.
1 Einleitung
8
Dabei steht ein ganzheitlicher Ansatz (»Holistic Approach«) im Mittelpunkt, der
Maßnahmen in Richtung nachhaltiger, geschlechterspezifischer, auf den Menschen
ausgerichteter Entwicklung einbezieht. Als übergeordnete Richtschnur finden
verschiedene Prinzipien wie ausgleichende Gerechtigkeit, Partizipation,
Verantwortlichkeit oder Verfügungsmacht Erwähnung.
Ferner geht es darum, akteursspezifisch die Unterschiede der einzelnen Konzepte,
Motive, Förderschwerpunkte und Instrumente der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit zu analysieren sowie die Wirkungen der Zusammenarbeit, soweit
als möglich, zu erörtern und zu bewerten.
Das Ende der Systemkonkurrenz zwischen Ost und West veränderte die
Dimensionen und die Funktion von Entwicklungspolitik in der »Neuen Weltordnung«.
Es wird vermutet, dass ein weltweit spürbarer Umverteilungsprozess der
Entwicklungszusammenarbeit in die Transformationsländer zu Lasten der
klassischen »Dritten Welt« geht, die über Jahrzehnte einen Nutzen aus dem Ost-
West-Konflikt ziehen konnte.
Sehr viele Themen unserer Zeit haben einen direkten oder indirekten Bezug zur
Globalisierung. Dies gilt in besonderer Weise für Themen, die sich mit »Entwicklung«
beschäftigen. Streitfragen um die beste Strategie zur Überwindung der Armut, über
die Verschuldung der Entwicklungsländer oder über Klima- und Ressourcenschutz
müssen heute im Zusammenhang der Globalisierung gesehen und diskutiert werden.
Es ist auch Ziel meiner Diplomarbeit, Globalisierungseinflüsse und -effekte in den
Gesamtkontext einzubringen.
Mit der Globalisierung und der einhergehenden Beschleunigung des Strukturwandels
verbinden sich bei den Menschen in allen Erdteilen Hoffnungen und Ängste. Der
Grund für die unterschiedliche Sichtweise der Globalisierung liegt hauptsächlich
darin, dass es sowohl Gewinner als auch Verlierer gibt, und zwar auf allen
Maßstabsebenen. Dabei werden ausdrücklich zwei Hypothesen kontrovers diskutiert:
Kann die Globalisierung zur Vermehrung des allgemeinen Wohlstands beitragen
oder ist sie ein »Nullsummenspiel«, welches zu noch größeren Polarisierungen
führen wird? Nach zunächst euphorischer Lehrmeinung vermehren sich in den
letzten Jahren die pessimistischen Stimmen innerhalb der Forschungsfront (so z. B.
SCHOLZ 2002), die die zweite Variante verifizieren. Ferner belegen Statistiken, dass
sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter geöffnet hat und der Abstand
scheinbar unaufhörlich wächst. Liegt dies nur an einer ungerechten Umverteilung?
Gibt es globale Lösungsansätze, welche die wirtschaftlichen und politischen Vorteile
der Globalisierung nicht in Frage stellen und geeignet sind, die Ungerechtigkeiten
und drängenden Weltprobleme zu mindern?
1 Einleitung
9
Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik haben zuletzt durch die
Terroranschläge wieder an Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und in der Politik
gewonnen. Unbestritten sind Terror und Fundamentalismus nicht ausschließlich von
religiösen Antagonismen motiviert, sondern Ausdruck bestehender Strukturen, durch
die ein Großteil der Menschheit benachteiligt wird und einen Nährboden für die
Entstehung des Terrorismus, aber auch anderer Konfliktformen, darstellen. Die
derzeitige »Allianz gegen den Terrorismus« muss durch eine Allianz gegen Armut
und Verelendung ergänzt und langfristig ersetzt werden. Ob die weltweiten Vorhaben
zur Armutsbekämpfung überwiegend Lippenbekenntnisse sind, kann erstens nur
sehr schwer und muss zweitens differenziert beurteilt werden.
Es stellt sich die Frage, ob die staatliche Entwicklungszusammenarbeit mehr und
mehr zu einem Instrument einer neuen Außen- und Weltfriedenspolitik wird.
Vorgehensweise
Der Haupttext meiner Arbeit beginnt mit der Definition wichtiger Begriffe. Darauf
folgend werden ökonomische, politische, soziokulturelle und ökologische Merkmale
und Probleme der Entwicklungsländer in deskriptiver Form wiedergegeben, die zum
Teil die Ursachen der Unterentwicklung ansprechen. Zur weiteren Untersuchung
werden Theorien und Strategien herangezogen. Für die Praxisnähe kommt
insbesondere den Strategien eine bedeutende Rolle zu.
Im dritten Kapitel werde ich, beginnend mit einem historischen Rückblick der
Entwicklungszusammenarbeit, in allgemeiner Form die Entwicklungspolitik und
-zusammenarbeit sowie einflussreiche Akteure behandeln. Die deutsche
Entwicklungszusammenarbeit, die ihre Fortsetzung in der zwischenstaatlichen Ebene
findet, ist Thema im nächsten Kapitel.
Eine länderübergreifende Analyse Südamerikas hat zum Ziel, den Entwicklungsgang
in den 1990er Jahren sowie Struktur- und Entwicklungsprobleme dieses
Kulturerdteils zu klären. Hauptaugenmerk gilt der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung, deren Bewertung durch Datenmaterial sowie zahlreiche Statistiken
gestützt wird. Insbesondere unter dem globalen Blickwinkel von Unterentwicklung
und Entwicklung ist die Vorstellung von der südamerikanischen Übereinstimmung in
der Grundsituation durchaus akzeptabel. Kolonialgeschichtliche Merkmale,
»Demokratisierungswellen« in den 1990er Jahren, enge wirtschaftliche
Verflechtungen der Länder untereinander, vergleichbare Funktionen innerhalb der
Weltwirtschaft und ähnlichen Abhängigkeitsbeziehungen im globalen »Zentrum-
Peripherie-System« erlauben meiner Ansicht nach eine einheitliche, generalisierende
makroökonomische Betrachtung. Räumliche- wie zeitliche Differenzierungen bleiben
selbstverständlich nicht völlig außer acht.
1 Einleitung
10
Verschiedene Determinanten der deutsch-südamerikanischen Entwicklungs-
zusammenarbeit ergänzen das fünfte Kapitel.
Praxisnahe Arbeitsweisen in der Entwicklungszusammenarbeit sollen einzelne
Fallbeispiele aus Chile verdeutlichen. Ich habe bewusst einerseits Projekte einer
staatlichen Durchführungsorganisation und andererseits einer Nichtregierungs-
organisation gewählt, um Gegensätze und Übereinstimmungen belegen zu können.
Bereits während der Chileexkursion konnte ich Informationen und Erkenntnisse vor
Ort gewinnen, die speziell in diesem Teil der Arbeit Verwendung finden.
Mit der Zusammenfassung eines ausführlichen Experteninterviews wird der
Haupttext abgeschlossen.
Im Schlussteil werden Ergebnisse, die die Arbeit erbracht hat, noch einmal kurz
zusammengefasst sowie auf zukünftige Perspektiven verwiesen.
Insgesamt stützt sich meine Diplomarbeit also auf eine breite theoretische
Grundlage, statistischen Untersuchungen und Interviews, die durch eigene
Erfahrungen ergänzt werden.
Die Entwicklungsproblematik mit ihrer Komplexität von Wechselbeziehungen
zwischen dem Menschen und seiner Umwelt fordern eine interdisziplinäre
Betrachtungsweise. Die Einbeziehung der allgemeinen Kybernetik und Ansichten von
Nachbardisziplinen wie von Wirtschafts- und Politikwissenschaften oder der
Soziologie würden das Ausmaß einer solchen Arbeit sprengen und werden daher nur
ansatzweise verfolgt.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
11
2 ENTWICKLUNG - UNTERENTWICKLUNG
2.1 Klärung zentraler Begriffe
Zunächst werde ich auf einige der häufiger gebrauchten zentralen Fachbegriffe
näher eingehen beziehungsweise definieren, da viele der Begriffe in der Fachliteratur
nicht einheitlich verwendet werden, oft irreführen oder mit anderen Kriterien
assoziiert werden.
Entwicklung
Der Begriff »Entwicklung« hat seinen Ursprung in der Biologie, wurde aber
zunehmend in gesellschaftliche, soziale, geschichtliche, politische oder
wirtschaftliche Bereiche transferiert. Er ist weder fest vorgegeben, noch gibt es eine
allgemein akzeptierte Definition, noch ist er wertneutral; er ist abhängig von Raum
und Zeit sowie von individuellen und kollektiven Wertvorstellungen und Ideologien.
Es besteht zweifelsohne eine enge zeitliche Verflechtung zwischen Entwicklung,
Entwicklungstheorie und Entwicklungsstrategie. Fehlschläge der vergangenen
Dekaden in der Entwicklungspolitik haben entscheidend zur Weiterentwicklung des
dynamischen und offenen Entwicklungsbegriffes beigetragen (NOHLEN 2000, S.
216). In diesem Sinne wird in den älteren Entwicklungstheorien das wirtschaftliche
Wachstum in den Mittelpunkt des Entwicklungsbegriffs gestellt
(Wachstumstheorien). Ungenügende Wachstumserfolge und das Ausbleiben der an
wirtschaftlichem Wachstum gekoppelten sozialen Entwicklungsfortschritte führten zu
einer Ausweitung des Entwicklungsbegriffs mit neuen Komponenten. Die neue
»Entwicklungsformel« lautete zu Beginn der 1960er Jahre Wachstum und Wandel.
Hierbei wurden Veränderungen in den Wertsystemen und Verhaltensweisen der
Bevölkerung, politische und institutionelle Modernisierung, Investitionen im sozialen
Bereich sowie gerechtere Verteilung (z. B. von Einkommen und Land) gefordert.
Die internationale »Unabhängige Kommission für internationale Entwicklungsfragen«
(Nord-Süd-Kommission) hatte »Entwicklung« im Jahre 1977 folgendermaßen
umschrieben: ,,Entwicklung ist mehr als der Übergang von Arm zu Reich, von einer
traditionellen Agrarwirtschaft zu einer komplexen Stadtgemeinschaft. Sie trägt in sich
nicht nur die Idee des materiellen Wohlstands, sondern auch die von mehr
menschlicher Würde, mehr Sicherheit, Gerechtigkeit und Gleichheit" (ANDERSEN
1996, S. 7).
2 Entwicklung - Unterentwicklung
12
Dieter NOHLEN und Franz NUSCHELER haben fünf komplementäre Aspekte und
Ziele von Entwicklung zum »magischen Fünfeck des Entwicklungsbegriffs« erhoben:
Partizipation
Arbeit und Beschäftigung Wirtschaftliches Wachstum
Soziale Gerechtigkeit und
Politische und wirtschaftliche
Strukturwandel Unabhängigkeit
Jüngste Anstrengungen, einheitliche Standards und Bewertungskriterien im Kontext
»Entwicklung« auszuarbeiten, wurden unter anderem von den Vereinten Nationen
(UN) aufgegriffen. Seit 1990 wird vom Weltentwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen (UNDP) ein »Bericht über die menschliche Entwicklung« veröffentlicht. Ein
aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzter relativierter Indikator (Human
Development Index, Abk. HDI)
1
bewertet den wirtschaftlich-sozialen Fortschritt in
einem Land. Dieser Index wird ergänzt durch den Gender-related Development Index
(Abk. GDI; geschlechtsbezogener Entwicklungsindex, der die Ungleichheit der
Geschlechter bei den menschlichen Entfaltungsmöglichkeiten untersucht)
und durch
das Gender Empowerment Measure (Abk. GEM, Maß für die Ermächtigung der
Geschlechter, das geschlechterspezifische Ungleichheiten bei der Mitwirkung in
Wirtschaft, Politik und Beruf analysiert) sowie neuerdings durch den Human Poverty
Index (Abk. HPI, Index für menschliche Armut).
Entwicklungsländer
Entwicklungsländer sind eine nicht einheitlich definierte Gruppe von Ländern, deren
Entwicklungsstand im Vergleich zu den Industriestaaten relativ gering ist, die als
»arme Welt« und vielfach auch als »Dritte Welt« bezeichnet werden. Es ist kaum
eines der Merkmale, die regelmäßig mit der Definition der Dritten Welt assoziiert
1
Die Komponenten sind Lebensdauer, Bildungsniveau (definiert durch Analphabetismus und Dauer
des Schulbesuchs) und Lebensstandard, der durch das reale, den jeweiligen lokalen
Lebenshaltungskosten angepasste (Kaufkraftparitäten-Konzept) Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf
der Bevölkerung gemessen wird.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
13
werden, auf alle Länder zutreffend, die in internationalen Statistiken als solche
aufgeführt werden (NUSCHELER 1996, S. 72).
Der Begriff entstand 1949 und markierte bis weit in die 1950er-Jahre einen Dritten
Weg der blockfreien Staaten, die sich im Kalten Krieg zu einer Politik der
Bündnisfreiheit zwischen den Militärblöcken der westlichen (pluralistisch-
demokratischen) und der östlichen (kommunistischen) Staatenwelt (das heißt der bei
der Wortprägung einbezogenen »Ersten« und »Zweiten« Welt) bekannten. Erst
Anfang der 1960er Jahre wurde der Begriff auf alle Entwicklungsländer ausgedehnt
(als Gegenstück zur »Ersten« und »Zweiten Welt«).
Mit dem Zusammenbruch der
kommunistischen Staatenwelt in Ostmittel-, Südost- und Osteuropa verlor die
Bezeichnung »Dritte Welt« ihren ursprünglichen Sinngehalt.
Infolge der ausgeprägten und fortschreitenden Auseinanderentwicklung der
Entwicklungsländer hat sich der Begriff »Dritte Welt« inzwischen weitgehend
überlebt. An seine Stelle treten mehr und mehr Bezeichnungen, die diesem
Differenzierungsprozess Rechnung tragen (Schwellenländer, less developed
countries etc.), denn schließlich liegen innerhalb Lateinamerikas oder zwischen Ost-
und Südasien »Entwicklungswelten« so z. B. nach Ressourcenausstattung, nach
Entwicklung der Infrastruktur und des Humankapitals, nach Größe, Bevölkerungszahl
oder nach verschiedenen Armutskriterien. Dieser Begriff ist als Synonym zu der
allgemeinen Bezeichnung »Entwicklungsländer« zu verstehen.
Kriterien für deren Zuordnung sind insbesondere niedriges Pro-Kopf-Einkommen,
geringe Arbeitsproduktivität, hohe Arbeitslosen- und Analphabetenquote,
mangelhafte Infrastruktur, hoher Anteil der Produktion landwirtschaftlicher
Erzeugnisse, Abhängigkeit von Rohstoffexporten und damit vom Preisniveau des
Weltmarktes (siehe weiter unter Punkt 2.2:
Hauptkennzeichen der
Entwicklungsländer). Der Entwicklungshilfeausschuss (DAC) der OECD
2
stuft rund
140 Staaten als Entwicklungsländer ein, in denen ca. ¾ der Weltbevölkerung leben,
die aber nur ein Fünftel der Weltwirtschaftsleistung erbringen. Beispielsweise
orientiert sich die Bundesregierung bei der EZ an dem Länderverzeichnis der OECD,
an die sog. DAC-Liste.
2
Abkürzung für englisch Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), Organisation der westlichen Industrieländer
mit beratender Funktion zur Koordinierung der Wirtschafts-, Währungs- und Außenwirtschaftspolitik
der Mitgliedsstaaten sowie für Aufgaben in Bereichen wie Umwelt, Energie, Verkehr, Finanzmärkte,
Entwicklungshilfe, Arbeit und Soziales; gegründet 1960 durch das Pariser Übereinkommen.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
14
Die Weltbank unterscheidet, ungeachtet der methodischen Einwände, nach dem
Hauptkriterium Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner folgende Ländergruppen
(BROCKHAUS 2002, o. S.):
·
Low income countries (Abk. LIC; Entwicklungsländer mit niedrigem
Einkommen; BIP je Einwohner maximal 785 US-$ pro Jahr)
·
Lower middle income countries (Abk. LMIC; Entwicklungsländer mit mittlerem
Einkommen; BIP je Einwohner maximal 3125 US-$)
·
Upper middle income countries (Abk. UMIC; Entwicklungsländer mit hohem
mittlerem Einkommen; BIP je Einwohner maximal 9655 US-$ )
·
High income countries (Industrieländer) mit hohem Einkommen (BIP je
Einwohner über 9656 US-$)
Die Vereinten Nationen (UN) führten 1970 für die Entwicklungsländer die
Bezeichnung Less developed countries (wenig entwickelte Länder; Abkürzung LDC)
ein. Kriterien für die Einordnung in die Gruppe der Least developed countries (am
wenigsten entwickelte Länder; Abkürzung LLDC) sind ein Bruttoinlandsprodukt (BIP)
je Einwohner unter 473 US-$, ein Anteil der Industrieproduktion am BIP von
höchstens 10 % und eine Analphabetenrate von mehr als 80 %. Hierbei handelt es
sich also um die ärmsten Entwicklungsländer, die von einigen Autoren als »Vierte
Welt« bezeichnet und damit begrifflich aus der Dritten Welt ausgegliedert werden.
Die »Least developed countries« erhalten in der Zusammenarbeit mit den UN und
anderen Gebern wesentlich günstigere Bedingungen
3
als die übrigen
Entwicklungsländer.
Nach 1973 (starke Erhöhung der Erdölpreise) definierte die UN die Kategorie der
Most seriously affected countries (am schwerwiegendsten betroffene Länder;
Abkürzung MSAC): niedriges Pro-Kopf-Einkommen, hohe Verschuldung durch
Preisanstieg bei wichtigen Importen und geringe Exporterlöse. Die Grenzen
zwischen LLDC und MSAC sind fließend (BROCKHAUS 2002, o. S.).
Einen differenzierteren Versuch der UN stellt der bereits erwähnte Human
Development Index (HDI) dar, der tendenziell auf Erweiterung angelegt ist. Weitere
Indikatoren wie die Berücksichtigung des politischen Freiheitsgrades, der
Umweltbelastung und des Grades an regionaler, sozialer und
geschlechtsspezifischer Ungleichheit werden gefordert (ANDERSEN 1996, S. 19).
Der HDI liegt für alle Länder zwischen 0 und 1, Teilgruppen werden mit hohem (
0,8), mittlerem (0,5-0,8) und niedrigem ( 0,5 ) HDI unterschieden. Im aktuellsten
3
Beispielsweise Kredite zu Bedingungen der IDA (International Development Association): Die
Tochtergesellschaft der Weltbank vergibt lediglich Darlehen zu Sonderbedingungen an ärmere Länder
bis zu einem Pro-Kopf-Einkommen von 940 US-$ (NUSCHELER 1996, S. 75).
2 Entwicklung - Unterentwicklung
15
Bericht werden 53 Länder mit einem »High human development«, darunter
südamerikanische Länder wie Argentinien, Chile und Uruguay, aufgeführt. Weiterhin
sind aufgelistet 84 Länder mit einem »Medium human development«, so etwa
Venezuela, Brasilien, Peru, Paraguay und Bolivien sowie 36 Länder mit einem »Low
human development«, wobei kein Land aus Südamerika vertreten ist und sie
überwiegend dem afrikanischen Kontinent zuzuordnen sind (UNITED NATIONS
DEVELOPMENT PROGRAMME 2002, S. 149).
Ein Teil der Entwicklungsländer gehört zur OPEC
4
und kann durch Erlöse aus
Erdölexporten seine Industrialisierung zum Teil selbst finanzieren oder zählt bereits
zu den sog. Schwellenländern wie Chile, Brasilien oder die ostasiatischen
»Tigerstaaten«. Jene Länder konnten sich aus der einseitigen Abhängigkeit von
Rohstoffexporten befreien und haben aufgrund der Eigendynamik ihrer Wirtschaft
den Weg der Entwicklung zum Industrieland eingeschlagen und sind verstärkt in die
Weltwirtschaft integriert. Synonym zum Begriff »Schwellenländer« wird auch der
Begriff »Newly Industrializing Countries« benutzt.
Die Entwicklungsländer treten offiziell seit 1967 als »Gruppe der 77«, der
Interessenorganisation der Entwicklungsländer auf. Insgesamt leben rund ¾
der
Weltbevölkerung in diesen Ländern. Der Austritt Argentiniens aus der Gruppe der 77
und der Beitritt Südkoreas und Mexikos zur OECD demonstriert das
Selbstverständnis einiger Staaten, Teil der »Ersten Welt« zu sein.
Es gibt zahlreiche weitere Versuche zur Gliederung der Entwicklungsländer
beziehungsweise der »Einen« Welt, doch ist allen gemeinsam, dass sie lediglich eine
Simplifizierung der wahren Verhältnisse darstellen und die Heterogenität und den
Facettenreichtum etwa von komplexen ökonomischen und sozialen Strukturen in den
Ländern sowie den Verflechtungen zwischen ihnen nicht vollständig berücksichtigen.
Dass sie beiläufig den internen Differenzierungen nicht gerecht werden ist ein
weiteres Manko (MIKUS 1994, S. 9). Problematisch ist ferner die Gewichtung der
einzelnen Indikatoren, die zumindest regelmäßig umstritten ist und stark von
subjektiven Bewertungen und Standpunkten abhängig ist.
Entwicklungshilfe
Beinhaltet Know-how-, Technologie- und Ressourcentransfer zu
Vorzugsbedingungen in EL mit dem vorrangigen Ziel, die sozioökonomische
Entwicklung zu fördern und die Lebensbedingungen zu verbessern.
4
Abkürzung für englisch Organization of Petroleum Exporting Countries, Organisation Erdöl
exportierender Länder, gegründet 1960, Sitz: Wien.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
16
Entwicklungshilfe wird durch private, öffentliche und internationale Organisationen
sowie durch Staaten als Kapitalhilfe (Kredite, Bürgschaften), technische Hilfe
(Bereitstellung von Fachleuten, Bildungs- und Beratungshilfe), Güterhilfe
(Nahrungsmittel, Medikamente, Investitionsgüter) und Handelshilfe (z. B. Abbau von
Zöllen und Kontingenten) gewährt (http://www.bessereweltlinks.de/ book22a.htm).
Das 1970 von den Vereinten Nationen formulierte Ziel, dass die Industrieländer
0,7 % ihres Bruttoinlandsprodukts für öffentliche Entwicklungshilfe aufwenden sollen,
wird nur selten erreicht. Neben strategisch-machtpolitischen Überlegungen
(Schaffung weltpolitischer Einflusszonen) sind vor allem die Wahrung binnen- und
außenwirtschaftlicher Interessen (Exportförderung, Markterschließung, Sicherung
von Rohstoffreserven), aber auch idealistisch-humanitäre Gründe wesentliche Motive
für Entwicklungshilfe.
Nach MYRDAL soll Entwicklungshilfe nicht so sehr Industrieprojekte unterstützen,
sondern vielmehr und dringender Maßnahmen zu Produktivitätssteigerungen im
Nahrungsmittelsektor, Verbesserungen im Bereich der Hygiene, des
Gesundheitswesens, der Geburtenkontrolle und der Bildung sowie die Verbreitung
angepasster Technologie und direkte Armutshilfe anstreben
(http://www.bessereweltlinks.de/book22a.htm).
Nord-Süd-Gegensätze
Der weitläufige Ausdruck »Nord-Süd-Konflikt« bezeichnet jenes strukturelle
Konfliktverhältnis, das sich aus dem wirtschaftlich-sozialen und politisch-kulturellen
Entwicklungsgefälle zwischen den Industriestaaten der nördlichen Erdhalbkugel und
den dem Süden der Erde zugerechneten Entwicklungsländern Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas andererseits (Nord-Süd-Gefälle) ergibt. Das Gefälle resultiert
aufgrund historischer Voraussetzungen, im Zuge der Entkolonialisierung und vor
allem als Konsequenz von Bevölkerungsexplosion, Nahrungsmittelknappheit,
unzureichender Industrialisierung sowie mangelnder Einbindung der
Entwicklungsländer in die internationale Arbeitsteilung, der Ausbeutung ihrer
wirtschaftlichen Ressourcen durch die Industriestaaten und der ungerechten
Handelsbeziehungen.
Seit den 1970er Jahren wird diese Redewendung immer wieder auf den weltweiten
politischen und wirtschaftlichen Foren angewendet, und 1977 konstituierte sich sogar
eine unabhängige »Nord-Süd-Kommission« unter dem Vorsitz von Willy BRANDT,
deren 1980 vorgelegte Vorschläge einen partnerschaftlichen Ausgleich zwischen
Nord und Süd zum Ziel hatten. Forderungen nach einer Neuen
Weltwirtschaftsordnung (NWWO) zugunsten der Entwicklungsländer, die mit den
2 Entwicklung - Unterentwicklung
17
OPEC-Ländern einen neuen Machtfaktor innehatten, rückten zwischen den
Konfliktparteien zunehmend in den Mittelpunkt.
Der Nord-Süd-Gipfel in Cancún 1981 und die sechste UN-Konferenz für Handel und
Entwicklung in Belgrad 1983 zogen praktisch einen Schlussstrich unter das Konzept
der NWWO und anderer Reformziele. Die zunehmende Differenzierung des Südens
in den 1980er und 1990er Jahren in neue Wachstums- und Krisenregionen, löste die
Einheit der Entwicklungsländer gegenüber den Industrieländern weitgehend auf, und
die Nord-Süd-Verhandlungsforen verloren an Bedeutung. Während einerseits
zahlreiche Entwicklungsländer infolge des dramatischen Verfalls der Rohstoffpreise
und von Verschuldungskrisen sich vom Weltmarkt abkoppelten, konnten andererseits
speziell die ostasiatischen Schwellenländer weitere Wachstumserfolge verbuchen
und sehen die Anpassung an die Bedingungen des Weltmarktes als einzige
Entwicklungsstrategie (NOHLEN 2000, S. 565).
Der geographische Begriff versucht eine globale Gültigkeit zu vermitteln, die er
zweifelsohne nicht erfüllen kann (MIKUS 1994, S. 35), schließlich liegen
Industrieländer wie Australien und Neuseeland ebenfalls auf der Südhemisphäre
und, spätestens nach dem Zusammenbruch der UDSSR ist offenkundig, dass neben
zahlreichen anderen Entwicklungsländern auf der Nordhalbkugel auch die meisten
Länder Mittel- und Osteuropas, zumindest gemessen an ihrem Pro-Kopf-
Einkommen, ebenfalls als Entwicklungsländer anzusehen sind.
Ebenso wie bei anderen stark generalisierten oder obsolet gewordenen Begriffen
stellt sich die Frage, ob man nicht Abschied vom weiteren Gebrauch machen sollte.
Zumindest seine originäre Begrifflichkeit ist sehr verschwommen, und er wird
neuerdings, wie z. B. von Fred SCHOLZ in seinem »Modell der globalen
Fragmentierung«, zunehmend als soziale Kategorie verstanden. Sie ist ausgegrenzte
»Restwelt« beziehungsweise als »neuer Süden« (Meer der Armut) weltweit
anzutreffen. ,,Ebenso hat auch der Begriff Peripherie seine drittweltliche Verortung
und Konnotation verloren. Als new periphery ist sie global präsent" (zit. n. SCHOLZ
2000, S. 13). So hat der Begriff, wenn auch mit verändertem und empirisch
gestütztem Inhalt, gewiss noch immer Anwendungsberechtigung.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
18
2.2 Hauptkennzeichen der Entwicklungsländer
Unterentwickelte Länder weisen zumeist eine ganze Anzahl an Indikatoren auf, mit
denen sie sich von den klassischen Industrieländern unterscheiden lassen und
welche selbstverständlich in den einzelnen Bereichen mehr oder weniger stark
ausgeprägt sind. Demgemäss werden sie nachstehend lediglich pauschal
beziehungsweise generalisierend vorgestellt. Nicht alle negativen Tendenzen äußern
sich offensichtlich, sondern bleiben für viele Menschen latent verborgen oder treten
erst in ferner Zukunft gravierender zutage. Viele der Probleme sind ursächlich
miteinander verknüpft; oft nicht nachvollziehbar in welchem Ausmaß oder über
welche Verbindungen. Außerordentliche Relevanz besitzen sie, wenn effektive und
erfolgsversprechende Ansatzpunkte für Entwicklungsmaßnahmen erörtert und
angewandt werden sollen, insbesondere vor dem Hintergrund eingeschränkter
Möglichkeiten, die den einzelnen Akteuren zur Verfügung stehen.
Ein bedeutungsvolles Charakteristikum ist besonders das Vorhandensein sehr
starker wirtschaftlicher und sozialer Disparitäten innerhalb eines Landes, häufig in
Form einer sehr ungleichen Entwicklung zwischen der Hauptstadt (in Südamerika
typisch mit extrem ausgeprägter primacy
5
) und den peripheren Gebieten, sowie sehr
starke soziale Unterschiede zwischen Arm und Reich.
2.2.1 Ökonomische Defizite
In internationalen Vergleichsstatistiken wird die wirtschaftliche Situation der
Bevölkerung gerne in Form des durchschnittlichen Bruttosozialprodukts (BSP) pro
Kopf als Maßstab herangezogen, obwohl die Datenerhebungen mit vielfältigen
Problemen behaftet sind (hoher Anteil von Selbstversorgung
informeller Sektor,
rudimentärer statistischer Verwaltungsapparat etc.) und eine objektive
Vergleichbarkeit eigentlich nicht gegeben ist. Die Abbildung 1 verdeutlicht
exemplarisch an einigen Ländern die ungleiche Verteilung des durchschnittlichen
Bruttosozialprodukts pro Kopf im Jahr 1999 in US-$. Zweckmäßiger ist eine
Umrechnung in Kaufkraftparitäten für wichtige Dienstleistungen, Güter und einigen
Fixkosten. Analysen haben gezeigt, dass die reale Kaufkraft durchschnittlich um das
Zwei- bis Dreifache höher liegt, als es sich bei einer bloßen Umrechnung zu
Wechselkursen ergeben würde (ANDERSEN 1996, S. 8).
5
Der Index of Primacy wird als Quotient aus der Einwohnerzahl der größten und der zweitgrößten
Stadt definiert. In Südamerika lassen sich Spitzenwerte für Paraguay, Chile und Uruguay mit jeweils
ca. 15 errechnen (BÄHR 1995, S. 31). Eine solche Primatstruktur drückt sich neben einer
bevölkerungsmäßigen Dominanz ebenso in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht aus.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
19
Abb. 1: Bruttosozialprodukt pro Kopf in ausgewählten Entwicklungs- und
Schwellenländern
Quelle: http://www.worldbank.org
Zusätzlicher Gesichtspunkt ist die ungleiche Verteilung des Bruttosozialprodukts
innerhalb der meisten Entwicklungs- und Schwellenländer (Einkommenskluft), die in
Relation zu den Industrieländern deutlich extremer ausgeprägt ist und sich sowohl
regional als auch nach Personen ausdrückt. Der Grad der sozialen Ungleichheit kann
etwa durch den Gini-Index statistisch erfasst und bearbeitet werden. Als besonders
krasses Beispiel wirtschaftlicher Konzentration, besonders der Einkommens- und
Landverteilung, kann Brasilien aufgeführt werden.
Ein weiteres Dilemma stellt die hohe Arbeitslosigkeit dar, die ebenfalls aus
verschiedenen Gründen in den offiziellen Statistiken nicht korrekt widergespiegelt
wird. Das Problem der Arbeitslosigkeit entsteht hauptsächlich durch die starke
Abwanderung vom Land in die Städte, ausgelöst durch mannigfaltige »push- und
pull«-Faktoren sowie durch entsprechend hohe Bevölkerungswachstumsraten
(BARATTA 2000, S. 1091). Ein beachtlicher Teil der Menschen ist unterbeschäftigt,
arbeitet als Tagelöhner oder in der sog. ,,Schattenwirtschaft", also im informellen
Sektor. Wie die Abbildung 2 exemplarisch verdeutlicht, ist in vielen Ländern
Lateinamerikas der Beschäftigungsanteil in der informellen Wirtschaft bei über 50 %
(Anteil der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung), (HAUCHLER 1999, S. 251).
2 Entwicklung - Unterentwicklung
20
Abb. 2: Beschäftigte in der informellen Wirtschaft in ausgewählten Ländern
Südamerikas
0
20
40
60
80
100
in %
A
rg
en
tinie
n
Bo
liv
ie
n
Bra
si
lie
n
Ch
ile
K
ol
umbie
n
Ec
ua
dor
Pa
ra
gua
y
Pe
ru
U
ru
gua
y
Ve
ne
zue
la
1990
1996
Quelle: Datenquelle: HAUCHLER 1999, S. 251; Abb.: Eigene Darstellung
Demzufolge ist ein hoher Anteil an versteckter Arbeitslosigkeit zu konstatieren, die
zumeist höher liegt als die offene Arbeitslosigkeit. Folgeerscheinungen sind unter
anderem Unter- und Mangelernährung bis hin zu Hungerkatastrophen,
Gesundheitsschäden oder eine unzureichende Ausbildung. Folglich gelangen
betroffene Bevölkerungsteile in einen sog. »Teufelskreis der Armut«. Das Gros der
Menschen ist im primären Sektor tätig, der noch immer in den meisten
Entwicklungsländern der dominierende Produktionsbereich darstellt (siehe
Abbildung 3).
Wirtschaftsenklaven, Lizenzproduktion und Tochterfirmen multinationaler Konzerne
sind charakteristisch, wobei der Verflechtungsgrad mit der lokalen Industrie
größtenteils nur in geringem Maße ausgebildet ist und Sozialdumping beklagt wird
(z. B. Maquiladora-Industrie
6
). Die »new economy«, hier im Sinne einer
ökonomischen und finanziellen Globalisierung, erfasste auch rasch viele
Entwicklungsländer, und hieraus sich ergebende neue Gefährdungen entziehen sich
überwiegend den nationalstaatlichen Kontrollen. Internationale Portfolioinvestitionen
verfolgen beispielsweise kein unternehmerisches Ziel, sondern sie werden aus
Renditegesichtspunkten getätigt und unterscheiden sich daher wesentlich von
ausländischen Direktinvestitionen. Sie dienen durch Kapitaleinlagen zur Gründung
oder Beteiligung mit unternehmerischer Verantwortung an Unternehmen,
6
Die Maquiladora-Industrie bezeichnet weltmarktorientierte Produktionsstätten (oft von
transnationalen Konzernen = TNK) in den Entwicklungsländern, in denen ausschließlich
arbeitsintensive Teilefertigung durchgeführt wird. Vielfach stellen sie lediglich Zulieferbetriebe der TNK
dar. Hauptanreiz für deren Ansiedlung sind niedrige Lohnkosten, ein Wettbewerbsvorteil, um den die
Entwicklungsländer im Rahmen der Globalisierung stark gegeneinander konkurrieren (NOHLEN
2000, S. 498).
(Anteil nichtlandwirtschaftlicher Bevölkerung)
2 Entwicklung - Unterentwicklung
21
Produktionsstätten oder Niederlassungen. Der sog. »Laissez-Faire-Kapitalismus«,
gekennzeichnet durch eine atemberaubende Zunahme des um die Welt
»floatenden« Finanzkapitals, kann ganze Volkswirtschaften in die Abhängigkeit
international agierender Finanzjongleure bringen. Lag der tägliche Devisenhandel zu
Beginn der siebziger Jahre bei rund 15 Mrd. US-$, so wurden im Jahre 1999 bereits
über 200 Mrd. US-$ gehandelt (BARATTA 2000, S. 1094). Die Entscheidungs- und
Schaltzentralen konzentrieren sich auf einige »Global Cities« wie New York, Tokio,
London oder Frankfurt, alles Städte erster Rangstufe in der Weltstadthierarchie,
sogenannte Alpha Weltstädte. Sie befinden sich alle in Nordamerika, Europa und
Ostasien, die zusammen ein tripolares System, die sog. »Triade« bilden. Auf der
Südhemisphäre erreichen lediglich die Beta Weltstädte (Weltstädte zweiter
Rangstufe in der Weltstadthierarchie) São Paulo und Sydney einen »Global City«-
Rang (GLEBE 2001, S. 38).
Infolge intensiven Kapitalabzugs treibt die neue »Casino-Mentalität« Länder wie
Mexiko, Indonesien, Brasilien und jüngst Argentinien an den Rand bzw. in einen
Staatsbankrot.
Viele weitere ökonomische Mängel wie eine unzureichende Infrastruktur, geringe
Diversifizierung, niedrige Spar- und Investitionstätigkeit, Schuldenkrisen, geringe
Produktivität sowie Innovationsfähigkeit, lassen sich pauschal nennen, ohne näher
auf sie eingehen zu wollen. Die zweifelsohne einseitigen Handelsbeziehungen
zwischen den Entwicklungs- und den Industrieländern im Weltwirtschaftssystem
werden unter Punkt 2.2.5 (Einseitige Handelsbeziehungen) näher erläutert.
2.2.2 Soziokulturelle und demographische Merkmale
Ein Schlüsselproblem in weiten Teilen der Dritten Welt ist immer noch das hohe
Bevölkerungswachstum, auch wenn neuere Zahlen einen Rückgang manifestieren.
Vor allem wird ein beträchtliches Bevölkerungswachstum als Hemmfaktor im
Entwicklungsprozess gewertet. Durchaus bemerkenswerte wirtschaftliche
Wachstumsraten werden daher in vielen unterentwickelten Staaten relativiert. In
Anbetracht der Bevölkerungsproblematik werden verschiedene Bewältigungs-
strategien mehr oder weniger entschlossen angepackt. Wegen fehlender
Legitimation bleibt der Einfluss des Staates durch eine entsprechende
Bevölkerungspolitik begrenzt und ein gesellschaftlicher/sozialer Bewusstseinswandel
(z. B. die Stärkung der Rolle der Frau, Bildung) stellt sich, wenn überhaupt, nur auf
längere Sicht ein. Daneben findet das Wachstum zunehmend aufgrund des
sogenannten »demographischen Momentums« (starke Geburtenjahrgänge werden
zu Elternjahrgängen) statt (SCHULZ 2001, S. 9). Gekoppelt mit einer zunehmenden
2 Entwicklung - Unterentwicklung
22
Bevölkerungszahl drängen sich Fragen auf wie die der Ernährungssicherung, der
Nutzung endlicher Ressourcen oder der Umweltverschmutzung.
Das globale Bevölkerungswachstum, das derzeit zu rund 95 % in EL stattfindet
(SCHULZ 2001, S. 4), wird zudem den Migrationsdruck in Richtung auf die
westlichen Industrieländer verstärken, was neben positiven auch problematische
Konsequenzen hat. Bei den wohlhabenden Ländern ist eine Tendenz der
zunehmenden Abschottung erkennbar und man spricht bereits von einer »Festung
Europa«, wobei allerdings gleichzeitig die Zuwanderung hochqualifizierter Migranten,
also »High Potentials«, erleichtert wird (wie das Beispiel Green Card zeigt), was mit
einem »brain drain« (Wissens- und Kompetenzverlust) in den weniger entwickelten
Ländern verbunden ist.
Bei der Verteilung der Bevölkerung zwischen Stadt und Land ist eine zunehmende
Dichotomie festzustellen. Obwohl die Geburtenrate in den Städten etwas unter der
der ländlichen Regionen liegt, ist der Bevölkerungszuwachs, größtenteils infolge
Land-Stadt-Wanderungen, in den Städten sehr viel größer und führt zu
fortschreitenden Verstädterungs- und Metropolisierungsprozessen, wodurch
zahlreiche neue Probleme generiert werden. Speziell in südamerikanischen Ländern
wie Argentinien, Chile, Uruguay und Venezuela wird bereits ein Verstädterungsgrad
von über 85 % erreicht (BÄHR 1995, S. 24).
Soziokulturelle Merkmale wie eine zu beobachtende engere Bindung an bestimmte
Gruppen (Großfamilie, Stämme, Clans etc.), eine geringere soziale Mobilität, die sich
in traditionellen Werte- und Verhaltensmustern manifestiert, werden als Hindernis im
Entwicklungsprozess genannt, die allerdings meines Erachtens nicht verallgemeinert
werden sollten. Viele Verhaltens- und Bindungsmuster müssen als soziale
Netzwerke betrachtet werden, die als »Überlebensstrategien« fungieren, um im
täglichen Existenzkampf bestehen zu können.
Eine zentrale Rolle kommt den Frauen zu, die in mehrfacher Hinsicht benachteiligt
und diskriminiert werden; in Entwicklungsländern noch weitaus stärker als in
Industrieländern. Wie bereits aufgeführt, wird die geschlechtsbezogene Ungleichheit
seit 1995 im »Bericht über die menschliche Entwicklung« der UN als »Gender-
related Development Index« (GDI) erhoben. Länder mit hohen HDI-Rangziffern
haben nahezu durchweg zugleich hohe GDI-Rangziffern. Als Resümee ist
festzustellen, dass in nahezu allen sozioökonomischen Indikatoren die Situation der
Männer relativ besser als die der Frauen ist. Untersuchungen machen deutlich, dass
wesentlich mehr Frauen als Männer in Armut leben, die Einschulungsrate von
Mädchen drastisch niedriger als die von Jungen ist und folglich Frauen rund zwei
Drittel der Analphabeten stellen (ANDERSEN 1996, S. 14). In aktuellen
2 Entwicklung - Unterentwicklung
23
Entwicklungsstrategien und -programmen wird demzufolge dem weiblichen
Geschlecht besondere Aufmerksamkeit zuteil, da sie ein großes Potential z. B. in
Form von »social capital« für künftige Entwicklungschancen von ganzen Regionen
und Nationen darstellen.
2.2.3 Politische Merkmale
Länder der Dritten Welt weisen sehr vielfältige Staats- und Herrschaftsformen oder
gar Anarchismus auf, häufig handelt es sich um autoritäre Regime und um
»schwache Staaten« die sich in entsprechendem Handeln und den hieraus
entstehenden Strukturen äußern. Diktaturen (überwiegend Militär- oder Ein-Parteien-
Regime), Monarchien sowie Oligarchien sind ebenso vorzufinden, wie
entsprechende Modelle westlicher Industrieländer oder kommunistischer Regime.
Selbst die demokratischen Formen gelten tendenziell zentralistischer als die der
Industrienationen.
Unbestritten war die Diktatur bis zum Ende der Siebzigerjahre die dominierende
Herrschaftsform in der Dritten Welt. In den beiden folgenden Jahrzehnten brachen
jedoch viele autoritäre Regime zusammen und eine Demokratisierungswelle setzte
ein (»Demokratisierung der Dritten Welt«), die die politisch-institutionelle Landkarte
der Welt grundlegend veränderte. Dieser Prozess begann Ende der Siebzigerjahre in
Lateinamerika. Mitte der Neunzigerjahre waren dort 14 von 20 Staaten
uneingeschränkt als Demokratien zu bezeichnen, darunter so wichtige Länder wie
Argentinien, Brasilien und Chile; fünf Staaten befanden sich im Übergang und
lediglich Kuba blieb bzw. bleibt unter der Herrschaft Fidel Castros eine Diktatur
(BROCKHAUS 2002, o. S.).
Für die Demokratisierung lateinamerikanischer Länder lassen sich einige allgemeine
Ursachen nennen. Angesichts der tiefen wirtschaftlichen Krise des »verlorenen
Jahrzehnts der Achtziger« und ihrer sozialen Folgen bleiben die autoritären Regime
weit hinter den Erwartungen zurück, die sie als so genannte
»Entwicklungsdiktaturen« zunächst hatten akzeptabel erscheinen lassen. Defizitäre
Staatshaushalte, wachsende Armut, Menschenrechtsverletzungen oder die
Einschränkung von Menschenrechten schürten die Proteste der Bevölkerung und
verursachten Spannungen unter den regimetragenden Kräften oder beschwuren die
Gefahr von Spaltungen im Militär herauf. Dies begünstigte die Bereitschaft der
Machthaber zu einer politischen Öffnung, die sich überall zur Demokratisierung der
politischen Systeme fortentwickelte. Hinzuzurechnen sind »äußere Ursachen«,
insbesondere in Form von Auflagen der Strukturanpassungsprogramme des
Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
24
Die Logik von Strukturanpassungsprogrammen besteht primär darin, dass Kredite
die auch zu besonders günstigen Konditionen, etwa niedrigen Zinsen, vergeben
werden können nur gewährt werden, wenn die Entwicklungsländer bestimmte
Auflagen erfüllen, die als notwendig für die wirtschaftliche Gesundung erachtet
werden. Dazu gehören in der Regel die Reduzierung der Staatsausgaben, die
Deregulierung der Wirtschaft, die Aufhebung von festen (meist niedrigen)
Nahrungsmittelpreisen, die Neufestsetzung von Wechselkursen für die einheimische
Währung (bedeutet zumeist eine drastische Abwertung) und schließlich eine
generelle Liberalisierung des Außenhandels sowie eine allgemeine Forderung der
»guten Regierungsweise« (»good governance«) nach demokratischen
Gesichtspunkten.
Überdies begannen die einzelnen westlichen Geberländer, die Gewährung von
Entwicklungshilfe an politische Bedingungen zu knüpfen; unter anderem fordern sie
die Einhaltung von Menschenrechten, die Einschränkung der Rüstungsausgaben, die
Beteiligung der Bevölkerung an der politischen Willensbildung und eben eine »gute
Regierungsweise«, worunter sie besonders die Bekämpfung der Korruption
verstehen.
2.2.4 Ökologische Probleme
Der Charakter wichtiger Umweltbelastungen hat in den letzten Jahren einen
Bedeutungswandel erfahren. Wurden früher eher lokale Probleme wahrgenommen,
so stehen heute Internationalität, Komplexität und Langfristigkeit im Vordergrund.
Ökosysteme und Länder sind über globale Stoffkreisläufe miteinander vernetzt, so
dass nahezu jedes Umweltproblem grenzüberschreitende Auswirkungen hat.
Umweltzerstörung stellt ein nahezu ubiquitäres Problem dar und globale Wirkungen,
z. B. ,,global change"-Szenarien wie anthropogener Klimawandel, Degradation und
Desertifikation, Wassermangel und Wasserverschmutzung, Waldzerstörung oder der
Verlust der biologischen Vielfalt bzw. Biodiversität, treten zunehmend hervor.
Einhergehend ist die Übernutzung der natürlichen Ressourcen durch den Menschen,
die sich ohne einschneidende Maßnahmen in den kommenden Jahrzehnten weiter
verschärfen wird und ein erhebliches Konfliktpotential beherbergt, speziell um
knappe strategische Rohstoffe wie Erdöl und Wasser. Besonders in den weniger
entwickelten Staaten kommt es infolge rasanter Wandlungsprozesse und einem
teilweise armutsbedingten Verzicht auf ökologisch ausgerichtete Handlungsweisen
zu einer extremen Verschärfung der Umweltprobleme und -konflikte, wobei in
zahlreichen Regionen besonders empfindliche, störanfällige und nicht-regenerierbare
Ökosysteme betroffen sind. Darüber hinaus verschärft sich die Migrationsproblematik
(»Umweltflüchtlinge«) und belastet die Nord-Süd-Beziehungen. Weiterhin basiert die
2 Entwicklung - Unterentwicklung
25
Ökonomie vieler Entwicklungsländer auf natürlichen Ressourcen und
Agrarprodukten, die wiederum in großem Stil in Industrienationen exportiert werden,
deren Ressourcenverbrauch inzwischen die globalen Ökosysteme überfordert.
Bereits die Konferenz über die menschliche Umwelt in Stockholm (1972) illustrierte,
dass Umweltprobleme grenzüberschreitende Verursacher- und Wirkungsstrukturen
haben und ein effektiver Umweltschutz auf internationale Kooperation angewiesen
ist. In Stockholm wurde ferner das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United
Nations Environment Programme, UNEP) ins Leben gerufen.
In der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in
Rio de Janeiro (1992) sind Umweltprobleme und -zerstörung erneut in den
Mittelpunkt des Interesses gerückt worden. Ein neues Bewusstwerden der
zunehmenden Interdependenz der ,,Einen Welt" sowie die Erkenntnis, dass das
Entwicklungs- und Umweltproblem einen unzertrennlichen Zusammenhang bildet
und demnach nur mit gemeinsamer Verantwortung von Industrie- und
Entwicklungsländern unter der Beteiligung aller Menschen gelöst werden kann,
wurden vermittelt (NUSCHELER 1996, S. 247). Die Rio-Deklaration schreibt unter
anderem vor, dass die Entwicklungs- und Umweltschutzbedürfnisse gegenwärtiger
und zukünftiger Generationen in gleichem Maße berücksichtigt werden müssen. Die
Staatengemeinschaft hatte die »Nachhaltige Entwicklung« zum neuen globalen
Leitbild erklärt, wodurch der Umweltschutzfokus um die Dimensionen soziale
Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung erweitert wurde; daneben ist ein
internationaler Aktionsplan, die Agenda 21
7
verabschiedet worden. Welchen Beitrag
einzelne Kommunen zur Umsetzung der Beschlüsse von Rio leisten können, ist in
der lokalen Agenda 21 festgelegt, denn eine effektive Umsetzung internationaler
Vereinbarungen muss letztendlich immer noch mittels Strategien und Programmen
auf nationaler und lokaler Ebene geleistet werden (vgl. weiter unter Punkt 2.4.7
Leitbild Nachhaltige Entwicklung).
In der ebenfalls von den Vereinten Nationen organisierten Weltklimakonferenz in
Kyôto (1997) ging es um die Stabilisierung oder Reduzierung der Emission von
Treibhausgasen (Kohlendioxid, Methan, Lachgas, ferner Schwefelhexafluorid, SF
6
;
Fluorkohlenwasserstoffe, HCFC; Perfluorkohlenwasserstoffe, PFC) in den
Industrieländern, die zwar ¾ der globalen Energie verbrauchen, aber nur ¼ der
7
Aktionsprogramm zu Umwelt- und Entwicklungsvorhaben der UN, in dessen 40 Kapiteln Regeln für
die nachhaltige Nutzung aller natürlichen Ressourcen festgelegt sind; es wurde auf der UN-Konferenz
für Umwelt- und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 diskutiert und angenommen.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
26
Weltbevölkerung stellen. Im Abschlussprotokoll (Kyôto-Protokoll) verpflichteten sich
die Industrieländer, die Emissionen in der Zeit von 2008 bis 2012 zusammen um
durchschnittlich 5,2 % gegenüber 1990 zu senken (tritt jedoch erst in Kraft, wenn das
Protokoll von 55 Staaten ratifiziert ist); dafür bekommen die einzelnen
Industriestaaten unterschiedliche Vorgaben. Die Entwicklungsländer werden nicht
einbezogen (BROCKHAUS 2002, o. S.).
Unbestritten ist der Energie- und Rohstoffverbrauch (pro Kopf gerechnet) in den
Industriestaaten um ein Vielfaches höher als in der sog. »Dritten Welt«. Es sollte
dagegen bedacht werden, dass der hohe Verbrauch der Industrieländer an fossilen
Energieträgern und anderen natürlichen Ressourcen nicht weltweit übertragbar ist,
wenn auch im Zuge der nachholenden und fortschreitenden Industrialisierung der
Energieverbrauch und damit ebenso z. B. der Ausstoß des klimarelevanten Gases
(»Treibhausgas«) Kohlendioxid (CO
2
) zweifelsohne noch drastisch steigen wird.
Einige Modelle und Untersuchungen weisen Szenarien aus, dass die
Entwicklungsländer in ein bis zwei Jahrzehnten mehr CO
2
emittieren werden als die
Industrieländer. Erwiesen ist die direkte oder indirekte Beteiligung der Industrieländer
an den wachsenden Umweltproblemen der Entwicklungsländer infolge unzähliger
und unüberschaubarer Verflechtungen, die mehrheitlich der Ökonomie zuzuordnen
sind. Es müssen neue Wege und Möglichkeiten gefunden werden, die einerseits
einen effizienteren Umgang mit den Naturgütern erlauben und andererseits die
Chance auf Wachstum und Entwicklung erhalten, denn Fehler im Bereich des
Umweltschutzes, werden den Entwicklungsländern nicht zugestanden. Falls
beispielsweise einzelnen Ländern aus globalen Umweltgründen ökonomische
Nutzungsverzichte zugemutet werden, sollte ein ökonomischer Nutzenausgleich
nicht ausbleiben. Erwägbar wäre etwa die Einrichtung eines globalen Umweltfonds
als Finanzierungsinstrument. Forderungen nach Sanktionen bestehen auch gegen
Unternehmen/Ländern, deren Produkte aufgrund niedriger Umweltschutzstandards
preiswert angeboten werden können und daher Umweltdumping betreiben
(BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG 2000, S. 230).
2.2.5 Einseitige Handelsbeziehungen
Ein florierender Handelsaustausch ist allgemein Ausdruck hoch entwickelter
Arbeitsteilung. Die natürliche Voraussetzung für internationalen Handel ist die
unterschiedliche Faktorausstattung der einzelnen Länder mit Energieträgern,
Rohstoffen, Kapital (monetäres, soziales) und Arbeitskraft. Eine zentrale Rolle
spielen ebenso allgemeine Wettbewerbsfähigkeit, Unterschiede im Lohnniveau,
2 Entwicklung - Unterentwicklung
27
Standards (Umweltschutz-, Qualität-, Sozialstandards etc.), Image (z. B.
Herkunftsgoodwill), Produktivität, Steuerpolitik oder Subventionsverhalten.
Noch immer unbestritten in Einzelfällen auch sinnvoll sind internationale
Handelshemmnisse und einseitige, diskriminierende Handelsbeziehungen weltweit
verbreitet, so z. B. Protektionismus, ein sehr altes Phänomen der Außenwirtschafts-
politik. Zu Zeiten des Merkantilismus
8
herrschte noch der Glaube, Nutzen im
internationalen Handel nur dann zu erlangen, wenn man mehr Ausfuhren als
Einfuhren realisieren kann. Erst später gelangte man zu der Erkenntnis, dass
Freihandel für alle Beteiligten Wohlfahrtssteigerungen bewirken kann.
Ausgangspunkt ist dabei die von den britischen Nationalökonomen Adam SMITH
(1723-1790) und David RICARDO (1792-1823) entwickelte Theorie des
Wirtschaftsliberalismus, der Arbeitsteilung und des Freihandels (vgl. zudem
»Theorem der komparativen Kosten« unter 2.3.1.1) (FRANZMEYER 1999, S. 11-12).
Nach dem 2. Weltkrieg wurden die Weichen für intensive Liberalisierungs- und
Deregulierungsmaßnahmen gestellt. Mit dem »Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommen« (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) wurde 1948
ein internationales Instrument in Kraft gesetzt, in dessen Rahmen die
mengenmäßigen Handelsbeschränkungen (Kontingente) und die tarifären
Handelshemmnisse wie Zölle stark gesenkt beziehungsweise zu wesentlichen Teilen
beseitigt wurden. Dumpingmaßnahmen wie Exportsubventionen sind grundsätzlich
verboten. Die sog. Uruguay-Runde (1986-1993) bewirkte schließlich einen
erheblichen Fortschritt in der Ausweitung der Handelsfreiheit, da die Liberalisierung
erstmals den traditionell geschützten Handel mit Agrarerzeugnissen und mit
Textilien/Bekleidung sowie Teile des Dienstleistungshandels erfasste
(FRANZMEYER 1999, S. 13.). Ferner wurde 1995 das GATT durch eine
eigenständige Behörde der UN-Familie, nämlich die Welthandelsorganisation (World
Trade Organisation, WTO) abgelöst.
Wie bereits erwähnt, gibt es immer noch Staaten, die zu protektionistischen
Maßnahmen greifen, wobei vielgestaltige Argumente dies rechtfertigen soll, etwa
zum Schutz neuer junger und international noch nicht wettbewerbsfähiger Branchen
oder ebenso bei alten Industrien, die sich nicht mehr gegen ausländische Konkurrenz
behaupten können, aber ein struktureller Umbau sozialverträglich und nicht abrupt
erfolgen soll. Doch vielfach werden protektionistische Maßnahmen dauerhaft
8
Merkantilismus bezeichnet die auf Steigerung der staatlichen Macht ausgerichtete Wirtschaftspolitik
der absolutistischen Staaten Europas seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Ziel war die
Sanierung der Staatsfinanzen durch eine aktive Handelsbilanz; zu diesem Zweck empfahlen die
Theoretiker und Praktiker des Merkantilismus eine Reihe von Maßnahmen, die die wirtschaftliche
Kraft eines Landes auf Kosten der anderen Staaten stärken sollten (BROCKHAUS 2002, o. S.).
2 Entwicklung - Unterentwicklung
28
angewendet, um z. B. heimische Arbeitsplätze gegenüber der ausländischen
Konkurrenz zu schützen. Betreffen entsprechende Bestimmungen die wirtschaftlich
schwächeren Entwicklungsländer, sind dort regelmäßig Krisen vorprogrammiert.
Über die Mythologie des »freien Welthandels« und den Protektionismus der
Industrieländer schreibt NUSCHELER: ,,Sie versuchten unter dem Druck von
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Wählern, ihre arbeitsintensiven und
wettbewerbsschwachen Industriebranchen Textilien, Lederwaren, Schuhe,
Stahlprodukte und Gebrauchsartikel aller Art vor der wachsenden Konkurrenz aus
»Billiglohnländern« zu schützen. Dies waren und sind genau die Branchen, in denen
Entwicklungsländer komparative Kostenvorteile erzielten" (zit. n. NUSCHELER 1996,
S. 269).
Forderungen der Entwicklungsländer, wie einen deutlichen Abbau von
Agrarsubventionen der Industrieländer oder verminderte Preisschwankungen bei
Agrarprodukten und Rohstoffen, werden weitgehend nicht erfüllt beziehungsweise
nur vage Zusagen vereinbart.
Da viele Entwicklungsländer vorwiegend Rohstoffpolitik betreiben und nur eine
Minderheit die Abhängigkeit von Rohstoffexporten und Agrarerzeugnissen
vermindern konnte, stellt sich zudem die Frage nach der Entwicklung der Terms of
Trade
9
. Die Theorie der »säkulären Verschlechterung« der Terms of Trade
(PREBISCH-SINGER-Hypothese) besagt, dass sich die realen Austausch-
verhältnisse für die Entwicklungsländer, die wie erwähnt überwiegend Primärgüter
ausführen, entgegen den Annahmen der neoklassischen Außenhandelstheorie
(Komparativer Kostenvorteil) langfristig negativ entwickeln (HAUCHLER 1999,
S. 198). Gegen diese Begründung, zumindest der langfristigen Benachteiligung, gibt
es hingegen zahlreiche Einwände, wie es z. B. Langzeitstatistiken belegen.
Unbestritten ist hingegen eine exorbitante Volatilität bei der Preisentwicklung
(Ernteausfälle versus Überproduktion, konjunkturelle Abkühlung, erhöhte
Recyclingraten, Substitution etc.) im kurzfristigen Bereich (Tage, Monate, bis hin zu
einigen Jahren) und damit eine hohe Verwundbarkeit, die vornehmlich die ärmsten
Staaten unter Umständen in eine »Handelsfalle« schlittern lässt (aus NUSCHELER
1996, S. 275):
9
Maßzahl für die Austauschposition eines Landes im internationalen Handel; in der Regel
ausgedrückt durch das Verhältnis der Ausfuhrpreisindizes zu den Einfuhrpreisindizes. Steigen z. B.
die Ausfuhrpreise bei konstanten oder sinkenden Einfuhrpreisen oder sinken die Einfuhrpreise bei
konstanten Ausfuhrpreisen, so verbessern sich die Terms of Trade, weil für die gleiche Exportmenge
mehr Importe getätigt werden können
Außenhandelsgewinne können realisiert werden (gains from
trade). Die Verschlechterung der Terms of Trade durch den Preisverfall bei vielen Rohstoffen war eine
wesentliche Ursache der Schuldenkrise.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
29
Geringer Entwicklungsstand
hoher Anteil von Primärgütern an den Exporten
Verwundbarkeit durch Nachfrage- und Preisschwankungen
Devisenknappheit
sowie eine geringe Spar- und Investitionsfähigkeit
schwache Wachstumsimpulse
geringe Produktivitätsfortschritte
Konsolidierung der Strukturdefizite von
Unterentwicklung.
Beachtenswert ist, dass gemäß der Welthandelsstatistik die inzwischen 30 OECD-
Staaten (Organization for Economic Cooperation and Development), darunter alle
wichtigen Industriestaaten und häufig als »Club der Reichen« bezeichnet, im
Welthandel mit einem Import- und Exportanteil von über 75 % ein ausgesprochenes
Übergewicht haben.
Der durchschnittliche Anteil aller Entwicklungsländer an den Weltexporten
(Warenwert) erreichte zwar im Jahr 2000 mit 30 % einen Höhepunkt nach 50 Jahren
(WTO 2001, S. 3), doch darf nicht übersehen werden, dass diese Steigerung
überwiegend auf den Exportboom von lediglich einigen Staaten, wie Mexiko, China
oder ostasiatischen Staaten, zustande kam. Zwischen Schwellenländern und den
ärmsten Staaten steht inzwischen eine so starke Diskrepanz, dass
Generalisierungen kaum möglich sind. Eine Marginalstellung belegen die 49 LDC,
die zusammen nur noch mit einem prozentualen Warenwert von ca. 1,8 % am
Welthandel beteiligt sind (WTO 2001, S. 4), wovon wiederum annähernd die Hälfte
auf den Erlös von Erdölexporten von wenigen Ländern zurückzuführen ist. Allein die
vier Erdöl exportierenden Länder Angola, Jemen, Sudan und Äquatorialguinea sind
mit über 40 % am Gesamtanteil der Exporte beteiligt! Würde man alle LDC als ein
Land zusammenfassen, würden sie Platz 34 in der Länderstatistik für Warenexporte
einnehmen, gerade noch vor Ländern wie Polen oder Venezuela.
In den letzten Jahrzehnten schrumpfte der Anteil der Primärgüter am Wert der
gesamten Weltexporte zusehends. Betrug dieser Anteil 1998 unter 20 % hatte er zu
Beginn der19 60er Jahre noch bei über 45 % gelegen (HAUCHLER 1999, S. 205).
Als weitere Tendenz parallel zu den Globalisierungstendenzen ist eine neue
Regionalisierungsdynamik auf supranationaler Ebene zu verzeichnen, wodurch
zweifelsohne ein latentes Spannungsverhältnis zwischen multilateralen und
regionalen Handelsinteressen gegeben ist. Eine Handelsbevorzugung der
teilnehmenden Länder eines Integrationsabkommens bedeutet schließlich zugleich
eine Diskriminierung gegenüber der restlichen Staatenwelt. Statistiken der WTO
belegen, dass der Anteil intraregionaler Exporte bedeutender regionaler
Integrationsabkommen, z. B. im Gemeinsamen Markt des Südens Lateinamerikas
(Mercado Común del Cono Sur, Abk.: MERCOSUR), erheblich zugenommen haben.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
30
2.3 Entwicklungstheorien
Entwicklungstheorien versuchen, Ursachen und Entstehung der Unterentwicklung zu
erklären, die zwar überwiegend in gemeinsamen Symptomen zutage tritt, aber in
verschiedenen Ländern und Regionen anders geartete Ursachen und
Problemstellungen aufweist. Theorien zeichnen sich insbesondere dadurch aus,
dass sie mit einem Maximum an empirisch gestütztem Wissen ein Optimum an
Erklärung darstellen (NUSCHELER 1996, S. 156). Ferner sollten bereits aus einer
Theorie Ansätze für geeignete und umsetzbare entwicklungspolitische Strategien
ableitbar sein. Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen Theorie und
Strategie, die speziell in einer praxisorientierten Wissenschaft nicht uneingeschränkt
getrennt werden können, da aus Theorien öfters direkt Strategien gefolgert werden
und Strategien ebenso einen theoretischen Inhalt haben.
Bei der Erklärung der Ursachen von Unterentwicklung stehen Ansätze, die die
Unterentwicklung durch endogene Faktoren erklären, im Gegensatz zu Ansätzen, die
exogene Faktoren in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung stellen. Weiterhin werden
grundsätzlich nicht ökonomische von ökonomischen Entwicklungstheorien
unterschieden (MIKUS 1994, S. 25).
Zu den ältesten nicht ökonomischen Erklärungsansätzen gehören im engeren Sinne
die Klimatheorien
10
und psychologische Ansätze (i. w. S. Rassentheorien), die eine
geringere Produktivität der Arbeit durch religiöse Verhaltensweisen, fehlende soziale
oder regionale Mobilität und einen geringen Leistungswillen erklären. Insbesondere
die Modernisierungstheorie baut auf diesen geographischen und psychologischen
Ursachen der Unterentwicklung auf.
Ökonomische Theorien sehen die Ursachen der Unterentwicklung primär in den
Außenhandelsbeziehungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern (vgl.
Dependenztheorien) und reichen bis zu merkantilistischen Wirtschaftstheorien des
17. und 18. Jahrhunderts zurück (HEIN 1998, S. 197).
Ein weiterer zentraler Grund für Unterentwicklung wird darin gesehen, dass in den
Entwicklungsländern die Bevölkerung stärker wächst als das Brutto-Inlandsprodukt
(BIP). Daneben werden die so genannten »Teufelskreise der Armut« (vgl. Abbildung
3) oder circulus vitiosus als eine Art Regelmechanismus verstanden, in dem negative
Faktoren praktisch als positive Rückkopplungen (Verstärkungen) wirken, welche
10
Ungünstige klimatische Bedingungen senken die Produktivität der arbeitenden Menschen und die
Ergiebigkeit der landwirtschaftlichen Produktion [z. B. nach WEISCHET, W. (1977): Die ökologische
Benachteiligung der Tropen].
2 Entwicklung - Unterentwicklung
31
wiederum gleichzeitig Ursache und Wirkung für andere Negativfaktoren darstellen.
Gunnar MYRDAL (1956) trägt mit seinem Konzept der »kumulativen Verursachung«
(cumulative causation) zum Verständnis der Problematik sich selbst verstärkender
Gegensätze zwischen Zentrum und Peripherie, aber auch der Wirkung von
Gegentendenzen, bei. Einzelne Faktoren können als Ansatzpunkte für gezielte
Entwicklungsmaßnahmen dienen, die einen Beitrag zur Überwindung solcher
Kreisläufe leisten.
Abb. 3: Teufelskreise der Armut
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung 2000, S. 271
Obwohl gegen Ende der Sechzigerjahre, mit wenigen Ausnahmen, die
Entkolonialisierung europäischer Mächte abgeschlossen war, zeigte sich doch bald,
dass die neu erlangte nationale Unabhängigkeit sich kaum in einem vermehrten
allgemeinen Wohlstand der Völker niederschlug. Die jungen Staaten wurden nämlich
allgemein mit einer Reihe tief greifender wirtschaftlicher, sozialer und politischer
Probleme konfrontiert: mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen, krasser Einkommenskluft
zwischen Arm und Reich, einer agrarisch geprägten Volkswirtschaft, geringer
Lebenserwartung der Bevölkerung, Mängel im Bildungs- und Gesundheitswesen
sowie von Infrastrukturen, unzureichender Versorgung und oftmals konfliktträchtigen
Gegensätzen zwischen ethnischen Gruppen.
Die »Unterentwicklung« hatte zweifelsohne mit dem kolonialen Erbe zu tun und
bestand vor allem in einseitigen Ausrichtungen der jeweiligen Volkswirtschaften (vgl.
weiter unter Dependenztheorien). Auch auf dem Feld der Politik gab es eine Vielzahl
von Problemen. Beispielsweise waren durch willkürliche Grenzziehungen oftmals
traditionell verfeindete Völkerschaften künstlich zusammengefasst. Überdies hatten
2 Entwicklung - Unterentwicklung
32
die Kolonialherren häufig ethnische Feindseligkeiten angeheizt oder erst geschaffen,
indem sie z. B. bei den Verwaltungsarbeiten bewusst einzelne Ethnien bevorzugten.
So tauchte in Reden der Sprecher der Entwicklungsländer der an die Adresse der
Industriestaaten gerichtete Vorwurf des Neokolonialismus auf, der zumeist mit dem
Schlagwort des Neoimperialismus verbunden wurde und die neuen Eliten entlasten
sollte.
2.3.1 Klassische »Große Theorien«
Unter den sog. »großen Theorien« lassen sich diejenigen subsumieren, die den
Anspruch auf universelle Geltung haben, als auch eine umfassende Erklärung aller
Phänomene und Veränderungsprozesse innerhalb der betroffenen Gesellschaften in
einem internationalen Vergleich aufzeigen. Dabei handelt es sich im wesentlichen
um die Paradigmen der Modernisierungstheoretiker in den 1950er und 1960er
Jahren und der Dependenztheoretiker in den 1960er und 1970 er Jahren.
In den 1980er Jahren kam es zu einer verstärkten Kritik an den »großen oder
Großraum« -Theorien und es wurden diverse Debatten und Diskussionen über das
»Scheitern der großen Theorie« (z. B. MENZEL 1992) geführt, die allgemein zu einer
Ablehnung der älteren Entwicklungstheorien führte (MÜRLE 1997, S. 9). In
Deutschland wurde bereits 1976 als Folge der augenscheinlichen Theoriedefizite der
»Geographische Arbeitskreis Entwicklungstheorien« gegründet. Es wurde
zunehmend erkannt, dass es keine globale, verallgemeinerungsfähige Theorie geben
kann. Auf den Punkt bringt es sicherlich folgendes Zitat: ,,Wir haben keinen
allumfassenden und alles erklärenden Begriff von Unterentwicklung und werden ihn
auch niemals finden" (zit. n. SCHMIDT-WULFFEN 1987, S. 133).
Trotz all der zahlreichen Unzulänglichkeiten dieser oberflächenhaften und
deskriptiven Darstellung der Wirklichkeit, stellen solche Theorien immer noch
wichtige Grundsatzfragen und können zumindest ansatzweise Anregungen über die
Gründe von Entwicklung und Unterentwicklung generieren bzw. vermitteln. Nach
NUSCHELER (1998, S. 284) erfordern gerade die verschiedenen Prozesse der
Globalisierung einen neuen Anlauf globaler Theorien, wobei Schwerpunkte gesetzt
sind vor allem in die Bedingungen nachhaltiger Entwicklung, in eine angepasste
Gewichtung der Wirtschaft/Marktkräfte im Verhältnis zu sozialen und ökologischen
Fragen und in ein neues »Governance Modell«, in welchem Staat, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft in vernetzten Strukturen zusammenarbeiten.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
33
2.3.1.1 Modernisierungstheorien
Unter dem »Etikett« der Modernisierungstheorien ist Unterentwicklung ein
vorindustrielles, vormodernes Phänomen. Danach befinden sich die EL in einem
Durchgangsstadium von der »Tradition« zur »Moderne«, in einem evolutionären
Prozess, den die heutigen Industriestaaten bereits vor ihnen durchlaufen haben. Als
konstitutive Hemmfaktoren für eine erfolgreiche »nachholende Entwicklung« gelten
vor allem solche Erscheinungen, die ihren Grund innerhalb dieser Gesellschaften
selbst haben (also endogene Faktoren). Als interne Ursachen können unter anderem
aufgeführt werden:
Erstens der Mangel an Rationalität, sozialer Mobilität und kultureller Dynamik; das
Verharren im Stammesdenken (tribalistische Gesellschaftsstrukturen) und in
Religionen; zweitens die geringe institutionell vollzogene Regelung sozialer und
politischer Konflikte; drittens das Überwiegen politischer Systeme, die durch
mangelnde politische Legitimität und Stabilität gekennzeichnet sind; und, viertens,
die geringe Autorität und Leistungsfähigkeit des Staates, der oftmals elitär, korrupt
(gefördert durch Klientelismus) und schwach ist.
Modernisierungstheorien beurteilen alle externen, also die außerhalb der Länder
selbst liegenden Faktoren der Einwirkung, insbesondere des kapitalistischen
Weltmarkts, als förderlich für die Entwicklung. Man begründet dies unter anderem mit
dem Theorem der komparativen Kostenvorteile
11
(Kern der Erklärung der
internationalen Arbeitsteilung), das schon der englische Nationalökonom David
RICARDO (1772-1823) im 19. Jahrhundert aufgestellt hatte und in seinen
Grundzügen bis heute Gültigkeit behält.
Inspiriert wurden die Modernisierungstheorien zusätzlich durch die Überlegungen
des britischen Ökonomen KEYNES, der ein aktives nachfrageorientiertes Eingreifen
des Staates in die Wirtschaft (z. B. durch Steuer- , Ausgabe- und Geldpolitik)
propagierte, um Friktionen zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen.
11
Dieses Theorem besagt vereinfacht, dass die Arbeitsteilung mehrerer Länder dann von Vorteil ist,
wenn es Unterschiede bei den Herstellungskosten für bestimmte Produkte gibt. Spezialisiert sich nun
jedes Land auf die Produktion derjenigen Güter, für die es die relativ günstigsten
Herstellungsbedingungen besitzt, so werden letztlich alle Handelsteilnehmer davon profitieren.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
34
2.3.1.2 Dependenztheorien
Die Dependenztheorien haben ihren Ursprung in Lateinamerika, wo ab Mitte der
1960er Jahre Studien und Theorien erschienen sind, die den Begriff dependencia
(Abhängigkeit) in den Mittelpunkt rückten. In einer Vielzahl an Arbeiten werden
neben ökonomischen zudem politische, soziologische und historische Determinanten
berücksichtigt. Sie entstanden als Kritik auf das vorherrschende Entwicklungs-
verständnis sowie der angewandten Entwicklungsstrategien, die vor allem den US-
amerikanischen Modernisierungstheorien zugrunde lagen.
Zu dem Theorietypus dependencia werden die lateinamerikanischen
Dependenztheorien im eigentlichen Sinn, Neoimperialismustheorien und
Weltsystemtheorien (z. B. WALLERSTEINS Welt-System-Ansatz) gerechnet
(MENZEL 1992, S. 6).
Gemeinsames Kennzeichen der Dependenztheorien ist die Annahme eines
historischen Vorganges der Ausbreitung des Kapitalismus, der zur Unterentwicklung
führte beziehungsweise ein stetiges Hemmnis für eine erfolgreiche nachholende
Entwicklung darstellt. Die Theoretiker konzentrierten sich auf externe
Abhängigkeiten, deren Ursprung in der Kolonialzeit lag, und griffen den Gedanken
der Verschlechterung der terms of trade beziehungsweise den des »ungleichen
Tausches« auf, wonach den Industriestaaten eine größere Wertschöpfung beim
Handel beschert wurde und demgemäss Außenhandelsgewinne (gains from trade)
erzielt werden konnten. Entwicklungshemmnisse waren demnach nicht mit einer
mangelnden Integration in den Weltmarkt verknüpft, sondern waren im Gegenteil die
Konsequenz der Abhängigkeit von diesem. Den Entwicklungsländern kam dabei nur
der Status abhängiger und ausgebeuteter Peripherien zu, deren Unterentwicklung
keine Übergangsphase darstellte, sondern eine dauerhafte Struktur.
Die dahinter stehende Idee ist einfach und vermeintlich einleuchtend: Zwar haben die
ehemaligen Kolonien die formale Unabhängigkeit erlangt; die Haltung der
ehemaligen Kolonialmächte und der Länder des Westens, insbesondere der USA,
haben sich jedoch in keiner Weise geändert. Angesichts der Durchdringung der
Entwicklungsländer mit ausländischem Kapital, der von den multinationalen
Konzernen (Multis, TNK) ständig betriebene Ressourcentransfer aus den
Entwicklungsländern in die Industriestaaten, die politisch-militärische Überlegenheit
des Nordens gegenüber dem Süden und der Kollaborationsbereitschaft
einheimischer Eliten mit den Europäern steht nach Ansicht der Dependenztheoretiker
die Eigenständigkeit lediglich auf dem Papier. Zusammengefasst: Der Kolonialismus
existiert fort und hat nur eine andere Gestalt angenommen (neokoloniale
Beziehungen, strukturelle Abhängigkeit, »Brain drain« usw.).
2 Entwicklung - Unterentwicklung
35
Im »Konsens von Viña del Mar« (Chile) vom 17. Mai 1969 klagte der Süden
Amerikas den Norden an: ,,Dessen multinationale Konzerne zögen ihr in den
Entwicklungsländern erwirtschaftetes Kapital ab, was ein Vielfaches ihrer
Investitionen ausmache. So entstünde ein dramatischer Ressourcentransfer von
Latein- nach Nordamerika. Um den weiteren Zugriff auf wertvolle Rohstoffe zu
sichern, schrecke der Westen vor der Unterstützung willkommener
Sezessionsbestrebungen nicht zurück..." (zit. n. NOHLEN 2002, o. S.).
Zu den führenden Protagonisten der dependencia gehörte der Argentinier Raúl
PREBISCH (erster Generaldirektor der CEPAL
12
) und der deutsche Emigrant Hans
SINGER, deren Überlegungen und Analysen insbesondere gegen die klassische
Wohlfahrtssteigerung durch »Handel für alle Handelspartner«, also gegen die
klassische liberale Außenhandelstheorie, gerichtet waren. In einem »Zentrum-
Peripherie-Modell« ordnete PREBISCH die am Welthandel beteiligten Länder einem
industriellen Zentrum und einer unterentwickelten Peripherie zu (NOHLEN 2002,
o. S.). Der Handel bewirkte hierbei nicht die im Theorem von den komparativen
Kostenvorteilen unterstellte Angleichung der Einkommensunterschiede, sondern die
Verschlechterung der terms of trade bewirkte eine ungleiche Entwicklung: Für den
Import einer konstanten Menge von Konsum- und Industriegütern, wie etwa Autos
oder Maschinen, mussten die unterentwickelten Länder eine immer größer werdende
Menge von Primärgütern oder Rohstoffen, wie z. B. Kaffee, Zuckerrohr, Rindfleisch
oder Produkte aus geologischen Lagerstätten, exportieren.
Stellvertretend für die Boomphase der dependencia empfahl die CEPAL zur
Überwindung der Unterentwicklung eine Strategie der Industrialisierung, die durch
einen stärkeren Protektionismus bestimmt sein sollte. Primäre Ziele waren, die
Einfuhr von Industriegütern durch einheimische Produktion zu ersetzen, die
Ausfuhren zu steigern, die Produktpalette zu erweitern (Importsubstituierende
Industrialisierung ), eine zumindest partielle Dissoziation vom Weltmarkt sowie eine
Entwicklung nach innen (»desarrollismo«) durch weitere Maßnahmen zu fördern
(autozentrierte Entwicklung).
Im deutschen Sprachraum war der Bremer Politologe Dieter SENGHAAS wohl der
einflussreichste Verfechter des Dependenz-Paradigmas. Er propagierte unter
anderem die Abkopplung (Dissoziation) der Entwicklungsländer vom Weltmarkt, um
zunächst durch einen verstärkten Handelsaustausch unter EL (Süd-Süd-Handel) die
12
Kommission für wirtschaftliche Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik; eine1948 gegründete
Unterorganisation der UNO, engl. ECLAC (Economic Commission for Latin America and the
Caribbean).
2 Entwicklung - Unterentwicklung
36
kolonialhistorisch gewachsenen Nord-Süd-Handelsbeziehungen zu durchbrechen,
um selbständig und unabhängig Fortschritte in der Entwicklung erzielen zu können.
In seinem Modell des »peripheren Kapitalismus«
13
bezog er die ursprünglich auf
Lateinamerika beschränkte Dependenztheorie auch auf Asien und Afrika, womit das
Paradigma überstrapaziert war (NOHLEN 1996, S. 168).
2.3.2 Neuere Theorien
Mit drei neueren makrobezogenen Theorien mittlerer Reichweite möchte ich die
zentralen Aspekte der entwicklungsbezogenen Diskussionen und Theoriefindungen,
die sich überwiegend mit gesamtgesellschaftlichen Veränderungen der 1980er und
1990er Jahre befassen, vorstellen. Ihnen ist gemeinsam, dass es sich hierbei um
eine nachholende Entwicklung »von oben« handelt, die sich primär mit den Themen
Staat und Markt sowie Exportorientierung auseinandersetzt. Makrobezogene
Theorien erlauben, unter gewissen Voraussetzungen Ländervergleiche
vorzunehmen, und liefern Erklärungsmuster für Entwicklung und Unterentwicklung, in
denen sowohl externe als auch interne Faktoren und die historische Dimension
Berücksichtigung finden.
2.3.2.1 Neoliberale »counter-revolution«
Obwohl die Politik der importsubstituierenden Industrialisierung durchaus
Wachstumserfolge erzielte, geriet sie zunehmend in die Kritik. Einerseits wurde die
Neigung zum Staatsinterventionismus verurteilt und andererseits erwies sich die
einseitige Bewertung des kapitalistischen Weltwirtschaftssystems als stetiges
Entwicklungshemmnis als falsch. Speziell die sog. »vier kleinen Tigerstaaten« (Süd-
Korea, Taiwan, Hongkong, Singapur) in Ostasien hatten ihre raschen
Entwicklungserfolge (bis Mitte der 1990er Jahre) nämlich durch eine exportorientierte
Weltmarktanbindung (Export-Led-Growth) erreicht.
Von neoliberalen Protagonisten wird dieser Erfolg als einer auf dem freien Spiel der
Marktkräfte in Form von komparativen Kostenvorteilen und freiem Unternehmertum
beruhenden Entwicklungsstrategie angeführt, obwohl ein empirisch nachweisbarer
Staatsinterventionismus etwa in Form von Schutzzöllen und gezielter Lenkung des
Marktes getätigt wird (= aktive Integration).
13
Im Modell des ,,peripheren Kapitalismus" wird im Wesentlichen von der Annahme ausgegangen,
dass die Peripherie durch die Einbindung in den kapitalistischen Weltmarkt unterentwickelt und zu
eigenständiger Entwicklung unfähig geworden sei.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
37
Die neoliberale Wirtschaftslehre setzt auf makroökonomische Stabilität,
Wirtschaftswachstum, Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung von Handel
und Finanzen, Preisregulierung über den Markt und somit auf einen weitgehenden
Rückzug des Staates aus der Wirtschaft. Die Grundsätze dieser neoliberalen
Ordnung sind unter dem Namen »Konsens von Washington« bekannt.
Die Basis dieser vergleichsweise offenen Wirtschaft stellen wettbewerbsfähige
Exportprodukte dar, die in den Weltmarkt integriert sind. Die neoliberale »counter-
revolution« entstand als Reaktion auf den in den Industrieländern praktizierten
Interventionismus keynesianischer Prägung in der Wirtschaftskrise von 1973/75. Die
Wirtschaftskrise ließ zudem das Bretton-Woods-Währungssystem
14
zusammenbrechen. Geprägt wurde die neoliberale Ausrichtung insbesondere durch
Milton FRIEDMAN (Chicagoer-Schule) und den Monetarismus, einer
angebotsorientierten wirtschaftstheoretischen und wirtschaftspolitischen Konzeption,
die eine Geldpolitik als Stabilisierungspolitik ablehnt und stattdessen auf die
Selbstheilungskräfte des Marktes, bei funktionsfähigem und freien Wettbewerb, setzt.
Der außergewöhnliche Erfolg der »Tigerstaaten« ist indessen auf ein ganzes Bündel
von Faktoren, wie z. B. Armut an natürlichen Ressourcen, kleine Binnenmärkte,
Landreform und Agrarmodernisierung, hohes Grundbildungsniveau der
Gesamtbevölkerung und technische Ausrichtung der höheren Ausbildung, gute
Infrastruktur, Kultur, geopolitische Lage oder weltwirtschaftlicher Zeitpunkt der
Industrialisierung, gestützt folglich kann das Modell so nicht auf
lateinamerikanische Länder übertragen werden (MÜRLE 1997, S. 25).
In Südamerika hatte Chile im Zuge der Militärherrschaft (1973-1990) unter General
PINOCHET den neoliberalen wirtschaftspolitischen Kurswechsel eingeleitet und
nahm eine Vorreiterrolle ein, dessen Grundzüge bis heute Bestand haben und als
»Modellfall« in der Literatur Erwähnung findet (NOLTE 1998, S. 636).
Etwa zu Beginn der 1980er Jahre etablierte sich der Neoliberalismus als
dominierendes Paradigma, sowohl in weiten Teilen der Entwicklungstheorie, als auch
in der entwicklungspolitischen Praxis (MÜRLE 1997, S. 20). Die Verschuldungskrise
14
Auf der internationalen Währungs- und Finanzkonferenz der UNO, die 1944 in Bretton Woods (New
Hampshire, USA) stattfand, wurden neben der Errichtung des IWF und der Weltbank auch feste
Wechselkurse zwischen den Teilnehmerstaaten beschlossen. Das Wechselkursabkommen legte fest,
dass jedes IWF-Mitglied seine Währung fest an Gold oder an den US-Dollar binden musste. Als Folge
wurde das weltweite Preisniveau für handelbare Güter v. a. durch die Geldpolitik der Notenbank der
USA bestimmt. Das Ende des Wechselkurssystems begann 1971, als Präsident Nixon wegen hoher
und steigender Leistungsbilanzdefizite der USA den US-Dollar um 10-20 % gegenüber den
wichtigsten Handelspartnern abwertete. Anfang 1973 brach das Bretton-Woods-System endgültig
auseinander und die Wechselkurse zum Dollar wurden flexibel.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
38
koppelte die meisten Länder Lateinamerikas an die neuen hegemonischen
Entwicklungsstrategien der internationalen Finanzinstitutionen [vor allem des
Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank]. Es wurden wirtschaftliche
Strukturanpassungsprogramme (SAP) implementiert, die den Anfang der
neoliberalen Ausrichtung darstellten, da die dringend notwendigen Kredite mit
entsprechenden makroökonomischen und politischen Auflagen gekoppelt wurden,
mit dem Ziel Demokratisierungsprozesse zu fördern (NOHLEN 2000, S. 548). Auf
die Risiken und negativen Folgen im Zusammenhang mit dem Neoliberalismus, wie
beispielsweise Konzentrationstendenzen (ökonomische Ungleichheit), soziale
Probleme und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, werde ich an dieser Stelle
nicht weiter eingehen. CHOMSKY (2000) betont in diesem Zusammenhang, dass in
der Realität die Märkte seltener vom freien Wettbewerb, sondern von Großkonzernen
beherrscht und kontrolliert werden.
2.3.2.2 Regulationstheorie
In Frankreich entstanden in den 1970er Jahren erste theoretische Ansätze, so von
BOYER (1970), die Produktions- und Konsumstrukturen in Verbindung mit
staatlichem und gesellschaftlichem Handeln brachten. In der Regulationstheorie wird
die langfristige wirtschaftliche Entwicklung nicht wie bei den
Wirtschaftsstufentheorien vergangenheitsbezogen-deskriptiv oder als eine zyklische,
technologisch-deterministische Abfolge von Langen Wellen gesehen (wie z. B. von
SCHUMPETER 1911), sondern als eine ,,nicht-deterministische Abfolge von stabilen
Entwicklungsphasen (Formationen) und Entwicklungskrisen (Formationskrisen oder
Krisen der Akkumulation)" (zit. n. BATHELT 1994, S. 64).
In ein Konzept von ökonomischen Wachstums- und Krisenperioden wird der
wirtschaftliche-, technologische-, politische- und gesellschaftliche Handlungsrahmen
mit all seinen Wechselwirkungen miteinbezogen. Im Zusammenhang etwa mit dem
Fordismus geht es darum zu verstehen, welche sozialen und politischen
Zusammenhänge es erlauben, eine rasche Expansion der Massenproduktion und die
entsprechende Nachfrageentwicklung in Übereinstimmung zu bringen.
Die Theorie gliedert die wirtschaftlich-gesellschaftliche Struktur einer Volkswirtschaft
in zwei Teilkomplexe, die sich wechselseitig beeinflussen (siehe auch Abbildung 4):
Wachstumsstruktur (Akkumulationsregime): Im Akkumulationsregime steht der
Produktionsstruktur ein Konsummuster mit einer differenzierten Nachfragestruktur
gegenüber. Produktion und Konsum stehen sowohl über marktbedingte als auch
über nicht-marktbedingte Austauschprozesse miteinander in Verbindung.
2 Entwicklung - Unterentwicklung
39
Koordinationsmechanismus (Regulationsweise): Er definiert den sozio-
institutionellen Handlungsrahmen (mit entsprechenden Normen, Gesetzen,
gesellschaftlicher Steuerung usw.) bzw. die Regulation, innerhalb dessen die
Austauschprozesse zwischen Konsum und Produktion ablaufen.
Abb. 4: Regulationstheoretische Grundstruktur der wirtschaftlich-
gesellschaftlichen Beziehungen in einer Volkswirtschaft
Auswirkungen auf die Wachstumsstruktur
Quelle: Bathelt 1994, S. 66; verändert W. Reik
Zwischen den Teilkomplexen kann es infolge von internen oder externen
Veränderungen zu Diskrepanzen bzw. zur Inkompatibilität kommen, die den
Fortbestand des stabilen Systems gefährdet eine Formationskrise liegt vor, und der
Koordinationsmechanismus ist z. B. nicht mehr in der Lage, Austauschprozesse
zwischen Produzent und Konsument zu stabilisieren. Um Krisen überwinden zu
Wachstumsstruktur
(Akkumulationsregime)
Koordinationsmechanismus
(Regulationsweise
)
Wechselwirkungen
von
gesellschaftlicher
Regulation
und
wirtschaftlicher
Akkumulation
Arten der Koordination
-
Normen/Gesetze/Regeln
-
Gesellsch. Bedürfnisse
-
Politiken
-
Machtverhältnisse
-
Kulturelle Gewohnheiten
-
etc.
Aushandlung,
Festlegung,
Durchsetzung und
Überwachung des
Wirtschaftlich-
Gesellschaftlichen
Handlungsrahmen
Institutionen der
Koordination
-
supranational, national
-
regional/lokal
-
Arbeitgeber, Verbände
-
Gewerkschaften
-
Parteien, Kirchen,
Kooperationen ...
-
etc.
Produktionsstruktur
-
Industrielles Paradigma
(Produkte/Prozesse)
-
Arbeitsorganisation
-
Arbeitsteilung
-
Produktionskonzepte
-
Industrie-/Prod.struktur
-
etc.
Marktbedingte und nicht-
Marktbedingte
Austauschprozesse
Konsummuster
-
Präferenzsystem
-
Einkommensverteilung
-
Haushalts-/Familien-
struktur
-
Kulturelle Tradition
-
Nachfragestruktur
-
etc.
Anforderungen an den Koordinationsmechanismus
Entwicklungszusammenhang zwischen
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Struktur
2 Entwicklung - Unterentwicklung
40
können, ist eine grundlegende Umstrukturierung des Koordinationsmechanismus
und/oder der Wachstumsstruktur notwendig.
HIRSCH (1990) ergänzte, dass nicht nur eine einzige Wachstumsstruktur und ein
einziger Koordinationsmechanismus existiert, sondern unterschiedliche Wachstums-
und Koordinationsformen nebeneinander (dabei ist einer dominant) vorkommen
(BATHELT 1994, S. 71). So sind z. B. fast immer vorfordistische Handwerks-
strukturen neben fordistischen und postfordistischen Produktionsstrukturen in einem
Koordinationsmechanismus (z. B. innerhalb eines Nationalstaates) gegenwärtig.
Obwohl die Regulationstheorie nicht als Raumtheorie konzipiert wurde, kann sie für
wirtschaftsgeographische Forschung verwendet werden und räumliche
Strukturmuster in theoretisch allen Volkswirtschaften begreiflich machen.
2.3.2.3 Neue Institutionen Ökonomie
Die zunächst in den USA hervorgetretenen sog. New Institutional Economics
betonen die Bedeutung von Institutionen für die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung. Unter dem Terminus »capacity building« ist gegenwärtig eine weltweite
Diskussion über Ziele und Formen der Entwicklungszusammenarbeit im Gange.
Geberorganisationen überdenken ihre entwicklungspolitischen Instrumentarien, um
den veränderten Gegebenheiten besser gerecht zu werden.
»Institutionen« umfassen einerseits Organisationen, das heißt formal strukturierte,
soziale Gebilde mit bestimmten Rollen oder Zuständigkeiten wie Behörden,
privatwirtschaftliche Dachverbände oder NRO, andererseits Werte und Normen.
Jeder Einzelne gestaltet mit seinen individuellen Verhaltensweisen und Ansprüchen
an die Institutionen deren Form und Inhalt, die wiederum auf menschliche
Lebensmuster und Handlungsoptionen zurückwirken.
Unter institutionellen Strukturen verstehen sich Verbindungen, die zum einen das
komplexe Zusammenspiel zwischen den drei »Systemvariablen« Mensch,
Organisation und Norm erst ermöglichen und zum anderen offen legen, in welcher
Beziehung sie zueinander stehen und wie sie interagieren (GTZ 1994, S. 7).
2 Entwicklung - Unterentwicklung
41
2.3.3 Zusammenfassende Bewertung
Die Entwicklungstheorie hat neben der ursächlichen Erklärung bestimmter
Phänomene weiterhin die Verpflichtung, der praktischen Politik zuzuarbeiten, denn
sie benötigt sie für die Erarbeitung von Konzepten. Darüber hinaus ist die
Globalisierung eine neue große Herausforderung für Entwicklungstheorien.
Die Theorien müssen sich am neuen integrativen Konzept von Entwicklung
orientieren, der sich nach NUSCHELER (1998) in vier Dimensionen vollzieht:
·
Nachhaltige Entwicklung und das ,,Bewusstwerden der gemeinsamen
Überlebensinteressen"
·
Die ,,normative Synthese von Entwicklung, good governance, Demokratie und
Menschenrechten"
·
Die ,,fast weltweite Bekehrung zu marktwirtschaftlichen Prinzipien"
·
Die neue Rolle der Zivilgesellschaft
Monokausale Theorien haben ebenso ausgedient wie solche, die vorgeben,
universal erfolgreich anwendbar zu sein.
2.4 Entwicklungsstrategien
Unter einer Strategie wird allgemein der ,,Entwurf und die Durchführung eines
Gesamtkonzepts" verstanden (zit. n. BROCKHAUS 2002, o. S.).
Entwicklungsstrategien sind Konzepte, also genaue Pläne oder Programme, nach
denen Maßnahmen organisiert werden, die zur Umsetzung der
entwicklungspolitischen Ziele führen sollen und sind im Gegensatz zu den
Entwicklungstheorien praxisorientiert und handlungsbezogen. Dabei werden sie des
öfteren aus Entwicklungstheorien abgeleitet (vgl. voriges Kapitel) beziehungsweise
bauen direkt auf die empirisch haltbar erscheinenden Erkenntnisse über die
Ursachen von Unterentwicklung und über entwicklungsrelevante Faktoren auf.
Da in Entwicklungsprojekten entsprechende Konzepte direkt umgesetzt und
angewandt werden, aber zumindest als Leitlinien und Prinzipien für die finanzielle
und technische Zusammenarbeit fungieren, sind sie im Rahmen meiner Diplomarbeit
von großer Bedeutung. Beispielhaft arbeitet das Internationale Kolpingwerk nach
dem Selbstverständnis »Hilfe zur Selbsthilfe«, eine Strategie, die die Eigeninitiative
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832468446
- ISBN (Paperback)
- 9783838668444
- Dateigröße
- 2.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg – Chemie und Geowissenschaften
- Note
- 1,1
- Schlagworte
- lateinamerika entwicklungstheorien entwicklungsstrategien entwicklungsänder chile
- Produktsicherheit
- Diplom.de