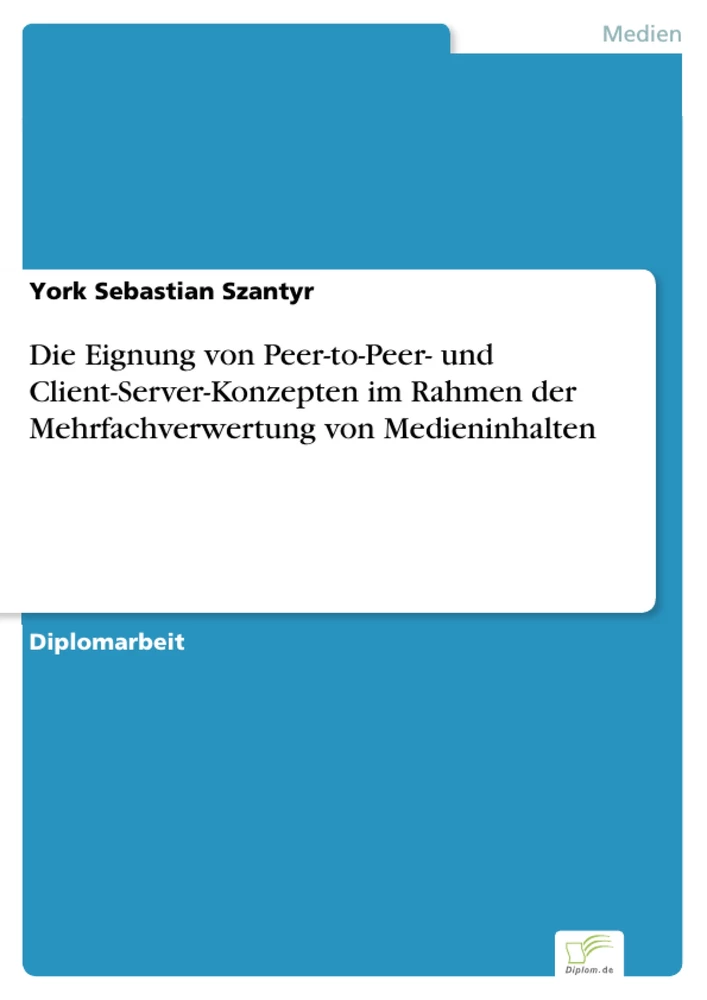Die Eignung von Peer-to-Peer- und Client-Server-Konzepten im Rahmen der Mehrfachverwertung von Medieninhalten
©2002
Diplomarbeit
99 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ausgehend von den Eigenschaften des Client-Server- und Peer-to-Peer-Konzepts und den Anforderungen der Mehrfachverwertung von Medieninhalten Hypothesen auf Basis der Transaktionskosten-Theorie zu gewinnen, die Anhaltspunkte für die Eignung der Konzepte in konkreten Einsatzsituationen bieten. Dabei werden sowohl die technischen als auch die aktuellen betriebswirtschaftlichen Aspekte detailliert mit einbezogen.
Zunächst werden in Teil 2 die notwendigen Grundlagen vorgestellt: die Eigenschaften digitaler Medieninhalte, die Mehrfachverwertung dieser Inhalte und die Netz-Konzepte Peer-to-Peer und Client-Server. Daraus werden in Teil 3 die Möglichkeiten für einen P2P-Einsatz bei der Mehrfachverwertung abgeleitet, sowie Kriterien zur genaueren Erfassung der Unterschiede zu Client-Server vorgestellt. Im vierten Teil werden diese Kriterien anhand dreier auf die Einsatzmöglichkeiten von P2P abgestellter Szenarien mit einer bzgl. der Medienwertschöpfungskette unterschiedlichen Reichweite ausgewertet. Diesem Teil fällt besondere Bedeutung zu, da die späteren Empfehlungen hierauf basieren und bisher keine zusammenhängende Untersuchung der Unterschiede von C/S zu P2P unter dem Gesichtspunkt der Mehrfachverwertung existiert. Teil 5 nutzt diese Ergebnisse in Verbindung mit den Akteurseigenschaften und den Anforderungen der verschiedenen Inhaltearten an ein Träger- bzw. Verbreitungsmedium, um unter Verwendung der Transaktionskosten-Theorie Hypothesen für die Eignung von Peer-to-Peer bei der Mehrfachverwertung von Medieninhalten zu erlauben.
Eine Stellungnahme der Praxis ermöglicht eine erste Abschätzung von deren Tragfähigkeit. Die gewonnenen Erkenntnisse und künftige, noch weiter anzustellende vertiefende Untersuchungen werden im Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
1.1Problemstellung1
1.2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit1
2.Grundlagen3
2.1Digitale Medieninhalte3
2.2Mehrfachverwertung von Medieninhalten4
2.2.1Beteiligte und Märkte5
2.2.2Darstellung der Mehrfachverwertung ausgehend von der Wertschöpfungskette der Medienbranche8
2.3Peer-to-Peer- und Client-Server-Konzept10
2.3.1Client-Server-Konzept11
2.3.2Peer-to-Peer-Konzept14
2.3.3Hybrides Peer-to-Peer19
3.Einsatzmöglichkeiten und Bewertungskriterien des P2P-Konzeptes bei der Mehrfachverwertung20
3.1Betrachtung der C/S-geprägten Mehrfachverwertung als Ausgangspunkt20
3.2Determinanten […]
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ausgehend von den Eigenschaften des Client-Server- und Peer-to-Peer-Konzepts und den Anforderungen der Mehrfachverwertung von Medieninhalten Hypothesen auf Basis der Transaktionskosten-Theorie zu gewinnen, die Anhaltspunkte für die Eignung der Konzepte in konkreten Einsatzsituationen bieten. Dabei werden sowohl die technischen als auch die aktuellen betriebswirtschaftlichen Aspekte detailliert mit einbezogen.
Zunächst werden in Teil 2 die notwendigen Grundlagen vorgestellt: die Eigenschaften digitaler Medieninhalte, die Mehrfachverwertung dieser Inhalte und die Netz-Konzepte Peer-to-Peer und Client-Server. Daraus werden in Teil 3 die Möglichkeiten für einen P2P-Einsatz bei der Mehrfachverwertung abgeleitet, sowie Kriterien zur genaueren Erfassung der Unterschiede zu Client-Server vorgestellt. Im vierten Teil werden diese Kriterien anhand dreier auf die Einsatzmöglichkeiten von P2P abgestellter Szenarien mit einer bzgl. der Medienwertschöpfungskette unterschiedlichen Reichweite ausgewertet. Diesem Teil fällt besondere Bedeutung zu, da die späteren Empfehlungen hierauf basieren und bisher keine zusammenhängende Untersuchung der Unterschiede von C/S zu P2P unter dem Gesichtspunkt der Mehrfachverwertung existiert. Teil 5 nutzt diese Ergebnisse in Verbindung mit den Akteurseigenschaften und den Anforderungen der verschiedenen Inhaltearten an ein Träger- bzw. Verbreitungsmedium, um unter Verwendung der Transaktionskosten-Theorie Hypothesen für die Eignung von Peer-to-Peer bei der Mehrfachverwertung von Medieninhalten zu erlauben.
Eine Stellungnahme der Praxis ermöglicht eine erste Abschätzung von deren Tragfähigkeit. Die gewonnenen Erkenntnisse und künftige, noch weiter anzustellende vertiefende Untersuchungen werden im Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
1.1Problemstellung1
1.2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit1
2.Grundlagen3
2.1Digitale Medieninhalte3
2.2Mehrfachverwertung von Medieninhalten4
2.2.1Beteiligte und Märkte5
2.2.2Darstellung der Mehrfachverwertung ausgehend von der Wertschöpfungskette der Medienbranche8
2.3Peer-to-Peer- und Client-Server-Konzept10
2.3.1Client-Server-Konzept11
2.3.2Peer-to-Peer-Konzept14
2.3.3Hybrides Peer-to-Peer19
3.Einsatzmöglichkeiten und Bewertungskriterien des P2P-Konzeptes bei der Mehrfachverwertung20
3.1Betrachtung der C/S-geprägten Mehrfachverwertung als Ausgangspunkt20
3.2Determinanten […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6787
Szantyr, York Sebastian: Die Eignung von Peer-to-Peer- und Client-Server-Konzepten im
Rahmen der Mehrfachverwertung von Medieninhalten
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: München, Universität, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
I
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
III
Tabellenverzeichnis
IV
Abkürzungsverzeichnis
V
1
Einleitung 1
1.1 Problemstellung 1
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
1
2
Grundlagen 3
2.1 Digitale Medieninhalte
3
2.2 Mehrfachverwertung von Medieninhalten
4
2.2.1 Beteiligte und Märkte
5
2.2.2 Darstellung der Mehrfachverwertung ausgehend von der
Wertschöpfungskette der Medienbranche
8
2.3 Peer-to-Peer- und Client-Server-Konzept
10
2.3.1 Client-Server-Konzept 11
2.3.2 Peer-to-Peer-Konzept 14
2.3.3 Hybrides Peer-to-Peer
19
3
Einsatzmöglichkeiten und Bewertungskriterien des P2P-Konzepts bei der
Mehrfachverwertung 20
3.1 Betrachtung der C/S-geprägten Mehrfachverwertung als
Ausgangspunkt 20
3.2 Determinanten und Einsatzbereiche von Peer-to-Peer bei der
Mehrfachverwertung 22
3.2.1 Aggregationsgrad 22
3.2.2 Reichweite 24
3.3 Beurteilungskriterien von Peer-to-Peer bei der Mehrfachverwertung
28
3.3.1 Ökonomische Dimension
28
3.3.2 Technische Dimension
31
3.3.3 Rechtliche Dimension
33
II
3.3.4 Auswahl der betrachteten Kriterien
34
4
Betrachtung der Beurteilungskriterien anhand dreier Szenarien
unterschiedlicher
Reichweite
36
4.1 Beurteilung der Konzepte auf der Distributionsstufe
37
4.2 Beurteilung der Konzepte auf der Distributions- und Syndikationsstufe 47
4.3 Beurteilung der Konzepte bei Einsatz auf der gesamten
Wertschöpfungskette
54
5
Ableitung von Hypothesen auf Basis der Transaktionskosten-Theorie
62
5.1 Relevante Eigenschaften ausgewählter Inhaltearten
62
5.2 Relevante Eigenschaften der Akteure
65
5.3 Grundzüge der Transaktionskosten-Theorie
66
5.4 Ableitung der Hypothesen
67
5.5 Stellungnahme der Praxis
75
6
Fazit 77
Literaturverzeichnis
VII
Anhang
XIV
III
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1.2/1
Aufbau der Untersuchung
2
Abb. 2.2.2/1 Wertschöpfungskette und -akteure der Medienbranche
8
Abb. 2.3.1/1 Einfaches Client-Server-Netz
12
Abb. 2.3.2/1 Einfaches serverloses Peer-to-Peer-Netz
16
Abb. 2.3.2/2 Überblick über Peer-to-Peer-Applikationen
17
Abb. 2.3.3./1 Einfaches serverbasiertes Peer-to-Peer-Netz
19
Abb. 3.2.1/1 Peer-Aggregationsgrade bei der Mehrfachverwertung
23
Abb. 3.2.2/1 Einsatzbereiche von Peer-to-Peer
25
Abb. 4/1
Übersicht der Untersuchungsabschnitte
36
Abb. 4.1/1
Strukturen der Konzepte bei einer Wertschöpfungsstufe
37
Abb. 4.2/1
Strukturen der Konzepte bei zwei Wertschöpfungsstufen
47
Abb. 4.3/1
Strukturen der Konzepte bei drei Wertschöpfungsstufen
54
IV
Tabellenverzeichnis
Tab. 2.3/1
Einordnung und Umsetzung einiger Anwendungen
10
Tab. 3.3.4/1
Überblick erläuterter Beurteilungskriterien
35
Tab. 4.1/1
Ergebnisse des Abschnitts 4.1
47
Tab. 4.2/1
Ergebnisse des Abschnitts 4.2
54
Tab. 4.3/1
Ergebnisse des Abschnitts 4.3
61
Tab. 5.1/1
Gegenüberstellung von Text- und Videoinhalten
65
V
Abkürzungsverzeichnis
AG
Aktiengesellschaft
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
B2B
Business to Business
B2C
Business to Consumer
C2C
Consumer to Consumer
CD Compact
Disc
C/S Client-Server
DAT
Digital Audio Tape
DivX
Digital Video Express
DNS
Domain Name System
DRM
Digital Rights Management
DVD
Digital Versatile Disc
E-Business Electronic
Business
E-Mail Electronic
Mail
FTP
File Transfer Protocol
GB Gigabyte
Gbps
Gigabit per Second
GHz Gigahertz
GIF
Graphics Interchange Format
HTML
Hypertext Markup Language
ICE
Information and Content Exchange
ISP
Internet Service Provider
IP Internet
Protocol
IT Informationsverarbeitungstechnologie
JPEG
Joint Photographic Experts Group
LAN
Local Area Network
MB Megabyte
MIPS
Million Instructions Per Second
MP3
MPEG Audio Layer 3
VI
MPEG
Moving Pictures Experts Group
P2P Peer-to-Peer
PC Personal
Computer
SDSL
Symmetric Digital Subscriber Line
SMS
Short Message Service
TCPA
Trusted Computer Platform Alliance
TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TTL
Time To Live
UrhG Urheberrecht
Gesetz
VoD
Video on Demand
WDDX
Web Distributed Data Exchange
WIPO
World Intellectual Property Organization
WTO
World Trade Organization
WWW
World Wide Web
XML
Extensible Markup Language
1
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Aus den Aktienhöhenflügen der frühen Internet-Economy wurde in den letzten
anderthalb Jahren ein tiefer Sturz. Während anfangs alle internetbezogenen Ideen
von den Marktteilnehmern euphorisch aufgenommen und bewertet wurden, hat sich
die Stimmung mittlerweile ins Gegenteil verkehrt; die ursprüngliche Euphorie ist in
Depression und Skepsis gegenüber Innovationen aus dem Internetumfeld
umgeschlagen. Eine der davon betroffenen Innovationen ist das Peer-to-Peer-
Konzept
1
. In dieser Arbeit gilt es dessen Potenzial realistisch zu beurteilen, abseits
von emotionsgeprägten Einschätzungen aller Akteursgruppen.
Für den Großteil der Anwender ist bei Innovationen aus dem Netzwerk-Bereich nicht
die technische Umsetzung interessant, sondern nach wie vor gilt: ,,content is king",
Inhalte bleiben Trumpf
2
. Dabei werden diese Inhalte häufig, zur Erwirtschaftung
höherer Gewinne, auf verschiedenen Wegen und in verschiedenen Kombinationen
und Formen mehrmals verwendet. Dieses als Mehrfachverwertung von Inhalten
3
bezeichnete Vorgehen basiert auf einer client-server-geprägten
Wertschöpfungskette. Doch gerade im Bereich der Inhalteverbreitung hat Peer-to-
Peer seine Stärken, wie seit Napster allgemein bekannt ist; ein Einsatz in der
Content Syndication scheint daher nahe liegend.
Doch sind auch Fragen der Sicherheit, Bandbreitenanforderungen, etablierte
Standards u.Ä. zu bedenken. Dies zeigt die Notwendigkeit einer eingehenderen
Betrachtung der in der Literatur noch kaum diskutierten Fragestellung der Eignung
von Client-Server (C/S) und Peer-to-Peer (P2P) im Bereich der Mehrfachverwertung
von Medieninhalten.
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ausgehend von den Eigenschaften des C/S- und
P2P-Konzepts und den Anforderungen der Mehrfachverwertung von Medieninhalten
Hypothesen auf Basis der Transaktionskosten-Theorie zu gewinnen, die
Anhaltspunkte für die Eignung der Konzepte in konkreten Einsatzsituationen bieten.
Dazu wird das in Abb. 1.2/1 dargestellte Vorgehen angewandt.
1
Obwohl Peer-to-Peer seit den Anfängen des Internets in den 1960er Jahren existierte, wurde es erst Ende der
90er durch die Musiktauschbörse Napster als E-Business-Konzeption wieder entdeckt.
2
Vgl. Zerdick / Picot / Schrape / Atropé / Goldhammer / Heger / Lange / Vierkant / López-Escobar / Silverstone
(2001), S. 48.
3
Im Weiteren synonym zu Content Syndication verwendet (vgl. auch 2.2).
2
Zunächst werden in Teil 2 die notwendigen Grundlagen vorgestellt: die
Eigenschaften digitaler Medieninhalte, die Mehrfachverwertung dieser Inhalte und
die Netz-Konzepte Peer-to-Peer und Client-Server. Daraus werden in Teil 3 die
Möglichkeiten für einen P2P-Einsatz bei der Mehrfachverwertung abgeleitet, sowie
Kriterien zur genaueren Erfassung der Unterschiede zu Client-Server vorgestellt. Im
vierten Teil werden diese Kriterien anhand dreier auf die Einsatzmöglichkeiten von
P2P abgestellter Szenarien ausgewertet. Diesem Teil fällt besondere Bedeutung zu,
da die späteren Empfehlungen hierauf basieren und bisher keine
zusammenhängende Untersuchung der Unterschiede zu P2P unter dem
Gesichtspunkt der Mehrfachverwertung existiert. Teil 5 nutzt diese Ergebnisse in
Verbindung mit den Akteurseigenschaften und den Anforderungen der
verschiedenen Inhaltearten, um unter Verwendung der Transaktionskosten-Theorie
Hypothesen für die Eignung von Peer-to-Peer bei der Mehrfachverwertung von
Medieninhalten zu erlauben. Eine Stellungnahme der Praxis ermöglicht eine erste
Abschätzung von deren Tragfähigkeit. Die gewonnenen Erkenntnisse und künftig
anzustellende Untersuchungen werden im Fazit zusammengefasst.
Peer-to-Peer- und
Client-Server-
Konzept
Teil 2
Grundlagen
Einsatzmöglichkeiten von
Peer-to-Peer bei der
Mehrfachverwertung
Ökonomische, technische und
rechtliche Bewertungskriterien
Teil 3
Einsatzmöglichkeiten
und Messkriterien für
deren Auswirkungen
Ermittlung der Unterschiede von
P2P und C/S anhand dreier
Szenarien
Teil 4
Auswertung der
Kriterien aus Teil 3
Eigenschaften von
Medieninhaltearten und Akteuren
Stellungnahme der Praxis
Teil 5
Ableitung der
Hypothesen
Fazit
Teil 6
Mehrfachverwertung
von Medieninhalten
Eigenschaften
digitaler
Medieninhalte
Ableitung von Hypothesen mithilfe
der Transaktionskosten-Theorie
Abb. 1.2/1
Aufbau der Untersuchung
3
2 Grundlagen
2.1 Digitale Medieninhalte
Inhalte werden seit der Erfindung des Buchdrucks um 1440 in immer größerem
Umfang vervielfältigt. Dabei konnten diese bis in die zweite Hälfte des 20.
Jahrhunderts nur analog festgehalten werden. Die Möglichkeit, Informationen in Bits
statt in Atomen festzuhalten
4
, bringt tief greifende Änderungen für Medieninhalte mit
sich:
,,Your marginal cost to make more bits is zero. You need no inventory. You
can sell them and keep them for yourself at the same time. The originals and
the copies are indistinguishable."
5
Unter Inhalten sind Texte, Bilder, Audio und Video, Mischungen aus diesen, und
interaktive Komponenten, wie Software, in unterschiedlichen Formaten zu
verstehen
6
. Inhalte sind dabei Informationen und Unterhaltung
7
, die vom
Produzenten für Nachfrager i.d.R. gegen eine Entlohnung bereitgestellt werden.
Hierfür sind die Inhalte in eine geeignete Form zu überführen bzw. zu konservieren,
was durch ein Übertragen auf Medien erreicht wird. Medien sind somit nicht die
Inhalte selbst, sondern ihre physischen Träger bzw. materiellen Repräsentationen.
Die Digitalisierung von Inhalten erlaubt eine weitgehende Loslösung der Inhalte von
den Trägermedien und damit auch eine Repräsentation der Inhalte in
unterschiedlicher Form. So können Audioinhalte auf Medien wie CD, DAT u.Ä.
gespeichert sein; sie können jedoch ebenso in Form von MP3-Dateien online
verfügbar gemacht werden, quasi ,,mediumless"
8
also ohne Trägermedium.
Digitale Inhalte dieser Form stehen im Fokus der Arbeit und sind bevorzugter
Gegenstand der Mehrfachverwertung.
Dank der Digitalisierung können Inhalte von Nutzern ohne Qualitätsverlust günstiger
und schneller vervielfältigt und verbreitet werden, als dies bei analogen Medien
möglich wäre. Dies führt dazu, dass Inhalte den Charakter eines öffentlichen Gutes
erhalten
9
, mit Nichtrivalität
10
und Nichtausschließbarkeit vom Konsum
11
. Dies setzt
4
Vgl. Zerdick / Picot / Schrape / Atropé / Goldhammer / Heger / Lange / Vierkant / López-Escobar / Silverstone
(2001), S. 15.
5
Vgl. Negroponte (1998), S. X.
6
Vgl. Klee (2001), S. 43-44 und Bechtold (2001), S. 16-17. Meier versteht hierunter alles, ,,was Inhalt einer Website
sein kann", Meier (2000).
7
Vgl. Schuhmann / Hess (2000), S. 6.
8
Vgl. Negroponte (1996), S. 71-74.
9
Vgl. Zerdick / Picot / Schrape / Atropé / Goldhammer / Heger / Lange / Vierkant / López-Escobar / Silverstone
(2001), S. 48 und Wirtz (2000), S. 26.
10
Unter der Voraussetzung ausreichender Bandbreite und Serverleistung schmälert der Konsum durch einen
Rezipienten nicht die Konsummöglichkeiten anderer.
11
So genügt im Extremfall ein einziger regulär erworbener Inhalt, um mithilfe illegaler Kopien alle Konsumenten zu
versorgen.
4
etablierte Strukturen in der Medienbranche unter erheblichen Wandlungsdruck und
führte zur Entwicklung sog. Digital Rights Management Systeme
12
.
Diese Charakteristika digitaler Medieninhalte sind andererseits auch für die
Medienunternehmen von Vorteil: das Erstellen neuer Kopien verursacht kaum
Kosten. Es kommt zu einer stärkeren Stückkostendegression bei zunehmenden
Auflagenzahlen als bei traditionellen Medien, da Vervielfältigungs- und
Distributionskosten nahezu entfallen. Dies verstärkt den sog. First-Copy-Cost-
Effekt
13
. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, digital vorliegende Inhalte durch
mathematische Verfahren zu komprimieren, entweder mit kaum wahrnehmbaren
oder ohne Qualitätseinbußen
14
. Weiterentwicklungen schaffen hier stetig bessere
Ergebnisse bei geringerem Speicherbedarf.
Im Online-Bereich dominieren z.Z. Inhalte zu Technik und Finanzen; dies wird sich
künftig voraussichtlich zugunsten von General-Interest-Themen verschieben
15
. Die
Nachfrage nach Rich-Media-Inhalten
16
wird mit der Verfügbarkeit von Breitband-
Verbindungen zunehmen und die heute üblichen, textbasierten Inhalte eher
ergänzen als substituieren
17
. Durch die aufgrund der digitalen Natur einfache
Mischung verschiedener Inhaltearten lässt sich sog. Multimedia realisieren und so
eine individuellere und umfassendere Auseinandersetzung mit Sachverhalten
ermöglichen
18
.
Die Lieferung und Kombination von Inhalten ist mit aktueller Technologie bereits in
Echtzeit möglich. So ermöglicht die Leistungssteigerung in der
Informationstechnologie einerseits die Übernahme traditioneller Inhaltearten, lässt
andererseits aber auch die Kreation neuer Arten und Kombinationen von Inhalten
zu. Gerade das Bündeln von Inhalten verschiedener Anbieter in Form der
Mehrfachverwertung von Inhalten gewinnt zunehmend an Bedeutung.
2.2 Mehrfachverwertung von Medieninhalten
Im Online-Bereich stellt die Content Syndication
19
einen zentralen, stetig
wachsenden Unterbereich des Content Commerce, also des geschäftsmäßigen
Vertriebs von Inhalten zwischen mehreren Partnern dar und wird teilweise sogar als
12
Vgl. Bechtold (2001), S. 1-3.
13
Danach verursacht die Erstellung des Originals hohe einmalige Produktionskosten, die distribuierten Kopien
haben jedoch Grenzkosten nahe Null. Vgl. Shy (2000), S. 97-98; Wirtz (2000), S. 22-24 und Schuhmann / Hess
(2000), S. 59.
14
Vgl. Hess / Anding / Schreiber (2002), S. 30-31. In Verbindung mit fehlerprüfenden und -korrigierenden Verfahren
wird so eine Übertragung in hoher Qualität auch bei begrenzter Netzwerk-Bandbreite und Speicherkapazität
möglich.
15
Vgl. Kohlschein (2001), S. 9.
16
Dies sind speicherintensive dynamische Inhalte, bspw. Audio- und Videoinhalte.
17
Vgl. Kohlschein (2001), S. 9.
18
Vgl. Negroponte (1996), S. 62-67.
19
Content Syndication wird im Folgenden i.S. einer Mehrfachverwertung verstanden. Sie wird von
Nachrichtenagenturen bereits seit langem betrieben und ist im Printbereich auch unter dem Begriff Nachdruck-
oder Reprint-Prinzip bekannt. Vgl. Hardt (1999), S. 268-270.
5
,,the fundamental organizing principle for e-business"
20
bezeichnet. Unter Content
Syndication bzw. Mehrfachverwertung wird dabei verstanden, dass Inhalte in
verschiedenen ,,Inhaltepaketen", Vertriebsformen oder Medien mehrmals verwertet
werden, um höhere Erlöse zu erwirtschaften. So werden Agenturmeldungen bspw.
als Tickermeldungen bei Nachrichtenfernsehsendern, für Radionachrichten und auf
Internetseiten verwendet; besonders das Internet fördert die Verwendung gleicher
Inhalte auf verschiedenen Seiten im WWW. Content Syndication bzw.
Mehrfachverwertung wird im Folgenden so verstanden, dass die Abwicklung B2B
abläuft, also Erstellung, Syndikation und Distribution geschäftsmäßig erfolgen. In
den beiden folgenden Abschnitten werden zunächst die an der Mehrfachverwertung
Beteiligten vorgestellt und anschließend der Ablauf der Mehrfachverwertung anhand
der Wertschöpfungskette der Medienbranche betrachtet.
2.2.1 Beteiligte und Märkte
An der Mehrfachverwertung sind i.d.R. drei auf Erlöserzielung ausgerichtete
Akteursgruppen beteiligt: Inhalteanbieter bzw. -ersteller, Syndikatoren und
Distributoren.
Der Begriff Inhalteanbieter bzw. Content Provider umfasst dabei Content
Produzenten und Content Geber. Erstere sind im Online-Bereich mit den Autoren
des Printbereichs vergleichbar, da sie originäre Inhalte schaffen
21
; Letztere
hingegen besitzen Lizenzen bzw. Verwertungsrechte für Inhalte, die nicht von ihnen
selbst erstellt wurden. Während Produzenten sowohl Urherberpersönlichkeits- als
auch Verwertungsrechte innehaben, besitzen Content Geber lediglich
Verwertungsrechte, die abgetreten werden können; Urheberpersönlichkeitsrechte
hingegen sind in Deutschland nicht veräußerbar
22
.
Anbieter können über eine Mehrfachverwertung weitere Erlöse mit ihren Inhalten
generieren. Dabei sind Image- und Markengesichtspunkte zu berücksichtigen, um
nicht langfristig die Marke des Anbieters durch kurzfristige Gewinne aus maximaler
Mehrfachverwertung zu schädigen; Interessenkonflikte der Anbieter intern (Rendite-
vs. Markenziele) und zwischen Anbieter und Syndikator (Anbieter-Image vs.
intensive Verwertung) sind vorhanden. Gesamtziel ist es, Inhalte so zu verbreiten,
dass alle Inhalte des Produzenten dadurch an Wert gewinnen
23
.
Syndikatoren dienen als Intermediäre des Inhaltebereichs v.a. der Vermittlung
zwischen Produzenten und Weiterverwertenden, sie bringen Angebot und
Nachfrage effizient zusammen
24
. Generelle Aufgaben der Intermediäre sind die
20
Werbach (2000), S. 85.
21
Vgl. Schuhmann / Hess (2000), S. 10.
22
Vgl. auch 3.3.3.
23
Vgl. Gerpott / Schlegel (2002), S. 135.
24
Syndikatoren werden daher auch als ,,Content Broker" bezeichnet und ermöglichen durch Bündelung von
Angeboten und Nachfragen eine Senkung der Transaktionskosten im stark fragmentierten Inhaltemarkt. Dies gilt
6
Versorgung der Marktteilnehmer mit Informationen, die Organisation der
Zusammenstellung, Gewinnung des Vertrauens der Marktteilnehmer und
Übernahme zusätzlicher Leistungen wie Finanzierung
25
. Content Syndikatoren
bieten darüber hinaus spezielle Leistungen, v.a. Marketingleistungen, aber auch
Rights Clearing und technische Dienstleistungen an; zu Letzteren zählt neben
Kategorisieren und Aggregieren auch Formatkonvertierung, da Content Provider
ihre Inhalte i.d.R. noch nicht medienneutral erstellen, wie es für eine Einbindung in
verschiedene Angebote notwendig ist
26
.
Eine wesentliche Wertschöpfungsaktivität ist die Bündelung der Inhalte mehrerer
Produzenten, wodurch individuelle Angebote für Nachfrager aus den
Inhalteportfolios mehrerer Anbieter zusammengestellt werden können
27
. Über eine
Modularisierung des Contents können ganze Inhalte oder einzelne Inhaltemodule
nach den Wünschen der Kunden oder eigenen ökonomischen Strategien kombiniert
werden. Häufig übernimmt der Syndikator auch die Beratung der Inhaltekäufer,
wodurch sich die Transaktionskosten bei Erwerb von Inhalten verschiedener
Inhalteersteller reduzieren. Die B2B-Weitergabe erfolgt oft über eine eigene
Technikplattform, wobei Transaktionen im Internet weit gehend darauf beruhen,
dass sie über zentralisierte Portale ablaufen
28
(vgl. auch 2.3.1).
Die Distributoren übernehmen die Lieferung der Inhalte zum Rezipienten. Dies
geschieht bisher v.a. über den Einbau in eigene Websites, u.U. auch über den
Versand per E-Mail oder SMS als Push-Dienst (vgl. 2.2.2). Die Distributoren stehen
in direktem Kontakt mit den Rezipienten und übernehmen daher auch die
Endkunden-Abrechnung, wenn es sich um kostenpflichtige Inhalte handelt. Zweck
einer unentgeltlichen Bereitstellung von Inhalten hingegen ist v.a. die
Differenzierung von anderen Angeboten, um somit einen ersten Kundenkontakt zu
ermöglichen oder die Kundenbindung zu erhöhen
29
.
Schätzungen des Marktvolumens der Online-Mehrfachverwertung belaufen sich auf
1,5 Mrd. US$ in 2004
30
. Die im Internet ubiquitären kostenfreien Inhalte
ermöglichten es bisher meist nicht, ein dauerhaft tragfähiges B2C-Geschäftsmodell
für Inhalte zu etablieren. Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Wallstreet Journal,
Handelsblatt.com) sind Nutzer kaum bereit, für Inhalte zu zahlen.
in besonderem Maße, wenn Nachfrager Inhalte von mehreren Providern beziehen wollen. Vgl. Werbach (2000),
S. 89.
25
Vgl. Picot / Reichwald / Wigand (2001), S. 377.
26
Hier bieten sich XML-basierte Standards zur Erstellung zur Übertragung der Inhalte (bspw. ICE oder WDDX) an.
Dies führt u.U. zu einem Verlust an Spezifität, ermöglicht aber eine effizientere Mehrfachverwertung. Vgl.
Kohlschein (2001), S. 14.
27
Somit geschieht an dieser Stelle die eigentliche Mehrfachverwertung. Eine Personalisierung der Inhaltepakete
bzgl. der Nachfragerwünsche wird möglich.
28
Vgl. Wirtz (2001), S. 94.
29
Vgl. Kohlschein (2001), S. 11.
30
Vgl. Eads (2001).
7
Um ihr Erlöspotenzial zu erhöhen übernehmen Akteure auch mehrere der oben
genannten Rollen. So agieren die in Deutschland anzutreffenden
Inhalteproduzenten teilweise gleichzeitig als Syndikatoren. Während es für die B2B-
agierenden Syndikatoren weniger problematisch ist, ein tragfähiges
Geschäftsmodell aufzustellen, sind Distributoren in einer weitaus schwierigeren
Situation, da eine ,,traditionelle" Finanzierung über den doppelten Absatzmarkt
31
aufgrund stark gesunkener Bannerwerbepreise selten möglich ist.
Nahezu alle größeren Medienunternehmen sind bereits in der Content Syndication
aktiv oder werden dies in nächster Zukunft sein
32
. Die Zahl der Syndikatoren in
Deutschland ist hingegen relativ begrenzt und wird dies voraussichtlich auch
bleiben
33
. Hier sind v.a. Reuters, FocusTomorrow und Telekurs (als Produzenten
und Syndikatoren), cocomore (als verlagsnaher Syndikator von Bertelsmann) und
Tanto-Xipolis, ScreamingMedia und die mittlerweile Konkurs gegangene 4Content
AG als unabhängige Mittler zu nennen. Die Zahl der Distributoren steigt stetig, zum
einen da mit der Internetnutzerzahl auch die Inhaltenachfrage, die Distributoren
fördert, zunimmt und zum anderen Unternehmen verstärkt Inhalte zur Information
ihrer Mitarbeiter einsetzen und an diese distribuieren
34
. Zudem begünstigen Internet
und WWW im besonderen die Mehrfachverwertung, da in letzterem textuelle Inhalte
neben der potenziell größeren Aktualität im Vergleich zu Printmedien auch die
Möglichkeit einer Verlinkung
35
und Einteilung in trennbare Module bieten, die eine
Bündelung und Neuzusammenstellung erleichtern. Niedrigste Übertragungskosten
und etablierte -standards sind als weitere Vorteile zu nennen.
Da es sich bei Online-Mehrfachverwertung von Inhalten um ein junges
Geschäftsfeld handelt, ist noch Unsicherheit bei der Preisfestsetzung durch die
Medienunternehmen festzustellen; es wird hier jedoch auch in Zukunft u.U. keine
einheitlichen Preise, sondern flexible Vereinbarungen mit Preisdifferenzierung
36
geben. Dies bringt teilweise aufwändige Verhandlungen und umständliche
Abrechnungsmodelle
37
mit sich.
Das Zusammenspiel der genannten Akteure bei der Mehrfachverwertung wird im
nächsten Abschnitt mit Hilfe des Instruments der Wertschöpfungskette näher
betrachtet
31
Hier i.S. einer Kombination aus Werbe- und Vertriebserlösen verwendet.
32
Vgl. Kohlschein (2001), S. 7.
33
Vgl. Kohlschein (2001), S. 8.
34
Vgl. Kohlschein (2001), S. 11.
35
Dies wird auch als Hypermedia- bzw. Hypertext-Prinzip bezeichnet. Vgl. Negroponte (1996), S. 69.
36
Vgl. Kohlschein (2001), S. 12-13.
37
Abrechnungen erfolgen bspw. Pay-per-View, Pay-per-Click etc. Dies wird i.d.R. mit Mindestabnahmemengen
oder Werbevereinbarungen kombiniert, um die bekannten Probleme von Mikropayments auf B2B-Ebene zu
vermeiden.
8
2.2.2 Darstellung der Mehrfachverwertung ausgehend von der
Wertschöpfungskette der Medienbranche
Die in 2.2.1 beschriebenen an der Mehrfachverwertung von Inhalten Beteiligten
interagieren auf vielfältige Weise, um dem Rezipienten digitale Medieninhalte zu
liefern. Um den Ablauf dieser Interaktionen aggregiert
38
und nach
Wertschöpfungsaktivitäten differenziert auf einer angemessenen Abstraktionsebene
betrachten zu können, hat sich das Analyseinstrument der ,,value chain" von Michael
Porter bewährt.
Die Wertekette, auch als Wertschöpfungskette bezeichnet, stellt die einzelnen
funktionalen Segmente, in denen eine Wertschöpfung in Unternehmen oder einer
Branche geschieht, als Wertschöpfungsstufen in ihrer Abfolge dar
39
. Hierzu werden
Wert schaffende Einzelaktivitäten über die Gleichheit ihrer Inhalte zu
Wertschöpfungsaktivitäten zusammengefasst. Diese zeichnen sich zusätzlich
dadurch aus, dass sie voneinander jeweils relativ unabhängig sind und sich i.d.R.
technologisch, physisch und ökonomisch voneinander unterscheiden lassen
40
,
wobei die Zuordnung aufgrund von Schnittstellen zwischen den Aktivitäten zu einem
gewissen Grad willkürlich bleibt
41
.
Die Wertschöpfungskette der Medienbranche besitzt eine dreistufige Struktur
42
. Die
grundlegenden Aktivitäten sind die Erzeugung der Inhalte, deren Bündelung und
schließlich die Distribution zum Rezipienten, die aktuell mit den in 2.2.1 genannten
Akteursgruppen übereinstimmen.
Abbildung 2.2.2/1 stellt die Wertschöpfungskette und Akteure der aktuellen Situation
dar, bei der die Bereitstellung für den Abruf durch die nachfolgende Stufe bis hin
zum Rezipienten jeweils über einen zentralen Server in jedem Unternehmen erfolgt.
Hinter jeder Wertschöpfungsstufe stehen dabei i.d.R. zahlreiche Unternehmen. Wie
38
Im Sinne einer Abstraktion von konkreten Einzelaktivitäten der beteiligten Unternehmen.
39
Vgl. hier und im Folgenden Porter (1989), S. 59-63.
40
Vgl. Porter (1989), S. 64.
41
Vgl. Klemm (1997), S. 83.
42
Vgl. Schuhmann / Hess (2002), S. 9-10 und S. 64.
Abb. 2.2.2/1
Wertschöpfungskette und -akteure der Medienbranche
Abb. 2.2.2/1
Wertschöpfungskette und -akteure der Medienbranche
Inhalte
erzeugen
Inhalte
bündeln
Inhalte
distribuieren
Content
Provider
Content
Syndicator
Content
Distributor
Reuters,
FocusTomorrow
Tanto-Xipolis
Diverse
Websites
Akteur
Wertschöpf-
ungsstufen
Unter-
nehmen
Erlöse
Konsu-
ment
9
oben angedeutet, sind die Übergänge der Stufen teilweise fließend, so ist z.B. die
FocusTomorrow AG in erster Linie Inhalteproduzent, hat jedoch auch die
Syndikationsfunktion z.T. mitübernommen. Dem Inhaltefluss entgegengesetzt läuft
der Erlösstrom, wobei die Bezahlung nicht zwingend monetär erfolgen muss,
sondern auch in Rezipientenaufmerksamkeit, Traffic o.ä. bestehen kann.
Auf der Stufe der Inhalteerzeugung agieren Inhalteproduzenten und -geber. Hier
findet neben der eigentlichen Erstellung des Inhalts zunehmend auch die
Bereitstellung in einem geeigneten Format
43
und das Versehen mit entsprechenden
Metadaten
44
statt, um eine Weiterverwendung zu erleichtern.
Auf der zentralen Stufe der Bündelung und Mehrfachverwertung agieren
Syndikatoren als Intermediäre. Hier finden technische Aufbereitung, Bündelung der
Inhaltemodule (Packaging), Beratung bei der Inhalteauswahl und -bereitstellung
(Content-Hosting) statt. Da ,,Inhalte von der Stange" zunehmend weniger gefragt
sind, werden die gebündelten Inhalte u.U. auf dieser Stufe noch einmal redaktionell
überarbeitet und erfahren so eine Wertsteigerung
45
. Content-Syndication erfolgt
dabei heute i.d.R. nur B2B zwischen Syndikatoren und Distributoren
46
.
Die Distributionsstufe umfasst die Lieferung der Inhalte zum Rezipienten. Hierzu
werden Inhalte bspw. in eigene Internetseiten eingebunden, wofür die Bereitstellung
auf Internetservern in entsprechenden Formaten notwendig ist, sowie ggf.
Zusatzleistungen wie Suchmaschinen und Archive. Die Übergabe an den
Endkunden kann dabei auf zwei Arten erfolgen; beim Push-Verfahren werden die
vom Kunden gewünschten Inhalte diesem aktiv gesendet, sobald sie vorhanden
sind oder ein auslösendes Ereignis eintritt (z.B. via SMS oder E-Mail). Alternativ
kann auch ein Pull-Verfahren realisiert werden, d.h. die Inhalte werden erst nach
Anforderung durch den Rezipienten an diesen übermittelt (z.B. durch Aufruf einer
Internetseite). Eine Einbindung in eigene Seiten kann auch über eine Verlinkung von
Überschriften erfolgen. Die Stufe der Distribution umfasst sofern vorhanden
auch die Abrechnung der Inhalte mit dem Endkunden, die z.Z. nicht adäquat gelöst
ist
47
.
Neben einer Erläuterung digitaler Medieninhalte und der Wertschöpfung in der
Mehrfachverwendung sind als dritter Grundbaustein die Konzepte Peer-to-Peer und
Client-Server vorzustellen, die eine Übertragung der Inhalte zwischen den Akteuren
erst ermöglichen.
43
Hier eignen sich Standards mit Trennung von Layout und Inhalt, wie bspw. XML.
44
Metadaten sind Beschreibungen anderer Daten, bspw. von Videoinhalten. Sie ermöglichen inhaltliche Suchen mit
diesen Inhaltearten und sind damit essenziell für relevante Suchergebnisse bei heterogenen Inhaltearten und
großer Inhaltezahl. Vgl. Dornfest / Brickley (2001), S. 191-197.
45
Vgl. Kohlschein (2001), S. 10.
46
Dies ist u.a. in der bisher ungelösten Mikropayment-Abrechnungsproblematik begründet.
47
Als Probleme sind v.a. mangelnde Zahlungsbereitschaft und hohe Kosten bei der Abrechnung von
Mikropayments zu nennen.
10
2.3 Peer-to-Peer- und Client-Server-Konzept
Sowohl die Peer-to-Peer- als auch die Client-Server-Architektur
48
sind
Gestaltungskonzepte für verteilte Systeme
49
.
Häufig stehen bei der Betrachtung solcher Rechnernetze Hardware-Details im
Vordergrund, die zugrunde liegende ,,Netzphilosophie" ist scheinbar von
untergeordneter Bedeutung. Dies ist jedoch eine einschränkende Sichtweise
50
, denn
v.a. die gedankliche Konzeption ist für den realisierbaren Nutzen von Bedeutung.
Heutige Netzwerke sind i.d.R. für den Betrieb als zentralistische Client-Server-
Konstellation optimiert
51
. Diese Ausrichtung geschah in erster Linie aus dem
zugrunde gelegten Konzept heraus und weniger aus technischem Zwang. Ein
Paradigmenwechsel würde sich daher auch nicht (zwangsweise) in neuer Technik
ausdrücken, sondern in der Art, wie Netzteilnehmer zueinander gestellt sind und
welche Rechte und Möglichkeiten ihnen gegeben werden
52
.
Im weiteren Verlauf wird daher nicht der einschränkende Begriff Peer-to-Peer-
Technik bzw. Client-Server-Technik verwendet werden, sondern der umfassendere
Begriff des Konzepts, Paradigmas bzw. der Architektur, da in erster Linie die Art des
Zusammenwirkens der Elemente in einem Netzwerk entscheidend für dessen
Eignung für bestimmte Aufgaben ist und nicht die technische Ausprägung. Letztere
ergibt sich als Folge aus Ersterem.
Tab. 2.3/1
Einordnung und Umsetzung einiger Anwendungen
Die im Folgenden erläuterten Konzepte sind zum einen das zentralistische C/S-
Konzept, das Teilnehmer strikt in (Dienste-)Anbieter und Nachfrager unterscheidet
und das dezentrale P2P-Konzept, das alle Teilnehmer gleichberechtigt. In Tabelle
2.3/1 sind beispielhaft einige Interaktionsformen nach ihrer logischen Grundstruktur
und tatsächlichen technischen Realisation den Konzepten zugeordnet.
48
Der Begriff Architektur wird synonym zu Paradigma und Konzept gebraucht und als ganzheitliche Konzeption
verstanden, die der Planung und Realisierung von Informationssystemen zugrunde liegt. Konkrete
Implementierungen werden als P2P- oder C/S-Technik bezeichnet, die Datenverarbeitung auf Basis dieser
Technik als P2P- oder C/S-Computing. Vgl. Schmitt (1993), S. 32-38.
49
Zwar können insbesondere beim Client-Server-Konzept beide Prozesse in einem Rechner ablaufen, im Rahmen
dieser Arbeit wird jedoch der Aspekt einer Verwertung von Inhalten in einem Netzwerk, also einem verteilten
System, zu untersuchen sein.
50
Vgl. Bentsche (1993), S. 220; Meyer (1993), S. 72. und Tolkmit (1993), S. 353.
51
Beispielhaft seien das Übertragungsverfahren ADSL und zentralisierte Internet-Server genannt, die beide den
Fluss von Inhalten zum Browser-Client besser unterstützen als die entgegen gesetzte Flussrichtung.
52
Aktuelle P2P-Applikationen werden daher paradoxerweise i.d.R. auf Client-Server-Technik ausgeführt.
Anwendung Rundfunk Telefon E-Mail
Instant
Messaging
Logische
Einordnung
Client-Server Peer-to-Peer Peer-to-Peer Peer-to-Peer
Technische
Umsetzung
Client-Server Client-Server Client-Server Peer-to-Peer
11
Dabei soll an dieser Stelle lediglich festgehalten werden, dass beide Konzepte
sowohl aus technischer Sicht, wie auch als Interaktions- und Kommunikationsmodell
zu verstehen sind und technische Umsetzung und zugrunde liegende Struktur
voneinander abweichen können.
2.3.1 Client-Server-Konzept
Client-Server kam zu Beginn der 1990er Jahre auf und sollte die in Unternehmen
vorhandenen leistungsfähiger werdenden PCs
53
mit zentralen Instanzen
kombinieren, um so eine geordnete Struktur zu erhalten, mit drastischen
Kostenreduktionen
54
und höherer Flexibilität
55
.
Das Client-Server-Konzept unterscheidet zwei Arten von Netzteilnehmern:
einerseits Server (engl. Diener), die Dienste anbieten und andererseits Clients (engl.
Kunden), die Dienste nachfragen. Server sind hier der passive Teil, da sie von sich
aus keine Anfragen stellen und ohne an sie gerichtete Anfragen ,,ruhen". Erst auf
eine Anfrage hin werden entsprechende Informationen für den Client bereitgestellt
und übermittelt. Dabei sind Server untereinander gleichberechtigt und können
sowohl Anfragen (im Auftrag des Client) stellen als auch beantworten; Clients
hingegen können in diesem Konzept lediglich Anfragen stellen, nie Dienste
anbieten. Damit ist die festgelegte Unterscheidung in Anbieter und Nachfrager die
zentrale Aussage dieses Konzepts.
Technische Komponenten sind Client, Server und u.U. ein verbindendes Netzwerk.
Dabei sind sowohl Client als auch Server im engeren Sinne lediglich Prozesse
56
und
nicht die ausführende(n) Maschine(n). Tatsächlich können Client- und Server-
Prozess auf demselben Rechner ablaufen. Im Regelfall befinden sich diese jedoch
auf möglicherweise weit entfernten verschiedenen Rechnern, wie bspw. beim
Internet.
Die Dienste, die Server dabei anbieten können, sind vielfältig und umfassen u.a.
Datei-, Drucker- und Datenbankserver; im Internet u.a. Web-, Mail-, FTP- und
Domain-Name-Server
57
.
In Abbildung 2.3.1/1 ist beispielhaft ein Client-Server-Netz dargestellt. Die Daten
sind auf dem Server abgelegt und können von den Clients dort angefordert werden.
Die Übertragung einer Datei zwischen zwei Clients in der Abbildung an denselben
Server angeschlossen erfolgt stets über Server. Dies kann bspw. über einen
53
Vgl. Schmitt (1993), S. 2.
54
Der als Down- bzw. Rightsizing bezeichnete Übergang von Mainframes auf PCs wurde durch ,,economies of
scale" aufgrund von Massenproduktion möglich; so kostete 1993 eine MIPS bei Mainframes 100.000 US$
gegenüber 200 US$ bis 700 US$ bei Arbeitsplatzrechnern. Vgl. Hansen (1993), S. 15.
55
Vgl. Krcmar (1993), S. 16.
56
Prozess wird hier i.S. eines in Ausführung befindlichen Programms verwendet. Für eine Prozessdefinition und
Modellierungsmöglichkeiten vgl. Magee / Kramer (1999), S.11-22.
57
Eine Beschreibung von Servertypen findet sich im Anhang und bspw. in Eckert (1993), S. 235-245.
12
Upload der Datei auf den Server und einen anschließenden Download auf den
zweiten Client vom Server aus geschehen.
Der Server kann dabei als passiver Server mit zentraler oder dezentraler
Datenhaltung oder als aktiver Server mit Datenhaltung und Anwendungslogik
realisiert sein
58
. Theoretisch sind verschiedene Topologien
59
denkbar, praktisch hat
sich die n:1 Konstellation etabliert, da ein Server aufgrund seiner Leistungsfähigkeit
i.d.R. mehrere Clients versorgen kann. Die Zahl der Schichten differenziert C/S-
Architekturen weiter
60
. Bei der dominierenden Two-Tier-Form befindet sich die
Datenhaltung auf dem Server, während der Client Anwendungslogik und
Präsentation übernimmt
61
. Multi-Tier-Anwendungen lagern zusätzlich die
Anwendungslogik auf den Server aus, der Client übernimmt lediglich die
Präsentation
62
.
Das Client-Server-Konzept ist u.a. aufgrund seiner Offenheit
63
so erfolgreich, da
unterschiedliche Systeme als Clients und Server kombiniert werden können. Dieser
Umstand förderte v.a. die Ausbreitung innerhalb von Unternehmen. Außerhalb von
Unternehmen bescherte das rasante Internetwachstum seit Mitte der 1990er Jahre
dem Client-Server-Konzept seine größte und schnellste Verbreitung. Die
ursprüngliche Architektur des Internets nur aus Servern, die stets online waren und
daher feste IP-Adressen hatten,
konnte durch den immensen Ansturm von nur
temporär verbundenen, hauptsächlich an Download bzw. Webseiten-Abruf
interessierten Clients in Form von Webbrowsern nicht unverändert beibehalten
werden. Daher erhielten die Clients temporäre Adressen und Anbindung über die
Server der Internet Service Provider; es kam damit zu einer Zweiteilung der
58
Vgl. o.V. (2002a).
59
Im Sinne des Verhältnisses von Clients je Server. Denkbar sind ein Client je Server (1:1), mehrere Clients je
Server (n:1), ein Client je mehrere Server (1:m), mehrere Clients je mehrere Server (n:m).
60
Die Aufteilung in Softwareschichten (engl. Tier) erhöht die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit.
61
Dies entlastet den Server, erfordert jedoch sog. Fat Clients, d.h. gut ausgestattete Rechner, die häufig erweitert
werden müssen, um aktuellen Softwareanforderungen stets zu genügen.
62
Dies ermöglicht sog. Thin Clients, die lediglich für die Darstellung optimiert sind und kaum Upgrades benötigen;
Application Service Providing versucht über diesen Ansatz die Total Cost of Ownership zu senken.
5
6
1
2
3
4
Mögliche
Verbindungen
Beispielhafter
Dateiaustausch
zwischen Client 2
und Client 4
Client
Abb. 2.3.1/1
Einfaches Client-Server-Netz
Server
13
Internetteilnehmer in Server, die Inhalte anbieten und Clients, die Inhalte
nachfragen
64
.
Client-Server bestimmt auch, wie Suchen im Internet organisiert sind. Stellt ein
Client an eine Suchmaschine
65
eine Anfrage nach einem Suchbegriff, so durchsucht
der Server eine interne Liste mit den auf anderen Servern und nur auf Servern
verfügbaren Seiten. Obwohl dieses Verfahren bei Netzwerkbelastung und
Antwortzeit effizient ist und u.U. zahlreiche Ergebnisse liefert, sind diese nur
eingeschränkt relevant, da i.d.R. keine Metadaten verwendet werden. Zudem sind
Volltextsuchen nicht in Echtzeit durchführbar, wodurch Suchergebnisse nie den
aktuellen, sondern einen Zustand des Internets in der Vergangenheit
repräsentieren.
Die Offenheit des Konzepts erlaubt es, durch Kombination unterschiedlicher
Systeme eine Erweiterung der Rechnerleistung innerhalb des Unternehmens über
einen Ausbau von PCs deutlich kostengünstiger durchzuführen als es bei
Mainframes möglich gewesen wäre
66
. Auch konnten bereits vorhandene
Ressourcen eingebunden werden. Geeignete Betriebssysteme wie Windows NT
und OS/2, zugehörige Entwicklungswerkzeuge und Anwendungen (z.B. SAP R/3)
standen schnell bereit. Im Internet konnten ein schneller Ausbau und hohe
Nutzerzahlenzuwächse über eine C/S-Architektur erfolgreich bewältigt werden.
Zudem bietet diese Architektur weitreichende Kontrollmöglichkeiten, sowohl der
Daten, die zentral gesichert und verwaltet werden, als auch des Zugangs der
Nutzer, die durch ein ,,fest definiertes Tor" gehen müssen
67
.
Nachteilig ist, dass je nach Ausgestaltung des Client-Server-Verhältinisses
erhebliche Netzwerkkapazitäten erforderlich sind; eine Dateibearbeitung erfordert
u.U. Übertragung und Rückübertragung der gesamten Datei. Eine Skalierung des
Netzes erfordert i.d.R. eine Erweiterung des Servers bzw. Anschaffung weiterer
Server und ist so mit erheblichen Kosten verbunden. Zwar verhindert der zentrale
Server einen Informatik-Wildwuchs, es entstehen dafür jedoch erhebliche Kosten für
die Serverbetreuung und v.a. für die Installation neuer Arbeitsplatz-Software
68
. Der
Vorteil der zentralen Instanz erweist sich umgekehrt als ,,single point of failure"
nachteilig: ein Ausfall würde die Arbeit der Clients weitest gehend (bei Fat Clients)
63
Systeme werden als offen bezeichnet, wenn sie sich an allgemein akzeptierte und öffentlich zugängliche Regeln
(sog. Standards) halten und es dadurch möglich ist, verschiedenartige Systeme im Verbund einzusetzen. Vgl.
Picot / Reichwald / Wigand (2001), S. 182.
64
Als Folge daraus ist es mit relativ hohem Aufwand verbunden, Inhalte im WWW bereitzustellen, da diese speziell
aufbereitet und übertragen werden müssen, wobei zuvor u.U. eigene Domains beantragt werden müssen.
65
Bei Suchmaschinen handelt es sich um spezialisierte Datenbank-Server.
66
Vgl. Hansen (1993), S. 15 und Krcmar (1993), S. 16-17.
67
Diese zentrale Stelle kann bspw. über Firewall-Rechner, die die Netzwerkkommunikation überwachen und nicht
erlaubte Aktionen blockieren, gesichert werden.
68
So übersteigen die Total Cost of Ownership, ein von der Gartner Group entwickeltes Instrument zur
Gesamtkostenermittlung bei Arbeitsplatzrechnern, den Anschaffungspreis u.U. um ein Mehrfaches. Zu
Erweiterungen und Diskussion vgl. Wild / Herges (2000).
14
oder vollständig (bei Thin Clients) lahm legen. Die Architektur ist trotz der bei ihrer
Einführung geforderten Anpassung an den Arbeitsprozess
69
immer noch so starr,
dass bspw. für SAP R/3 i.d.R. Geschäftsprozesse neu strukturiert werden müssen.
Dienste wie Chat sind im Vergleich zu ihren P2P-Pendants unhandlicher zu nutzen.
Nichtsdestoweniger war und ist das C/S-Konzept enorm erfolgreich, wie bspw.
Größe und Wachstumsrate das Internets beweisen; die Weiterentwicklung und
Leistungssteigerung bei Prozessorleistung, Speicherkapazität und
Netzwerktechnik
70
brachten jedoch das durch Client-Server verdrängte Peer-to-Peer
wieder zur Geltung und zeigten, dass dieses das Potenzial besitzt, Client-Server
teilweise zu verdrängen.
Zusammenfassung: In der vorliegenden Arbeit wird unter Client-Server ein Konzept
verstanden, bei dem Anbieter und Nachfrager dauerhaft unterschieden werden und
konzeptuell in ihren Rollen fest verankert sind; ein Nachfrager kann hier nie zu
einem Anbieter werden.
2.3.2 Peer-to-Peer-Konzept
Das Peer-to-Peer-Konzept bezeichnet wörtlich die Kommunikation von
,,Gleichgestelltem-zu-Gleichgestelltem"
71
, im Unterschied zur Trennung in Anbieter
und Nachfrager im C/S-Konzept. Diese Vorstellung bezieht sich darauf, dass alle
Netzwerkteilnehmer die gleichen Möglichkeiten haben, d.h. sowohl als
bereitstellender Server wie auch als empfangender Client agieren können. Peer-to-
Peer ist dabei einerseits als ein technisches Phänomen zu sehen, andererseits aber
auch als ein gesellschaftliches
72
.
Aus historischer Sicht stellt dieses Netzwerkparadigma die ursprüngliche
Philosophie des Internets dar
73
, die wegen begrenzter Ressourcen bei schnellen
Wachstumsanforderungen während des Internet-Booms aufgegeben wurde. Die
Musiktauschbörse Napster verhalf Peer-to-Peer Ende der 1990er Jahre in neuer
Form wieder zur Geltung, sowohl durch die beachtlichen Nutzerzahlen
74
als auch
durch das Aufzeigen der eingeschränkten Möglichkeiten der Musikindustrie, gegen
diese neue Bedrohung vorzugehen. Obwohl P2P aufgrund der Urheberrechts-
Problematik eine negative Konnotation erhielt, kam es zur Gründung einer Reihe
von P2P-Start-Up-Unternehmen und Entwicklungen in diesem Bereich; eine breite
Diskussion über die Möglichkeiten der Nutzung verteilter Ressourcen durch P2P
69
Vgl. Wollschläger (1993), S. 163-164.
70
Die Markteinführung von GHz-Prozessoren, GB-Festplatten und Gbps-Netzwerken in 1999 von Fattah als
,,Ankunft der drei Gigas" bezeichnet machte beachtliche Leistung allgemein verfügbar. Vgl. Fattah (2002),
S. 48-51.
71
Peer (engl.): Gleichgestellter, Ebenbürtiger.
72
Vgl. Becker / Hörning / van Deelen / Ziegler (2002), S. 29.
73
Der Internetvorläufer ARPANET hatte ein möglichst ausfallsicheres Computernetzwerk zum Ziel, das über
gleichberechtigte Knoten einen Informationsaustausch erlauben sollte.
74
Die maximale Nutzerzahl bewegte sich zwischen 40 Mio. und 80 Mio. Vgl. Fattah (2001), S.11 und Graham
(2001).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832467876
- ISBN (Paperback)
- 9783838667874
- DOI
- 10.3239/9783832467876
- Dateigröße
- 670 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Fakultät für Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Mai)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- video-on-demand wertschöpfungskette praxisbewertung medienbranche
- Produktsicherheit
- Diplom.de