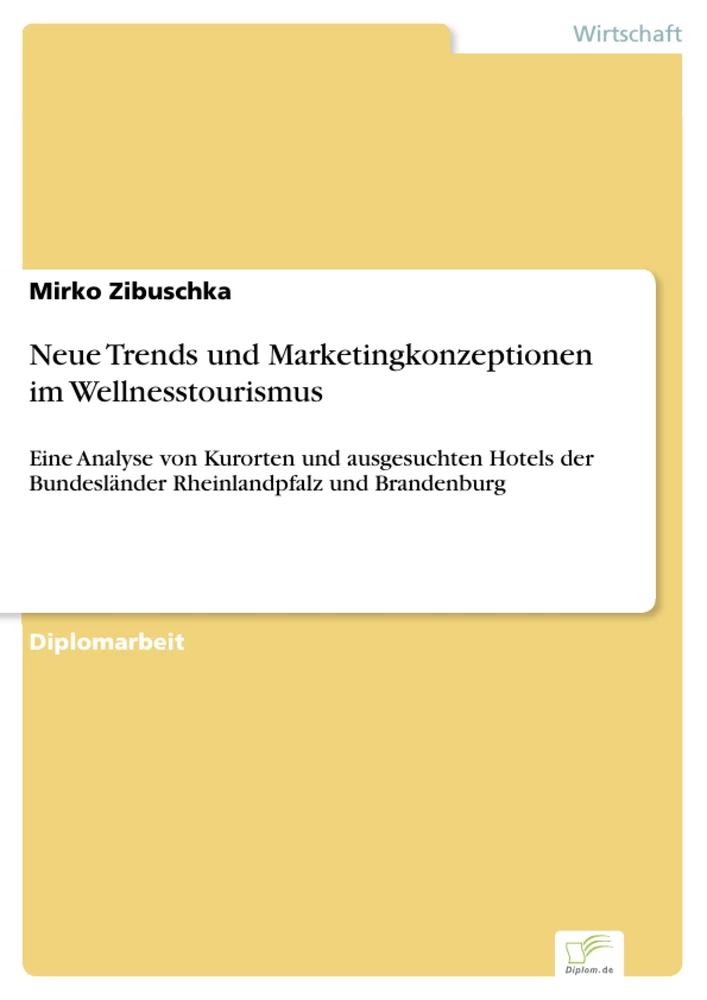Neue Trends und Marketingkonzeptionen im Wellnesstourismus
Eine Analyse von Kurorten und ausgesuchten Hotels der Bundesländer Rheinlandpfalz und Brandenburg
©2003
Diplomarbeit
189 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Wellness ist schon seit einigen Jahren ein Begriff, der nicht nur in der wissenschaftlichen Literatur immer häufiger Verwendung findet. Wellness ist in aller Munde und so hat sich auch ein eigenständiger touristischer Zweig - der Wellnesstourismus - entwickelt. Dieser Bereich befindet sich im Wachstum, nicht nur aus demographischen Gründen, sondern gerade weil der heutige Tourist immer neue und höhere Qualitätsanforderungen an die Tourismusbranche stellt.
Aus Fitness wird Wellness lautete in den achtziger Jahren eine Zukunftsprognose des Freizeitforschers Horst Opaschowski. Diese hat sich erfüllt: Der Mensch ist im Gesundheitsfieber und die Wellness-Welle breitet sich jenseits von Krankenhausimage, Sozialversicherung und chronischen Leiden immer weiter aus.
Wellness umfaßt ein breites Spektrum von Angeboten, unter denen sich traditionelle Heilkünste aus Asien, bewährte Bewegungstherapien und Wohlfühl-Wochenenden ebenso zusammenfassen lassen wie fettreduzierte Kost, sphärische Harfenklänge oder Ohrkerzen zur Entspannung. Wellness ist eine neue Lebensart, die auf leistungsorientierte, gestreßte Menschen zielt, die ihrem Alltag entfliehen möchten. Das Zukunftsinstitut in Frankfurt/Main erklärt Wellness zu einer gesellschaftlichen Bewegung, die sich durch aktive, gesundheitsbewußte Lebensführung auszeichnet. Ziel ist es, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.
Jeder fünfte geht im Urlaub auf die Suche nach Wellnessangeboten und möchte gezielt etwas für die eigene Gesundheit tun. Hochgerechnet ergibt sich eine Summe von rund zwölf Millionen potentiellen Wellness-Urlaubern, bei denen Sonne und mediterranes Flair eine untergeordnete Rolle spielen. In Deutschland haben 1,7 Prozent (ca. 1 Mio.) der Bevölkerung über 14 Jahren im Zeitraum von 1998 bis 2000 mindestens einmal einen Wellness-Urlaub gemacht. Zehn Prozent, das entspricht über zehn Mio. Bundesbürgern, planten im Jahr 2001, in den nächsten drei Jahren einen Wellness-Urlaub durchzuführen. Das Interesse an einem Wellness-Urlaub hat von dem Jahr 1999 bis 2002 um 125% zugenommen.
Schon die alten Römer würdigten den Einklang von Geist und Körper mit dem Ausspruch: Mens sana in corpore sano was so viel bedeutet wie Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und dieser Gedanke hat sich bis heute bewahrheitet. Wer sich gut fühlt, dem geht es auch gut - und umgekehrt. Gesund zu bleiben ist in vielen Bereichen nicht die Aufgabe des Arztes, sondern […]
Wellness ist schon seit einigen Jahren ein Begriff, der nicht nur in der wissenschaftlichen Literatur immer häufiger Verwendung findet. Wellness ist in aller Munde und so hat sich auch ein eigenständiger touristischer Zweig - der Wellnesstourismus - entwickelt. Dieser Bereich befindet sich im Wachstum, nicht nur aus demographischen Gründen, sondern gerade weil der heutige Tourist immer neue und höhere Qualitätsanforderungen an die Tourismusbranche stellt.
Aus Fitness wird Wellness lautete in den achtziger Jahren eine Zukunftsprognose des Freizeitforschers Horst Opaschowski. Diese hat sich erfüllt: Der Mensch ist im Gesundheitsfieber und die Wellness-Welle breitet sich jenseits von Krankenhausimage, Sozialversicherung und chronischen Leiden immer weiter aus.
Wellness umfaßt ein breites Spektrum von Angeboten, unter denen sich traditionelle Heilkünste aus Asien, bewährte Bewegungstherapien und Wohlfühl-Wochenenden ebenso zusammenfassen lassen wie fettreduzierte Kost, sphärische Harfenklänge oder Ohrkerzen zur Entspannung. Wellness ist eine neue Lebensart, die auf leistungsorientierte, gestreßte Menschen zielt, die ihrem Alltag entfliehen möchten. Das Zukunftsinstitut in Frankfurt/Main erklärt Wellness zu einer gesellschaftlichen Bewegung, die sich durch aktive, gesundheitsbewußte Lebensführung auszeichnet. Ziel ist es, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.
Jeder fünfte geht im Urlaub auf die Suche nach Wellnessangeboten und möchte gezielt etwas für die eigene Gesundheit tun. Hochgerechnet ergibt sich eine Summe von rund zwölf Millionen potentiellen Wellness-Urlaubern, bei denen Sonne und mediterranes Flair eine untergeordnete Rolle spielen. In Deutschland haben 1,7 Prozent (ca. 1 Mio.) der Bevölkerung über 14 Jahren im Zeitraum von 1998 bis 2000 mindestens einmal einen Wellness-Urlaub gemacht. Zehn Prozent, das entspricht über zehn Mio. Bundesbürgern, planten im Jahr 2001, in den nächsten drei Jahren einen Wellness-Urlaub durchzuführen. Das Interesse an einem Wellness-Urlaub hat von dem Jahr 1999 bis 2002 um 125% zugenommen.
Schon die alten Römer würdigten den Einklang von Geist und Körper mit dem Ausspruch: Mens sana in corpore sano was so viel bedeutet wie Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und dieser Gedanke hat sich bis heute bewahrheitet. Wer sich gut fühlt, dem geht es auch gut - und umgekehrt. Gesund zu bleiben ist in vielen Bereichen nicht die Aufgabe des Arztes, sondern […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6746
Zibuschka, Mirko: Neue Trends und Marketingkonzeptionen im Wellnesstourismus - Eine
Analyse von Kurorten und ausgesuchten Hotels der Bundesländer Rheinlandpfalz und
Brandenburg
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Trier, Universität, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
Vorwort
Tourismus und Marketing sind wichtige Bereiche meines Studiums und meiner außeruni-
versitären Aktivitäten. Trends stoßen bei mir auf ein besonderes Interesse, da diese aus der
Sicht des Marketings ein breites Spektrum an Handlungsalternativen eröffnen. In dieser
Arbeit sehe ich die Chance, neue Trends und Marketingkonzeptionen im Wellnesstouris-
mus zu analysieren und Schlußfolgerungen für die Fremdenverkehrspraxis zu gewinnen.
Ich habe durch den Forschungskreis Tourismus Management (FTM) an verschiedenen Pro-
jekten im Bereich Gesundheitstourismus mitgearbeitet und ein großes Interesse an dieser
Form des Tourismus gefunden. Aus diesem Grunde freut es mich besonders, daß mir Pro-
fessor Dr. Christoph Becker ein Diplomarbeitsthema mit den genannten Schwerpunkten
zur Bearbeitung anbot.
Wellness als eine Form des Gesundheitstourismus wird immer populärer und die Anzahl
der Wellnessangebote nimmt stark zu. Viele Anbieter, leider auch einige unseriöse, möch-
ten auf der Trendwelle ,,Wellness" mitschwimmen. Daher sind nicht alle Angebote adäquat
und werden dem Begriff ,,Wellness" und ,,Wellnesstourismus" gerecht. Was genau unter
diesen Termini zu verstehen ist, wie sich die Wellnessangebote und Dienstleistungen im
einzelnen unterscheiden und wie diese vermarktet werden, soll in der vorliegenden Arbeit
herausgestellt werden.
Für die Betreuung der Diplomarbeit und damit verbundenen Gesprächen danke ich Herrn
Professor Dr. Christoph Becker. Gleichermaßen bedanke ich mich bei Professor Dr. Rein-
hard Hoffmann für die Übernahme der Zweitkorrektur.
Bei meinen Gesprächsteilnehmern aus der Hotellerie und den Kurorten möchte ich mich
ganz herzlich für die Kooperationsbereitschaft und die sehr informativen Gespräche be-
danken.
Ebenso danke ich Tessa Randau, Forian Maas, Pascal Josch und Veit Kleeberg, die mich
bei der Fertigstellung der vorliegenden Diplomarbeit viele Stunden unterstützt haben.
Zum Schluß möchte ich mich bei meinen Eltern für die Unterstützung, im finanziellen und
ideellen Sinne, während meines Studiums und der Diplomarbeit bedanken.
Trier
im
Februar
2003 Mirko
Zibuschka
I
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
V
Kartenverzeichnis
V
Verzeichnis
der
Fotografien
VI
Abkürzungsverzeichnis
VIII
1. Einleitung...1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit...1
1.2 Aufbau und Inhalt der Arbeit ...3
2. Theoretische Grundlagen...5
2.1 Grundlagen des Wellnesstourismus ...5
2.1.1 Definition Trend ...5
2.1.2 Definition Tourismus...6
2.1.3 Definition Wellness ...7
1.2 Definition und Abgrenzung des Wellness-Tourismus ...10
2.2.1 Definition Gesundheitstourismus ...10
2.2.2 Definition Wellness-Tourismus...12
2.3 Das Produkt ,,Wellness"...14
2.3.1 Produktbestandteile und deren Träger...14
2.3.2 Produktspezifische Besonderheiten...15
2.4 Der Wellnessmarkt...16
2.4.1 Besonderheiten des Marktes...16
2.4.1.1 Das Wellnessangebot...17
2.4.1.2 Die Nachfrage im Verlauf der Geschichte...19
2.4.1.2.1 Die Entwicklung des Kurwesens in der BRD ...19
2.4.1.2.2 Die Entwicklung des Kurwesens in der DDR...21
2.4.1.2.3 Entwicklungen in Brandenburg nach der Wiedervereinigung ...21
2.5 Allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen ...22
2.6 Potentiale des Wellnesstourismus ...24
3. Grundlagen des Marketings im Wellnesstourismus ...27
3.1 Wesen und Bedeutung des Marketings ...27
3.1.1 Definition Marketing ...27
3.1.2 Einordnung des Tourismus-Marketing in das Modell des allgemeinen
Marketing ...29
3.2 Die Marketingkonzeption...32
3.2.1 Begriff und Inhalt der Marketingkonzeption...32
3.2.2 Funktion und Ziel der Marketingkonzeption...34
3.2.3 Kriterien zur Zielerfüllung der Marketingkonzeption...34
3.3 Strategische Marketingziele ...35
3.3.1 Strategische Unternehmensziele...35
3.3.2 Wesen und Arten von Marketingzielen...36
3.4 Die Marketingstrategie...38
3.4.1 Definition der Marketingstrategie ...38
3.4.2 Arten von Marketingstrategien...38
3.4.2.1 Marktfeldstrategie...38
3.4.2.2 Marktbearbeitungs- und Marktstimulierungsstrategie...39
3.4.2.3 Markteintrittsstrategie...40
3.4.2.4 Marktarealstrategie ...40
3.4.2.5 Kooperationsstrategie ...40
II
3.5 Strategisches Marketing-Mix ...41
3.5.1 Begriff und Bedeutung des Marketing-Mix ...41
3.5.2 Beziehungen zwischen den Marketinginstrumentarien...41
3.6 Taktisches und operatives Marketing...41
3.6.1 Taktisches Marketing als Gestaltung des Marketing-Mix...41
3.6.1.1 Produktpolitik ...41
3.6.1.1.1 Produktpolitische Grundsätze ...41
3.6.1.1.2 Produktgestaltung...42
3.6.1.1.3 Produktpositionierung ...42
3.6.1.2. Preispolitik ...44
3.6.1.3 Distributionspolitik ...45
3.6.1.4 Kommunikationspolitik ...45
3.6.2 Operatives Marketing ...47
3.6.2.1 Marketing-Implementierung...47
3.6.2.2 Controlling ...48
3.7 Neue Herausforderungen für das Marketing...48
3.7.1 Allgemeine neue Herausforderungen ...48
3.7.2 Chancen und Risiken der Internetnutzung ...49
4. Analyse der Kurorte und ausgesuchter Hotels mit Wellnessangebot in Rheinland-Pfalz
und Brandenburg...53
4.1 Allgemeine methodische Vorgehensweise ...53
4.2 Analyse der Kurorte in Rheinland-Pfalz ...56
4.2.1 Einzelanalyse der Kurorte ...56
4.2.1.1 Die Vorgehensweise ...56
4.2.1.2 Bad Bertrich...58
4.2.1.3 Kurort Traben-Trabach und Bad Wildstein ...59
4.2.1.4 Bad Sobernheim...61
4.2.1.5 Bad Münster am Stein-Ebernburg ...64
4.2.1.6 Bad Kreuznach...65
4.2.1.7 Bad Breisig ...68
4.2.1.8 Kurort Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig Bad Bodendorf ...69
4.2.1.9 Bad Marienberg ...71
4.2.1.10 Kurort Manderscheid ...73
4.2.1.11 Bad Ems...74
4.2.1.12 Bad Bergzabern...75
4.2.1.13 Bad Dürkheim...77
4.2.2 Gesamtanalyse der Kurorte ...79
4.2.2.1 Vorgehensweise ...79
4.2.2.2 Allgemeine Fragen...79
4.2.2.2.1 Zeitpunkt der Erstellung eines Wellnessangebotes...79
4.2.2.2.2 Wandel der Dienstleistungen ...80
4.2.2.2.3 Analyse der Konkurrenzsituation...80
4.2.2.2.4 Auswirkungen des 11.September 2001...81
4.2.2.3 Trends ...82
4.2.2.3.1 Neue Trends ...82
4.2.2.3.2 Alleinstellungsmerkmale der Kurorte ...83
4.2.2.3.3 Identifikation neuer Trends ...83
4.2.2.4 Gästestruktur...83
4.2.2.4.1 Die Aufenthaltsdauer der Wellnessgäste ...83
4.2.2.4.2 Frequentierung des Wellnessbereiches durch Tagesgäste ...84
4.2.2.4.3 Anteil des Wellnessumsatzes am Gesamtumsatz...85
4.2.2.4.4 Tagesausgaben der Wellnessurlauber ...85
III
4.2.2.4.5 Anteil der Frauen bei den Wellnessgästen ...85
4.2.2.4.6 Saisonale Schwankungen ...85
4.2.2.5 Produkte und Dienstleistungen ...85
4.2.2.6 Beschäftigungsstruktur ...86
4.2.2.6.1 Qualifikation der Beschäftigten ...86
4.2.2.6.2 Variationen in der Personalstärke ...86
4.2.2.7 Marketing und zukünftige Entwicklungen ...86
4.2.2.7.1 Allgemeine Umsetzung des Marketings ...86
4.2.2.7.2 Innenmarketing ...87
4.2.2.7.3 Internetmarketing ...87
4.2.2.7.4 Ausbau des Wellnessangebotes...88
4.2.2.7.5 Zukünftige Zielgruppen ...89
4.2.2.7.6 Chancen und Risiken des Wellnesstourismus...89
4.3 Analyse der Kurorte in Brandenburg ...89
4.3.1 Einzelanalyse der Kurorte ...89
4.3.1.1 Vorgehensweise ...89
4.3.1.2 Bad Liebenwerda ...91
4.3.1.3 Bad Freienwalde ...92
4.3.1.4 Kurort Buckow ...93
4.3.1.5 Bad Saarow-Pieskow ...95
4.3.1.6 Bad Wilsnack...97
4.3.1.7 Kurort Templin ...99
4.3.2 Gesamtanalyse der Kurorte ...100
4.3.2.1 Vorgehensweise ...100
4.3.2.2 Allgemeine Fragen...100
4.3.2.2.1 Zeitpunkt der Erstellung des Wellnessangebotes...100
4.3.2.2.2 Wandel der Dienstleistungen ...101
4.3.2.2.3 Analyse der Konkurrenzsituation...101
4.3.2.2.4 Auswirkungen des 11. September 2001...101
4.3.2.3 Trends ...103
4.3.2.3.1 Neue Trends ...103
4.3.2.3.2 Alleinstellungsmerkmale der Kurorte ...103
4.3.2.3.3 Identifikation neuer Trends ...104
4.3.2.4 Gästestruktur...104
4.3.2.4.1 Die Aufenthaltsdauer der Wellnessgäste ...104
4.3.2.4.2 Frequentierung des Wellnessbereiches durch Tagesgäste ...104
4.3.2.4.3 Anteil des Wellnessektors am Gesamtumsatz...105
4.3.2.4.4 Tagesausgaben der Wellnessurlauber ...106
4.3.2.4.5 Anteil der Frauen bei den Wellnessgästen ...106
4.3.2.4.6 Saisonelle Schwankungen...106
4.3.2.5 Produkte und Dienstleistungen ...106
4.3.2.6 Beschäftigungsstruktur ...106
4.3.2.7 Marketing und zukünftige Entwicklungen ...107
4.3.2.7.1 Allgemeine Umsetzung des Marketings ...107
4.3.2.7.2 Innenmarketing ...107
4.3.2.7.3 Internetmarketing ...107
4.3.2.7.4 Ausbau des Wellnessangebotes...108
4.3.2.7.5 Zukünftige Zielgruppen ...109
4.3.2.7.6 Chancen und Risiken des Wellnesstourismus...109
4.4 Analyse ausgesuchter Hotels mit Wellnessangebot in Rheinland-Pfalz und
Brandenburg...109
4.4.1 Einzelanalyse der Hotels ...109
IV
4.4.1.1 Die Vorgehensweise ...109
4.4.1.2 Dorint Sporthotel Biersdorf ...110
4.4.1.3 Hotel Zugbrücke ...111
4.4.1.4 Hotel Heinz ...113
4.4.1.5 Romantik Hotel zur Bleiche ...115
4.4.1.6 Dorint Sporthotel Waldbrunnen...116
4.4.1.7 Lindner Hotel & Therme Binshof...117
4.4.1.8 Hotel Bellevue ...119
4.4.1.9 Dorint Hotel Lahnstein ...120
4.4.1.10 Dorint Hotel & Resort Daun...122
4.4.1.11 Artotel Potsdam ...123
4.4.1.12 Land & Golfhotel Stromberg...124
4.4.2 Gesamtanalyse der Hotels ...125
4.4.2.1 Vorgehensweise ...125
4.4.2.2 Allgemeine Fragen...126
4.4.2.2.1 Zeitpunkt der Erstellung des Wellnessangebotes...126
4.4.2.2.2 Wandel der Dienstleistungen ...126
4.4.2.2.3 Analyse der Konkurrenzsituation...126
4.4.2.2.4 Auswirkungen des 11.September 2001...127
4.4.2.2.5 Organisationsstruktur der Hotels...128
4.4.2.3 Trends ...128
4.4.2.3.1 Neue Trends ...128
4.4.2.3.2 Alleinstellungsmerkmale der Hotels ...130
4.4.2.3.3 Identifikation neuer Trends ...130
4.4.2.4 Spezifische Merkmale der Wellnessgäste...131
4.4.2.4.1 Die Aufenthaltsdauer der Wellnessgäste ...131
4.4.2.4.2 Frequentierung des Wellnessbereiches durch Tagesgäste ...131
4.4.2.4.3 Anteil des Wellnessektors am Gesamtumsatz...132
4.4.2.4.4 Tagesausgaben der Wellnessbesucher ...133
4.4.2.4.5 Anteil der Frauen bei den Wellnessgästen ...133
4.4.2.4.6 Saisonale Schwankungen ...134
4.4.2.5 Produkte und Dienstleistungen ...134
4.4.2.6 Beschäftigungsstruktur ...134
4.4.2.6.1 Anzahl und Verteilung der Beschäftigten auf den Wellnessbereich 134
4.4.2.6.2 Qualifikation der Beschäftigten ...135
4.4.2.7 Marketing und zukünftige Entwicklungen ...136
4.4.2.7.1 Allgemeine Umsetzung des Marketings ...136
4.4.2.7.2 Innenmarketing ...136
4.4.2.7.3 Internetmarketing ...136
4.4.2.7.4 Ausbau des Wellnessangebotes...137
4.4.2.7.5 Zukünftige Zielgruppen ...138
4.4.2.7.6 Chancen und Risiken des Wellnesstourismus...138
5. Zusammenfassung ...139
6. Fazit ...142
7. Literaturverzeichnis ...144
8. Anhang...162
V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Konzeptioneller Aufbau der Arbeit ...4
Abbildung 2: Die Wortschöpfung ,,Wellness" ...8
Abbildung 3: Wellnesselemente ...9
Abbildung 4: Ausprägungen des Gesundheitstourismus ...12
Abbildung 5: Wellness mit verschiedenen Ausprägungen im touristischen Kontext ...13
Abbildung 6: Die langen Wellen der Konjunktur und ihrer Basisinnovationen...25
Abbildung 7: Tourismusmarketing...29
Abbildung 8: Ausprägungen des Tourismus-Marketing ...32
Abbildung 9: Marketing Konzeptionierungsprozeß ...33
Abbildung 10: Elemente einer Zielpyramide im Tourismus ...35
Abbildung 11: Produkt-Markt-Matrix ...38
Abbildung 12: Zufriedenheit bezüglich Auslastung und Umsatz vor dem 11.Sept. 2001 ..81
Abbildung 13: Auswirkungen auf den Umsatz nach dem 11.September ...81
Abbildung 14: Identifikation neuer Trends ...83
Abbildung 15: Anteil von Tagesgästen im Wellnessbereich...84
Abbildung 16: Gesammelte Erfahrungen mit dem Internet...88
Abbildung 17: Bereitschaft zum Ausbau des Wellnessangebotes...88
Abbildung 18: Zufriedenheit bezüglich Auslastung und Umsatz vor dem 11.Sept. 2001 102
Abbildung 19: Auswirkungen auf den Umsatz nach dem 11.September ...102
Abbildung 20: Anteil von Tagesgästen im Wellnessbereich...105
Abbildung 21: Umsatzverteilung...105
Abbildung 22: Gesammelte Erfahrungen mit dem Internet...108
Abbildung 23: Bereitschaft zum Ausbau des Wellnessangebotes...109
Abbildung 24: Zufriedenheit bezüglich Auslastung und Umsatz vor dem 11.Sept. 2001 127
Abbildung 25: Auswirkungen auf den Umsatz nach dem 11.September ...128
Abbildung 26: Unternehmensstruktur der Hotels...128
Abbildung 27: Identifikation neuer Trends ...131
Abbildung 28: Anteil von Tagesgästen im Wellnessbereich...132
Abbildung 29: Gesamtumsatzverteilung ...133
Abbildung 30: Anteil der Beschäftigten im Wellnessbereich ...135
Abbildung 31: Gesammelte Erfahrungen mit dem Internet...137
Abbildung 32: Bereitschaft zum Ausbau des Wellnessangebotes...138
Kartenverzeichnis
Karte 1: Die Lage von Rheinland-Pfalz und Brandenburg in der Bundesrepublik... 55
Karte 2: Erhebungsstandorte in Rheinland-Pfalz... 57
Karte 3: Erhebungsstandorte in Brandenburg... 90
VI
Verzeichnis der Fotografien
Foto 1 : Ansicht Bad Bertrich...59
Foto 2: Innenansicht Kurhotel Fürstenhof... 59
Foto 3: Kurhotel Parkschlößchen...61
Foto 4: Therme Traben-Trabach... 61
Foto 5: Therme Hotel Bollant´s...62
Foto 6: Therme Hotel Maasberg... 62
Foto 7: Felke Kurhaus Menschel... 62
Foto 8: Kurmittelhaus Bad Münster am Stein...64
Foto 9: Freiluftinhalatorium... 64
Foto 10: Parkhotel Kurhaus... 66
Foto 11: Laconicum des Bäderhauses...67
Foto 12: Innenansicht Bäderhaus... 67
Foto 13: Innenstadtansicht Kreuznach... 67
Foto 14: Römertherme... 68
Foto 15: Steigenberger Hotel... 70
Foto 16: Außenansicht Ahrtherme...70
Foto 17: Innenansicht Ahrtherme... 70
Foto 18: Außenansicht Marienbad... 72
Foto 19: Kurviertel Bad Ems... 74
Foto 20: Außenbereich Petronella Therme... 76
Foto 21: Dampfbad im Kurzentrum... 77
Foto 22: Kurparkhotel...78
Foto 23: Innenansicht Hotel Leininnger Hof ...78
Foto 24: Hotel Eduardshof... 92
Foto 25: Luftaufnahme Buckow... 93
Foto 26: Innenansicht Saarow Therme...96
Foto 27: Kurzentrum Bad Saarow... 96
Foto 28: Hotel & Resort Das Brandenburg Sporting Club Berlin... 96
Foto 29: Gradierwerk Bad Wilsnack...98
Foto 30: Edelsteinmeditationsraum der Therme... 98
Foto 31: Dampfbad der Naturtherme...99
Foto 32: Außenansicht Naturtherme... 99
Foto 33: Aqua Mares Aqua Therme...110
Foto 34: Außenansicht Dorint Hotel... 110
Foto 35: Außenansicht Hotel Zugbrücke...112
Foto 36: Whirlpool des Hotels... 112
Foto 37: Außenansicht Hotel Heinz...114
Foto 38: Auro-Soma Fläschchen... 114
Foto 39: Wabi Sabi... 115
Foto 40: Schwimmbad Dorint Waldbrunnen...116
Foto 41: Dampfbad Dorint Waldbrunnen... 116
Foto 42: Rasulbad im Wellnessbereich...118
Foto 43: Außenbereich des Hotels... 118
Foto 44: Außenansicht Hotel Bellevue... 120
Foto 45: Kurpark des Hotels...121
Foto 46: Thermalspa... 121
Foto 47: Schwimmbad des Hotels...122
Foto 48: Außenansicht Dorint Daun... 122
VII
Foto 49: Ansicht Artotel... 124
Foto 50: Land & Golfhotel Stromberg...125
Foto 51: Schwimmbad... 125
VIII
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
Aufl.
Auflage
B.A.T.
British American Tobacco Freizeitforschungsinstitut
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
DBV
Deutscher Bäderverband e.V.
DFV
Deutscher Fremdenverkehrsverband e.V.
d.h.
das
heißt
DHV
Deutscher Heilbäderverband e.V.
DSF
Deutsches Seminar für Fremdenverkehr e.V.
DTV
Deutscher Tourismusverband e.V.
DWV
Deutscher Wellness-Verband
DZT
Deutsche Zentrale für Tourismus
ETI
Europäisches Tourismus Institut GmbH an der Universität Trier
f. folgende
(Seite)
FIF
Forschungsinstitut für Freizeit und Touristik
FTM
Forschungskreis Tourismus Management
F.U.R.
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.
Hrsg.
Herausgeber
IFKA
Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit
ITB
Internationale Tourismus Börse
Jg.
Jahrgang
Mio.
Millionen
Mrd.
Milliarden
N.I.T.
Institut für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH
o. J.
ohne Jahresangabe
o. O.
ohne Ortsangabe
o. S.
ohne Seitenangabe
o. V.
ohne Verfasserangabe
RA
Reiseanalyse
Reha
Rehabilitation
S. Seite
TCM
Traditionelle Chinesische Medizin
IX
TQM
Total Quality Management
TUI
Touristik Union International
u.a.
unter
anderem
u.s.w.
und so weiter
vgl.
vergleiche
USP
Unique Selling Proposition
WHO
World Health Organisation
WTO
World Trade Organisation
z. B.
zum Beispiel
zit.
zitiert
% Prozent
1. Einleitung
1
1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
,,Wellness" ist schon seit einigen Jahren ein Begriff, der nicht nur in der wissenschaftlichen
Literatur immer häufiger Verwendung findet. ,,Wellness" ist in aller Munde und so hat sich
auch ein eigenständiger touristischer Zweig - der Wellnesstourismus - entwickelt. Dieser
Bereich befindet sich im Wachstum, nicht nur aus demographischen Gründen, sondern
gerade weil der heutige Tourist immer neue und höhere Qualitätsanforderungen an die
Tourismusbranche stellt.
Aus ,,Fitness" wird ,,Wellness" lautete in den achtziger Jahren eine Zukunftsprognose des
Freizeitforschers Horst Opaschowski (vgl. Opaschowski 1987, S.34). Diese hat sich erfüllt:
Der Mensch ist im Gesundheitsfieber und die Wellness-Welle breitet sich jenseits von
Krankenhausimage, Sozialversicherung und chronischen Leiden immer weiter aus (vgl.
Opaschowski 2000, S.10).
Wellness umfaßt ein breites Spektrum von Angeboten, unter denen sich traditionelle Heil-
künste aus Asien, bewährte Bewegungstherapien und Wohlfühl-Wochenenden ebenso zu-
sammenfassen lassen wie fettreduzierte Kost, sphärische Harfenklänge oder Ohrkerzen zur
Entspannung. Wellness ist eine neue Lebensart, die auf leistungsorientierte, gestreßte Men-
schen zielt, die ihrem Alltag entfliehen möchten. Das Zukunftsinstitut in Frankfurt/Main
erklärt ,,Wellness" zu einer gesellschaftlichen Bewegung, die sich durch aktive, gesund-
heitsbewußte Lebensführung auszeichnet. Ziel ist es, Körper, Geist und Seele in Einklang
zu bringen (vgl. Rahlfes 2002, S.28).
Jeder fünfte geht im Urlaub auf die Suche nach Wellnessangeboten und möchte gezielt
etwas für die eigene Gesundheit tun. Hochgerechnet ergibt sich eine Summe von rund
zwölf Millionen potentiellen Wellness-Urlaubern, bei denen Sonne und mediterranes Flair
eine untergeordnete Rolle spielen (vgl. Opaschowski 2000, S.10). In Deutschland haben
1,7 Prozent (ca. 1 Mio.) der Bevölkerung über 14 Jahren im Zeitraum von 1998 bis 2000
mindestens einmal einen Wellness-Urlaub gemacht. Zehn Prozent, das entspricht über zehn
Mio. Bundesbürgern, planten im Jahr 2001, in den nächsten drei Jahren einen Wellness-
Urlaub durchzuführen (vgl. Reiseanalyse
1
der F.U.R. 2002a, zit. in: Daniels-
1
In der Reiseanalyse werden zu Beginn jeden Jahres ca. 7.500 Deutsche zu ihrem Urlaubs- und
Reiseverhaltens befragt. Ein Baustein dieser Untersuchung stellt der Gesundheitstourismus dar.
1. Einleitung
2
er verglichen.
son/Seelig/Rogmann 2002, S.35). Das Interesse an einem Wellness-Urlaub hat von dem
Jahr 1999 bis 2002 um 125% zugenommen (vgl. F.U.R. 2002b, S.7).
Schon die alten Römer würdigten den Einklang von Geist und Körper mit dem Ausspruch:
,,Mens sana in corpore sano" was so viel bedeutet wie
,,Ein gesunder Geist in einem ge-
sunden Körper". Und dieser Gedanke hat sich bis heute bewahrheitet. Wer sich gut fühlt,
dem geht es auch gut - und umgekehrt. Gesund zu bleiben ist in vielen Bereichen nicht die
Aufgabe des Arztes, sondern obliegt der Verantwortung des Einzelnen. Viele Leiden, vor
allem die Zivilisationskrankheiten
2
entstehen aus einem ,,Zuviel". Durch richtige Ernäh-
rung und entsprechender Bewegung lassen sie sich größten Teils vermeiden
(vgl.Vollmer/Riebensahm 2000, S.9f). Dies ist in das Bewußtsein der Menschen gerückt
und so zeigte sich in den letzten Jahren ein klarer Trend: Der Wunsch nach Fitness, Wohl-
befinden und Wellness. Hier tat sich eine Chance für die Tourismusbranche auf - es hieß
den Zeitgeist einzufangen und im Marketing umzusetzen (vgl. Scheftschik 2000, S.82).
Inzwischen stellen sich ganze Regionen auf diesen Trend ein. Die Bäderdreiecke im
Chiemgau und Tirol sind nur einige Beispiele, die sich dem ganzheitlichen Wohlbefinden
widmen (vgl. Schmidt 2000, o. S.).
Ziel dieser Arbeit ist es ,,Neue Trends" im Wellnesstourismus zu identifizieren und zu ana-
lysieren. Dabei stellt sich die Frage, ob nur ,,alter Wein in neuen Schläuchen" verkauft
wird, oder ob es sich wirklich um ,,Neuerungen" handelt, bzw. eine Kombination von alten
und neuen Behandlungsarten. Desweiteren widmet sich die folgende Untersuchung dem
Aspekt, wie und durch wen diese neuen Trends entstehen und wie sich diese im Markt
verbreiten. Hier wird die Verzahnung mit dem Marketing relevant und somit ist das
Marketing ein weiterer wichtiger Baustein dieser Arbeit. Folglich werden die
verschiedenen Marketingkonzeptionen zahlreicher touristischer Anbieter untersucht und
miteinand
Dabei treten wichtige Fragen auf, die es zu klären gilt, wie z. B. ,,Welche Auswirkungen
haben die Ereignisse des 11. Septembers 2001 auf den Deutschlandtourismus?", ,,Besteht
eine Konkurrenz zwischen privaten den kommunalen Wellnessanbietern?", ,,Ist das Perso-
nal im Wellnessbereich gut ausgebildet und hoch qualifiziert?". Desweiteren sind für diese
Arbeit folgende Punkte von Interesse: Die Analyse von Alleinstellungsmerkmalen
3
, die
Konkurrenzsituation im Ort und Umland, die Zufriedenheit der Wellnessanbieter bezüglich
2
Zu diesen zählen: Übergewicht, Bluthochdruck, Allergien, Bewegungsmangel u.v.a..
3
Die Begriffe Alleinstellungsmerkmal und Unique Selling Proposition (USP) werden in dieser
Arbeit synonym verwendet.
1. Einleitung
3
der Auslastung und des Umsatzes, die Beschäftigungsstruktur und die Nutzung neuer Me-
dien.
1.2 Aufbau und Inhalt der Arbeit
Diese Arbeit ist in sechs Teilkomplexe gegliedert. Gegenstand des ersten Kapitels - der
Einleitung - ist es die Themenwahl zu begründen und Zielsetzung sowie Aufbau der vor-
liegenden Arbeit zu erläutern.
Im zweiten Teil werden die theoretischen Grundlagen erläutert. Termini wie ,,Trend",
,,Tourismus" und ,,Wellness" werden erörtert. In einem zweiten Schritt wird der Begriff
,,Wellness-Tourismus" definiert und von anderen Arten des Tourismus abgegrenzt. Zudem
wird die Entwicklung des Gesundheitswesens in der BRD und der DDR erläutert. Diese
Erklärung ist wichtig, damit deutlich wird, wie die teilweise erheblichen Differenzen im
Wellness-Tourismus zwischen Rheinland-Pfalz und Brandenburg entstehen konnten.
Im dritten Kapitel wird auf die Grundlagen des Marketings im Wellnesstourismus einge-
gangen. Hier sind eine Vielzahl von Handlungsalternativen zu erläutern, die in der Analyse
(vierter Teil) wieder aufgegriffen werden. Dieser Marketingkomplex zeigt unter anderem
die Chancen und Risiken durch die Nutzung ,,neuer Medien" auf. Anhand der Kombinati-
on der Bereiche ,,Marketing", ,,Trends" und ,,neue Medien" besteht die Möglichkeit zu
analysieren, wie neue Trends generiert - und mit Hilfe welcher Medien diese vermarktet
werden. Dies ist besonders im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen im Wellnesstouris-
mus sehr interessant.
Der vierte Teil - die Analyse - ist der Schwerpunkt der vorliegenden Studie. Hier werden
zunächst die empirischen Grundlagen und die statistische Vorgehensweise erläutert. An-
schließend werden die Kurorte sowie ausgesuchte Hotels von Rheinland-Pfalz und Bran-
denburg vorgestellt. Zuletzt folgt eine Auswertung der vorliegenden Daten. Die empiri-
schen Erhebungen wurden im Rahmen von Expertengesprächen durchgeführt. Gesprächs-
partner waren: Vertreter der Kurorte
4
, Hotelbetreiber und Vertreter touristischer Institutio-
nen auf Landesebene. Eine umfangreiche Auswertung von Prospekt- und Informationsma-
terial untermauert die Ergebnisse der Expertengespräche. Für ein besseres Verständnis des
Untersuchungsgegenstandes wird ein Überblick über Aufbau und Methodik der vorliegen-
den Studie gegeben.
4
In dieser Arbeit wird zusammenfassend von Kurorten gesprochen, dies schließt die höher zertifi-
zierten Heilbäder mit ein.
1. Einleitung
4
Abbildung 1: Konzeptioneller Aufbau der Arbeit
Neue Trends
und Marketing-
konzeptionen in Kurorten
Expertengespräche und ausgesuchten Hotelbetrieben
Umsetzung des
Marketings Grundlagen des
Marketings
Erkennen und und des Wellnesstourismus
generieren der Trends
Qualitative
Auswertung der
Kurorte und
Hotels
Literatur-, Internet-
und Prospektauswer-
tung
Quelle: Eigene Darstellung
Zunächst wurde eine ausführliche Literaturauswertung zu den Themen Wellness, Trends
und Marketing durchgeführt. Die Literaturauswertung erfolgte parallel zur Internetrecher-
che, mit deren Hilfe die Kurorte
5
und Hotels mit Wellnessangebot
6
ermittelt wurden. Im
Anschluß erfolgte die Prospektauswertung und die qualitative Auswertung der untersuch-
ten Kurorte und Hotelbetriebe, basierend auf 33 Expertengesprächen und der eigenen sub-
jektiven Beobachtungen. Im Zusammenhang mit dem Begriff ,,Wellness" werden Fach-
termini verwendet, die im Wellness-Lexikon im Anhang erläutert werden.
5
In Rheinland-Pfalz gibt es 23 Kurorte, in Brandenburg sechs.
6
Insgesamt wurden elf Hotels mit Wellnessangebot untersucht.
2. Theoretische Grundlagen
5
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Grundlagen des Wellnesstourismus
2.1.1 Definition Trend
Das Wort ,,Trend" ist ein sehr häufig gebrauchter Begriff in der deutschen Sprache. Was
versteht man aber unter einem Trend und wer macht Trends? Auf diese Frage gibt der Zu-
kunftsforscher Matthias Horx mehrere Antworten. Ein Trend kann sich auf einen Kontext
der Mode, oder auch auf den Wertewandel beziehen, wobei im Kern bei beiden Erklärun-
gen die gleiche Ursache zu Grunde liegt. Auf der kulturellen Ebene zerbricht in den frühen
achtziger Jahren das Koordinationssystem, die ,,gesellschaftlichen Steuereinheiten", das
alles ordnete. In den Sechzigern und Siebzigern gab es noch dieses System, welches auch
den Kulturprozeß über Jahrhunderte bestimmte. Es existierte eine Differenz zwischen
Hoch- und Populärkultur. In den Neunzigern, zu Beginn der postmodernen Ära kam es zu
einer fortschreitenden Individualisierung, zu dem Generationenkonflikt, mit dem damit
verbundenen Bedeutungsverlust der Familie und vielen anderen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen (vgl. Horx/Wippermann 1996, S.12f).
In der heutigen Welt werden wir oft mit Prozessen konfrontiert, die wir spüren, allerdings
nicht ausmachen können. Wie auf eine geheime Weisung hin geschehen merkwürdige
Dinge. Scheidungsraten nehmen zu, politische Parteien verlieren ihre Anhänger, Institutio-
nen verlieren ihre Bedeutung, Schwarz ist ,,IN", jeder reist auf die Antillen (vgl.
Horx/Wippermann 1996, S.20). ,,Wie von Geisterhand getrieben verändern sich Märkte
und Mengen, Paradigmen und Moralvorstellungen. Das ist gewissermaßen die magische
Substanz der Trends..." (Horx/Wippermann 1996, S.20)
Man kann Trends definieren als ,,hochkomplexe, selbststeuernde (autopoietische) dynami-
sche Prozesse in der modernen Individualgesellschaft." (Horx/Wippermann 1996, S.21)
Es gibt speziellere Ausprägungen von Trends, so zum Beispiel die ,,Konsumenten-Trends",
welche für diese Arbeit von besonderem Interesse sind.
,,Konsumenten-Trends bezeichnet diejenige Trend-Kategorie, die vor allem das Kaufver-
halten, die Marketing- und Produktkonzeptionen betrifft." (Horx 1996, S.14)
Es sind Trends auszumachen, die sowohl von Seite der Konsumenten, als auch der Produ-
zenten induziert werden können.
So beschreibt Horx bei dem ,,Authentic-Trend" die Suche des Konsumenten nach dem
echten, individuellen und glaubwürdigen Produkt mit Ursprung und Originalität. ,,Prosu-
2. Theoretische Grundlagen
6
ming" ist die immer weitergehende ,,Individualschneiderung" von Produkten auf den ein-
zelnen Konsumenten (z. B. individuelle Parfums) durch die Unternehmen (vgl. Horx 1996,
S.14f).
7
Es gibt vier Phasen, die durchlaufen werden, um einen Trend als solchen zu identi-
fizieren.
Phase 1: Die Semiotik
In dieser Phase der Trendanalyse wird nach wiederkehrenden Merkmalen gesucht, welche
sich als Trend entpuppen könnten.
Phase 2: Die Beweisführung
In der zweiten Phase wird das via Semiotik entdeckte Phänomen durch Statistiken gestützt
oder widerlegt.
Phase 3: Der ökonomische Abgleich
Hier wird kontrolliert, ob der Trend in Marketingkonzepte übertragbar ist.
Phase 4: Das ,,Naming"
Es werden einprägsame Namen gesucht, sogenannte ,,Magic words", welche sich gut ver-
markten lassen (vgl. Horx/Wippermann 1996, S.51f).
Die Ermittlung und Beschreibung von Trends, ist eine wichtige Komponente bei der Er-
stellung eines nachfragegerechten touristischen Angebotes und dessen erfolgreichen Ver-
marktung (vgl. Brittner/Kolb/Steen 1999, S.33).
2.1.2 Definition Tourismus
Zum Teil liegen unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung der Begriffe ,,Reise-
verkehr", ,,Tourismus", ,,Fremdenverkehr" und ,,Touristik" vor, es hat sich aber gezeigt,
daß diese Begriffe synonym gebraucht werden können (vgl. Opaschowski 2002, S.21). ,,Im
Einzelfall ist es jedoch erforderlich, durch weitere Spezifizierung auf einzelne Aspekte des
Reiseverkehrs/Tourismus/Fremdenverkehrs/Touristik hinzuweisen, wie zum Beispiel Inco-
ming-, Outgoing-Tourismus oder der Motivation des Reisens, zum Beispiel Geschäfts- oder
Erholungstourismus, oder der technische Transport- beziehungsweise Vermittlungs-
schwerpunkt." (Freyer 1995, S. 406)
Somit werden diese Begriffe auch in dieser Arbeit synonym verwendet.
7
Wenn in diesen Fällen eine ,,Innovation" vorläge, das heißt, auf einen Markt würden technologi-
sche oder produktspezifische Neuerungen generiert, und diese Innovation
entstünde aus einem
Nachfragesog, könnte man aus Marketingsicht von einer ,,Demand Pull-Innovation" sprechen (vgl.
Weiber/Adler 2001, S.56).
2. Theoretische Grundlagen
7
Es folgen nun zwei Definitionen des Fremdenverkehrs, bei denen allerdings unterschiedli-
che Schwerpunkte gesetzt werden:
Für Freyer ist Fremdenverkehr ,,der Innenbegriff der Beziehungen und Erscheinungen, die
sich aus dem Aufenthalt Ortsfremder ergeben, sofern durch den Aufenthalt keine Nieder-
lassung zur Ausübung einer dauernden oder zeitweilig hauptsächlichen Erwerbstätigkeit
begründet wird." (Freyer 1993, S. 15)
Bei dieser Definition liegt der Schwerpunkt auf den Motivationsgründen des Aufenthaltes,
der Aspekt der Aufenthaltsdauer wird nicht berücksichtigt. Es ergeben sich nach Freyer
nur fremdenverkehrsbezogene Erscheinungen, wenn der Zielort weder als Wohnort noch
zu vorwiegend berufsausübenden Zwecken bereist wird.
Auf einer Konferenz der Welt Tourismus Organisation (WTO) 1991 in Ottawa/Kanada
wurde eine allgemeine Definition für den Terminus ,,Tourismus" erstellt. Demnach be-
zeichnet Tourismus ,,die Aktivitäten von Personen, die sich an Orte außerhalb ihrer ge-
wohnten Umgebung begeben und sich dort nicht länger als ein Jahr zu Freizeits-, Ge-
schäfts- und anderen Zwecken aufhalten, wobei der Hauptreisezweck ein anderer ist als
die Ausübung einer Tätigkeit, die vom besuchten Ort aus vergütet wird." (Opaschowski
2002, S.21f)
Durch die Umschreibung ,,der gewohnten Umgebung" werden Reisen am Wohnort und
Routinereisen ausgeschlossen. Die Aufenthaltsdauer wird mit ,,nicht länger als ein Jahr"
berücksichtigt und schließt somit langfristige Wanderungen aus. Kurzfristige Wanderun-
gen zur vorübergehenden Arbeitsausübung werden durch den letzten Teil des zitierten Sat-
zes von der Betrachtung ausgenommen (vgl. Opaschowski 2002, S.22). Im Gegensatz zu
Freyer wird eine zeitliche Komponente bei der Definition des Tourismus mit einbezogen.
Aus diesem Grunde wird die Definition der WTO für die vorliegende Arbeit zugrunde ge-
legt.
2.1.3 Definition Wellness
Der Begriff ,,Wellness"
8
stammt aus den USA und ist von Wissenschaftlern des nordame-
rikanischen Gesundheitswesens entwickelt worden. Der Sozialmediziner Halbert L. Dunn
hatte den Begriff 1961 in seiner Publikation ,,High Level Wellness"
9
durch die Kombinati-
on der Wörter Fitness und Well-being
10
, geprägt (vgl. Nahrstedt 1999a, S.53). Er schreibt
8
Zu Deutsch: Wohlbefinden.
9
Zu Deutsch: Wellness auf hohem Niveau.
10
Zu Deutsch: wohlfühlen.
2. Theoretische Grundlagen
8
über einen Zustand hohen menschlichen Wohlbefindens im Sinne eines Systems, welches
den Menschen bestehend aus Körper, Seele und Geist, in Abhängigkeit von seiner Umwelt,
versteht. Diesen Zustand ,,großer persönlicher Zufriedenheit" nennt Dunn ,,high level
wellness" (vgl. Dunn 1961, zit. in Ardell 1986, S.5). Dunn legte damit den Grundstein für
die amerikanische Wellness-Bewegung der siebziger Jahre (vgl. Verbraucherzentrale
NRW
11
2001, S. 10).
In der Wortkombination wurden zwei Bewegungen zusammengefaßt. Well-being wurde
1948 Ausdruck der neuen Gesundheitsdefinition der WHO. Fitness kennzeichnete in den
USA seit den fünfziger Jahren die neue ,,sport for all" Bewegung, die diesem Gesundheits-
begriff dienen sollte. In Deutschland wurde in den siebziger Jahren die ,,sport for all" Be-
wegung von dem Deutschen Sportbund als Trimm-Dich-Bewegung übernommen (vgl.
Nahrstedt 1999b, S.367).
Abbildung 2: Die Wortschöpfung ,,Wellness"
Well-being Well-ness Fit-ness
1948 1961
1953
WHO DUNN Sport for all
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Nahrstedt 2000, S.98
Es existiert eine Vielzahl von Abgrenzungen des Begriffes ,,Wellness". Zudem besteht im
internationalen Bereich ein unterschiedliches Begriffsverständnis bezüglich dieses Begrif-
fes.
12
Aus diesem Grunde werden zwei im deutschen Sprachraum gebräuchliche Definitio-
nen vorgestellt, welche den Begriff zum einen im ,,engen" und zum anderen im ,,weiten
Sinn" beschreiben. Evelin Lanz Kaufmann entwickelte eine Definition im engen Sinn, für
die Autorin ist Wellness ,,... ein Gesundheitszustand der Harmonie von Körper, Geist und
Seele. Wesensbestimmte Elemente sind Selbstverantwortung, Fitness und Körperpflege,
gesunde Ernährung, Entspannung, geistige Aktivität/Bildung sowie soziale Beziehungen
und Umweltsensibilität." (Lanz Kaufmann 2002, S.22) Bei dieser Abgrenzung wird die
körperliche Fitness vorausgesetzt. Dies ist bei der Definition von Mairinger (Damp Touri-
stik GmbH) nicht der Fall. In Damp wird der Begriff Wellness bei der gesamten Klientel
11
Nordrhein-Westfalen wird vereinfachend mit NRW abgekürzt.
12
Im englischen Sprachraum wird der Begriff ,,Wellness", im Gegensatz zu unserem Sprachraum,
kaum mit Tourismus in Zusammenhang gebracht. In den USA wird das deutsche Verständnis von
Wellness mit dem Begriff ,,Spa" assoziiert. Ausführlich zum Begriffsverständis von ,,Wellness" auf
internationaler Ebene (vgl. Lanz Kaufmann 2002, S. 32f).
2. Theoretische Grundlagen
9
(Patienten und Touristen) zur Anwendung gebracht. ,,Wellness wird bei uns schlicht und
einfach so definiert, dass es der Weg von einem Stadium in ein besseres Stadium ist (flow).
Dies trifft selbstverständlich für Touristen wie Patienten zu, auch ein kranker Mensch kann
Wellness (Wohlbefinden) empfinden, selbst dann, wenn seine Krankheit nicht geheilt wer-
den kann, nur seine Situation und sein Wohlbefinden verbessert wird." (Mairinger 1999,
S.160)
Die Definition nach Mairinger ist durch einen dominanten medizinischen Aspekt geprägt.
Eine Unterscheidung von Kur-
13
und Wellnessangeboten würde nach dieser Definition
recht kompliziert. Daher wird in der vorliegenden Arbeit die Definition von Lanz Kauf-
mann zugrunde gelegt, da durch diese eine eindeutigere Abgrenzung vom Kur- und ande-
ren Arten des Gesundheitstourismus möglich ist. Diese Abgrenzung hat für die vorliegende
Arbeit einen hohen Stellenwert. Wellness stellt ein vielschichtiges Phänomen dar, welches
aus mehreren Elementen besteht. In der folgenden Abbildung nimmt die Wichtigkeit dieser
Elemente vom Rand des Kreises zum Zentrum hin zu.
Abbildung 3: Wellnesselemente
Soziale Beziehungen
Gesunde Ernährung
Geistige Selbst- Körper-
Aktivität verantwortung liche
Fitness
Entspannung
Umweltsensibilität
Quelle: Lanz Kaufmann 1999, S.37 (in Anlehnung an Ardell 1986, S.324)
2. Theoretische Grundlagen
10
9a, S.53f).
Für den Begriff ,,Wellness" sind zudem folgende Merkmale zutreffend:
· Gesundheit im Sinne von ,,Wellness" (Wohlbefinden) hat einen eigenständigen, in sich
steigerungsfähigen Wert.
· Der Begriff ,,Wohlbefinden" (WHO 1948) wird als Zustand eines vollkommenen kör-
perlichen, seelisch, geistigen und sozialen Wohlbefindens definiert. Fitness ist für das
körperliche Wohlbefinden eine Voraussetzung, die Begriffe Ernährung und Beauty
wurden hinzufügt. Voraussetzungen für das seelisch-geistige und soziales Wohlbefin-
den sind Entspannung, geistige Aktivität und Umweltsensibilität.
· Gesundheit wird dadurch von dem Begriff Krankheit abgekoppelt. Gesundheit ist mehr
als Abwesenheit von Krankheit und Gebrechlichkeit.
· Gesundheit geht in die Selbstverantwortung und den Lebensstils des Einzelnen über.
Ärzte und Gesundheitsfachleute werden zu Beratern.
· Das Modell Wellness wird durch asiatische Gesundheitsansätze ergänzt (Ayurveda,
Yoga, Tai Chi, Qi Gong
14
etc.). Es tritt eine Art Globalisierung des Gesundheitsver-
ständnisses ein.
· Freizeit und der Tourismus sind die Zielbereiche, in denen sich das neue
Gesundheitsverständnis ,,Wellness" etablieren kann (vgl. Nahrstedt 199
1.2 Definition und Abgrenzung des Wellness-Tourismus
Wie auch bei den zuvor erläuterten Begriffen ,,Wellness" und ,,Tourismus" existieren eine
Vielzahl von Vorstellungen über die Begriffe ,,Wellness-Tourismus", ,,Gesundheitstouris-
mus" und ,,Kur". Aus diesem Grunde werden diese zunächst definiert und anschließend
voneinander abgegrenzt.
2.2.1 Definition Gesundheitstourismus
Der Gesundheitstourismus - als eigenständige Form des Tourismus - ist inhaltlich schwer
abzugrenzen, da dieser ein weites Spektrum unterschiedlicher Teilaspekte beinhaltet (vgl.
Brittner/Kolb/Steen 1999, S.15).
13
Der Begriff Kur stammt von dem lateinischen Wort ,,cura" ab, welches Sorge bedeutet (vgl. Das
moderne Lexikon 1971, S.373).
14
Im Anhang der Arbeit ist ein Wellness-Lexikon zu finden, welches die Erklärungen von Fachbe-
griffen, die im Bezug zu ,,Wellness" stehen, beinhaltet.
2. Theoretische Grundlagen
11
Nach Kaspar ist Gesundheitstourismus die ,,Gesamtheit der Beziehungen und Erscheinun-
gen, die sich aus der Ortsveränderung und dem Aufenthalt von Personen zur Förderung,
Stabilisierung und gegebenenfalls Wiederherstellung des körperlichen, geistigen und so-
zialen Wohlbefindens unter der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ergeben, für
die der Aufenthaltsort weder hauptsächlicher noch dauernder Wohn- und Arbeitsort ist."
(Kaspar 1996b, S.56)
Somit stehen bei dem Gesundheitstourismus, im Gegensatz zu dem ,,normalen" Urlaub,
Gesundheitsdienstleistungen im Vordergrund (vgl. Müller/Lanz Kaufmann 1999, S.82).
Der Gesundheitstourismus läßt sich zum einen in den Gesundheitsvorsorgetourismus und
den Kur- und Rehabilitationstourismus unterteilen. Der Gesundheitsvorsorgetourismus
kann wiederum in den spezifischen Gesundheitsvorsorgetourismus und dem Wellness-
Tourismus unterteilt werden (vgl. Müller/Lanz 1998, S.481).
Der Wellness-Tourismus stellt daher eine Unterkategorie des Gesundheitstourismus dar
(vgl. Lanz Kaufmann 2002, S.49).
Die Kur, als eine weitere Unterkategorie des Gesundheitstourismus, wird definiert als
komplexe, ärztlich geleitete Übungsbehandlung zur Rehabilitation, aber auch zur Präventi-
on, von chronischen Krankheiten und Leiden. Die Kur nutzt interdisziplinär verschiedene
Therapieformen, in deren Mittelpunkt natürliche Heilmittel stehen und dauert in der Regel
drei Wochen (vgl. DBV
15
/DFV 1991, S. 57). Die Kur wird zumeist von erkrankten Perso-
nen in Anspruch genommen, während der Gesundheitsvorsorgetourismus von gesunden
Personen nachgefragt wird, welche ihre Gesundheit fördern möchten (vgl. Müller/Lanz
1998, S.481).
15
Der Deutsche Bäderverband e.V. (DBV) hat sich im Jahre 1999 aufgelöst und in den Deutschen
Heilbäderverband e.V. (DHV) umbenannt.
2. Theoretische Grundlagen
12
Abbildung 4: Ausprägungen des Gesundheitstourismus
Gesundheitstourismus
gesund krank
Gesundheitsvorsorge-
Kur/
tourismus Rehabilitationstourismus
Spezifische Gesundheits- Wellnesstourismus
fürsorge
Einzelne
Wellness
Medizinische
Gesundheitsleistungen Leistungen Leistungen
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Müller/Lanz 1998, S.482
Es gibt auch Autoren, die den Gesundheitsurlaub, da dieser selbst finanziert ist, aufgrund
dieses Merkmals von der Kur abgrenzen (vgl. Dehmer 1996, S. 5). In diesem Fall wären
allerdings Privatkurgäste, das heißt Gäste, die ihre Kur selbst finanzieren, gleichzusetzen
mit Gesundheitsvorsorgetouristen. Aus diesem Grunde wird dieses Differenzierungsmerk-
mal in dieser Studie vernachlässigt.
In der Praxis ist zudem eine klare Einteilung der Ausprägungen recht schwierig. In Kuror-
ten kommen sehr oft alle drei Kategorien nebeneinander vor oder gehen fließend ineinan-
der über (vgl. Kaspar 1996b, S.58).
2.2.2 Definition Wellness-Tourismus
Der Wellness-Tourismus wird nach Lanz Kaufmann in einem engeren Sinne, aufbauend
auf die Definition von Kaspar, abgeleitet:
,,Wellness-Tourismus umfasst Reise und Aufenthalt von Personen mit dem Hauptmotiv der
Erhaltung oder Förderung ihrer Gesundheit. Der Aufenthalt erfolgt in einem spezialisier-
2. Theoretische Grundlagen
13
ten Hotel mit entsprechender Fachkompetenz und individueller Betreuung, wobei ein um-
fassendes Leistungsbündel bestehend aus folgenden Elementen angeboten wird:
- Fitness/Körperpflege
- gesunde Ernährung
- Entspannung
- geistige Aktivität/Bildung" (Lanz Kaufmann 2002, S.35).
Da in der vorliegenden Arbeit Hotels und Kurorte analysiert werden, wird die obige Defi-
nition mit einer minimalen Erweiterung übernommen. Die Passage bezüglich des Aufent-
haltes in einem spezialisierten Hotel wird um ,,Kurorte" erweitert und lautet nun wie folgt:
...Der Aufenthalt erfolgt in einem spezialisierten Hotel oder einem Kurort mit entspre-
chender Fachkompetenz und individueller Betreuung, wobei ein umfassendes Leistungs-
bündel bestehend aus folgenden Elementen angeboten...
Diese Erweiterung ist wichtig, um die Begrifflichkeit des ,,Wellness-Tourismus" auch auf
die Kurorte übertragen zu können. Zudem ist es im touristischen Kontext maßgebend, die
verschiedenen Bedeutungsbereiche von ,,Wellness" aus Sicht des Gastes zu unterscheiden.
Die enge Abgrenzung, mit den Bausteinen ,,Fitness/Körperpflege, gesunde Ernährung,
Entspannung und geistige Aktivität/Bildung" nach Lanz Kaufmann, wird in der touristi-
schen Realität von vielen Gästen nicht konsequent ausgelebt und somit werden wiederum
nicht immer alle Bausteine nachgefragt. Illing hat aufgrund dieser Tatsache die Motivatio-
nen der ,,Wellnessgäste" in drei Stufen unterteilt.
Abbildung 5: Wellness mit verschiedenen Ausprägungen im touristischen Kontext
passives Entspannen
Genuß ohne Berücksichtigung der
Wellness
1. Grades
körperlichen und geistigen Konsequenzen
aktives Entspannen
Der Zustand des Wohlbefindens wird aktiv
Wellness
2. Grades
zu erreichen versucht (Training, Bewußtwerdung)
und die Konsequenzen werden beachtet.
ganzheitlicher Ansatz
Nachhaltige Verhaltensänderung mit dem Ziel,
Wellness
3. Grades
Körper und Geist gleichermaßen in einen
dauerhaften Zustand des Wohlbefindens zu bringen.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Illing 1999, S.12
2. Theoretische Grundlagen
14
Der ganzheitliche Ansatz von Illing entspricht einer Definition der Wellnessgäste von Lanz
Kaufmann. Lanz Kaufmann hat nach einer empirischen Studie festgestellt, daß nur 4% der
Gäste in einem Wellnesshotel, sowohl die Gesundheitsförderung als Hauptmotiv angeben
als auch ein umfassendes Leistungsbündel aus den Bereichen der körperlichen und geisti-
gen Aktivität, Entspannung und gesunden Ernährung beanspruchen. Diese 4% können als
,,Wellnessgäste im engeren Sinn" bezeichnet werden. In der touristischen Realität ist dieser
Ansatz die konsequente Umsetzung des Wellnessgedankens. Allerdings wird der Großteil
der Gäste, also 96% nach Lanz Kaufmann als ,,Wellnessgäste im weiteren Sinn" bezeich-
net (vgl. Lanz Kaufmann 1999, S. 48). Die Bezeichnungen beider Autoren werden in die-
ser Arbeit synonym verwendet. Die unterschiedlichen Ausprägungen von ,,Wellness" im
touristischen Kontext werden bei den Expertengesprächen noch genauer untersucht.
2.3 Das Produkt ,,Wellness"
2.3.1 Produktbestandteile und deren Träger
Das Gesamtprodukt Wellness setzt sich aus unterschiedlichen Teilleistungen heterogener
Leistungsträger zusammen. Solche Leistungen werden als Dienstleistungsbündel bezeich-
net. Dieses Bündel besteht aus dem Ort in seiner Gesamtheit; zu ihm gehören die Gast- und
Verpflegungsleistungen, die therapeutischen Angebote sowie die infrastrukturellen und
kulturellen Einrichtungen (vgl. Ziegenbalg 1996, S. 16).
Das touristische Angebot einer Destination besteht aus einem primären (ursprünglichen)
und einem sekundären (abgeleiteten) Angebot. Zu dem primären Angebot zählen z. B.
· die natürlichen Faktoren ( geographische Lage, Klima, Landschaft)
· die soziokulturellen Faktoren (Kultur, Gastfreundschaft, Sprache)
· die allgemeine Infrastruktur.
Diese primären Faktoren spielen bei der Marketing-Konzepztion eine besondere Rolle. Sie
sind produktpolitisch nicht beeinflußbar, können aber strategisch und kommunikationspoli-
tisch sehr gut eingesetzt werden (vgl. Freyer 2001, S.290f).
Zu dem sekundären Angebot gehören:
· die touristische Suprastruktur (Beherbergungs- und Verpflegungseinrichtungen,
Fremdenverkehrsämter
etc.)
· die touristische Infrastruktur (Schwimmbäder, Rad- und Wanderwege)
· der Ortscharakter (Gästebegrüßungen, Konzerte, gepflegtes Ortsbild)
2. Theoretische Grundlagen
15
· das spezielle touristische und medizinisch-therapeutische Angebot (vgl. Ziegenbalg
1996, S.17).
Das abgeleitete Angebot besteht aus allen Leistungen, die ergänzend zu dem ursprüngli-
chen Angebot erstellt werden (vgl. Kaspar 1996a, S.65). Jeder Ausbau des sekundären An-
gebotes (Bau von Hotels, Verkehrsflächen etc.) reduziert das primäre Angebot dement-
sprechend (vgl. Althof 1996, S. 85). Grundsätzlich gilt, daß dort, wo das ursprüngliche
Angebot wenig zu bieten hat, besonders viel in das abgeleitete Angebot investiert werden
muß (vgl. Becker 2000, S.17, zit. in Brittner 2002, S.11f).
Das spezielle touristische und medizinisch-therapeutische Angebot ist das Kernstück des
Produktes ,,Wellness". Der Kunde nimmt bei seiner Bedürfnisbefriedigung zumeist Lei-
stungsbündel und nicht einzelne Leistungen aus dem primären oder sekundären Angebot in
Anspruch. Das Produkt ,, Wellness" wirkt also in seiner Gesamtheit, obwohl einzelne Lei-
stungen von unterschiedlichen Leistungsträgern erstellt werden. Primäres und sekundäres
Angebot stehen somit in einem engen komplementärem Verhältnis (vgl. Ziegenbalg 1996,
S. 16 f).
2.3.2 Produktspezifische Besonderheiten
Die Besonderheiten resultieren vornehmlich aus dem Dienstleistungscharakter des Produk-
tes Wellness. Diese dienstleistungsspezifischen Kriterien sind:
· Intagibilität (Immaterialität)
Potentielle Gäste können die Leistung ex ante nicht beurteilen. Es bestehen große
Unsicherheiten und hohe Suchkosten des Konsumenten. Nach dem Urlaub haben
die Wellnesstouristen einen immateriellen Nutzen (lange Erinnerung).
· Simultaneität von Konsum und Produktion (Uno actu Prinzip)
Bei persönlichen Dienstleistungen erfolgen die Produktion und der
Konsum gleichzeitig an einem Ort, es gibt somit keine Speichermöglichkeit dieser
Leistungen (vgl. Bieger 2000, S.304).
· Nichtlagerfähigkeit
Die touristischen Leistungen können vorrätig erstellt werden. Es besteht eine gewisse
Kapazität, die zeitlich begrenzt ist. Wird diese Kapazität überlastet, bzw. nicht ausgela-
stet, gehen Leistungen verloren.
· Heterogenität
Keine Leistung gleicht einer anderen (vgl. Dehmer 1996, S.75f).
2. Theoretische Grundlagen
16
· Subjektivität
Gleiche Leistungen werden von jedem Einzelnen unterschiedlich wahrgenommen
(vgl. Ziegenbalg 1996, S.18).
Dem persönlichen Kontakt kommt zudem eine große Bedeutung zu. Es ist wichtig, die
Mitarbeiter zu motivieren, da diese einen wesentlichen Beitrag für das Image leisten (vgl.
Bieger 2000, S.304).
Es gibt neben diesen allgemeinen Kriterien von Dienstleistungen noch spezifische, die auf
den Wellnessbereich zutreffen:
· Ein Produkt besteht aus vielen Einzelleistungen, die von eigenständigen
Wirtschaftssubjekten erbracht werden. Durch diese Vielzahl der Beschäftigten
entsteht ein soziales System mit einer hohen Komplexität.
· Das Produkt ,,Wellness" ist noch kapital- und personalintensiver als andere Produkte
des Fremdenverkehrs.
· Die Beziehung zwischen der therapeutischen und sozialen Umwelt sind eng, da das
Wohlbefinden und die Gesundheit im Vordergrund steht.
· Das akquisitorische Potential
16
ist im Wellnessektor wesentlich größer als das
anderer Fremdenverkehrseinrichtungen (vgl. Ziegenbalg 1996, S.17 f).
2.4 Der Wellnessmarkt
2.4.1 Besonderheiten des Marktes
Der Wellnesstourismus ist im Vergleich zu anderen Formen des Tourismus ein besonderer
Teilbereich. Er zeichnet sich aus dem markanten Dienstleistungscharakter und einem
enormem Kapitalaufwand aus. So sind in der Schweiz die Investitionskosten für die
Errichtung einer neuen Wellnessanlage von 4.500 bis 7.500 Franken pro Quadratmeter die
Regel, nach oben sind hier aber keine Grenzen gesetzt. Setzt man nun eine Minimalfläche
von 500 Quadratmetern voraus, befindet man sich bei einem Investitionsvolumen von rund
2 Millionen Franken.
17
Kosten für Innenausbau und Innenausstattung sind noch nicht be-
rücksichtigt. Häufig wird aufgrund der enormen Baukosten die Inneneinrichtung vernach-
16
Gutenberg versteht hierunter die Fähigkeit eines Unternehmens, Präferenzen der Nachfrager
zu konzentrieren und sich so einen Firmenmarkt zu schaffen. Ausführlich in: Gutenberg, Erich
(1971): Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Bd. 2, Der Absatz, 1971.
17
Der Investitionsaufwand für die Errichtung einer Wellnesseinrichtung ist in der Schweiz ver-
gleichbar zu den Investitionskosten in Deutschland. In Deutschland entstünden bei einer Fläche
von 500 Quadratmetern dementsprechend Kosten in Höhe von ca. 1,36 Mio. Euro.
2. Theoretische Grundlagen
17
lässigt. Je nach Angebotsschwerpunkt variieren die Kosten in diesem Bereich erheblich
(vgl. Lanz Kaufmann 2002, S.175). Auf der Kundenseite liegt, im Vergleich zu anderen
Arten des Tourismus, eine erhöhte Zahlungsbereitschaft vor. Allerdings sind die Anforde-
rungen an die Qualität des gesamten Angebotes sehr hoch (mündl. Mitteilung von Herrn
Heinz 2002).
2.4.1.1 Das Wellnessangebot.
Auf der Angebotseite existieren eine Vielzahl heterogener, zum Teil aber auch komple-
mentärer Leistungsträger, die sehr unterschiedliche Produkte anbieten. Zu diesen Lei-
stungsträgern zählen die Hotellerie, Kurorte und Heilbäder, Kliniken, Ferienclubs, Beauty-
farmen und auch Spezialangebote für Kranke.
· Hotellerie
Eine zunehmende Anzahl von Hotels investieren in neue Saunen, Fitnessräume,
Schwimmbäder etc. und schmücken sich dann mit einem sogenannten ,,Wellness-Bereich"
(vgl. Verbraucherzentrale NRW 2001, S. 55).
Solche Bezeichnungen sind in den meisten Fällen nicht gerechtfertigt und verwirren zudem
die Konsumenten. Um sich klar zu positionieren und Qualitätsstandards zu setzen, haben
sich mehr als 30 Hotels dem ,,Deutschen Wellness-Verband"
18
angeschlossen.
Aus diesem Verband ist im Jahre 1997 der Qualitäts- und Marketingverbund ,,Wellness
Hotels Deutschland" hervorgegangen. Die ,,Wellness Hotels Deutschland" bieten neben
westlichen und fernöstlichen Entspannungs- und Bewegungsangeboten vielfältige kulinari-
sche Besonderheiten, Beauty, Bäder, Naturerlebnisse, Kindererlebnisse und sporadisch
medizinische Therapien an. Diese Hotels werden über einen eigenen Katalog vermarktet
und die Betriebe müssen folgende Checkliste des Wellness-Verbandes erfüllen, um in den
Verband aufgenommen zu werden:
· mindestens 4 Sterne Hotel
· umweltbewußte Betriebsführung
· naturnahe, ruhige Lage des Hauses
· vollwertige Küche und Wellness-Vital-Küche als Teilangebot
· Nichtraucherzone
· ein Wellness-Center (mit Ayurveda, Thalasso etc.), eine Badelandschaft ist nicht Pflicht
18
Der Verband führt seit dem Jahre 2002 eine eigene Hotel-Zertifizierung durch. Ausführliche In-
formationen unter: www.wellnessverband.de/html/hotel/zertifizierung.html.
2. Theoretische Grundlagen
18
· ein ausgebildeter Wellness-Trainer, der regelmäßig fortgebildet wird
· freundlicher Service
· Erlebnisprogramm
· regelmäßige Überprüfung des Hotels vom Verband (vgl. Kunze/Stange/Ziegenbalg
2001, S. 32).
Hierbei werden in den jeweiligen Hotels unterschiedliche Schwerpunkte gelegt, wie zum
Beispiel auf Geschäftsreisende (Manager-Check-Up) oder sportive Menschen (vgl. Ver-
braucherzentrale NRW 2001, S. 56).
· Kurorte und Heilbäder
Die Kurortkrise hat dazu geführt, daß manche Kurorte und auch Heilbäder, Wellness-
Urlaube als Chance sehen, sich am Markt neu zu positionieren. Vermarktet werden die
Angebote in den meisten Fällen über die Heilbäder- und Tourismusverbände der einzelnen
Bundesländer. Ein Urlaub in einem Kurort bzw. einem Heilbad kann folgende Vorteile mit
sich bringen:
Es werden gesetzlich festgelegte Qualitätsanforderungen z. B. an Luftqualität, Bioklima,
Umweltschutz etc. gestellt und regelmäßig überprüft. Kurorte haben den Vorteil, daß sie
natürliche Heilmittel für Kuren z. B. nach Kneipp besitzen. Das Personal unterliegt gesetz-
lich bestimmten Qualitätsanforderungen und für die Hygiene werden hohe Maßstäbe fest-
gesetzt. Über die Heilbäderverbände sind teilweise günstige und qualitativ ansprechende
Angebote zu buchen. Für Musik-, Kultur- und Kreativinteressierte ist oftmals ein reichhal-
tiges Angebot vor Ort anzutreffen. (vgl. Verbraucherzentrale NRW 2001, S. 57f).
· Kliniken
Krankenhäuser, Reha- und Kurkliniken versuchen ihre leerstehenden Bettenkapazitäten
über ambulante und präventive Maßnahmen abzubauen und werden zum Teil von Touris-
musämtern vermarktet. Im Angebot sind medizinisch-kosmetische Leistungen, Antistreß-
seminare, Akupunktur, Diätberatung etc.. Es werden präventive, diagnostische und thera-
peutische Behandlungen, Badefreuden und auch kulinarische Genüsse offeriert. Teilweise
werden zielgruppenspezifische Angebote z. B. Gesundheitsschecks für Geschäftsleute und
Manager kreiert (vgl. Verbraucherzentrale NRW 2001, S. 60).
· Reisen für Kranke
Verstärkt bieten die Reiseanbieter für die zunehmend ältere Bevölkerung und deren ge-
sundheitlichen Probleme zugeschnittene Pauschalen an. Die Reise und der Spaß stehen hier
2. Theoretische Grundlagen
19
im Vordergrund. Einige Reiseveranstalter bieten Hotels mit Arztpraxen oder Programme
für bestimmte Krankheitsbilder an. So informiert die Deutsche Dialysegesellschaft über
Dialysereisen. Die Deutsche Herzstiftung veranstaltet mit einem Kölner Reiseveranstalter
Reisen für Herz- und Kreislaufkranke. Hier stellt sich die Frage nach der Abgrenzung des
Begriffes Wellness. Da für diese Arbeit die enge Abgrenzung von Lanz Kaufmann festge-
legt wurde, fällt diese Gruppe nicht in den für diese Studie beschriebenen Themenkom-
plex.
19
· Ferienclubs
Clubveranstalter haben zahlreiche Wellness- Fitness-, Beauty- und Kreativ- Programme für
potentielle Kunden im Angebot. Außer den Trendsportarten werden Entspannungsangebo-
te wie Badelandschaften, Massagen, Thalasso, und Ayurveda offeriert. Speziell ausgebil-
dete Wellness-Trainer erarbeiten anspruchsvolle Wellness- und Ernährungs-Checks. Zu-
dem werden Outdoor-Erlebnistrainings, Internet-, Persönlichkeits- und Managementsemi-
nare angeboten. Die Vielfältigkeit des Angebotes ist groß, allerdings sind die Preise in vie-
len Fällen relativ hoch (vgl. Verbraucherzentrale NRW 2001, S. 61f).
· Beautyfarmen
Es gibt eine große Anzahl von Beautyfarmen, die allerdings den Fokus auf die äußere
kosmetische Schönheitsbehandlung von Gesicht und Körper legen. Wenige dieser Anbieter
haben auch Reduktionsdiäten, Ausflüge, Aroma-, Bade- und Cellulitebehandlungen, Er-
nährungs- und Stilberatung sowie Sauna und Fitness im Programm. Die Branche versucht
ihr Angebot um Maßnahmen der inneren und äußeren Entspannung zu ergänzen. Gerade in
diesem Bereich ist aber Vorsicht geboten, da teilweise unglaubwürdige Versprechungen
gemacht werden. Zudem ist es empfehlenswert, sich nach den fachlichen Qualifikationen
zu erkundigen (vgl. ebenda 2001, S. 62).
2.4.1.2 Die Nachfrage im Verlauf der Geschichte
2.4.1.2.1 Die Entwicklung des Kurwesens in der BRD
Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre hatte das Kurwesen in der BRD enorme
Zuwachsraten und die Nachfrage war derart groß, daß man die Werbung um den Gast ver-
nachlässigte. Das Angebot im Beherbergungs- und Therapiebereich wurde erheblich aus-
gebaut. So entstanden Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre eine große An-
19
Siehe Kapitel 2.2.1 und Abbildung 4: Ausprägungen des Gesundheitstourismus.
2. Theoretische Grundlagen
20
zahl kombinierter Bäder- und Therapiezentren. Mit der ersten Ölkrise brach Mitte der sieb-
ziger die erste Rezession der Heilbäder und Kurorte herein. Die Langfristigkeit des kom-
menden Strukturwandels wurde nicht erkannt. Es wurden nur kurzfristige Lösungen (auch
im Marketing) favorisiert, ohne jedoch Inhalte oder Angebote neu zu gestalten. Ein drama-
tischer Einbruch kam 1982/83 mit dem Kostendämpfungsgesetz, welches zu enormen Ein-
brüchen der Gästezahlen von durchschnittlich 50% führte. Dramatisch war die Situation
vor allem deshalb, da die hohen Fixkosten, bestehend aus den Energiekosten und den ho-
hen Personalkapazitäten, kurzfristig nicht abgebaut werden konnten. Nun mußte um den
Kunden geworben werden. Dies war jedoch schwer, da bis dato ,,Marketing" ein Fremd-
wort ohne spezifischen Inhalt war und sich die Werbung nur auf einfache Reklame be-
schränkte. Das eigentliche Kurangebot wurde immer noch nicht grundlegend verändert und
so bekam der Begriff ,,Kururlaub" einen negativen Beigeschmack (vgl. Kirchner 1996,
S.232f). Durch die umfassenden Gesundheitsreformen 1989, 1991 und 1992 wurden die
Kurorte gezwungen, strukturelle Veränderungen vorzunehmen und die Kur neu zu definie-
ren. Dies wurde durch die gesetzliche Festschreibung der Prävention erleichtert (vgl.
Kirchner 1996, S.234). Im Jahre 1997 folgte durch das Inkrafttreten des Beitragsentla-
stungsgesetzes und der dritten Stufe der Gesundheitsreform eine weitere Krise. Den gesetz-
lichen Kranken- und Rentenversicherungen wurden die Mittel für Vorsorge- und Rehabili-
tationsmaßnahmen um ein Drittel gekürzt. Zudem wurde der Abstand zur nächsten Kur
verlängert und die Dauer der Kur verkürzt (vgl. Brittner/Kolb/Steen 1999, S.18f). Dies
führte abermals zu einem durchschnittlichen Rückgang der Gäste und Übernachtungszah-
len von 35%, in Einzelfällen auch bis zu 50%, so daß Betriebe schließen mußten. Diese
krisenbedingte Marktbereinigung führte wiederum seit Mitte 1998 zu einer Zunahme der
Gäste- und Übernachtungszahlen bei den bestehenden Betrieben. Im Jahr 1999 entspannte
sich die Situation und ein leichtes generelles Wachstum war zu erkennen (vgl. Wilms-
Kegel 2000, S.239). Im folgenden Jahr war die Anzahl der ambulanten Kuren allerdings
erneut rückläufig. Ursächlich war die vermehrte Bewilligung wohnortnaher ambulanter
Rehabilitationsmaßnahmen. Die Entwicklung zwang zahlreiche Anbieter innovative Kon-
zepte für den Gesundheitstourismus zu entwickeln (vgl. Kunze/Stange/Ziegenbalg 2001,
S.25). Der Wellness-Tourismus wurde als Chance angesehen, um die Einbrüche bei den
Gästezahlen zu kompensieren. Diese Umstrukturierung ist noch immer nicht vollständig
abgeschlossen, da der Wellnesstourismus ein Wachstumssektor ist und einzelne Betriebe
bzw. Orte durch eine Umstrukturierung an diesem Wachstum partizipieren können.
2. Theoretische Grundlagen
21
2.4.1.2.2 Die Entwicklung des Kurwesens in der DDR
Das Heilbäderwesen der DDR war verstaatlicht und unterschied sich erheblich von dem
der BRD. In der BRD existierte eine Dreistufung von Gesundheitsurlaub, ambulanter bzw.
offener Badekur und stationärer Kur, während es in der DDR nur stationäre Kurmaßnah-
men, allerdings mit teilstationären Komponenten gab. Eine starke Kompetenz wies der
kurmedizinische und der Kurforschungsbereich der DDR auf.
In beiden deutschen Staaten hatten die Kurorte eine dominierende Stellung in der Frem-
denverkehrswirtschaft. Es kann davon ausgegangen werden, daß die DDR Kurorte einen
Anteil am Binnenfremdenverkehr von ca. 45% hatten, ähnlich wie es in der BRD der Fall
war (vgl. Kirchner 1996, S.232). Nach der Wiedervereinigung waren ungeklärte Eigen-
tumsverhältnisse, mangelnde Erfahrung mit der freien Marktwirtschaft, fehlende Infra-
struktur und mangelnde oder zögerliche Umsetzung von Investitionsvorhaben ein Hemm-
nis für die Entwicklung der Neuen Länder im Kur- und Wellnessbereich.
2.4.1.2.3 Entwicklungen in Brandenburg nach der Wiedervereinigung
Die Kurortentwicklung in Brandenburg ist seit 1990 durch eine Vielzahl von ähnlichen,
bereits erläuterten Prozessen gekennzeichnet. Die Kurorte hatten nach der Wende einen
enormen Nachholbedarf im infrastrukturellen Bereich, um die Prädikatisierungsvorausset-
zungen zu erfüllen. In einigen potentiellen Kurorten war ein inhaltlicher Neubeginn erfor-
derlich. Die traditionellen Ausrichtungen waren vorwiegend Moorbad und Luftkurort, So-
le- und Kneippanwendungen waren in der Vergangenheit von untergeordneter Bedeutung
und mußten neu entwickelt werden. Alle Orte hatten eine starke Sommersaisonalität, in
einigen ist dies heute noch der Fall. Viele Investitionsvorhaben im Bereich der Thermen
und Bäder wurden im Vergleich zu den anderen Neuen Bundesländern zu spät realisiert.
Dies ist mit der verspäteten Positionierung
20
des Landes Brandenburg im Zusammenhang
zu sehen. In einigen Orten bestehen kommunikative Störungen, aus denen eine zurückhal-
tende Kooperationsbereitschaft resultiert (vgl. Kunze/Stange/Ziegenbalg 2001, S. 32).
Als Beispiel für einen Kurort in Brandenburg wird Bad Saarow aufgeführt, um die Situati-
on nach der Wiedervereinigung besser zu veranschaulichen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg mauerte die Rote Armee das komplette Zentrum der Stadt
ein und siedelte auf diesen abgetrennten Sanatoriumsgelände über 100 russische Ärzte an.
Bad Saarow wurde zum Kurort der russischen Luftstreitkräfte ernannt und war der größte
20
Unter Positionierung wird die Stellung eines Produktes im Wahrnehmungsraum des Kunden
verstanden, siehe Kapitel 3.6.1.1.3.
2. Theoretische Grundlagen
22
russische Kurort außerhalb des eigenen Landes. Um das Zentrum herum betrieb die DDR
Betriebsferienheime, Pionierlager und FDJ-Einrichtungen. Größter Arbeitgeber war ein
Lazarett, welches zugleich die größte Einrichtung seiner Art in der DDR war. So zählte
Bad Saarow in der DDR mit ca. 700.000 Übernachtungen im Jahr zu den Fremdenver-
kehrsschwerpunkten des Landes. Nach der Wiedervereinigung bot sich für Bad Saarow die
Chance, als zukunftsweisender Kurort neu geplant und erbaut werden zu können (vgl.
Körber 2001, S.99). In den folgenden Jahren gingen fast alle Einrichtungen wie Betriebsfe-
rienheime, Hotels, Pensionen etc. in das Eigentum der Alteigentümer oder von Investoren
über. Der neue Kurdirektor von Bad Saarow möchte nun an den Glanz der ,,Goldenen
Zwanziger Jahre"
21
anknüpfen, als das 70 Kilometer südöstlich von Berlin gelegene Städt-
chen noch Prominentenwohnsitz von Politikern, Künstlern, Literaten und anderen berühm-
ten Personen war (vgl. Schlag 1996, S.257). Heute ist Bad Saarow einer der führenden
Kurorte im Lande Brandenburg. Die Umsetzung des neuen Marketingkonzeptes und der
Bezug zu der Vergangenheit ist Bad Saarow relativ gut gelungen.
Heute wird der Wellness-Tourismus in den Neuen als auch in den Alten Bundesländern als
Chance gesehen. Eine Umstrukturierung und damit verbundene, nicht unerhebliche Inve-
stitionen sind allerdings notwendig, um diese Chance auch nutzen zu können. Solch eine
Umstrukturierung ist teilweise sehr kompliziert, da die Alteigentümer nicht mit dem Tou-
rismus verwachsen sind und einige Betriebe auch nicht mehr den heutigen Qualitätsanfor-
derungen entsprechen.
2.5 Allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen
Mit der Zeit hat sich die Gesellschaft und auch der Konsument geändert. Man spricht in
diesem Zusammenhang von einem Wertewandel. Unter Wertewandel versteht man die
Veränderung von grundlegenden Überzeugungen und Einstellungen, die das Denken und
Handeln der Menschen in der Zukunft bestimmen (vgl. Tacke 1990, S.42). Ein Wandel der
Gesellschaft führt auch zu einer Veränderung der individuellen Ansprüche. Dies betrifft
auch Ansprüche, die an einen Urlaub und die damit im Zusammenhang stehenden Dienst-
leistungen gestellt werden (vgl. Scherhag 2000, S. 150). Hier nun einige Beispiele für den
Wertewandel und gesellschaftliche Entwicklungen:
· Verstärktes Gesundheitsbewußtsein
Das Bewußtsein des Menschen für die eigene Gesundheit als wichtigstes Gut hat
21
Zu den Gästen zählten Max Schmeling, Maxim Gorki, Käthe Dorsch, Ernst Lubisch u.a..
2. Theoretische Grundlagen
23
zugenommen (vgl. Kreilkamp 1998, S.300).
· Zunehmendes Umweltbewußtsein
Die Natur als Heilmittel wird neu entdeckt, natürliche Heilmittel werden gesucht, zum
Teil bedingt durch das Wissen über Nebenwirkungen von konventionellen
Arzneimitteln (vgl. Dehmer 1996, S.22).
· Zunehmende Freizeit und steigende Qualitätsansprüche
Die Menschen verfügen über mehr Freizeit und haben durch einen gehobenen Lebens-
stil höhere Qualitätsansprüche. Zudem verfügt der Konsument über eine große
Reiseerfahrung (vgl. Brittner 2002, S.20).
· Flexibilität und Spontanität
Durch kurzfristige Entschlüsse und zunehmende Flexibilität zeichnet sich der Konsu-
ment von heute aus. Der Last-Minute-Boom ist ein Beleg für diese Annahme (vgl. Stei-
necke 1997, S. 10).
· Verstärkte Erlebnis- und Zusatznutzenorientierung
Psychologischer Zusatznutzen (,,added value") und der Erlebniswert werden zu einem
entscheidenden Wettbewerbsfaktor, um den Kunden zu gewinnen (vgl. Hennings 2000,
S.58).
· Veränderte Strukturen des Wettbewerbes
Die zunehmende Konzentration und Kooperation bei überlappenden Branchengrenzen
führt zu einem Hyper- und paradoxem Wettbewerb (Coopetition).
· Uneinheitliche Konsumstrukturen
Inkonsistenz und Instabilität der Verhaltensmuster (bedingt durch den Wertewandel)
begrenzen die Prognostizierbarkeit der Nachfrage. Der Konsument ist hybride,
multioptional und paradox in seinem Verhaltensmuster (vgl. Meffert 1999a, S.6).
22
· Steigendes Markenbewußtsein
Durch ein großes Angebot verliert der Kunde die Übersicht und orientiert sich
zunehmend an Marken (vgl. Steinecke 2000, S.12).
· Demographische Entwicklung
Die Anzahl älterer Menschen und damit stärker mit Krankheiten belasteter Menschen
nimmt weiter zu. Der Wunsch nach Gesundheit bis ins hohe Alter steigt
dementsprechend (vgl. Ziegenbalg 1996, S.24).
22
ausführlich zu dem ,,Neuen Konsumenten" Horx 2002, S. 202f.
2. Theoretische Grundlagen
24
· Trend zum Hedonismus
23
· Veränderungen des Krankheitsspektrums
Zivilisationskrankheiten (Herz- Kreislauf- Störungen, Gelenkerkrankungen etc.) und
Umwelterkrankungen (Allergien, Atemweg- und Hauterkrankungen) nehmen weiter zu
(vgl. Lanz Kaufmann 2002, S.63).
Einige der erläuterten Entwicklungen zeigen, daß die Bereiche Gesundheitsförderung und
Prävention eine stärkere Gewichtung erhalten. Das Potential derer, die auch im Urlaub
etwas für ihre Gesundheit tun möchten, ist groß (vgl. Opaschowski 2000, S.10).
2.6 Potentiale des Wellnesstourismus
Der russische Physiker und Geisteswissenschaftler Nikolai Kondratieff entwickelte ein
Modell, mit dem er Produktivitätsschübe seit Beginn der industriellen Revolution unter-
suchte. Durch technische Innovationen (Basisinnovationen) werden ökonomische ,,Wohl-
standswellen" ausgelöst, die weltweite Auswirkungen mit sich bringen. Jede Welle erzeugt
dabei eine Knappheit, die in der nächsten Welle gelöst wird. Alle Wellen zusammen er-
zeugen eine Rhythmik des Wohlstandes (vgl. Horx 2002, S. 38). Leo Nefiodow, seit 1974
Forscher bei der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, ist der Ansicht, daß
die Dauer eines Kondratieffzyklus zwischen 45-60 Jahren beträgt (vgl. Hilger/Steinbach
1998, S.503). In der letzten Zeit haben sich diese Zyklen jedoch verkürzt. Es ist
anzunehmen, daß der langwellige Wirtschaftszyklus der Informationstechnologie in naher
Zukunft von einem neuen Zyklus abgelöst wird. Als einen möglichen Träger dieses neuen
Langzyklus nennt Nefiodow, neben anderen Kandidaten, den Gesundheitsmarkt (vgl.
Nefiodow 1996, S.93f). Er nennt als Indikatoren der kommenden Entwicklung, unter
anderen die steigende Anzahl der Beschäftigten im Gesundheitssektor. So haben in
Deutschland die Beschäftigten im Gesundheitssektor zwischen 1983 und 1993 um 600%
zugenommen. In den USA zählen zu den zehn Berufsgruppen mit den höchsten Wach-
stumsraten in dem Zeitraum von 1994 bis 2005 fünf Gesundheitsberufe. Zudem kommt ein
Anstieg der körperlichen und psychischen Erkrankungen in den westlichen Ländern. In den
USA werden zum Beispiel 14% der Menschen als psychisch schwer krank eingestuft.
24
Rapide haben auch Allergien und vegetative Störungen zugenommen. Nefiodow spricht
23
Hedonismus ist die ,,... Lehre, nach der Lust und Genuß das höchste Gut des Lebens und das
Streben danach die Triebfeder menschlichen Handelns und Verhaltens sind bzw. sein sollten."
(Brockhaus 1981, S.446)
24
als psychisch schwer krank gilt, wer mindestens drei schwere Depressionen pro Jahr erleidet.
2. Theoretische Grundlagen
25
von der Megabranche ,,Gesundheit" und sieht diese als künftigen Entwicklungsfaktor (vgl.
Horx 2002, S,110f). Gesundheit im ganzheitlichen Sinn - physisch, seelisch, geistig, öko-
logisch und sozial ist der Leitsektor des sechsten Kondratieffs (vgl. Nefiodow 2001,
S.133). Die Existenz von fünf dieser Wellen konnte in einem Zeitfenster der letzten 250
Jahre empirisch nachgewiesen werden. Aus diesem Grunde hat das Modell eine gewisse
Aussagekraft und kann uns auch heute nützliche Dienste erweisen (vgl. Nefiodow 1996,
S.4). Man kann davon ausgehen, daß Gesundheits- und Wellnessurlaube auch weiterhin zu
den Wachstumssparten
25
des Tourismus zählen werden (vgl. Hilger/Steinbach 1998,
S.503).
Abbildung 6: Die langen Wellen der Konjunktur und ihrer Basisinnovationen
Dampfmaschine Stahl Elektrotechnik Petrochemie Informations-
?
Baumwolle Eisenbahn Chemie Automobil technik
1. Kondratieff 2. Kondratieff 3. Kondratieff 4. Kondratieff 5. Kondratieff 6. Kondratieff
1800 1850 1900 1950 1990 20XX
Quelle: Nefiodow 1996, S.94
Das Interesse der Deutschen an einem Wellness-Urlaub hat von dem Jahr 1999 bis 2002
um 125% zugenommen (vgl. F.U.R. 2002b, S.7). Diese Entwicklung kann herangezogen
werden, um die von Nefiodow beschriebenen Entwicklungen zu belegen.
Aufgrund dieses großen Wachstumspotentials fordert Opaschowski, daß sich die Kurorte
zu Trainingszentren des Gesundheits- und Wellnesstourismus wandeln müssen. Hierzu
müssen unter anderen die Kurverwaltungen ihre gesundheitstouristischen Managementauf-
gaben wahrnehmen und die Kurdirektoren sollen sich zu Wellnessdirektoren wandeln. Zu-
dem sollte das Angebot stärker freizeit- erlebnisorientiert ausgerichtet sein. Solch eine
25
Der Wellnesstrend wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken. Der Umsatz der ge-
samten Wellnessbranche betrug im Jahr 2000 121 Mrd. DM. Für das Jahr 2003 wird von Forschern
eine Steigerung auf ca. 145 Mrd. DM geschätzt (vgl. Lang/Dorner 2001, S.30).
2. Theoretische Grundlagen
26
Neukonzeption ist zwingend erforderlich, um in Zukunft am Markt bestehen zu können
(vgl. Opaschowski 2002, S.309f).
3. Grundlagen des Marketing im Wellnesstourismus
27
3. Grundlagen des Marketings im Wellnesstourismus
3.1 Wesen und Bedeutung des Marketings
3.1.1 Definition Marketing
,,Marketing ist ein Prozeß im Wirtschafts- und Sozialgefüge, durch den Einzelpersonen
und Gruppen ihre Bedürfnisse und Wünsche befriedigen, indem sie Produkte und andere
Dinge von Wert erzeugen, anbieten und miteinander austauschen." (Kotler/Bliemel 1995,
S.7)
Diese Definition des Begriffs ,,Marketing" von Kotler und Bliemel ist sehr allgemein
gehalten; sie verweist auf eine bestehende Ziel-Mittel-Beziehung. Diese findet in der
folgenden Definition eine stärkere Berücksichtigung.
,,Marketing ist die permanente und systematische Analyse und Ausgestaltung von Transak-
tionsprozessen zwischen zwei Marktparteien mit dem Ziel, ein Transaktionsdesign zu fin-
den, daß die Zielsysteme der Transaktionspartner bestmöglich erfüllt." (Weiber 1996, S.
38)
Bei dieser Definition versteht der Autor als Transaktion den Austausch von Gütern, als
Transaktionsdesign den Abschluß eines Vertrages, wobei für das Leistungsangebot ein
Entgelt entrichtet wird, und als Zielsystem die Nutzenmaximierung des jeweiligen Trans-
aktionspartners (vgl. Weiber 1996, S.38f). Für die vorliegende Arbeit wird die Definition
des Marketings von Weiber zugrunde gelegt, da in dieser Definition auf das Ziel der Nut-
zenmaximierung des Einzelnen eingegangen wird. Jeder Transaktionspartner soll bezüg-
lich des Nutzens größte Zufriedenheit erfahren.
Das Marketing läßt sich zudem unterscheiden in:
· Marketing als Maxime (konsequente Ausrichtung an die Markterfordernisse)
· Marketing als Mittel (Schaffung von Präferenzen durch gezielte Maßnahmen)
· Marketing als Methode (systematische Entscheidungsfindung) (vgl.
Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 1994, S.13).
Seit den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat das Marketing zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen. Der Hintergrund dieser Entwicklung war und ist der Wandel des Marktes
von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt.
Die Entwicklung zu einer ganz nach dem Markt ausgerichteten Unternehmensführung hat
sich aufgrund dieses Wandels in verschiedenen Etappen vollzogen. Diese Stufen lassen
3. Grundlagen des Marketing im Wellnesstourismus
28
sich jedoch nicht eindeutig trennen, sie überschneiden sich sogar zum Teil. Dies ist auf
sektorale und regionale Gründe zurückzuführen.
Stufe 1: Fehlendes Tourismus-Marketing (bis ca. 1980)
Bis in die achtziger Jahre wuchs der touristische Markt stetig, das Wachstum war ange-
botsbedingt und der Markt (Verkäufermarkt) führte nicht zu der Notwendigkeit einer Aus-
richtung der Unternehmen an moderne Marketingkonzepte.
Stufe 2: Instrumentelles Tourismus-Marketing (von ca. 1975 bis 1985)
In den achtziger Jahren traten erste Stagnationstendenzen auf und die Reisenachfrage ging
zum Teil, in absoluten Zahlen betrachtet, zurück. In dieser Phase waren erste Stimmen zu
hören, die ein modernes Marketing forderten.
Stufe 3: Konzeptionelles Marketing im Tourismus (von ca. 1985 bis 1995)
In dieser Etappe kam es zu einem verstärkten Einsatz verschiedener Marketinginstrumente.
Diese Entwicklung wurde durch die Wiedervereinigung und der damit verbundenen (indu-
zierten) Nachfragesteigerung unterbrochen.
Stufe 4: Professionelles Tourismus-Marketing (ab ca. 1995)
Seit Mitte der neunziger Jahre kamen erneut, sowohl beim Outgoing- als auch beim Inco-
mingtourismus rezessive Tendenzen auf. Aus diesem und auch anderen Gründen (z. B.
Naturkatastrophen und Anschläge auf Touristen)
26
werden heute besondere Anforderungen
an ein modernes Marketing gestellt (vgl. Freyer 1999, S. 49f). Nach Kreilkamp sollen sich
die Unternehmen stärker an den Bedürfnissen der Kunden orientieren, um langfristig er-
folgreich zu sein (vgl. Kreilkamp 1998, S. 287). Kundenorientierung bedeutet in diesem
Zusammenhang in Problemlösungen zu denken. Der Kunde kauft nicht ein Produkt um es
zu besitzen, sondern um seine individuellen Probleme zu lösen. Daher ist es notwendig,
latente Kundenwünsche mit entsprechenden Marketingaktivitäten zu bearbeiten (vgl.
Kreilkamp 1994, S. 95f).
26
Ausführlich zu dem Krisenmanagement im Tourismus (vgl. Dreyer 2001, S. 11f).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832467463
- ISBN (Paperback)
- 9783838667461
- DOI
- 10.3239/9783832467463
- Dateigröße
- 12.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Trier – Geographie/Geowissenschaften FB VI
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Mai)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- wellness wellneskonzept internetmarketing marketingkonzeptionierungsprozess
- Produktsicherheit
- Diplom.de