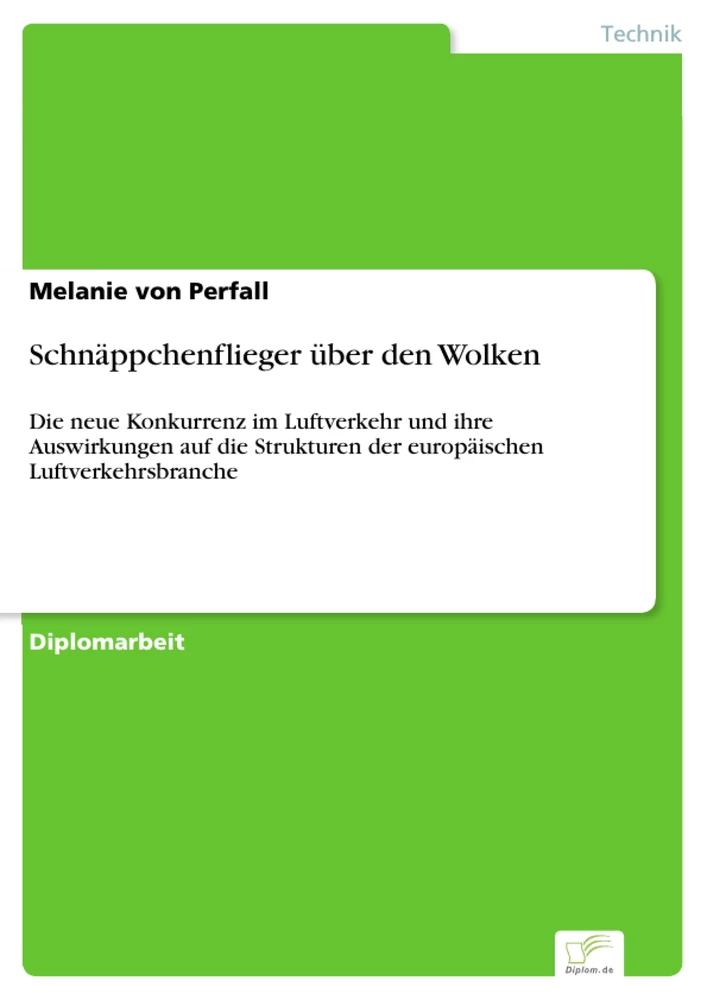Schnäppchenflieger über den Wolken
Die neue Konkurrenz im Luftverkehr und ihre Auswirkungen auf die Strukturen der europäischen Luftverkehrsbranche
©2003
Diplomarbeit
81 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Das ehemalige deutsche Staatsunternehmen Lufthansa wurde erfolgreich privatisiert, der europäische Luftverkehr liberalisiert und der Marktzugang im wichtigen Verkehr zwischen Deutschland und den USA geöffnet. Deutschland ist einer der bedeutendsten Luftverkehrsstandorte weltweit und liegt im internationalen Vergleich bei der Personenbeförderung auf Platz vier. Luftverkehr ist und bleibt ein Wachstumsmotor. Die Liberalisierung (letzte Stufe 1993) in Europa stellt einen entscheidenden Wendepunkt für die Luftverkehrsgesellschaften dar. Die Zukunft der einzelnen Airlines in Europa wird von den veränderten institutionellen Rahmenbedingungen und von der Weiterentwicklung der Wettbewerbsstrukturen dieser Branche abhängen.
Seit Ende der neunziger Jahre setzen sich zunehmend Billigairlines auf dem europäischen Markt durch, die den etablierten Airlines Touristen und preissensitive Geschäftskunden abwerben. Während die europäischen Linienfluggesellschaften im vergangenen Jahr rückläufige Passagierzahlen hinnehmen müssten, lockten Ryanair und Easyjet zwischen 30 und 40 Prozent mehr Passagiere an, steigerten Umsätze und Gewinne. Bereits jetzt machen mehr als neuen Low-Cost-Airlines den etablierten Fluggesellschaften auf dem europäischen Kurzstreckenmarkt das Leben schwer. Seitdem tobt ein heftiger Kampf um die Flugreisenden in Europa, - mit innovativen Konzepten, frischen Ideen und niedrigen Preisen. Der europäische Luftverkehrsmarkt gilt derzeit mit seinen vielfältigen Veränderungen und seinen aktuellen Turbulenzen als einer der dynamischsten Branchen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung der neuen Rahmenbedingungen, denen sich große europäische Fluggesellschaften seit der Liberalisierung stellen müssen. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, wie der bisherige Erfolg der jüngst in den Markt getretenen Schnäppchenflieger die Strukturen des europäischen Luftverkehrsmarktes und das Verhalten der bisherigen Markteilnehmer verändert. Es soll untersucht werden, wie sich die großen Fluggesellschaften von ihren neuen billigen Wettbewerbern unterscheiden. Abschließend wird analysiert, wie sich dieser Trend auf die ökonomischen Marktprozesse, auf die zukünftigen Erfolgsfaktoren der alteingesessenen Fluggesellschaften sowie für die Kunden auswirkt.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
EINFÜHRUNG1
1.1PROBLEMSTELLUNG1
1.2ZIELSETZUNG UND AUFBAU2
1.3GRUNDBEGRIFFE UND ABGRENZUNG4
ERSTER TEIL: VOM MONOPOL ZUM […]
Das ehemalige deutsche Staatsunternehmen Lufthansa wurde erfolgreich privatisiert, der europäische Luftverkehr liberalisiert und der Marktzugang im wichtigen Verkehr zwischen Deutschland und den USA geöffnet. Deutschland ist einer der bedeutendsten Luftverkehrsstandorte weltweit und liegt im internationalen Vergleich bei der Personenbeförderung auf Platz vier. Luftverkehr ist und bleibt ein Wachstumsmotor. Die Liberalisierung (letzte Stufe 1993) in Europa stellt einen entscheidenden Wendepunkt für die Luftverkehrsgesellschaften dar. Die Zukunft der einzelnen Airlines in Europa wird von den veränderten institutionellen Rahmenbedingungen und von der Weiterentwicklung der Wettbewerbsstrukturen dieser Branche abhängen.
Seit Ende der neunziger Jahre setzen sich zunehmend Billigairlines auf dem europäischen Markt durch, die den etablierten Airlines Touristen und preissensitive Geschäftskunden abwerben. Während die europäischen Linienfluggesellschaften im vergangenen Jahr rückläufige Passagierzahlen hinnehmen müssten, lockten Ryanair und Easyjet zwischen 30 und 40 Prozent mehr Passagiere an, steigerten Umsätze und Gewinne. Bereits jetzt machen mehr als neuen Low-Cost-Airlines den etablierten Fluggesellschaften auf dem europäischen Kurzstreckenmarkt das Leben schwer. Seitdem tobt ein heftiger Kampf um die Flugreisenden in Europa, - mit innovativen Konzepten, frischen Ideen und niedrigen Preisen. Der europäische Luftverkehrsmarkt gilt derzeit mit seinen vielfältigen Veränderungen und seinen aktuellen Turbulenzen als einer der dynamischsten Branchen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung der neuen Rahmenbedingungen, denen sich große europäische Fluggesellschaften seit der Liberalisierung stellen müssen. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, wie der bisherige Erfolg der jüngst in den Markt getretenen Schnäppchenflieger die Strukturen des europäischen Luftverkehrsmarktes und das Verhalten der bisherigen Markteilnehmer verändert. Es soll untersucht werden, wie sich die großen Fluggesellschaften von ihren neuen billigen Wettbewerbern unterscheiden. Abschließend wird analysiert, wie sich dieser Trend auf die ökonomischen Marktprozesse, auf die zukünftigen Erfolgsfaktoren der alteingesessenen Fluggesellschaften sowie für die Kunden auswirkt.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
EINFÜHRUNG1
1.1PROBLEMSTELLUNG1
1.2ZIELSETZUNG UND AUFBAU2
1.3GRUNDBEGRIFFE UND ABGRENZUNG4
ERSTER TEIL: VOM MONOPOL ZUM […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6702
von Perfall, Melanie: Schnäppchenflieger über den Wolken - Die neue Konkurrenz im
Luftverkehr und ihre Auswirkungen auf die Strukturen der europäischen
Luftverkehrsbranche
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Witten, Universität, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
Inhalt
1.
EINFÜHRUNG
1
ERSTER TEIL: VOM MONOPOL ZUM LIBERALISIERTEN MARKT
2.
GRUNDLAGEN
DES
LUFTVERKEHRS
7
3.
DER
ORDNUNGSPOLITISCHE
RAHMEN 13
ZWEITER TEIL: MARTEINTRITT NEUER WETTBEWERBER
4. DER NEUE WETTBEWERB IM EUROPÄISCHEN LUFTVERKEHR
23
DRITTER TEIL: RUINÖSER WETTBEWERB ODER EFFIZIENZSTEIGERUNG?
5. AUSWIRKUNGEN AUF DIE STRUKTUREN DES LUFTVERKEHRSMARKTES
45
6. AUSWIRKUNGEN FÜR DIE FLUGGESELLSCHAFTEN
56
7. DIE BEDEUTUNG DES STRUKTURWANDELS FÜR DEN KUNDEN
62
8. ZUSAMMENFASSUNG
65
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
67
LITERATURVERZEICHNIS 68
ANHANG
72
Inhaltsverzeichnis
EINFÜHRUNG
... 1
1.1 P
ROBLEMSTELLUNG
... 1
1.2 Z
IELSETZUNG UND
A
UFBAU
... 2
1.3 G
RUNDBEGRIFFE UND
A
BGRENZUNG
... 4
E
RSTER
T
EIL
: V
OM
M
ONOPOL ZUM LIBERALISIERTEN
M
ARKT
KAPITEL 2
GRUNDLAGEN DES LUFTVERKEHRS
... 7
2.1 E
IGENSCHAFTEN DES
P
RODUKTES
F
LUGREISE
... 7
2.2 B
ESONDERHEITEN DER
N
ACHFRAGE
... 8
2.3 B
ESONDERHEITEN DES
A
NGEBOTS
... 9
2.4 B
ESONDERHEITEN DES EUROPÄISCHEN
L
UFTVERKEHRS
... 11
KAPITEL 3
DER ORDNUNGSPOLITISCHE RAHMEN
... 13
3.1 I
NTERNATIONALE UND NATIONALE
A
BKOMMEN
... 14
3.1.1 Internationale multilaterale Abkommen ... 14
3.1.2 Bilaterale Abkommen zwischen Staaten ... 16
3.1.3 Bilaterale Abkommen zwischen Nationalen Fluggesellschaften ... 17
3.1.4 Das deutsche Luftverkehrsrecht ... 17
3.1.5 Fazit ... 18
3.2 D
IE
L
IBERALISIERUNG DES EUROPÄISCHEN
L
UFTVERKEHRS
... 19
3.2.1 Erstes Umdenken in der Luftverkehrspolitik ... 19
3.2.2 Stufen der Liberalisierung des europäischen Luftverkehrs ... 20
3.2.3 Fazit ... 22
Z
WEITER
T
EIL
: M
ARKTEINTRITT NEUER
W
ETTBEWERBER
KAPITEL 4
DER NEUE WETTBEWERB IM EUROPÄISCHEN LUFTVERKEHR
... 23
4.1 D
IE SPEZIFISCHEN
MA
RKTEINTRITTS
-
UND AUSTRITTSBARRIEREN
... 23
4.1.1 Strukturelle Markteintrittsbarrieren... 24
4.1.2 Wirtschaftliche Markteintrittsbarrieren ... 26
4.2.3 Strategische Markteintrittsbarrieren... 30
4.1.4 Marktaustrittsbarrieren... 32
4.1.5 Fazit ... 33
4.2 W
ACHSENDER
W
ETTBEWERB ZWISCHEN DEN ETABLIERTEN
L
INIENFLUGGESELLSCHAFTEN
... 33
4.3 D
RUCK VON ALLEN
S
EITEN
: D
IE
L
OW
-C
OST
-A
IRLINES
... 34
4.3.1
Die neuen Marktteilnehmer in Deutschland... 35
4.3.2 Preisbildungsstrategie der Low-Cost-Airlines ... 37
4.3.3 Nur billig ist zu wenig ... 40
4.4 F
AZIT
... 43
D
RITTER
T
EIL
: R
UINÖSER
W
ETTBEWERB ODER
E
FFIZIENZSTEIGERUNG
?
KAPITEL 5
AUSWIRKUNGEN AUF DIE STRUKTUREN DES LUFTVERKEHRSMARKTES
... 45
5.1 P
OSITIVE ÖKONOMISCHE
A
USWIRKUNGEN
... 45
5.1.1 Mehr Wettbewerb, mehr Angebot... 45
5.1.2 Anreize zur Kosteneffizienz ... 47
5.1.3 Senkung des Tarifniveaus ... 48
5.2 G
RENZEN DER
L
IBERALISIERUNG
... 49
5.2.1 Eingeschränkte Wachstumspotentiale... 50
5.2.2 Wertvernichtung statt Wertschöpfung... 53
5.2.3 Wettbewerbsverzerrung durch Subventionen ... 53
5.2.4 Liberalisierung und Flugsicherheit ... 54
5.3 F
AZIT
... 55
KAPITEL 6
AUSWIRKUNGEN FÜR DIE FLUGGESELLSCHAFTEN
... 56
6.1 D
RUCK AUF
P
REIS
-
UND
P
RODUKTGESTALTUNG
... 57
6.2 D
RUCK AUF
S
EGMENTIERUNG
... 58
6.2.1 Nischenstrategien ... 59
6.2.2 Qualität versus Preis... 60
6. 3 F
AZIT
... 61
KAPITEL 7
DIE BEDEUTUNG DES STRUKTURWANDELS FÜR DEN KUNDEN
... 62
7.1 P
REISSENSIBILITÄT DER
(G
ESCHÄFTS
-) K
UNDEN
... 62
7.2 G
RENZEN
... 63
KAPITEL 8
ZUSAMMENFASSUNG... 65
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
... 67
LITERATURVERZEICHNIS
... 68
ANHANG
... 72
Schnäppchenflieger über den Wolken
1
Kapitel 1
Einführung
Seit den 80er Jahren gerät der europäische Luftverkehr in Bewegung. Die protektionistische
Luftverkehrspolitik verlor mit der letzten Liberalisierungsstufe im Jahre 1993 ihre Wirkung. Das
ehemalige deutsche Staatsunternehmen Lufthansa wurde erfolgreich privatisiert, der
europäische Luftverkehr liberalisiert und der Marktzugang im wichtigen Verkehr zwischen
Deutschland und den USA geöffnet - ein entscheidender Einschnitt für die europäischen
Luftverkehrsgesellschaften. Die europäischen Fluggesellschaften stehen vor vielfältigen
Herausforderungen, da sie sich im wachsenden Wettbewerb zunehmend dem
marktwirtschaftlichen Druck im eigenen Land und europaweit stellen müssen.
Einen der spannendsten Aspekte des freien Marktes stellt der Eintritt der Low-Cost-Airlines
dar, die die Struktur des europäischen Linienflugverkehrs neu formen und mit innovativen
Geschäftskonzepten und niedrigen Preisen viel Nachfrage und Aufmerksamkeit auf sich
ziehen. Derzeit profitieren die Billigairlines davon, dass die Tarifstruktur der traditionellen
Fluggesellschaften nicht mehr in der bisherigen Form zu halten ist. Aber sie profitieren auch
von der neuen Preissensibilität der Konsumenten. Die derzeitige Wirtschaftskrise verstärkt
durch den aktuellen Verlauf der Weltkonjunktur sowie die hohe Unsicherheit durch
Terroranschläge und den Irakkrieg hat auch die Luftfahrt- und Touristikbranche erfaßt.
Die durch die neuen Schnäppchenflieger über den Wolken ausgelöste Dynamik ist
faszinierend für die Passagiere. Sie profitieren von dem starken Preiswettbewerb und der
neuen Kundenorientierung der Fluggesellschaften. Die Low-Cost-Airlines setzen dabei ganz
unterschiedliche Strategiekonzepte ein, um sich gegen die mächtigen Fluggesellschaften
durchzusetzen. Sie positionieren sich durch innovative Produkte, durch Nischenstrategien
sowie über radikale Preiskonkurrenz aufgrund günstiger Kostenstrukturen. Fliegen wird immer
billiger, der Wettbewerb härter. Die etablierten Fluggesellschaften müssen in naher Zukunft
handeln, denn der verschärfte Wettbewerb führt zu einem nachhaltigen Strukturwandel im
europäischen Luftverkehr.
1.1 Problemstellung
Der Wettbewerb war im europäischen Luftverkehr jahrzehntelang stark eingeschränkt. Die
Regulierung des Luftverkehrs führte in der Vergangenheit zu erheblichen Ineffizienzen durch
institutionelle Barrieren, starke Subventionierungspolitik, nationale Schutzmaßnahmen und ein
europäisches Gesamtnetz, das aus einem Wirrwarr sich überschneidender und paralleler
Schnäppchenflieger über den Wolken
2
Einzelnetze bestand. Das europäische Flugnetz spiegelte folglich nicht eine markt-
wirtschaftliche Optimierung nach Kosten- und Nachfragebedingungen wider.
Erst durch die Deregulierung, deren letzte Stufe 1993 in Kraft trat, entwickelt sich der
Luftverkehr in Europa Schritt für Schritt zu einem funktionsfähigen Markt. Die Deregulierung
führt auf den Märkten zu verschärften Wettbewerbsbedingungen zwischen den bestehenden
Fluggesellschaften. Eine der Hauptantriebskräfte der Wettbewerbsentwicklung ist der
Markteintritt neuer Wettbewerber.
Neue Markteilnehmer stoßen bestehende Marktstrukturen der Luftverkehrsbranche um. Die
Low-Cost-Airlines, die mit innovativer Preispolitik und aggressivem Marketing auf den
europäischen Luftverkehrsmarkt drängen, sorgen seit 2002 für viel Furore. Ihre
Geschäftskonzepte und radikalen Kostenstrukturen unterscheiden sich erheblich von den
großen Linienfluggesellschaften. In Deutschland kämpften am Ende des Jahres 2002 bereits 8
Billigairlines um Kunden und Marktanteile. Auch wenn diese neuen Airlines derzeit nicht direkt
in den wichtigen Märkten der großen Fluggesellschaften konkurrieren, also im
Hochpreissegment und im internationalen Netzwerksystem, rütteln sie doch an bisherigen
Preisstrukturen, Kommunikationsmitteln sowie am Verhalten und Verständnis der
Konsumenten.
Für die etablierten europäischen Fluggesellschaften bedeutet dies, dass sie sich sowohl in
ihren Heimatmärkten als auch im globalen Wettbewerb der verstärkten Konkurrenz nicht mehr
entziehen können. Sie beobachten die Entwicklung sehr genau und beginnen auf die Low-
Cost-Airlines mit entsprechenden Strategien zu antworten. Es wird angenommen, dass Low-
Cost-Airlines die Zukunft des innereuropäischen Luftverkehrs darstellen. Aber ihrem
Wachstum und Erfolg sind aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Luftverkehrsmarktes
und seiner besonderen Eintrittsbarrieren Grenzen gesetzt.
1.2 Zielsetzung und Aufbau
Mit der schrittweisen Liberalisierung des Luftverkehrsmarktes eröffnet sich ein interessantes
Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit einer Regulierung und der Öffnung eines
netzgebundenen Marktes für den länderübergreifenden Wettbewerb. Damit verbunden ist die
Frage, unter welchen Rahmenbedingungen ein funktionsfähiger Wettbewerb stattfinden und
zukünftig vorangetrieben werden kann.
Schnäppchenflieger über den Wolken
3
Ziel der Arbeit ist die Darstellung der neuen Rahmenbedingungen, denen sich große
europäische Fluggesellschaften seit der Deregulierung stellen müssen. Von besonderem
Interesse ist dabei die Frage, wie der bisherige Erfolg der jüngst in den Markt getretenen Low-
Cost-Airlines die Strukturen des europäischen Luftverkehrsmarktes und das Verhalten der
bisherigen Markteilnehmer verändert. Aus diesem Grund wird untersucht, wie sich die großen
Fluggesellschaften von ihren neuen billigen Wettbewerbern unterscheiden und wie sich dieser
Trend auf die ökonomischen Marktprozesse und auf die zukünftigen Erfolgsfaktoren der
alteingesessenen Fluggesellschaften auswirkt.
Die vorliegende Arbeit ist in drei Abschnitte untergliedert: Im Ersten Teil der Arbeit erfolgt eine
Situationsanalyse des Luftverkehrsmarktes in Europa vor und während des
Liberalisierungsprozesses. Für ein Verständnis der aktuellen Entwicklungen im Luftverkehr
sind die spezifischen Eigenschaften des Produktes Flugreise und die bisherigen ordnungs-
politischen Rahmenbedingungen des Marktes von großer Bedeutung. Die neuen
Rahmenbedingungen durch die Öffnung des Marktes prägen maßgeblich das Verhalten und
die Strategien der Marktteilnehmer im Luftverkehr.
Im Zweiten Teil der Arbeit geht es um die Entwicklungen des Wettbewerbs auf dem
europäischen Luftverkehr seit der letzten Liberalisierungsstufe im Jahre 1993. Die neuen
Rahmenbedingungen führten zur Herausbildung besonderer Eintritts- und Austrittsbarrieren für
den Luftverkehrsmarkt. Dieser Effekt wird mit Blick auf den deutschen Luftverkehrsmarkt und
den bisherigen Monopolisten Lufthansa dargestellt. Im Anschluss daran wird die seit wenigen
Jahren auftretende neue turbulente Dynamik auf dem europäischen Luftverkehr analysiert:
Der Markteintritt von Low-Cost-Airlines. Aufgrund der damit einhergehenden europaweiten
Verschärfung der Wettbewerbsbedingungen stellt sich die Frage, wie und womit sich die
Schnäppchenflieger in diesem neuartigen Markt und gegen die mächtigen Fluggesellschaften
zu behaupten versuchen. Im Fokus der Untersuchung steht die besondere
Preisbildungsstrategie der Billigairlines.
Im abschließenden Dritten Teil der Arbeit werden die Auswirkungen der Deregulierung auf die
Strukturen der Luftverkehrsbranche in drei Ebenen analysiert. Zunächst geht es um die Frage,
welche positiven ökonomischen Auswirkungen der verschärfte Wettbewerb auf die Strukturen
des Marktes hat. Andererseits stößt man unter ökonomischen Gesichtspunkten an die
Grenzen der Liberalisierung bzw. eines uneingeschränkten Wettbewerbs. Ruinöser
Wettbewerb, der zu volkswirtschaftlichen Verwerfungen führt und soziale Schäden und große
Kapitalvernichtung zur Folge hat, kann ökonomisch nicht richtig sein. Anschließend werden die
Auswirkungen des Strukturwandels auf das Verhalten der alteingesessenen Marktteilnehmer
Schnäppchenflieger über den Wolken
4
- am Beispiel Lufthansa - erläutert. Wesentliches Merkmal eines funktionsfähigen
Wettbewerbs ist die Entwicklung von Kundenorientierung, Preis- und Produktdifferenzierung
sowie die Erschließung von Nischenstrategien der Marktteilnehmer. Abschließend ist es
interessant, die Perspektive des Kunden einzunehmen: Wie verändern sich das
Konsumverhalten der Kunden und ihre Erwartungen an den Markt?
1.3 Grundbegriffe und Abgrenzung
Der Luftverkehr stellt einen Netzsektor dar. Netzsektoren sind Branchen, deren Produkte auf
Basis von realen Infrastrukturnetzwerken erstellt werden. Aufgrund der Netzstruktur können
die Güter bzw. Dienstleistungen über weite Strecken transportiert werden, ohne dass alle
Anschlusspunkte direkt miteinander verbunden werden müssen. Die Unternehmen können
durch die technisch bedingte Vernetzung Bündelungsvorteile bei der Leistungserstellung
realisieren und dem Kunden auf diese Weise eine effiziente Infrastruktur anbieten. Infolge
positiver Netzwerkeffekte bestehen für Mitglieder von Netzwerken erhebliche Anreize zur
Schaffung von großen homogenen Netzwerken, insbesondere auch im Bereich der
Bereitstellung von netzwerkbasierten Infrastrukturdienstleistungen
1
.
Betrachtet man den Luftverkehr als Gesamtheit der damit verbundenen Organisationen und
Beziehungen, so ist ein dichtes Geflecht aus zwischenstaatlichen Verträgen, Preis- und
Produktionskartellen, nationalen Interessen und Unternehmensstrategien festzustellen. Die
Luftverkehrswirtschaft ist ein komplexes System von vielen wirtschaftlich Beteiligten, die
untereinander in Beziehung stehen - ein großes Netzwerk aus vielfältigen Beiträgen und
Transaktionen. Sie bezeichnet die Gesamtheit sowohl der ökonomischen, organisatorischen
und technischen Einrichtungen des Luftverkehrs, die zur Produktion und Bereitstellung von
Luftfahrzeugen und Infrastruktureinrichtungen dienen, sowie die Institutionen, die die
rechtlichen und abwicklungstechnischen Rahmenbedingungen für die Durchführung des
Luftverkehrs und die Produktion der Luftfahrtindustrie vorgeben
2
. Fluggesellschaften,
Flugsicherungsinstitutionen, Flughafenbetreiber etc. können nur gemeinsam einen
reibungslosen Flugverkehr garantieren organisatorisch und institutionell sind sie jedoch
getrennt. Diese Organisationsform stellt einen wichtigen Referenzfall eines Netzsektors dar
3
.
1
Vgl. Knieps, G., Brunekreeft, S. 11.
2
mehr dazu vgl. Pompl, W., S.10 ff.
3
Vgl. Knieps, G. (Wettbewerb), S. 68.
Schnäppchenflieger über den Wolken
5
Abb. 1: Das System Luftverkehrswirtschaft
Das Luftverkehrssystem ist je nach Zweckbestimmung in militärischen und zivilen, privaten
und öffentlichen Luftverkehr untergliedert. Der öffentliche Luftverkehr, dessen Träger die
Luftverkehrsgesellschaften sind, steht jedermann im Rahmen allgemeiner
Beförderungsbestimmungen offen
4
. Im öffentlichen Luftverkehr wird weiterhin nach Linien- und
Charterverkehr unterschieden. Unter Linienflugverkehr versteht man staatlich genehmigten
Personenluftverkehr, der gemäß Luftverkehrsgesetz der Bundesrepublik Deutschland
,,regelmäßig" und ,,öffentlich"
5
durchführt wird. Dazu benötigt das Luftfahrtunternehmen für jede
Fluglinie eine besondere Genehmigung, die sich auf die Flugpläne, Beförderungsentgelte und
-bedingungen bezieht. Der Charterflug in der Bundesrepublik Deutschland wird nach § 22
LuftVG Gelegenheitsverkehr genannt, der keine Konkurrenz zum Linienverkehr darstellen darf.
Dabei handelt es sich um gewerblichen Gelegenheitsverkehr, in der Regel zur Durchführung
von Pauschalreisen. Charterfluggesellschaften unterliegen nicht den gesetzlichen
Forderungen nach Flugplanveröffentlichung, Tarifgenehmigung und Beförderungspflicht
6
,
denen Linienfluggesellschaften unterworfen sind.
4
Vgl. Gröner, H., S. 10.
5
Vgl. LuftVG: § 21 Abs. 1-2.
6
Vgl. mehr zur Abgrenzung Linien- und Charterflug vgl. Schwenk, W., S. 457 ff. und 620 ff.
Fluggesellschaften
Agenturen
Reiseveranstalter
Speditionsgewerbe
Consolidators
Kunden
Internationale Institutionen:
-
EU-Gremien
-
EUROCONTROL
-
ECAC
-
ICAO
Private Organisationen:
-
Produzentengewerbe
-
Verbraucherorganisationen
-
Umweltschutzorganisationen
-
Industrieverbände
Luftfahrtindustrie:
-
Hersteller von Fluggeräten
-
Produzenten von
Abwicklungseinrichtungen
- Versicherungen
Finanzierungsinstitutionen:
-
Banken
-
Leasingunternehmen
-
öffentlicher Haushalte
Infrastrukturträger:
-
Flughäfen
-
Handling Agents
-
Datennetze,
Computerreservierungs-
systeme
-
Wetterdienste
-
Kommunikationseinrichtungen
Luftverkehrsverwaltung:
-
Bundesministerien
-
Länderministerien
-
Genehmigungs- und
Aufsichtsbehörden
Quelle: vgl. Pompl, W., S. 11
.
Schnäppchenflieger über den Wolken
6
In der vorliegenden Arbeit wird ausschließlich die Passagierbeförderung des öffentlichen
Linienflugverkehrs in Europa und in Deutschland eine Rolle spielen. In den Bereichen
Beförderung von Post und Fracht sowie Charterluftverkehr ist nicht ein durch die Marktöffnung
hervorgerufener Strukturwandel wie im Linienflugverkehr zu beobachten. Sie bleiben in der
Arbeit unberücksichtigt.
Netzinfrastrukturleistungen gehen meist Hand in Hand mit einer Konzentration der Marktmacht
auf einzelne Unternehmen. Durch die Entstehung von Monopolen oder monopolistischen
Marktstrukturen leidet meist die wohlfahrtstheoretisch gewünschte Effizienz einer allein auf
Selbstregulierung der Marktakteure basierten Marktordnung. Dies schafft die Legitimations-
grundlage für ein gesellschaftspolitisch begründetes Eingreifen von Regulierungsinstitutionen,
die der Marktmacht einzelner Akteure Grenzen setzt und so wohlfahrtstheoretisch bessere
Lösungen des Wirtschaftsgeschehens herbeiführt. Die Öffnung des Wettbewerbs betrifft vor
allem den europäischen Linienflugverkehr und legt dessen große Wettbewerbspotentiale
offen. Deutschland hat hierzu maßgebliche Impulse von der Europäischen Union empfangen,
in der nicht nur der Nutzen der Liberalisierung erkannt worden war, sondern auch die
Schaffung von gemeinsamen Märkten auch in anderen Netzsektoren vorangetrieben
wurde. Diese Entwicklung führte zu erheblichen Veränderungen für die bisherigen
Marktteilnehmer des Luftverkehrs.
Schnäppchenflieger über den Wolken
7
Erster Teil: Vom Monopol zum liberalisierten Markt
Kapitel 2
Grundlagen des Luftverkehrs
Der Luftverkehrswirtschaft werden in der Literatur Besonderheiten zugeordnet, die diese von
anderen Wirtschaftssektoren unterscheidet. Sie beziehen sich auf das Produkt Flugreise
selbst, auf die Struktur der Nachfrage und auf die Produktions- und Angebotsbedingungen.
Die Auswirkungen dieser spezifischen Charakteristika finden ihren Ausdruck in den vielfältigen
Strategien und Angeboten der Fluggesellschaften und in der intensiven staatlichen
Regulierung des Luftverkehrssystems. Zunächst erfolgt ein kurzer Überblick über die
Besonderheiten des Luftverkehrs.
2.1 Eigenschaften des Produktes Flugreise
Die Grundleistung des Produktes Flugreise ist die Beförderung eines Passagiers von einem
Ausgangsort zu einem Zielort. Diese Leistung wird durch Serviceleistungen vor Beginn,
während und nach Beendigung des Fluges ergänzt. Durch die Homogenität der Grundleistung
selbst bestehen für eine Fluggesellschaft nur eingeschränkte Möglichkeiten, sich durch
Produktdifferenzierung stark von Konkurrenten zu unterscheiden
7
. Da infolge der staatlichen
Tarifregelungen die Preise für einen bestimmten Flug häufig gleich waren, galten bis zur
Liberalisierung neben Flugplan, also Flugroute und -zeiten, die Serviceleistungen rund um die
Grundleistung als wichtigste Wettbewerbsparameter in der Luftverkehrsbranche.
Aus der Immaterialität des Produktes
8
Flugreise ergibt sich, dass der Passagier das Produkt
vor Kauf nicht in Augenschein nehmen kann. Es handelt sich vielmehr um den Kauf eines
Anspruchs auf eine Leistung, deren Qualität noch ungewiss ist. Der Passagier kauft in
Erwartung einer ordnungsgemäßen Leistung, bei der - anders als bei materiellen Produkten -
eine Vorausbezahlungspflicht besteht. Wichtig für eine Fluggesellschaft ist es, für den Kunden
das Leistungspotential und die Qualität der Leistung in den Vordergrund zu stellen. Dies wird
zum Beispiel über vertrauensschaffende Markenbildung und Werbemaßnahmen erreicht.
7
Vgl. Pompl, W., S. 37.
8
Vgl. Pompl, W., S. 37.
Schnäppchenflieger über den Wolken
8
Da der Konsum- und Leistungsprozess simultan
9
erfolgt, ist eine Produktion auf Vorrat und
eine Lagerfähigkeit der Leistungen Flugreise unmöglich. Ein auf einem Flug leer gebliebener
Sitz ist eine unwiederbringliche, nicht mehr nutzbare Produkteinheit. Die Erreichung eines
kostendeckenden durchschnittlichen Sitzladefaktors
10
eines Fluggerätes wird deshalb zum
entscheidenden Kriterium eines wirtschaftlichen Streckenergebnisses
11
.
Ein wesentliches Merkmal des Luftverkehrs ist schließlich, dass dem Faktor Sicherheit
höchste Priorität gilt. Die staatlichen Zulassungs- und Aufsichtsbehörden üben eine strenge
Kontrolle über technische Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der
Fluggesellschaften aus. Die Einhaltung der Verkehrssicherheit wird durch die Vorgabe von
Sicherheitsstandards, Vorschriften zur Wartung sowie die Anwendung eines Haftungsrechts
gewährleistet.
2.2 Besonderheiten der Nachfrage
Hinter einem langfristig stabilen Wachstum
12
der Luftverkehrsbranche verbirgt sich eine sehr
hohe Zyklizität. Das jährliche Nachfragewachstum schwankt, da die Nachfrage nach Flug-
reisen - insbesondere bei politischen Ereignissen
13
- hochsensibel reagiert und damit als sehr
krisenanfällig gilt. Das Wachstum des Luftverkehrs ist an die Entwicklung des
Bruttosozialproduktes gekoppelt. Die zyklischen Ausschläge sind allerdings fast immer größer
als die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Hinzu kommen erhebliche
Nachfrageschwankungen, die sich nach Reise- und Saisonzeiten richten. Im Geschäfts-
reiseverkehr gilt, dass Montag und Freitag die nachfragestärksten Tage sind. Urlaubs- bzw.
Privatreisende fliegen vermehrt am Wochenende und zu Saisonzeiten.
Daraus resultieren je nach Tages- und Saisonzeiten unterschiedliche Sitzladefaktoren bzw.
Nachfragemengen, wodurch eine kontinuierlich hohe durchschnittliche Auslastung der
angebotenen Kapazitäten verhindert wird. Gleichzeitig ergeben sich unterschiedliche
Kundensegmente mit variierenden Preiselastizitäten und qualitativen Ansprüchen.
9
Vgl. Jäckel, K., S.79.
10
Der Sitzladefaktor entspricht dem Anteil beförderter Passagiere an der Gesamtzahl
angebotener Sitzplätze, die eine Fluggesellschaft im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum
erreicht.
11
Vgl. Pompl, W., S. 37.
12
Von 1990 bis 2002 wies das Weltverkehrsaufkommen der Luftverkehrsbranche ein stabiles
durchschnittliches Wachstum von 4,5% p.a. auf, vgl. Hollmeier, S., S.3.
13
Als gutes Beispiel gilt der Nachfragerückgang nach den Ereignissen des 11.September 2001: Fast
ein Jahr nach den Anschlägen lag der Verkehrsrückgang für die Mitglieder der Association of
European Airlines (AEA) immer noch bei 10,8 Prozent, auf dem Nordatlantik sogar bei 19,6 Prozent,
vgl. Die Zeit, 38/2002, S.1.
Schnäppchenflieger über den Wolken
9
Fluggesellschaften nutzen diese Unterscheidung in der Nachfrage zu einer
Preisdifferenzierung nach dem Reisezeitpunkt mit dem doppelten Ziel der Abschöpfung der
höheren Ausgabebereitschaft in der Hochsaison und der Entzerrung der Nachfrage zur
gleichmäßigeren Auslastung der Produktionskapazitäten
14
. Weitere extreme Formen der
Preisdifferenzierung im Luftverkehr werden im Zusammenhang mit den Billigfluggesellschaften
dargestellt.
2.3 Besonderheiten des Angebots
Ausgeprägter als in anderen Industrien steht der Luftverkehr einem Branchendilemma
gegenüber, indem eine hochsensible Nachfrage auf eine relativ inflexible Angebotsseite
15
trifft:
diese gilt als teilreguliert, personal- und kapitalintensiv und unterliegt langen Planvorlaufzeiten.
Daraus ergibt sich, dass die Gestaltung der Angebotsmenge durch die Fluggesellschaften
relativ unelastisch
16
ist. Die Fluggesellschaften können auf die zeitlichen Unterschiede der
Nachfrage, die auch hinsichtlich der Beförderungsklassen variiert, nur begrenzt mit einer
Anpassung der angebotenen Flugsitze und Fluggeräte reagieren. Die mit den vorab
genehmigten Flugplänen und Routen verbundene Betriebspflicht lässt nicht zu, schlecht
gebuchte Flüge nicht durchzuführen. Auch der bestehende Flugzeugpark einer
Fluggesellschaft ermöglicht keinen unbegrenzten Wechsel des Flugzeugtyps, da die
verfügbaren Flugzeuge wegen der unterschiedlichen Reichweiten und des verplanten
Einsatzes nicht beliebig austauschbar sind.
Kostenstruktur
Netzgebundene Infrastruktureinrichtungen bedeuten in der Regel hohe Fixkosten und geringe
variable Kosten
17
. Eine Fluggesellschaft ist durch hohe direkte variable Kosten
(beförderungsabhängige und flugabhängige Kosten), hohe Fixkosten (direkte und indirekte
Fixkosten) und relativ geringe Grenzkosten pro Passagier bzw. verkauften Sitz
gekennzeichnet. Dies ergibt sich durch die hohe Anlagenintensität einer
Luftverkehrsgesellschaft, d.h. großen Anschaffungskosten für Flugzeuge, Werften und
Gebäude, die gemessen an der Bilanzsumme im Durchschnitt 50 bis 70 Prozent
18
betragen.
Das Fluggerät stellt den wichtigsten, aber auch kapitalintensivsten Produktionsfaktor dar. Die
direkten Fixkosten (Abschreibung auf Fluggeräte, Leasingkosten, Technikkosten) und die
indirekten Fixkosten (Kosten der Administration) sind hoch und bleiben für die Periode eines
geltenden Flugplans konstant.
14
Vgl. Pompl, W., S. 200.
15
Vgl. Hollmeier, S., S. 13.
16
Vgl. Pompl, W., S. 40.
17
Vgl. Knieps, G., Brunekreeft, G., S. 9.
18
Vgl. Diegruber, J., S. 144 ff.
Schnäppchenflieger über den Wolken
10
Die flugabhängigen Kosten für Treibstoff, Navigations- und Flughafengebühren, Flugsicherung
und Bordservicekosten haben den höchsten Anteil an den variablen Kosten. Die
beförderungsabhängigen Kosten für einen zusätzlichen Passagier (Agenturprovision,
Bordverpflegung, Abfertigung) machen dagegen einen kleinen Anteil der Gesamtkosten aus.
Durch den relativ geringen Grenzkostenanteil an den Gesamtkosten ergibt sich innerhalb der
Luftverkehrsbranche eine starke Preissensivität des Angebots einer Luftverkehrsgesellschaft,
da jede Beförderungsleistung zu einem Preis, der oberhalb der Grenzkosten liegt, einen
positiven Deckungsbeitrag liefert
19
. Durch die geringen Grenzkosten kann ein intensiver Kampf
um Kunden in dieser Branche zu ruinösem Wettbewerb führen. Ein ruinöser Wettbewerb kann
dazu führen, dass die Verdrängung schwächerer Konkurrenten eine Anstieg des
Konzentrationsgrades des Marktes zu Folge hat. Regierungen erklärten früher auch mit dieser
Gefahr die Schutz- und Regulierungsbemühungen.
Preisdifferenzierung
Linienfluggesellschaften haben aufgrund der Besonderheiten des Angebots und der Nachfrage
eine sehr komplexe Preisstruktur entwickelt, die zu heftigen Diskussionen unter Ökonomen
führte
20
. Im Zentrum der Diskussion steht die Frage, in welchem Umfang der beobachtete
Grad der Preisdifferenzierung über eine bessere Auslastung des Fluggerätes zu höherer
Effizienz führt oder Preisdifferenzierung allein auf die Ausschöpfung unterschiedlicher
Zahlungsbereitschaften von Nachfragern zurückzuführen ist.
Die komplexe Preisstruktur im Linienflugverkehr ist Ausdruck von Marktmacht der etablierten
Fluggesellschaften und das Ergebnis einer erfolgreichen Preisdifferenzierung dritten Grades.
Preisdifferenzierung dritten Grades liegt dann vor, wenn identische Einheiten eines
homogenen Gutes je nach der Preiselastizität der Nachfrage zu unterschiedlichen Preisen
verkauft werden
21
. Voraussetzung für eine erfolgreiche Anwendung der Preisdifferenzierung ist
die Heterogenität der Reisenden bzw. die Möglichkeit, die Nachfrage in einzelne Gruppen zu
segmentieren. Im Linienluftverkehr wird im Wesentlichen unterschieden zwischen räumlicher,
zeitlicher, mengenmäßiger und personeller Preisdifferenzierung
22
. Da Flugpreise vom
Grundsatz her Entfernungstarife
23
sind, besteht also räumliche Preisdifferenzierung, die durch
die Unterschiede in der Ausgabebereitschaft bezüglich der Flugstrecke oder der Nachfrage in
der jeweiligen Angebotsregion begründet wird. Die zeitliche Preisdifferenzierung richtet sich
nach dem Reisezeitpunkt (z.B. Saisonzeiten, Reservierungszeitpunkt) und die mengenmäßige
19
Vgl. Diegruber, J., S. 144.
20
Vgl. Weinhold, M.D., S. 34.
21
Vgl. Bühler, S., Jaeger, F., S. 67 ff.
22
Vgl. Pompl, W., S. 198 ff.
23
Der Flugpreis steigt i.d.R. degressiv mit zunehmender Entfernung.
Schnäppchenflieger über den Wolken
11
Preisdifferenzierung nach der nachgefragten Menge (z.B. Gruppentarife, Ehepartnertarife).
Personelle Preise richten sich nach personenbezogenen Merkmalen (z.B. Student, Kinder).
Dadurch ergibt sich für Fluggesellschaften eine hohe Anzahl an Teilmärkten mit
unterschiedlichen Preiselastizitäten. Auf diese Weise werden die Nachfrager in Märkten mit
höherer Preiselastizität auf Kosten der Nachfrager in Märkten mit geringerer Preiselastizität
bevorteilt. Das betriebswirtschaftliche Ziel der Preisdifferenzierung besteht darin, das
Nachfragepotential mengen- und preisbezogen optimal auszuschöpfen
24
. Dem preispolitischen
Gestaltungsspielraum sind aber durch die zunehmende Wettbewerbsintensität und die
Offenheit des Marktes zunehmend Grenzen gesetzt
25
, wie im späteren Verlauf der Arbeit noch
erläutert wird.
2.4 Besonderheiten des europäischen Luftverkehrs
Der Linienflugverkehr in den europäischen Staaten weist einen starken grenzüberschreitenden
Charakter mit hohem Ziel- und Umsteigeverkehr im Interkontinentalverkehr
26
auf - dabei
vorwiegend zwischen den USA und Südostasien. Zu erklären ist die internationale Ausrichtung
mit den in Europa vorherrschenden geringen Ländergrößen und dem daraus resultierenden
hohen Substitutionspotential alternativer Verkehrsmittel (Eisenbahn, Auto). Im Jahr 1996
erbrachten die europäischen Fluggesellschaften (ohne die Russische Förderation) 22 Prozent
des weltweiten Verkehrsaufkommens. 53,9 Prozent aller internationalen Abflüge erfolgten in
Europa
27
. Somit unterliegen alle europäischen Fluggesellschaften auch den internationalen
Vereinbarungen und Verträgen.
Als weiteres Charakteristikum des europäischen Marktes ist hervorzuheben, dass - trotz der
genannten geographischen Besonderheit - jedes Land über zumindest eine eigene
Fluggesellschaft verfügt (sog. ,,National Flag Carrier"), die am internationalen Verkehr
teilnimmt. Die Wettbewerbsbedingungen der National Flag Carrier sind je nach Land höchst
unterschiedlich, insbesondere hinsichtlich der staatlichen Beteiligung, der Rigidität
protektionistischer Maßnahmen, der Erteilung von Verkehrsrechten und der rechtlichen
Rahmenbedingungen. Die Wettbewerbsstruktur der Luftverkehrsbranche in Europa weist
folglich eine starke Fragmentierung auf, d.h. die konkurrierenden National Carrier besitzen
europaweit weder signifikante Marktanteile noch können sie selbst das Branchenergebnis
24
Vgl. Pompl, W., S. 197.
25
Vgl. Weinhold, M.D., S. 33 f.
26
Vgl. Piepelow, V., S. 79 f.
27
Berechnet nach ICAO Journal, No. 6, 1997, S.15, vgl. Pompl, W., S.3.
Schnäppchenflieger über den Wolken
12
stark beeinflussen
28
. Im Jahr 1990 gab es 20 nationale europäische
Linienflugverkehrsgesellschaften, die der Association of European Airlines (AEA)
angeschlossen sind. Abgesichert durch das Netz bilateraler und privatwirtschaftlicher
Abkommen teilten sich die Fluggesellschaften die Märkte zum gegenseitigen Nutzen auf. Die
Summe der Marktanteile der vier größten nationalen Fluggesellschaften zeigt einen relativ
hohen Konzentrationsgrad der Luftverkehrsgesellschaften
29
: Im Jahr 1993 vereinten die vier
Gesellschaften - British Airways, Lufthansa, Air France und KLM - 66,5 Prozent der gesamten
europäischen Verkehrsleistung auf sich.
Anders als in den europäischen Staaten gab es zu Beginn der Deregulierung in den USA, die
bereits 1978 mit dem sog. ,,Deregulation Act" initiiert wurde, acht große Fluggesellschaften.
Ein wesentlicher Unterschied dabei ist die Größe des US-Marktes und die damit verbundenen
Längen der Flugstrecken. Daraus resultiert die wesentlich höhere Passagierbeförderungs-
leistung in den USA. Die amerikanische Deregulierung
30
läßt sich mit der Situation in Europa
wegen der unterschiedlichen Ausgangssituationen und Bedingungen im Einzelnen kaum
vergleichen - vor allem begründet mit der unterschiedlichen Branchen- und Marktstruktur und
den unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Kosten und Preise der Fluggesellschaften in
den USA
31
- hat die Deregulierung des amerikanischen Luftverkehrsmarktes auf die
Entwicklungen in Europa einen starken Einfluss ausgeübt. Die Öffnung des amerikanischen
Wettbewerbs führte zu erheblichen Veränderungen und Effizienzsteigerungen im
Luftverkehrsmarkt. In den ersten sechs Jahren nach der Deregulierung traten 87 neue
Linienfluggesellschaften in den amerikanischen Luftverkehrsmarkt. Noch drastischer verlief die
Entwicklung bei den regionalen Fluggesellschaften, deren Zahl der Neuzulassungen nahezu
200 betrug.
28
Vgl. Diegruber, J., S. 223 f.
29
Association of European Airlines, AEA-Yearbook 1993.
30
Mehr zur Deregulierung in den USA vgl. Diegruber, J., S. 193 ff.
31
Mehr über die Grenzen und Möglichkeiten der Vergleichbarkeit der Deregulierung in den USA und in
Europa vgl. Diegruber, J., S. 201 ff.
Schnäppchenflieger über den Wolken
13
Kapitel 3
Der ordnungspolitische Rahmen
Wie haben sich die heutigen Marktstrukturen herausgebildet und wie können die
Marktteilnehmer im Luftverkehr durch ihr Verhalten die Marktstruktur beeinflussen? Dies sind
die wichtigen Fragen, die in diesem Kapitel untersucht werden. Zunächst erfolgt eine
Darstellung der staatlichen Regulierung sowie der internationalen Vereinbarungen zwischen
den Fluggesellschaften, die für den Wettbewerbsprozess im Luftverkehr relevant sind. Damit
steht die ökonomische Regulierung im Mittelpunkt. Technische Auflagen, wie Sicherheits-
bestimmungen und Umweltstandards, werden dabei nicht betrachtet.
Der Luftverkehr wird aufgrund der technologischen Netzeigenschaften als natürliches Monopol
charakterisiert. Ein natürliches Monopol kennzeichnet sich dadurch, dass ein Unternehmen
den Markt kostengünstiger bedienen kann als mehrere Anbieter
32
, wobei Bündelungsvorteile
und Skaleneffekte aufgrund der Netzwerkinfrastruktur eine große Rolle spielen. Die
Marktstrategie aus Sicht der Monopolunternehmen richtet sich vor allem darauf, den Zugang
zum Markt zu erschweren oder unmöglich zu machen und seine Gewinnposition zu
verbessern
33
. Bis 1988 besaß die Lufthansa ein Monopol auf innerdeutschen
Flugverbindungen, da keine weiteren Fluggenehmigungen vom Verkehrsministerium vergeben
wurden. Die Deutsche Lufthansa dominierte noch im Jahre 1990 den deutschen Luftverkehr
mit 99 Prozent
34
. Nur auf Nebenstrecken existierten Regionalfluggesellschaften, die teilweise
Tochterunternehmen der Lufthansa waren (z.B. Deutsche Luftverkehrsgesellschaft DLT), fast
immer aber in Kooperation mit der Lufthansa ihre Dienste anboten.
Natürliche Monopole waren in der Vergangenheit ein wesentliches Argument zur
Rechtfertigung staatlicher Regulierungseingriffe aus Effizienzgründen. Dabei wurden drei
wesentliche Regulierungsmaßnahmen kombiniert
35
: Marktzutrittsregulierung durch gesetzliche
Marktzutrittsschranken, Regulierung der Monopolmacht (Preisregulierung) und Regulierung
mit dem Ziel der Versorgungspflicht zu einem sozial erwünschten Preis.
32
Bei Netzwerkinfrastrukturen, wie z.B. Luftverkehr oder Telekommunikation, bringen die zugrunde
liegenden Technologien sehr hohe Fixkosten mit sich (Aufbau, Instandhaltung) und niedrige
Grenzkosten für die Bereitstellung zusätzlicher Einheiten. Die hohen Kosten können eine Ineffizienz
bzw. negative Gewinne trotz Monopolstellung hervorrufen, vgl. Vahlen, H.R., S. 390 ff.
33
Vgl. Woll, A., S. 197 f.
34
1990 erhielt schließlich die nach der Lufthansa zweitgrößte innerdeutsche Fluggesellschaft LTU vom
Bundesministerium für Verkehr die Erlaubnis für Linienflüge, vgl. Piepelow, V., S. 87.
35
Vgl. Knieps, G. (Wettbewerbsökonomie), S.28.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832467029
- ISBN (Paperback)
- 9783838667027
- DOI
- 10.3239/9783832467029
- Dateigröße
- 765 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Witten/Herdecke – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Mai)
- Note
- 2,1
- Schlagworte
- billigfluggesellschaften deregulierung erfolgsfaktoren fluggesellschaften wettbewerbsökonomie preisbildungsstrategie
- Produktsicherheit
- Diplom.de