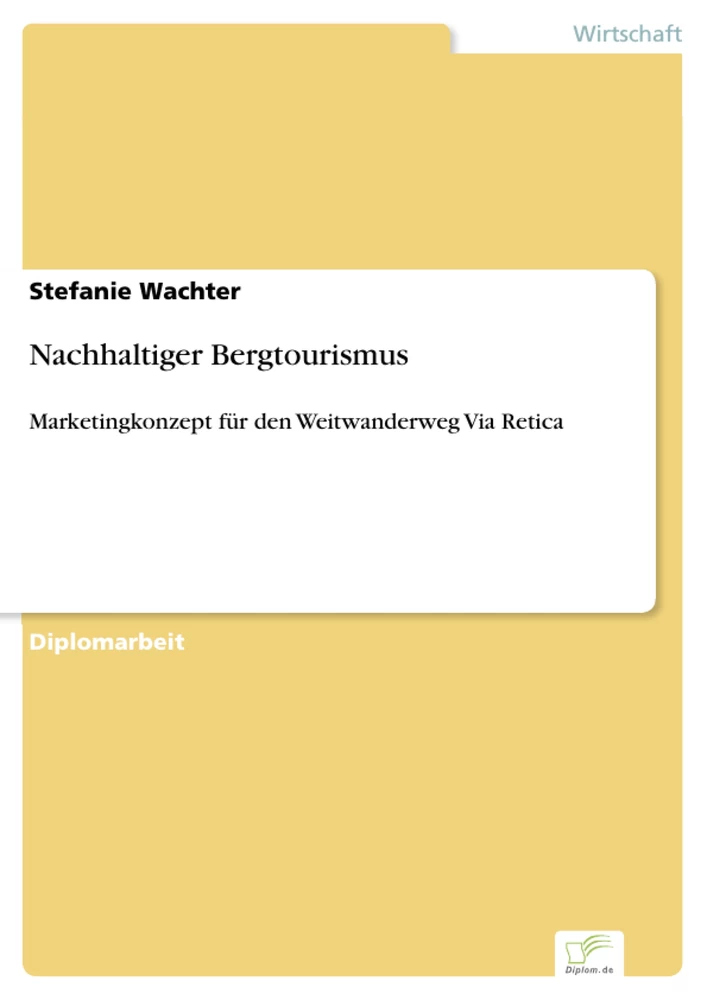Nachhaltiger Bergtourismus
Marketingkonzept für den Weitwanderweg Via Retica
Zusammenfassung
Für die Sicherung der zukünftigen Lebensgrundlagen in den Alpen ist eine Erweiterung unseres Denkens und Handelns auf horizontaler und vertikaler Ebene, d. h. sektorübergreifend und auf einen langen Planungshorizont ausgerichtet, unerlässlich. Zu einer langfristigen nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums gehören politische Lenkungsprozesse und grenzenüberschreitende Staatsverträge. Mit der Alpenkonvention wurde ein erster Meilenstein zu einer einheitlichen Regelung alpiner Nutz- und Schutzinteressen auf internationaler Ebene geschaffen. Die Europäische Union und die Regierungen der einzelnen Länder schaffen durch spezielle Förderprogramme den Rahmen für eine umwelt- und sozialverträgliche Entwicklung in den Alpen. Inwiefern innovative, branchenübergreifende Tourismusprojekte zur Umsetzung der Protokolle der Alpenkonvention beitragen können, wird in der vorliegenden Arbeit am Beispiel des Weitwanderweges Via Retica gezeigt. Das ausgearbeitete Marketingkonzept soll mit seinen nachhaltigen Ansätzen und Ideen eine Richtschnur für die optimale Produktgestaltung und Vermarktung der Via Retica liefern sowie Anreize für ähnliche Entwicklungsprogramme in anderen ländlichen Regionen schaffen.
Nach den ersten Gesprächen zu urteilen ist auf Seiten der Gemeinden und Tourismusorganisationen des Prättigaus, Montafons und Liechtensteins großes Interesse an der Markteinführung der Via Retica vorhanden. Geklärt werden muss noch die Frage der Finanzierung, bzw. der Kapitalgeber, welcher die Alpenbüro Netz GmbH als Initiator und Leiter des Projekts jedoch zuversichtlich gegenübersteht.
In der vorliegenden Arbeit wird aufgezeigt, dass ein entsprechender Markt für den Absatz der Via Retica vorhanden ist und erörtert, auf welche Weise die einzelnen Marktsegmente am sinnvollsten angesprochen werden sollten. Im Bereich der Angebotsgestaltung werden Vorschläge zur nachhaltigen Verbesserung der Wege-, Übernachtungs-, Verpflegungs- und Serviceleistungen erarbeitet und ein konkretes Verkaufspaket zusammengestellt. Inwieweit das Konzept erfolgreich umgesetzt werden kann, wird größtenteils davon abhängen, inwieweit es gelingt, die beteiligten Akteure (v. a. die Hüttenwarte) für die nachhaltigen Ideen zu sensibilisieren und zu begeistern. Nur durch kollektives Engagement und Investitionsbereitschaft werden die Anforderungen an eine hohe Produktqualität zur Zufriedenheit der Gäste und im Einklang mit der Natur und einheimischen Bevölkerung erfüllt […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A. Nachhaltiger Tourismus in Bergregionen
I. Tourismusproblematik in Gebirgsregionen
II. Aktuelle Entwicklungssituation in den Alpen
1. Tourismus und Landschaft
2. Energie und Verkehr
3. Notwendigkeit der Regionalorientierung
III. Lösungsansätze der Alpenkonvention
1. Grundlegende Ziele und Inhalte der Alpenkonvention
2. Protokolle und Umsetzung auf regionaler Ebene
B. Marketingkonzept für die Via Retica unter Berücksichtigung nachhaltiger Gesichtspunkte
I. Idee des Weitwanderweges Via Retica
II. Analyse
1. Globale Umweltanalyse
a) Wachstumsnische Ökotourismus
b) Entwicklung des Wandertourismus
2. Marktanalyse
a) Potenzieller Markt für die Via Retica
b) Nachfrageanalyse
α) Profil des Wanderers
β) Profil des Ökotouristen
c) Analyse vergleichbarer Weitwanderwege
α ) Kulturweg Alpen
β) Grenzpfad Napfbergland
γ) Via Valtellina
δ) Via Spluga
ε) Zusammenfassende Gegenüberstellung
3. Angebotsanalyse
a) Bestandteile der Via Retica
α) Route, Verkehrsanbindung, Wegenetz und Markierung
β) Beherbergung, Gastronomie und Dienstleistungsqualität
γ) Kulturelles Engagement und Umweltschutz
δ) Gästestruktur und Hüttenmarketing
ε) Einstellung der Hüttenwarte zur Via Retica
b) Abhebung von anderen kulturellen Wegen
c) Einfügung in übergreifende Leitbilder
α) Positionierung von Graubünden, Vorarlberg und Liechtenstein
β) Internationaler Naturpark
γ) Fernwanderweg Via Alpina
III. Konzeption
1. Beurteilung der Markteinführung der Via Retica
2. Zielformulierung und Positionierungsentscheid
3. Auswahl der Marketingstrategien
a) Marktsegmentierung
b) Qualitative Differenzierung
c) Präferenzstrategie
IV. Gestaltung
1. Finanzierung des Projekts
a) INTERREG III A und Kofinanzierung
b) Gewinnung potenzieller Geldgeber
2. Auswahl der Marketinginstrumente
a) Produktpolitik
b) Preispolitik
α) Preisfestsetzung
β) Preisdifferenzierung
c) Distributionspolitik
d) Kommunikationspolitik
α) Logo
β) Werbung
γ) Verkaufsförderung
δ) Public Relation
3. Kostenplan
C. Fazit
Anhang I: Anwendungsbereich der Alpenkonvention
Anhang II: Karte Via Retica
Anhang III: Kleiner Wanderführer
Anhang IV: Fragebogen für Hüttenwarte
Anhang V: Ergebnisse der Hüttenbestandsaufnahme
Anhang VI: Prospekt Via Alpina
Anhang VII: Lebensmittelkreis
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Wachstum und Abwanderung
Abb. 2: Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Alpenraum
Abb. 3: Verkehrsmittelwahl der deutschen Alpenurlauber 1998
Abb. 4: Verkehrsmittelwahl in Schweizer Ferienorte und Städte
Abb. 5: Kauf eines teureren Produktes / Verzicht auf Komfort zugunsten der Umwelt
Abb. 6: Definition von Spazieren, Wandern und Bergsteigen
Abb. 8: „Besonders wichtige“ Urlaubsmotive der Deutschen 1999 (in %)
Abb. 9: Reisemotive der Schweizer bei Inland-Reisen (in %)
Abb. 10: Chancen und Risiken des Wandertourismus
Abb. 11: Gästeherkunft Graubünden 2000
Abb. 12: Gästeherkunft Vorarlberg 2000
Abb. 13: Gästeherkunft Liechtenstein 2000
Abb. 14: Deutsche Wanderer nach Alter und Geschlecht
Abb. 15: Motivationen der deutschen Wanderer
Abb. 16: Motivationen der Vorarlberger Wanderer
Abb. 17: Berufsgruppen der Wanderer
Abb. 18: Zusammenfassung der nderprofile
Abb. 19: Verpflegung von regelmäßig in Berghütten Übernachtenden
Abb. 20: Informationsquellen für naturnahen Tourismus
Abb. 21: Wirksamste Werbemittel für naturnahen Tourismus
Abb. 22: Analyse vergleichbarer Wanderwege (Teil 1)
Abb. 23: Analyse vergleichbarer Wanderwege (Teil 2)
Abb. 24: Wegmarkierung
Abb. 25: Übernachtungspreise der Bergunterkünfte
Abb. 26: SWOT-Analyse für die Via Retica
Abb. 27: Leitbild für die Via Retica
Abb. 28: Preiskalkulation Via Retica
Abb. 29: Logo Via Retica
Abb. 30: Zielgruppenorientierte Werbebotschaften
Abb. 31: Budget 2002 – 2005 (in CHF)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A. Nachhaltiger Tourismus in Bergregionen
I. Tourismusproblematik in Gebirgsregionen
Während sich in den Alpen seit Anfang des 19. Jahrhunderts die verschiedensten touristischen und sportlichen Aktivitäten entwickelten, trugen der wachsende Wohlstand, steigende Einkommen und die größer werdende Freizeit nach dem zweiten Weltkrieg dazu bei, dass sich der Bergtourismus bis zu den entferntesten Gipfeln der Welt ausdehnte. Insbesondere durch die Technisierung der Gebirge, ihre leichtere Erreichbarkeit im Zuge der Globalisierung, die zunehmende Reisemobilität sowie die steigende Nachfrage nach Freizeit- und Sporturlauben erfreut sich der Bergtourismus weltweit großer Beliebtheit.[1]
Der Tourismus hat für viele Bergregionen eine enorme wirtschaftliche Bedeutung, da er der Bevölkerung Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region bietet und eine beachtliche Wertschöpfung induziert. Zudem beschleunigt er die Modernisierung des alten Lebens, finanziert Infrastruktur und stoppt die Abwanderung aus den Berggebieten in größere Städte. Oft ist die touristische Entwicklung das einzige ökonomische Potenzial, das ländliche Bergregionen vorzuweisen haben.[2]
Viele touristisch genutzte Gebirgsregionen haben jedoch mit erheblichen ökologischen Problemen zu kämpfen, wie z. B. Landschaftszerstörung und –zersiedelung, Bodenerosion, Luftverschmutzung, Verlust an Wäldern, Bedrohung des natürlichen Lebensraumes für Tiere und Pflanzen, Abwasser- und Müllproduktion oder Verkehrsbelastung.[3]
Die Sehnsuchtsliteratur und die Tourismuswerbung, die von den lokalen Gegebenheiten, insbesondere den Kulturen der Bergbewohner, vielfach ein falsches, verklärtes Bild liefern, trugen dazu bei, dass sich der Fremdenverkehr in zahlreichen Gebirgsregionen zu einer kulturzerstörerischen Gefahr entwickelte. Den einheimischen Sitten und Bräuchen droht eine kulturelle Abflachung und Anpassung im Gefolge der Kommerzialisierung. Ein Beispiel hierfür ist der weitverbreitete Alpenmythos: Klischees wie die des „trachtlich-kostümierten, ... jodelnden Älpler“[4] oder die als „Heimatmelodien“ bezeichnete Volksmusik aus den Musikantenstadeln werden durch die Tourismuswirtschaft bewusst gefördert und gestärkt. Authentische kulturelle Eigenarten laufen Gefahr als Unterhaltung für die Touristen zum Folklorismus zu verkommen.[5]
Fremdbestimmung, touristische Monostrukturen, Abfluss des eingenommenen Kapitals in die Quellgebiete, Erhöhung des allgemeinen Preisniveaus sowie verstärkter Alkohol- und Drogenmissbrauch v.a. bei den jugendlichen Einheimischen werden als weitere soziokulturelle Auswirkungen des Tourismus in den Bergregionen beobachtet.[6]
Die Gratwanderung zwischen dem ökonomischen Nutzen des Tourismus als Wirtschaftskraft und den möglichen ökologischen und soziokulturellen Gefahren gibt immer wieder Anlass für weltweite Diskussionen in der Tourismuspolitik. Für den Bereich Bergtourismus stellt sich hierbei die Frage, wie Kultur, Natur und Tourismus in Gebirgsregionen in Einklang gebracht werden können, so dass natürliche Ressourcen geschont werden, wirtschaftliche Bedürfnisse befriedigt werden, die Umwelt in ihrer Vielfalt insgesamt erhalten bleibt und traditionelle und kulturelle Identitäten weiterhin bestehen können.[7]
Als Weiterführung der Agenda 21[8], bzw. des Kapitels 13 „Bewirtschaftung empfindlicher Ökosysteme: nachhaltige Bewirtschaftung von Berggebieten“ wurde das Jahr 2002 von der Uno zum „Internationalen Jahr der Berge“ erklärt. Sinn und Zweck dieser Deklaration ist es, das allgemeine Bewusstsein für das Ökosystem Berge und für das Kulturerbe der Bergvölker zu stärken. Durch effektive Zusammenarbeit zwischen Bergbewohnern, Tourismusunternehmen, Umweltschützern und der Privatwirtschaft sowie durch die eigens zu diesem Anlass von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen erarbeiteten Programme soll weltweit eine nachhaltige Entwicklung der Bergregionen gefördert werden.[9]
Die Uno definiert den Begriff „nachhaltige Entwicklung“ als „eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Grundlagen der nachfolgenden Generationen zu gefährden“.[10] Überträgt und präzisiert man diese Definition auf den Bereich Tourismus, muss dieser „langfristig ökologisch tragbar, wirtschaftlich machbar sowie ethisch und sozial gerecht für die Einheimischen“[11] sein, um als nachhaltig zu gelten.
II. Aktuelle Entwicklungssituation in den Alpen
1. Tourismus und Landschaft
Die Alpen als Lebens- und Kulturraum für 14 Millionen Menschen sind jedes Jahr Ferienziel für 100 Millionen Gäste. Verteilt auf 3500 Gemeinden werden jährlich 300 Millionen Übernachtungen gezählt, 40% aller Gemeinden verzeichnen jedoch so gut wie keine Touristen.[12]
Neben den bereits oben beschriebenen Problemen der Gebirgsregionen sind die Alpen v. a. der Übernutzung als Folge von Wohlstandsproblemen ausgesetzt, die im überbordenden Transit- und Tourismusverkehr und der übermäßigen Energienutzung zum Ausdruck kommt Ein weiteres alpenspezifisches Phänomen ist die riesige Konzentration von Besuchern in wenigen Orten und für einen kurzen Zeitraum.[13]
Nur 10 - 20% des Alpenraums sind topographisch begünstigt und mit Infrastruktur für eine intensive Nutzung durch den Menschen ausgerüstet, was einen enormen Druck auf diese Gunstlagen zur Folge hat. Mit der Abwanderung in die intensiv genutzten Ballungsräume schreitet die Entvölkerung und Entleerung entlegener Dörfer und Täler voran. Die Infrastruktur in den Abwanderungsregionen kann durch mangelnde Auslastung oft nicht erhalten werden, was zu einem weiteren Attraktivitätsverlust für Einheimische und Touristen führt. Als Folge ist eine Verstädterung der Haupttäler und Tourismushochburgen zu beobachten.[14] Die unterschiedlichen Entwicklungstrends werden in der folgenden Tabelle anhand von sechs ausgewählten Beispielen veranschaulicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Glauser, P./Siegrist, D., Schauplatz Alpen, 1997, S. 13.
Abb. 1: Wachstum und Abwanderung
Auch wenn man unterstellt, dass mit den insgesamt rund 13.000 Liften und Seilbahnen (das sind 56% aller Anlagen dieser Art in der Welt) die touristische Erschließung im Alpenraum weitgehend abgeschlossen ist, nimmt die Belastung weiter zu: Durch die Trendsportarten wie Mountain- und Downhillbiking, Snowboarding, Paragliding, Drachenfliegen, Rafting, Canyoning und Sportklettern sowie die Zunahme des Individualverkehrs erfolgt eine Schädigung der Bergwaldökosysteme. Neben der Schutzwirkung der Wälder (z. B. gegen Lawinenabgänge) und ihrem wirtschaftlichen Wert (Holzproduktion) spielt auch ihr Beitrag zu einer harmonischen Landschaftskulisse eine große Rolle. Einer Umfrage im Spitzingseegebiet bei Schliersee zufolge messen 92% der befragten Besucher dem Wald eine hohe bzw. sehr hohe Bedeutung für die Erholung im Gebirge zu: Nur ein funktionsfähiger Gebirgswald liefert die schutztechnischen und ästhetischen Voraussetzungen für einen qualifizierten Tourismus in der Alpenregion.[15]
Seit etwa 50 Jahren ist in den Alpen ein Rückgang der Landwirtschaft zu verzeichnen, der im Hinblick auf die Marktliberalisierung und die standörtlichen Produktionsnachteile für alpine Landwirtschaftsbetriebe weiter andauern wird. Trotz Subventionen und anderen staatlichen Hilfestellungen wird die alpine Agrarwirtschaft auf dem europäischen Markt immer weniger konkurrenzfähig sein. Die Wirtschaftskraft der Alpentäler wird dadurch weiter geschwächt, dezentrale Arbeitsplätze gehen verloren, ökologische und landschaftliche Veränderungen setzen ein und die bisherigen Lebens- und Gesellschaftsformen unterliegen einem Wandel.[16]
Der Niedergang der alpinen Berglandwirtschaft zeigt sich deutlich an der Abnahme der Betriebszahlen um jährlich rund 1,5% (vgl. Abb. 2), dem Rückgang der landwirtschaftlichen Nutzfläche in fast allen Ländern sowie der rückläufigen Rinder- und Schweinehaltung v. a. in den Südalpen.[17]
* Eine Aufsummierung ist aufgrund der unterschiedlichen Erhebungszeitpunkte nur bedingt zulässig und soll hier primär den Stellenwert der einzelnen Staaten im Alpenraum verdeutlichen.
Quelle: Staub, R./Buchgraber, U./Dietrich, R./Hilbert, A./Kals, R./Sladek, C/Steininger, K./Tappeiner, U., Daten zur Berglandwirtschaft, in: CIPRA, 2. Alpenreport, 2001, S.155f.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Alpenraum
Allein in der Schweiz sind in den letzten zehn Jahren 25.000 Vollzeitbeschäftigte aufgrund der stark liberalisierten Marktordnung, der hohen Konsumentenansprüche und des Stützungsabbaus aus der Landwirtschaft ausgestiegen, ein Drittel der Betriebe verzeichnet eine negative Eigenkapitalbildung.[18]
Verschärft wird die Situation durch die Ansiedlung auswärtiger und außerregionaler Investoren (z. B. Hoteliers), die oft ihr eigenes Personal und ihre eigenen Produkte mitbringen, anstatt auf einheimische Produkte zurückzugreifen, was neben einer weiteren Existenzbedrohung für die lokalen Bergbauern auch das Ausbleiben positiver ökonomischer Auswirkungen auf die Regionalwirtschaft bedeutet.[19]
Nach einer Umfrage der CIPRA bei ihren Trägerschaften und Mitgliedsverbänden in allen Alpenstaaten (1991) spielt die Berglandwirtschaft in den volkswirtschaftlichen Bilanzen nur noch eine marginale Rolle. Bezieht man jedoch ihre ökologischen und landschaftskulturellen Leistungen mit ein, liegt ihre Bedeutung weit höher. Mit dem Verschwinden der an die alpine Natur angepasste landwirtschaftliche Nutzung droht ein Verlust der traditionellen bäuerlichen Kulturlandschaft[20]. Das Aufgeben traditioneller Landnutzung führt zu Brache und Verbuschung und beeinträchtigt den von den Touristen gesuchten besonderen ästhetischen Reiz der alpinen Landschaft.[21]
2. Energie und Verkehr
Neben ihrer Funktion als Erholungsgebiet für europäische Ballungszentren sind die Alpen wichtiger Trinkwasserspeicher, Energielieferant und Transitkorridor für Westeuropa. – wichtige Funktionen, die jedoch das alpine Ökosystem erheblich belasten.[22]
Im Alpenraum spielt die Energiegewinnung durch Wasserkraft eine zentrale Rolle. In der Schweiz werden etwa 56% der Elektrizität aus Speicher- oder Flusskraftwerken gewonnen, in Österreich sind es sogar 66%. Aufgrund der intensiven Wasserkraftnutzung sind nach einer CIPRA-Studie bereits 79% der Flussökosysteme stark in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt.[23]
Für die Elektrizitätswirtschaft bedeutet der zunehmende Preisdruck durch die Marktöffnung, dass strenge Umweltauflagen eine Bedrohung für die Rentabilität darstellen und die Bereitschaft zu ökologischen Verbesserungen entsprechend gering ist. Dennoch ermöglicht der Wettbewerb eine Absetzung von umweltfreundlich erzeugter Energie zu höheren Preisen an ein Klientel, das bereit ist, für die höhere Umweltqualität des Stroms einen Aufschlag zu zahlen.. So wird z. B. Solarenergie oder nach speziellen Umweltauflagen erzeugte Wasserkraft (z. B. Label „naturmade star“) erfolgreich als Ökostrom verkauft.[24]
Verantwortlich für die wohl größte ökologische und soziale Belastung im Alpenraum ist der Straßenverkehr, der neben den indirekten Auswirkungen (Zerschneidung und Flächenverbrauch für Straßen und Parkplätze) durch die hohen Stickoxydimmissionen in den engen Gebirgstälern eine existenzgefährdende Wirkung auf Fauna und Flora ausübt, sowie eine zum Teil unzumutbare Lärm- und Gestanksbelästigung für die Anwohner und Besucher darstellt.[25]
Seit dem 1992 von der EU erklärten freien Warenverkehr nimmt der kontinentale Transitverkehr kontinuierlich zu und erfordert den Bau neuer Hochleistungsstrassen und Lückenschlüsse. Der größte Teil des motorisierten Verkehrs wird jedoch von der inneralpinen Bevölkerung verursacht, gefolgt vom Freizeit- und Urlaubsverkehr. Je nach Verkehrslage des Zielgebietes reisen zwischen 70 und 90% der Alpentouristen mit dem eigenen Pkw an.[26] Die Ergebnisse der Reiseanalyse 1999 zeigen, dass 77% der deutschen Alpenurlauber ihre Reise mit dem Pkw antreten, dagegen nur 15% mit dem Bus und lediglich 7% mit der Bahn (vgl. Abb. 3).[27]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: F.U.R., Reiseanalyse, 1999, S. 105
Abb. 3: Verkehrsmittelwahl der deutschen Alpenurlauber 1998
Eine Umfrage von TopSwiss (Tourismus Profil Schweiz, 1998) bzgl. der Verkehrsmittelwahl für die Anreise in Schweizer Ferienorte und Städte mit mindestens einer Übernachtung ergab, dass 67,4% der in- und ausländischen Feriengäste den Pkw benutzen (vgl. Abb. 4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Vgl. Meier, R., Freizeitverkehr, 1999, S. 101
Abb. 4: Verkehrsmittelwahl in Schweizer Ferienorte und Städte
3. Notwendigkeit der Regionalorientierung
Europa ist derzeit von zwei parallelen Entwicklungen geprägt: Zum einen erfährt es ein Zusammenwachsen in den verschiedensten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen, zum anderen steht der Zentralisierung eine zunehmende Regionalorientierung gegenüber. Dezentralisierung von Wirtschaft und Verwaltung, Identifizierung von endogenen Potentialen, regionale Selbstverantwortung, Regionalbewusstsein und regionale Vernetzungsprojekte sind wichtige Aspekte der Regionalentwicklung im „Europa der Regionen“.[28]
„Regionalpolitik hat immer zum Ziel, Wettbewerbsnachteile auszugleichen.“[29] Gerade die Alpen sind durch ihre starke Abhängigkeit von der außeralpinen Wirtschaft auf die Konzentration regionaler Möglichkeiten und Potenziale angewiesen. Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Bevölkerung, aber auch Natur, Landschaft und Kultur sind dabei von großer Bedeutung für den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten durch die Vernetzung verschiedener Wirtschaftssektoren. Durch die Produktion und Vermarktung qualitativ hochwertiger, regionaltypischer Produkte können Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Regionen erzielt werden. Eine hohe Produktqualität ist die Voraussetzung für das Bestehen im internationalen Wettbewerb. Aufgrund der schwer zu bewirtschaftenden topographischen Lage der Alpen ist eine kostengünstige Produktion kaum möglich, so dass die Produkte (v.a. aus Landwirtschaft und Tourismus) folglich nur zu einem gehobenen Preisniveau über die Qualitätsschiene vermarktet werden können.[30]
Die Vernetzung von Tourismus, Landwirtschaft, Natur- und Landschaftsschutz und Gemeinde ist eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung eigenständiger regionaler Projekte und Wirtschaftskreisläufe. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine Agrarpolitik, die den Bergbauern neben ihren Erlösen aus dem Nahrungsmittelabsatz ein zweites Einkommen für die Erhaltung der alpinen Kulturlandschaft sichert. Diese Direktzahlungen können beispielsweise Entgelte für besonders umweltverträgliche Bewirtschaftung oder für Sonderleistungen zur Pflege schutzbedürftiger Biotope und Aufforstungen sein. Förderungsbedürftig ist die Auszeichnung von anerkannt biologischen Landwirtschaftsbetrieben mit Umweltgütesiegeln sowie eine entsprechende Kennzeichnung und Direktvermarktung ihrer Produkte. So kann nicht nur eine langfristige Absatzgarantie zu Spitzenpreisen erzielt werden, sondern auch ein weiteres Gütemerkmal für das Außenmarketing der Feriengemeinde geschaffen werden. Die Direktvermarktung leistet ihrerseits einen Beitrag zum Umweltschutz durch Vermeidung von Verpackungen und kurzen Transportwegen. Für die Verbesserung der Kooperation zwischen Tourismus und Landwirtschaft ist ferner eine effiziente Öffentlichkeitsarbeit zur Bedeutung der Landwirtschaft für die alpine Kulturlandschaft erforderlich.[31]
III. Lösungsansätze der Alpenkonvention
1. Grundlegende Ziele und Inhalte der Alpenkonvention
Die Alpenländer und die Europäische Gemeinschaft bemühen sich seit 1989 um eine gemeinsame Lösung für die in Kapitel I und II beschriebene ökologische und soziokulturelle Gebirgsproblematik.
Die erstmals 1991 von sieben Alpenstaaten unterzeichnete Alpenkonvention stellt ein völkerrechtliches Vertragswerk zum Schutz von Mensch und Natur im Alpenraum dar. Sie ist der Versuch, Ökologie und Ökonomie, Umweltschutz und Wirtschaft im Alpengebiet in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen und damit die Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Dabei sollen Schutz- und Nutzungsansprüchen gleichermaßen Rechnung getragen werden, d. h. die Alpen sollen unter schonender Nutzung der natürlichen Ressourcen und unter Berücksichtigung der Anliegen der ansässigen Bevölkerung wirtschaftlich gestärkt werden.[32]
Die grundlegenden Ziele und Verpflichtungen der Vertragspartner (Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich, Schweiz, Slowenien, Monaco und die Europäische Union) sind in einer Rahmenkonvention festgelegt. Die konkreten Inhalte und Maßnahmen zur Umsetzung der Alpenkonvention werden in verschiedenen Protokollen von einer internationalen Arbeitsgruppe aus hohen Beamten und NGOs aus allen beteiligten Staaten erarbeitet. Im Idealfall erfolgt anlässlich der alle zwei Jahre stattfindenden Alpenkonferenz eine einstimmige Annahme des Protokolls und die Unterzeichnung der Umweltminister der Vertragsparteien. Seit 1994 sind acht Protokolle von den Alpenländern ratifiziert worden, Liechtenstein unterschrieb im April dieses Jahres als erstes Land alle zwölf Protokolle.[33]
2. Protokolle und Umsetzung auf regionaler Ebene
Folgende acht Protokolle der Alpenkonvention sind bisher in Kraft getreten und werden nun innerstaatlich auf der jeweils geeigneten Ebene der Gebietskörperschaften umgesetzt:[34]
- Berglandwirtschaft
Mit dem Protokoll „Berglandwirtschaft“ soll die Abwanderung und die Zerstörung kultureller Identitäten durch den Verlust von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft gestoppt werden. Umweltgerechte, traditionelle Wirtschaftsweisen sollen aufrechterhalten und der Absatz von Bergprodukten besonders gefördert werden, um die Instandhaltung der einzigartigen Kulturlandschaften zu sichern.
- Bergwald
Das Protokoll „Bergwald“ beinhaltet den Schutz des Bergwaldes durch Senkung der Schadstoffeinträge und die Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung.
- Bodenschutz
Das wichtigste Ziel ist die Erhaltung des Bodens als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen. Das Protokoll strebt eine standortgerechte Bodennutzung und einen sparsamen Umgang mit den Flächen an, sowie die Vermeidung von Erosion und bodenbelastenden Stoffen.
- Energie
Eine umweltverträgliche Erzeugung, Verteilung und Nutzung der Energie soll durchgesetzt sowie energieeinsparende Maßnahmen gefördert werden.
- Naturschutz und Landschaftspflege
Das Protokoll beinhaltet die dauerhafte Sicherung der Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, die Erhaltung der Artenvielfalt und die Ausweitung neuer großflächiger Schutzgebiete. Unter Berücksichtigung der Interessen der einheimischen Bevölkerung sollen Belastungen und Beeinträchtigungen der Natur verringert werden. Als erste alpenweite Umsetzung des Protokolls kann hier das „Netzwerk alpiner Schutzgebiete“ angeführt werden.
- Raumplanung und nachhaltige Entwicklung
Mit dem Protokoll wird eine sparsame und rationelle Raumnutzung der Alpen angestrebt, sowie eine gesunde, harmonische Entwicklung des Gesamtraumes. Strukturschwächen sind zu beseitigen, Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen und regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Ökologisch und kulturell wertvolle Gebiete sollen erhalten, bzw. wiederhergestellt werden.
- Verkehr
Durch die Förderung des umweltfreundlichen öffentlichen Verkehrs und die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene sollen Belastungen und Risiken im Bereich des inneralpinen und alpenquerenden Verkehrs auf ein Maß gesenkt werden, dass für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensräume erträglich ist.
Als gelungenes Beispiel für die Umsetzung des Protokolls ist die Schweizer Alpen-Initiative zu nennen, der es durch entscheidende Maßnahmen gelungen ist, die negativen Auswirkungen des Transitverkehrs in der Schweiz auf ein erhebliches Maß zu reduzieren.[35]
- Tourismus
Das Protokoll „Tourismus“ will Freizeit- und Fremdenverkehrsaktivitäten mit den ökologischen und sozialen Anforderungen in Einklang bringen. Bevorzugt werden sanfte Tourismusaktivitäten, die auf Natur und lokale Gesellschaft möglichst keine schädlichen Einflüsse haben.
Wichtige Inhalte des Tourismusprotokolls sind die Förderung umweltfreundlicher Freizeitangebote in ländlichen Gebieten, der qualitative Umbau der touristischen Zentren in Bezug auf Verkehr, Energie, Ver- und Entsorgung sowie die Bewertung der sozioökonomischen Auswirkungen der geplanten Entwicklungen auf die ansässige Bevölkerung. Die Wettbewerbsfähigkeit des sanften, naturnahen Tourismus ist zu stärken (beispielsweise durch Auszeichnung der touristischen Angebote mit Umwelt-Gütesiegeln), Informationen und Angebote für Anreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind zu verbessern und der längerfristige Urlaubsverkehr dem Tagesausflugsverkehr vorzuziehen. Gemeinsame Aktionsprogramme mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung im Bereich Beherbergungseinrichtungen und touristische Dienstleistungsangebote insbesondere hinsichtlich der ökologischen Erfordernissen sind konsequent umzusetzen. Weiterhin verpflichten sich die Vertragsparteien die kulturellen Aktivitäten in den jeweiligen Gebieten aufzuwerten und eine Zusammenarbeit der Tourismuswirtschaft mit Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu unterstützen.[36]
Durch seine Vorgaben legt das Tourismusprotokoll den Grundstein für eine integrative Tourismusentwicklung[37] in den Alpen.
Es liegen noch keine abschließenden Vereinbarungen der Alpenstaaten bzgl. der Handlungsfelder Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft, Wasser sowie Bevölkerung und Kultur vor. Obwohl das Protokoll „Bevölkerung und Kultur“ an erster Stelle in den allgemeinen Verpflichtungen der Vertragsparteien angeführt wird und laut CIPRA für die Akzeptanz und Umsetzung der Alpenkonvention eine entscheidende Bedeutung hat, stand es jahrelang auf einem politischen Abstellgleis. Die CIPRA sieht als wichtigste Ziele eines Kulturvertrages den Bau von Brücken zwischen den verschiedenen alpinen Kulturen sowie der alpinen und außeralpinen Bevölkerung. Ferner müsse die kulturelle und gesellschaftliche Eigenständigkeit der Alpenregionen erhalten und gefördert sowie eine optimale Lebensqualität für Bewohner und Besucher geschaffen werden.[38]
Die Alpenkonvention wird als Prozess verstanden, der dem Anspruch gerecht zu werden versucht, die nachhaltige Entwicklung konkret an einer regionalen Ebene festzumachen. Unmittelbar betroffene Gebietskörperschaften (z.B. Regionen, Gemeinden) werden deshalb so weit wie möglich an der Vorbereitung und Umsetzung der Politiken und der sich daraus ergebenden Maßnahmen beteiligt. Das Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“ liefert vorbildliche Beispiele für die Umsetzung der Alpenkonvention auf kommunaler Ebene.[39]
Es ist bereits festzustellen, das vielversprechende Initiativen, wie z.B. die Gründung von Arbeitsgemeinschaften, Netzwerken und Kooperationen zur Umsetzung nachhaltiger Projekte von Einzelpersonen, kleinen Gruppen und Gemeinden ausgehen. Die Aufgabe der Staatengemeinschaften sollte es sein, derartigen Initiativen günstige Rahmenbedingungen zu schaffen und sie großzügig zu fördern.[40]
„Im Rahmen der Alpenkonvention spielt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Vertragspartnern einerseits und zwischen den Behörden und den Nicht-Regierungs-Organisationen andererseits eine wichtige Rolle.“[41]
B. Marketingkonzept für die Via Retica unter Berücksichtigung nachhaltiger Gesichtspunkte
I. Idee des Weitwanderweges Via Retica
Wie bereits erwähnt geht es darum, die geforderten Maßnahmen der Alpenkonvention auf regionaler Ebene umzusetzen. Im Hinblick auf eine nachhaltige Regionalentwicklung müssen die Prinzipien von wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Verantwortung und Selbstbestimmung auch in den touristischen Beziehungen zur Geltung gebracht werden, d. h. integrierte Tourismuskonzepte sind gefragt. Jedes regionale touristische Angebot sollte mit den übrigen Bereichen der regionalen Wirtschaftsstruktur vernetzt sein um so die Vermarktungschancen derselben zu fördern.[42]
Um diesen Anforderungen nachzukommen entstand 1999 im Alpenbüro Klosters die Idee des Weitwanderweges Via Retica durch den Rätikon, einem Gebirgszug zwischen dem Prättigau (Graubünden) und dem Montafon (Vorarlberg). Mit dem Projekt soll ein landschaftsorientierter Tourismus, der keine neue Infrastruktur erfordert, sondern das bestehende Angebot aus Wegen und Bergunterkünften vernetzt und nachhaltig unterstützt, verwirklicht werden.
Regionale Potenziale wie Kulturlandschaft und Arbeitskräfte (Hüttenwirte, Landwirte, regionale Nahrungsmittelindustrie und Handwerk) werden in das Projekt einbezogen. Ein möglichst hoher Teil der Wertschöpfung aus Transport (möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln), Unterkunft und Verpflegung soll der Region zugute kommen. Mit dem Verkauf von regionstypischen, ökologischen Produkten auf den Berghütten soll die Berglandwirtschaft unterstützt und die regionale Wirtschaft angekurbelt werden. Den Wanderern sollen Kenntnisse über die Regionen Prättigau und Montafon vermittelt werden, damit Volkstum und Kulturerbe weitergetragen werden und die kulturelle Identität erhalten bleibt. Durch Umwelt- und Bewusstseinsbildung sollen die Gäste außerdem für das Ökosystem Berge sensibilisiert werden.
Die Via Retica ist als Teilstrecke des internationalen Weitwanderweges Via Alpina, der alle Alpenstaaten miteinander verbindet und im Sommer 2002 offiziell eröffnet wurde, geplant.
Da für den Erfolg des Projekts die vorhandene Nachfrage sowie die Produktgestaltung und -vermarktung eine entscheidende Rolle spielen, soll in den folgenden Kapiteln ein abgestimmtes Marketingkonzept für die Via Retica erarbeitet werden.
II. Analyse
1. Globale Umweltanalyse
a) Wachstumsnische Ökotourismus
Ökotourismus[43] gilt als eine der dynamischsten Wachstumsnischen in der Reisebranche. Während die gesamte Urlaubsbranche in den vergangenen Jahren durchschnittlich vier Prozent Wachstum verzeichnete, legte der Ökotourismus-Zweig laut dem World Ressources Institute bis zu 30% zu. Nach einer Umfrage des Forschungsinstitutes für Freizeit und Tourismus der Universität Bern spielt Ökologie beim Kauf eines Reiseproduktes bei 57% der Bevölkerung eine wichtige Rolle. Davon sind 74% auch bereit, einen Aufpreis zu zahlen, wenn sie damit zum Umweltschutz und zur wirtschaftlichen Verbesserung der Situation der einheimischen Bevölkerung beitragen können. Allerdings würden nur 56% zugunsten der Umwelt auf Komfort im Urlaub verzichten (vgl. Abb.5).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Vgl. FIF, Tourismus und Umweltverhalten, 2001, S. 9
Abb. 5: Kauf eines teureren Produktes / Verzicht auf Komfort zugunsten der Umwelt
Ähnliche Ergebnisse liefert die Studie ,Tourismusbewusstsein‘ von Müller/Boess: 71 – 80% der befragten Urlauber wünschen sich eine Tourismusförderung, die Rücksicht auf Natur und Landschaft nimmt und sind auch bereit, dafür tiefer in den Geldbeutel zu greifen. Mit dem Begriff „Ökotourismus“ wird außerdem ein gewisses Qualitätsniveau sowie erhöhter Genuss assoziiert.[44]
Nach einer Gästebefragung in Österreich durch das IITF (2001) bevorzugen 71% der Befragten einen Reiseveranstalter mit ausgewiesenem Umweltmanagement. 91% stimmen zu, dass zu einer Reise unmittelbare Naturerlebnisse gehören, für den Großteil ist der Respekt gegenüber der Lebensweise und den Traditionen der einheimischen Bevölkerung sowie ein intaktes Landschaftsbild von großer Bedeutung. Aus der Befragung ließ sich ein vorsichtiges Potential von 29% der Österreich Touristen für Natur- und Umweltreisen in Österreich ermitteln.[45]
Auch der naturnahe Tourismus[46] in der Schweiz verfügt über erhebliche finanzielle Effekte und Potenziale: Mit Gästeausgaben von 2,3 Mrd. Schweizer Franken (2001) und einem Anteil an Gästen aus dem Inland von 30% bildet er ein wichtiges Standbein des Binnentourismus. Für die kommenden zehn Jahre werden zusätzliche finanzielle Potenziale von 10 – 40% für naturnahe Tourismusangebote erwartet.[47]
Derzeit vollzieht sich in unserer Gesellschaft ein Wertewandel, der geprägt ist durch eine hedonistische Grundhaltung (Lust, Genuss, Ausleben), die gleichzeitig aber auch mit einer gewissen Zukunftsverantwortung gepaart ist: Eine zunehmend konsumkritische Haltung, ein steigendes Umwelt-, Gesundheits- und Körperbewusstsein (das u. a. in der gesunden Ernährung und der hohen Nachfrage nach ökologischen Produkten zum Ausdruck kommt) sowie die zunehmende Bedeutung von spirituellen Werten machen sich immer stärker bemerkbar. „Die stark leistungsorientierten ‚Workaholics‘ verlieren an Bedeutung zugunsten von Menschen mit einer ganzheitlichen Lebensorientierung.“[48]
So erfreut sich auch der ländliche Tourismus, der dem Gast eine Annäherung an die naturräumlichen Gegebenheiten der Region, an ihre Tier- und Pflanzenwelt, an ihre historisch-kulturellen Wurzeln und an die Lebens- und Arbeitszusammenhänge ihrer Menschen erlaubt (z. B. Ferien auf dem Bauernhof) zunehmender Beliebtheit.[49]
Das wachsende Umweltbewusstsein der Bevölkerung, die steigende Nachfrage nach einer gesunden, umwelt- und sozialverträglicheren Form des Reisens und die erhöhte Zahlungsbereitschaft der Touristen sind optimale Voraussetzungen für den Erfolg innovativer, nachhaltiger Tourismusprojekte.
Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass in den Entwicklungsmodellen von wahrheitsgetreuen Voraussetzungen der Einheimischen ausgegangen wird und dass Ökotourismus nicht dazu missbraucht wird, weitere naturnahe Gebiete zu erschließen.[50] Die große Herausforderung wird es zukünftig sein, zwischen ,ökotouristischem Marketing-Gag‘ und dem für die Region tatsächlich wertschöpfenden Angebot zu unterscheiden.[51]
b) Entwicklung des Wandertourismus
Die Begriffe „Spazieren gehen“, „Wandern“ und „Bergsteigen“ sind schwierig voneinander abzugrenzen, da diese Begriffe von den Erholungssuchenden sehr unterschiedlich verwendet werden: Je nach Alter, Kondition, Gemütsverfassung oder Herkunft wird für dasselbe Tun, dieselbe Strecke oder für denselben Schwierigkeitsgrad eine andere Bezeichnung verwendet.[52]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6 zeigt, wie die Begriffe in der vorliegenden Arbeit verwendet werden. Mit Wandern ist im folgenden immer das Wandern i.e.S. gemeint.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Definition von Spazieren, Wandern und Bergsteigen
Der Wanderurlaub steht nach einer Umfrage des EMNID-Instituts (1996) an zweiter Stelle auf der Liste der bevorzugten Urlaubsformen der Deutschen, die Nachfrage nach gesundheitsorientierten Reisen sowie Sport- und Aktivurlaub ist steigend (vgl. Abb. 7).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: ETI-Repräsentativbefragung 1996, EMNID-Institut, vgl. Hoffmann, Jan/Wolf, Angelika, Umwelt- und sozialverträglicher Tourismus, in: Buchwald, K./Engelhardt, W. (Hrsg.), Umweltschutz, 1998, S. 132
Abb. 7: Bevorzugte Urlaubsformen der Deutschen
Auf die Frage nach der Wichtigkeit allgemeiner Urlaubsmotive (Reiseanalyse 1999) nannten 44% der deutschen Bevölkerung das gesunde Klima als besonders wichtig, für 40% spielt das Naturerlebnis eine große Rolle, etwa ein Drittel erachten das Verlassen der verschmutzten Umwelt sowie die Gesundheitsförderung als wichtiges Urlaubsmotiv (vgl. Abb. 8). Für einen großen Anteil der Bevölkerung spielen die physische Erholung, wie z. B. Stressabbau (62%) und Kräfte auftanken (53%), sowie die psychische Entspannung (frei sein, Zeit haben, 54%) eine wesentliche Rolle. 46% der Befragten möchten im Urlaub Zeit füreinander haben, für 27% ist der gemeinsame Erlebniswert und das Zusammensein mit netten Leuten wichtig. Diese Einstellungen und Erwartungen der deutschen Urlauber sprechen für eine positive Entwicklung des Wandertourismus. Allerdings wird das Motiv „aktiv Sport treiben“ von den wenigsten Befragten als besonders wichtig angesehen (8%), mehr als ein Drittel geben „ausruhen und faulenzen“ als wichtigen Urlaubsgrund an.[53]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: F.U.R., Reiseanalyse, 1999, S. 137
Abb. 8: „Besonders wichtige“ Urlaubsmotive der Deutschen 1999 (in %)
Während in Deutschland Entspannung und Stressabbau das wichtigste Urlaubsmotiv darstellt, steht bei den Schweizern das Landschafts- und Naturerlebnis an erster Stelle, gefolgt von Zeit haben für die Familie und den Partner. Mit 43% stellt das Motiv Sport treiben einen prozentual wesentlich höheren Anteil dar als in Deutschland (vgl. Abb. 9). Wandern ist dabei die bei Inland-Reisen am häufigsten praktizierte Sportart (38,8%).[54]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Schweiz Tourismus, Reisemarkt Schweiz, 1999, S. 13
Abb. 9: Reisemotive der Schweizer bei Inland-Reisen (in %)
Nach den Ergebnissen der Gästeumfrage in Österreich 2001 unternehmen im Sommerurlaub 49% der Gäste Wanderungen, was einem Zuwachs von 16% gegenüber 1997 entspricht.[55]
Der Trend geht hin zu mehr, aber kürzeren Reisen, wobei das klassische Ferienmuster der Samstag-Samstag-Rotation zunehmend verschwindet.[56]
Die angeschlagene Weltwirtschaftslage kann eine Chance für die Entwicklung des Wandertourismus bedeuten, da Wandern im Vergleich zu anderen Sportarten als ausgesprochen preisgünstig gilt. Auf dem Tourismusmarkt ist allerdings trotz der Terroranschläge von New York im September letzten Jahres und der folgenden Konjunkturkrise kein massiver Rückgang der Urlaubsaktivität erkennbar. Die Reisefreudigkeit der Europäer ist nach wie vor hoch: Im Januar 2002 sind nur knapp weniger Deutsche (69%) als im Januar 2001 (72%) positiv zu einer Urlaubsreise eingestellt. Auch in Österreich sind fast ebenso viele Menschen (43%) wie im Vorjahr (45%) zu einer Reise entschlossen. Es ist also kein konjunkturbedingter Rückgang des Wandertourismus zu erwarten.[57]
Die fortschreitende Globalisierung und die Öffnung von Grenzen für den Tourismus kann Chance und Risiko für das Wandern bedeuten. Zum einen werden entfernte Bergregionen leichter erreichbar, bzw. erst zugänglich (z. B. Tibet), zum anderen nimmt jedoch auch die Konkurrenz der Bade-Fernreisen zu (z. B. Karibik).
Neue Techniken im Kommunikations- und Reservierungsbereich (z.B. Internet, Multi-Media) ermöglichen eine direkte Information und Buchung des Wanderurlaubs von zu Hause aus.
Die wachsende Neigung der zunehmenden Zahl älterer Menschen zu gemäßigt sportlicher Betätigung sowie die überdurchschnittlich steigende Zahl der Urlaubsreisen bei älteren Menschen fördern die Wanderaktivitäten.[58] Ferner ist Wandern eine familienfreundliche Sportart, in die auch Kinder gut mit einbezogen werden können.[59]
Einen neuen, unerwarteten Aufschwung hat in den letzten 30 Jahren die Pilgerschaft erlebt. Pilgern als spirituelle Form des Unterwegsseins spiegelt die Sehnsucht der Menschen in der heutigen hektischen Zeit nach Selbstfindung und Sinngebung wieder. Als Beispiel ist der Jakobsweg nach Santiago de Compostela zu nennen, dessen jährliche Pilgerschaft sich in den letzten 25 Jahren verzehnfacht hat.[60]
Zunehmend beliebt bei jüngeren Menschen sind Trekkingreisen[61], die dem konventionellen Wandern eine moderne, sportliche und abenteuerliche Note verleihen. Besonders im Trend liegen seit einigen Jahren Trekkingtouren in den Anden und im Himalaya und entsprechend groß ist das diesbezügliche Angebot der Trekking-Reiseveranstalter.[62] Auch andere moderne Wanderformen, wie z. B. das aus Finnland stammende „Nordic Walking“ (schnelles Gehen mit Stöcken) setzen sich immer mehr durch.[63]
Dem Wandern steht jedoch eine Konkurrenz neuer Freizeitangebote mit großem Nervenkitzel oder Fun-Komponenten gegenüber (wie z. B. Sportklettern, Canyoning oder Rafting) und kann sich somit v. a. bei jugendlich-sportiven Männern nur noch schwer behaupten.[64]
Das herkömmliche Wandern hat zudem ein gewisses Negativimage als „Seniorensport“, weil es von relativ vielen Rentnern ausgeübt wird. Schließlich leidet das Wandern auch darunter, dass es häufig mit Ausflugsaktivitäten verbunden ist. Viele Menschen scheuen zunehmend den damit verbundenen Massenverkehr und –betrieb.[65]
Der globale Klimawandel kann sowohl Chance als auch Risiko für die Entwicklung des Wandertourismus bedeuten: Durch das Ansteigen der winterlichen Schneegrenze, die zunehmende Schneearmut und den damit zusammenhängenden Rückgang des Skitourismus werden in Zukunft auch in den Wintermonaten vermehrt Wanderungen unternommen werden. Die globalen Klimaveränderungen bringen jedoch nicht zu unterschätzende Gefahren für den Wandertourismus mit sich: Extreme Unwetter mit Murgängen und Überschwemmungen, Erosion bei Wanderwegen und zunehmende Sommertrockenheit.[66]
Außerdem werden bereits bestehende Umweltschäden in manchen Bergregionen, wie Waldsterben, Landschaftsverbrauch, Ozonloch und Verknappung der natürlichen Ressourcen das Reiseverhalten der Wandertouristen künftig negativ beeinflussen.[67]
Die Chancen und Risiken für den Wandertourismus sind in folgendem Schaubild zusammengefasst:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 10: Chancen und Risiken des Wandertourismus
2. Marktanalyse
a) Potenzieller Markt für die Via Retica
Der geplante Weitwanderweg Via Retica wird in Liechtenstein beginnen und entlang der Grenze Schweiz – Österreich bis zum Silvrettagebiet verlaufen.[68] Um die potenziellen Interessenten für diese Wanderstrecke zu ermitteln, werden im folgenden die vom Wanderweg durchquerten Gebiete Liechtenstein, Vorarlberg und Graubünden (i. f. Projektgebiet) auf das Einzugsgebiet ihrer Gäste hin untersucht.
Mehr als die Hälfte der Logiernächte in Graubünden werden von den Schweizern selbst gebucht, 30,5% der Gäste stammen aus Deutschland (vgl. Abb. 11):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Vgl. Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden, Graubünden in Zahlen 2001
Abb. 11: Gästeherkunft Graubünden 2000
In Vorarlberg kommt der überwiegende Teil der Gäste aus Deutschland, Österreich liegt mit 11% an zweiter Stelle (vgl. Abb. 12):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Vgl. Landesverband Vorarlber äg Tourismus, Jahresbericht 2000, S. 20
Abb. 12: Gästeherkunft Vorarlberg 2000
In Liechtenstein führen ebenfalls die deutschen Touristen die Rangliste der Logiernächte an, gefolgt von den Gästen aus der Schweiz (vgl. Abb. 13):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Vgl. Liechtenstein Tourismus, Fremdenverkehr, S. 8
Abb. 13: Gästeherkunft Liechtenstein 2000
Die häufigsten Nächtigungen in Graubünden, Vorarlberg und Liechtenstein sind also auf Besucher aus Deutschland, Schweiz und Österreich zurückzuführen. Da es kaum Erhebungen über die tatsächliche Wanderaktivität der Besucher im Projektgebiet gibt, werden zunächst alle Gäste als potenzielle Wanderer betrachtet.
Saisonal lässt sich der Markt problemlos auf die Zahl der Sommertouristen eingrenzen, da der Wanderweg aufgrund seiner hochalpinen Lage nur von Juli bis September begehbar ist. Der hochalpine Charakter der Wanderung und die teilweise langen Tagesetappen fordern außerdem eine gewisse physische Ausdauer und Trittsicherheit, so dass bestimmte Altersgruppen aus, wie etwa Kleinkinder und ein Teil der Senioren als potenzielle Wanderer ausgeschlossen werden können.
Um die angestrebten nachhaltigen Ziele, wie z.B. den Verkauf von regionalen Produkten und eine umweltverträgliche Hüttenpolitik zu verwirklichen, muss mit einem höheren Preisniveau als bei anderen, diese Gesichtspunkte nicht berücksichtigenden Weitwanderwegen gerechnet werden. Aus diesem Grund ist ein entsprechendes Einkommen der Wandertouristen sowie eine Förderungsbereitschaft der ökotouristischen Ziele vorauszusetzen.
Zusammenfassend ergibt sich demnach für den relevanten Nachfragermarkt der Via Retica eine Personengruppe bestehend aus deutschen, schweizerischen und österreichischen Sommerwanderern und Ökotouristen im erwerbsfähigen Alter.
Auf der Angebotsseite kann der relevante Markt auf die Zahl der in Thematik und Zielsetzungen vergleichbaren Weitwanderwege im Umkreis des Projektgebietes begrenzt werden. Der Schwerpunkt wird dabei auf der Berücksichtigung der umwelt- und sozialverträglichen Gestaltung sowie der Gewichtung kultureller Aspekte liegen.
[...]
[1] Vgl. Luger, K./Inmann K. (Hrsg), Vereiste Berge, 1995, S. 12.
[2] Vgl. Krippendorf, J., Alpsegen Alptraum, 1986, S. 18 - 25.
[3] Vgl. Universität Graz, Touristische Entwicklung, 1999, URL: http://www.uni-graz.at/geowww/lehre /exkursion/alpenex /tourismus.htm; zu den durch den Tourismus verursachten Umweltwirkungen s. ausführlich Hopfenbeck, W., Ökologische Aspekte, in: Gewald, S. (Hrsg.), Handbuch, 1999, S. 256f.
[4] Haid, H., Alpenmythos, in: PÖ, Nr. 55, Juli/August 1998, S. 20.
[5] Vgl. Luger, K./Inmann K. (Hrsg), Vereiste Berge, 1995, S. 12, ebenso Haid, H., Alpenmythos, in: PÖ, Nr. 55, Juli/August 1998, S. 20; vgl. auch Krippendorf, J., Alpsegen Alptraum, 1986, S. 45.
[6] Zur Darlegung soziokultureller Auswirkungen des Tourismus s. Baumgartner, C./Röhrer, C., Nachhaltigkeit im Tourismus, 1998, S. 83f.
[7] Vgl. Schaaf, T., Thesen und Forderungen, in: Luger, K./Inmann K. (Hrsg), Vereiste Berge, 1995, S. 349f.
[8] Die Agenda 21 ist ein umfassendes Maßnahmenprogramm, das von 182 Staaten während der Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro ratifiziert wurde. Es befasst sich mit globalen Umwelt- und Entwicklungsfragen und enthält Lösungsansätze und –strategien für eine nachhaltige Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft im 21. Jahrhundert. Als eine der Branchen mit hohem Potenzial für einen Beitrag zur Nachhaltigkeit wird der Tourismus angesehen. Vgl. hierzu ausführlich World Travel & Tourism Council, Agenda 21, o. J., S. 10.
[9] Vgl. o.V., Das Jahr der Berge, in: AZ, Nr. 300 vom 31.12.2001, S. 11, sowie BMVEL, Nachhaltige Entwicklung, 2002, URL: http://www.berge2002.de/hintergrund.html.
[10] Solcher, L., Auf die sanfte Tour, in: AZ, Nr. 88 vom 16.04.2002, S. 11.
[11] Definition der World Conference on Sustainable Tourism, April 1995 auf Lanzarote, in: Opaschowski, H., Umwelt, Mobilität und Tourismus, 1998, S. 19.
[12] Vgl . SAB, Die Alpenkonvention, 2000, S.3.
[13] Vgl. Glauser, P./Siegrist, D., Schauplatz Alpen, 1997, S. 12,13, sowie CIPRA, Jahresfachtagung, 2000, URL: http://www.deutsch.cipra.org/texte/publikationen/Info_59/CI59_ Jahresfachtagung.htm.
[14] Vgl. Weissen, A., Zum Geleit, in: CIPRA (Hrsg.), 2. Alpenreport, 2001, S. 15, sowie Reutz-Hornsteiner, B., Jung sein, in: CIPRA (Hrsg.), 2. Alpenreport, 2001, S. 43; eine ausführliche Analyse der alpinen Urbanisationsprozesse ist vor kurzem unter dem Titel „Alpenstädte- Zwischen Metropolisation und neuer Eigenständigkeit“ vom Geograhischen Institut der Universität Bern herausgegeben worden.
[15] Vgl. Ammer, U., Freizeit im Alpenraum, in: Buchwald, K./Engelhardt, W. (Hrsg.), Umweltschutz, 1998, S. 240f.; vgl. auch CIPRA (Hrsg.), 2. Alpenreport, 2001, S. 214, 215.
[16] Vgl. Glauser, P./Siegrist, D., Schauplatz Alpen, 1997, S. 84, 85.
[17] Vgl. CIPRA, 2. Alpenreport, 2001, S. 154f.
[18] Vgl. Schwarz, D., Immer mehr Bauern, in: SchwB, Nr. 28 vom 17.04.02, S. 3.
[19] Vgl. CIPRA, Jahresfachtagung, 2000, URL: http://www.deutsch.cipra.org/texte/publikationen/Info_ 59/CI59_ Jahresfachtagung.htm.
[20] Nach Ewald (1978) sind Kulturlandschaften „vom Menschen zur Nutzung gestaltete oder umgestaltete Landschaften, bzw. erweitert nach Weiss (1987) „naturnahe, historisch geprägte Gebilde, in denen die Vorstellungen und Lebensgewohnheiten früherer Gesellschaften auch in der Gegenwart noch vielfältig wirkende Realität sind.“ Vgl. hierzu Broggi, M., bäuerliche Kulturlandschaft, in: CIPRA (Hrsg.), Kulturlandschaften, 1992, S. 93f.
[21] Zur Bedeutung landschaftlicher Schönheit und Erlebniswirksamkeit als Grundlage für die Erholungseignung einer Landschaft s. ausführlich Wöbse, H., Die Erlebniswirksamkeit, in: Buchwald, K./Engelhardt, W. (Hrsg.), Umweltschutz, 1998, S. 166f.
[22] Vgl. Glauser, P./Siegrist, D., Schauplatz Alpen, 1997, S. 12,13.
[23] Vgl. CIPRA, 2. Alpenreport, 2001, S. 318.
[24] Vgl. Markard, J./Peter, A./Truffer, B., Ökostrom aus den Alpen, in: CIPRA (Hrsg.), 2. Alpenreport, 2001, S. 317f.
[25] Vgl. Glauser, P./Siegrist, D., Schauplatz Alpen, 1997, S. 117, ebenso Ammer, U., Freizeit im Alpenraum, in: Buchwald, K./Engelhardt, W. (Hrsg.), Umweltschutz, 1998, S. 246.
[26] Vgl. Glauser, P./Siegrist, D., Schauplatz Alpen, 1997, S. 100, 115; vgl. auch Tiefenthaler, H., Verkehrsprobleme, in: Jülg, F./Staudacher C. (Hrsg.), Tourismus im Hochgebirge, 1993, S. 58.
[27] Vgl . F.U.R., Reiseanalyse, 1999, S. 105.
[28] Vgl. Job, H./Witzel, A./Becker, C (Hrsg.), Tourismus und nachhaltige Entwicklung, 1996, S. 146f., sowie Glauser, P./Siegrist, D., Schauplatz Alpen, 1997, S. 50.
[29] Vgl. Zölch, E., „Oberland wird kein Ballenberg“, in: htr, Nr. 19 vom 09.05.02, S. 9.
[30] Vgl. Bätzing, W., Regionale Wirtschaftsverflechtungen, in: PÖ, Nr. 55, Juli/August 1998, S. 26-34; vgl. auch Job, H./Witzel, A./Becker, C (Hrsg.), Tourismus und nachhaltige Entwicklung, 1996, S. 146f; s. hierzu auch Ausführungen von Hansjörg Hassler, SVP-Nationalrat Graubünden, in der CIPRA Veranstaltung „Alpenkonvention als Chance für den Bündner Tourismus“, Chur, Mai 2002.
[31] Vgl. CIPRA, Kulturlandschaften, 1992, S.9,183, sowie BUWAL, Alpenkonvention, 2000, S. 6, 26, 27. Erfolgreiche Beispiele für die Vernetzung verschiedener Wirtschaftszeige im Rahmen einer nachhaltigen Regionalpolitik liefern die Gemeinden des Netzwerks „Allianz in den Alpen“, welches als konsequente Umsetzung der Alpenkonvention von der CIPRA ins Leben gerufen wurde.
[32] Vgl. BUWAL, Alpenkonvention, 2000, S. 12, sowie AFI/CIPRA (Hrsg.) , Die Alpenkonvention, 1994, S.2; zum Anwendungsbereich der Alpenkonvention s. Anhang I.
[33] Vgl. OeAV, Alpenkonvention, 2000, S. 8-11; vgl. auch Ansprache des Direktors der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) Thomas Egger in der CIPRA Veranstaltung „Alpenkonvention als Chance für den Bündner Tourismus“, Chur, Mai 2002.
[34] Zur ausführlicheren Beschreibung der Protokollinhalte der Alpenkonvention s. BUWAL, Alpenkonvention, 2000, S. 17,18, sowie AFI/CIPRA (Hrsg.) , Die Alpenkonvention, 1994, S. 5, ebenso OeAV, Alpenkonvention, 2000, S. 24f.
[35] Vgl. Glauser, P./Siegrist, D., Schauplatz Alpen, 1997, S. 112, 113; s. auch Graf, A., Keine Sattelschlepper mehr, in: SO, Nr. 92 vom 22.04.02, S. 2.
[36] Vgl. OeAV, Alpenkonvention, 2000, S. 60-65, s. auch AFI/CIPRA (Hrsg.) , Die Alpenkonvention, 1994, S. 4.
[37] Der Begriff „integrativer“ Tourismus wird von manchen Autoren anstelle von „nachhaltiger“ Tourismus gebraucht, da ihrer Meinung nach ein Wirtschaftsbereich an sich nicht nachhaltig sein kann. Dem Institut für Integrativen Tourismus und Freizeitforschung (IITF) zufolge funktioniert Tourismus nur innerhalb bestehender gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und wird somit als querschnittsorientierter Sektor verstanden, der sich in ein Gesamtkonzept der nachhaltigen Ausrichtung unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems nahtlos einfügen muß. Vgl. dazu die Ausführungen des IITF in Baumgartner, C./Röhrer, C., Nachhaltigkeit im Tourismus, 1998, S. 38-43, S. 67.
[38] Vgl. Götz, A., Kulturvertrag, in: CIPRA (Hrsg.), 2. Alpenreport, 2001, S. 127,128.
[39] Vgl. BUWAL, Alpenkonvention, 2000, S. 12, sowie jsk, Schutz & Förderung, S.4.
[40] Vgl. Weissen, A., Zum Geleit, in: CIPRA (Hrsg.), 2. Alpenreport, 2001, S. 16.
[41] Leuenberger, M., Alpenpolitik, in: CIPRA (Hrsg.), 2. Alpenreport, 2001, S. 146.
[42] Vgl. Job, Hubert / Witzel, Anke / Becker, Christoph (Hrsg.), Tourismus und nachhaltige Entwicklung, 1996, S. 149f.
[43] Bislang liegt noch keine verbindliche Definition über die genaue Bedeutung von Ökotourismus vor. Neben der Erfüllung von sozialen, kulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien gemäß dem Prinzip der Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall der Besuch eines möglichst naturnahen und ökologisch sensiblen Gebietes ein wichtiger Aspekt. Siehe dazu Strack, S., Ökotourismus, in: tm, 12/2001, S. 78-79.
[44] Vgl. Maier, D., Alles Öko, in: AZ, Nr. 300 vom 31.12.2001, S. 11; vgl. auch Strack, S., Ökotourismus, in: tm, 12/2001, S. 78-79, sowie Hoffmann, J./Wolf, A., Umwelt- und sozialverträglicher Tourismus, in: Buchwald, K./Engelhardt, W. (Hrsg.), Umweltschutz, 1998, S. 133.
[45] Vgl. Leuthold, M., Potentiale des Ökotourismus, 2001, S. 7, 8.
[46] In der Studie der Hochschule Rapperswil wird der Begriff „Ökotourismus“ durch die Umschreibung „naturnaher Tourismus“ ersetzt , meint aber ebenso einen verantwortungsbewußten Tourismus in naturnahen Gebieten, der die lokale Kultur und Wirtschaft des Ferienortes fördert.
[47] Vgl. FTL, Naturnaher Tourismus, 2002, S. 6.
[48] Müller, H., Freizeittrends und Freizeitverhalten, in: Weiermair, K. (Hrsg.), Alpine Tourism, 1996, S. 178.
[49] Vgl. Müller, H., Zukunft für den ländlichen Tourismus, in: Regio Plus Info Bulletin, Nr. 2/2000, S. 4–5.
[50] Vgl. East, P./Hopfenbeck, W., Sustainable Tourism, in: Gewald, S. (Hrsg.), Handbuch, 1999, S. 360f.
[51] Vgl. Leuthold, M., Potentiale des Ökotourismus, 2001, S. 4.
[52] Vgl. Kunz, B., Wandern im Kanton Bern, 1999, S. 12.
[53] Vgl . F.U.R., Reiseanalyse, 1999, S. 135f.
[54] Vgl. Schweiz Tourismus, Reisemarkt Schweiz, 2000, S. 13, 23.
[55] Vgl. Leuthold, M., Potentiale des Ökotourismus, 2001, S. 6.
[56] Vgl. Schweiz Tourismus, Reisemarkt Schweiz, 2000, S. 1, sowie Institut für Freizeitwirtschaft, Zielgruppen, 1998, Abschnitt Wanderer, S. 12.
[57] Vgl. F.U.R., RA 2002, URL: www.fur.de/home/reiseanalyse2002.pdf; vgl. auch o. V., Wenig Verunsicherung, 2002, URL: www.t-online.at/toat/Reisen/inhalte/Reiseb_Fcros/Artikel/endPrefix/templateId= content/id=29232.html.
[58] Vgl. Institut für Freizeitwirtschaft, Zielgruppen, 1998, Abschnitt Wanderer, S. 12.
[59] Vgl. Institut für Freizeitwirtschaft, Wachstumsfelder, 1993, S. 544.
[60] Vgl. Schönauer, J., Jakobsweg, 2002, Url http://www.pilgern.ch/jakobsweg.htm.
[61] Unter der Sportart „Trekking“ versteht man Extrem-Wandertouren, bei denen querfeldein oder auf schmalen Pfaden teilweise grosse Höhenunterschiede zu bewältigen sind. Die Etappen führen oft tagelang durch unbewohnte Gebirgsgegenden (Definition laut wissen.de GmbH München).
[62] S. hierzu die Reisekataloge renommierter Trekking-Reiseveranstalter, wie z. B. Hauser Exkursionen, DAV Summit Club oder Ikarus Tours GmbH.
[63] Vgl. o. V., Fit mit Nordic Walking, in: BW, Nr. 16 vom 24.04.02, S. 3.
[64] Vgl. Institut für Freizeitwirtschaft, Zielgruppen, 1998, Abschnitt Wanderer, S. 12.
[65] Vgl. Institut für Freizeitwirtschaft, Wachstumsfelder, 1993, S. 533, 544.
[66] Vgl. Glauser, P./Siegrist, D., Schauplatz Alpen, 1997, S. 142f.
[67] Vgl. Freyer, W., Tourismus-Marketing, 2001, S. 153.
[68] Zum Streckenverlauf der Via Retica siehe Anhang II.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832466688
- ISBN (Paperback)
- 9783838666686
- DOI
- 10.3239/9783832466688
- Dateigröße
- 8.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten – Tourismus
- Erscheinungsdatum
- 2003 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- sanfter tourismus nachhaltigkeit regionalentwicklung alpenkonvention wandern
- Produktsicherheit
- Diplom.de