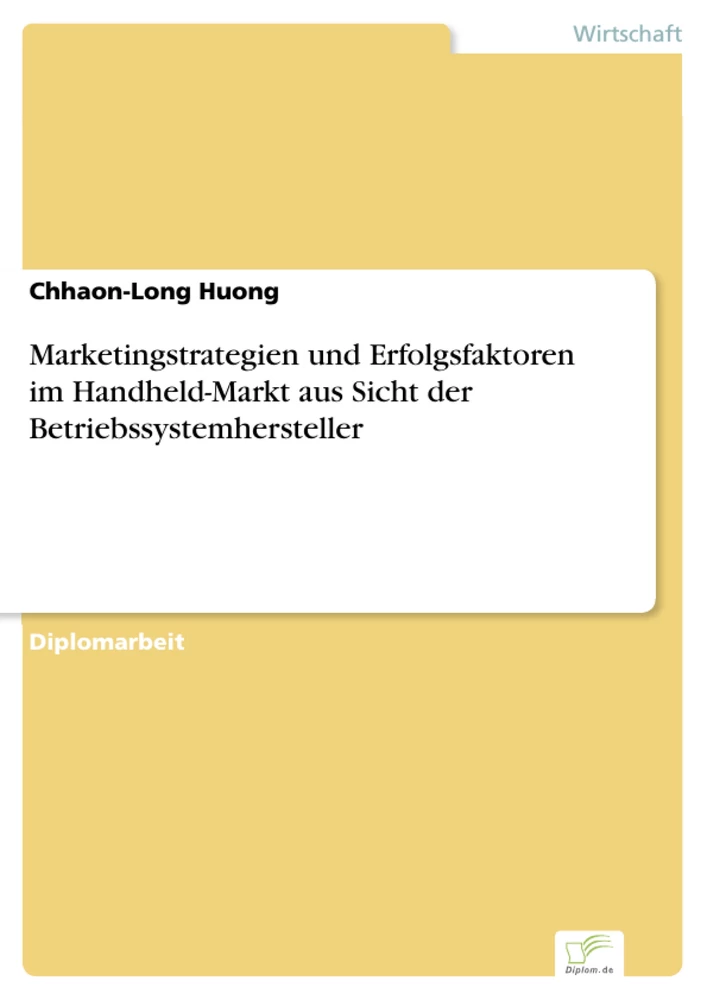Marketingstrategien und Erfolgsfaktoren im Handheld-Markt aus Sicht der Betriebssystemhersteller
©2002
Diplomarbeit
89 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Technische Innovationen im Bereich Telekommunikation und Multimedia eröffnen neue Potenziale für die Organisation von Arbeit. Traditionelle Arbeitsplätze, die durch Bindungen von Arbeitswelten, Arbeitsvolumina und Arbeitsplätzen an den Ort Betrieb geprägt sind, lassen nach und werden weiter gemindert werden. Die multimedialen Anwendungen und technische Innovationen in Form von mobilen Endgeräten führen zu einer steigenden Flexibilisierung der Faktoren Ort und Zeit und ermöglichen so mobiles Arbeiten. Um mobile Arbeitskräfte zu unterstützen, ist in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von tragbaren Computern auf dem Markt erschienen. Die Palette reicht von Mobiltelefonen bis zu kleinen Taschencomputern. Mit Hilfe dieser Geräte haben Berufstätige auch außerhalb des Büros stets schnellen Zugriff auf ihre wichtigsten Daten und können dadurch in sonst ungenutzten Zeiträumen effektiver arbeiten.
Um allen Anforderungen, die Unternehmen und Anwender an eine mobile Datenverarbeitung haben, zu entsprechen, sind speziell die Hersteller von Betriebssystemen für mobile Geräte gefragt. Sie müssen eine Plattform bereitstellen, die es gestattet, Funktionalitäten von mobilen Geräten ständig zu erweitern, um den wandelnden Bedürfnissen von Unternehmen gerecht zu werden. Es reicht jedoch nicht aus ein gutes Betriebssystem bereitzustellen, da der Handheld-Markt sehr wettbewerbsintensiv ist, und die Technologie in diesem Bereich sich rasant fortentwickelt. Um in diesem Markt bestehen zu können, müssen Hersteller von Betriebssystemen für Handhelds Wettbewerbsstrategien entwickeln und ihre gesamten Aktivitäten darauf ausrichten.
Gang der Untersuchung:
Die vorliegende Ausarbeitung soll Marketingstrategien und Erfolgsfaktoren im Handheld-Markt aufzeigen, und erläutern wie Marktteilnehmer insbesondere Betriebssystemhersteller sie nutzen können. Dazu werden zunächst in Kapitel 2 ausgewählte theoretische Grundlagen der Marketingstrategien vorgestellt, sowie relevante Erfolgsfaktoren der Branche in Kapitel 3. Anschließend zeigt Kapitel 4 die besondere Situation im Handheld-Markt: Verschiedene Marktteilnehmer werden vorgestellt, welche Rolle sie im Markt einnehmen und wie sie miteinander agieren. In Kapitel 5 werden die theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2 und 3 mit der gegenwärtigen Situation des Handheld-Marktes wie sie in Kapitel 4 beschrieben sind miteinander verknüpft und daraus Strategieempfehlungen abgeleitet. Kapitel 6 […]
Technische Innovationen im Bereich Telekommunikation und Multimedia eröffnen neue Potenziale für die Organisation von Arbeit. Traditionelle Arbeitsplätze, die durch Bindungen von Arbeitswelten, Arbeitsvolumina und Arbeitsplätzen an den Ort Betrieb geprägt sind, lassen nach und werden weiter gemindert werden. Die multimedialen Anwendungen und technische Innovationen in Form von mobilen Endgeräten führen zu einer steigenden Flexibilisierung der Faktoren Ort und Zeit und ermöglichen so mobiles Arbeiten. Um mobile Arbeitskräfte zu unterstützen, ist in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von tragbaren Computern auf dem Markt erschienen. Die Palette reicht von Mobiltelefonen bis zu kleinen Taschencomputern. Mit Hilfe dieser Geräte haben Berufstätige auch außerhalb des Büros stets schnellen Zugriff auf ihre wichtigsten Daten und können dadurch in sonst ungenutzten Zeiträumen effektiver arbeiten.
Um allen Anforderungen, die Unternehmen und Anwender an eine mobile Datenverarbeitung haben, zu entsprechen, sind speziell die Hersteller von Betriebssystemen für mobile Geräte gefragt. Sie müssen eine Plattform bereitstellen, die es gestattet, Funktionalitäten von mobilen Geräten ständig zu erweitern, um den wandelnden Bedürfnissen von Unternehmen gerecht zu werden. Es reicht jedoch nicht aus ein gutes Betriebssystem bereitzustellen, da der Handheld-Markt sehr wettbewerbsintensiv ist, und die Technologie in diesem Bereich sich rasant fortentwickelt. Um in diesem Markt bestehen zu können, müssen Hersteller von Betriebssystemen für Handhelds Wettbewerbsstrategien entwickeln und ihre gesamten Aktivitäten darauf ausrichten.
Gang der Untersuchung:
Die vorliegende Ausarbeitung soll Marketingstrategien und Erfolgsfaktoren im Handheld-Markt aufzeigen, und erläutern wie Marktteilnehmer insbesondere Betriebssystemhersteller sie nutzen können. Dazu werden zunächst in Kapitel 2 ausgewählte theoretische Grundlagen der Marketingstrategien vorgestellt, sowie relevante Erfolgsfaktoren der Branche in Kapitel 3. Anschließend zeigt Kapitel 4 die besondere Situation im Handheld-Markt: Verschiedene Marktteilnehmer werden vorgestellt, welche Rolle sie im Markt einnehmen und wie sie miteinander agieren. In Kapitel 5 werden die theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2 und 3 mit der gegenwärtigen Situation des Handheld-Marktes wie sie in Kapitel 4 beschrieben sind miteinander verknüpft und daraus Strategieempfehlungen abgeleitet. Kapitel 6 […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6637
Huong, Chhaon-Long: Marketingstrategien und Erfolgsfaktoren im Handheld-Markt aus
Sicht der Betriebssystemhersteller
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Köln, Fachhochschule, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
II
Inhaltsverzeichnis
Seite
Inhaltsverzeichnis...II
Abbildungsverzeichnis...V
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis...VI
1
Einleitung ...1
1.1 Problemstellung...1
1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit...2
1.3 Begriffsdefinitionen...3
2
Marketingstrategien in Hightech-Märkten...5
2.1 Das Technology Adoption Life Cycle Modell ...7
2.2 Strategien im Technology Adoption Life Cycle Modell...14
2.2.1 Nischenstrategie ...14
2.2.2 Strategische Allianz ...16
2.2.3 Absatzmittlergerichtete Strategie...18
2.2.4 Offensive Wettbewerbsstrategie ...22
2.3 Strategisches Timing ...24
2.4 Innovationsstrategie...27
3
Erfolgsfaktoren im Handheld-Markt ...29
3.1 Anforderungen an ein Handheld ...29
3.2 Schlüsseltechnologien im Handheld-Markt ...31
III
3.2.1 Bildschirmtechnologie ...31
3.2.2 Batterietechnologie ...32
3.2.3 Prozessortechnologie ...33
3.2.4 Speichertechnologie ...34
4
Gegenwärtige Situation des Handheld-Marktes...36
4.1 Interaktionen zwischen Endgerät, Netzwerk und Inhalten...38
4.2 Die Hersteller von Betriebssystemen für Handhelds ...41
4.3 Vergleich von PalmOS, WindowsCE und SymbianOS ...43
4.3.1 Allgemeines zu Betriebssystemen ...43
4.3.2 PalmOS 5.0 von PalmSource ...45
4.3.3 WindowsCE von Microsoft ...47
4.3.4 SymbianOS 7.0 von Symbian ...49
4.3.5 Zusammenfassung...50
4.4 Vergleich: Computerindustrie versus Mobilfunkindustrie...52
4.4.1 Die Wertschöpfungskette der Computerindustrie...53
4.4.2 Die Wertschöpfungskette der Mobilfunkindustrie...54
4.4.3 Absatzkanäle von Handhelds ...55
4.5 Das traditionelle Internet versus mobiles Internet...56
5
Strategische Implikationen für den Handheld-Markt ...59
5.1 Bedeutung anderer Marktteilnehmer für Betriebssystemhersteller...59
5.1.1 Die Rolle von Geräteherstellern...60
5.1.2 Die Rolle von Inhaltsanbietern und Entwicklern...61
IV
5.1.3 Die Rolle von Mobilfunkbetreibern...62
5.1.4 Die Rolle von Wiederverkäufern ...64
5.2 Strategieempfehlungen für Betriebssystemhersteller
in der aktuellen Situation...65
5.2.1 Nischenstrategie ...66
5.2.2 Waren- und Dienstleistungsallianz ...67
5.2.3 Offensive Wettbewerbsstrategie in der Nische...68
5.2.4 Absatzmittlergerichtete Kooperationsstrategie ...69
5.2.5 Strategisches Timing und Innovationsstrategie ...70
6
Zusammenfassung und Ausblick ...73
Literaturverzeichnis...76
V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Das Technology Adoption Life Cycle Modell ...8
Abbildung 2: Absatzmittlergerichtete Basisstrategien ...19
Abbildung 3: Situation, Chancen und Risiken des Pioniers...25
Abbildung 4: Situation, Chancen und Risiken des Frühfolgers ...26
Abbildung 5: Situation, Chancen und Risiken des Spätfolgers...27
Abbildung 6: Vergleich von ARM- und XScale-Prozessor (modifiziert) ...34
Abbildung 7: Hersteller von ,,konvergierten" Produkten ...37
Abbildung 8: Die komplette SHD-Lösung...38
Abbildung 9: Beziehungen im Handheld-Markt ...39
Abbildung 10: Die bekanntesten Betriebssystemhersteller für mobile
Endgeräte...41
Abbildung 11: Marktaufteilung von PDA-Betriebssystemen...42
Abbildung 12: Vergleich von PalmOS, WindowsCE und SymbianOS ...50
Abbildung 13: Marktsituation: Computerindustrie - Mobilfunkindustrie...52
Abbildung 14: Die Wertschöpfungskette der Computerindustrie ...53
Abbildung 15: Die Wertschöpfungskette der Mobilfunkbranche ...54
Abbildung 16: Unterschiede zwischen WWW und mobilem Internet ...56
Abbildung 17: Herausforderungen für Handheld-Hersteller...62
VI
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
3G
Dritte Mobilfunkgeneration, auch UMTS
4G
Vierte Generation des Mobilfunks, auch Wirless Lan
B2B
Business-to-business
CDMA
Code Division Multiple Access, Mobilfunkstandard in den USA
CF
CompactFlash Speicherkarte
DOS
Disk Operating System
EMS
Enhanced Message Service
GSM
Global System for Mobile Communications
Kbit
Kilobit
MB
Megabyte
Mbit
Megabit
Mbps
Megabit pro Sekunde
MByte
Megabyte
MIS
Microsoft Information Server
MMS
Multi Media SMS Message
MP3
MPEG 3 = Motion Picture Expert Group 3
mW
Milliwatt
OLED
Organische Licht Emittierende Displays
OS
Operating System
PDA
Personal Digital Assistant
PIM
Personal Information Management
SD
Secure Digital
SHD
Smart Handheld Devices
SMS
Short Message Service
Techies
Technologische Enthusiasten
TFT
Thin Film Transistor
UMTS
Universale Mobile Telecommunications Systems, auch 3G
USB
Universal Serial Bus
WWW
World Wide Web
1
1
Einleitung
1.1
Problemstellung
Technische Innovationen im Bereich Telekommunikation und Multimedia
eröffnen neue Potenziale für die Organisation von Arbeit. Traditionelle Ar-
beitsplätze, die durch Bindungen von Arbeitswelten, Arbeitsvolumina und
Arbeitsplätzen an den Ort Betrieb geprägt sind, lassen nach und werden
weiter gemindert werden. Die multimedialen Anwendungen und technische
Innovationen in Form von mobilen Endgeräten führen zu einer steigenden
Flexibilisierung der Faktoren Ort und Zeit und ermöglichen so mobiles Ar-
beiten. Um mobile Arbeitskräfte zu unterstützen, ist in den vergangenen
Jahren eine ganze Reihe von tragbaren Computern auf dem Markt erschie-
nen. Die Palette reicht von Mobiltelefonen bis zu kleinen Taschencompu-
tern. Mit Hilfe dieser Geräte haben Berufstätige auch außerhalb des Büros
stets schnellen Zugriff auf ihre wichtigsten Daten und können dadurch in
sonst ungenutzten Zeiträumen effektiver arbeiten.
Um allen Anforderungen, die Unternehmen und Anwender an eine mobile
Datenverarbeitung haben, zu entsprechen, sind speziell die Hersteller von
Betriebssystemen für mobile Geräte gefragt. Sie müssen eine Plattform
1
bereitstellen, die es gestattet, Funktionalitäten von mobilen Geräten ständig
zu erweitern, um den wandelnden Bedürfnissen von Unternehmen gerecht
zu werden. Es reicht jedoch nicht aus ein gutes Betriebssystem bereitzustel-
len, da der Handheld-Markt sehr wettbewerbsintensiv ist, und die Technolo-
gie in diesem Bereich sich rasant fortentwickelt. Um in diesem Markt beste-
hen zu können, müssen Hersteller von Betriebssystemen für Handhelds
Wettbewerbsstrategien entwickeln und ihre gesamten Aktivitäten darauf
ausrichten.
1
Betriebssystem und Plattform werden synonym verwendet.
2
1.2
Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit
Die vorliegende Ausarbeitung soll Marketingstrategien und Erfolgsfaktoren
im Handheld-Markt aufzeigen, und erläutern wie Marktteilnehmer insbe-
sondere Betriebssystemhersteller sie nutzen können. Dazu werden zu-
nächst in Kapitel 2 ausgewählte theoretische Grundlagen der Marketingstra-
tegien vorgestellt, sowie relevante Erfolgsfaktoren der Branche in Kapitel 3.
Anschließend zeigt Kapitel 4 die besondere Situation im Handheld-Markt:
Verschiedene Marktteilnehmer werden vorgestellt, welche Rolle sie im
Markt einnehmen und wie sie miteinander agieren. In Kapitel 5 werden die
theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2 und 3 mit der gegenwärtigen Situa-
tion des Handheld-Marktes wie sie in Kapitel 4 beschrieben sind mitein-
ander verknüpft und daraus Strategieempfehlungen abgeleitet. Kapitel 6
fasst die erarbeiteten Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf die
weitere Entwicklung im Handheld-Markt.
3
1.3
Begriffsdefinitionen
Begriffe aus dem Handheld-Bereich sind nicht eindeutig und werden oft
missverständlich benutzt. Erschwerend kommt hinzu, dass verschiedene
mobile Geräte miteinander verschmelzen, so dass eine klare Abgrenzung
schwierig ist. Im Rahmen dieser Diplomarbeit werden deshalb folgende
Definitionen benutzt:
Ein Handheld ist ein Computer, der aufgrund seiner kompakten Abmes-
sung bequem in einer Hand gehalten werden kann, während die Bedienung
mit der anderen Hand erfolgt. Diese Geräte bieten dem Benutzer eine breite
Palette von mobilen Anwendungen. Der Zugriff auf Daten und deren Ver-
waltung kann somit jederzeit und von jedem Ort aus vorgenommen werden.
Bezüglich der Dateneingabe werden Handhelds grob in zwei Kategorien
unterteilt: Entweder erfolgt die Eingabe der Daten beziehungsweise die Be-
dienung des Gerätes hauptsächlich mit einem Stift oder anhand einer integ-
rierten Tastatur. Bei der Software von Handhelds handelt es sich in der Re-
gel um proprietäre Software. Außerdem können sie unter anderem über fol-
gende Funktionen verfügen: Einen kabellosen Internet-Zugang, kabellose
Text-Kommunikation oder Telefonie.
Weiterhin lassen sich Handhelds unterteilen in:
· Personal Digital Assistant (PDA)
Ein PDA ist ein tragbarer Computer in Handflächengröße, der problem-
los in einer Jackentasche getragen werden kann. Er bietet in der Regel
Zugriff auf E-Mail, Internet und elementare Office-Tools wie Textver-
arbeitung, Tabellen, Kontakte und Terminkalender. PDAs sind von ver-
schiedenen Herstellern erhältlich, wobei sich Betriebssysteme, Textein-
gabemethoden, Bildschirme und Gerätegrößen meist unterscheiden.
· Wireless PDA
Ein Wireless PDA bedeutet wörtlich übersetzt ,,kabelloser" PDA und
verfügt über einen integrierten mobilen Netzwerkzugang, womit eine
Telefonfunktion gewährleistet ist. Somit sind die Möglichkeiten eines
4
Mobiltelefons und die eines PDAs in einem Gerät vereint, wobei das
Augenmerk auf der Datenfunktion liegt.
· Smartphones
Bei Smartphones handelt es sich um Mobiltelefone mit PDA-
Komponenten, die unter anderem durch größere Displays, höherer Spei-
cherkapazität und mobilem Internetzugang in Erscheinung treten. Der
Schwerpunkt der Smartphones liegt in der Telefonie und nicht wie bei
Wireless-PDAs auf der Datenfunktion. Deshalb sind sie von der Größe
wesentlich kleiner als PDAs.
Des Weiteren beschreibt der Begriff Mobiltelefon ein ,,normales", kabello-
ses Telefon, das über einen Zugang zum GSM
2
-Netz verfügt. Der Begriff
wird für Modelle mit oder ohne WAP
3
benutzt.
2
Abkürzung für Global System for Mobile Communications: Ein digitaler Telefonstan-
dard, der in insgesamt über 190 Ländern gilt. Auch ,,zweite" Mobilfunkgeneration genannt.
3
Abkürzung für Wireless Application Protocol: ,,Protokoll zur kabellosen Datenübertra-
gung". Ein Datenübertragungsverfahren, nach dem spezielle Internet-Seiten auf elektroni-
schen Kleingeräten angezeigt werden können, zum Beispiel auf dem Display eines Mobilte-
lefons oder Handheld, sofern das betreffende Gerät WAP-fähig ist.
5
2
Marketingstrategien in Hightech-Märkten
Dieses Kapitel befasst sich mit Marketingstrategien, die die besondere Situ-
ation des Handheld-Marktes berücksichtigen. Eine Begründung der Marke-
tingstrategien findet in Kapitel 5 statt, in Verknüpfung mit der gegenwärti-
gen Situation des Handheld-Marktes, die in Kapitel 4 vorgestellt wird.
Zum Verständnis dieser Arbeit ist ferner zu klären, worum es sich bei einer
Marketingstrategie handelt. Hier hat die Literatur zahlreiche Definitionen
hervor gebracht:
Becker
4
betrachtet Strategien als einen notwendigen Handlungsrahmen be-
ziehungsweise als eine Route (,,Wie kommen wir dahin?"), um sicherzustel-
len, dass alle operativen (taktischen) Instrumente auch zielführend einge-
setzt werden. Eine andere Formulierung verwendet Meffert
5
: Unter einer
Marketingstrategie versteht er einen bedingten, langfristigen und globalen
Verhaltensplan zur Erreichung der Unternehmens- und Marketingziele. Laut
Porter
6
ist eine Wettbewerbsstrategie das Streben, sich innerhalb der Bran-
che, dem eigentlichen Schauplatz des Wettbewerbs, günstig zu platzieren.
Dabei ist das Ziel einer Wettbewerbsstrategie eine gewinnbringende Positi-
on, die sich gegenüber den wettbewerbsbestimmenden Kräften innerhalb der
Branche behaupten lässt. Für Nieschlag
7
sind Strategien mittel- bis langfris-
tig wirkende Grundsatzentscheidungen mit Instrumentalcharakter. Ihnen
kommt die Aufgabe zu, nachgeordnete Entscheidungen und den Mittelein-
satz eines Unternehmens im Bereich des Marketinginstrumentariums an den
Bedarfs- und Wettbewerbsbedingungen sowie am vorhandenen Leistungs-
potenzial auszurichten und auf die Erreichung der Ziele hin zu kanalisieren.
Aus diesen unterschiedlichen Strategieformulierungen lässt sich Folgendes
feststellen:
4
Vgl. Becker, Jochen: Marketingkonzeption, 2002, S. 140
5
Vgl. Meffert, Heribert: Marketing, 1998, S. 60
6
Vgl. Porter, Michael E.: Wettbewerbsvorteile, 2000, S. 25
7
Vgl. Nieschlag, Robert; Erwin Dichtl; Hans Hörschgen: Marketing, 1997, S. 883
6
Meffert und Becker verstehen unter einer Marketingstrategie einen Verhal-
tensplan beziehungsweise einen Handlungsrahmen zur Erreichung der Ziele.
Gemeint ist also ,,wie" Ziele erreicht werden. Für Porter ist das Ziel einer
Strategie die Erreichung einer gewinnbringenden Position, also das ,,Wo-
hin". Der Gedanke der Langfristigkeit von Strategien ist bei der Formulie-
rung von Nieschlag und Meffert zu finden.
Basierend auf diesen Strategieformulierungen wird im Rahmen dieser Dip-
lomarbeit unter einer Marketingstrategie Folgendes verstanden: Eine Marke-
tingstrategie ist vergleichbar mit einer Route (,,Wie"), die verfolgt werden
muss, um zu einer gewinnbringenden Position (,,Wohin") zu gelangen. Fer-
ner hat sie einen langfristigen Charakter.
Um erfolgreiche Strategien entwickeln zu können, müssen weiterhin die
besonderen Merkmale des Handheld-Marktes, einem so genannten ,,High-
tech-Markt", berücksichtigt werden. Hightech-Märkte sind jene Anbieter-
Nachfragerkonstellationen, bei denen Hightech-Güter und Hightech-
Dienstleistungen vermarktet werden. Diese Märkte sind durch
· dynamisches und turbulentes Verhalten,
· fragmentierte Angebots- und Nachfragestruktur,
· instabile Kooperationsstrukturen und
· geringe Vorhersagbarkeit
gekennzeichnet.
8
Das Hauptmerkmal von Hightech-Produkten ist die Technologiebezogen-
heit: Damit soll die Nähe zur Innovation, zur Forschung und Entwicklung
eines Produktes einerseits, aber auch Komplexität, schwere Verständlich-
keit, Fortschrittlichkeit und Neuigkeit anderseits ausgedrückt werden.
9
8
Vgl. Scheuch, Fritz: Hightech-Marketing zur Effizienzsteigerung der Technologiepolitik,
Marketing Arbeitspapier Nr. 11, Dezember 1994, S. 46
9
Vgl. Scheuch, Fritz: Hightech Marketing zur Effizienzsteigerung der Technologiepolitik,
Marketing Arbeitspapier Nr. 11, Dezember 1994, S.45
7
Hightech-Märkte, wie zum Beispiel der Handheld-Markt, sind meist so ge-
nannte junge Märkte. Junge Märkte sind Märkte, die sich in der Einfüh-
rungsphase sowie der schnellen Wachstumsphase befinden.
10
Unabhängig
von branchenspezifischen Unterschieden besteht die wesentliche Eigen-
schaft dieser Märkte aus strategischer Sicht darin, dass noch keine auf spe-
ziellen Erfahrungen begründeten Spielregeln existieren.
11
Darüber hinaus
sind junge Märkte in der Regel durch eine erhebliche technologische Unsi-
cherheit gekennzeichnet. Häufig konkurrieren mehrere alternative Techno-
logien um die Anerkennung als Industriestandard
12
. Mit der technologischen
Unsicherheit geht meistens auch die strategische Unsicherheit einher: Noch
keine der von den Wettbewerbern verfolgten Strategien hat sich als überle-
gen herausgestellt.
13
Ein Ansatz, um die genannten Unsicherheiten eines Hightech-Marktes er-
folgreich zu bewältigen, ist das Technology Adoption Life Cycle Modell.
2.1
Das Technology Adoption Life Cycle Modell
Das Technology Adoption Life Cycle Modell versucht zu erklären wie neue
technologische Produkte vom Markt oder vom Konsumenten aufgenommen
werden. Das Modell hat seine Wurzeln in den von Moore
14
beschriebenen
,,Discontinuous Innovations". Discontinuous Innovations sind neue Produk-
te oder Dienstleistungen, die vom Konsumenten verlangen ihre alten Ver-
haltensmuster gegenüber neuen Produkten oder Dienstleistungen abzulegen,
mit dem Versprechen eines besseren Produktnutzens. Im Gegensatz dazu
handelt es sich bei ,,Continuous Innovations" um verbesserte Produkte, bei
denen keine Verhaltensänderung notwendig ist, um ein Produkt zu gebrau-
10
Vgl. Meffert, Heribert: Marketing, 1998, S. 246
11
Vgl. Porter, Michael E.: Wettbewerbsstrategie, 1999, S. 279
12
Vgl. Meffert, Heribert: Marketing, 1998, S. 246
13
Vgl. Porter, Michael E.: Wettbewerbsstrategie, 1999, S. 281
14
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Crossing the Chasm, 1999, S. 10/ 11
8
chen. Bei Discontinuous Innovations stellt sich also die Frage, inwieweit
Verbraucher ihr Verhalten ändern wollen und können.
Das Technology Adoption Life Cycle Modell besagt nun, dass jede techno-
logische Innovation (Discontinuous Innovation) in ihrem Lebenszyklus den
frühen Markt durchlaufen und für sich gewinnen muss, um in den ertragrei-
chen Mainstream-Markt zu gelangen.
15
Zwischen diesen beiden Märkten
gibt es jedoch die von Moore beschriebene Kluft, die den Erfolg oder Miss-
erfolg von technologischen Innovationen ausmachen. Da letztendlich der
Verbraucher über den Erfolg oder Misserfolg eines Produktes entscheidet,
besteht die Kluft zwischen den Konsumenten aus dem frühen Markt und
denen des Mainstream-Marktes. Das Technology Adoption Life Cycle Mo-
dell zeigt Strategien auf wie die Kluft überwunden werden kann, um einen
Markterfolg herbeizuführen.
16
Um Moores Modell und damit die Kluft gänzlich zu verstehen, müssen
die Zielgruppen, die sich hinter diesen Märkten befinden, näher beleuchtet
werden. Eine Übersicht der Zielgruppen zeigt Abbildung 1:
Tec
hno
logis
che
Enth
usia
sten
Visio
näre
Pra
gm
atik
er
Kon
serv
ativ
e
Ske
ptik
er
Der Mainstream
Markt
Der Mainstream
Markt
Der frühe
Markt
Der frühe
Markt
Die
Kluft
Abbildung 1: Das Technology Adoption Life Cycle Modell
(Quelle: Moore, Geoffrey A.: Inside the Tornado, 1999, S. 14)
15
Die Begriffe ,,frühen Markt" ,,und Mainstream-Markt" werden auf S. 9 ff erklärt.
16
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Inside the Tornado, 1999 , S. 13-22
9
Das Technology Adoption Life Cycle Modell unterteilt die Käufer in ver-
schiedene Gruppen. Jede Gruppe in der Glockenkurve besitzt ein bestimm-
tes psychographisches Profil, das sie voneinander unterscheidet. Unter-
scheidungsmerkmal ist die Art der Reaktion auf die Discontinuous Innova-
tions.
17
Neue Technologien werden von den in Abbildung 1 beschriebenen
Gruppen verschieden absorbiert, wobei die Adoption von links nach rechts
verläuft.
18
Deswegen ist eine genaue Kenntnis der Konsumentenprofile und
ihrer Beziehungen zueinander Voraussetzung für ein erfolgreiches High-
tech-Marketing. Diesbezüglich sollte der Markt von links nach rechts, ange-
fangen bei den technologischen Enthusiasten über die Visionäre, die Prag-
matiker und die Konservativen bis hin zu den Skeptikern bearbeitet wer-
den.
19
Die nachstehenden Abschnitte sollen diese Vorgehensweise näher
erläutern.
Die unterschiedlichen Gruppen bilden zusammen zwei Märkte: Der frühe
Markt setzt sich zusammen aus den technologischen Enthusiasten und den
Visionären, der Mainstream-Markt aus den Pragmatikern und den Konser-
vativen. Skeptiker gehören keinem der beiden Märkte an, da sie im High-
tech-Marketing nicht beachtet werden.
20
Entsprechend den Gesetzmäßigkeiten der Normalverteilung stellen die
Pragmatiker und die Konservativen jeweils ein Drittel der Grundgesamtheit
dar, ergeben zusammen folglich zwei Drittel. Die Visionäre und die Skepti-
ker sind zwei und die technologischen Enthusiasten drei Standardabwei-
chungen von der Norm entfernt und ergeben zusammen ein Drittel der
Grundgesamtheit. Aufgrund dieser Verteilung ist es für ein erfolgreiches
Hightech-Marketing wichtig, den Mainstream-Markt zu gewinnen.
17
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Crossing the chasm, 1999 , S. 11
18
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Crossing the chasm, 1999 , S. 14
19
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Crossing the chasm, 1999 , S. 13 ff
20
Vgl. detaillierte Beschreibung der Skeptiker auf S. 12
10
Im Folgenden sollen die verschiedenen Gruppen des Technology Adoption
Life Cycle Modells näher beschrieben werden:
· Die technologischen Enthusiasten
21
Für diese Menschen spielt Technologie eine zentrale Rolle in ihrem Le-
ben. Die Funktion des technologischen Produktes ist dabei nicht wichtig.
Technologische Enthusiasten im Folgenden auch ,,Techies" genannt
haben Freude daran die Eigenschaften der neuen Technologie zu erkun-
den und zu testen, mit all den Widrigkeiten, die Neuerungen mit sich
bringen. Sie erwarten kein Produkt, das hundertprozentig ausgereift ist.
Techies suchen förmlich nach technologischen Neuerungen, da sie die
Ersten sein wollen, die eine neue Technologie besitzen und anwenden.
Der Vorteil dieser Gruppe liegt in dem Einfluss, den sie auf die anderen
Segmente im Technology Adoption Life Cycle Modell haben. Techies
sind der erste Kontakt in jedem Hightech-Marketing, da sie den Neue-
rungen (Discontinuous Innovations) aufgeschlossen gegenüber stehen
und so das Produkt einer breiteren Masse zugänglich machen.
· Die Visionäre
22
Die Visionäre sind die wirklichen Revolutionäre im Markt. Sie wollen
die Discontinuous Innovation nutzen, um mit der Vergangenheit zu bre-
chen und eine neue Zukunft zu gestalten. Sie wollen keine Verbesserung
in ihrem Bereich, sondern einen Durchbruch. Sie verfolgen einen
Traum. Im Gegensatz zu den Techies ist der Traum geschäftlicher Na-
tur, nicht technologischer. Sie erkennen eine neue Technologie und
möchten sie in einen strategischen Vorteil verwandeln, indem sie diese
neuen Möglichkeiten ausschöpfen. Von all den Gruppen sind sie am
wenigsten preisempfindlich, weil sie die großen Möglichkeiten der Neu-
erung sehen. Als Käufer sind sie jedoch sehr schwer zufrieden zu stel-
len, da sie einen Traum kaufen beziehungsweise eine Vision realisieren
wollen.
21
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Crossing the chasm, 1999 , S. 30-33
22
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Crossing the chasm, 1999 , S. 33-38
11
In Visionäre muss deswegen sehr viel investiert werden, doch sind es
gerade sie, die die Technologie an die Öffentlichkeit tragen. Um die Vi-
sion wahr werden zu lassen, sind sie bereit an der Innovation mitzuar-
beiten und erwarten wie die technologischen Enthusiasten kein aus-
gereiftes Produkt.
Die technologischen Enthusiasten und die Visionäre bilden zusammen den
frühen Markt. Trotz der unterschiedlichen Einstellung gegenüber neuen
Technologien, gibt es eine Gemeinsamkeit: Sie wollen die Ersten sein. Die
technologischen Enthusiasten wollen die neue Technologie erforschen be-
ziehungsweise entdecken und die Visionäre haben vor sie zu verwerten.
23
· Die Pragmatiker
24
Die Pragmatiker mit ein Drittel des Gesamtmarktes stellen einen
Großteil des Marktvolumens dar. Mit ihnen und den Konservativen ma-
chen sich die großen Investitionen im frühen Markt bezahlt. Gegenüber
neuen Technologien sind sie neutral. Sie lieben Technologie nicht ihrer
selbst Willen wie die Techies. Im Vergleich zu den Visionären glauben
Pragmatiker an Evolution und nicht an Revolution. Sie übernehmen nur
eine neue Technologie, die sich bereits bewährt hat und hundertprozen-
tig auf ihr Problem zugeschnitten ist. Sie wollen Referenzen von Men-
schen haben, denen sie vertrauen können. Wenn sie sich entschlossen
haben, eine neue Technologie zu adoptieren, kaufen sie meist von
Marktführern. Der Grund ist praktischer Natur: Der Markt richtet sich
nach den Produkten des Marktführers. Konkurrenzprodukte orientieren
sich also nach dessen Standard. Drittanbieter bauen schließlich auf diese
Technologie auf und erfüllen dadurch auch komplexere Kundenbedürf-
nisse.
23
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Inside the tornado, 1999 , S. 16
24
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Crossing the chasm, 1999 , S. 41-45
12
· Die Konservativen
25
Die Konservativen sind gegenüber Technologien sehr pessimistisch
eingestellt und glauben nicht, dass sie aus Technologien irgendwelchen
Nutzen ziehen können. Sie sind mehr in der Tradition verwurzelt als im
Fortschritt. Wenn sie etwas gefunden haben, mit dem sie gut arbeiten
können, halten sie daran fest. Investitionen in neue Technologien wer-
den nur dann getätigt, wenn sie das Gefühl haben, dass die Welt sie
sonst überrundet. Sie stellen ein Drittel des Marktpotenzials dar und so-
mit eine bedeutende Gruppe, die es zu gewinnen gilt. Um Konservative
zu erreichen, muss die technologische Innovation soweit entwickelt sein,
dass sie billiger und zuverlässiger wird.
· Die Skeptiker
26
Skeptiker partizipieren nicht am Hightech-Markt, außer, dass sie sich
weigern Käufe in Hightech-Märkten zu tätigen. Deshalb ist es die Auf-
gabe des Hightech-Marketings nicht an sie, sondern um sie herum zu
verkaufen und so ihren Einfluss auf andere Gruppen zu minimieren.
Diese fünf Konsumentenprofile ergeben zusammen das Technology Adop-
tion Life Cycle Modell. Das Modell besagt nun, dass jede technologische
Innovation diese fünf Gruppen von links nach rechts nacheinander durch-
läuft. Entsprechend müssen die Konsumentenprofile von links nach rechts
bearbeitet werden, um das Produkt erfolgreich im Markt zu etablieren.
27
Doch wie schon erwähnt, gibt es eine Kluft zwischen dem frühen und dem
Mainstream-Markt. Da der frühe Markt sich aus den technologischen En-
thusiasten und den Visionären und der Mainstream sich aus Pragmatikern
und Konservativen zusammensetzt, besteht die Kluft zwischen den Visionä-
ren und den Pragmatikern. Der Grund liegt in den psychographischen
Merkmalen beider Gruppen. Der Unterschied zwischen beiden Gruppen
lässt sich am besten durch den unterschiedlichen Gebrauch des Satzes ,,Ich
25
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Crossing the chasm, 1999 , S. 46-49
26
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Inside the tornado, 1999 , S. 17
27
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Crossing the chasm, 1999 , S. 13-14
13
sehe." beschreiben:
28
Wenn Visionäre sagen: ,,Ich sehe.", dann tun sie dies
mit geschlossenen Augen. Sie haben also eine Vision. Dagegen sehen
Pragmatiker mit offenen Augen. Sie wollen etwas Konkretes, was sich be-
reits bewährt hat. Sie wollen eine Lösung, die zu hundert Prozent auf ihre
Problemstellung zugeschnitten ist.
29
Visionäre dagegen, die mit ihrer Vision
als Erste auf dem Markt sein wollen, erwarten kein ausgereiftes Produkt und
sind deswegen schlechte Referenzen für Pragmatiker.
30
Dieses Spannungs-
verhältnis zwischen Visionären und Pragmatikern ist die von Moore be-
schriebene Kluft.
Aus dem Technology Adoption Life Cycle Modell lässt sich nun folgende
Standardstrategie ableiten
31
:
· Neue Produkte beginnen immer bei den technologischen Enthusiasten.
Dort müssen die Produkte als erste gestreut werden, damit sie es einer
breiteren Masse zugänglich machen. Aus den Erfahrungen der technolo-
gischen Enthusiasten mit der Innovation können Unternehmen lernen
und diese für Produktverbesserungen nutzen, um auf die Visionäre zu-
zugehen.
· Sind Visionäre auf das Produkt aufmerksam geworden sind, sollte das
Unternehmen in sie investieren und zu zufriedenen Kunden machen,
damit sie die Technologie an die Öffentlichkeit tragen. Visionäre erwar-
ten wie die technologischen Enthusiasten auch kein ausgereiftes Pro-
dukt, aber sie sind bereit an dessen Entwicklung mitzuarbeiten, da sie
die Möglichkeiten der Innovation sehen.
· Da die Pragmatiker einen Drittel der Käuferschicht darstellen, kann und
muss mit ihnen Umsatz generiert werden, damit sich die frühen Investi-
tionen bezahlt machen. Deswegen können Produkte in dieser Phase auch
28
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Inside the tornado, 1999 , S. 18-20
29
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Inside the tornado, 1999 , S. 16
30
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Crossing the chasm, 1999 , S. 55-59
31
Vgl. Moore, Geoffrey A.: Inside the tornado, 1999 , S. 18
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832466374
- ISBN (Paperback)
- 9783838666372
- DOI
- 10.3239/9783832466374
- Dateigröße
- 729 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln – Wirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2003 (April)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- personal digital assistant windows palmsource symbion wireless service
- Produktsicherheit
- Diplom.de