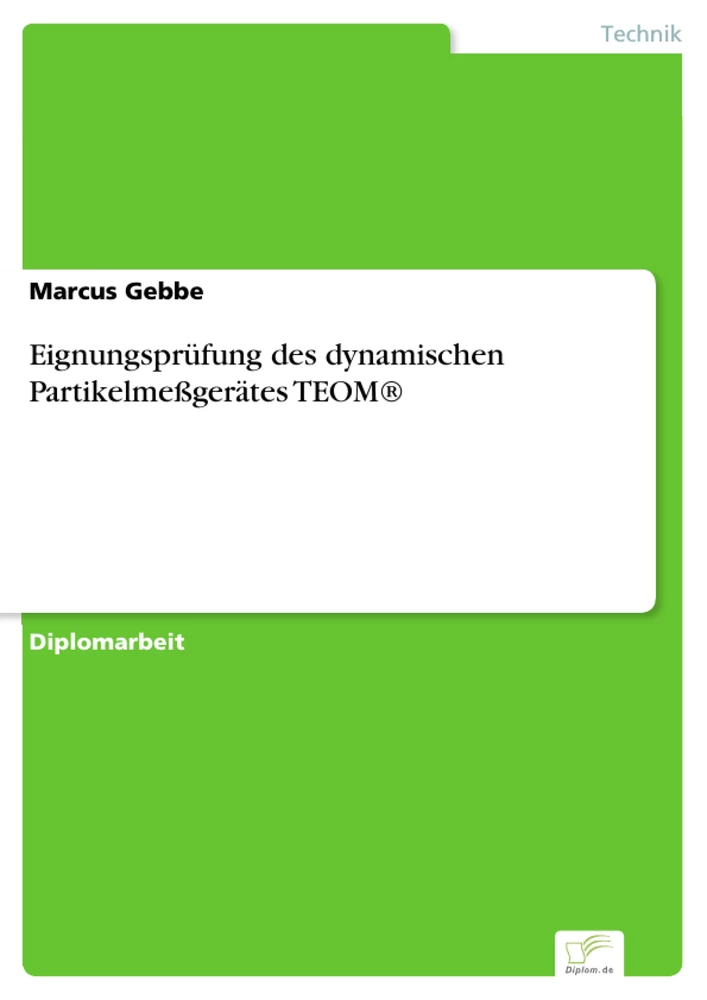Eignungsprüfung des dynamischen Partikelmeßgerätes TEOM®
©1999
Diplomarbeit
106 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde die Eignung des TEOM® zur dynamischen Erfassung der Partikelemission von Kfz mit Dieselmotoren auf einem Abgasrollenprüfstand geprüft.
Ein Kriterium für diesen Nachweis ist der Vergleich der vom TEOM® ermittelten Gesamtmasse im europäischen Fahrzyklus relativ zum gesetzlich vorgeschriebenen gravimetrischen Verfahren. Hier konnte bei Beachtung einiger Randbedingungen eine gute Übereinstimmung von durchschnittlich 92,9 % beim Testfahrzeug erreicht werden.
Das Auftreten von negativen Massenraten führt bei der Analyse von einzelnen Motorbetriebszuständen zu Verzerrungen, da sie hauptsächlich in ruhigen Phasen des Tests (Verzögerung, Leerlauf) auftreten. Durch geeignete Wahl der Betriebsparameter des TEOM® ist eine deutliche Reduzierung, nicht aber eine vollständige Eliminierung der negativen Peaks möglich. Da die negativen Massenraten aber an definierten Stellen, also nicht willkürlich, auftreten, stellen sie die generelle Eignung des Gerätes nicht in Frage. Der vom TEOMÒ ermittelte Verlauf kann dem Applikateur wichtige Erkenntnisse zur Optimierung der Partikelemission liefern.
In dieser Diplomarbeit wurden drei dynamische Partikelmeßgeräte verglichen. Neben dem TEOM® kam ein Trübungsmeßgerät und das nach der Infrarot- Extinktionsmethode funktionierende DPA 482 zum Einsatz. Das hier eingesetzte Trübungsmeßgerät kann die Partikelemission moderner Motoren (EURO 3) nicht mehr hinreichend genau erfassen.
Das TEOM® empfiehlt sich für einen Einsatz, wenn die Emission in Anlehnung an das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren ermittelt werden soll. Bei gleichzeitiger Ermittlung der limitierten gasförmigen Abgasbestandteile ist das TEOM® dem DPA 482 vorzuziehen, da keine Entnahme von Rohgas vorgenommen wird und somit die Analyse der verdünnten Gase nicht negativ beeinflußt wird. Das DPA 482 ermöglicht die differenzierte Erfassung von Ruß und Kohlenwasserstoffen und empfiehlt sich daher für entsprechende Aufgabenstellungen. Das TEOM® ist verglichen mit dem DPA 482 einfacher zu bedienen.
Abschließend läßt sich feststellen, daß das TEOM® geeignet ist, die dynamische Partikelemission von Dieselkraftfahrzeugen hinreichend genau zu erfassen. Diese Aussage trifft insbesondere vor dem Hintergrund zu, das bessere Alternativen bei den gegebenen Randbedingungen nicht vorhanden sind. Das TEOM® bietet die Möglichkeit, zukünftig einen besseren Kompromiß zwischen dem Zielkonflikt der gleichzeitigen […]
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde die Eignung des TEOM® zur dynamischen Erfassung der Partikelemission von Kfz mit Dieselmotoren auf einem Abgasrollenprüfstand geprüft.
Ein Kriterium für diesen Nachweis ist der Vergleich der vom TEOM® ermittelten Gesamtmasse im europäischen Fahrzyklus relativ zum gesetzlich vorgeschriebenen gravimetrischen Verfahren. Hier konnte bei Beachtung einiger Randbedingungen eine gute Übereinstimmung von durchschnittlich 92,9 % beim Testfahrzeug erreicht werden.
Das Auftreten von negativen Massenraten führt bei der Analyse von einzelnen Motorbetriebszuständen zu Verzerrungen, da sie hauptsächlich in ruhigen Phasen des Tests (Verzögerung, Leerlauf) auftreten. Durch geeignete Wahl der Betriebsparameter des TEOM® ist eine deutliche Reduzierung, nicht aber eine vollständige Eliminierung der negativen Peaks möglich. Da die negativen Massenraten aber an definierten Stellen, also nicht willkürlich, auftreten, stellen sie die generelle Eignung des Gerätes nicht in Frage. Der vom TEOMÒ ermittelte Verlauf kann dem Applikateur wichtige Erkenntnisse zur Optimierung der Partikelemission liefern.
In dieser Diplomarbeit wurden drei dynamische Partikelmeßgeräte verglichen. Neben dem TEOM® kam ein Trübungsmeßgerät und das nach der Infrarot- Extinktionsmethode funktionierende DPA 482 zum Einsatz. Das hier eingesetzte Trübungsmeßgerät kann die Partikelemission moderner Motoren (EURO 3) nicht mehr hinreichend genau erfassen.
Das TEOM® empfiehlt sich für einen Einsatz, wenn die Emission in Anlehnung an das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren ermittelt werden soll. Bei gleichzeitiger Ermittlung der limitierten gasförmigen Abgasbestandteile ist das TEOM® dem DPA 482 vorzuziehen, da keine Entnahme von Rohgas vorgenommen wird und somit die Analyse der verdünnten Gase nicht negativ beeinflußt wird. Das DPA 482 ermöglicht die differenzierte Erfassung von Ruß und Kohlenwasserstoffen und empfiehlt sich daher für entsprechende Aufgabenstellungen. Das TEOM® ist verglichen mit dem DPA 482 einfacher zu bedienen.
Abschließend läßt sich feststellen, daß das TEOM® geeignet ist, die dynamische Partikelemission von Dieselkraftfahrzeugen hinreichend genau zu erfassen. Diese Aussage trifft insbesondere vor dem Hintergrund zu, das bessere Alternativen bei den gegebenen Randbedingungen nicht vorhanden sind. Das TEOM® bietet die Möglichkeit, zukünftig einen besseren Kompromiß zwischen dem Zielkonflikt der gleichzeitigen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6627
Gebbe, Marcus: Eignungsprüfung des dynamischen Partikelmeßgerätes TEOM®
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Berlin, Technische Universität, Diplomarbeit, 1999
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
Danksagung
I
Marcus Gebbe
Sprengelstr. 33
13353 Berlin
Tel.: 030 / 454 900 44
Special Thanks to:
·
Prof. em Dr. H. Appel, Leiter des Instituts für Straßen- und Schienenverkehr an
der TU Berlin.
·
Herrn Holthaus, Betriebsleiter der IAV GmbH Berlin,
·
Detlef Volkmer, der als Betreuer der Diplomarbeit und Ingenieur am Abgasrol-
lenprüfstand am inhaltlichen Gelingen dieser Arbeit wesentlichen Anteil hatte und
immer mit guten Tips und Ratschlägen zur Verfügung stand.
·
Andreas Rahne und Frank Michael Schulz, die als Prüfstandsfahrer allzeit
das Lenkrad fest im Griff hatten.
·
Ralf Valentin für das Aufspüren von Tippfehlern und inhaltlicher Sinnlosigkeiten.
·
Frank Bunar, der das Testfahrzeug organisierte, den Motordatenstand appli-
zierte, die Rauchgasmessung durchführte und hilfreiche Tips gab.
·
Frank Appel, der die Meßdaten des DPA 482 zur Verfügung stellte.
·
Sven Exler, der die Auswertung von Motorkenndaten erarbeitet hat.
·
der IAV GmbH in Berlin, die Ihren modernen Abgasrollenprüfstand für die
Messungen zur Verfügung gestellt hat.
·
und meiner Frau Andrea, die meine guten und schlechten Launen in der Zeit der
Erstellung der Diplomarbeit ertragen mußte
Daten zu dieser Diplomarbeit:
Bei den durchgeführten Tests wurden knapp 1 Millionen Meßwerte ermittelt.
Inhalt
II
Inhalt
1 EINLEITUNG ... 1
2 ZUSAMMENFASSUNG, BEWERTUNG UND AUSBLICK ... 3
3 EIGENSCHAFTEN UND WIRKUNGEN VON PARTIKELN ... 5
3.1 Partikel - eine Einordnung ... 5
3.1.1 Eigenschaften von Rußpartikeln... 6
4 GRUNDLAGEN DER PARTIKELMESSUNG VON DIESEL-KFZ... 8
4.1 Eigenschaften von Partikeln aus Diesel-Kfz... 8
4.1.1 Höhe der Partikelemission... 9
4.1.2 Stoffliche Zusammensetzung der Partikel ...10
4.1.3 Größenverteilung der Partikel...12
4.1.4 Gesetzliche Bestimmungen für die Messung von Partikeln aus Dieselmotoren in Europa...14
4.2 Meßtechniken zur Bestimmung der Partikelemission ...15
4.2.1 Gravimetrisches Verfahren...15
4.2.2 Rauchgasmessung ...18
4.2.3 Infrarot-Extinktionsmethode ...20
4.2.4 Tapered Element Oscillating Microbalance...21
4.3 Ergebnisse vergleichender Messungen mit dem TEOM
®
...22
5 KONZEPT FÜR DIE MESSUNGEN MIT DEM TEOM
®
...31
5.1 Optimierungstests...31
5.1.1 Überprüfung der Starteffizienz neuer Filter...32
5.1.2 Überprüfung des Druckabfalls bei stark beladenen Filtern...32
5.1.3 Variation von Geräteeinstellungen...33
5.1.4 Detailuntersuchung der negativen Peaks ...34
5.2 Applikationstests...35
5.3 Katalysatortests ...36
6 VERSUCHSAUFBAU UND -DURCHFÜHRUNG...38
6.1 Abgasrollenprüfstand der IAV GmbH ...38
6.2 TEOM
®
-Meßgerät...40
6.3 Fahrzyklen...46
6.4 Testfahrzeuge...48
Inhalt
III
6.5 Berechnungsgrundlagen und Definitionen...49
7 VERSUCHSERGEBNISSE...52
7.1 Ergebnisse der Optimierung der Geräteeinstellung ...52
7.1.1 Überprüfung der Starteffizienz neuer Filter...52
7.1.2 Überprüfung des Druckabfalls bei stark beladenen Filtern...54
7.1.3 Optimierung der Geräteeinstellung...55
7.1.4 Detailuntersuchung der negativen Peaks ...65
7.1.5 Zusammenfassung der Optimierungstests...67
7.2 Ergebnisse der Applikationstests ...68
7.2.1 Übersicht über die Ergebnisse in den europäischen Fahrzyklen ...68
7.2.2 Vergleichende Betrachtung der Ergebnisse des TEOM
®
, der Trübungsmessung
und des gravimetrischen Verfahrens ...74
7.2.3 Vergleichende Betrachtung der Ergebnisse des TEOM
®
und des DPL 482 ...80
7.3 Ergebnisse der Katalysatortests ...82
7.4 Empfehlungen zum Einsatz des TEOM
®
im täglichen Betrieb eines Abgasprüfstandes...86
8 ERGEBNISZUSAMMENFASSUNG...90
9 LITERATURVERZEICHNIS ...95
Verzeichnisse
IV
Abbildungsverzeichnis
Kapitel 3
Bild 3.1 Ungefährer Größenbereich verschiedener Teilchenarten / Birkle 1979 / ...6
Kapitel 4
Bild 4.1 Typische Partikelmassenemission von Kfz im europäischen Fahrzyklus...9
Bild 4.2 Typische stoffliche Zusammensetzung der Partikelemission eines Diesel-
Kfz / Klingenberg 1995 /...10
Bild 4.3 Einfluß des Katalysators auf die Partikelemission und -zusammensetzung
im europäischen Fahrzyklus / MTZ 1996 / ...12
Bild 4.4 Typische Größenverteilung von Partikeln eines Dieselmotors mit
Oxidationskatalysator / Klingenberg 1995 /...13
Bild 4.5 Zukünftige Partikel- und NOx-Grenzwerte für Dieselmotoren in Europa...14
Bild 4.6 Filterung von Dieselabgas auf dem Abgasprüfstand...17
Bild 4.7 Ermittlung der Partikelemission eines Kfz / Klingenberg 1995 /...17
Bild 4.8 Prinzipskizze des Rauchgasmeßgerätes Celesco 300 ...18
Bild 4.9 Prinzipskizze des Kondensations-Partikelmeßgerätes 3022A von TSI...19
Bild 4.10 Funktionsprinzip der Infrarot-Extinktionsmethode ...21
Bild 4.11 Prüfung auf korrekte Massenermittlung des TEOM
®
/ SAE 850403 b / ...24
Bild 4.12 Einfluß des Filter-Durchsatzes auf das T/G-Ratio / SAE 1998 / ...25
Bild 4.13 Einfluß der Filtertemperatur auf das T/G-Ratio auf einem Motorprüfstand
/ SAE 1998 / ...26
Bild 4.14 Einfluß der Filtertemperatur auf das T/G-Ratio auf einem
Abgasrollenprüfstand / SAE 1998 / ...27
Bild 4.15 Einfluß des Fahrzyklus auf das T/G-Ratio bei idi-Dieselmotoren
/ SAE 1985 a / ...28
Bild 4.16 Einfluß des Motorbetriebszustandes auf das T/G-Ratio bei idi-Diesel-
motoren mit Turbolader / SAE 1985 a / ...29
Bild 4.17 Einfluß des Motorbetriebszustandes auf das T/G-Ratio bei di-Diesel-
motoren mit Turbolader / SAE 1985 a / ...29
Verzeichnisse
V
Kapitel 6
Bild 6.1 Rollenprüfstand der IAV GmbH ...38
Bild 6.2 Ansicht der Waage zur gravimetrischen Partikelmassenemission...40
Bild 6.3 Prinzipskizze des TEOM
®
-Meßgerätes ...41
Bild 6.4 Frontansicht des TEOM
®
-Meßgerätes ...42
Bild 6.5 Ansicht der geschlossenen Meßzelle des TEOM
®
-Meßgerätes ...43
Bild 6.6 Ansicht der geöffneten Meßzelle des TEOM
®
-Meßgerätes mit
aufgesetztem Filter ...43
Bild 6.7 Grafische Darstellung der Meßwerte am PC...44
Bild 6.8 Skizze eines TEOM
®
-Filters...45
Bild 6.9 Europäischer Fahrzyklus ...46
Bild 6.10 Amerikanischer Fahrzyklus FTP75...47
Kapitel 7
Bild 7.1 Starteffizienz eines beladenen und neuen TX40-Filters ...52
Bild 7.2 Übersicht über die Starteffizienz verschiedener Filtertypen...53
Bild 7.3 Druckabfall am Filter in Abhängigkeit von der Filterbeladung...54
Bild 7.4 Typischer Verlauf der Massenrate im Hot505-Fahrzyklus...55
Bild 7.5 Typischer Verlauf negativer Emissionsspitzen im Hot505-Fahrzyklus ...56
Bild 7.6 Typischer Verlauf der Massenrate bei Schaltvorgängen im Hot505-
Fahrzyklus...57
Bild 7.7 Typischer Verlauf der Gesamtmasse im Hot505-Fahrzyklus...58
Bild 7.8 T/G-Ratio in den Hot505-Tests in Abhängigkeit von Durchfluß und
TEOM
®
-Temperatur ...60
Bild 7.9 Verlauf der Massenrate im Hot505-Fahrzyklus bei 25 und 45° C
Temperatur des TEOM
®
-Meßgerätes [0..505 Sek.]...61
Bild 7.10 Verlauf der Massenrate im Hot505-Fahrzyklus bei 25 und 45° C
Temperatur des TEOM
®
-Meßgerätes [320..505 Sek.] ...62
Bild 7.11 Verlauf der Massenrate im Hot505-Fahrzyklus bei 1 und 3 l/min
Durchfluß des TEOM-Meßgerätes [0..505 Sek.]...63
Bild 7.12 Verlauf der Massenrate im Hot505-Fahrzyklus bei 1 und 3 l/min
Durchfluß des TEOM
®
-Meßgerätes [320..505 Sek.] ...64
Bild 7.13 Verlauf der Massenrate in reinen Beschleunigungs- und
Verzögerungsphasen ...66
Bild 7.14 Verlauf der Massenrate in Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen,
die durch Konstantfahrten getrennt sind...66
Verzeichnisse
VI
Bild 7.15 P/G-Ratio in Abhängigkeit von Durchfluß und Temperatur in den
Hot505-Tests ...67
Bild 7.16 T/G-Ratio in den europäischen Fahrzyklen...69
Bild 7.17 T/G-Ratio in den Phasen des europäischen Fahrzyklus...69
Bild 7.18 Exemplarischer Verlauf der Massenrate im europäischen Fahrzyklus ...70
Bild 7.19 Exemplarischer Verlauf der Gesamtmassen im europäischen Fahrzyklus ...71
Bild 7.20 Partikelemission des Fahrzeugs in einzelnen Testphasen ...72
Bild 7.21 Partikelemission des Fahrzeugs in einzelnen Motorbetriebszuständen...73
Bild 7.22a Massenrate des TEOM
®
vor und nach Applikation im europäischen
Fahrzyklus [200..400 Sek.]...75
Bild 7.22b Trübung vor und nach Applikation im europäischen Fahrzyklus
[200..400 Sek.]...75
Bild 7.23a Massenrate des TEOM
®
vor und nach Applikation im europäischen
Fahrzyklus [800..1200 Sek.]...77
Bild 7.23b Trübung vor und nach Applikation im europäischen Fahrzyklus
[800..1200 Sek.] ...77
Bild 7.24 Korrelation zwischen TEOM
®
-Massenrate und Frischluftmenge als
Indikator der Verstellung der Abgasrückführung [1080..1140 Sek.] ...79
Bild 7.25 Verringerung der Partikelemission durch Applikation in Abhängigkeit
vom eingesetzten Meßgerät...79
Bild 7.26 Vergleich der Verläufe der Massenrate von DPA 482 und TEOM
®
[200..400 Sek.]...81
Bild 7.27 Vergleich der Verläufe der Massenrate von DPA 482 und TEOM
®
[800..1200 Sek.] ...81
Bild 7.28 T/G-Ratio in den europäischen Fahrzyklen eines Fahrzeugs mit und
ohne Oxidationskatalysator ...82
Bild 7.29 Massenrate mit und ohne Katalysator im europäischen Fahrzyklus
[200..400 Sek.]...84
Bild 7.30 Massenrate mit und ohne Katalysator im europäischen Fahrzyklus
[800..1200 Sek.] ...84
Bild 7.31 Gesamtmasse mit und ohne Katalysator im europäischen Fahrzyklus
[800..1200 Sek.] ...85
Bild 7.32 Anzahl der Tests pro Filter und P/G-Ratio in Abhängigkeit vom
Durchfluß...88
Verzeichnisse
VII
Tabellenverzeichnis
Tab. 5.1 Übersicht über das Meßprogramm ...37
Tab. 7.1 Druckabfall pro Test in Abhängigkeit der relevanten Parameter ...87
Tab. 7.2 Zeitaufwand für wiederkehrende Arbeiten am TEOM
®
-Gerät ...89
Verzeichnisse
VIII
Formelverzeichnis
Formel 4.1 Berechnung der Kalibrierkonstanten eines TEOM
®
-Sensors
/ Gefahrstoffe 1996 /...23
Formel 6.1 Berechnung der Partikelemission des Testfahrzeugs aus dem
Ergebnis der TEOM
®
-Messung ...50
Formel 6.2 Berechnung der Partikelemission des Testfahrzeugs aus dem
Ergebnis der gravimetrischen Bestimmung ...50
Formel 6.3 Berechnung des T/G-Ratio...51
Formel 6.4 Berechnung des P/G-Ratio...51
Verzeichnisse
IX
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzung
Bedeutung
AGR
Abgasrückführung
C
Kohlenstoff
CH
4
Methan
CO
Kohlenmonoxid
CO
2
Kohlendioxid
di
direkt einspritzender Dieselmotor
DPA 482
dynamisches Partikel- und Lambdamess-System 482 der Fa. AVL
EPA
Environmental Protection Agency (der USA)
FTP
Federal Test Procedure (in den USA)
HC
Kohlenwasserstoff
idi
indirekt einspritzender Dieselmotor
LA 4
Los Angeles 4 Testzyklus
NMHC
Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe
NOx
Stickoxide
O
2
Sauerstoff
PAH
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
THC
Gesamtheit aller Kohlenwasserstoffe
VDI
Verein deutscher Ingenieure
Einleitung
Seite 1
1 Einleitung
Nicht erst seitdem sich die direkt einspritzenden Dieselmotoren im Markt durchge-
setzt haben, ist der Dieselmotor im Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch und damit
auch auf die Kohlendioxidemission ohne Konkurrenz. Anstelle dessen steht bei den
Dieselmotoren u. a. die Partikelemission im Vordergrund der Kritik, da sie vermut-
lich gesundheitsschädigende Wirkung auf den menschlichen Organismus hat.
Daher wurden im Rahmen des präventiven Schutzes der Menschen in den Indust-
rienationen massenbezogene Grenzwerte für die Partikelemission definiert. Der
genaue Zusammenhang hinsichtlich der gesundheitsschädlichen Wirkung von Parti-
keln aus Dieselmotoren konnte aber noch nicht restlos geklärt werden.
Eine stufenweise Verringerung der Abgasgrenzwerte in Europa wurde sowohl für
das Jahr 2000 als auch für 2005 beschlossen. Aufgrund dieser Verschärfung wird
es den Applikateuren nicht mehr ausreichen, nur die Gesamtemission der Fahrzeu-
ge in den jeweiligen Abgastestzyklen zu kennen. Zu einem noch wichtigerem Werk-
zeug werden die zeitaufgelösten Emissionswerte. Für die gasförmigen Emissionen
sind diese bereits seit langem verfügbar. Einzig die limitierte Partikelemission wurde
bisher nicht zeitaufgelöst betrachtet.
Der sogenannte ,,Dieselkonflikt" - die gleichzeitige Reduzierung der Stickoxid- und
Partikelemission - wird zukünftig ohne genaue Kenntnis der Partikelemission in ein-
zelnen Fahrzuständen nicht optimal zu lösen sein.
Das Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM
®
) ist in der Lage, die Parti-
kelemission zeitaufgelöst zu ermitteln. Dabei wird das Gerät wie beim gesetzlich
vorgeschriebenen gravimetrischen Verfahren mit Filtern betrieben. Die unweigerlich
im Abgas vorhandene Feuchte und flüchtige, an Partikeln angelagerte Bestandteile
können das Ergebnis beeinflussen.
Einleitung
Seite 2
Inwieweit das TEOM
®
geeignet ist, die Partikelemission so genau darzustellen, daß
die Ergebnisse in der Praxis von Applikateuren genutzt werden können, soll Ge-
genstand der Untersuchungen in dieser Diplomarbeit sein. Dazu werden drei Meß-
reihen durchgeführt.
In der ersten Meßreihe wird untersucht, ob die Variation von Geräteeinstellungen
Einfluß auf die Qualität und Quantität der Ergebnisse des TEOM
®
hat. In dieser
Untersuchung wird auch das Problem der geringen Starteffizienz von neuen Filtern
und das Problem negativer Peaks im Verlauf der Massenrate betrachtet.
In der zweiten Meßreihe wird überprüft, ob der zeitliche Verlauf der Massenrate
durch das TEOM
®
korrekt wiedergegeben wird. Da es keine Möglichkeit der direk-
ten Überprüfung der zeitaufgelösten Partikelmeßwerte gibt, kann die qualitative und
quantitative Überprüfung nur auf indirektem Wege geführt werden. Hierzu wird ver-
sucht, an einem Fahrzeug durch Variation der Abgasrückführung an genau definier-
ten Stellen eine Verbesserung der Partikelemission herbeizuführen. Diese Verbes-
serung wird zum einen durch das gravimetrische Standardverfahren, durch die TE-
OM
®
-Messung und durch eine Rauchgasmessung ermittelt. Die Ergebnisse der drei
Meßgeräte werden verglichen und bewertet. Diese Meßreihe beinhaltet auch einen
Vergleich zwischen einer TEOM
®
-Messung und einer mittels DPL 482
1
.
In der dritten Meßreihe wird der Einfluß des Katalysators auf die Ergebnisse des
TEOM
®
-Gerätes ermittelt. Dazu wird der serienmäßig eingebaute Oxidations-
katalysator des Testfahrzeugs gegen einen unbeschichteten Katalysator getauscht.
1
Das Prinzip dieses Gerätes beruht auf der Infrarot-Extinktionsmethode (siehe Kapitel 4.2.3)
Zusammenfassung
Seite 3
2 Zusammenfassung, Bewertung und Ausblick
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde die Eignung des TEOM
®
zur dynamischen
Erfassung der Partikelemission von Kfz mit Dieselmotoren auf einem Abgasrollen-
prüfstand geprüft.
Ein Kriterium für diesen Nachweis ist der Vergleich der vom TEOM
®
ermittelten
Gesamtmasse im europäischen Fahrzyklus relativ zum gesetzlich vorgeschriebenen
gravimetrischen Verfahren. Hier konnte bei Beachtung einiger Randbedingungen
eine gute Übereinstimmung von durchschnittlich 92,9 % beim Testfahrzeug erreicht
werden.
Das Auftreten von negativen Massenraten führt bei der Analyse von einzelnen Mo-
torbetriebszuständen zu Verzerrungen, da sie hauptsächlich in ,,ruhigen" Phasen des
Tests (Verzögerung, Leerlauf) auftreten. Durch geeignete Wahl der Betriebspara-
meter des TEOM
®
ist eine deutliche Reduzierung, nicht aber eine vollständige Eli-
minierung der negativen Peaks möglich. Da die negativen Massenraten aber an de-
finierten Stellen, also nicht willkürlich, auftreten, stellen sie die generelle Eignung
des Gerätes nicht in Frage. Der vom TEOM
®
ermittelte Verlauf kann dem Applika-
teur wichtige Erkenntnisse zur Optimierung der Partikelemission liefern.
In dieser Diplomarbeit wurden drei dynamische Partikelmeßgeräte verglichen. Ne-
ben dem TEOM
®
kam ein Trübungsmeßgerät und das nach der Infrarot-
Extinktionsmethode funktionierende DPA 482 zum Einsatz. Das hier eingesetzte
Trübungsmeßgerät kann die Partikelemission moderner Motoren (EURO 3) nicht
mehr hinreichend genau erfassen.
Das TEOM
®
empfiehlt sich für einen Einsatz, wenn die Emission in Anlehnung an
das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren ermittelt werden soll. Bei gleichzeitiger
Ermittlung der limitierten gasförmigen Abgasbestandteile ist das TEOM
®
dem
Zusammenfassung
Seite 4
DPA 482 vorzuziehen, da keine Entnahme von Rohgas vorgenommen wird und so-
mit die Analyse der verdünnten Gase nicht negativ beeinflußt wird. Das DPA 482
ermöglicht die differenzierte Erfassung von Ruß und Kohlenwasserstoffen und emp-
fiehlt sich daher für entsprechende Aufgabenstellungen. Das TEOM
®
ist verglichen
mit dem DPA 482 einfacher zu bedienen.
Abschließend läßt sich feststellen, daß das TEOM
®
geeignet ist, die dynamische
Partikelemission von Dieselkraftfahrzeugen hinreichend genau zu erfassen. Diese
Aussage trifft insbesondere vor dem Hintergrund zu, das bessere Alternativen bei
den gegebenen Randbedingungen nicht vorhanden sind. Das TEOM
®
bietet die
Möglichkeit, zukünftig einen besseren Kompromiß zwischen dem Zielkonflikt der
gleichzeitigen Senkung der NOx- und Partikelemission zu erreichen. Insbesondere
im Hinblick auf die bereits beschlossenen Senkungen der Partikel- und Abgas-
grenzwerte in Europa ist eine genauere Kenntnis der Partikelemission unbedingt
notwendig.
Die hier vorliegenden Messungen wurden an einem Fahrzeug mit direkt einspritzen-
den Dieselmotor vorgenommen, der mit Turbolader und Oxidationskatalysator aus-
gerüstet war. Dieser Motor entspricht dem derzeitigen Standard bei Neufahrzeugen
mit Dieselmotor. Für andere Motor- und Abgasminderungskonzepte kann eine Eig-
nungsprüfung des TEOM
®
zu differenzierten Ergebnissen kommen.
Derzeit wird die stoffliche Zusammensetzung und die Größenverteilung der Partikel
vom Gesetzgeber nicht bewertet. Es ist zu vermuten, daß einen relevanter Wir-
kungszusammenhang zwischen diesen beiden Kenngrößen und der gesundheitlichen
Gefährdung durch Partikel besteht. In Zukunft könnten daher entsprechende Meß-
geräte in den Mittelpunkt rücken.
Grundlagen der Partikelmessung
Seite 5
3 Eigenschaften und Wirkungen von Partikeln
3.1 Partikel - eine Einordnung
Unter Partikeln oder partikelförmigen Luftverunreinigungen werden feste und flüssi-
ge, in der Atemluft schwebende, fein verteilte Stoffe verstanden. Dieser Schweb-
staub wird den Aerosolen untergeordnet. Diese bezeichnen allgemein Systeme aus
Gasen (z. B. Luft oder Stickstoff etc.) mit darin verteilten, kleinen, festen oder flüs-
sigen Schwebstoffen. Diese Schwebstoffe haben natürliche (Vulkanismus, Blüten-
staub etc.) wie auch menschlich-industrielle Ursachen (Verbrennungsprozesse). In
diesem Zusammenhang spricht man oft von anthrophogenen Quellen des Schweb-
staubes, womit all die Stäube gemeint sind, die nicht natürlich, sondern vom Men-
schen verursacht sind / Birkle 1979 /.
Die untere Grenze der Partikelgröße ist mit dem Übergang von festen zu gasförmi-
gen Stoffen verbunden. Die obere Grenze wird mit zunehmender Partikelgröße da-
durch gekennzeichnet, daß die Stoffe aufgrund ihres Gewichts rasch zu Boden sin-
ken. Dieses Sedimentieren ist erst oberhalb einer Korngröße von 10
µ
m
2
nennens-
wert (die Sinkgeschwindigkeit eines kugelförmigen Teilchens von 10
µ
m Durchmes-
ser und der Dichte von 1 g/cm³ in ruhender Luft beträgt etwa 3 mm/s). Damit ergibt
sich ein Rahmen für den Durchmesser von Schwebstoffen von etwa 0,001
µ
m bis
500
µ
m (oder: 0,5 mm). Teilchen, die kleiner als 10
µ
m sind, bezeichnet man als
Feinstäube, größere als Grobstaub / Birkle 1979 /.
Bild 3.1 zeigt eine Übersicht über die Größenbereiche verschiedener Teilchenarten.
Der im Bild genannte Teilchendurchmesser ist ein geometrischer Begriff, da weder
Durchmesser, noch Volumen oder Oberfläche an den unregelmäßig geformten Par-
tikeln direkt meßbar sind. Deswegen wird hier von Äquivalentdurchmesser gespro-
2
1
µ
m = 1 * 10
-6
m = 0,001 mm
Grundlagen der Partikelmessung
Seite 6
chen. Er ordnet einem beliebigen Teilchen denjenigen Durchmesser eines kugelför-
migen Teilchens gleicher Stoffart zu / Birkle 1979 /.
Bild 3.1 Ungefährer Größenbereich verschiedener Teilchenarten / Birkle 1979 /
3.1.1 Eigenschaften von Rußpartikeln
Ruß ist eine Erscheinungsform des Kohlenstoffs, der sich bei unvollständiger
Verbrennung (Verbrennung unter Sauerstoffmangel) bildet. Ruß besteht aus räum-
lich verzweigten, losen Ketten mehrerer tausend Einzelpartikel. Diese besitzen eine
relativ große Oberfläche, auf der Reizgase, organische und anorganische Verbin-
dungen sowie Metalle adsorbiert werden. Ruß in der Atemluft kommt also nicht in
reiner, elementarer Form, sondern in Verbindung mit an der Oberfläche adsorbier-
ten Stoffen vor / Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin 1994 /. Den größten
Anteil an der Partikelemission von Dieselmotoren trägt der Kohlenstoff mit ca. 70
bis 90 % (siehe auch Bild 4.2).
Zu den adsorbierten anorganischen Substanzen zählen unter anderem Wasser,
Rostpartikel, Salze (z. B. Sulfate) und keramische Fasern. Organische Substanzen
werden alle (organischen) Kohlenstoffverbindungen genannt, die größtenteils Koh-
lenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff sowie geringe Mengen anderer Stoffe (z. B.
Schwefel) enthalten.
Grundlagen der Partikelmessung
Seite 7
Zu den organischen Substanzen, die adsorbiert werden, gehören die polyzyklischen
aromatischen Kohlenwasserstoffe, im weiteren nur noch kurz PAH genannt. Diese
Klasse umfaßt eine Gruppe von mehreren hundert Stoffen. PAH entstehen bei allen
unvollständigen Verbrennungen. Ein bekannter Vertreter ist das Benzo(a)pyren /
VDI Berichte 888-a, 1991 /.
Die Größenverteilung der Dieselrußmasse ist aufgrund von Messungen auf Abgas-
prüfständen bekannt (siehe Bild 4.4) und liegt in etwa zwischen 0,01 und 10 µm. In
dieser Größe sind sie in der Lage, bis in tiefste Bereiche der Lunge vorzudringen.
Eine detaillierte Beschreibung des Bildungsmechanismus, der Partikel-
häufigkeitsverteilung und der stofflichen Zusammensetzung von Dieselruß wird im
VDI Bericht 888 aus dem Jahre 1991 von H. Klingenberg gegeben
/ VDI Berichte 888-b, 1991 /.
Die Emission von partikelförmigen Ruß ist auf verschiedene Quellen zurückzuführen.
Abzugrenzen sind hierbei die verkehrlichen Rußemissionen von Emissionen aus pri-
vaten Haushalten und Industriebetrieben (Hausbrand etc.) Bei den verkehrlichen
Rußemissionen werden bisher die dieselmotorisch betriebenen Pkw und Lkw als
Hauptverursacher angesehen. Ruß wird auch im Straßenbau eingesetzt und somit
über den Abrieb der Straßenoberfläche in die Umgebung emittiert / Stechmann
1993 /.
Nachdem der Ruß von seiner Quelle emittiert wird, gelangt er in die Umgebungsluft
und kann von dort unmittelbar über die Atemluft in den Atemtrakt des Menschen
gelangen. Die in der Luft schwebenden Teilchen werden je nach Größe und Ge-
wicht der Partikel sowie Witterungseinflüßen (Regen, Wind etc.), nach einer mehr
oder weniger langen Zeit in Böden oder in Gewässern abgelagert. Von dort aus
können diese über die Nahrungskette (angereichert in Pflanzen, Tieren und Trink-
wasser) vom Menschen aufgenommen werden.
Grundlagen der Partikelmessung
Seite 8
4 Grundlagen der Partikelmessung von Diesel-Kfz
Eine fundierte Grundlage für die folgenden Messungen mit dem TEOM
®
soll in die-
sem Kapitel dargeboten werden. Die Grundlagen orientieren sich an dem Konzept
der Messungen (siehe Kapitel 5) und beschränken sich daher im wesentlichen auf
folgende Themengebiete:
·
Höhe, stoffliche Zusammensetzung und Größenverteilung der Partikelemission
·
europäische Gesetzgebung, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmung der
Partikelemission
·
Meßtechniken zur Bestimmung der dynamischen Partikelemission
·
Einfluß des Katalysators auf die Partikelemission
4.1 Eigenschaften von Partikeln aus Diesel-Kfz
Die derzeitige europäische Gesetzgebung begrenzt die Gesamtmasse der Partikel-
emission von Kraftfahrzeugen mit Dieselmotor. Eine Bewertung der stofflichen Zu-
sammensetzung und der Größenverteilung wird nicht vorgenommen. Derzeit wird
aber zu den beiden letztgenannten Themen eine wissenschaftliche Diskussion ge-
führt / MTZ 1996 / MTZ 1997 /. Daher sollen neben der Höhe der Partikel-emission
diese beiden Aspekte in den folgenden Unterpunkten berücksichtigt werden.
Grundlagen der Partikelmessung
Seite 9
4.1.1 Höhe der Partikelemission
Die Partikelemission des im Rahmen dieser Diplomarbeit genutzten Fahrzeugs mit
modernem, direkt einspritzendem Dieselmotor (Serienfertigung 1999) beträgt im
europäischen Fahrzyklus ca. 0,0350 g/km. Damit liegt sie gemäß Bild 4.1 etwa
30 % unterhalb des ab dem Jahre 2000 geltendem Grenzwert von 0,05 g/km. Im
Vergleich zum Serienstand von 1992 und zu noch älteren Dieselmotoren werden die
in den letzten Jahren erreichten erheblichen Verbesserungen bei der Partikel-
emission erkennbar.
Der indirekt einspritzende Ottomotor mit 3-Wege-Katalysator, der keiner gesetzge-
berischen Begrenzung der Partikelemission unterliegt, emittiert weniger als 1/10 der
Partikelmasse eines heutigen modernen Dieselmotors (Serienfertigung 1999). Die
Partikelemission von direkt einspritzenden Ottomotoren könnte aber wesentlich ü-
ber derjenigen indirekt einspritzender liegen.
Ottomotor idi mit
3-Wege-Katalysator
Grenzwert EURO 4
(ab 2005)
Dieselmotor di
(Serienfertigung 1999)
Grenzwert EURO 3
(ab 2000)
Dieselmotor idi
(Serienfertigung 1992)
alter Dieselmotor
0.0025
0.0250
0.0350
0.0500
0.0700
0.25
0.000
0.100
0.200
0.300
Partikelmassenemission [g/km]
Ottomotor idi mit
3-Wege-Katalysator
Grenzwert EURO 4
(ab 2005)
Dieselmotor di
(Serienfertigung 1999)
Grenzwert EURO 3
(ab 2000)
Dieselmotor idi
(Serienfertigung 1992)
alter Dieselmotor
Bild 4.1 Typische Partikelmassenemission von Kfz im europäischen Fahrzyklus
(Quellen: / MTZ 1992 / Klingenberg 1995 / eigene Messungen /)
Grundlagen der Partikelmessung
Seite 10
4.1.2 Stoffliche Zusammensetzung der Partikel
Die Partikel aus dem Dieselmotor bestehen hauptsächlich aus dem Feststoff Ruß
und daran angelagerten Kohlenwasserstoffen. Gemäß Bild 4.2 liegt der Anteil die-
ser beiden Bestandteile bei ca. 95 % der Partikelmasse. Der im Kraftstoff enthalte-
ne Schwefel wird im Motor oxidiert und bildet mit dem Wasser im Abgas partikel-
förmige Sulfate (hauptsächlich Schwefelsäure). Diese Sulfate tragen ebenso wie
Abrieb aus dem Motor und Öladditive in geringem Umfang zur Partikelmasse bei
/ Klingenberg 1995 / MTZ 1994 /.
elementarer
Kohlenstoff (Ruß)
71%
Sulfat (kondens.
Schwefelsäure)
3%
organische
Komponenten
(angelagert)
24%
sonstige
Bestandteile
(Metalloxide etc.)
2%
Bild 4.2 Typische stoffliche Zusammensetzung der Partikelemission eines Diesel-Kfz
/ Klingenberg 1995 /
Grundlagen der Partikelmessung
Seite 11
Bei der Analyse kann die Partikelmasse in drei Fraktionen unterteilt werden
/ MTZ 1996 /:
·
organisch lösbarer Anteil (SOF = soluble organic fraction); partikelgebundene
Kohlenwasserstoffe, die durch Extraktion aus dem Partikelfilter gelöst werden.
·
Sulfate und Wasser, die durch Ultraschallextraktion gelöst werden und nachfol-
gend weiteren Auswertungsmethoden unterzogen werden.
·
Ruß (elementarer Kohlenstoff) mit geringen Mengen Motorabrieb und Öladditi-
ven, als verbleibender Rest.
Bild 4.3 zeigt Ergebnisse der Forschungsvereinigung Verbrennungs-kraftmaschinen
(FVV), die den Einfluß des Oxidationskatalysators auf die Partikelemission und -
zusammensetzung untersucht hat / MTZ 1996 /. Dabei wurde festgestellt, daß der
Oxidationskatalysator die Partikelemission hauptsächlich durch Verringerung der
angelagerten Bestandteile (SOF) senkt. Die Partikelemission des Fahrzeugs wurde
durch den Katalysator von 0,16 g/km auf 0,12 g/km reduziert, wobei die absolute
Rußmasse nicht beeinflußt wurde.
Bei hohen Abgastemperaturen im Katalysator wird der Kraftstoffschwefel oxidiert
und trägt dann als Sulfat zur Partikelemission bei. Dies kann den mindernden Effekt
der Reduzierung des SOF-Anteils kompensieren. Das dazu notwendige Tempera-
turniveau wird im europäischen Fahrzyklus aber selten erreicht / MTZ 1994 /.
Grundlagen der Partikelmessung
Seite 12
SOF
Ruß
Sulfat und Wasser
Summe
0.071
0.036
0.082
0.082
0.006
0.002
0.160
0.120
0.000
0.040
0.080
0.120
0.160
0.200
Partikelemission [g/km]
SOF
Ruß
Sulfat und Wasser
Summe
Test ohne Kat
Test mit Kat
Bild 4.3 Einfluß des Katalysators auf die Partikelemission und -zusammensetzung im europä-
ischen Fahrzyklus / MTZ 1996 /
4.1.3 Größenverteilung der Partikel
Bild 4.4 zeigt die typische Größenverteilung von Partikeln eines indirekt einspritzen-
den Dieselmotors mit Oxidationskatalysator / Klingenberg 1995 /. Der Mittelwert
des Partikeldurchmessers liegt bei ca. 0,261 µm. Damit können sie bis in die Berei-
che der Lunge vordringen, in denen der Stoffaustausch stattfindet.
Partikel aus Fahrzeugen mit direkt einspritzendem Dieselmotor haben mutmaßlich
aufgrund der hohen Einspritzdrücke (bis zu 2000 bar) noch geringere Durchmesser.
Hierzu finden sich in der Literatur aber widersprüchliche Aussagen / MTZ 1997 /
AMS 1999 /.
Da die gesetzlichen Bestimmungen eine Analyse der Partikelgrößenverteilung nicht
vorschreibt und mit dem TEOM
®
eine solche auch nicht möglich ist, soll auf diese
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1999
- ISBN (eBook)
- 9783832466275
- ISBN (Paperback)
- 9783838666273
- DOI
- 10.3239/9783832466275
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Berlin – Verkehrswesen
- Erscheinungsdatum
- 2003 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- abgasrollenprüfstand abgastest partikelfilter
- Produktsicherheit
- Diplom.de