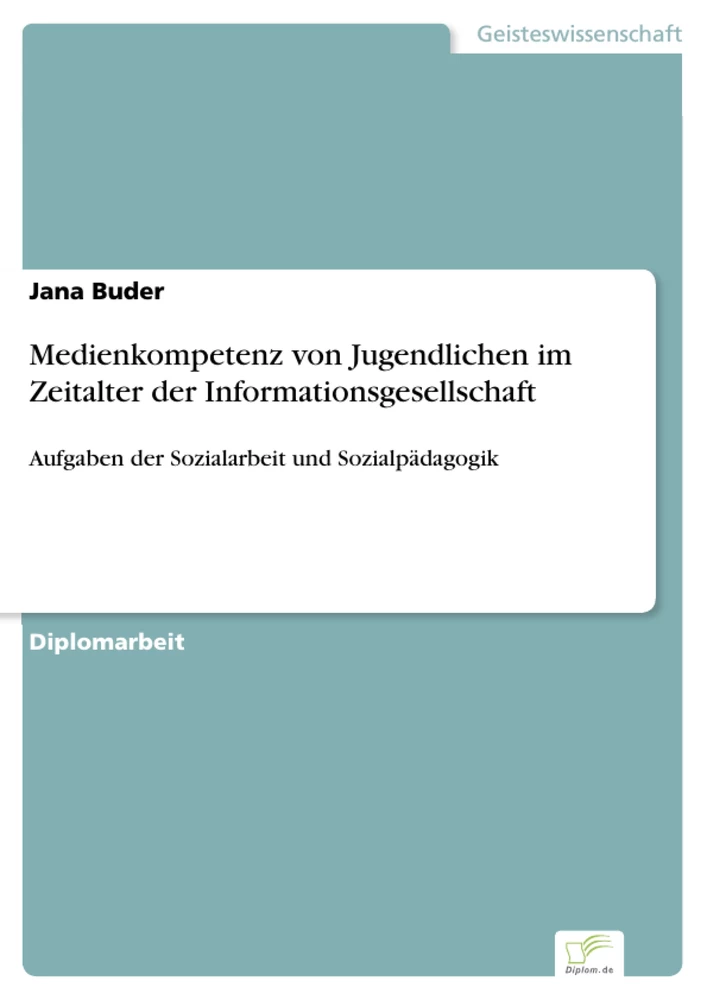Medienkompetenz von Jugendlichen im Zeitalter der Informationsgesellschaft
Aufgaben der Sozialarbeit und Sozialpädagogik
©2002
Diplomarbeit
102 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Diese Diplomarbeit geht vor allem den Fragen nach, welche Fähigkeiten Medienkompetenz ausmachen, welchen Stellenwert diese in der Informationsgesellschaft schon jetzt hat sowie zukünftig haben wird, wie die Vermittlung von Medienkompetenz in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen stattfinden kann und welche Aufgaben die Sozialpädagogik dabei erwartet. Im ersten Teil der Arbeit wird dazu der Begriff der Medienkompetenz wissenschaftlich definiert und die in ihm enthaltenen Dimensionen näher betrachtet. Im zweiten Teil steht die Informationsgesellschaft im Vordergrund. Nach einer kurzen Ursachendefinition und Beschreibung der relevanten Faktoren dieser neuen Gesellschaft widmet sich die Arbeit besonders den entstehenden gesellschaftlichen Veränderungen und Risiken. Das Internet spielt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle, welche im Text speziell beleuchtet wird. Hierzu werden empirische Untersuchungen der letzten Jahre herangezogen. Die Arbeit bezieht sich in großen Teilen vor allem auf das so genannte Medium der Zukunft und zeigt Chancen und Risiken der Internetnutzung für Jugendliche. Im Schwerpunkt der Arbeit wird erläutert, mit welchen Methoden Medienkompetenz im schulischen Unterricht und der sozialpädagogischen Jugendarbeit vermittelt werden kann, welche Ziele dazu aufgestellt werden müssen und welche Probleme die Bildungseinrichtungen damit (noch) haben. Es werden verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten in der pädagogischen Jugendarbeit aufgezeigt und ein Praxisbeispiel angeführt.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung4
2.Medienkompetenz als Ziel medienpädagogischen Handelns7
2.1Die Entwicklung der Medienpädagogik7
2.2Versuch einer Begriffsbestimmung10
2.2.1Der Kompetenzbegriff11
2.2.2Kommunikative Kompetenz in der Medienpädagogik12
2.2.3Medienkompetenz13
2.3Dimensionen von Medienkompetenz14
2.3.1Dimensionen nach Baacke14
2.3.2Dimensionen nach Theunert16
2.3.3Dimensionen nach Schorb17
2.3.4Zusammenfassung18
3.Die Informationsgesellschaft20
3.1Was ist die Informationsgesellschaft?20
3.2Gesellschaftliche Veränderungen24
3.2.1Veränderungen im Bereich Arbeit24
3.2.2Veränderungen im Bereich Bildung27
3.2.3Realisierungsmöglichkeiten30
3.3Risiken der Informationsgesellschaft30
3.3.1Wahrheitsgehalt und Manipulation von Daten31
3.3.2Informationsfülle32
3.3.3Soziale Isolation33
3.3.4Entwicklung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft34
3.4Die Rolle des Internets in der […]
Diese Diplomarbeit geht vor allem den Fragen nach, welche Fähigkeiten Medienkompetenz ausmachen, welchen Stellenwert diese in der Informationsgesellschaft schon jetzt hat sowie zukünftig haben wird, wie die Vermittlung von Medienkompetenz in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen stattfinden kann und welche Aufgaben die Sozialpädagogik dabei erwartet. Im ersten Teil der Arbeit wird dazu der Begriff der Medienkompetenz wissenschaftlich definiert und die in ihm enthaltenen Dimensionen näher betrachtet. Im zweiten Teil steht die Informationsgesellschaft im Vordergrund. Nach einer kurzen Ursachendefinition und Beschreibung der relevanten Faktoren dieser neuen Gesellschaft widmet sich die Arbeit besonders den entstehenden gesellschaftlichen Veränderungen und Risiken. Das Internet spielt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle, welche im Text speziell beleuchtet wird. Hierzu werden empirische Untersuchungen der letzten Jahre herangezogen. Die Arbeit bezieht sich in großen Teilen vor allem auf das so genannte Medium der Zukunft und zeigt Chancen und Risiken der Internetnutzung für Jugendliche. Im Schwerpunkt der Arbeit wird erläutert, mit welchen Methoden Medienkompetenz im schulischen Unterricht und der sozialpädagogischen Jugendarbeit vermittelt werden kann, welche Ziele dazu aufgestellt werden müssen und welche Probleme die Bildungseinrichtungen damit (noch) haben. Es werden verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten in der pädagogischen Jugendarbeit aufgezeigt und ein Praxisbeispiel angeführt.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung4
2.Medienkompetenz als Ziel medienpädagogischen Handelns7
2.1Die Entwicklung der Medienpädagogik7
2.2Versuch einer Begriffsbestimmung10
2.2.1Der Kompetenzbegriff11
2.2.2Kommunikative Kompetenz in der Medienpädagogik12
2.2.3Medienkompetenz13
2.3Dimensionen von Medienkompetenz14
2.3.1Dimensionen nach Baacke14
2.3.2Dimensionen nach Theunert16
2.3.3Dimensionen nach Schorb17
2.3.4Zusammenfassung18
3.Die Informationsgesellschaft20
3.1Was ist die Informationsgesellschaft?20
3.2Gesellschaftliche Veränderungen24
3.2.1Veränderungen im Bereich Arbeit24
3.2.2Veränderungen im Bereich Bildung27
3.2.3Realisierungsmöglichkeiten30
3.3Risiken der Informationsgesellschaft30
3.3.1Wahrheitsgehalt und Manipulation von Daten31
3.3.2Informationsfülle32
3.3.3Soziale Isolation33
3.3.4Entwicklung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft34
3.4Die Rolle des Internets in der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6624
Buder, Jana: Medienkompetenz von Jugendlichen im Zeitalter der
Informationsgesellschaft - Aufgaben der Sozialarbeit und Sozialpädagogik
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Berlin, Fachhochschule, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
- 1 -
Vorwort
In dieser Arbeit wird darauf verzichtet, die Geschichte und Funktionsweise des
Internet aus technischer Sicht zu beschreiben, da dies thematisch wenig relevant
ist. Ich bin davon ausgegangen, dass Grundlagenwissen heute allgemein
vorhanden und die geläufigsten Begriffe ausreichend bekannt sind. Weniger
gebräuchliche Begriffe sind im Fußnotenteil erläutert.
Da die Entwicklung zur Informationsgesellschaft eine internationale ist und die
neuen Medien ebenso international genutzt werden können, möchte ich
hervorheben, dass sich die vorliegende Arbeit lediglich auf die pädagogische
Situation in Deutschland bezieht. Auf einen Blick in andere Länder wurde
verzichtet, obwohl dies sicher spannend gewesen wäre, da gerade in den USA
die Anerkennung und Nutzung der neuen Medien sehr viel weiter entwickelt ist.
Es ist wünschenswert, dass zukünftige Arbeiten sich mit diesem Thema
auseinandersetzen.
Aufgrund meiner thematischen Eingrenzung und aus Fragen der Aktualität ergab
es sich, dass ich viel im Internet recherchiert habe. Da Veröffentlichungen im
Internet laufend verändert werden, kann ich jedoch keine Garantie dafür
übernehmen, dass die zitierten Quellen weiterhin unverändert existieren und
unter den angegebenen Links zu erreichen sind. Aus diesem Grund enthalten
Internetquellen in meinem Literaturverzeichnis eine genaue Angabe, wann sie
heruntergeladen wurden.
In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit durchgängig die
männliche Geschlechtsform angewendet. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass
diese Form als geschlechtsneutral angesehen wird. Ist ein bestimmtes
Geschlecht für den Text von Bedeutung, wird dies entsprechend hervorgehoben.
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass sämtliche Zitate nach den
Regeln der neuen Rechtschreibung wiedergegeben wurden, soweit dies nicht
sinnverändernd war.
- 2 -
Inhaltsverzeichnis
Seite
1.
Einleitung
4
2.
Medienkompetenz als Ziel medienpädagogischen Handelns 7
2.1
Die Entwicklung der Medienpädagogik
7
2.2
Versuch
einer
Begriffsbestimmung
10
2.2.1
Der
Kompetenzbegriff 11
2.2.2 Kommunikative Kompetenz in der Medienpädagogik
12
2.2.3
Medienkompetenz
13
2.3
Dimensionen
von
Medienkompetenz 14
2.3.1
Dimensionen
nach
Baacke
14
2.3.2
Dimensionen
nach
Theunert
16
2.3.3
Dimensionen
nach
Schorb
17
2.3.4
Zusammenfassung
18
3. Die
Informationsgesellschaft
20
3.1
Was ist die Informationsgesellschaft?
20
3.2
Gesellschaftliche
Veränderungen
24
3.2.1
Veränderungen
im
Bereich
Arbeit
24
3.2.2
Veränderungen
im
Bereich
Bildung
27
3.2.3
Realisierungsmöglichkeiten
30
3.3
Risiken der Informationsgesellschaft
30
3.3.1 Wahrheitsgehalt und Manipulation von Daten
31
3.3.2
Informationsfülle
32
3.3.3
Soziale
Isolation
33
3.3.4 Entwicklung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft
34
3.4
Die Rolle des Internets in der Informationsgesellschaft
37
4.
Chancen und Risiken der Internetnutzung für Jugendliche 41
4.1
Bildungswert
des
Internet
41
4.1.1
Informationsrecherche 42
4.1.2
Präsentationsmöglichkeiten
43
4.1.3
Kommunikation 44
4.1.4
Selbstgesteuertes
Lernen
45
- 3 -
4.1.5
Auswertung
der
Chancen
46
4.2
Problematische
Inhalte
im
Internet
48
4.2.1
Pornografie
48
4.2.2
Politischer
Extremismus
50
4.2.3
Weitere
problematische
Inhalte
51
4.2.4
Bewertung
der
Gefahr 51
4.3
Maßnahmen gegen problematische Inhalte
52
4.3.1
Juristische
Maßnahmen
53
4.3.2
Technische
Maßnahmen
55
4.3.3 Erziehung und Bildung des Nutzers
58
5.
Die Vermittlung von Medienkompetenz
59
5.1
Wichtigkeit
von
Medienkompetenz
59
5.2
Voraussetzungen
für
die
Vermittlung 61
5.2.1
Technische
Voraussetzungen 61
5.2.2
Pädagogische
Voraussetzungen
63
5.2.3
Methodische
Voraussetzungen
66
5.3
Vermittlung von Medienkompetenz in Schule und Unterricht
67
5.3.1
Probleme
67
5.3.2
Methoden
und
Ziele
69
5.3.3
Praktische
Umsetzung 70
5.4
Vermittlung von Medienkompetenz in der Jugendarbeit
72
5.4.1
Probleme
74
5.4.2
Methoden
und
Ziele
75
5.4.3
Praktische
Umsetzung 78
6.
Beispiel aus der sozialpädagogischen Praxis
83
6.1
Das
Projekt
,,Cyberland"
83
6.2
Auswertung
des
Praxisbeispiels
86
7. Schlusswort
88
Anhang
I. Literaturverzeichnis
- 4 -
1. Einleitung
Die Lebenswelten der Menschen unserer Gesellschaft sind heute untrennbar mit
Medien verbunden. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass wir eine Zeitung oder
Bücher, das Fernsehen oder das Radio genutzt haben. Kinder und Jugendliche
wachsen in dieser Medienwelt auf und müssen bereits in jungem Alter lernen,
sich darin zurechtzufinden. Im Unterschied zur Vergangenheit wird unsere
heutige Medienlandschaft immer vielfältiger, aber auch unübersichtlicher. Die
technische Entwicklung verläuft immer rasanter und aktuelle Trends wechseln
immer schneller ab. Der kritische Umgang mit Medien, ihre aktive Nutzung und
Kenntnisse der Medienwirkung werden daher immer wichtiger. Für die Förderung
dieser Fähigkeiten ist die Medienpädagogik zuständig, in welcher die Vermittlung
von Medienkompetenz eine entscheidende Zielposition einnimmt.
Gleichzeitig befinden wir uns heute auf dem Weg in die Informationsgesellschaft,
welche große Veränderungen in allen Lebensbereichen mit sich bringen wird.
Besonders die so genannten ,,neuen Medien" (zu ihnen gehören vor allem
Multimedia-Computer und das Internet) spielen in diesem Zusammenhang eine
große Rolle. Es herrscht die Erwartung, dass das Internet aufgrund seiner
dezentralen Struktur, seines nichtlinearen Aufbaus, der in der Kommunikation
herrschenden Internationalität, den Möglichkeiten des flexiblen
Informationszugriffs und seiner unendlichen Vielfalt zum wichtigsten
Informations- und Kommunikationsmedium unserer Zeit wird. Schon heute hat es
Einzug in Bereiche der Arbeit, der Bildung, der Freizeit, der Kommunikation und
des Konsums gehalten. Viele Dinge, wie das Schreiben von E-Mails und die
Informationsrecherche im Internet wirken mittlerweile selbstverständlich. Hält
diese Entwicklung an, wird ein Leben ohne das Internet bald nicht mehr
vorstellbar sein. Aus diesen Gründen ist es eine wichtige Aufgabe der Pädagogik,
die heutige und folgende Jugendgenerationen auf die Informationsgesellschaft
vorzubereiten und sie in der damit verbundenen Nutzung der neuen Medien
(insbesondere des Internets) zu unterrichten. In der oben skizzierten Gesellschaft
werden der kritische Umgang, das Wissen über Ziele und Wirkungsweisen der
Medien und vor allem die aktive und kreative Gestaltung von Medien noch
wichtiger sein, als sie es heute bereits ist.
- 5 -
Die Entscheidung für mein Thema fällte ich aus den oben genannten
Überlegungen heraus. Da ich das Internet für mein Studium sowie privat schon
seit einigen Jahren intensiv nutze und die in der Gesellschaft und besonders
unter Pädagogen herrschenden Vorbehalte dazu kennen lernte, stellte ich mir die
Frage, welche Auswirkungen die zunehmende Verbreitung und Nutzung des
Internet auf Jugendliche hat und ob es nicht auch in der sozialen Arbeit mit
Jugendlichen genutzt werden könnte. Bei meinen ersten Recherchen stieß ich
schnell auf das Konzept der Medienkompetenz und ihre Bedeutung in der
zukünftigen Informationsgesellschaft und beschloss, dieses Thema zu vertiefen.
Ich gehe in dieser Arbeit daher vor allem den Fragen nach, welche Fähigkeiten
Jugendliche für ein Leben in der zukünftigen Gesellschaft benötigen, wie die
angestrebte Vermittlung von Medienkompetenz stattfinden kann und welche
Aufgabe die Sozialpädagogik in diesem Zusammenhang erfüllen muss. Ziel der
Arbeit kann es nicht sein, eine allgemein gültige, verbindliche Methodik zu
entwerfen oder eine Lösung zu allen Problemen anzubieten. Sie wird jedoch
einen Rahmen ziehen, in welchem die Voraussetzungen, Ziele, Methoden und
heutigen Missstände der Thematik aufgezeigt und Vorschläge für die zukünftige
Entwicklung skizziert werden.
Dazu wird im ersten Teil der Arbeit versucht, zu bestimmen, was
,,Medienkompetenz" bedeutet und welche Dimensionen sie enthält. Einleitend
wird die historische Entwicklung der Medienpädagogik als wissenschaftlicher
Disziplin kurz dargestellt und ihre Aufgaben und Ziele erläutert. Anschließend soll
der Begriff der Medienkompetenz definiert und die in ihm enthaltenen
Dimensionen näher betrachtet werden. Mein Interesse gilt in diesem
Zusammenhang vor allem der Frage, welche Fähigkeiten Medienkompetenz
ausmachen. Diese Ausführungen zur Medienkompetenz sollen die Grundlage
zum Verständnis des Begriffs bilden und genau eingrenzen, wie
Medienkompetenz wissenschaftlich definiert wird. Im folgenden Teil steht im
Vordergrund, was die Informationsgesellschaft ist und welche Veränderungen sie
mit sich bringen wird. Nach einer kurzen Ursachendefinition und Beschreibung
der relevanten Faktoren widme ich meine Aufmerksamkeit besonders den
gesellschaftlichen Veränderungen und Risiken, welche die momentane
Diskussion beherrschen. Hierzu wird ausführlich über mögliche Veränderungen
im Arbeits- und Bildungsbereich berichtet und auf ihre Realisierung eingegangen.
- 6 -
Anschließend werden mögliche Risiken aufgezählt und näher erläutert.
Besonders wichtig erscheint hier, wie die aufgeführten Veränderungen umgesetzt
und die drohenden Risiken mit pädagogischen Mitteln verhindert werden können.
Um zum folgenden Kapitel hinzuführen, wird abschließend aufgezeigt, welche
wichtige Rolle das Internet in der Informationsgesellschaft spielt und wie es
bereits heute genutzt wird. Hierzu werden empirische Untersuchungen der
letzten Jahre herangezogen. Im dritten Teil der Arbeit werden Chancen und
Gefahren der Internetnutzung herausgearbeitet, um zu verdeutlichen, wie
Jugendliche das neue Medium sinnvoll nutzen können und welche Risiken dabei
bestehen. Es soll deutlich gemacht werden, dass das Internet ein wichtiges
Medium für Jugendliche ist und reichhaltige Chancen für Bildung und Lernen
bietet. Da der Umgang mit dem Internet für Jugendliche aber auch Gefahren
bereithält, wird diskutiert, welchen Einfluss diese Gefahren auf Jugendliche
haben können und wie sie sich darstellen. Im Anschluss daran werden
verschiedene Möglichkeiten geschildert, Risiken der Internetnutzung zu
unterbinden bzw. mit ihnen umzugehen und das Fazit gezogen, dass vor allem
ein kompetenter Umgang mit dem Medium und das Bewusstsein und Kenntnisse
über die vorhandenen Risiken dazu beitragen können, Jugendliche vor ihnen zu
schützen.
Der letzte Teil bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit, hier wird am Beispiel des
Internets geschildert, wie Medienkompetenz vermittelt werden kann. Dazu
werden eingehend nochmals Argumente für die Wichtigkeit von
Medienkompetenz zusammengefasst und Voraussetzungen für die Praxisarbeit
aufgestellt. Anschließend wird erläutert, mit welchen Methoden
Medienkompetenz im schulischen Unterricht und der sozialpädagogischen
Jugendarbeit vermittelt werden kann, welche Ziele dazu aufgestellt werden
müssen und welche Probleme die Bildungseinrichtungen damit (noch) haben.
Besonderer Wert wird hier auf die außerschulische Jugendarbeit gelegt und
entsprechende Projektideen unter den Aspekten der Qualifikation, Sozialisation
und Individuation Jugendlicher entworfen. Abschließend wird ein Beispiel aus der
sozialpädagogischen Praxis vorgestellt und anhand dessen detailliert
ausgewertet, inwiefern sich die theoretisch erarbeiteten Dimensionen von
Medienkompetenz praktisch umsetzen lassen, welcher Handlungsspielraum für
die Sozialpädagogik besteht und wie ähnliche Projekte einen Beitrag zur
Entwicklungsförderung von Jugendlichen leisten können.
- 7 -
2. Medienkompetenz als Ziel medienpädagogischen Handelns
,,Medienkompetenz" ist in den letzten Jahren zu einem bekannten,
pädagogischen Stichwort geworden.
Politiker wie Wissenschaftler, Pädagogen
und Medienexperten fühlen sich berufen, zu diskutieren und zu definieren und
dabei wird recht unterschiedliches laut. Je nach Interesse und Zweck wird unter
Medienkompetenz etwas anderes verstanden. So bleibt häufig unklar, welche
Dimensionen der Begriff umfasst und was wirklich damit gemeint ist. Einig ist sich
die Fachliteratur, dass Medienkompetenz eine Grundfähigkeit für das Leben in
der zukünftigen Informationsgesellschaft darstellen wird und daher dringend einer
einheitlichen Definition bedarf. Wie Medienkompetenz sich vermitteln lassen wird
und welche Voraussetzungen technischer wie pädagogischer Art dafür
notwendig sind, beherrscht die aktuelle Diskussion.
In den folgenden Kapiteln soll der Versuch einer Begriffsbestimmung
unternommen und Dimensionen von Medienkompetenz herausgearbeitet
werden. Dafür wird als Grundlage die Entwicklung der Medienpädagogik, wie wir
sie heute kennen, kurz nachgezeichnet. Darauf aufbauend wird versucht, den
Begriff ,,Medienkompetenz" zu erläutern. Mit der Vorstellung unterschiedlicher
Konzepte namhafter Experten wird das Kapitel abschließen.
2.1 Die Entwicklung der Medienpädagogik
Die Medienpädagogik als eigenständige wissenschaftliche Disziplin hat man erst
in den letzten 40 Jahren kennen gelernt. Seitdem ist ihr Ziel hauptsächlich die
Erziehung zum reflexiven Umgang mit Medien und ihrer kritischen Nutzung.
Aufgrund der Komplexität medialer Kommunikation ist die Medienpädagogik
interdisziplinär angelegt und lässt sich damit nicht nur in den Erziehungs- und
Sozialwissenschaften sondern vielfach auch in Publikations- und
Kommunikationswissenschaften, sowie der Soziologie, Psychologie und
Kulturwissenschaft wieder finden.
- 8 -
Medienpädagogische Debatten spielen trotz des jungen Alters der
Medienpädagogik als Wissenschaft schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine
große Rolle. Zwei wesentliche Grundtendenzen sind seitdem zu unterscheiden.
1
Auf der einen Seite steht eine Medien ablehnende Seite, die Kinder und
Jugendliche vor schädlichen Einflüssen der Medien bewahren will. Sie wird daher
Bewahrpädagogik genannt und verstärkte besonders im ersten Drittel des 20.
Jahrhunderts Tendenzen, die bereits im 18. und 19. Jahrhundert
Präventivmaßnahmen zum ,,Schutz" des Bürgers vor den Medien forderten.
2
Besonders die um die Wende zum 20. Jahrhundert aufkommende
Massenliteratur und die Entwicklung des Kinos wurden von der
Bewahrpädagogik scharf kritisiert. Schon früh kristallisierte sich ein auf der
anderen Seite stehender, Medien akzeptierender Ansatz heraus, der die
positiven Aspekte von Medien bildungspolitisch nutzbar machen wollte. Hierzu ist
besonders die Schulfilmbewegung der 20er Jahre zu erwähnen, welche erste
Konzepte einer Unterrichtsfilmdidaktik entwickelte und als Vorläufer des heutigen
Bildstellenwesens gilt.
3
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurde das gesamte
Medienwesen propagandistischen Zielen unterworfen. ,,Von einer
Medienpädagogik aus erziehungswissenschaftlicher Sicht kann während des
Nationalsozialismus nicht die Rede sein, [...]"
4
Eine Debatte über
medienpädagogische Aspekte fand nicht statt, Medien wurden staatlich
kontrolliert und zensiert.
Erst in der Nachkriegszeit wurden medienpädagogische Debatten wieder
aufgegriffen.
5
Aus Angst vor der möglichen Wiederholung eines medienbewirkten
Massenwahns, wie ihn die Nationalsozialisten schufen, knüpften viele Ansätze an
die bewahrpädagogischen Traditionen der 20er und 30er Jahre an. So galt
weithin die Annahme, Kinder und Jugendliche seien den Einflüssen bewegter
Bilder in Film und im gerade aufkommenden Fernsehen hilflos ausgeliefert. Die
Folge war die Entstehung eines weitreichenden Jugendschutzes, der bis heute
seine Bedeutung nicht verloren hat. Unter anderem entstanden in dieser Zeit die
1
vergl. Vollbrecht, 2001, S. 25
2
vergl. Hüther & Podehl, 1997, S. 118
3
vergl. Hüther & Podehl, 1997, S. 119
4
Hüther & Podehl, 1997, S. 120
5
Die im Folgenden geschilderte Entwicklung kann lediglich auf Westdeutschland bezogen
werden. Die Entwicklung in der DDR wird außen vor gelassen.
- 9 -
,,Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft" FSK (1949), das ,,Gesetz über
Verbreitung jugendgefährdender Schriften" GjS (1953) und die ,,Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Schriften" BPjS (1954).
Die zunehmende Verbreitung des Fernsehens und die trotz aller bewahrenden
Tendenzen wachsende Beliebtheit des Kinos, sowie populären Zeitungen und
Zeitschriften forderte bald eine neue Auseinandersetzung mit
medienpädagogischen Ansichten, die nicht länger alleine auf Abwehr eingestellt
sein konnten.
6
Besonders in den 60er und 70er Jahren wurden daraufhin
medienakzeptierende Ansätze entworfen. ,,Mit der Zielkategorie der ,kritischen
Rezeption' etabliert sich etwa ab Mitte der 60er Jahre eine Medienpädagogik, die
Erziehung zum aufgeklärten Rezipienten und die Anleitung zum ,sinnvollen'
Gebrauch der Medien anstrebt."
7
Innerhalb dieser Ansätze können heute eine funktionale und eine kritisch-
reflexive Medienpädagogik unterschieden werden. Die lange vorherrschende und
seit den 90er Jahren aufgrund der Verbreitung der ,,neuen Medien" einen
Aufschwung erfahrende, funktionale Medienpädagogik befasst sich mit dem
Einsatz von Medien zu Lehr- und Lernzwecken. Heute wird für diesen Ansatz
meist der Begriff ,,Mediendidaktik" verwendet.
Dem gegenüber thematisiert die kritisch-reflexive Medienpädagogik die sozialen,
kulturellen und sozialisatorischen Effekte der Medien.
8
Sie zielt darauf ab, die
Individuen einer mediendominierten Gesellschaft, wie der heutigen, zu
befähigen, ,,über bloßen Medienkonsum hinaus die Medien auch aktiv für ihre
individuellen und kollektiven Ziele nutzen sowie Medieneffekte reflektieren zu
können."
9
Dieses Verständnis von Medienpädagogik hat sich heute in
Fachkreisen weitgehend durchgesetzt.
Dabei werden vier Zielkategorien der Medienpädagogik unterschieden:
10
6
vergl. Hüther & Podehl, 1997, S. 122
7
ebenda
8
vergl. Vollbrecht, 2001, S. 25
9
ebenda
10
vergl. im Folgenden Hüther & Schorb, 1997, S. 246 ff.
- 10 -
· Bewahren In medienpädagogischen Debatten wird auch heute noch viel
Wert auf den Jugendschutz gelegt. Eine alleinige Konzentration auf
Medienprävention und -abwehr hat sich allerdings längst als
problematisch erwiesen.
· Informieren Durch Information im Rahmen von Medienkunde und
Medienerziehung soll Wissen über Organisation, Struktur, Bedeutung,
Arbeits- und Wirkungsweise von Medien vermittelt werden
· Sensibilisieren Die Wahrnehmungsfähigkeit der Rezipienten muss
verbessert werden, um diese gegen Gefahren immun zu machen
· Aktivieren Um die Partizipation der Mediennutzer zu ermöglichen
müssen handlungsorientierte Ansätze umgesetzt werden. Nicht mehr
allein Medienkonsum ist Thema der Medienpädagogik, sondern auch der
Einfluss der Nutzer, den sie auf die Medien nehmen können und sollen.
Bei einer Zielfindung der Medienpädagogik wird in der Fachliteratur immer wieder
der Begriff der Medienkompetenz bemüht. Medienkompetente Nutzer sollen fähig
sein, zu problematischen Medieninhalten kritische Distanz zu wahren und mit
Medien eigenverantwortlich umzugehen. Die Vermittlung und Förderung von
Medienkompetenz gilt als oberstes Ziel medienpädagogischen Handelns.
2.2 Versuch einer Begriffsbestimmung
Den Begriff der Medienkompetenz zu bestimmen scheint sehr schwer. Ein Blick
in die Fachliteratur lässt schnell erkennen, dass sich, wie einleitend erwähnt, die
Experten über eine endgültige Definition von Medienkompetenz nicht einig sind.
Eine Vielzahl verschiedener Begriffsverständnisse erschwert die Diskussion und
macht den Begriff Medienkompetenz nicht greifbar.
Legt man der Begriffsbestimmung die im Alltag gebräuchliche Bedeutung von
,,Kompetenz" zugrunde, müsste man unter Medienkompetenz die Fähigkeit von
Menschen verstehen, Medien kompetent, das heißt sachkundig und urteilsfähig
zu nutzen. Oberflächlich betrachtet könnte dies auch als hinreichend gültige
Bedeutung von Medienkompetenz stehen bleiben. Als wissenschaftliche
Definition reicht diese Erläuterung allerdings bei weitem nicht aus. Um die
pädagogischen und soziologischen Dimensionen des Begriffes zu klären, ist eine
- 11 -
tiefer gehende Betrachtung unumgänglich. Zur begrifflichen Eingrenzung von
Medienkompetenz soll als erstes auf die Bedeutung von ,,Kompetenz" in der
sozialwissenschaftlichen Diskussion und anschließend auf die Begriffe
,,kommunikative Kompetenz" und ,,Medienkompetenz" eingegangen werden.
2.2.1 Der Kompetenzbegriff
,,Im anthropologischen Sinn wird unter Kompetenz die Fähigkeit zur Befriedigung
von Bedürfnissen und die diesem Zweck dienlichen Fertigkeiten verstanden. Für
verschiedene Wirklichkeitsbereiche werden unterschiedliche Kompetenzen
entwickelt."
11
Demnach kann ein Mensch soziale, sexuelle, ökonomische,
sprachliche und andere Kompetenzen entwickeln. Dieser Kompetenzbegriff
wurde von dem Linguisten Chomsky weiterentwickelt. ,,... [Er] sieht eine
wesentliche Eigenschaft der Sprache darin, dass sie die Mittel bereithält, beliebig
viele Gedanken auszudrücken und ermöglicht, entsprechend den beliebig vielen
neuen Situationen adäquat zu reagieren."
12
Daraus folgernd versteht Chomsky
Kompetenz auf Sprache und Sprecher angewendet als ,,die Fähigkeit des
Sprechers, eine potentiell unbegrenzte Anzahl von Sätzen und Aussagen
hervorbringen und über die Sprechrichtigkeit von Sätzen entscheiden zu
können."
13
Nach Chomskys Theorie gilt Kompetenz als analytische Kategorie und
ist kein Erziehungsziel. Auf dieses Konzept aufbauend entwickelte Habermas
1971 den Begriff der ,,kommunikativen Kompetenz" und definiert diesen als ein
zentrales Sozialisationsziel.
14
Kommunikative Kompetenz gilt als angeborene
Fähigkeit, da Menschen von Geburt an kommunikative Lebewesen sind. Durch
Habermas wird der Kompetenz-Begriff ,,zu einer gesellschaftskritischen Kategorie
gleichermaßen Voraussetzung und Ziel des idealen Diskurses, in dem
prinzipiell jeder den Sinn aller vorgetragenen Argumente adäquat verstehen und
ihre Wahrheit definitiv beurteilen könnte."
15
Erst die Ausbildung von
kommunikativer Kompetenz ,,eröffnet die Möglichkeit der Teilnahme am
gesellschaftlichen Kommunikationsprozess."
16
Die Zieldimension von
kommunikativer Kompetenz in Habermas Sinne konzentriert sich somit auf die
gesellschaftliche Emanzipation und Partizipation aller Rezipienten.
11
Mikos, 1999, S. 57
12
Baacke, 1996a, S. 116
13
vergl. Vollbrecht, 2001, S. 54
14
vergl. Vollbrecht, 2001, S. 55
15
Vollbrecht, 2001, S. 55 f.
16
vergl. Baacke, 1973, zit. nach Mikos, 1996, S. 72
- 12 -
2.2.2 Kommunikative Kompetenz in der Medienpädagogik
1973 bringt Baacke den Begriff der ,,kommunikativen Kompetenz" erstmals in die
medienpädagogische Diskussion ein. Er erweitert ihn von einem auf Sprache
fixierten Standpunkt auf ,,andere mögliche Arten des Verhaltens (z.B. Gesten,
Expressionen durch leibgebundene Gebärden, auch Handeln)"
17
und auf die
massenmediale Kommunikation, welche seiner Meinung nach mit der personalen
Kommunikation eng verbunden ist und entsprechend auf individuelle und
gesellschaftliche Sozialisationsprozesse einwirkt.
18
Gleichzeitig stellt Baacke
kommunikative Kompetenz im Gegensatz zu Habermas' gesellschaftskritischem
Ansatz als pädagogische Ziel- und Handlungsdimension dar. Aus seiner Sicht
geht die Arbeitshypothese einer kommunikativen Kompetenz von der
Erziehbarkeit des Menschen aus. Weiter führt er aus: ,,... [Diese] begründet sich
in seiner Kompetenz zu sprachlichem Handeln und damit zur Fähigkeit, aktiv an
der Weltkonstruktion teilzunehmen. Verbunden mit der Erziehbarkeit und
Bildbarkeit des Individuums ist die Verpflichtung, dies auch zu ermöglichen. Es
steckt also von Anfang an ein Zielwert in dem Konzept und damit wechselt es
aus der analytischen Dimension in die pädagogische über."
19
Auch Schell stellt
fest: ,,Die grundlegende Fähigkeit, kommunikative Kompetenz zu erwerben und
zu entfalten, ist dem Menschen eigen, diese Fähigkeit zu entwickeln und zu
fördern, ist Aufgabe von Bildung."
20
Unter kommunikativer Kompetenz kann als medienpädagogischem Begriff heute
folgendes verstanden werden: ,,Da Aneignung von und kompetentes Handeln in
der Realität an Kommunikation als der elementaren Interaktionsebene gebunden
sind, bezeichnet kommunikative Kompetenz die Fähigkeit zu selbst bestimmter,
reflexiv orientierter Kommunikation, die Aneignungsfähigkeit und
Handlungskompetenz in sich einschließt und bildet somit die Grundlage, auf der
Aneignung von, aktives Einwirken auf und Veränderung von Realität gründet.
(Massen) Medien und mediale Kommunikation als Bestandteile von individueller
wie gesellschaftlicher Realität sind in diese Perspektive eingeschlossen [...]."
21
17
Baacke, 1973, zit. nach Theunert, 1999, S. 51
18
vergl. Theunert, 1999, S. 51
19
Baacke, 1997, S. 51
20
Schell, 1999, S. 277
21
Theunert, 1999, S. 51
- 13 -
2.2.3 Medienkompetenz
Da die mediale Kommunikation in unserer Gesellschaft große Bedeutung für das
Leben des Individuums hat, spielt dieser Aspekt der kommunikativen Kompetenz
eine besondere Rolle. In der medienpädagogischen Debatte wurde dafür der
Begriff der Medienkompetenz geprägt. Baacke bestimmt Medienkompetenz
grundsätzlich als ,,die Fähigkeit, in die Welt aktiv aneignender Weise auch alle
Arten von Medien für das Kommunikations- und Handlungsrepertoire von
Menschen einzusetzen."
22
Medienkompetenz kann daher als Bestandteil und
medienpädagogischer Zielaspekt der kommunikativen Kompetenz gesehen
werden. ,,Kommunikative Kompetenz als Fähigkeit, an gesellschaftlicher
Kommunikation zu partizipieren, repräsentiert das übergreifende Ziel, dem in
allen pädagogischen, also auch in medienpädagogischen Handlungskontexten
Geltung zu verschaffen ist. Medienkompetenz steht für das spezifisch
medienpädagogische Ziel und umreißt die Fähigkeit, Medien und medial basierte
Kommunikation zu begreifen und ebenso selbst bestimmt wie verantwortlich zu
nutzen und sich dienstbar zu machen."
23
Um dieses Ziel zu erreichen, kann unter Medienkompetenz nicht alleine das
Erlernen kognitiver Strukturen, wie zum Beispiel das Umgehen mit Medien, das
Wissen über Medien etc. verstanden werden. Diese Bereiche gehören nach
Meinung der Fachliteratur durchaus dazu, Medienkompetenz muss dem
entgegengesetzt aber auch Handlungskompetenz und gesellschaftliche
Orientierung sein. Baacke führt dazu aus: ,,Medienkompetenz ist eine
Besonderung von ,kommunikativer Kompetenz' (hier sind alle Sinnesakte der
Wahrnehmung gemeint) sowie von ,Handlungskompetenz' (hier sind alle Formen
der Weltbemächtigung und Weltveränderung gemeint, die zwar durch
kommunikative Akte begleitet werden, aber über diese insofern hinausgehen,
weil hier Objekte, Gegenstände und Sachverhalte ,verrückt' werden).
,Medienkompetenz', ,kommunikative Kompetenz' und ,Handlungskompetenz' sind
die Bausteine, die [durch die Pädagogik] zusammenzufügen und zu verfugen
sind."
24
Zu Medienkompetenz gehört danach auch die Fähigkeit, Chancen und
Gefahren medialer Kommunikation einschätzen und sie für eigene Interessen
22
Baacke, 1996b, S. 4
23
Theunert, 1999, S.53
24
Baacke, 1999a, S.8
- 14 -
und Bedürfnisse adäquat einsetzen zu können. Theunert führt dementsprechend
aus: ,,Medienkompetenz meint [...] die Fähigkeit, die Medien und Techniken, die
gesellschaftliche Kommunikation unterstützen, steuern und tragen, erstens zu
begreifen, zweitens sinnvoll damit umzugehen und drittens sie selbst bestimmt zu
nutzen."
25
Damit wird Medienkompetenz zur wichtigsten Fähigkeit, um sich in der
medial geprägten Welt von heute zurechtzufinden. Nicht vergessen werden darf
an dieser Stelle, ,,dass kommunikative Akte auch in Face-to-face-Situationen, live
und in direkter Begegnung, über Sprache und Sprechen, Sich-Anschauen, Sich-
Berühren etc. stattfinden, [...]".
26
Die Förderung von kommunikativer Kompetenz
und Medienkompetenz muss dementsprechend immer miteinander verknüpft
bleiben.
2.3 Dimensionen von Medienkompetenz
Im Folgenden sollen die verschiedenen Dimensionen von Medienkompetenz
herausgearbeitet werden. Eine einheitliche Bestimmung kann nicht stattfinden,
da die Dimensionierung und die Auffächerung der unterschiedlichen Fähigkeiten,
welche Medienkompetenz ausmachen bei den relevanten Autoren nach
unterschiedlichen Gesichtspunkten differenziert werden. Daher werden die
Konzepte von Baacke, Theunert und Schorb unabhängig voneinander vorgestellt
und im Anschluss kurz verglichen.
2.3.1 Dimensionen nach Baacke
Baacke unterscheidet vier Dimensionen von Medienkompetenz mit den
entsprechenden Unterdimensionen Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung
und Mediengestaltung.
27
· Die Fähigkeit zur Medienkritik teilt Baacke in eine analytische Dimension
(welche das Ziel hat, problematische gesellschaftliche Prozesse (z.B.
Konzentrationsbewegungen) angemessen zu erfassen), eine reflexive
Dimension (welche das Ziel hat, den Menschen zu befähigen,
25
Theunert, 1999, S. 53
26
Baacke, 1999b, S.32
27
vergl. im Folgenden Baacke, 1999b, S. 34 sowie Vollbrecht, 2001, S. 61
- 15 -
analytisches Wissen auf sich selbst und sein Handeln anzuwenden) und
eine ethische Dimension (welche das Ziel hat, analytisches Denken und
reflexiven Rückbezug als sozial verantwortet abzustimmen und zu
definieren).
· Die Medienkunde, welche Wissen über Medien und Mediensysteme
bedeutet, beinhaltet eine informative Dimension (welche klassische
Wissensbestände zum Thema umfasst) und eine instrumentell-
qualifikatorische Dimension (welche die Fähigkeit meint, Mediengeräte
bedienen zu können).
Sowohl Medienkritik als auch Medienkunde umfassen die Dimension der
Vermittlung, also didaktische Fragen.
· Die Mediennutzung muss in der rezeptiven Anwendung und in der
interaktiven Nutzung von Medien gelernt werden.
· Die Mediengestaltung ist zum einen zu verstehen als innovative
Dimension (im Sinne von Veränderungen und Weiterentwicklungen des
Mediensystems) und als kreative Dimension (die die Betonung
ästhetischer Varianten und das ,,Über-die-Grenzen-der-
Kommunikationsroutine-hinaus-Gehen" enthält)
Mediennutzung und Mediengestaltung liegen als Dimensionen der
Zielorientierung im Handeln der Menschen.
Um diese Ausdifferenzierung von Medienkompetenz nicht subjektiv-
individualistisch zu verkürzen, strebt Baacke außerdem den Diskurs der
Informationsgesellschaft als Gestaltungsziel auf überindividueller,
gesellschaftlicher Ebene an. ,,Ein solcher Diskurs würde alle wirtschaftlichen,
technischen, sozialen, kulturellen und ästhetischen Probleme einbeziehen, um so
die ,Medienkompetenz' auf dem Laufenden zu halten."
28
Hier zeigt sich nach
Vollbrecht ,,die enge Bindung von Baackes Kompetenzbegriff an den von
Habermas."
29
28
Baacke, 1999b, S. 35
29
Vollbrecht, 2001, S. 61
- 16 -
Baacke bemängelt am Begriff der Medienkompetenz vor allem die pädagogische
Unspezifität
30
. Dazu führt er aus, dass nicht angegeben wird, wie die
beschriebenen vier Dimensionen des Begriffs praktisch, didaktisch oder
methodisch umzusetzen und zu vermitteln sind. Eine Debatte darüber hält
Baacke für dringend nötig und schlägt vor einzuführen, dass ,,wer von
,Medienkompetenz' redet, [gleichzeitig davon reden muss], wie diese zu
vermitteln sei."
31
2.3.2 Dimensionen nach Theunert
Theunert unterscheidet im Gegensatz zu Baacke nur drei Dimensionen der
Medienkompetenz und nennt diese drei ,,zentrale Fähigkeiten".
32
· Als erstes nennt sie die Fähigkeit zu kritischer Distanz gegenüber
Medienentwicklungen. Hierin sind die Analyse der Medienentwicklung in
ihrer Bedeutung für das individuelle und gesellschaftliche Leben und das
sozial-ethisch gerichtete Abwägen zwischen technischem Fortschritt und
humanen Lebensbedingungen enthalten. Als Voraussetzungen für diese
Fähigkeit nennt sie z.B. das Verstehen der Funktionsweisen einzelner
Medien und das Durchschauen der Interessen, welche
Medienentwicklungen bestimmen und forcieren.
· Die Fähigkeit zu selbst bestimmtem Umgang mit Medien bedeutet
Auswahl, Nutzung und Rezeption von Medien aufgrund eigener, nicht
fremdbestimmter Interessen und Urteile. Dieser Fähigkeit werden
Relevanzkriterien und Strukturierungswissen zum Ordnen medialer
Inhalte, sowie das Vermögen, die Wirklichkeit von medialen Abbildern
trennen zu können vorausgesetzt.
· Schließlich nennt sie als drittes die Fähigkeit zu aktiver Kommunikation
mittels Medien. Dadurch wird die Partizipation an der medial gestalteten
Kommunikationswelt möglich. Voraussetzungen dazu sind technische
Kenntnisse der Handhabung einzelner Medien, sowie, sich in Sprache,
Bildern, Tönen und Symbolen ausdrücken und mit anderen in Beziehung
treten zu können.
30
vergl. Baacke, 1996a, S. 120
31
Baacke, 1996a, S. 121
32
vergl. im Folgenden Theunert, 1996, S. 62/63 sowie Theunert, 1999, S. 54
- 17 -
Nach Theunert sollte die Medienpädagogik im Kindesalter beginnend und durch
alle Altersstufen begleitend einen umfassenden und integrierten Umgang mit der
Medienwelt vermitteln, um Menschen zu befähigen, ,,kompetent" mit Medien
umzugehen. Hierbei muss den entwicklungsbedingten Möglichkeiten in jeder
Altersstufe Rechnung getragen werden.
33
2.3.3 Dimensionen nach Schorb
Schorb bestimmt wie Baacke vier verschiedene Inhaltsbereiche der
Medienkompetenz.
34
· Orientierungs- und Strukturwissen gilt als wichtig, da es für den einzelnen
aufgrund der komplexen Durchdringung unserer Welt mit Medien nicht
möglich ist, detailliertes Wissen jeder Medientechnologie zu erwerben.
Entscheidend ist daher der Erwerb von Grundlagenwissen, verbunden mit
Strukturwissen, um verschiedene Informationen aufeinander beziehen
und benötigte Informationen aktuell ermitteln zu können. Verbunden damit
muss ein Strukturwissen der Programme und Verbindungen in unserer
Medienwelt sein. Orientierungswissen ist dagegen wichtig, um auf der
Basis historischer, ethischer und politischer Kenntnisse das erworbene
Wissen bewerten zu können. Ziel der Beherrschung dieser beiden
Aspekte ist es, sich in Mediennetzen bewegen und diese bewerten zu
können.
· Kritische Reflexivität weist die Fähigkeit des Menschen aus,
Wissensbestände nicht nur anhäufen und strukturieren, sondern auch
nach Wertungskriterien ordnen, revidieren und in neue Zusammenhänge
bringen zu können. Als Bestandteil von Medienkompetenz muss sie einen
ausgewiesenen ethischen Standpunkt haben. Schorb weist auf die
Unterscheidung von kritischer Reflexivität und ethischen Fähigkeiten in
Baackes Dimension der Medienkritik hin. Aus diesem Hinweis auf den
Begriff der Medienethik folgert er, dass der heutige, medial beeinflusste
Individualisierungsprozess nicht primär von sozialer Verantwortung
33
vergl. Theunert, 1999, S. 57
34
vergl. im Folgenden Schorb, 1997, S. 237 ff.
- 18 -
geleitet ist und daher ethisch-moralische Kriterien diesen Prozess von
außen begleiten und steuern müssen.
· Fähigkeit und Fertigkeit des Handelns wird als in der Regel eng verknüpft
mit dem Begriff der Medienkompetenz beschrieben. Doch nicht nur
Anwendungswissen, welches schließlich Bedingung zur Nutzung von
Medien ist, wird hier benannt, sondern auch weit über die Beherrschung
dieser Fertigkeiten hinaus die Er- und Bearbeitung von Bereichen sozialer
Realität und somit der selbstständige Umgang mit Medien und deren
Nutzung als Instrumente von Kommunikation. Die Fähigkeit, Medien zum
Zweck der menschlichen Kommunikation einzusetzen und sie in diesem
Nutzungsprozess dem Ziel zuzuordnen, im Austausch mit anderen
soziale Realität zu gestalten gilt hier als entscheidend.
· Soziale, kreative Interaktion beinhaltet die Fähigkeit, die Bestimmung von
Kommunikation als Austauschhandeln zwischen Menschen zum Zwecke
der Gestaltung menschlicher Gemeinschaft zu erkennen und mediales
Handeln danach auszurichten. Wertbestimmungen, die die Sozialbindung
von Kommunikation mit einschließen, müssen als Maßstab medialer
Kommunikation gesehen werden. Neben diese Fähigkeit ist die Kreativität
zu setzen, welche unerlässlich für das Schaffen von neuem und damit
auch der Gestaltung der Medien ist.
2.3.4 Zusammenfassung
Diese drei Darstellungen der Dimensionen von Medienkompetenz sollen zur
Verdeutlichung der vielfältigen Begriffsbestimmungen und Dimensionen der
Medienkompetenz genügen. Betrachtet man die Beispiele, fällt auf, dass die
Dimensionen der Medienkritik, der Medienanwendung (des Umgangs mit
Medien) und die Mediengestaltung in allen drei aufgeführten Beispielen genannt
werden. Diese Dimensionen sind gleichzeitig die drei von Theunert genannten.
Die bei ihr nicht explizit auftauchende Medienkunde nennt sie eine
Voraussetzung für die Medienkritik. Schorbs Ausarbeitungen können dagegen
annähernd mit Baackes Dimensionen gleichgesetzt werden. Er baut auf Baackes
Dimensionen auf und bezieht sich stark auf ihn. Im Gegensatz zu Schorb fächert
Baacke die Dimensionen jedoch detaillierter auf.
- 19 -
Meiner Meinung nach wird bei Baacke deutlichsten, welche Fähigkeiten die
unterschiedlichen Dimensionen beinhalten und was sie voneinander
unterscheidet. Baacke erwähnt auch als einziger weiterführend die Notwendigkeit
eines gesellschaftlichen Diskurses. Aus diesen Gründen soll seine
Begriffsbestimmung für meine Arbeit Gültigkeit haben.
- 20 -
3. Die Informationsgesellschaft
Deutschland befindet sich auf dem Weg in die Informationsgesellschaft. So lautet
das Credo der Bundesregierung, die 1999 das Aktionsprogramm ,,Innovation und
Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts" vorlegte. In
diesem Programm wurden konkrete Ziele für die nächsten Jahre aufgestellt, um
dafür zu sorgen, dass Deutschland den ,,Anschluss" an die neue
Gesellschaftsform nicht verpasst. Auch international bestimmt die Debatte um die
Informationsgesellschaft schon seit einigen Jahren die Politik. Experten gehen
davon aus, dass durch innovative Fortschritte im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) große gesellschaftliche
Veränderungen auf uns zukommen werden. Wie diese Veränderungen aussehen
werden, wie sich die Informationsgesellschaft theoretisch bestimmen lässt,
welche Risiken diese Gesellschaft birgt und welche besondere Rolle in dieser
Diskussion das Internet spielt soll im folgenden Kapitel näher erläutert werden.
3.1 Was ist die Informationsgesellschaft?
Mit dem Begriff der Informationsgesellschaft ist vor allem die Annahme
verbunden, dass die Gewinnung, Speicherung und Verarbeitung von Information
in Zukunft eine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft spielen wird. Basis
hierfür ist die rasant voranschreitende Entwicklung neuer IuK-Technologien.
Theoretisch lässt sich die Informationsgesellschaft schwer bestimmen, ein
allgemein anerkanntes Erklärungsmodell fehlt. Einig ist sich die Fachliteratur über
den Umstand, dass es zu großen Veränderungen in fast allen gesellschaftlichen
Bereichen kommen wird. Es findet jedoch keine Ursachendefinition statt;
wodurch es zu einem solch revolutionären gesamtgesellschaftlichen Wandel
kommt, wird nur unzureichend beleuchtet.
35
35
vergl. Weiß, S. 1
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832466244
- ISBN (Paperback)
- 9783838666242
- DOI
- 10.3239/9783832466244
- Dateigröße
- 688 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Alice-Salomon Hochschule Berlin – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2003 (April)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- internet medienpädagogik jugendarbeit kommunikation multimedia
- Produktsicherheit
- Diplom.de