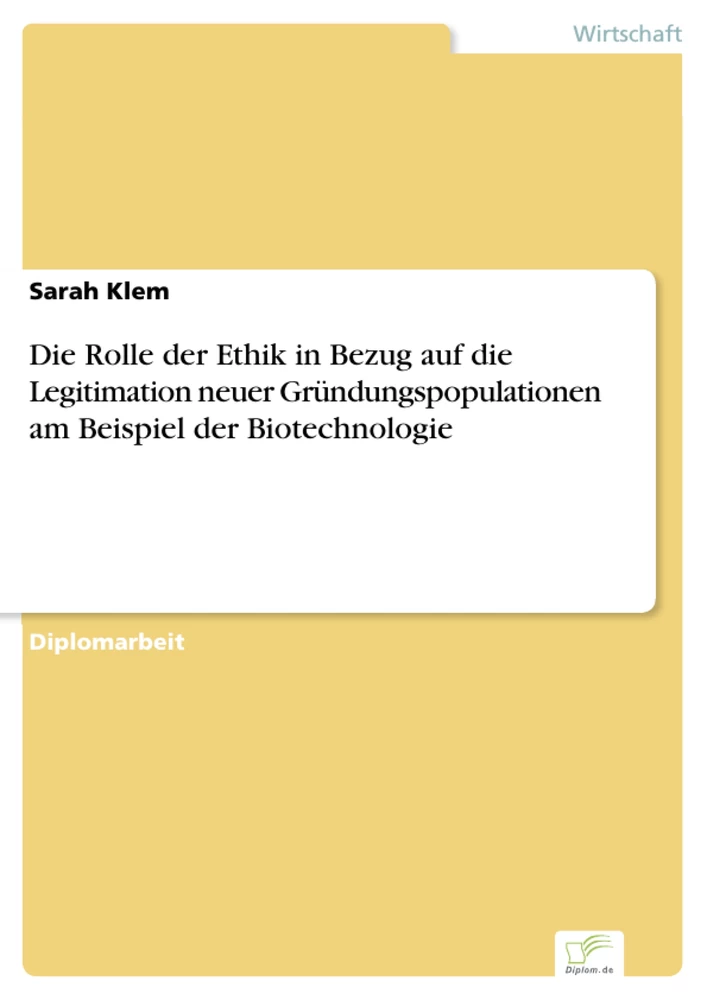Die Rolle der Ethik in Bezug auf die Legitimation neuer Gründungspopulationen am Beispiel der Biotechnologie
©2003
Diplomarbeit
119 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
Die Diskussion um Ethik in der Wirtschaft ist noch sehr jung und erst seit ungefähr zehn Jahren im Gange. Doch es wird häufig behauptet, dass derjenige, der das Wort Moral auch nur in den Mund nimmt, Gefahr läuft, als Spießer, Spielverderber, als politisch korrekt oder als Ewiggestriger zu gelten. Auch der Wirtschaftsethiker Karl Homann machte den Moralisten den Vorwurf, dass ihre Forderungen nach mehr Moral selbst der Grund dafür sind, dass es zu einem immer weitergehenden Verfall der Moral kommt. Weiters ist es notwendig darauf hinweisen, dass es unumstritten klar ist, dass sich die Wissenschaft der Ethik anzupassen hat und nicht umgekehrt und dass sie in der Wirtschaft eine intensive Diskussion und eine ernsthafte Beachtung verdient.
Welche Rolle die Ethik, bzw. auch welche Ethik eine Rolle in der Branche der Biotechnologie in Bezug auf junge Unternehmen, die sich erst am Markt etablieren müssen, spielt, gilt es in der vorliegenden Arbeit zu klären. Diese Klärung soll in der vorliegenden Arbeit auf Basis des organisationsökologischen Ansatzes der Gründungsforschung vorgenommen werden. Zur Behandlung dieser Problemstellung wurde folgende Vorgangsweise gewählt:
Das zweite Kapitel klärt grundlegende Begriffe der Biotechnologie. Es wird im Folgenden auf die Anwendungsfelder, im besonderen auf die der Genforschung, auf die Struktur- und Technikdeterminanten von Biotechnologieunternehmen eingegangen werden. Daraus ergibt sich bereits das nächste Kapitel, denn die meisten Biotechnologieunternehmen werden typischerweise als kleine Start-ups, oft auch als Spin-offs, ein aktuelles Phänomen im Klein- und Mittelbetriebssektor, gegründet. Dieser Teil hat die Aufgabe, Klein- und Mittelbetriebe klar von Großbetrieben abzugrenzen. Das nächste Kapitel wird dem Leser den organisationsökologischen Ansatz, ein Ansatz aus der Gründungsforschung, der eine makroökonomische Betrachtungsweise einnimmt, näher bringen. Weiters wird auf zwei Phänomene im Detail eingegangen, die bei der Gründung von Biotechnologieunternehmen bemerkenswert sind: die Gründung als Spin-off wie auch die verstärkte Bildung von Kooperationen. Das nächste Kapitel legt die Grundbausteine für die Ethik. Vorerst wird eine Systematik der philosophischen, wie auch der Wirtschaftsethik erstellt und am Schluss des Kapitels wird näher auf die verschiedenen Ethikkonzepte eingegangen. Für die vorliegende Arbeit wurden die Ethik von Kant (Kategorischer Imperativ), […]
Die Diskussion um Ethik in der Wirtschaft ist noch sehr jung und erst seit ungefähr zehn Jahren im Gange. Doch es wird häufig behauptet, dass derjenige, der das Wort Moral auch nur in den Mund nimmt, Gefahr läuft, als Spießer, Spielverderber, als politisch korrekt oder als Ewiggestriger zu gelten. Auch der Wirtschaftsethiker Karl Homann machte den Moralisten den Vorwurf, dass ihre Forderungen nach mehr Moral selbst der Grund dafür sind, dass es zu einem immer weitergehenden Verfall der Moral kommt. Weiters ist es notwendig darauf hinweisen, dass es unumstritten klar ist, dass sich die Wissenschaft der Ethik anzupassen hat und nicht umgekehrt und dass sie in der Wirtschaft eine intensive Diskussion und eine ernsthafte Beachtung verdient.
Welche Rolle die Ethik, bzw. auch welche Ethik eine Rolle in der Branche der Biotechnologie in Bezug auf junge Unternehmen, die sich erst am Markt etablieren müssen, spielt, gilt es in der vorliegenden Arbeit zu klären. Diese Klärung soll in der vorliegenden Arbeit auf Basis des organisationsökologischen Ansatzes der Gründungsforschung vorgenommen werden. Zur Behandlung dieser Problemstellung wurde folgende Vorgangsweise gewählt:
Das zweite Kapitel klärt grundlegende Begriffe der Biotechnologie. Es wird im Folgenden auf die Anwendungsfelder, im besonderen auf die der Genforschung, auf die Struktur- und Technikdeterminanten von Biotechnologieunternehmen eingegangen werden. Daraus ergibt sich bereits das nächste Kapitel, denn die meisten Biotechnologieunternehmen werden typischerweise als kleine Start-ups, oft auch als Spin-offs, ein aktuelles Phänomen im Klein- und Mittelbetriebssektor, gegründet. Dieser Teil hat die Aufgabe, Klein- und Mittelbetriebe klar von Großbetrieben abzugrenzen. Das nächste Kapitel wird dem Leser den organisationsökologischen Ansatz, ein Ansatz aus der Gründungsforschung, der eine makroökonomische Betrachtungsweise einnimmt, näher bringen. Weiters wird auf zwei Phänomene im Detail eingegangen, die bei der Gründung von Biotechnologieunternehmen bemerkenswert sind: die Gründung als Spin-off wie auch die verstärkte Bildung von Kooperationen. Das nächste Kapitel legt die Grundbausteine für die Ethik. Vorerst wird eine Systematik der philosophischen, wie auch der Wirtschaftsethik erstellt und am Schluss des Kapitels wird näher auf die verschiedenen Ethikkonzepte eingegangen. Für die vorliegende Arbeit wurden die Ethik von Kant (Kategorischer Imperativ), […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6504
Klem, Sarah: Die Rolle der Ethik in Bezug auf die Legitamtion neuer
Gründungspopulationen am Beispiel der Biotechnologie
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniversität, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
1
1
ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER ARBEIT ... 4
2
BIOTECHNOLOGIE ... 6
2.1
E
INLEITUNG IN DIE
B
IOTECHNOLOGIE
... 6
2.2
A
NWENDUNGSFELDER
... 10
2.2.1
U
MWELTBEREICH
...10
2.2.2
L
ANDWIRTSCHAFT
...11
2.2.3
N
AHRUNGSMITTELPRODUKTION
...11
2.2.4
G
ESUNDHEITSSEKTOR
...12
2.3
F
ORSCHUNG IN DER
G
ENTECHNOLOGIE
... 13
2.3.1
F
UNKTION DER
G
ENE
...13
2.3.2
A
NWENDUNGSFELDER
...13
2.4
B
IOTECHNOLOGIE IN
Ö
STERREICH
... 17
2.5
D
IE
B
RANCHE
B
IOTECHNOLOGIE
... 19
3
UNTERSCHIEDE VON KLEIN- UND MITTELBETRIEBEN UND GROßBETRIEBEN... 22
3.1
Q
UANTITATIVE
A
BGRENZUNG
... 22
3.2
Q
UALITATIVE
A
BGRENZUNG
... 24
3.2.1
P
FOHL
´
SCHER
M
ERKMALSKATALOG
...24
3.2.2
M
UGLER
´
SCHER
M
ERKMALSKATALOG
...29
4
GRÜNDUNGSFORSCHUNG... 30
4.1
E
INLEITUNG
... 30
4.2
D
ER ORGANISATIONSÖKOLOGISCHE
A
NSATZ
... 30
4.2.1
I
NTRAPOPULATIONSPROZESSE
...33
4.2.2
I
NTERPOPULATIONSPROZESSE
...34
4.2.3
I
NSTITUTIONELLE
P
ROZESSE
...34
4.3
G
RÜNDUNGEN IM
B
IOTECHNOLOGIESEKTOR
... 35
4.3.1
S
PIN
-
OFF
...36
4.3.2
K
OOPERATIONEN
...39
5
ETHIK... 42
5.1
E
INLEITUNG
... 42
2
5.2
D
IE DREI
D
ISZIPLINEN DER
E
THIK
... 44
5.2.1
D
ESKRIPTIVE
E
THIK
...46
5.2.2
N
ORMATIVE
E
THIK
...47
5.2.3
A
NALYTISCHE
E
THIK
...50
5.3
S
YSTEMATIK DER
W
IRTSCHAFTSETHIK
... 52
5.3.1
H
ANDLUNGSEBENEN DER
E
THIK
...54
5.3.2
I
NSTITUTIONAL
-
UND
I
NDIVIDUALETHIK
...56
5.4
E
THISCHE
K
ONZEPTE
... 59
5.4.1
I
MMANUEL
K
ANT
...59
5.4.2
D
ER
U
TILITARISMUS
...61
5.4.3
D
ISKURSETHIK
...63
6
ETHIK UND BIOTECHNOLOGIE ... 67
6.1
E
THISCHE
A
NSÄTZE IN DER
B
IOTECHNOLOGIE
... 67
6.1.1
U
TILITARISMUS
...67
6.1.2
D
ISKURSETHIK
...68
6.1.3
K
ANT
...68
6.2
I
MPLEMENTIERUNG
... 70
6.2.1
I
MPLEMENTIERUNG DES ETHISCHEN
K
ONZEPTS
...71
7
LEGITIMATION NEUER GRÜNDUNGSPOPULATIONEN UND IHRE ETHISCHEN
IMPLIKATIONEN... 72
7.1
D
ER
E
TABLIERUNGSANSATZ
... 72
7.1.1
P
HASE
1: B
ILDUNG DES
G
RÜNDUNGSNUKLEUS
...72
7.1.2
P
HASE
2: A
UFBAU DER
U
NTERNEHMENSSTRUKTUR
...73
7.1.3
P
HASE
3: U
NABHÄNGIGKEIT DER
S
TRUKTUR VOM
G
RÜNDUNGSNUKLEUS
...73
7.2
V
OM
G
RÜNDER ZUR
O
RGANISATION
... 76
7.2.1
O
RGANISATION
...77
7.2.2
O
RGANISATION IN
K
OOPERATIONEN
...79
7.2.3
O
RGANISATION IN
B
IOTECH
-S
PIN
-
OFFS
...80
7.2.4
E
THISCHE
I
MPLIKATIONEN
...81
7.3
V
OM ERSTEN
P
RODUKT ZUM
P
RODUKTPORTFOLIO
... 87
7.3.1
O
PTIONALE
W
EGE
...88
7.3.2
E
THISCHE
I
MPLIKATIONEN
...89
7.4
V
OM ERSTEN
K
UNDEN ZUM
K
UNDENSTAMM
... 95
7.4.1
P
HARMAMARKT
...96
3
7.4.2
E
THISCHE
I
MPLIKATIONEN
...99
8
RESUMÉE... 101
LITERATURVERZEICHNIS ... 105
ABBILDUNGSVERZEICHNIS... 112
4
1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Die Diskussion um Ethik in der Wirtschaft ist noch sehr jung und erst seit ungefähr
zehn Jahren im Gange. Doch es wird häufig behauptet, dass derjenige, der das Wort
Moral auch nur in den Mund nimmt, Gefahr läuft, als Spießer, Spielverderber, als
,,politisch korrekt" oder als Ewiggestriger zu gelten. Auch der Wirtschaftsethiker Karl
Homann machte den ,,Moralisten" den Vorwurf, dass ihre Forderungen nach mehr
Moral selbst der Grund dafür sind, dass es zu einem immer weitergehenden Verfall
der Moral kommt.
1
Weiters ist es notwendig darauf hinweisen, dass es unumstritten
klar ist, dass sich die Wissenschaft der Ethik anzupassen hat und nicht umgekehrt
und dass sie in der Wirtschaft eine intensive Diskussion und eine ernsthafte
Beachtung verdient.
2
Welche Rolle die Ethik, bzw. auch welche Ethik eine Rolle in der Branche der
Biotechnologie in Bezug auf junge Unternehmen, die sich erst am Markt etablieren
müssen, spielt, gilt es in der vorliegenden Arbeit zu klären. Diese Klärung soll in der
vorliegenden Arbeit auf Basis des organisationsökologischen Ansatzes der
Gründungsforschung vorgenommen werden. Zur Behandlung dieser Problemstellung
wurde folgende Vorgangsweise gewählt:
Das zweite Kapitel klärt grundlegende Begriffe der Biotechnologie. Es wird im
Folgenden auf die Anwendungsfelder, im besonderen auf die der Genforschung, auf
die Struktur- und Technikdeterminanten von Biotechnologieunternehmen
eingegangen werden. Daraus ergibt sich bereits das nächste Kapitel, denn die
meisten Biotechnologieunternehmen werden typischerweise als kleine Start-ups, oft
auch als Spin-offs, ein aktuelles Phänomen im Klein- und Mittelbetriebssektor,
gegründet. Dieser Teil hat die Aufgabe, Klein- und Mittelbetriebe klar von
Großbetrieben abzugrenzen. Das nächste Kapitel wird dem Leser den
organisationsökologischen Ansatz, ein Ansatz aus der Gründungsforschung, der eine
makroökonomische Betrachtungsweise einnimmt, näher bringen. Weiters wird auf
zwei Phänomene im Detail eingegangen, die bei der Gründung von
1
Homann, K. (1997), S. 13-21
2
vgl. Thierfelder, R. (2001), S. 587
5
Biotechnologieunternehmen bemerkenswert sind: die Gründung als Spin-off wie
auch die verstärkte Bildung von Kooperationen. Das nächste Kapitel legt die
Grundbausteine für die Ethik. Vorerst wird eine Systematik der philosophischen, wie
auch der Wirtschaftsethik erstellt und am Schluss des Kapitels wird näher auf die
verschiedenen Ethikkonzepte eingegangen. Für die vorliegende Arbeit wurden die
Ethik von Kant (Kategorischer Imperativ), der utilitaristische Ansatz und die
Diskursethik von Habermas ausgewählt, da sie die Hauptströmungen in der Ethik
darstellen. Basierend auf diesen Kenntnissen wird im nächsten Kapitel geprüft,
welcher Ansatz für die Biotechnologie am sinnvollsten ist. Weiters wird geklärt, auf
welchen Ebenen die Implementierung vor sich gehen soll bzw. welche regionalen
Unterschiede bestehen. Aufbauend auf dem, was bis dahin behandelt wurde, wird
folgendes Kapitel alle vorigen verbinden. Es wird näher auf den Etablierungsprozess
eingegangen werden, den junge Biotechnologieunternehmen ab dem Zeitpunkt ihrer
Gründung durchlaufen. Es gilt, sich vom Gründer, vom ersten Produkt und vom
ersten Kunden unabhängig zu machen. Somit muss eine Organisation im
Unternehmen aufgebaut werden und ein Produktportfolio sowie ein Kundenstamm
entwickelt werden. Es wird an der Stelle geprüft, welche ethischen Probleme in den
jeweiligen Bereichen auftreten können.
Abschließend folgt eine Zusammenfassung, die die wichtigsten Aussagen der
vorliegenden Arbeit resümiert.
6
2 Biotechnologie
2.1 Einleitung in die Biotechnologie
,,Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir
nicht tun." (Molière)
Doch nun zur Definition von Biotechnologie der European Federation of
Biotechnology:
3
Biotechnologie wird hier definiert als ein ,,Zusammenwirken von natur- und
ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen, mit dem Ziel, mittels Organismen, Zellen
oder Zellbestandteilen sowie molekularer Analoga Produkte herzustellen oder
Untersuchungen durchzuführen."
Eine weitere Definition lautet: Unter Biotechnologie versteht man ,,eine
multidisziplinäre, anwendungsorientierte Naturwissenschaft, die Organismen und
deren Stoffwechselleistungen produktiv nutzt. Hierbei werden biologische Prozesse
im Rahmen technischer Verfahren und industrieller Produktionen unter integrierter
Anwendung des Wissens aus Biologie, Chemie und Verfahrenstechnik eingesetzt."
4
Die klassische Biotechnologie verwendet hierzu vor allem folgende Organismen:
Mikroorganismen: Hierzu zählen Bakterien, Hefen, andere Pilze und Algen.
Zellen oder Zellgewebe: Hier sind Zellkulturen höherer Pflanzen und Tiere
zuzurechnen.
Aus diesen beiden Organismen isolierte Bestandteile: z.B. Enzyme
Man kann hier klar erkennen, dass es in der klassischen Biotechnologie darum geht,
lebendige Organismen mit bekannten Eigenschaften zu produzieren oder zu
reproduzieren.
3
EFB General Assembly (1989), online
4
vgl. Nuesch, J. (1989), S. 63f
7
Im Gegensatz zur klassischen Biotechnologie, trachtet die Gentechnologie danach,
entsprechende Mikroorganismen genetisch zu verändern, also nicht-natürlich
vorhandenes Leben herzustellen.
5
Gentechnologie ist demnach ein Teilbereich der
Biotechnologie, in dem genetische Grundlagenforschung mit der Entwicklung und
Bereitstellung von Verfahren für die Biotechnologie verknüpft wird.
Im weiteren folgen die geschichtlichen Eckdaten der Biotechnologie.
Im Grunde genommen reicht die Biotechnologie schon einige Tausende Jahre in der
Menschheitsgeschichte zurück. Es wurde zum Beispiel schon vor 6000 bis 8000
Jahre Hefen und Bakterien zur Nahrungsmittelveredelung benutzt.
6
Lange, bevor die Genetik entstanden war, versuchte der Mensch, Tiere und Pflanzen
gemäß seinen Wünschen zu verändern. Auf diese Art und Weise entstanden aus
wild wachsenden Gräsern ertragreiche Getreidesorten. Der Mensch konnte die
Erbgänge jedoch nicht genau analysieren.
Es folgt die Darstellung der wichtigsten Entdeckungen der letzten 40 Jahre:
7
1859: Charles Darwin veröffentlicht sein Buch über die Entstehung der Arten. Seine
revolutionäre These: Die Evolution ist der Motor des Lebens. Die Lebewesen
erhalten durch das Zusammenwirken von Mutationen und Selektionen ihre
Eigenschaften.
1865: Gregor Mendel macht die Entdeckung, dass Erbmerkmale nach festen
Regeln vererbt werden.
1869: Friedrich Miescher findet in Zellkernen "Nukleine" - saure Substanzen.
1879: Walther Flemming beobachtet die Trennung der Chromosomen bei der
Mitose. Er zählt zunächst 24 Chromosomen-Paare.
1902: Walter Sutton untermauert die Mendelschen "Faktoren". Er beobachtet an
Grashüpfern, dass die Chromosomen die Träger der Erbinformationen sind.
1909: Der Engländer Archibald Garrod veröffentlicht sein Buch "Inborn Errors of
Metabolism". Darin weist er die Erblichkeit von vier Stoffwechselkrankheiten nach -
Krankheiten, die auf biochemische Unterschiede zwischen Gesunden und Kranken
zurückzuführen sind.
5
Löw, R. (1985), S. 113
6
Scheller, R.. (1988), S. 11
7
Sachsen LB (2001), online
8
1927: Der US-Genetiker Herman Muller zeigt, dass energiereiche Strahlung das
Erbgut verändert. Er erzeugte bei Taufliegen durch Röntgenbestrahlung künstliche
Mutationen und erhielt dafür 1946 den Nobelpreis für Medizin.
1944: Oswald Theodore Avery, Colin McLeod und Maclyn McCarty entdecken, dass
die DNA die Trägerin der Erbinformation ist.
1945: Der Physiker Erwin Schrödinger veröffentlicht das Buch "Was ist Leben?"
Seine Vermutung: Gene sind "aperiodische Kristalle", die aus einer nur kleinen
Anzahl verschiedener Elemente bestehen, deren Abfolge die Erbinformation kodiert.
1952: Alfred Day Hershey und Martha Chase beweisen, dass die Nukleinsäuren die
Erbinformation speichern. Damit kommen Proteine als Informationsträger nicht mehr
in Frage.
1953: James D. Watson und Francis H. C. Crick veröffentlichen die Doppelhelix-
Struktur der DNA: Zwei Stränge werden durch Wasserstoffbrückenbindungen
zwischen den Basen Adenin/Thymin und Guanin/Cytosin zusammengehalten. Doch
die Kristallographin Rosalind Franklin hatte die helikale Struktur und die Außenlage
der Phosphatbrücken bereits vor ihnen erkannt.
1956: Der Indonesier Joe Han Tijo und Albert Levan korrigieren die Zahl der
menschlichen Chromosomenpaare von 24 auf 23.
1966: Die Entschlüsselung des genetischen Codes gilt als abgeschlossen. Har
Gobind Khorana, R. W. Holley und M. W. Nirenberg erhalten dafür 1968 den
Nobelpreis für Medizin.
1969: Jonathan Beckwith gelingt erstmals die Isolierung eines Gens.
1975: Im kalifornischen Asilomar findet erstmals eine Konferenz über Gentechnik
statt. Vor allem die Sicherheitsaspekte werden debattiert.
1976: In San Francisco wird das erste Biotechnologie-Unternehmen der Welt
gegründet: die Firma Genentech.
1977: Walter Gilbert und Frederick Sanger entwickeln unabhängig voneinander zwei
Methoden zur DNA-Sequenzierung. Sanger erhält drei Jahre später den Chemie-
Nobelpreis.
1981: Die Firma General Electric erhält das erste Patent für einen gentechnisch
veränderten Organismus.
1982: Die amerikanische Gesundheitsbehörde lässt rekombinantes Insulin als
erstes gentechnisch hergestelltes Medikament zu.
1984: Alec Jeffreys entwickelt den "Genetischen Fingerabdruck".
9
1986: Der Durchbruch auf dem Gebiet des Klonens: Durch Trennung embryonaler
Rinderzellen in einem sehr frühen Stadium erhält Neal First von der Universität von
Wisconsin genetisch identische Mehrlinge (Klone). Als Klon bezeichnet man den auf
ungeschlechtlichem Wege vermehrten, genetisch identischen Nachkommen eines
Lebewesens.
1988: Philip Leder und Timothy Stewart erhalten das erste Patent für ein
gentechnisch verändertes Säugetier - eine transgene Maus, die als
Modellorganismus für die Untersuchung von Tumorerkrankungen dient.
1994: In den USA kommen gentechnisch veränderte Tomaten auf den Markt. In
Großbritannien ist Tomatenmark aus transgenen Tomaten in Supermärkten
erhältlich.
1995: Das "Institute for Genomic Research" veröffentlicht die erste komplette
Genomsequenz eines Bakteriums.
1997: Ian Wilmut gelingt das Klonen eines erwachsenen Tieres. Das Klonschaf
Dolly ist das erste Tier, das im Labor als völlig erbgutgleicher Zwilling gezeugt und
von einem Ammentier ausgetragen wurde. Heftige ethische Debatten entbrennen
weltweit.
1998: Zwei Forscherteams berichten, dass sie embryonale Stammzellen zur
Differenzierung in spezialisierte Gewebezellen anregen können.
2000: Das Genom der Fruchtfliege ist entschlüsselt.
2001: Auf beiden Seiten des Atlantiks gibt es jeweils rund 1300 Biotechnologie-
Unternehmen.
Die Arbeit beschränkt sich jedoch im Wesentlichen auf die jüngeren Entdeckungen.
Die in diesem Jahrhundert relevanten Schlüsseltechnologien sind Genübertragung,
Zellfusion oder bestimmte biochemische Verfahren.
8
8
vgl. Freier, P. (2000), S. 81
10
Die Entwicklung der Biotechnologie verläuft weltweit extrem rasant, sowohl in
der Grundlagen- als auch in der angewandten Forschung. Damit entwickelte sich die
Biotechnologie in nur 25 Jahren zu einer der Schlüsseltechnologien unserer Zeit und
wurde zum wichtigen Motor für die wirtschaftliche Prosperität.
Somit handelt es sich um ein neues Technologiesystem, bestehend aus
zusammenhängenden Innovationen, die durch bestehende Unternehmen wirt-
schaftlich nutzbar gemacht wird, so wie zum Beispiel der pharmazeutischen
Industrie. Weiters zielen die zahlreichen Neugründungen in dem Bereich darauf ab,
Innovationen wirtschaftlich zu nutzen.
2.2 Anwendungsfelder
Nach dieser kurzen Einführung in die Biotechnologie werden die wichtigsten
Anwendungsfelder erläutern.
9
2.2.1 Umweltbereich
Biotechnologie kann auch im Umweltbereich genutzt werden. Hierbei dient sie der
Analytik und Überwachung, für den Abbau sowie auch für die Vermeidung von
Umweltbelastungen. Für die Analytik und Überwachung kommen Biosensoren,
Immuntests und auch DNA-Sonden in Frage. Biosensoren können kleinste Mengen
an Einzelschadstoffen messen und finden zur Messung des biologischen
Sauerstoffbedarfs in Kläranlagen Anwendung. Auch einige Immuntests zur Messung
von bestimmten Schadstoffen sind schon am Markt erwerbbar. DNA-Sonden
letztendlich dienen der Analyse verschiedener Umweltkompartimenten. Hierbei ist
die Entwicklung eines Tests für die Krankheitserreger der Legionärskrankheit (=
Legionellen) im Trinkwasser, von Bedeutung.
Der wichtigste Anwendungsbereich der Biotechnologie beim Abbau von
Umweltbelastungen stellt die biologische Abwasserreinigung dar. Aber biotechnische
Verfahren zum Schadstoffabbau im Boden werden auch immer wichtiger. Dabei
9
vgl. Reiß, T. (1997), S. 2ff
11
werden einige Mikroorganismen dazu verwendet, Schadstoffe als Nahrungs- oder
Energiequelle zu nutzen.
Es ist ein genereller Trend in Richtung Vermeidung von Umweltbelastungen durch
entsprechende Prozessoptimierungen zu verzeichnen. Dieser Bereich stellt ein
großes Potential für die Biotechnologie dar; denn viele biotechnische Ansätze
könnten in diese Produktionsprozesse integriert werden.
2.2.2 Landwirtschaft
Die Bedeutung der Biotechnologie in der Landwirtschaft erstreckt sich auf die Tier-
als auch auf die Pflanzenproduktion. Im Jahr 1983 gelang es zum ersten Mal, gezielt
fremde Gene auf Pflanzen zu übertragen. Heute können die wichtigsten
Nahrungspflanzen gentechnisch verändert werden (Mais, Weizen, Reis, Sojabohne).
Die Züchtungsziele sind folgende: Krankheitsresistenz, höhere Toleranz gegen
Trockenheit und Kälte, Herbizidtoleranz und Qualitätssteigerung. Während die
gentechnische Veränderung von Pflanzen große öffentliche Diskussionen
hervorgerufen hat, blieben die Fortschritte in der klassischen Pflanzenzüchtung kaum
beachtet. Durch die hoch entwickelten Zell- und Gewebekulturtechniken wird
erwartet, dass die Neuzüchtung von Nutzpflanzen von durchschnittlich 15-20 Jahren
auf 10 Jahre reduziert werden kann.
Vergleichsweise ähnliche Methoden werden heute auch schon in der Nutztierzucht
eingesetzt. Analog zur Humanmedizin, konnten in der Tiermedizin Diagnosever-
fahren verbessert werden und Impfstoffe und Therapeutika entwickelt werden.
Es ist jedoch klar, dass die Bedeutung der Biotechnologie im Landwirtschaftssektor
stark davon abhängt, wie die Konsumenten bzw. Verbraucher reagieren. Und wie
sich klar herausgestellt hat, sind die Reaktionen der Konsumenten bzw. der Verbrau-
cher kritisch.
2.2.3 Nahrungsmittelproduktion
Die wichtigsten Einsatzgebiete der Biotechnologie in der Nahrungsmittelproduktion
sind jene Bereiche, in denen mit Mikroorganismen (Starterkulturen) oder mit
enzymatischen Verfahren gearbeitet wird. Diese betreffen vor allem die
12
Milchindustrie, die Rohwurstherstellung, die Backwarenindustrie, die Produktion
alkoholischer Getränke, die Herstellung von Enzympräparaten sowie die Produktion
von Lebensmittelzusatzstoffen (z.B. Vitamine, Aminosäuren oder organische
Säuren). Ziel der Starterkulturen ist es, die Prozesssicherheit zu erhöhen, die
Wirtschaftlichkeit zu verbessern, den ernährungsphysiologischen Wert zu erhöhen,
neue Produkte herzustellen oder das hygienische Risiko zu reduzieren.
Voraussetzung ist die Anwendung von gentechnischen Methoden bei den jeweiligen
Mikroorganismen. Für den Lactobacillus, einem Mikroorganismus der
Lebensmittelverarbeitung ist diese Methodik inzwischen etabliert.
Weiters sind bereits einige gentechnisch modifizierte Enzyme bekannt; doch es
werden nur wenige Präparate für die Käseherstellung und Stärkevergärung
verwendet.
2.2.4 Gesundheitssektor
Biotechnologie im Gesundheitssektor kann in drei wesentliche Produktgruppen bzw.
Verfahren eingeteilt werden. Erstens die Entwicklung von neuen Diagnostika,
zweitens von Therapeutika und Impfstoffen und drittens der Beitrag der
Biotechnologie zur Gentherapie und Genomanalyse.
10
Die Wirkstoffentwicklung, das
ist ein Screening von tausenden natürlichen und chemischen Substanzen, ist ein
risikoreicher, zeitintensiver und aufwendiger Prozess. Es werden jährlich ca. 10.000
Substanzen geschleust, woraus schließlich dann nur ein bis zwei Medikamente
entwickelt werden können.
Die vorliegende Arbeit nimmt eine Trennung zwischen der roten (Medizin) und der
grünen (Landwirtschaft, Nahrungsmittel und Umwelt) Biotechnologie vor. Im Folgen-
den konzentriert sich die Autorin aufgrund der aktuellen erheblichen Umwälzungen in
dem Bereich auf die rote Biotechnologie, bzw. auf die Biomedizin.
10
Buse, S. (2000), S. 51
13
2.3 Forschung in der Gentechnologie
2.3.1 Funktion der Gene
Es wird eine kurze Erklärung der Funktion der Gene angeführt, um eine Brücke zur
medizinisch- sachlichen Diskussion zu schlagen.
11
Die Gene sind für alle im Leben eines Organismus ablaufenden Zellfunktionen
verantwortlich. Die Gene liefern die Information für die Erzeugung der Proteine, die
für verschiedene chemische Reaktionen und für die Kommunikation der Zellen
untereinander verantwortlich sind. Das Erbmaterial verschiedener Organismen ist in
den spezifischen DNA-Sequenzen in ganz bestimmter Aminosäurenabfolge
festgelegt.
Diese Übertragung der Information von der DNA (von einem Gen) auf ein Protein
erfolgt in verschiedenen Phasen, wobei zuerst eine Transkription des gesamten
Erbmaterials und dann eine Replikation durchgeführt werden.
2.3.2 Anwendungsfelder
2.3.2.1 In-vitro-Fertilisation
12
Die Entwicklung der In-vitro-Fertilisation (IVF) war ein revolutionärer Prozess für
unfreiwillig unfruchtbare Paare. Bei der IVF werden nach einer Hormonbehandlung
Eizellen aus den Eierstöcken der Frau entnommen und mit isolierten Samenzellen
des Mannes auf einem Kulturträger künstlich (in vitro) befruchtet. Nach 2-5 Tagen
findet der Transfer des Embryos in die Uterushöhle statt.
Nach vorliegenden Schätzungen sind etwa zwei Millionen Neugeborene weltweit
durch In-vitro-Fertilisation zur Welt gekommen.
Falls mehr als ein oder zwei normal befruchtete Embryos mit normalem Aussehen
gewonnen werden, können nicht alle ohne Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft in
11
vgl. Fiori, F. (2001), online
12
vgl. Fiori, Francesco (2001), online
14
den Uterus eingepflanzt werden.
13
Diese werden überzählige Embryonen genannt,
die nicht mehr für einen Transfer in den Mutterleib genützt werden können und somit
dem Tod geweiht sind. Zur ethischen Frage was mit diesen Embryonen passieren,
soll wird in Kapitel 7.3.2. näher eingegangen.
2.3.2.2 Präimplantationsdiagnostik
Die embryonale Chromosomenanalyse mit Hilfe der Präimplantationsdiagnostik (PID)
ermöglicht es, die Übertragung von nicht lebensfähigen Embryos mit Chromosomen-
schäden zu vermeiden. Die PID gestattet eine primäre Selektion unter welchen
Kriterien ein Embryo verpflanzenswert ist und schafft sofort ein ethisches Problem.
Hier besteht eine Spannung zwischen dem Ziel und dem Mittel. Das Ziel ist es, den
Wunsch von risikobehafteten Eltern nach einem genetisch intakten Kind zu erfüllen.
Doch durch das Mittel wird ein Selektionsvorgang ausgelöst. Embryonen werden
vernichtet, die nicht den Testkriterien entsprechen. Somit entstünde eine Wertigkeit
der Embryonen.
2.3.2.3 ICSI
14
Die Behandlung der männlichen Unfruchtbarkeit erfuhr in den letzten zehn Jahren
dank der Technik der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) eine bedeu-
tende Veränderung. Das Spermium, das unter natürlichen Umständen nicht fähig ist,
eine Eizelle zu befruchten, wird unter dem Mikroskop direkt in das Zytoplasma einer
Eizelle injiziert. Da diese Methode den qualitativen Mangel der Samenzellen
ausgleicht, ist die Anwendung der Präimplantationsdiagnostik besonders wichtig, um
die Einpflanzung von Embryos mit schwerer Missbildung zu verhindern.
2.3.2.4 Verfahren zur Behandlung genetischer Krankheiten
2.3.2.4.1
Die Gentherapie
Mit der Gentherapie wird die anomale Funktion eines Gens korrigiert. Es wird
dagegen gesteuert, dass mangelhafte Gene an die nachfolgenden Generationen
13
vgl. Fiori, Francesco (2001), online
14
vgl. Ärzte Zeitung Verlagsgesellschaft mbH (2002), online
15
weitergegeben werden. Sie wird Keimbahntherapie genannt, wenn sie an
Reproduktionszellen oder an Embryonen vorgenommen wird. In diesem Fall wird die
Veränderung an die Nachkommen weitergegeben.
2.3.2.4.2
Die Genmedizin
Im Unterschied zur Gentherapie, greift die Genmedizin nicht in die Zellfunktionen ein,
sondern behandelt mangelhafte Gene durch Medikamente. Der größte Teil der
neuen Medikamente wirken auf die Proteine und Enzyme und haben somit eine
größere Wirksamkeit bei geringeren Nebenwirkungen und wirken selektiver auf den
Organismus.
a) Medikamente aus transgenen Tieren
Eine Methode zur Herstellung von Humanproteinen für neue Medikamente ist die
Herstellung sogenannter transgener Tiere, die Träger menschlicher Gene sind und
daher zum Beispiel in ihrer Milch ein Protein erzeugen, das für die Behandlung von
Menschen verwendet werden kann. Da nicht alle behandelten Tiere das gewünschte
menschliche Protein erzeugen, wird an der Klonung dieser transgenen Tiere
gearbeitet, die verlässlich die entsprechenden Proteine liefern. Die Experimente
betreffen insbesondere Ziegen, aber auch Schafe, Schweine und Rinder.
b) Die Transplantation von Geweben und Organen
Auf internationaler Ebene ist ein ständiger Mangel an Transplantationsorganen zu
verzeichnen. Nichts weist darauf hin, dass die Bevölkerung sich an die Vorstellung,
Organspender zu werden, gewöhnt, ganz im Gegenteil. Die Entnahme bei nicht
lebenden Spendern hat das medizinisch-ethisch-juristische Problem der Feststellung
des Todes und der Erlaubnis für die Organtransplantation aufgeworfen. Aber die
Rechtslage ist wenig homogen. Die Nachfrage nach Organen steigt parallel zur
Entwicklung der Transplantationstechniken. Zurzeit stehen 50.000 Europäer auf der
Warteliste für neue Organe, und diese Listen wachsen jedes Jahr um 15 %. Die
Forschung konzentriert sich vor allem auf zwei Bereiche: die Xenotransplantation
und die Gewebe- und Organtechnologie, einschließlich der Nutzung von
Stammzellen zu therapeutischen Zwecken.
16
·
Die Xenotransplantation ist eine Transplantation eines tierischen Organs auf
den Menschen. Mit Hilfe der Genmanipulation wird versucht, aus transgenen
Schweinen geeignete Organe für die Xenotransplantation auf den Menschen
zu gewinnen.
·
Die Nutzung von Stammzellen zu therapeutischen Zwecken ist als potentiell
revolutionäre neue Methode zur Behandlung von Krankheiten und
Verletzungen auf dem Vormarsch. Ziel dieser Therapie ist die Entwicklung
differenzierter Zellen oder Gewebe zur Transplantation bei Patienten mit
Krankheiten wie Diabetes, Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson, Infarkt usw.
Krankheiten, für die es bis heute keine wirksamen Therapien oder
Behandlungen gibt. Stammzellen sind während der ganzen Entwicklungszeit
eines Menschen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen vorhanden.
Solche Zellen können aus adulten oder fötalen Geweben, aus Embryonen
oder durch Klonen mittels Zellkerntransfer gewonnen werden. Eine Quelle für
embryonale Stammzellen könnte die Nutzung ,,überzähliger Embryonen" sein,
das heißt die Nutzung von Embryonen, die nicht mehr für die
Infertilitätsbehandlung gebraucht werden. Eine andere Möglichkeit könnte die
Isolierung embryonaler Stammzellen aus Embryonen sein, die durch
Kerntransfer (therapeutisches Klonen) hergestellt wurden. Diese Stammzellen
hätten den Vorteil einer immunologischen Verträglichkeit mit dem Patienten.
Fötale Stammzellen können aus abgetriebenen Föten und dem
Nabelschnurblut bei der Geburt gewonnen werden. Adulte Stammzellen
können aus einigen für Transplantationen verwandten Geweben wie etwa
Knochenmark, Haut und Blut isoliert werden. In klinischer Hinsicht stützt sich
diese Therapie in den meisten Fällen auf die Transplantation von Organen
Verstorbener oder seltener von lebenden Spendern. Die Grenzen dieser
Methode sind der Mangel an transplantierbaren Organen und die
Notwendigkeit einer ständigen Unterdrückung der Immunabwehr, um eine
Abstoßung des Organs zu verhindern.
Dem Human-Genom-Projekt ist es zu verdanken, dass die Sequenz des gesamten
menschlichen Genoms inzwischen bekannt ist. Überraschenderweise ist die Zahl der
menschlichen Gene sehr viel kleiner als erwartet. Das menschliche Genom enthält
nämlich nur 30.000 Gene und nicht 100.000, wie in der Vergangenheit angenommen.
17
Das bedeutet, dass wir nur zwei- oder dreimal so viele Gene haben wie eine
Fruchtfliege.
Die Erkennung der molekularen Ursachen von Erbkrankheiten bedeutet in der Tat
eine Erweiterung der Diagnose- und Präventionsmöglichkeiten durch eine präzisere,
personenspezifischere und wirksamere Behandlung von Krankheiten als derzeit
möglich ist.
2.4 Biotechnologie in Österreich
Österreich startet im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich verspätet
den Aufbau einer Biotech-Industrie, nachdem lange Zeit ein allgemeines Misstrauen
der Öffentlichkeit gegenüber neuen Technologien und die relativ geringen
Aufwendungen im Forschungs- und Entwicklungsbereich diese Entwicklung verhin-
dert hatten.
Doch im Jahr 2000 beträgt die Zahl an Biotech-Firmen beachtliche 57 in Österreich
laut Company Directory, VBA. Und auch die Forschungs- und Entwicklungsausgaben
sind im Jahr 2000 auf 50,2 Mrd. ATS gestiegen. Davon sind 25 in Wien angesiedelt,
welches sich zu Österreichs Biotech-Zentrum entwickelt hat: 69% der
wissenschaftlichen Forschung sind in Wien konzentriert.
Der folgende Absatz wurde aus dem Newsletter von Ronge Evelyne entnommen:
15
Rund 6000 hoch qualifizierte Jobs werden dem Bereich Pharma- und Biotechnologie
zugerechnet. So birgt die Biotechnologiebranche ein immenses Beschäftigungs-
potential in sich.
Seit dem Eintritt Österreichs in die EU und der verstärkten Öffnung Osteuropas
versucht man die Biotechnologie durch zahlreiche Initiativen attraktiver zu machen,
um die Ansiedlung von in- und ausländischen Biotech-Unternehmen in Österreich
verstärkt zu fördern. Neben 8 Universitäten verfügt das Land über eine gute
Forschungsinfrastruktur, die sich vor allem in der Umgebung der Universität Wien
manifestiert.
Hier entstand auch die erste österreichische Ausgründung eines Biotech-Start-ups
aus einer Hochschule (Intercell). Im Jahr 1984 wurde die Innovationsagentur durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, die Österreichische
15
vgl. Ronge, E. (2002), online
18
Bundeskammer und einige andere Partner gegründet, um Wissenschaftlern und
Unternehmern bei der Umsetzung ihrer Forschung in die Anwendung behilflich zu
sein.
Mit Hilfe des im Mai 1999 gestarteten ,,Biotechnologie Impuls Programms" soll die
Innovationsagentur die Neugründung von Biotech-Firmen durch qualifizierte
Beratung (bezüglich Patentierung/Lizenzierung, Businessplanerstellung, Kapital-
beschaffung, usw.) und finanzielle Unterstützung vorantreiben.
Im Zuge des Impuls-Programms ist das ,,Biotech Funding and Financing Network"
entstanden, das neben Banken, Venture Capital-Gesellschaften und Förder-
institutionen auch regionale Partner (z.B. die ,,Vienna Business Agency", VBA)
miteinander vernetzt.
Die finanzielle Förderung für Start-ups beläuft sich auf bis zu 10 Mio. ATS im
Rahmen des ,,Seedfinancing Programms, bzw. auf bis zu 5-20 Mio. ATS durch den
,,Uni Venture Fund" der Innovationsagentur.
Weiters unterstützt auch das Technologielizenzbüro Tecma Wissenschaftler der
Universitäten und Unternehmer bei der Vermarktung viel versprechender Produkte,
bei Patentproblemen und bei der Kontaktierung industrieller Partner.
Weitere Förderagenturen, wie z.B. der ,,Fonds zur Förderung der gewerblichen
Forschung" (FFF) unterstützen die Kommerzialisierung der Biotechnologie durch
Bereitstellung finanzieller Mittel für Start-ups und Klein- und Mittelbetriebe.
Im Jahr 1999 stellte der FFF dafür 28 Mio. Euro, die Vienna Business Agency
durch das so genannte ,,Innova Programm" weitere 5,3 Mio. Euro zur Verfügung.
Das ,,Büro für Internationale Forschung und Technologie Kooperation" (BIT) ist eine
Initiative von sieben Bundesministerien, der Wirtschaftskammer und allen namhaften
österreichischen Wissenschaftsorganisationen. Das BIT stellt ein nationales
Informations- und Service-Zentrum für alle internationalen Forschungs- und
Technologieprogramme inklusive dem Bereich der Life Sciences dar. Hauptaufgabe
des BIT ist die Beteiligung Österreichs an internationalen RTD (Research,
Technological Development and Demonstration) Aktivitäten, wie z.B. dem
Europäischen RTD Rahmenprogramm und die Förderung von internationalen RTD
Kooperationen.
Während der letzten Jahre konnte sich in Wien ein bedeutsames Kompetenzzentrum
für Biotechnologie ansiedeln. Das ,,Vienna Biocenter" (VBC) ging aus 5 universitären
Instituten, dem Institut für Molekulare Pathologie und 8 Biotech- Start-ups hervor.
19
Durch die Mithilfe der Innovationsagentur konnten bis heute mehrere neue Biotech-
Firmen gegründet werden. Inzwischen hat die VBC rund 700 wissenschaftliche
Mitarbeiter aus über 40 Ländern.
2.5 Die Branche Biotechnologie
Die Charakteristika der Branche Biotechnologie sind hauptsächlich die folgenden:
16
Technikdeterminanten:
Strukturdeterminanten:
Wissenschaftsbindung
KMU
Multidisziplinarität
Biotechnologie als Teilaktivität
Modulstruktur
Begrenzte Mittel für Forschung und
Entwicklung
Entwicklungsdynamik
Abbildung 1 : Technik- und Strukturdeterminanten für Innovationsaktivitäten in der
Biotechnologie
·
Die hohe Wissenschaftsbindung in der Biotechnologie bedeutet, dass sie in
besonderem Maße an die wissenschaftliche Forschung gekoppelt und von ihr
abhängig ist.
·
Der multidisziplinäre Charakter ergibt sich aus den verschiedenen
Wissenschaftsdisziplinen, die in die Biotechnologie einfließen, sowie aus ihren
ebenfalls zahlreichen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Die
Biotechnologie stellt eine Querschnittstechnologie aus der Kombination einer
Vielzahl von Disziplinen dar. Die gemeinsame Technologiebasis entwickelt
sich rasant und ermöglicht laufend weitere Innovationen. Die Biotechnologie
umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen (Pharma, Umwelt, Chemie,
Lebensmittel, Energie) und Sektoren (Industrie, Landwirtschaft,
Dienstleistung). Daraus folgen unterschiedliche Nachfragebeziehungen.
16
Reiß, T. (1997), S. 78
20
Doch weltweit ist die Pharmaindustrie vorherrschend, die Therapeutika,
Vakzinen, Diagnostika erzeugt und Produktions- und Analyseverfahren
anwendet.
·
Die modulare Produktionsstruktur drückt aus, dass Biotechnologie keine
Großtechnik darstellt, sondern dass biotechnologische Produktion oder
Verfahren in kleinen Einheiten (Bioreaktoren) durchgeführt werden können.
Bei Kombination von mehreren Technikmodulen ergeben sich komplexere
Konstrukte. Eine unvermeidbare Folge sind wesentlich größere Verflech-
tungen und Ankopplungsschnittstellen im Vergleich zu Großtechniken.
Der gesamte Markt wächst- je nach Anwendungs- und Definitionsbereich der
Studie- mit 10-40% pro Jahr, und wird im Jahre 2005 in Europa ein Volumen
von 100-300 Mrd. DM zu erreichen.
17
·
Aus den Technikdeterminanten resultiert eigentlich der Zwang zu größeren
Unternehmenseinheiten. Die Struktur steht jedoch in Österreich dagegen.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit zu F&E Kooperationen zwischen
Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Forschungsinstitutionen.
18
·
Eine der wesentlichen Strukturdeterminanten ist die Dominanz von Klein- und
Mittelbetrieben und die Organisation der Biotechnologie in Großunternehmen
als kleine Einheiten (Spin-offs).
·
Ein weiteres Charakteristikum der Biotechnologie stellt der finanzielle Aspekt
dar. Durch die schwer abschätzbaren und beurteilbaren Potentiale der
neuartigen Technologie-/Marktkombinationen sind Investoren kaum in der
Lage, zukünftige Zahlungsströme abzuschätzen. Oft übertragen sich
Informationen, die sich auf einzelne Unternehmen beziehen, wie zum Beispiel
die Zulassung oder Nichtzulassung von Medikamenten, auf die gesamte
Branche. Daher ergeben sich stark zyklische Schwankungen für
Biotechnologieunternehmen, Börsenkapital aufzunehmen. Phasen, in denen
die Kapitalaufnahme bedeutend einfacher als sonst ist, werden als ,,Financing
Windows" oder ,,Hot Markets" bezeichnet und lagen für die Biotechnologie in
den Jahren 1983, 1986, 1991 und 1992 vor.
19
17
vgl. Streck (1994), S. 52f zit. nach Freier, P. (2000), S. 85
18
vgl. Kulicke, M/ Menrad, K/ Wörner, S. (2002), online
19
vgl. Deeds/Decarolis/Coombs (1997), S. 40 zit. nach Freier, P. (2000), S. 87
21
Typisch für die Strukturen ist die begrenzte Verfügbarkeit von Forschungs-
und Entwicklungsmitteln.
20
Das ist ein weiterer Grund, warum viele kleine
Biotech-Start-ups Kooperationen eingehen.
·
Weiters werden für die Biotechnologie die gesellschaftlichen Ansprüche immer
wichtiger. Die Bevölkerung macht sich durch Proteste immer stärker
bemerkbar.
·
Doch neben der Zustimmung der Bevölkerung (Aufklärungskampagnen,
Diskussionsforen etc.) müssen Produkte und Verfahren auch behördlich
genehmigt werden. Ethische und gesetzliche Grenzen in der Anwendung der
Biotechnologie müssen in den Bereichen der Nutzung von humangenetischer
Information, der Keimbahntherapie (d.h. Gentransfer in menschliche
Keimzellen) und dem Klonen von Menschen (d.h. der gezielten Erzeugung
genetisch identischer Menschen) beachtet werden.
20
Reiß, T. (1997), S. 78
22
3 Unterschiede von Klein- und Mittelbetrieben und
Großbetrieben
Da Biotech-Unternehmen typischerweise Klein- und Mittelbetriebe sind, ist es
sinnvoll, im folgenden KMUs von Großbetrieben abzugrenzen. Es muss jedoch
hinzugefügt werden, dass aufgrund des hoch technologisierten Produkts bzw.
Dienstleistung einige Merkmale des Pfohl´schen und Mugler´schen Kataloges auf
Biotech-Unternehmen nicht mehr anzuwenden sind.
3.1 Quantitative Abgrenzung
Es wurde jene quantitative Abgrenzung angeführt, die zwar nicht formal verbindlich,
aber aufgrund ihrer starken Standardisierungskraft geeignet ist.
Sie stammt vom 3. April 1996 und wurde von der Europäischen Kommission
empfohlen (96/280/EG, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 30.4.1996,
Nr. L 107, S. 4-9 inklusive Anhang).
21
Diese Abgrenzung ist grundsätzlich auf drei Merkmale aufgebaut: Beschäftigte,
Umsatz oder Bilanzsumme und Unabhängigkeit.
Als unabhängig gelten Unternehmen, die nicht zu 25% oder mehr des Kapitals oder
der Stammanteile im Besitz von einem oder von mehreren Unternehmen gemeinsam
stehen, welche die Definition der KMU bzw. der kleinen Unternehmen nicht erfüllen.
Es bestehen zwei Ausnahmen:
Wenn das Unternehmen im Besitz von öffentlichen Beteiligungsgesellschaften,
Risikokapitalgesellschaften oder institutionellen Anlegern steht und diese weder
einzeln noch gemeinsam Kontrolle über das Unternehmen ausüben.
Wenn aufgrund der Kapitalstreuung nicht ermittelt werden kann, wer die Anteile hält,
und das Unternehmen erklärt, dass es nach bestem Wissen davon ausgehen kann,
dass es nicht zu 25% oder mehr seines Kapitals im Besitz von einem oder von
mehreren Unternehmen gemeinsam steht, die die Definition der Klein- und Mittel-
unternehmen bzw. der kleinen Unternehmen nicht erfüllen.
21
Mugler, J. (1998), S. 30ff
23
Diese Überschreitung muss allerdings in zwei aufeinander folgenden Geschäfts-
jahren erfolgen, damit das Unternehmen seinen Status eines KMU verliert.
Bei der Beschäftigtenzahl sind Teilzeit- und Saisonarbeiter auf Jahresarbeits-
einheiten umzurechnen.
Mittelunternehmen:
<250 beschäftigte Personen
Jahresumsatz< 40 Mio. ECU
Jahresbilanzsumme< 27 Mio. ECU
Kleinunternehmen:
<50 beschäftigte Personen
Jahresumsatz< 7 Mio. ECU
Jahresbilanzsumme<5 Mio. ECU
Kleinstunternehmen:
<10 beschäftigte Personen
Keine Abgrenzung nach Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme.
Für statistische Zwecke wird allerdings nur die Abgrenzung nach
Beschäftigtenzahlen angewendet. Die Kommission verlangt daher für statistische
Zwecke folgende Größenklassen zu verwenden.
0 Beschäftigte
1-9 Beschäftigte
10-49 Beschäftigte
50-249 Beschäftigte
250-499 Beschäftigte
500 und mehr Beschäftigte
24
3.2 Qualitative Abgrenzung
Das folgende Zitat macht deutlich, warum es nicht reicht, KMUs und Großbetriebe
lediglich quantitativ abzugrenzen. Denn für das Management in KMUs sind andere
betriebswirtschaftliche Prinzipien heranzuziehen als in Großbetrieben: A small
business is not a little big business.
22
Es wird hier sowohl auf den Pfohl´schen Merkmalskatalog als auch auf den
Mugler´schen eingegangen.
3.2.1 Pfohl´scher Merkmalskatalog
Es bietet sich eine Gegenüberstellung entsprechender Betriebstypen an, weil die
Gestaltungsempfehlungen überwiegend in Form von Tendenzaussagen zu erwarten
sind.
23
Aus demselben Grund kann man auch auf die Ziehung scharfer
Klassengrenzen verzichten und ohne Schwierigkeiten mehrere Merkmale zur
Beurteilung der Größe eines Betriebes verwenden.
In Anlehnung an die übliche Gliederung betrieblicher Tätigkeiten lassen sich die
ausgewählten Merkmale den Bereichen Unternehmensführung, Organisation,
Beschaffung, Produktion, Absatz, Entsorgung, Forschung und Entwicklung,
Finanzierung, Personal und Logistik zuordnen.
Man kann folglich leichter beurteilen, ob es sich in bestimmten Bereichen eher um
den typischen KMU oder eher den typischen Großbetrieb handelt.
Unternehmensführung:
Klein und Mittelbetriebe
Großbetriebe
Eigentümer-Unternehmer
Manager
Mangelnde
Unternehmensführungskenntnisse
Fundierte
Unternehmensführungskenntnisse
Technisch orientierte Ausbildung
Gutes technisches Wissen in
Fachabteilungen und Stäben verfügbar
22
Nevares, J. (2002), online
23
Pfohl, E. (1997), S. 18
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832465049
- ISBN (Paperback)
- 9783838665047
- DOI
- 10.3239/9783832465049
- Dateigröße
- 752 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Wirtschaftsuniversität Wien – Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2003 (März)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- klein- mittelbetriebe grundforschung ansatz spin-off split-off start-up genforschung biotechnologie
- Produktsicherheit
- Diplom.de