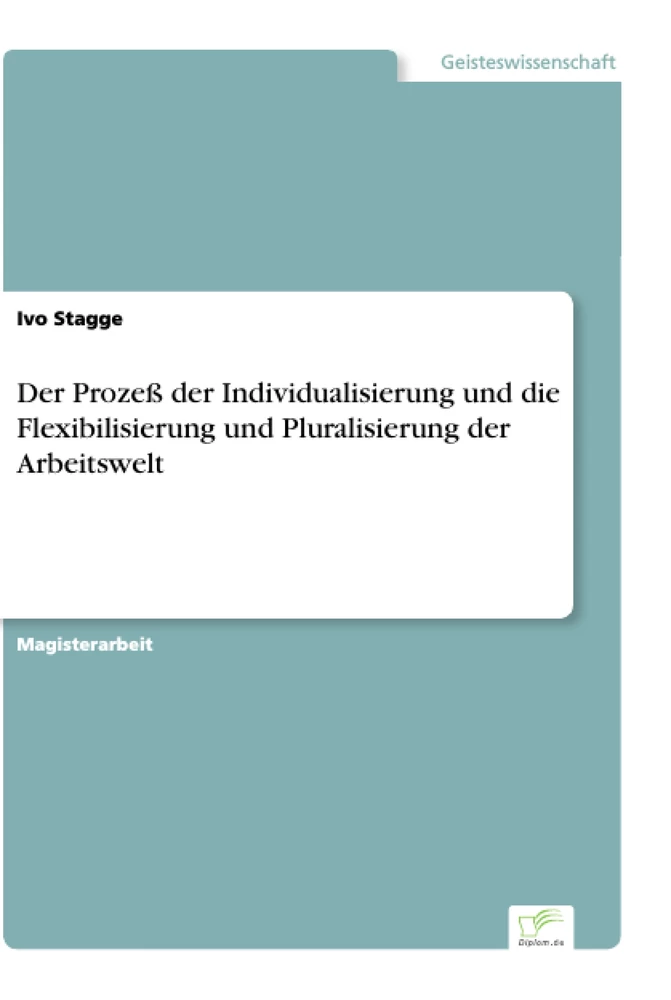Der Prozeß der Individualisierung und die Flexibilisierung und Pluralisierung der Arbeitswelt
Zusammenfassung
Der Individualisierungsprozess und die Flexibilisierung sowie Pluralisierung der Arbeitswelt sind aktuelle Entwicklungen, die zusammengehören.
Die gesellschaftlichen Akteure müssen sich zunehmend einem Arbeitsmarkt anpassen, der Flexibilität, Mobilität und lebenslanges Lernen verlangt. Umgekehrt sehen sich auch die Unternehmen mit einem schnell wandelnden Markt konfrontiert, der von ihnen Anpassungsfähigkeit, Innovation und Serviceorientierung erfordert. Deshalb bieten sie verstärkt Arbeitsplätze an, die ein hohes Maß an Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Kreativität und Kundenorientierung beinhalten.
Diese flexiblen Arbeitsmarktanforderungen in Verbindung mit dem Individualisierungsprozess führen zu erheblichen geographischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Gesellschaft. Die traditionellen Sicherheiten in Bezug auf Arbeitsplatz, Geschlechterrollen, Familienbindung und persönlicher Identität lösen sich nach und nach auf. An ihre Stelle treten neue Formen der Partnerschaft, des familiären Zusammenlebens und der individuellen Lebensführung. In diesem Zusammenhang ist der Einzelne zunehmend entwurzelt, da die traditionellen Sinnangebote und verbindlichen Lebensmuster nicht mehr allgemein gültig sind. Vor diesem Hintergrund müssen sich die Menschen ihre eigenen Identitäten und Lebenswelten zunehmend selbst erschaffen und zusammenbauen. Hierbei sehen sie sich mit einer Vielzahl von Sinnangeboten und Werten konfrontiert, die die Gesellschaft ihnen in unterschiedlicher Form täglich zur Verfügung stellt, sei es durch Medien, Berufe, Bildung, Freunde oder Freizeitaktivitäten.
Auf der Ebene der Erwerbsarbeit wird das Normalarbeitsverhältnis mit seinen Grundzügen wie lebenslange Anstellung und Arbeitsplatzsicherheit von einer risikoreichen Erwerbsbiographie abgelöst, die ständige Qualifizierung, geographische Veränderung und Arbeitsplatzwechsel beinhalten kann. Diese Anpassung an einen flexiblen Arbeitsmarkt kann darüber hinaus berufliche Neuorientierung, mehrfache Arbeitslosigkeit, Mobilität und daraus folgend erhöhten Abstimmungsbedarf in der Familie bzw. im Privatleben für die Menschen zur Folge haben. Hierbei wird der gesellschaftliche Akteur zunehmend auf sein eigenes Arbeitsmarktschicksal verwiesen, dessen Risiken und Anforderungen er eigenständig bewältigen und verantworten muss.
Diese Magisterarbeit analysiert die Besonderheiten der Individualisierung, die aktuellen Entwicklungen einer […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung.
2. Familie und Erwerbsleben der Nachkriegszeit in Deutschland
2.1 Traditionelle Bindungs- und Herrschaftsverhältnisse
2.1.1 Funktion der Familie
2.1.2 Die Rolle der Frau im Familienverbund und auf dem Arbeitsmarkt
2.2 Soziale Marktwirtschaft und Wirtschaftswachstum
2.2.1 Eine auf dem Prinzip des Taylorismus aufgebaute zentralisierte Organisationsstruktur der Produktionsstätten
2.2.2 Standardisierte und starre Erwerbsbiographie
2.3 Industriegesellschaftliche Lebensform
3. Gesellschaftliche Ursachen für die Individualisierung
3.1 Erhöhte Spielräume durch veränderte arbeitsrechtliche Regelungen
3.1.1 Neue Arbeitsplatzanforderungen im Zuge einer veränderten Wirtschaftsstruktur
3.2 Die Entstehung von Massenkaufkraft und gleichzeitige Erweiterung der Handlungsspielräume
3.2.1 Ausdifferenzierung der Konsummöglichkeiten und Aufwertung des privaten Raums
3.3 Bildungsexpansion und soziale Mobilität
3.4 Arbeitslosigkeit als privater Risikofaktor
3.5 Veränderung der Lage der Frauen
3.5.1 Herauslösung der Frauen aus festen Lebensläufen
3.5.2 Weibliche Erwerbstätigkeit im Wandel
4. Kennzeichen von Individualisierung heute32
4.1 Ausdifferenzierung der täglichen Rollenmuster und Erhöhung der Sinnangebote
4.2 Bastelexistenz
4.3 Wandel von Familienverhältnissen
4.3.1 Komplexe Lebenswelt von erwerbstätigen Partnern
4.3.2 Scheidung als Auslöser für die Pluralisierung von Lebensmustern
4.4 Erlebnisorientierung und die Herausbildung neuer Werte
5. Wandel der geschlechtsspezifischen weiblichen Lebensformen
5.1 Die Bedeutung der Hausarbeit für die weibliche Biographie
5.2 Pluralisierung der Beziehungsformen und Haushaltsstrukturen
5.3 Frauen zwischen Beruf und Familie
5.3.1 Mögliche Modelle junger Frauen für eine neue Lebensplanung
5.4 Teilzeitarbeit im weiblichen Lebenszusammenhang
6. Flexibilisierung von Arbeitsabläufen und das Auflösen traditioneller Arbeitsverhältnisse
6.1 Von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft
6.1.1 Neue Arbeitsplatzanforderungen an die Beschäftigten und die Durchdringung des Arbeitsmarktes mit Informationstechnologien
6.2 Verbesserung der Produktion durch Dezentralisierung und Optimierung der Arbeitsorganisation
6.2.1 Die schlanke Produktion
6.2.2 Weitere Konzepte der Gruppenarbeit
6.3 Die Erosion des Normalarbeitsverhältnis
6.3.1 Die Scheinselbständigkeit im Zuge von interaktiver Kommunikation
6.4 Arbeit als Element von Identität und subjektiver Befriedigung
6.5 Unternehmenskultur
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis
1. Einführung
In dieser Magisterarbeit soll der Prozess der Individualisierung in seinen vielfältigen Ausprägungen in Verbindung mit der Flexibilisierung und Pluralisierung der Arbeitswelt dargestellt werden. Hierbei werden zunächst die familiären und beruflichen Verhältnisse in den fünfziger und sechziger Jahren in der Bundesrepublik Deutschland beschrieben. Im weiteren Verlauf wird dann der Individualisierungsprozess mit seinen Ursachen und Konsequenzen dargestellt. Im Rahmen einer Analyse der aktuellen wirtschaftlichen und beruflichen Entwicklungen und Verhältnisse werden auch Zusammenhänge zwischen dem Individualisierungs- und Arbeitsprozess aufgezeigt.
Die gesellschaftliche Individualisierung und die Pluralisierung der Arbeit sind zwei Prozesse, die eng miteinander verknüpft sind. Wir befinden uns in einer Phase, in der sich traditionelle Lebensmuster und Biographien auflösen und von unstandardisierten, unvorhersehbaren Lebensentwicklungen abgelöst werden. Die Veränderungen in der Arbeitswelt haben ganz entscheidenden Anteil daran. Die Menschen müssen sich verstärkt einem Arbeitsmarkt anpassen, der Flexibilität, Mobilität und ständige Qualifizierung erfordert. Diese Anforderungen dringen unmittelbar in die private Sphäre ein und führen zu neuen Mustern der Lebensorganisation. Die klare Trennung von Beruf und Familie, im Sinne einer eindeutigen Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau, fängt an brüchig zu werden. Die traditionellen Familienbeziehungen lösen sich auf und werden durch neue, unübersichtliche Beziehungsmuster abgelöst.
Die einzelnen Lebensplanungen der Familienmitglieder müssen miteinander gestaltet und abgestimmt werden. „Die Familie wird eher zur Wahlgemeinschaft, zum Verbund von Einzelpersonen, die ihre je eigenen Interessen, Erfahrungen, Lebenspläne einbringen, auch je eigenen Kontrollen, Risiken, Zwängen ausgesetzt sind“.[1] Individualisierung eröffnet den Menschen einerseits Chancen, ein selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Leben zu führen, unabhängig von traditionellen Bindungen, aber andererseits entwickeln sich auch Risiken und Unsicherheiten, die von den Menschen eigenständig verarbeitet werden müssen. Vor allem die weiblichen Lebensmuster werden von diesen Entwicklungen verändert, denn ihre verstärkte Arbeitsmarktorientierung im Zuge weiterbestehender Familienpflichten führt bei ihnen zu einer ambivalenten Situation.
2. Familie und Erwerbsleben der Nachkriegszeit in Deutschland
In diesem Kapitel geht es um die gesellschaftlichen Entwicklungen der fünfziger und sechziger Jahre in Deutschland, in dessen Zeitraum sich eindeutige, feste Muster im Erwerbsleben, der Familie und der Lebensführung gebildet haben. Das Leben war in der Nachkriegszeit zunächst geprägt durch Mangel an Nahrungsmitteln und Kleidung.[2] Der Konsum beschränkte sich im wesentlichen auf das Notwendigste und diente hauptsächlich zur Deckung der Grundbedürfnisse. Es ging überwiegend darum, aufgrund der noch vom Krieg geprägten instabilen Situation, einen Ort zu finden, der Sicherheit und Schutz bot. Dieses Empfinden war entscheidend für die Restauration der traditionellen Kleinfamilie, die den Menschen Geborgenheit und Ordnung geben konnte.[3]
Im Rahmen dieser Entwicklung setzte sich bei den Eheleuten auch allmählich eine Emotionalisierung in der Partnerschaft durch, wonach beide Partner eine gleichberechtigte Stellung in der Ehe einnehmen sollten.[4] Die industrielle Kleinfamilie entwickelte sich zum zentralen Ort für Gespräche und den Austausch von Meinungen für die Menschen und führte auch zu einer Abkapselung von anderen Geschehnissen. Diese prägende Familienform der Nachkriegszeit hatte relativ klare Strukturen und Rollenbilder und ist das Fundament, auf dem Pluralisierungen von Lebensformen stattgefunden haben.
Neben den familiären Ausprägungen spielt auch die Erwerbstätigkeit, als zweiter zentraler Bezugspunkt, für die heutige Ausdifferenzierung der Gesellschaft eine entscheidende Rolle.
Aus diesem Grund ist die Beschreibung jener epochalen gesellschaftlichen Lebensform für das Verstehen der gegenwärtigen Veränderungen ein zentraler Punkt. Es geht im folgenden um die Darstellung dieser beiden zentralen Bereiche der Lebensführung
2.1 Traditionelle Bindungs- und Herrschaftsverhältnisse
Im Zuge des markwirtschaftlichen Kapitalismus mit seinem starken Wirtschaftsaufschwung in den fünfziger und sechziger Jahren wurde das Modell der industriellen Kleinfamilie als grundlegendes Familienbild in der Gesellschaft verankert. Hierbei kommt das Prinzip des freien Lohnarbeiters zur Geltung, der seine Arbeitskraft an die Unternehmen verkaufen muss. Die daraus resultierende Trennung von Wohnort und Arbeitsplatz war wesentlich für die Normierung der Kleinfamilie. Denn sie bot den Menschen einen sozialen Raum, in dem sie isoliert von den anderen gesellschaftlichen Ereignissen, Schutz und Sicherheit fanden.
„Die Funktionen der Kernfamilie wurden überwiegen auf Wohnen, Konsum, Erziehung und partnerschaftliche Solidarität reduziert“.[5] Diese Form des Zusammenlebens war ein gesellschaftliches quer durch die verschiedenen sozialen Gruppen übergreifendes anerkanntes Modell und prägt noch heute zu einem erheblichen Teil unser Gesellschaftsbild. Das Modell der Kleinfamilie hatte ihren Ursprung im historischen bürgerlichen Familienbild, das die Ehe als intime Verbindung mit lebenslanger Treue und Verantwortung der Eltern für die Kinder sah.[6] Erst in den fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurde dieses Bild der Familie von den breiten Bevölkerungsschichten angenommen. So hielten noch in den frühen sechziger Jahren 90% der Frauen und Männer die Ehe für eine unverzichtbare Institution.[7]
Die Rollenaufteilungen in der Familie waren relativ klar strukturiert, so galt der Ehemann als Familien Ernährer, der mit seiner Arbeitskraft überwiegend die materielle Versorgung der Frau und Kinder sicherstellte, wohingegen die Ehefrau für den privaten und häuslichen Bereich verantwortlich war.[8] Sie kümmerte sich um den Haushalt und verrichtete dabei häufig wiederkehrende, monotone Tätigkeiten, die sie allerdings selbständig und autonom, ohne Kontrolle von anderen ausübte.[9] Nach der Schule oder Ausbildung wurde in der Regel bereits in jungen Jahren geheiratet, Kinder geboren und das Leben an der Seite des Mannes verbracht. Ein solcher Lebensverlauf war typisch für die damalige Zeit und prägte die weibliche und männliche Biographie.
Diese Reproduktionsaufgaben wurden von der Gesellschaft als selbstverständlich angesehen und genossen keine allzu große Anerkennung, da sie als unproduktiv galten und nicht entlohnt wurden.[10] Das Modell der Kleinfamilie war ein allgemein akzeptiertes Modell und hatte Unterstützung von den großen gesellschaftlichen Institutionen wie Kirche, Staat, Verbänden und Gewerkschaften.
Die damalige CDU Regierung Anfang der fünfziger Jahre legte Wert darauf dieses Familienmodell zu etablieren und versuchte durch gesetzliche Regelungen kinderreiche Familien zu fördern. Mit Kindergeld, Steuerfreibeträgen, Familienermäßigung bei der Bundesbahn oder Muttererholung sollte die ökonomische Situation von Familien verbessert und Anreize geschaffen werden mehr Kinder in die Welt zu setzen.[11] Außerdem sollte dadurch Frauenarbeit verhindert werden.
Diese Funktion stellt jedoch einen Unterschied zu der vorindustriellen Zeit dar, in der die Familie zu Hause als Produktionseinheit arbeitete, wohnte und gemeinsam die notwendigen Ressourcen erwirtschaftete. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieses Modell der familiären Wirtschaftseinheit, im Rahmen der Industrialisierung, langsam von der industriellen Familie abgelöst.[12]
2.1.1 Funktion der Familie
Die Familie wurde zunehmend ein privat geschützter Raum, in dem der Mann einen emotionalen Bereich auffand, der ihm die Gelegenheit bot in einer vertrauten Umgebung Abstand zu gewinnen von der überwiegend zweckrational geprägten, anstrengenden Arbeitswelt.[13] Die hier entstehende soziale Sphäre, in der man sich von den übrigen Geschehnissen abkapseln konnte, war auch dazu geeignet, in einer persönlichen abgeschlossenen Welt eigene Werte und Interessen zu formulieren. Denn die Trennung der beiden Lebenspartner in zwei verschiedene Realitäten, den häuslichen und erwerbstätigen Bereich, ermöglicht jedem zumindest eine Zeitlang Abstand voneinander zu nehmen.[14] Durch die tägliche Kommunikation zwischen den Partnern in der eigenen Wohnung konnten Erlebnisse des Mannes an der Arbeit auf familienspezifische Weise verarbeitet werden.
Die Familie entwickelte sich also zum entscheidenden Milieu für die Herausbildung von Identität und Freizeit.
Dennoch gab es nicht die von der Frau gewünschte Gleichstellung, sondern eine männlich dominierte Gemeinschaft. Zwar prägte Zuneigung und Emotionalität das Beziehungsideal und die Partnerwahl, jedoch war die Beziehung der beiden Geschlechter von Ungleichheit geprägt, weil die männliche Erwerbstätigkeit durch ihre ökonomische Versorgungsleistung einen höheren Stellenwert als die weibliche Hausarbeit hatte. Die dadurch entstandene persönliche und materielle Abhängigkeit der Frau von ihrem Partner führte zu einem Machtungleichgewicht zugunsten des Mannes.[15]
Insofern kam es oft zu patriarchalischen, autoritären Verhaltensweisen und Führungsstilen des Mannes, der von der Familie Loyalität und Anerkennung erwartete. In diesem Sinne spielte vor allem die fehlende rechtliche Anerkennung weiblicher Erwerbstätigkeit eine wichtige Rolle. Frauen sollten nur dann eine Berufstätigkeit aufnehmen, wenn diese nicht die ehelichen und familiären Pflichten vernachlässigte. Deswegen bestimmte weitgehend der Ehemann, ob die Frau erwerbstätig wurde oder nicht.
Diese gesetzliche Verpflichtung der Frau für die Hausarbeit wurde erst 1977 zugunsten einer gleichberechtigten Berufstätigkeit geändert.[16]
Ein weiteres Merkmal für diese sozialen Unterschiede war die männlich dominierte Namensgebung bei der Eheschließung, die erst 1977 in ein gleichberechtigtes Namensrecht umgeändert wurde oder die gesetzlich festgelegte Regelung, dass der Ehemann das letzte Entscheidungsrecht bei Erziehungsangelegenheiten hat.[17] Außerdem war die Stellung von unverheirateten Müttern noch bis 1969 sehr schwach, da sich der Vater seiner Unterhaltspflicht entziehen konnte. Ebenso lag die Verwaltung und Nutzung des ehelichen Vermögens noch bis 1958 allein beim Mann.
Neben diesen Regelungen, die das ungleiche Verhältnis zwischen Mann und Frau ausdrückten, war auch die Bildungssituation und Erwerbstätigkeit in den fünfziger und Anfang der sechziger Jahren kennzeichnend für eine „schwache Stellung“ der Frau in der Gesellschaft.
Der Arbeitsmarkt in dieser Zeit war überwiegend auf die Männer zugeschnitten, was sich auch in der Bildung widerspiegelte. Da in der maskulinen Normalbiographie Erwerbstätigkeit vorgesehen war und tatsächlich auch weitaus mehr Männer als Frauen berufstätig waren, hatten Männer auch einen leichteren Zugang zu der Ressource Bildung. Zumal der weibliche Lebensverlauf noch bis in die siebziger Jahre hinein darauf angelegt war, in die Ehe einzutreten und Kinder zu bekommen, weshalb für Frauen eine gute Ausbildung nicht unbedingt benötigt wurde.[18] Diese Entwicklung zeigt sich auch bei den höheren Schulabschlüssen, wonach der Anteil weiblicher Abiturientinnen 1960 nur 35,5% betrug.[19]
2.1.2 Die Rolle der Frau im Familienverbund und auf dem Arbeitsmarkt
Eine wichtige Funktion der Frau war neben der Hausarbeit das Aufziehen der Kinder. Die primär weibliche Verantwortung für die Kinder ergab sich aus der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, wonach der Mann den Großteil des Tages an seinem Arbeitsplatz verweilte und die Frau im Haushalt tätig war. Dieses Modell der „fürsorglichen Mutter“ war gesellschaftlich anerkannt und wurde auch von den Frauen befürwortet, die durch ihre häusliche Rolle und dementsprechend verfügbaren Zeitbudget eine enge Beziehung zu ihren Kindern aufbauen konnten.[20] Hierbei ging es nicht nur darum, „nebenbei“ die Kinder zu erziehen, sondern sie in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern und ihnen Zuneigung und Unterstützung zu geben.
Neben der Mutterrolle hatte die Frau auch die Aufgabe, den Ehemann bei der Regeneration seiner Arbeitskraft zu unterstützen und ihm zu Hause Geborgenheit und Aufmerksamkeit entgegenzubringen.[21] Die weibliche Funktion in der Familie hatte somit neben der körperlichen auch eine ausgeprägte psychische Dimension, da einerseits das Aufziehen der Kinder und andererseits die Erholung des Ehemannes eine wichtige Rolle spielten. Diese psychische Reproduktionsaufgabe bekam noch durch die Ausweitung technischer Haushaltsgeräte zwischen 1950 und 1960 einen zusätzlichen Schub, weil diese Entwicklung die Hausarbeit erleichterte.[22]
Die Rolle als Mutter hatte Auswirkungen auf die weiblichen Vorstellungen gegenüber dem Erwerbsleben, denn ein Kind war in den Augen vieler Frauen ein Auslöser, die eigene Erwerbstätigkeit zu beenden und sich ganz auf die Erziehung der Jungen und Mädchen zu konzentrieren. Jedoch konnte diese Wunschvorstellung nur von einem Teil der verheirateten Frauen realisiert werden, da ihre Erwerbstätigkeit aus ökonomischen Gründen für die Familie notwendig war.[23]
Somit war ein erheblicher Teil der verheirateten Frauen von ca. 30% berufstätig.[24] Allerdings wurden ihre Tätigkeiten im Vergleich zum Ehemann als nachgeordnet angesehen und dienten lediglich der ökonomischen Existenzsicherung der Familie.[25] Zudem beschränkte sich ihre Berufstätigkeit auf überwiegend unqualifizierte und einfache Arbeiten. In dieser Hinsicht wird deutlich, dass die berufliche Orientierung eindeutig der Funktion als Mutter oder Ehefrau nachgeordnet war und die Erwerbstätigkeit nicht das grundlegende Ziel weiblicher Biographie darstellte. „Die Erwerbstätigkeit von Müttern verstieß gegen die Norm und wurde in der Öffentlichkeit mit einer stark negativen Betonung diskutiert“.[26]
Dennoch wurden Frauen zu begehrten Arbeitskräften, was vor allem durch den starken wirtschaftlichen Wachstum in den sechziger Jahren zu erklären ist. Denn die positive Konjunkturentwicklung mit einhergehendem Arbeitskräftemangel sollte vor allem durch weibliche Arbeitskräfte kompensiert werden.
2.2 Soziale Marktwirtschaft und Wirtschaftswachstum
In diesem Kapitel der Arbeit möchte ich mich im wesentlichen auf das Erwerbsleben in der industriellen Massenproduktion beschränken, da diese Produktionsform einen großen Teil der Beschäftigungsmöglichkeiten in den fünfziger Jahren ausmachte. Die soziale Markwirtschaft konnte, aufgrund des Zusammenbruchs des preußisch-deutschen Einheitsstaates 1945, in dieser Zeit neu geregelt werden.[27] Ihre Anfänge hatte sie jedoch schon in den zwanziger Jahren, wo bereits neue sozialrechtliche Maßnahmen getroffen wurden, wie z.B. Einführung des Normalarbeitstages oder betriebliche Mitbestimmung, die den Arbeitern und ihren Familien mehr soziale Sicherheit zubilligten.[28]
Jedoch erst in den fünfziger Jahren, im Rahmen relativ gesicherter politischer Verhältnisse, konnte die soziale Marktwirtschaft in ein föderales, freiheitliches und demokratisches Rechtssystem eingebunden werden, in dem sich eine florierende Wirtschaft entwickelte.[29] Die soziale Marktwirtschaft ist gekennzeichnet durch ein Gewinn- und Konkurrenzprinzip, das die Unternehmen zu einem Wettbewerb mit anderen Firmen zwingt. Hier kommt es zu einer Wechselbeziehung zwischen den privaten Haushalten und den Wirtschaftsbetrieben. Der Beschäftigte erhält für seine Arbeitsleistung im Unternehmen finanzielle Ressourcen, die er wiederum in die von den Betrieben angebotenen Güter investiert. Deren Ziel es ist, einen möglichst großen Absatz ihrer Produkte zu erreichen und somit einen hohen Gewinn zu erwirtschaften.[30] Hierbei agiert der Staat jedoch nicht nur im Sinne der Wirtschaft, sondern bietet viele arbeitsrechtliche Regelungen für die Arbeitnehmer an, um eine bestimmte soziale Absicherung zu garantieren, wie z.B. Arbeitslosengeld, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsgeld, Betriebsräte etc. Diese Maßnahmen führten zu einer zunehmenden Verbindung individueller Lebensläufe mit staatlichen Regelungen.
Die Nachfrage nach Massenkonsumgütern wie Fernseher, Radios, Waschmaschinen, Haushaltsgeräte, Genussmitteln sowie der Export deutscher Produkte, vor allem Autos, sorgte für einen starken wirtschaftlichen Aufschwung.[31] Dadurch kam es seit Mitte der sechziger Jahre annähernd zur Vollbeschäftigung und führte zu einem weitreichenden gesellschaftlichen Wohlstand.
Die Ausweitung vor allem elektronischer Haushalts- und Unterhaltungswaren der Nachkriegszeit seit 1950 war die Grundlage für die Ausweitung der industriellen Massenproduktion. Diese Expansion brachte ein enormes Beschäftigungswachstum z.B. in der Elektronikbranche mit einer Erhöhung des Beschäftigungsanteils von ca. 300.000/1950 auf 800.000/1960.[32]
2.2.1 Eine auf dem Prinzip des Taylorismus aufgebaute
zentralisierte Organisationsstruktur der Produktionsstätten
Die industrielle Massenfertigung in den fünfziger und sechziger Jahren war geprägt von einer Zentralisierung der Produktionsstätten und Rationalisierung der Arbeit. Hierbei war der Taylorismus eine wichtige Grundlagentheorie, der sich viele Unternehmer zu eigen machten.[33] Der Taylorismus bedeutet, dass die Handlungen der Arbeiter in Verbindung mit der Maschine zeitlich und örtlich genauestens geplant und berechnet werden, so dass am Ende das optimale Produktionsergebnis erzielt wird und kein überflüssiger Zeitaufwand entsteht.
Das auf dem Prinzip des Taylorismus aufgebaute Produktionsverfahren hatte also eine großtmögliche Effizienz in der Leistung und ein bestmögliches Produktionsergebnis der Arbeiter zum Ziel. Hierbei spielte die Mechanisierung des Arbeitsplatzes eine wichtige Rolle, weil sie den „Wirkungsrad der eingesetzten Arbeitskraft“ stark erhöht.[34] Riesige Fabriken mit großen Hallen und einer Vielzahl von Beschäftigten ermöglichten den Betrieben die verschiedenen Arbeitgänge- und Zeiten der Arbeitskräfte genau zu überwachen.[35] Die einzelnen Handlungsschritte im Arbeitsprozess wurden detailliert vorgegeben und geplant, um eine möglichst hohe Arbeitsintensität zu gewährleisten.[36]
Eine entscheidende Vereinfachung hierfür war die Fließbandarbeit, wodurch die Ergebnisse nachvollziehbarer und die Kontrollen erleichtert wurden. Dieser Einsatz von Maschinen rationalisierte den Produktionsprozess und führte zu festgelegten Bewegungen. Durch diese Automatisierung der Abläufe wurde die industrielle Produktionsweise im wesentlichen von Funktion und Tempo der Maschine abhängig gemacht. Ein solches Tätigkeitsprofil verlangte zwar hohe körperliche und psychische Anstrengung von den Beschäftigten, aber wenig Vorwissen oder Qualifikationen.
Es ging im wesentlichen darum, einfache Arbeitsabläufe ohne Ablenkung von anderen Geschehnissen zu reproduzieren. Individuelle Identitätsmomente oder Entfaltungsspielräume bei dieser Tätigkeit waren nicht vorhanden, die Hauptmotive zu arbeiten waren der Gelderwerb und der soziale Kontakt zu den Arbeitskollegen. Von Seiten des Betriebes wurde wenig Wert darauf gelegt eine angenehme Arbeitsatmosphäre oder individuellen Handlungsspielraum zu schaffen, um nicht von der eigentlichen Tätigkeit abzulenken. In diesem Zusammenhang verhinderte die strikte Trennung zwischen ausführender und anleitender Arbeit eine Selbstbestimmung des Beschäftigten am Arbeitsprozess und führte dazu, dass der industrielle Arbeitnehmer seine Tätigkeiten komplett in den Dienst der Produktion stellen sollte. Um diese Arbeitsstruktur zu gewährleisten, waren starre, hierarchische Strukturen und Organisationsformen in den Fabriken notwendig, die es ermöglichten, Anweisungen von oben nach unten zu delegieren.
Als Konsequenz dieser Mechanismen entstand eine Kontroll- und Disziplinierungsstruktur, wodurch sich die Verantwortung und Macht in der Fabrik auf einige wenige Personen konzentrierte. Die Führungspersonen trafen weitgehend eigenständig die Entscheidungen über die Arbeitsstruktur und Produktionsleistung sowie die Anschaffung neuer Maschinen, unabhängig von der Meinung der Belegschaft.
2.2.2 Standardisierte und starre Erwerbsbiographie
Diese industrielle Organisationsstruktur bot selten Gelegenheit für Männer und vor allem für Frauen, die berufliche Stellung im Hierarchiegefüge zu verändern und aufzusteigen, da die Position im Betrieb stark durch den persönlichen Ausbildungsgrad fixiert wurde.
Betriebsinterne Weiterbildungsprogramme, so wie heute, waren kaum vorhanden.
Zudem war eine berufliche Neuorientierung der Arbeitnehmer aufgrund der materiellen Familienverpflichtungen äußerst schwierig. Langfristige Anstellung im Betrieb gehörte zu der standardisierten Biographie eines Erwerbstätigen, der sich in der Regel darauf verlassen konnte, an einer Produktionsstätte viele Jahre oder gar ein ganzes Leben lang zu verbringen. Es gab in der Regel arbeitsabhängige und unbefristete Arbeitsverträge mit stabiler Entlohnung je nach Arbeitsleistung und beruflichem Status.[37]
Die Beschäftigten hatten tarifrechtliche Absicherungen, die ihnen Schutz vor Entlassungen, ein angemessenes Gehalt, geregelten Urlaub etc. zusicherten.
Eine entsprechend wichtige Funktion hatten die Gewerkschaften, welche die Interessen der Arbeiterschaft verteidigten und verschiedene sozialrechtliche Regelungen aushandelten. Das damalige industrielle Normalarbeitsverhältnis war also eingebettet in arbeitsrechtliche Leistungen, die ein hohes Maß an Zukunftssicherheit gewährleisteten. Dieses war auch im Interesse der Arbeitgeber, denn sie benötigten langfristig tätige Mitarbeiter.
Ein weiteres Merkmal der industriellen Nachkriegsepoche in Deutschland waren die festen Arbeitszeiten. Die Regelarbeitszeit belief sich mit einigen Schwankungen in den fünfziger Jahren zunächst auf eine 48 Stunden Woche mit sechs Werktagen für die Arbeitnehmer und wurde vertraglich abgesichert.[38] Im Laufe der sechziger und siebziger Jahre reduzierte sich diese Arbeitszeit dann allmählich.
Die Vollzeitarbeit galt als Standard Modell und bot zunächst kaum Spielraum für Flexibilisierung. Aufgrund der festen Arbeitszeiten konnte auch der Alltag detailliert geplant und strukturiert werden. Denn die Organisation der häuslichen Lebenswelt und des Tagesablaufes der Ehefrau waren zum großen Teil von dem Arbeitsrhythmus des Ehemannes geprägt.
Die Lebensgefährtin hatte durch die relativ genauen Arbeitszeitvorgaben die Gelegenheit sich auf die Ankunft des Mannes, z.B. beim Essen Kochen einzustellen. Der Beruf wurde zum bestimmenden Faktor der Lebenswelt der Arbeiter und seiner Familien. Der Arbeitsplatz und die dadurch entstandenen Erlebnisse und sozialen Kontakte prägten die Kommunikation und das Freizeitverhalten in der Familie.
2.3 Industriegesellschaftliche Lebensform
Die Lebensweise der fünfziger und beginnenden sechziger Jahre war zunächst geprägt durch einen begrenzten Spielraum an Freizeitmöglichkeiten. Durch die lange Arbeitsdauer der Männer mit einer körperlich meist sehr anstrengenden Beschäftigung unter schlechten Arbeitsbedingungen (laute Maschinen, dunkle Hallen mit mangelnder Durchlüftung) wurden sie zu großen Regenerationsphasen gezwungen.
Ihre Ehefrauen hatten durch die zeitaufwendige Hausarbeit und Erziehung auch ein hohes Arbeitspensum. Deswegen wurde die freie Zeit zum großen Teil zu Hause im Kreis der Familie verbracht, um Ruhe, Erholung und Entspannung zu finden.[39] Diesem familienzentrierten Leben stand auch anfangs ein geringes Zeitbudget mit vergleichbaren reduzierten Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gegenüber. So war die Fülle an Cafes oder Bars, wie heute, damals noch nicht vorhanden. Vor allem die freien Tage am Wochenende galten als wirkliche Gelegenheit, um auszugehen und sich zu amüsieren. Jedoch gestalteten sich die Wege zu den jeweiligen Veranstaltungen oft als zeitlich hoher Aufwand, denn ein Auto war in den fünfziger Jahren noch kein für die Massen zugängliches Fortbewegungsmittel und die noch schlecht ausgebaute Verkehrsinfrastruktur mit Bus und Bahn erforderten teilweise noch lange Fußmärsche zu den jeweiligen Aktivitäten.
Die Nachfrage nach Produkten war eher durch Einfachheit geprägt, weil auch die entsprechend großen Einkaufsmöglichkeiten mit einer vielfältigen Angebotsstruktur fehlten. Durch die zunächst mangelnde Ausstattung mit Unterhaltungsmedien waren zudem die entsprechenden Verlockungen durch die Werbung wenig ausgeprägt. Die Konsumorientierungen waren weniger durch individuelle Sinnbefriedigung als vielmehr durch Zweckmäßigkeit charakterisiert. Funktionalität und Haltbarkeit waren wichtiger als Ästhetik oder Originalität.
Diese Situation änderte sich seit Ende der fünfziger Jahre, als der Einzug von Unterhaltungselektronik eine Abwechslung in die private Familiensphäre sowie eine veränderte Konsumorientierung erwirkte.[40] Radios und Fernseher wurden zur Standardausrüstung eines bundesdeutschen Haushaltes und trugen maßgeblich zu einer Akzentuierung des häuslichen Milieus bei.[41] Hierbei bildete sich ein eigener Bereich, in dem abgetrennt von dem öffentlichen Leben die Akteure zwanglos und unbeobachtet ihren privaten Raum gestalten konnten.
Jedoch ging es in der Freizeit weniger darum seine Persönlichkeit weiter zu entwickeln, als vielmehr sich in den Sportvereinen zu engagieren, bei amüsanter Fernsehunterhaltung zu vergnügen und zu entspannen oder spazieren gehen. Auch Urlaubsreisen waren nicht mehr nur auf einige gesellschaftliche Gruppen beschränkt, sondern für ein breites Spektrum der Gesellschaft erschwinglich. Trotz der Anhebung des Lebensstandards waren die Lebensstile geprägt von Einfachheit, Sparsamkeit und Funktionalität.
Die traditionellen Wertvorstellungen hatten konservativen Charakter und beinhalteten vor allem Fleiß, Ordnung, Pünktlichkeit und Disziplin. Die lebenslange Ehe als Standartmodell war für die große Mehrheit der Bevölkerung bis in die sechziger Jahre hinein ein selbstverständliches und verpflichtendes Lebensmuster.[42] Diese Vorstellung einer institutionalisierten Bindung verlangte auch die lebenslange Monogamie und Treue, weshalb die Scheidung möglichst vermieden werden sollte. Solche überwiegend kollektiven Lebensmuster waren also lange Zeit prägend für die deutsche Gesellschaft.
3. Gesellschaftliche Ursachen für die Individualisierung
Die Gründe, welche für einen zunehmenden Wandel der Gesellschaft hin zu einer verstärkten Individualisierung geführt haben, sind vielfältig. Sie beruhen nicht nur auf einzelne konkrete Faktoren, sondern umfassen eine große Bandbreite der persönlichen Bezugssysteme. Die grundlegende Voraussetzung für die verstärkte Herauslösung aus traditionellen Bindungsverhältnissen ist die Trennung von Arbeit und Familie.[43] Das Prinzip der abhängigen Lohnarbeit macht den Einzelnen zum Verantwortlichen seiner Arbeitskraft, die er verkaufen muss. In diesem Sinne ist die individuelle Biographie entscheidend von dem Arbeitsmarkt geprägt. Dazu beigetragen hat vor allem der Sozialstaat, der mit der Einführung neuer sozialer und arbeitsrechtlicher Regelungen das Verhältnis zwischen Individuum und Institution dramatisch verändert hat.
„Das Hervortreten von Individualisierung ist damit an gesamtgesellschaftliche (soziale, wirtschaftliche, rechtliche und politische) Rahmenbedingungen gebunden.“[44]
Die familiäre Orientierungs- und Unterstützungsfunktion in bezug auf Lebensplanung, Arbeit, Geld etc. wird durch staatliche Vorgaben und Angebote erweitert.[45] Diese Entwicklung wurde vor allem durch die Einführung der sozialen Marktwirtschaft gefördert und führte zu einer verstärkten Abhängigkeit der Menschen von dem Arbeitsmarkt.[46] Das konjunkturelle Wachstum in den sechziger Jahren verstärkte noch diese Tendenz, weil in dieser Zeit durch die hohe Erwerbsquote ein Großteil der Menschen in vertraglich fixierte Arbeitsverhältnisse eingebunden war. Wirtschaft und Staat sind also zwei prägende Faktoren in der persönlichen Biographie geworden.
Seit den siebziger Jahren kommt es jedoch zu einer verstärkten De-Institutionalisierung des Lebenslaufes. Im Rahmen einer Deregulierung des Arbeitsmarktes verlieren sozial abgesicherte Arbeitsverhältnisse mit unbefristeter Anstellung zunehmend an Bedeutung. Die Beschäftigten müssen sich verstärkt auf flexible, befristete Arbeitsverhältnisse einlassen, die nur für einen bestimmten Zeitabschnitt ihrer Biographie Sicherheit und Orientierung geben. Sie müssen im Rahmen einer kundenorientierten, schnell veränderbaren Marktsituation räumlich, zeitlich und beruflich mobil sein, um sich auf die veränderten Marktbedingungen einzustellen. Die Ausdifferenzierung der Arbeitsverhältnisse in verschiedene Modelle mit teilweise geringer rechtlicher Absicherung löst die Menschen zunehmend aus der staatlichen Abhängigkeit heraus und verweist sie auf ihr eigenes Schicksal.
Diese Mobilität erweist sich als verstärkter Antrieb für die Individualisierung von Lebensläufen. „Die Lebenswege der Menschen verselbständigen sich gegenüber den Bindungen, aus denen sie stammen oder die sie neu eingehen (Familie, Nachbarschaft, Freundschaft, Kooperation), und gewinnen diesen gegenüber eine Eigenrealität, die sie überhaupt erst als ein persönliches Schicksal erlebbar und identifizierbar machen“.[47] Hierbei haben sich die Lebensumstände pluralisiert und zu größeren Entscheidungssituationen für die Individuen geführt.
Diese Ausdifferenzierung der individuellen Lebensmuster wurde vor allem durch die Bildungsexpansion in den sechziger Jahren gefördert, welche zu einer allgemeinen Anhebung der Schulabschlüsse geführt hat.
Im Zusammenhang mit besserer Bildung ist es zu einer Diversifizierung der eigenen Bedürfnisse und zu einer veränderten Rolle der Frau gekommen.[48] Sie hat von dieser Entwicklung am meisten profitiert und mehr Spielraum für die Gestaltung ihrer Zukunft erlangt, weil die daraus resultierende verstärkte Erwerbsorientierung einen neuen Schwerpunkt in ihrer Biographie darstellte. Im Zuge dieser Entwicklung haben auch sich die traditionellen Beziehungsformen in neue, pluralisierte Optionen für das Zusammenleben gewandelt. Bei der Frage nach den Ursachen für die neuen, flexiblen Lebensweisen ist also eine differenzierte Betrachtungsweise der Geschlechter notwendig.
3.1 Erhöhte Spielräume durch veränderte arbeitsrechtliche Regelungen
Der Wandel individueller Lebensgestaltung und die Herauslösung aus traditionellen Mustern sind durch verschiedene Prozesse im Verhältnis Subjekt - Erwerbstätigkeit zu erklären. Die Veränderungen der Beschäftigungszeiten haben die Bewegungsspielräume der individuellen Arbeitsorganisation erhöht. So ist die Arbeitszeit in den letzten fünfzig Jahren enorm gesunken, was bei der tariflichen Wochenarbeitszeit der Arbeiter deutlich wird, die sich von 48,8 Stunden 1955 auf 40,7 Stunden 1981 verringert hat.[49]
Außerdem hat sich durch flexiblere Arbeitszeitmodelle seit den siebziger Jahren, wie Gleitzeit, Teilzeit oder vier Tage Woche, den Beschäftigten ein größerer Spielraum zur Gestaltung ihres Arbeitsablaufes eröffnet.
Diese Regelungen haben eine Veränderung der Freizeitgestaltung für die Erwerbstätigen bewirkt, weil sie bei der Planung ihres Tagesablaufes mehr individuelle Schwerpunkte setzen können und nicht mehr auf feste Zeiten fixiert sind.
Hierbei bietet die bessere Ausstattung mit der Ressource Zeit die Gelegenheit in der Freizeit Aktivitäten nachzugehen, die der persönlichen Entfaltung und der Selbstverwirklichung und nicht nur der Entspannung oder Erholung dienen.
Neue arbeitsrechtliche Regelungen haben auch die Pensionierung zu einer Phase mit größeren Handlungsoptionen gemacht. So kann heute der Eintritt in den beruflichen Ruhestand aufgrund verschiedener Umstände, wie Krankheit oder Reorganisation der Betriebsstruktur etc. erheblich früher erfolgen.[50]
Zudem bietet die verlängerte Lebenserwartung, die erst durch staatliche Fürsorge, verbesserte Ernährung und effektivere medizinische Handlungsmethoden ermöglicht wurde, eine längere Phase die arbeitsfreie Zeit zu genießen.[51] Diese Erhöhung des Zeitbudgets steht in Verbindung mit einer besseren finanziellen Ausstattung der Rentner, die erheblich von der Steigerung der Realeinkommen in den letzten vierzig Jahren profitiert haben. Dadurch eröffnet der Ruhestand für sie mehr Freiraum beim Konsum oder Freizeitaktivitäten. Pensionierung bedeutet also heute nicht mehr bloße Altersschwäche oder das Absitzen der restlichen Zeit, sondern bietet durch die eben genannten Faktoren eine Chance zur individuellen Gestaltung des Lebensraumes. Sie hat sich zu einer eigenen Lebensphase entwickelt, wo der Wunsch nach Erfüllung der Bedürfnisse, wie Reisen, Genussmittel oder Hobbys gedeckt werden kann.
Neben der Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit und der Anhebung der Reallöhne spielt auch die Flexibilisierung von Arbeitsabläufen sowie der Wandel von der Produktions- zur Dienstleistungsgesellschaft eine wichtige Rolle für die Veränderung der individuellen Lebensläufe.[52]
3.1.1 Neue Arbeitsplatzanforderungen im Zuge einer veränderten Wirtschaftsstruktur
Die Massenproduktion wurde im Zuge von starken Rationalisierungsmaßnahmen in den letzten dreißig Jahren automatisiert und die einfachen Arbeiten zunehmend durch Maschinen ersetzt. Diese Entwicklung wurde durch verschiedene wirtschaftliche Krisen in den siebziger Jahren, wie z.B. die Ölkrise, vorangetrieben und verschärfte erheblich die Wettbewerbssituation zwischen den Unternehmen.[53]
Denn die hierdurch einsetzende Sättigung des Marktes und der entstehende Konkurrenzdruck bewirkten einen verstärkten Preiskampf und Innovations- sowie Kostendruck.[54] Dies hatte zur Folge, dass die Lebenszeit von Produkten kürzer wurde und die Unternehmen schneller auf Kundenwünsche reagieren mussten. Somit wurden Produktionsstrukturen entwickelt, die eine flexible Fertigungsstruktur von Gütern möglich machte und somit variabel auf individuelle Kundenwünsche reagiert werden konnte.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, geht der Organisationsprozess weg vom streng durchgeplanten, hierarchischen System hin zu einer dezentralen, flexiblen Betriebsstruktur, die ständige Qualifizierung des Personals erfordert.[55] Denn dezentrale Organisationen können leichter auf veränderte Produktionsanforderungen reagieren, was mehr Verantwortung und Entscheidungskompetenz von den Arbeitnehmern erfordert. Hierbei führt die Elektronisierung der Arbeitsabläufe durch Computer zu einer übersichtlicheren Vernetzung der Betriebseinheiten und zu einem vereinfachten Informationsfluss. Durch diesen Prozess wird die Kommunikation im Unternehmen erheblich ausgeweitet und das Erkennen möglicher Fehlerquellen bei der Fertigung vereinfacht. Die einzelnen Arbeitsschritte können effizienter miteinander koordiniert werden und den gesamten Produktionsprozesses leistungsfähiger gestalten.
Zudem hat es in den letzten dreißig Jahren in Deutschland eine Verlagerung von der Produktionsgesellschaft hin zur Dienstleistungsgesellschaft gegeben.
„Das Verhältnis von Arbeitern und Angestellten hat sich in den letzten vierzig Jahren also umgekehrt“.[56] Die Angestelltenberufe in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Bildung sowie den produktionsnahen Industriedienstleistungen werden stärker nachgefragt. In diesem Zusammenhang verlieren körperliche Tätigkeiten, wie z.B. Arbeit mit Maschinen, an Bedeutung und es gewinnen im Gegenzug kommunikative und kooperative Handlungen an Wichtigkeit. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die erhöhte Lebenserwartung vieler Menschen, die automatisch eine Ausweitung der humanen Dienstleistungen zur Folge hatten, weil ein immer größerer Anteil alter Menschen versorgt und gepflegt werden muss.
[...]
[1] vergl. Beck-Gernsheim, E. 1994, S.134
[2] vergl. Frevert, U. 1986, S.255
[3] vergl. Frevert, U. 1986, S.253
[4] vergl. Frevert, U. 1986, S.253
[5] vergl www.raumplanung.uni-dortmund.de/soz/skripte/soz1/skriptum_schmals8.htm
[6] die Entstehung der Kleinfamilie mit dem Aufstieg des Bürgertums begann etwa 1830. In Peuckert, R. 1991, S.14-15
[7] vergl. Peuckert, R. 1991, S.27
[8] vergl. Diezinger, A. 1991, S.35
[9] vergl. Kontos, S. / Walser, K. 1977, S.38 ff
[10] vergl. Diezinger, A. 1991, S.37
[11] vergl. Frevert, U. 1986, S.268
[12] vergl. Sieder, R. 1987, S.146
[13] vergl. Frevert, U. 1986, S.253
[14] vergl. Kontos, S. / Walser, K. 1979, S.40
[15] vergl. Diezinger, A. 1991, S.35
[16] vergl. Hoecker, B. 1999, S.35
[17] vergl. Hoecker, B. 1999, S.39
[18] vergl. Frevert, U. 1986, S.261
[19] vergl. Hoecker, B. 1999, S.42
[20] vergl. Frevert, U. 1986, S.257
[21] vergl. Kontos, S. / Walser, K. 1979, S.36 ff
[22] vergl. Wittke, 1996, S.102
[23] vergl. Frevert, U. 1986, S.257
[24] vergl. Frevert, U. 1986, S.257
[25] vergl. Frevert, U. 1986, S.257
[26] vergl. Sommerkorn, I. 1988, S.118
[27] vergl. Daheim, H. / Schönbauer, G. 1993, S.42
[28] vergl. Sieder, R. 1987, S.216,
[29] vergl. Daheim, H. / Schönbauer, G. 1993, S.42
[30] vergl. Weis, H / Sehling, H. 1988, S.17 ff
[31] vergl. Wittke, V. 1996, S.102
[32] vergl. Wittke, V. 1996, S.132
[33] vergl. Wittke, V. 1996, S.138
[34] vergl. Daheim, H. / Schönbauer, G. 1993, S.73
[35] vergl. Sauer, W. 1984, S.64
[36] vergl. www.people.freenet.de/matkuch1/tayt3.htm
[37] vergl. Schmid, G. 2000, S.269
[38] vergl. Schudlich, E. 1987, S.16, 15, 46, 47
[39] vergl. Herlyn, U. / Scheller, G. / Tessin, W. 1994, S.173
[40] vergl. Wittke, V. 1996, S.79
[41] vergl. Wittke, V. 1996, S.78
[42] vergl. Peuckert, R. 1991, S.16
[43] vergl. Mayer, K.-U. / Müller, W. 1994, S.273
[44] vergl. Beck, U. 1986, S.133
[45] vergl. Leisering, L. 1998, S.74
[46] vergl. Beck, U. 1995, S.189
[47] vergl. Beck, U. 1994, S.47
[48] vergl. Sieder, R. 1987, S.250
[49] vergl. Schudlich, E. 1987, S.46-47
[50] vergl. Kohli, M. 2000, S.368
[51] vergl. Kohli, M. 2000, S.367
[52] Hier geht es um produktnahen Dienstleistungen. In Schmid, G. 2000, S.275
[53] vergl. Matthies, H. u.a., 1994, S.50
[54] vergl. Matthies, H. u.a. 1994, S.50-51
[55] vergl. Schmid, G. 2000, S.280
[56] vergl. Schmid, G. 2000, S.281
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832465025
- ISBN (Paperback)
- 9783838665023
- Dateigröße
- 679 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Münster – Sozialwissenschaften
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- arbeitsmarkt mobilität frauen lebenswelt identität
- Produktsicherheit
- Diplom.de