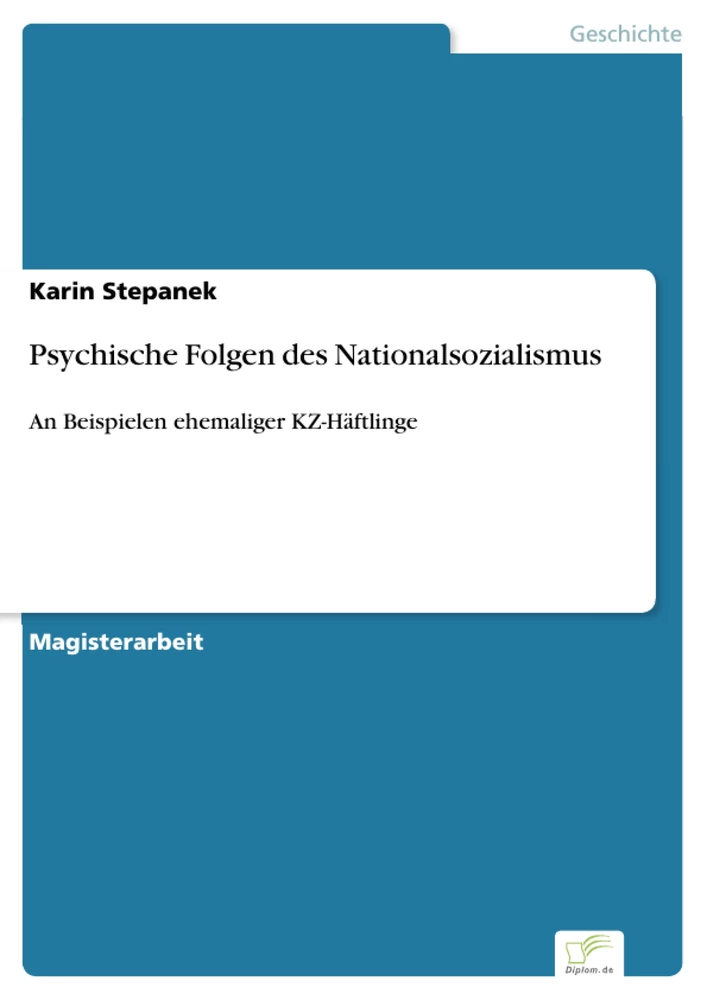Psychische Folgen des Nationalsozialismus
An Beispielen ehemaliger KZ-Häftlinge
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit versucht einen Einblick in die Vernichtungsmaschinerie in Form der Konzentrationslager während des Dritten Reiches zu geben. Um dies zu erreichen, gliedert sich die Arbeit in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil soll vor allem einen Überblick über die Ideologie, die im Dritten Reich herrschte und auf die sich das Phänomen der Konzentrationslager stützte, das System der KZs und die Organisation der Konzentrationslager geben. Dazu wird der erste Teil der Arbeit in vier Kapitel gegliedert.
Gang der Untersuchung:
Das erste Kapitel wird sich mit der Ideologie des Dritten Reiches auf die sich das System der Vernichtungslager stütze, befassen. In diesem Kapitel soll vor allem aufgezeigt werden, wie sich Hitlers Rassenwahn äußerte, auf welche Bevölkerungsgruppen er sich bezog und welche Dimensionen er annahm. Der Schwerpunkt wird hier auf dem Endziel der Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa liegen. Darüber hinaus wird auch aufgezeigt werden, daß sich das Ziel der Vernichtungsmaschinerie auch auf andere Gruppen, wie z.B. Russen, Polen und andere Nationalitäten, Homosexuelle, Zigeuner, religiöse Sekten etc. bezog.
Das zweite Kapitel ist dem System der KZs als Vernichtungslager gewidmet. Eine Schlüsselrolle spielte hier die Tatsache, daß der Vernichtungsapparat der SS vor allem ab 1941 einem geradezu industriell betriebenen Massenmord gleichkam. Nachdem auf die Entstehung der KZs mit Anfang 1933 eingegangen wird, wird auch der Tatsache Augenmerk geschenkt werden, daß es anfangs eher politische Häftlinge, später jedoch vorwiegend unerwünschte Bevölkerungs-gruppen waren (die bereits oben erwähnten Gruppen), gegen die sich die Säuberungsmaßnahmen richteten. Auch werden die gesetzlichen Grundlagen beleuchtet, die der nationalsozialistischen Maschinerie die rechtliche Grundlage boten, Menschen willkürlich in die Lager einzuweisen (Verordnungen, die die Polizei zur Schutzhaft ermächtigten, das Ermächtigungsgesetz vom 24.3.1933, das Reichsbürgergesetz, etc.).
Einen weiteren Schwerpunkt dieses Kapitels soll die Tatsache bilden, daß mit Voranschreiten des Krieges immer mehr ausländische Häftlinge aus allen Teilen Europas für die Überflutung der Konzentrationslager sorgten, trotzdem die Todesraten rasant stiegen. Schließlich soll die Rolle der Häftlinge als Arbeitskräfte für die Industrie behandelt werden.
Im dritten Kapitel wird die lagerinterne Organisation der KZs […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis:
I. Zielstellung und Aufbau der Arbeit
a. Zielstellung
b. Aufbau der Arbeit
II. Einleitung
a. Geschichtlicher Rückblick
b. Begriffsabgrenzung
III. Ideologie und Rassenwahn im Dritten Reich
a. Verfolgte Gruppen
b. Die Verfolgung der Juden- Der Versuch der Auslöschung eines gesamten Volkes
IV. Das System nationalsozialistischer Konzentrationslager
a. Zahlenmäßige Entwicklung und Verbreitung der Konzentrationslager
b. Die „gesetzlichen“ Grundlagen für die Greueltaten des SS-Apparates
c. Konzentrations- und Vernichtungslager als Ort der Systematisierung von Gewalt und Terror
c.a. Einschüchterungs-, Folter- und Terrormethoden der SS in den Konzentrations- und Vernichtungsöagern
c.a.a. Die Standortwahl der Konzentrationslager
c.a.b. Die Lebensbedingungen im KZ
c.a.c. Der quälende Hunger
c.a.d. Der lagerinterne Normen- und Strafsystem
c.a.e. Angst und Abschottung
c.a.f. Extremer Platzmangel
c.a.g. Entindividualisierung
c.a.h. Die Brechung des Einzelnen
c.a.i. Muselmänner
c.b. Greueltaten in Konzentrations- und Vernichtungslagern – ein Zeugnis menschlicher Inhumanität
c.b.a. Die Arbeit als Foltermethode
c.b.b. Todesmärsche
c.b.c. Medizinische Experimente
c.b.d. Greuel an Kindern
c.b.e. Die Hinrichtung
d. Die Ausbeutung der KZ-Häftlinge für die Industrie
V. Die Lagerorganisation
a. Die Spitze der Hierarchie
b. Das Lagerpersonal
c. Die Verwaltung
d. Das Sanitätswesen
e. Der Politische Sektor
f. Das Bewachungspersonal
g. Die Häftlingsfunktionäre
h. Die Organisation unter den Häftlingen
VI. Das Konzentrationslager Mauthausen
a. Standortwahl
b. Häftlingszusammensetzung
c. Häftlingsidentifikation
d. Mauthausen – ein Lager der Lagerstufe III
e. Räumliche Anordnung und spezielle Einrichtungen des Konzentrationslagers Mauthausen
Abbildung 1
Abbildung 2
Abbildung 3
Abbildung 4
Abbildung 5
Abbildung 6
Abbildung 7
Abbildung 8
Abbildung 9
Abbildung 10
Abbildung 11
Abbildung 12
Abbildung 13
Abbildung 14
Abbildung 15
Abbildung 16
Abbildung 17
Abbildung 18
Abbildung 19
f. Arbeits- und Tagesablauf im KZ Mauthausen
g. Verpflegung der Häftlinge
h. Nebenlager
i. Die Befreiung Mauthausens
VII. Das Leben im KZ und seine Folgen S. 70 dargestellt an Hand von Interviews mit Betroffenen
a. Forschungleitende Fragen
b. Methodik
c. Persönliche Daten - Charakterisierung der Interviewpartner
d. Auswertung der Interviews vor dem Hintergrund der forschungsleitenden Fragen
e. Zusammenfassende Schlußfolgerungen
VIII. Anhang
a. Interviews mit ehemaligen Kz-Häftlingen
a.a. Irma Trksak
b.b. Dr. Hermann Lein
c.c. Leo Kuhn
d.d. Mag. Kurt Hacker
b. Erklärungen der Fachausdrücke
IX. Quellenangaben
Abbildungen:Abbildung 1
Abbildung 2 S. 58 Abbildung 3
Abbildung 4
Abbildung 5
Abbildung 6
Abbildung 7
Abbildung 8
Abbildung 9
Abbildung 10
Abbildung 11
Abbildung 12
Abbildung 13
Abbildung 14
Abbildung 15
Abbildung 16
Abbildung 17
Abbildung 18
Abbildung 19
I. Zielstellung und Aufbau der Arbeit
a. Zielstellung
Die vorliegende Arbeit versucht einen Einblick in die Vernichtungsmaschinerie in Form der Konzentrationslager während des Dritten Reiches zu geben. Um dies zu erreichen, gliedert sich die Arbeit in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil soll vor allem einen Überblick über die Ideologie, die im Dritten Reich herrschte und auf die sich das Phänomen der Konzentrationslager stützte, das System der KZs und die Organisation der Konzentrationslager geben. Dazu wird der erste Teil der Arbeit in vier Kapitel gegliedert.
b. Aufbau der Arbeit
Das erste Kapitel wird sich mit der Ideologie des Dritten Reiches auf die sich das System der Vernichtungslager stütze, befassen. In diesem Kapitel soll vor allem aufgezeigt werden, wie sich Hitlers Rassenwahn äußerte, auf welche Bevölkerungsgruppen er sich bezog und welche Dimensionen er annahm. Der Schwerpunkt wird hier auf dem Endziel der Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa liegen. Darüber hinaus wird auch aufgezeigt werden, daß sich das Ziel der Vernichtungsmaschinerie auch auf andere Gruppen, wie z.B. Russen, Polen und andere Nationalitäten, Homosexuelle, Zigeuner, religiöse Sekten etc. bezog.
Das zweite Kapitel ist dem System der KZs als Vernichtungslager gewidmet. Eine Schlüsselrolle spielte hier die Tatsache, daß der Vernichtungsapparat der SS vor allem ab 1941 einem geradezu industriell betriebenen Massenmord gleichkam. Nachdem auf die Entstehung der KZs mit Anfang 1933 eingegangen wird, wird auch der Tatsache Augenmerk geschenkt werden, daß es anfangs eher politische Häftlinge, später jedoch vorwiegend unerwünschte Bevölkerungs-gruppen waren (die bereits oben erwähnten Gruppen), gegen die sich die „Säuberungsmaßnahmen“ richteten. Auch werden die „gesetzlichen“ Grundlagen beleuchtet, die der nationalsozialistischen Maschinerie die rechtliche Grundlage boten, Menschen willkürlich in die Lager einzuweisen (Verordnungen, die die Polizei zur Schutzhaft ermächtigten, das Ermächtigungsgesetz vom 24.3.1933, das Reichsbürgergesetz, etc.).
Einen weiteren Schwerpunkt dieses Kapitels soll die Tatsache bilden, daß mit Voranschreiten des Krieges immer mehr ausländische Häftlinge aus allen Teilen Europas für die Überflutung der Konzentrationslager sorgten, trotzdem die Todesraten rasant stiegen. Schließlich soll die Rolle der Häftlinge als Arbeitskräfte für die Industrie behandelt werden.
Im dritten Kapitel wird die lagerinterne Organisation der KZs behandelt. Es soll aufgezeigt werden, wie die Lager organisiert waren, welche Hierarchie es beim Bewachungspersonal in den KZs gab, aber auch wie die Lagerleitung für eine Organisation unter den Häftlingen sorgte.
In Kapitel V sollen schließlich die in den ersten drei Kapiteln gemachten Aussagen an dem konkreten Beispiel Mauthausen demonstriert werden.
Der auf den theoretischen folgende empirische Teil stützt sich vor allem auf vier Interviews, die mit ehemaligen KZ-Häftlingen geführt wurden. In den Interviews wird auf die Bedingungen in den KZs, auf die Folgen, die der dortige Aufenthalt auf überlebenden Häftlinge hatte, auf Überlebensstrategien der Häftlinge und auf sonstige Gründe, die für ein Überleben möglicherweise ausschlaggebend waren, wie z.B. Abstammungsgründe, besondere Verhältnisse zum Bewachungs-personal, Solidaritätshandlungen, etc. eingegangen werden. Auch soll versucht werden, mittels der Interviews Information darüber zu gewinnen, inwieweit die Erlebnisse im KZ die Psyche der Betroffenen verändert hatten. Schließlich soll auch abgeklärt werden, inwieweit die Häftlinge mit der Tatsache psychisch belastet waren, daß sie für eine Kriegsmaschinerie, die zu ihrer eigenen Vernichtung beitrug, als Arbeitskräfte eingesetzt wurden.
Zu diesem Zweck werden 7 forschungsleitende Fragen gestellt, die im Anschluß an die Interviews vor dem Hintergrund der Aussagen der Interviewten ausgewertet werden.
Eine zusammenfassende Schlußbetrachtung wird die Arbeit abrunden.
Das äußerst bedrohte Leben verlöscht bis auf eine Sparflamme, die sich nachher meist nicht wieder aufdrehen läßt und deren Licht [...] immer einen begrenzten Schein wirft.
(Armanski)
II. Einleitung
a. Geschichtlicher Rückblick
Ende der 30er Jahre trat das nationalsozialistische Deutschland unter der Führung des Diktators Hitler den Kampf um die Hegemonie in Europa und in der Folge um die Weltherrschaft an. Zuerst wurde unter der deutschnationalen Lösung „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ im März 1938 Österreich militärisch besetzt. Im gleichen Jahr wurden mit Hilfe der Regierungen von Großbritannien, Frankreich und Italien die befestigten Randgebiete der Tschechoslowakei abgetrennt. Im März 1939 wurde das restliche tschechoslowakische Staatsgebilde zerschlagen und die Länder Böhmen und Mähren okkupiert. Als dann unmittelbar nach einem Freundschafts- und Nichtangriffsvertrag (samt geheimen Zusatzabkommen) mit der Sowjetunion (23.8.1939) die deutschen Truppen im Morgengrauen des 1. September 1939 zum Überfall Polens antraten, setzte Hitler-Deutschland eine bewaffnete Auseinandersetzung in Gang, die sich bald zu einem Weltbrand ausbreitete. So begann der bisher blutigste Krieg der Menschheit und die nationalsozialistischen Machthaber begannen sofort die erste Phase ihrer Weltherrschaftspläne zu realisieren: Zuerst erfolgte die „Rückdeutschung der fremdvölkischen“ Polen, dann die „Ausmerzung der bolschewistischen Untermenschen“ und die unter der Bezeichnung „Endlösung der Judenfrage“ stattgefundene Ermordung der europäischen Juden.
In den ersten Jahren des zweiten Weltkrieges besetzten Soldaten der Deutschen Wehrmacht zahlreiche europäische Länder; im Sommer 1941 wurde in einem Vernichtungskrieg die Sowjetunion überfallen. Den Spuren der Militärstiefel folgten in allen okkupierten Ländern die Experten der deutschen Wirtschaft, der Banken und die fanatisierten Organe des nationalsozialistischen Terrorapparates: die Angehörigen der unter dem Zeichen eines Totenkopfes gekennzeichneten Gliederung der NSDAP. Es waren die Männer der Schutzstaffel (SS) als Angehörige der Geheimen Staatspolizei (GESTAPO), des Sicherheitsdienstes (SD), der Exekutionseinheiten (Einsatzkommandos) und als Erbauer von Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslagern. Infiziert von einer rassistischen Wahnidee und einem barbarischen Slawen- und Fremdenhaß hatten diese Organe den Auftrag, erbarmungslos alle Juden, Marxisten und die slawische Intelligenz festzunehmen und entweder sofort zu ermorden oder in den Konzentrationslagern durch den Einsatz für schwerste Arbeiten der Vernichtung zuzuführen (Österreicher in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, o. J., S. 2f).
a.b. Begriffsabgrenzung
Da diese Arbeit dem Phänomen der Konzentrationslager gewidmet ist, soll vorerst abgeklärt werden, was damit gemeint ist. In den Jahren 1933 und 1934 die als die Etablierungsphase des Nationalsozialismus gelten, hatten die Konzentrationslager mehrere Aufgaben. Ihre eindeutige Hauptfunktion war jedoch „die umfassende und möglichst gründliche Ausschaltung des politischen Gegners, die Einschränkung seiner Handlungsmöglichkeiten durch ´Konzentration´ im Lager (Tuchel 1991, S. 5). Der Ausdruck Konzentrationslager entstand also dadurch, daß sämtliche politische Gegner und unerwünschte Gruppen in Lagern konzentriert wurden.
Dieser nüchternen und neutralen Beschreibung der Einrichtung eines Konzentrationslagers fehlt jedoch der Aspekt des Terrors und der Repressionen der Anwendung physischer und psychischer Gewalt, die diese Institutionen verkörperten. Sofsky (1993) (MT, S. 204) bezeichnet die Konzentrationslager als einen Ort des institutionalisierten und habitualisierten Terrors, der einer eigenen extremen Normenwelt des Lagers unterlag. Nach Sofsky gipfelte dieser Terror in der allfälligen Selektion, als beispiellose Situation absoluter Macht, in welcher der einzelne Gewalträger die Serie auf der Drehscheibe des Todes bewegt.
In der „Kurzgeschichte der Konzentrationslager“ wird zwischen Konzentrationslager und Vernichtungslager wie folgt unterschieden: (1) Konzentrationslager: Die im nationalsozialistischen Deutschland (1933 bis 1945) errichteten Konzentrationslager (Abkürzung KZ) waren Sammellager für Zivilgefangene und eines der grausamsten Terrormittel des Hitler-Regimes. Politische Gegner, anfangs vor allem Kommunisten, Sozialisten und Angehörige anderer politischer Parteien, Juden, Priester, Zigeuner sowie nach 1939 Millionen Ausländer wurden ohne Gerichtsverfahren in den Konzentrationslagern inhaftiert. Bis etwa Winter 1941/42 dienten die Konzentrationslager der Aufrechterhaltung des Hitler-Terrors und waren zugleich eine Stätte der Ausbeutung unter sklavenartigen Bedingungen. Nach diesem Zeitpunkt mußten die KZ-Insassen auch noch für die Rüstung der Armee arbeiten. Aus den Konzentrationslagern wurden manchmal einzelne Häftlinge (vorwiegend Deutsche und Österreicher) entlassen.
(2) Vernichtungslager: Außer den Konzentrationslagern gab es auch Vernichtungslager. In diesen, so z.B. in Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Kulmhof, Belzec usw. sind Millionen von Juden aus ganz Europa nach (oder ohne) Selektion (Auslese vom Gesichtspunkt des Arbeitseinsatzes) sofort in zu diesem Zwecke installierten Gaskammern ermordet worden. Welches Ausmaß die Verfolgungen unter der nationalsozialistischen Terrorherrschaft angenommen haben, zeigen deutlich die Gesamtzahlen der beim Internationalen Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes in Arolsen bis jetzt festgestellten Lagerhaftstätten (nicht Gefängnisse oder Kriegsgefangenenlager). Es gab in den von deutschen Truppen setzten Gebieten in Europa 1226 Hauptlager, 1011 Neben- oder Außenlager und 114 Vernichtungs- und Judenlager (Kurzgeschichte der Konzentrationslager, o.J., S. 2f).
Seit die Grausamkeiten, die sich in Konzentrations- und Vernichtungslagern ereignet haben, publik geworden sind, hat man sich immer wieder gefragt, wie so viel Unmenschlichkeit möglich war, und um welche Art von Phänomen es sich dabei gehandelt haben kann. So stellt auch Levi, die Frage: „Haben wir der rationalen Durchführung eines unmenschlichen Plans beigewohnt oder einem (in der Geschichte bis jetzt und immer noch unzureichend erklärten) Ausbruch kollektiven Wahnsinns? Einer Logik, die das Böse wollte, oder dem Nichtvorhandensein von Logik? Wie so oft in den Dingen des menschlichen Lebens existieren die Alternativen gleichzeitig“ (Levi, 1990, 107).
Wir werden auch in dieser Arbeit keine eindeutige Antwort auf diese Frage finden; es soll jedoch versucht werden, mit Hilfe der Aufarbeitung diverser Literatur und den im empirischem Teil folgenden Interviews wesentliche Perspektiven des damaligen Geschehens aufzuzeigen.
„Ich kann nicht abseits stehen, weil es für mich abseits kein Glück gibt, wie es ohne Wahrheit kein Glück gibt.“ Hans Scholl, 28.10.1941
„Wie könnte man da von einem Schicksal erwarten, daß es einer gerechten Sache den Sieg gebe, daß sich kaum einer findet, der sich ungeteilt einer gerechten Sache opfert.“ Sophie Scholl, 22.6.1940
III. Ideologie und Rassenwahn im Dritten Reich
Hitlers Ideologie und somit die Ideologie des Dritten Reiches stütze sich auf einen Haß der jüdischen Rasse, und auf eine Reinhaltung der deutschen Rasse, was sich in einer Verfolgung und Vernichtung von Juden und vielen anderen Gruppen äußerte. In den folgenden beiden Abschnitten dieses Kapitels soll ein Überblick über die verfolgten Gruppen und Nationalitäten (erster Abschnitt) und im speziellen über die gnadenlose Verfolgung von Juden (zweiter Abschnitt) gegeben werden.
a. Verfolgte Gruppen
Neben der Verfolgung und geplanten Vernichtung der jüdischen Rasse, auf die im nächsten Abschnitt noch im Detail eingegangen wird, gab es noch eine Vielzahl anderer Gruppen von Menschen, die Hitlers Verfolgung und Repressionen ausgesetzt waren. Bereits im März 1933 errichteten die Nationalsozialisten in leeren Fabrikhallen oder ähnlichen Räumlichkeiten „wilde“ Konzentrationslagern (Bastian, 1994, S. 10). In diesem Zusammenhang schrieb Rudolf Diels, seinerzeit Leiter der Politischen Abteilung des Berliner Polizeipräsidiums, später über jene Tage:
„Nicht nur die Kommunisten, sondern jeder, der sich einmal gegen Hitlers Bewegung ausgesprochen hatte, war gefährdet [...] In diesen Märztagen entstanden die Konzentrationslager in Berlin.“ (Diels, 1950, S. 223).
Trotzdem waren es zu Beginn vor allem politisch anders Gesinnte, die in Konzentrationslagern inhaftiert waren (Hier waren es vor allem die Kommunisten und Sozialdemokraten, die als Staats- und Volksfeind stigmatisiert waren (Tuchel 1991, S. 5. Mit dem Fortschreiten der nationalsozialistischen Herrschaft waren jedoch immer mehr andere Bevölkerungsgruppen von den Verfolgungsmaßnahmen betroffen. Vor allem als das Polizeiwesen unter die SS-Herrschaft und unter die SS-Ideologie unterworfen wurde, änderte sich auch die Funktion der Konzentrationslager. Während im Konzentrationslager Dachau vorwiegend politische Häftlinge inhaftiert waren, brachte die Gestapo als Einweisungsbehörde eine immer größere Anzahl von – wie sie von der SS genannt wurden – Asozialen, daß heißt, Homosexuellen, Zeugen Jehovas, Arbeitsscheuen, Landstreichern und Raufbolden (Bastian, 1994, S. 20f.)
Von Verfolgung waren aber auch „niederwertige Rassen“ (Slawen, Zigeuner und vor allem Juden) betroffen. Sie waren es, die anscheinend auch aufgrund ideologischer Aspekte besonders harter Verfolgung ausgesetzt waren (Kirstein, 1992, S. 27.)
Eine weitere Gruppe, die unter der nationalsozialistischen Ideologie stark zu leiden hatte, waren Kranke und Behinderte. So wurden in der sogenannten Aktion T4,[1] Tausende Geisteskranke und Behinderte ermordet. Offiziell sollte laut einem Erlaß von Adolf Hitler vom Oktober 1939 Menschen, die als unheilbar krank galten, der Gnadentod gewährt werden. In Wahrheit sah die Aktion so aus, daß Gutachter auf Meldebögen ohne weiteres Aktenstudium „ja“ oder „nein“ notierten, wobei „ja“ Vergasung bedeutete. Insgesamt fielen dieser Mordaktion 80.000 bis 100.000 Kranke und Behinderte zum Opfer (Bastian, 1994, S.14f.)
Angehörige gewisser Nationen wurden ebenfalls verfolgt. Die größte und am härtesten verfolgte Gruppe bildeten darunter die Russen. An ihnen wurden zahlreiche Sonderexekutionen in den Konzentrationslagern verübt. Zu dieser Opfergruppe zählten sowohl russische Kriegsgefangene als auch zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppte russische Zivilisten. Eine weitere verfolgte Nationalität waren die Polen. Ihre Exekution wurde zumeist aus politischen oder aus rassischen Gründen angeordnet. Auch Slawen und Tschechen wurden verfolgt (Kirstein, 1992, S.11ff.)
Weiters wurden Kriegsgegner, radikale Schriftsteller und Anwälte, aber auch Priester in die KZs eingewiesen (Wittfogel, 1991S. 219.)
Auch deutsche und österreichische Häftlinge befanden sich in den Konzentrationslagern. Offenbar im Sinne der faschistischen Rassenlehre wurden ihnen jedoch etwas bessere Lebensbedingungen zugebilligt als den übrigen Gefangenen (Österreicher in Nationalsozialistischen Konzentrationslagern, o.J., S. 5).
b. Die Verfolgung der Juden – der Versuch der Auslöschung eines gesamten Volkes
„Zwölftausend Schurken zur rechten Zeit beseitigt, hätte vielleicht einer Million ordentlicher, für die Zukunft wertvoller Deutschen das Leben gerettet“ – so Adolf Hitler in „Mein Kampf“ (S. 772), wobei er sich auf den ersten Weltkrieg bezieht. Mit den „Schurken“ hat Hitler selbstverständlich die Juden gemeint. Somit konnte am Antisemitismus Hitlers niemals auch nur der geringste Zweifel bestehen. Das bereits im Februar 1920 verabschiedete und im Mai 1926 von Adolf Hitler für „unabänderlich“ erklärte Parteiprogramm der NSDAP unter dem vierten seiner 25 Punkte erklärte: „Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksicht auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.“
Im Jänner 1939 sprach Hitler seinen Antisemitismus und seine damit verbundenen Absichten noch deutlicher aus. Er sagte, daß - sollte es zu einem Krieg in Europa kommen - das Ergebnis dieses Krieges „die Vernichtung der jüdische Rasse in Europa“ sein werde (Bastian 1994, S. 9). Bereits am 30. Jänner 1933, am Tag der Machtergreifung, wurden Repressionen gegen jüdische Mitbürger immer offenkundiger. Im März 1933, wurde von der Parteileitung der NSDAP ein landesweiter Boykott von jüdischen Geschäften angeordnet. Im April wurde ein Gesetz erlassen, in dem verfügt wurde, daß Beamte nicht- arischer Abstammung sofort in den Ruhestand zu versetzen seinen. Im Sommer 1935 folgte eine neue Welle, zumeist gewalttätiger Boykottaktionen. 1936 wurde schließlich in einer Denkschrift des Führers am Parteitag ein Gesetz gefordert, das das gesamte Judentum für alle Schäden, die durch „einzelne Exemplare dieses Verbrechertums“ der deutschen Wirtschaft und damit dem deutschen Volk zugefügt werden, haftbar machte. Es folgten im Jahr 1938 die Reichskristallnacht (die Nacht vom 9. auf den 10. November) und „die erste Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben“, der noch andere derartige Anordnungen folgten (Bastian 1994, S. 12f.)
Wie es zu dem ausufernden Antisemitismus in der Mitte dieses Jahrhunderts kommen konnte, ist ein Thema, dem sich nach wie vor Historiker widmen. Armanski sieht die Gründe wie folgt:
„Infolge der Kränkung etwa durch die eigene inferiore Position oder das Fehlen, die Hintansetzung oder die Niederlage der eigenen Nation entstand mit der Romantik bei Intellektuellen und in kleinbürgerlichen Schichten eine deutsch-völkische Identität(ssuche), die im Juden als behaupteten Fremden schlechthin immer wieder einen Sündenbock für die eigene Malaise und ein Ventil der introjizierten Aggression fand“ (Armanski 1993, S.45).
Die deutsche Gründlichkeit, mit der Deutschland von den Juden „gereinigt“ wurde, kann leicht an Zahlen abgelesen werden. Im Januar 1933 lag die Zahl der in Deutschland lebenden Juden bei der damaligen Volkszählung noch bei 525.000 Menschen. Laut Volkszählung vom Mai 1939 lebten 214.000 Juden in Deutschland, deren Zahl – weit überwiegend durch Auswanderung – bis Kriegsausbruch auf 185.000 und bis zum Auswanderungsverbot vom Oktober 1941 nochmals auf ca. 90.000 Menschen absank. Ab 1941 wurden die noch in Deutschland lebenden Juden dann in die Vernichtungslager deportiert. Und so kam es zum letzten Akt im Drama eines sorgfältig geplanten Massenmordes: Im Jahre 1941 begann eine Vernichtungsmaschinerie ihren Betrieb, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hatte (Bastian 1994, S.14).
Wenngleich die Juden auch als Arbeitskräfte eingesetzt wurden (vgl. dazu vor allem Abschnitt 3.4.), so waren sie letzt endlich doch zur Vernichtung bestimmt:
„Das RSHA war immer für die restlose Beseitigung aller Juden, sah in jedem neuen Tausend Arbeitsfähiger die Gefahr der Befreiung, das am Lebenbleiben durch irgendwelche Umstände.[...] Das RSHA lieferte Häftlinge ein mit dem Endziel der Vernichtung; ob sofort durch Exekution oder durch die Gaskammer oder ob etwas langsamer durch Seuchen [...] blieb sich gleich. Das WVHA wollte die Häftlinge erhalten für die Rüstung (Höß im November 1946, zitiert nach Broszat, Stuttgart 1961, S. 138).
Sehr bedrückend in diesem Zusammenhang war auch die Tatsache, daß die gesamte Welt zusah, und nichts tat bzw. teilweise auch nichts tun konnte. So schrieb Churchill, als er im Juni 1944 erfuhr, daß jetzt täglich 10. 000 bis 12. 000 ungarische Juden nach Auschwitz deportiert wurden, in ratloser Verzweiflung an den Rand eines Berichts: „Was können wir tun? Was können wir sagen?“ (Graml 1988, S. 249). Da sich die deutsche Nation ohnehin schon mit mehreren Ländern, so auch den USA, im Kriegszustand befand, war dem Rest der Welt die Hände gebunden, da die deutsche Führung mit keinerlei Drohungen eingeschüchtert werden konnte.
Um so wichtiger scheint die Aufarbeitung dieses Teils der Geschichte, um Ähnliches in Zukunft nicht mehr geschehen zu lassen. In diesem Sinne schreibt Graml:
„Die nationalsozialistische Judenverfolgung ist geschehen und infolgedessen ein Teil unserer Geschichte. Ihre Verdrängung wäre eine neue Verfehlung gegen die damals geschundenen und getöteten europäischen Juden wie gegen die heute lebende Judenheit, und die Verdrängung würde außerdem unweigerlich zu neuen Gefährdungen des geistigen wie des emotionalen Zustandes unserer Nation führen. Um mit einer Last, wie sie der deutschen Nation von den Machthabern des Dritten Reiches aufgebürdet wurde, wenigstens leben zu können, müssen wir die im politischen Verbrechen gipfelnden Irrtümer und Irrwege zumindest erkannt, die entstandene Schuld zumindest anerkannt haben“ (Graml 1988, S.7).
Das Töten ist die Nahrung der Macht
(Sofsky)
IV. Das System nationalsozialistischer Konzentrations- und Vernichtungslager
a. Zahlenmäßige Entwicklung und Verbreitung der Konzentrationslager
Wie Bastian (1994) festhält, spielten bei dem geradezu industriell betriebenen Massenmord an nicht erwünschten Personengruppen ab 1941 die nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager eine Schlüsselrolle. Kirstein hält fest, daß es sich bei diesen Konzentrationslagern tatsächlich um ein Lager system handelte, das in steter Wechselbeziehung zur Dynamik des NS-Herrschaftssystems insgesamt stand. (Kirstein 1992: IX).
Der Beginn des KZ-Systems wurde bereits Anfang 1933 mit den wilden Konzentrationslagern gesetzt, die im Sommer 1933 wieder aufgelöst wurden. Ab 1934 entstanden jedoch nach und nach Konzentrationslager deren Wachmannschaften die SS-Angehörigen bildeten, und die in SS-Totenkopfverbänden zusammengefaßt wurden. Bereits in den Jahren 1933-34 gab es in Deutschland 40 Konzentrationslager (Österreicher in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, o. J., S. 2). Zu Kriegsbeginn im Jahre 1939 existierten bereits 6 Konzentrationslager, die nach einem einheitlichen Schema organisiert waren, und für jeweils etwa 5.000 Häftlinge Platz boten: Dachau (1933), Sachsenhausen (1936), Buchenwald (1937), Flossenbürg (1938), Mauthausen (1938) und das Frauenlager Ravensbrück (1939). Insgesamt waren in diesen Lagern zu Kriegsbeginn mehr als 21.000[2] Gefangene inhaftiert. Mit Kriegsbeginn fand eine gigantische Ausweitung des KZ-Systems statt, „das schließlich wie ein riesiger Tumor mit zahllosen Tochtergeschwülsten den nationalsozialistischen Herrschaftsbereich durchsetzte.“ (Bastian 1994: 22). Zu den wichtigsten nach 1939 errichteten Lagern zählten Bergen-Belsen, Groß-Rosen, Hinzert, Mittelbau Dora, Natzweiler, Neuengamme, Niederhagen-Wewelsburg und Struthof im Deutschen Reich, Herzogenbusch in Holland, Kauen in Litauen, Klooga in Estland, Riga-Kaiserwald in Lettland, Lublin-Majdanek und Plaszow im „Generalgouvernement Polen“ – und das größte Lager von allen, das KZ Auschwitz mit seinen Unterabteilungen Auschwitz I, II (Birkenau) und III (Monowitz), im „reichsdeutschen“ Teil des ehemaligen Polen gelegen (Bastian 1994, S. 19f).
Welches gigantische Ausmaß diese breitgestreuten terroristischen Maßnahmen der Nationalsozialisten erreichten, zeigen die Gesamtzahlen der bisher festgestellten KZ-Lagerstätten: In Hitlers Herrschaftsbereich gab es mindestens 1031 Haupt-, Neben- und Außenlager. Weiters gab es 8 Vernichtungslager, wo Millionen von europäischen Juden und zehntausende Zigeuner ermordet wurden. Im Generalgouvernement Polen gab es 367 Ghettos und jüdische Zwangsarbeitslager. Allein in Österreich wurden 38 Judenlager, 8 Arbeitserziehungslager, 49 Nebenlager des KZ Mauthausen und 7 Nebenlager des KZ Dachau errichtet. Darüber hinaus bestanden noch Tausende Arbeitslager für ausländische Zwangsarbeiter, Gefängnisse, Jugend- und Kriegsgefangenenlager (Österreicher in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, o.J., S 3).
b. Die „gesetzlichen“ Grundlagen für die Greueltaten des SS-Apparates
Adolf Hitler war der geborene Diktator. Er verachtete die Demokratie, den Parlamentarismus und propagierte nach innen den starken Staat und nach außen das blanke Schwert. Seine Gesetze waren willkürlich und dienten ihm als Mittel zur Erfüllung seiner Ziele.
Wie bereits in Abschnitt 2.2. beschrieben, wurde bereits im Februar 1920 von Adolf Hitler ein unabänderliches Parteiprogramm der NSDAP verabschiedet. Dreizehn Jahre nach der Verabschiedung dieses Parteiprogrammes übernahm die von Hitler angeführte nationalsozialistische Bewegung die Macht in Deutschland – jedoch nicht im Zuge von demokratischen Wahlen, sondern mittels eines geschickt inszenierten Staatsstreiches von oben (Bastian 1994, S. 9).
Am 28.2.1933 wurde dann die Verfassung weitgehend außer Kraft gesetzt und die Polizei ermächtigt, unliebsame Personen unbefristet in Schutzhaft zu nehmen. Dies geschah durch die „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“. Damit wurde das Grundrecht auf die persönliche Freiheit aufgehoben. Auf Grundlage dieser Verordnung begannen bereits im Februar Verhaftungen, Verhöre und Verhandlungen (Pingel 1978, S. 23; Broszat 1965, S. 12). Gleichzeitig wurden auch Maßnahmen gegen jüdische Mitbürger verschärft (vgl. dazu auch Abschnitt 2.2.).
Am NSDAP-Parteitag von Nürnberg am 16.9.1935 wurden die Nürnberger Gesetze vorgelegt, zu denen das „Reichsbürgergesetz“ und das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ zählte (Bastian 1994, S. 11). Mit 18. Oktober 1935 trat dann auch das „Gesetz zum Schutze der deutschen Erbgesundheit“ in Kraft. Damit war eine weitere Maßnahme zur Höherzüchtung der arischen Rasse erfolgt, womit eine totale Isolierung der jüdischen Rasse einherging (Graml 1988, S. 157).
Die oben erwähnte Schutzhaft erfolgte meist nach Freispruch oder Einstellung des Gerichtsverfahrens noch im Gerichtssaal und wurde zu einer unbefristeten Sonderstrafe, die jedermann treffen konnte, der von der SS und der von der ihr geleiteten Polizei als unerwünscht oder staatsgefährdend betrachtet wurde. In diesem Zusammenhang zitiert Bastian (1994, S. 21) Werner Best mit einem im Jahre 1936 geschriebenen Kommentar zum Gestapogesetz 1936. Darin beschreibt Best die Politische Polizei als
„eine Einrichtung, die den politischen Gesundheitszustand des deutschen Volkskörpers sorgfältig überwacht, jedes Krankheitssymptom rechtzeitig erkennt und die Zerstörungskeime ... feststellt und mit jedem geeigneten Mittel beseitigt.“
1941 wurden dann von Hitler Sondermaßnahmen gegen die Widerstandstätigkeiten Verdächtiger und umfangreiche Verhaftungsaktionen angeordnet. Der Großteil der Festgenommenen sollte jedoch nicht im eigenen Land vor Gericht gestellt, sondern heimlich nach Deutschland deportiert werden, wo die meisten Festgenommenen dann spurlos verschwinden sollten. Dieser Befehl Hitlers wurde im Dezember 1941 formal als Erlaß vom Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitl, durchgeführt und unterzeichnet. Der Zugriff der Wehrmacht auf die verhafteten Personen wurde jedoch erheblich beschränkt (Kirstein 1992, S. 4f).
„Der Erlaß sah nämlich nur in bestimmten Fällen, in denen es um militärische Belange handelte, Aburteilung durch Kriegsgerüchte im Reich und Überstellung der Betreffenden in Wehrmacht-Haftanstalten (als Wehrmachtsgefangene) vor, alle anderen festgenommenen Personen sollten von den Sondergerichten oder vom Volksgerichtshof abgeurteilt werden (Broszat, 1984, S. 95f).“
Im Jahre 1942 wurden noch zwei weitere Erlasse verabschiedet, die vorsahen, daß in NN-Aktionen (Nacht- und Nebelaktionen) Verhaftete, deren kriegsrechtliches Verfahren eingestellt worden war, oder die vor Gericht freigesprochen worden waren, und ebenso aus den Untersuchungsgefängnissen entlassene Häftlinge der Gestapo auszuliefern waren (Kirstein 1992, S.5).
Wie der kurze Überblick über all diese willkürlich verabschiedeten Gesetze und Erlässe zeigt, wurde dem Volk jegliche persönliche Freiheit geraubt und arbiträre Handlungen des Staates somit „legitimiert“.
Abschließend sei noch Wittfogel zitiert, dessen Worte keiner weiteren Interpretation mehr bedürfen.
„Die Regierung des Dritten Reiches erliess im gleichen Jahre, in dem sie ihre Konzentrationslager einrichtete, ein Gesetz, durch das jeder Deutsche mit schweren Strafen bedroht wird, der es wagt, roh und gefühllos mit Tieren umzugehen.
Nach diesem Gesetz – nachzulesen ´Reichsgesetzblatt´ 1933, Teil, Nr. 132 – ist es verboten, ´ein Tier in Haltung, Pflege oder Unterbringung oder bei der Beförderung derart zu vernachlässigen, dass es dadurch erhebliche Schmerzen oder erheblichen Schaden erleidet.´ Verboten ist, ´ein Tier unnötig zu Arbeitsleistungen zu verwenden, die offensichtlich seine Kräfte übersteigen, oder die ihm erhebliche Schmerzen bereiten, oder denen es infolge seines Zustandes nicht gewachsen ist.´
Das gleiche Gesetz (§4) schützt ´gebrechliche, kranke, abgetriebene und alte Haustiere.´ Es verbietet, Hunde zu Uebungszwecken auf lebende Katzen, Füchse oder andere Tiere loszulassen (§6).
Das Gesetz dient dem Schutz von Pferden, Hunden, Katzen und anderen Tieren. Bestimmungen über eine sinngemässe Anwendung des Gesetzes auf den Schutz von Menschen enthält das Reichsgesetzblatt des Hitlerstaates nicht“ (Wittfogel 1991, S. 126f).
c. Konzentrations- und Vernichtungslager als Ort der Systematisierung von Gewalt und Terror
Gewalt und Terror waren grundlegende Elemente der nationalsozialistischen Herrschaftsetablierung und –ausübung und wurden zu Eckpfeilern der NS-Herrschaft (Tuchel 1991, S. 3). Mit der Errichtung von zahllosen Konzentrations- und Vernichtungslagern wurde seitens der Nationalsozialisten versucht, eine Systematisierung dieser Gewalt und dieses Terrors zu erreichen (Tuchel 1991, S. 4).
„Um dieses Vernichtungsprogramm, gestützt auf Rassenwahn und Habgier, durchzuführen, wurde innerhalb der Staatsverwaltung, der NSDAP und der Berufsgruppen ein riesiger Apparat aufgebaut... Dieser Vernichtungsapparat wucherte wie ein Krebsgeschwür allmählich in allen Teilen des gesamten Staatsapparates. Seine Schöpfer und Exekutivorgane waren besessen von dem Gedanken der Legitimierung. Sie glaubten, keine Raubmörder zu sein, wenn sie ihren Verbrechen gegen die jüdischen Bürger ´gesetzliche´ Mäntelchen umhängten und jede Missetat an Juden in die Form von Verordnungen, Erlassen, Verfügungen usw. verpackten.“ (Kempner 1992, in Bastian 1994, S. 13).
c.a. Einschüchterungs-, Folter- und Terrormethoden der SS in den Konzentrations- und Vernichtungslagern
c.a.a. Die Standortwahl der Konzentrationslager
Schon in der Standortbestimmung für die Konzentrationslager lag eine gewisse Methodik:
„Die SS wählte für die Errichtung von Konzentrationslagern stets abgelegene Orte in der Nähe größerer Städte. Wald- und Moorgegenden wurden bevorzugt. Damit verband sie eine doppelte Absicht. Die Lager sollten von der Umwelt abgeschlossen bleiben, während der SS die Bezugsquellen und Annehmlichkeiten der Städte offengehalten wurden. Außerdem konnte so der nationalsozialistische oder regimefreundliche Teil der Bevölkerung an der Deckung des großen Bedarfs der Lager tüchtig mitverdienen, der übrige Teil wurde in heilsamem Schrecken gehalten.“ (Kogon, 1983, S. 74).
Diese Art der Standortwahl brachte automatisch die Tatsache mit sich, daß es sich meist um Land handelte, das von der restliche Bevölkerung aufgrund der ungünstigen Bedingungen nicht besiedelt wurde. So schreibt Kogon über die Standortwahl des Konzentrationslagers Buchenwald folgendes:
„Das Siedlungsgelände war für die Unterbringung von Menschen denkbar ungünstig. Der Ettersberg weist alle klimatischen Nachteile des mitteldeutschen Randgebirges auf, verschärft durch den Umstand, daß er sich direkt aus der Ebene nördlich Weimar erhebt ... . Die in der Gegend häufig auftretenden Temperaturschwankungen kamen dadurch auf dem Nordhang des Ettersbergs, wo das Lager errichtet wurde, unvermittelt zu Geltung.“ (Kogon, 1983, S. 77)
Auch im KZ Natzweiler herrschten ähnliche unwirtliche Klimabedingungen:
„Das Massiv und seine nähere Umgebung nennt man die ´Wetterecke´. Sie blieb seit alters her ihres ungesunden Klimas wegen unbewohnt, denn den größten Teil des Jahres über liegt der Bergkegel in Wolken gehüllt. Dieses Klima ist selbst für robuste Menschen unter den besten Ernährungsbedingungen auf die Dauer schlecht zu ertragen.“ (Ditmar, 1946, S. 25)
Zum schreckenseinflößenden und totalitären Charakter der Konzentrations- und Vernichtungslager schreibt Goffman folgendes:
„Ihr allumfassender oder totaler Charakter wird symbolisiert durch Beschränkungen des sozialen Verkehrs mit der Außenwelt sowie der Freizügigkeit, die häufig direkt in die dingliche Anlage eingebaut sind, wie verschlossene Tore, hohe Mauern, Stacheldraht, Felsen, Wassern, Wälder oder Moore.“ (Goffman, 1981, S. 15f).
c.a.b.. Die Lebensbedingungen im KZ
Prinzipiell können die inhumanen Methoden in physischen und psychischen Terror unterteilt werden. Einen Teil des physischen Terrors stellten die schrecklichen Lebensbedingungen in den Lagern dar. In seinem Werk „30.000 Tote mahnen! Die Geschichte des Konzentrationslagers Flossenbürg und seiner 100 Außenlager von 1938-1945“ läßt Siegert einen überlebenden KZ-Häftling die Lagerverhältnisse wie folgt schildern:
„Bei meinem Eintreffen in Hersbruck waren die Lagerverhältnisse grauenhaft. Die Unterkünfte glichen eher einem Schweinestall als einer menschlichen Behausung. Als Betten waren aus altem Holz zusammengezimmerte Pritschen vorhanden, drei Stockwerke hoch. Die Strohsäcke waren halb verfault. Das Lager war an einer so unglückliche Stelle errichtet, daß bei Regenfällen die Leute knietief versanken. Insgesamt waren nur 6 Klosettschüsseln vorhanden, die für 5.000 Menschen ausreichen sollten. Die Folge war, daß der Kot überall am Boden herumlag und die Jauche aus den Klärgruben austrat und bis in die Lagerküche hineinlief. Für 5.000 Häftlinge waren nur 12 Wasserhähne und 10 Brausen vorhanden. Das Essen wurde in alten Sauerkrautfässern, die beiderseits eine Holzlatte trugen, von der Küche in die Blocks getragen. Es ist wiederholt vorgekommen, daß – wenn Häftlinge zu spät von der Arbeitsstelle zurückkamen – das Essen in diesen alten, unsauberen Fässern total sauer geworden ist. Da die Häftlinge aber Hunger hatten und ein ganzes Essen nicht mehr zur Verfügung stand, waren sie gezwungen, auch das verdorbene Essen zu sich zu nehmen. Die Folge war wiederum, daß viele Häftlinge Darmerkrankungen und Durchfall bekamen.“ (Siegert 1984, S. 66)[3].
c.a.c. Der quälende Hunger
Ein weitere, nahezu alle Lagerinsassen betreffende Terrormethode war die in der soeben angeführten Textstelle ständige extreme Hungersnot. Alle Häftlinge im arbeitsfähigen Alter wurden meist zu schwerster körperlicher Arbeit herangezogen. Trotzdem bestand die Nahrung meist nur aus Ersatzkaffe, häufig verdorbenen Suppen und Eintöpfen und einer gewissen Ration Brot. Der Hunger unter den Häftlingen war oft so schlimm, daß er ihr alltägliches Leben dominierte und auch zum fortschreitenden Verfall ihrer physischen Konstitution führte. Er begann jedoch nicht nur physisch an ihnen zu zehren, sonder drohte auch ihre Persönlichkeit zu vernichten. Der Hunger wurde so schlimm, daß das gesamte Denken und Handeln nur noch um die Befriedigung dieses Mangelzustandes kreiste. Darüber hinaus hatte der Hunger eine entsolidarisierende Wirkung, da die Häftlinge einander oft das Wenige, das sie hatten, wegnahmen oder stahlen. Die Verlierer waren dabei meist Alte, Schwache und Kranke (Kirstein 1992, S. 93ff).
c.a.d. Das lagerinterne Normen- und Strafsystem
Eine weitere Spielart des in Konzentrationslagern ausgeübten Terrors war das lagerinterne Normen- und Strafsystem. Im Lager herrschte eine Fülle von Regeln, deren kleinste Verletzung die diversesten Strafen zur Folge hatte. Die Häftlinge fürchteten so ständig diese Strafen. Eine besonders harte Methode war hier, verschiedene Regeln aufzustellen, die einander widersprachen und nicht gleichzeitig erfüllt werden konnten, so daß sich die Häftlinge entscheiden mußten, welche der Regeln sie nun einhalten sollten, ständig in dem Bewußtsein dadurch eine andere Regel zu brechen. So lebten sie in der Angst vor ständiger Strafe. Zu den gebräuchlichsten Strafen zählten die Prügelstrafe, das Strafstehen, die Strafarbeit, der Arrest und die verschiedensten Varianten der Todesstrafe (Kirstein 1992, S 85 ff) (auf die diversen Foltermethoden und inhumanen Behandlungsmethoden der Häftlinge wird in Abschnitt 3.3.2 noch genauer eingegangen).
c.a.e. Angst und Abschottung
Neben dem physischen Terror bestand auch eine Reihe von Spielarten des psychischen Terrors. Eine davon war die ständige Angst, physischen Repressalien ausgesetzt zu werden. Auf diese Angst baute die Lagerführung und das Wachpersonal und hatte somit ein opportunes Mittel, um die Häftlingschaft in Schach zu halten.
Eine große Belastung war für die meisten Häftlinge auch die Tatsache, daß sie von Freunden und Verwandten völlig abgeschottet wurden und diese meist nicht einmal über ihren Aufenthaltsort Bescheid wußten (Kirstein 1992, S. 6).
c.a.f. Extremer Platzmangel
Bakels (1982) (WK 151) beschreibt eine weitere Methode des psychischen Terrors: Die Häftlinge waren aufgrund des extremen Platzmangels und der Tatsache, daß sie ständig überwacht wurden, niemals auch nur kurze Zeit für sich alleine. Bakels erzählt von einem Häftling, der dieses „Nie-und-nimmer-allein-Sein als eine extreme psychische Qual empfand und der sagte, daß dies äußerst zerstörerisch auf das Selbstgefühl des einzelnen gewirkt habe (Bakels 1982, S 210f).
c.a.g. Entindividualisierung
Ein Phänomen, das mit der großen Häftlingsmasse, aber auch mit den gezielten Methoden der SS im Zusammenhang stand, war die Entindividualisierung des einzelnen. Die Häftlinge bekamen Nummern, wurden also nicht mehr mit ihrem Namen angesprochen. Jeder Häftling erhielt die gleiche Kleidung, sämtliches Körperhaar wurde abgeschoren, persönliche Habseligkeiten wurden in Beschlag genommen.
„Nackt und mit geschorenen Köpfen sahen die Neuankömmlinge einander so ähnlich, daß sie [...] als Individuen kaum noch identifizierbar waren. Daran änderte auch die nachfolgende Einkleidung nichts. Anstelle der eigenen Kleider erhielt jeder uniforme Lagerkleidung, die ihn nicht mehr als Individuum, sondern nur noch als Angehörigen einer bestimmten Gefangenenkategorie auswies; anstatt seines Eigennamens bildete eine unpersönlich Nummer das einzige, ihm offiziell verbliebenen Identifizierungsmerkmal“ (Kirstein 1992, S. 82f).
c.a.h. Die Brechung des Einzelnen
Insgesamt gesehen war das Endziel dieser Behandlung die Brechung des einzelnen Individuums und die Aufgabe der Persönlichkeit, der somit die völlige Anpassung folgte:
„Die Essenz und Praxis des Konzentrationslagers liegt darin, daß der Mensch unberechenbarer und beliebiger Gewalt ausgeliefert und in allen (un)denkbaren Formen zunichte gemacht werden kann. Im Mahlstrom absoluter Negativität wurde Monstrosität zur Routine. Der Terror galt zu vernichtenswerten Feinden erklärten Menschen. Indem er den ununterscheidbar abstrakten einzelnen und vielen galt, sollte er die Häftlinge als je unverwechselbare Individuen brechen und willkürlich in kategoriale Serien eingliedern. Die Herstellung einer gefügigen Masse galt nicht nur dieser selbst, sondern auch den ´Volksgenossen´ außerhalb des Lagers. In dem Maß, wie das reale Gerücht des Terrors sich in diese einfraß, konnten sie leichter zu gehorsamen Objekten gemacht werden.“ (Armanski 1993, S. 64)
Um zu verhindern, daß einzelne Individuen zu Märtyrern wurden und aufrecht, erhobenen Hauptes zu ihrer Hinrichtung gingen, lag eine weitere Methode zur Brechung des Individuums darin, Gefangene vor deren Hinrichtung in Arrestzellen einzusperren, die eine Grundfläche von nur 80 x 60 cm hatten und nur 1,2 m hoch waren. Darüber hinaus waren diese Zellen auch bei größter Kälte unbeheizt. Da es innerhalb dieser Zellen erwachsenen Menschen selbstverständlich weder möglich war, ausgestreckt zu liegen noch zu stehen, konnten die Häftlinge nur zusammengekauert mit angezogenen Beinen liegen. So wurde die Beugung des Willens des Häftlings äußerlich versinnbildlicht und seine Persönlichkeit zumindest von der Körperhaltung her gebrochen. Wenn ein Häftling dann zur Todesstrafe schritt, war es ihm nach Tagen des Einnehmens dieser Haltung nicht mehr möglich, mit aufrechtem Gang und erhobenen Hauptes zur Hinrichtung zu schreiten (Kirstein 1992, S. 41).
c.a.i. Muselmänner
Jene Häftlinge, die der Behandlung im Konzentrationslager und den ständigen psychischen und physischen Terrormaßnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gewachsen waren und in denen jeglicher Lebenswille erloschen war, wurden im Lager als „Muselmänner“ bezeichnet. Sie waren von Apathie gekennzeichnet (Frankl 1977, S. 41 u. 102) und standen sozusagen am Ende des Weges durch das Konzentrationslager (Armanski 1993, S. 92). Die Muselmänner entsprossen der Lagergesellschaft selbst und waren ein Produkt derselben. Sie waren in Auflösung begriffen und verkörperten das absolute Antibild des Menschen, die Endstufe des inhumanen Terrors und waren insofern „Kern des Lagers“ (Levi 1988) (MT 200). Die Muselmänner standen auf der untersten Stufe der Häftlingshierarchie und bildeten somit eine eigene Klasse in der Lagergesellschaft. „Obwohl sie noch lebten, wurden sie doch wie Tote behandelt“ (Ryn, o.J., zitiert nach Armanski 1993, S. 93). Schmollnig beschreibt sie wie folgt:
They were known by their lifeless eyes, aimless wandering and total lack of interest in what was going on around them. Other prisoners considered them beyond help and tended to avoid them“ (Schmollnig 1984, S. 115).
Das Schicksal der Muselmänner war meist jenes, daß sie in Vereinsamung fielen und starben, da niemand helfen konnte und wollte.
c.b. Greueltaten in Konzentrations- und Vernichtungslagern – ein Zeugnis menschlicher Inhumanität
„Die Tortur dieser Lebensbedingungen und Ordnung durchstieß die Körper- und Schamgrenze der Person“ (Armanski 1993, S. 69). In diesem Zusammenhang stellt Levi (1988, S. 175) die Frage, wie man noch Mensch bleiben konnte in der „finsteren, schreienden Höllengrube des Blocks“. Auf der Tagesordnung standen ständige Schläge und Repressalien oder die unmittelbare klassische Folter selbst. Die Peiniger wollten
„Informationen herausholen, Widerstand präventiv oder selektiv ersticken und Qualen erproben. Dazu gehörten [...] Prügelrituale und –orgien, Strafexerzieren, Bunker, Ertränken, Scheinerschießungen, Beschmutzen (in/mit Kot), Zerquetschen der Glieder, Erfrieren, Baumhängen, Torstehen, [...]. Strafkompanie und Sonderkommando rundeten die Palette ab, die strukturell, spezifisch und sadistisch war (Armanski 1993, S. 69).
c.b.a. Die Arbeit als Foltermethode
Ein Instrument der Folter stellte die Arbeit dar. Sie hatte nicht nur den Zweck der Verrichtung verschiedener Tätigkeiten und der Erreichung eines wirtschaftlichen Zwecks, sondern war für die SS ein Instrument des Terrors, diente zum Quälen und Töten der Häftlinge; der eigentliche, der normale Zweck der Arbeit, dem Menschen die Mittel zur Befriedigung seiner Ziele und seiner Lebensbedürfnisse zu geben, war hier lediglich noch eine Reminiszenz aus der Freiheit (Klodzinski u.a. 1987, 135). Oft waren die Häftlinge während der Wintermonate eisiger Kälte und hohem Schnee ausgesetzt. Nur spärlichst bekleidet und teilweise sogar ohne Schuhe fanden so hunderte den Erfrierungstod. Im Hochsommer wiederum ließ die gnadenlose Sonne die schwere körperliche Arbeit, die meist in den Steinbrüchen verrichtet wurde, zur Qual werden und steigerte das Leiden ins Unermeßliche, wenn es trotz glühender Hitze den vor Durst und Erschöpfung fiebernden Häftlingen nicht gestattet war, während des Arbeitens einen Schluck Wasser zu trinken (Kirstein 1992, S. 67).
c.b.b. Todesmärsche
Eine weitere Spielart von Greuel und Terror waren die Todesmärsche, bei denen, wie deren Name schon sagt, ein großer Teil der Häftlinge ums Leben kam. Ein Betroffener, Leon Zelman, berichtet darüber unter anderem folgendes:
„Es war nicht der einzige Todesmarsch in dieser Zeit; überall leerten die Nazis ihre Lager, überall verlegten sie auf der Flucht vor den sie einschließenden Fronten die Häftlinge, die lebenden Zeugnisse ihrer Greueltaten, überall machten sie diese Verlegungen zu einem Teil ihrer Endlösung. Jetzt war der Tod nicht mehr in Lagern konzentriert, jetzt wurde er über das Land ausgestreut.
Herbstnächte könne kalt sein in Polen. Ein Marsch in Holzschuhen mit vor Hunger schwellenden Füßen, in dünnem Häftlingsgewand bei ein paar hundert Kalorien Nahrungszufuhr am Tag birgt viele Gefahren. Manche brachen, des langen Gehens entwöhnt, am ersten Tag nach wenigen Kilometern zusammen. Sobald einer in die Knie sank, war ein SS-Mann mit Hund zur Stelle und attackierte ihn.
Wer nicht hochkam, wurde an Ort und Stelle erschossen. Obwohl der Terror dieser Schäferhunde, ihre gefletschten Lefzen, ihr Geknurr und Gebell uns solch panische Angst einjagten, daß wir eine Weile weitertaumelten, dauerte es nicht lange, bis der nächste seiner Schwäche nachgab. Der Schock über seine Erschießung trieb uns wieder vorwärts. Es war ein Wechselspiel am Rand der völligen Entkräftung. Nachzugeben, liegenzubleiben und um Genickschuß Erlösung zu finden war eine starke Versuchung. Sich vom Schrecken vorwärtsreißen zu lassen, bedeutete weiterzuleben. Wozu? ´Weitergehen! Weitergehen!´ Den ersten Abend dieses Marsches erlebten Dutzende Menschen nicht mehr (Zelman 1995, S. 97f).
[...]
[1] Die Aktion trug diese Bezeichnung, weil die zentrale Planung in einer Villa in der Berliner Tiergartenstraße, Nr.4, erfolgt war.
[2] Eine andere Quelle beziffert diese mit 24.000 (Broszat 1984, S.74).
[3] In Birkenau standen pro Kopf 0,28 m2 Raum und 0,75 cm3 Luft zur Verfügung (Sehn 1957). (MT 203)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832464929
- ISBN (Paperback)
- 9783838664927
- DOI
- 10.3239/9783832464929
- Dateigröße
- 3.9 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Wien – Politikwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2003 (März)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- konzentrationslager wiedergutmachung ns-zeit juden mauthausen
- Produktsicherheit
- Diplom.de