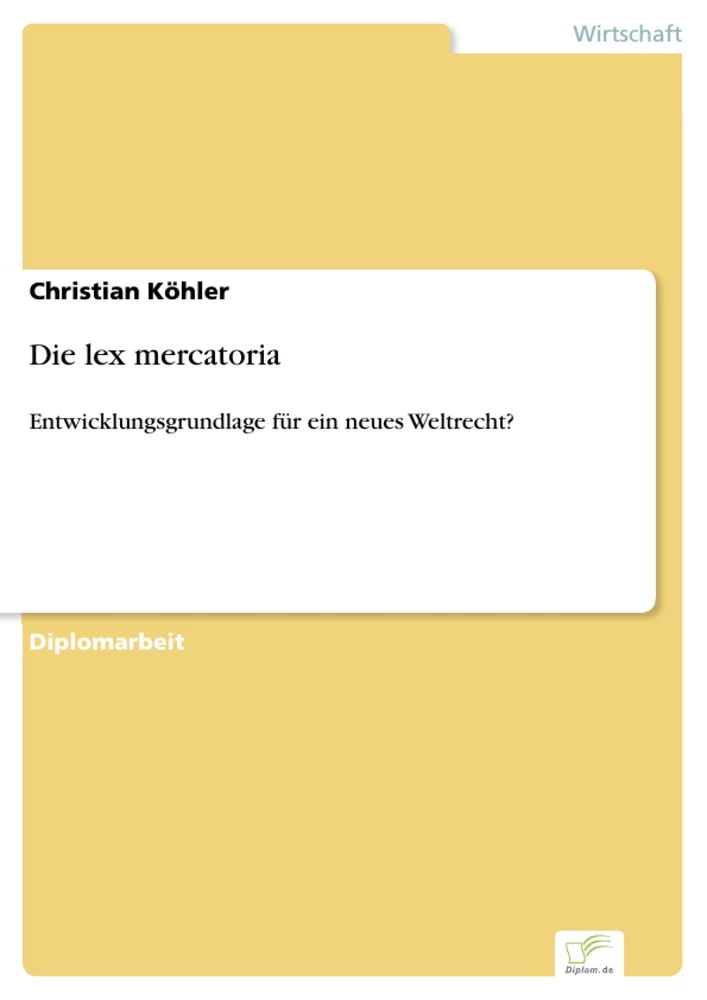Die lex mercatoria
Entwicklungsgrundlage für ein neues Weltrecht?
©2002
Diplomarbeit
75 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Modern und In ist es derzeit schon, vom internationalen Recht und einer globalen Rechtsordnung zu reden. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die Weltbank, die Welthandelsorganisationen, internationale Sportverbände sowie der Internationale Währungsfond sind die Spitze einer erfolgreichen Globalisierung. Doch arbeiten diese Institutionen in ihrem Rahmen einer globalen Rechtsordnung und eines internationalen Rechts bereits außerordentlich erfolgreich. Manch einer könnte an dieser Stelle anmerken, dass diese Rechtsordnung nichts anderes ist, als der schon seit Jahrzehnten bekannte Modus der Rechtsauslegung und der Rechtsvergleichung, garniert mit den Normen des internationalen Privatrechts oder ggf. der UN-Kaufrechtskonvention. Warum also ein globales Recht schaffen?
Mythos, Phantom oder Hirngespinst sind Begriffe, die an einer Existenz der lex mercatoria zweifeln lassen. Internationale Verträge wie Lando, UN-Kaufrechtskonvention oder UNCITRAL, anerkannte Prinzipien der UNIDROIT oder der Internationalen Handelskammer, das seit langem existierende Internationale Privatrecht (IPR), aber auch die jahrzehntelange Schiedsgerichtspraxis verstärken den ersten Eindruck und werfen die Frage nach Entstehung, Entwicklung und Eingliederung einer lex mercatoria auf.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Antwort auf die Frage, ob die lex mercatoria eine Basis für ein Weltrecht ist. Dazu wird diese Arbeit Beschreibungen und Definition von Globalisierung, Recht, Weltrecht und lex mercatoria liefern und diese untereinander in Beziehung setzten.
Aufbauend auf dem Begriff Konzern und Macht wird das Phänomen Globalisierung erklärt. Es sollte eine Notwendigkeit nach einem globalen Recht oder einer Rechtsordnung gesehen werden. Danach wird das Theoriekonstrukt einer positiven Rechtslehre und einer systemtheoretischen Rechtslehre erklärt und gegenseitig abgewogen. Das vierte Kapitel fragt nach Quasi-Recht, also nach Rechtsquellen ohne staatlichen Bezug im Staat. Aus dieser Zusammenstellung soll die Praxis mit dem Wissen der Theorie beleuchtet und kritisch hinterfragt werden. Nur so kann im letzten Kapitel die Lehre von der lex mercatoria entfa ltet und auf die Fragestellung hin überprüft werden. Am Schluss soll ein Ausblick mögliche Entwicklungen eines globalen Rechts skizzieren.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
LiteraturverzeichnisI
1.Einleitung1
1.1Einführung1
1.2Ziel der […]
Modern und In ist es derzeit schon, vom internationalen Recht und einer globalen Rechtsordnung zu reden. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die Weltbank, die Welthandelsorganisationen, internationale Sportverbände sowie der Internationale Währungsfond sind die Spitze einer erfolgreichen Globalisierung. Doch arbeiten diese Institutionen in ihrem Rahmen einer globalen Rechtsordnung und eines internationalen Rechts bereits außerordentlich erfolgreich. Manch einer könnte an dieser Stelle anmerken, dass diese Rechtsordnung nichts anderes ist, als der schon seit Jahrzehnten bekannte Modus der Rechtsauslegung und der Rechtsvergleichung, garniert mit den Normen des internationalen Privatrechts oder ggf. der UN-Kaufrechtskonvention. Warum also ein globales Recht schaffen?
Mythos, Phantom oder Hirngespinst sind Begriffe, die an einer Existenz der lex mercatoria zweifeln lassen. Internationale Verträge wie Lando, UN-Kaufrechtskonvention oder UNCITRAL, anerkannte Prinzipien der UNIDROIT oder der Internationalen Handelskammer, das seit langem existierende Internationale Privatrecht (IPR), aber auch die jahrzehntelange Schiedsgerichtspraxis verstärken den ersten Eindruck und werfen die Frage nach Entstehung, Entwicklung und Eingliederung einer lex mercatoria auf.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Antwort auf die Frage, ob die lex mercatoria eine Basis für ein Weltrecht ist. Dazu wird diese Arbeit Beschreibungen und Definition von Globalisierung, Recht, Weltrecht und lex mercatoria liefern und diese untereinander in Beziehung setzten.
Aufbauend auf dem Begriff Konzern und Macht wird das Phänomen Globalisierung erklärt. Es sollte eine Notwendigkeit nach einem globalen Recht oder einer Rechtsordnung gesehen werden. Danach wird das Theoriekonstrukt einer positiven Rechtslehre und einer systemtheoretischen Rechtslehre erklärt und gegenseitig abgewogen. Das vierte Kapitel fragt nach Quasi-Recht, also nach Rechtsquellen ohne staatlichen Bezug im Staat. Aus dieser Zusammenstellung soll die Praxis mit dem Wissen der Theorie beleuchtet und kritisch hinterfragt werden. Nur so kann im letzten Kapitel die Lehre von der lex mercatoria entfa ltet und auf die Fragestellung hin überprüft werden. Am Schluss soll ein Ausblick mögliche Entwicklungen eines globalen Rechts skizzieren.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
LiteraturverzeichnisI
1.Einleitung1
1.1Einführung1
1.2Ziel der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6490
Köhler, Christian: Die lex mercatoria - Entwicklungsgrundlage für ein neues Weltrecht?
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: München-Neubiberg, Universität der Bundeswehr, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
II
Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis... I
1. Einleitung ... 1
1.1 Einführung...1
1.2 Ziel der Arbeit ...2
1.3 Vorgehensweise...2
2. Globalisierung...3
2.1 Begriff Konzernmacht...5
2.2 Lobbyismus als Machtfaktor?... 10
2.3 NGOs als Opposition der Konzernmacht ...13
2.4 Zusammenfassung ...15
3. Rechtstheorien... 17
3.1 Beginn des Rechts ...18
3.2 Die Theorie des dritten Manns ...19
3.3 Rechtsposivitismus ... 22
3.4 Systemtheorie... 25
3.5 Zusammenfassung und kritische Betrachtung ... 32
4. Quasi-Recht im Normenstaat ...35
4.1 Kurzer Abriss des deutschen Rechtssystems ... 36
4.2 Lobbyismus im dt. Gesetzgebungsverfahren...37
4.3 Normvermeidende Absprachen...40
4.4 Private Rechtssetzung... 43
4.5 Vertragliche private Absprachen... 45
III
5. Phänomen der lex mercatoria ...48
5.1 Beschreibung der lex mercatoria ...50
5.2 Lex mercatoria eine Rechtsordnung?... 52
5.3 Lex mercatoria im Vertragsrecht... 54
5.4 Lex mercatoria Basis für ein Weltrecht?...57
6. Ausblick... 61
Literaturverzeichnis
Beck, Reinhart
(1986) Sachwörterbuch der Politik,
Stuttgart: Kröner.
Beck, Ulrich
(1996) Die Subpolitik der Globalisierung: Die
neue Macht der multinationalen Unterneh-
men,
in: Gewerkschaftliche Monatshefte, S.673-680.
Berger, Klaus Peter
(1996) Formalisierte oder "schleichende" Kodi-
fizierung des transnationalen Wirtschafts-
rechts Zu den methodischen und praktischen
Grundlagen der lex mercatoria, Berlin: de
Gruyter.
Berger, Klaus Peter
(2002) Lex Mercatoria Online - www.tldb.de:
Die CENTRAL Transnational Law Database,
in: RIW, S. 256-262.
Blankenburg, Erhard
(1994) Diskurs oder Autopoiesis: Lassen sich
Rechtstheorien operationalisieren?
in: Zeitschrift für Rechtssoziologie, S. 115-125.
Brockhaus
(2001) Brockhaus Nachschlagen im einbän-
digen Brockhaus: ,,Macht". Online AVL: URL:
http://www.brockhaus.de/suche_ tref-
fer_detail.php?lema=Macht&werk_id=3&artik
el_id=3015680 [Stand: 06.12.2001].
II
Brown, J.
(2001) Time to engage With Pressure Groups,
in: Financial Times, 2.4.2001, Online AVL:
URL: http://www.globalpolicy.
org/ngos/role/globalact/business/
2001/0405time.htm [Stand: 10.12.2001].
Bundeskriminalamt
(2002) Fahndung nach Personen, Online AVL:
URL: http://www.bka.de [Stand: 25.05.2002].
Cremades, Bermardo /
Plehn, Steven
(1984) "The New Lex Mercatoria and the Har-
monization of the Laws of International Com-
mercial Transactions",
in: Boston University International Law Jour-
nal, S. 317-348.
Dilenschneider, Robert
(1992) Macht und Einfluss: Mitarbeiter und
Medien für eigene Ziele gewinnen, Wiesbaden.
Deutscher Bundestag
(2002a) Die Gesetzgebung, Online AVL: URL:
http://www.bundestag.de [Stand: 3.6.2002]
Deutscher Bundestag
(2002b) Drucksache 14/6910.
Dörrenbächer, Chris-
toph /
Riedel, Christian
(2000) Strategie, Kultur und Macht Ein klei-
ner Streifzug durch die Literatur zur Internati-
onalisierung von Unternehmen,
in Dörrenbächer, Christopher / Plehwe, Dieter
(Hrsg.): Grenzenlose Kontrolle?: Organisatori-
scher Wandel und politische Macht multinati-
onaler Unternehmen, Berlin, 2000, S.15-41.
III
Dupuy, Jean Pierre
(1988) On the Supposed Closure of Normative
Systems,
in Teubner, Gunther: Autopoetic Law,
S. 51 ff., 68.
Eckhoff, Torstein /
Sundby, Nils Kristian
(1998) Rechtssysteme Eine systemtheoreti-
sche Einführung in die Rechtstheorie, Berlin:
Duncker & Humblot.
Ehrlich, Eugen
(1913) Grundlegung der Soziologie des Rechts.
Nachdruck 1967. 4. Aufl. 1989. Berlin: Du n-
cker & Humblot.
Engländer, Armin
(2000) Grundzüge des modernen Rechtsposi-
vitismus,
in: JURA, Seite 113-118.
Geismann, Georg
(1992) Politische Philosophie hinter Kant zu-
rück? Zur Kritik der "klassischen" Politi-
schen Philosophie,
in: Jahrbuch für Politik, S. 319-336.
Hillman, A. /
Zardkoohi, A./
Bierman, L.
(1999) Corporate Political Stategies And Firm
Performance: Indications Of Firm-Specific
Benefits From Personal Service In The U.S.
Government,
in: Strategic Management Journal, S. 67-81.
Hoffmann, F.
(1993) Der Konzern als Gegenstand betriebs-
wirt-
schaftlicher Forschung,
in Hoffmann, F. (Hrsg.): Konzernhandbuch,
Recht-Steuern-Rechnungslegung-Führung-
Organsiation-Praxisfälle, Wiesbaden, S. 5-24.
IV
Hofmann, Hasso
(2000) Einführung in die Rechts- und Staats-
philosophie, Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.
Kant, Immanuel
(1902) Grundlegung der Metaphysik der Sit-
ten,
in Kant, Immanuel: Werke, Berlin: Preußische
Akademie der Wissenschaft. Bd. IV, S. 385-
463.
Kappus, Andreas
(1990) 'Lex mercatoria' in Europa und Wiener
UN-Kaufrechtskonvention 1980, Frankfurt am
Main: Peter Lang.
Kelsen, Hans
(1934) Reine Rechtslehre, Wien.
Ladeur, Karl-Heinz
(2000) Die rechtswissenschaftliche Metho-
dendiskussion und die Bewältigung des gesell-
schaftlichen Wandels Zugleich ein Beitrag
zur Bedeutung der ökonomischen Analyse des
Rechts,
in: RabelsZ, S. 60-103.
Luhmann, Niclas
(2000) Die Rückgabe des zwölften Kamels:
Zum Sinn einer soziologischen Analyse des
Rechts,
in: Zeitschrift für Rechtssoziologie, S. 3-60.
Lutterbeck, Bernd
(2001) Internet Governance - Regulierungsan-
sätze für eine Weltordnung für globale Kom-
munikation, Wustrau, 16.2.2001.
V
Mertens, Hans-Joachim (1997) Lex Mercatoria: A Self-applying System
Beyond National Law?
in Teubner, Gunter (ed.): Global Law Without
a State, Hants (England): Dartmouth. S. 31-44.
Muchlinski, Peter T.
(1997) 'Global Bukuwina' Examined: Viewing
the Multinational Enterprise as a Transna-
tional Law-making Community,
in Teubner, Gunter (ed.): Global Law Without
a State, Hants (England): Dartmouth.
S. 79-108.
Neue Züricher Zeitung
(2002) Sonjas Frage Die Mühen des Rechts
mit der Internationalisierung und der Globali-
sierung. 15.06.2002, S. 85.
Newmann, Katherine
(1983) Law and Economic Organization. A
Comparative Study of Preindustrial Societies,
Cambridge: Cambridge University.
Paul, J.
(2000): NGOs and Global Policy-Making,
Online AVL: URL:
http://www.globalpolicy.org/ngos/analysis/an
al00.htm [Stand: 10.12.2001]
Plate, Bernhard von
(1999) Grundelemente der Globalisierung,
in: Informationen zur polit ischen Bildung
Globalisierung. Hrsg.: Bundeszentrale für poli-
tische Bildung, Bonn.
Rau, Johannes
(2002) Chancen, nicht Schicksal die Global-
isierung politisch gestalten. Online AVL: URL:
http://www.bundespraesident.de [Stand:
13.05.2002]
VI
Ricardo, David
(1969) The Principles of Political Economy and
Taxation, London: Everymen's library.
Robé, Jean-Philippe
(1997) Multinational Enterprises: The Consti-
tution of al Pluralistic Legal Order,
in Teubner, Gunter (ed.): Global Law Without
a State, Hants (England): Dartmouth. S. 45-78.
Sakowski, Klaus
(2002) Rechtsquellen des Arbeitsrechts. Onli-
ne AVL: URL:
http://www.sakowski.de/skripte/arbeit1.html
[Stand: 06. Mai 2002].
Sassen, Saskia
(2001) A New Geography of Power ? Online
AVL: URL:
http://www.globalpolicy.org/nations/sassen.h
tm [Stand: 10.12.2001].
Schnitzer, Adolf F.
(1977) Die Einordnung der internationalen
Sachverhalte in das Rechtssystem,
in: Festschrift F.A. Mann, S. 289-305.
Stein, Ursula
(1995) Lex mercatoria: Realität und Theorie,
Frankfurt am Main: Klostermann.
Teubner, Gunter
(2000a) Privatregimes: Neo-Spontanes Recht
und duale Sozialverfassungen in der Weltge-
sellschaft?,
in Simon, Dieter und Weiss, Manfred (Hrsg.):
Zur Autonomie des Individuums. Liber Amico-
rum Spiros Simitis, Baden-Baden: Nomos. S.
437-453.
VII
Teubner, Gunter
(2000b) Rechtsentfremdung: Zum gesell-
schaftlichen Mehrwert des zwölften Kamels,
in: Zeitschrift für Rechtssoziologie, S. 189-215.
Teubner, Gunther
(1996) Globale Bukowina, Zur Emergenz eines
transnationalen Rechtspluralismus,
in: Basler Schriften, Basel: Europainstitut der
Universität Basel
The Economist
(2001) Volume 360, Number 8241, Beilage:
Globalisation and its critics A survey of glob-
alisation, 29.11.2001
Trotha, Trutz von
(2000) Was ist Recht? Von der gewalttätigen
Selbsthilfe zur staatlichen Rechtsordnung,
in: Zeitschrift für Rechtssoziologie, S. 327-354.
United Nations Confer-
ence on Trade and De-
velopment (UNCTD)
(2000) Überleben im globalen Wettbewerb ist
treibende Kraft im gegenwärtigen Fusions-
und Übernahmeboom; Pressemitteilung vom
3.10.2000. Online AVL: URL:
http://www.unctad.org [Stand: 11.12.2001].
Vesting, Thomas
(2001) Kein Anfang und kein Ende Die Sys-
temtheorie des Rechts als Herausforderung für
Rechtswissenschaft und Rechtsdogmatik,
in: JURA, S. 299-305.
Wallerstein, Immanuel
(1979) The Capitatist World Economy, Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Weber, Max
(1985) Wirtschaft und Gesellschaft,
in: Schriften und Reden, Band 22, Teilband 1,
Tübingen.
1
1. Einleitung
1.1 Einführung
Mythos, Phantom oder Hirngespinst sind Begriffe, die an einer
Existenz der lex mercatoria zweifeln lassen.
1
Internationale Ver-
träge wie Lando, UN-Kaufrechtskonvention oder UNCITRAL,
anerkannte Prinzipien der UNIDROIT oder der Internationalen
Handelskammer, das seit langem existierende Internationale
Privatrecht (IPR), aber auch die jahrzehntelange Schiedsge-
richtspraxis verstärken den ersten Eindruck und werfen die
Frage nach Entstehung, Entwicklung und Eingliederung einer
lex mercatoria auf.
Wurzeln im Zeitraffer
Durch Märkte und Messen, die hauptsächlich durch "fliegende",
nicht ortsansässige, Kaufleute beschickt wurden, war schnelle,
effiziente und gerechte Klärung von Streitfällen nötig. Daher
wurden Sondergerichte eingeführt, wie bspw. die sog. "Piepow-
der-Courts" oder der Bozener Merkantilmagistrat. Die Verfah-
ren wurden grundsätzlich mündlich, unmittelbar und unter
Verzicht auf jeden Schriftwechsel durchgeführt. Richter waren
von den Besuchern unmittelbar gewählte Kaufleute.
Die lex mercatoria war hier spezielles Marktrecht, welches ohne
Staat und staatliche Gerichtsbarkeit gesprochen und vollzogen
wurde.
Doch bereits mit Ende des 17. Jahrhunderts haben einzelne
Staaten angefangen, die lex mercatoria in innerstaatliche
Rechtsordnungen zu inkorporieren. Spätestens mit Anfang des
19. Jahrhunderts war der Bruch mit jener "alten" in allen Staa-
ten vollzogen.
1
Stein, 1995, S. 203.
2
Bis ins 20. Jahrhundert hinein dauerte das vorläufige Ende der
lex mercatoria. Nach dem 2. Weltkrieg haben die Mercatoristen
allen voran Schmitthof 1957 mit ihrer Forderung nach Auf-
erstehung und Loslösung des internationalen Handelsrechts
vom Nationalen diese "neu" geschaffen.
2
1.2 Ziel der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit ist die Antwort auf die Frage, ob die lex
mercatoria eine Basis für ein Weltrecht ist. Dazu wird diese Ar-
beit Beschreibungen und Definition von Globalisierung, Recht,
Weltrecht und lex mercatoria liefern und diese untereinander in
Beziehung setzten.
1.3 Vorgehensweise
Aufbauend auf dem Begriff Konzern und Macht wird das Phä-
nomen Globalisierung erklärt. Es sollte eine Notwendigkeit
nach einem globalen Recht oder einer Rechtsordnung gesehen
werden. Danach wird das Theoriekonstrukt einer positiven
Rechtslehre und einer systemtheoretischen Rechtslehre erklärt
und gegenseitig abgewogen. Das vierte Kapitel fragt nach "Qua-
si-Recht", also nach Rechtsquellen ohne staatlichen Bezug im
Staat. Aus dieser Zusammenstellung soll die Praxis mit dem
Wissen der Theorie beleuchtet und kritisch hinterfragt werden.
Nur so kann im letzten Kapitel die Lehre von der lex mercatoria
entfaltet und auf die Fragestellung hin überprüft werden. Am
Schluss soll ein Ausblick mögliche Entwicklungen eines globa-
len Rechts skizzieren.
2
Kappus, 1990, S. 37 ff.
3
2. Globalisierung
"Das Machtstreben ohnehin schon mächtiger Konzerne vergrö-
ßert die Ungerechtigkeit dieser Welt." "Findige Wall-Street-
Spekulanten stürzen ganze Volkswirtschaften in den Ruin." Mit
dieser Kritik am Handel mit Gütern und Geld über alle Grenzen
hinweg, an der Konzentration der Global Player und an der
Vernetzung von Volkswirtschaften wird die ökonomische Glo-
balisierung zum Ungeheuer in der öffentlichen Wahrnehmung
gemacht. Vordergründig wehren sich die Kritiker gegen die
Auswüchse des Turbokapitalismus, Neoliberalismus und der
Privatisierungswelle.
Dabei folgt die Globalisierung einer in sich geschlossenen Theo-
rie, nach der die Welthandelsorganisation (WTO) auch gut 58
Jahre nach ihrer Gründung noch die internationalen Handels-
regeln auslegt. Der englische Banker Ricardo bewies die Vortei-
le des Handels und die Nachteile von Zöllen. Mit "komparativen
Kostenvorteilen" begründete Ricardo die Tatsache, dass sich der
Handel zwischen zwei Ländern selbst dann für beide Volkswirt-
schaften lohnt, wenn ein Land alle Güter günstiger herstellen
kann.
3
Unterstützung erfahren die Anhänger Ricardos von anderen be-
rühmten Ökonomen. Zunächst Adam Smith, schottischer Mo-
ralphilosoph, der Vater der klassischen Volkswirtschaftslehre
und so etwas wie der Erfinder der freien Marktwirtschaft. Und
schließlich Milton Friedmann. "Weniger Staat, dafür Freiheit
für die Wirtschaft", ließe sich das Credo des Amerikaners zu-
sammenfassen.
3
Ricardo, 1969, S. 5 ff.
4
Von Liberalismus ist der internationale Güterhandel dennoch
weit entfernt. Mit Zöllen oder der Subventionierung der eigenen
Produktion erschweren die Industrienationen den Import von
Textil- und Agrarprodukten, mithilfe derer Entwicklungsländer
vom Handel profitieren könnten. Verliefe die Globalisierung ge-
recht, so die Kritik, müssten gerade die reichen Länder ihre
Märkte öffnen. In diesem Fall geht einigen Globalisierungskriti-
kern die Liberalisierung nicht weit genug.
Anders beim Kapital, dessen ungebremster Verkehr in den Au-
gen vieler überwiegend Schaden anrichtet. Heute liegen die Zu-
wachsraten im grenzüberschreitenden Handel mit Wertpapie-
ren und Devisen deutlich über denen des Güterhandels. 1,5 Bil-
lionen US-Dollar beträgt allein das gehandelte Devisenvolumen
am Tag, der Wert der gehandelten Güter beläuft sich lediglich
auf ein Fünfzigstel dessen.
Anlage- und Direktinvestitionen forcieren weltweit das Wirt-
schaftswachstum. Bevor Länder wie Mexiko, Singapur, Thai-
land, Indonesien, Südkorea oder Argentinien in die Krise stürz-
ten, profitierten sie von internationalen Kapitalspritzen. Zwi-
schen 1990 und 1996, in den Jahren der Asienkrise, stieg das
Pro-Kopf-Einkommen in den ostasiatischen Tigerstaaten infla-
tionsbereinigt um mehr als 40 Prozent.
Zur Katastrophe kam es erst, als die Investoren ihr Geld auf ei-
nen Schlag abzogen und dabei noch Geld verdienten. Die
Stunde der Währungsspekulanten: Investoren nahmen große
Kredite in einer schwachen Währung auf und warfen diese kurz
darauf wieder auf den Markt.
Die Kritik an der Globalisierung bezieht sich in diesem Fall auf
die große Freiheit der Finanzjongleure, Geld ohne Auflagen ab-
zuziehen und anderswo wieder anzulegen. Von Regulierungen
5
der internationalen Finanzströme, Tobin-Steuer, Kapitalim-
portbeschränkungen und Kapitalverkehrskontrollen ist immer
häufiger die Rede. Doch die Lobbyisten von der Wall Street
wehren sich bislang erfolgreich gegen jede politische
Einflussnahme.
In diesem Teil der Arbeit soll die Macht der Konzerne einer glo-
balisierten Welt kurz beleuchtet werden. Sind sie tatsächlich so
mächtig, ohne Rücksicht auf staatliche Souveränität ihr eigenes
Verständnis von Regeln der Globalisierung durchzusetzen?
2.1 Begriff Konzernmacht
Ein Konzern besteht aus einem herrschenden und ein oder
mehreren abhängigen Unternehmen unter einheitlicher Leitung
des herrschenden Unternehmens.
4
Die betriebswirtschaftliche
Begriffsbestimmung des Konzerns verknüpft die rechtlich-
formalen Merkmale mit wirtschaftlich-materiellen Merkmalen.
Zentrales Kennzeichen des Konzerns ist demnach, neben der
rechtlichen Selbständigkeit der Töchter, die Integrationskraft
der einheitlichen Leitung. Daraus ergibt sich eine wirtschaftlich
autonome Einheit mit der entsprechenden Entscheidungs- und
Handlungseinheit.
5
Der Begriff der Macht wird wie folgt definiert:
,,Im allgemeinsten Verständnis bezeichnet M. [Macht,
Anm.d.Verf.] die Summe aller Kräfte und Mittel, die einem
Akteur (einer Person, einer Gruppe oder einem Sachver-
halt, auch der Natur) gegenüber einem anderen Akteur zur
Verfügung stehen".
6
4
AktG, § 18, Abs. 1, S. 1, 1. HS.
5
Hoffmann, 1993, S.6.
6
Brockhaus, 1998, S.706.
6
Macht beschreibt also das Verhältnis einer Über- bzw. Unter-
ordnung zwischen Personen, Gruppen, Organisationen oder
Staaten. Macht existiert unabhängig von der Anerkennung der
von ihr Betroffenen.
Weiterführend lässt sich der Begriff der Macht vier unterschied-
lichen Bestimmungsbereichen zuordnen:
a) Beschreibung einer sozialen Beziehung
Macht wird hierbei als Chance verstanden, den eigenen Willen
auch gegen Widerstände innerhalb einer sozialen Beziehung
durchzusetzen. Von Begriffen wie Autorität, Gewalt, Herrschaft,
Kraft oder Zwang unterscheidet sich Macht dadurch, dass sie
weniger spezifisch ist, wenngleich es durchaus Bezugsmöglich-
keiten und Überschneidungen gibt.
7
b) Politik und Staatswesen
Dieser Bereich wird charakterisiert durch supranationale Wech-
selbeziehungen und dem sich daraus ergebenden Einfluss-
vermögen von Politik und Staaten.
c) Einflussnahme
,,[...] M. [Macht, Anm.d.Verf.] kann in einem weitesten
Sinn die Fähigkeit bedeuten, Einfluss auszuüben und dabei
bestehenden Hindernissen überlegen zu sein, wobei dies
personale Akteure ebenso umfassen kann wie Naturkräfte
oder Figurationen".
8
d) Bereich des Übersinnlichen
Unter diesen Bereich fallen übersinnliches Einflussvermögen
und übersinnliche Kräfte bis hin zur Allmacht Gottes.
9
7
Weber, 1985, S.57
8
Brockhaus, 1998, S.706
9
Brockhaus, 1998, S.706.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832464905
- ISBN (Paperback)
- 9783838664903
- DOI
- 10.3239/9783832464905
- Dateigröße
- 502 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität der Bundeswehr München, Neubiberg – Wirtschafts- und Organisationswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Mai)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- kaufmannsrecht luhmann arbeitsrecht globalisierung risiken
- Produktsicherheit
- Diplom.de