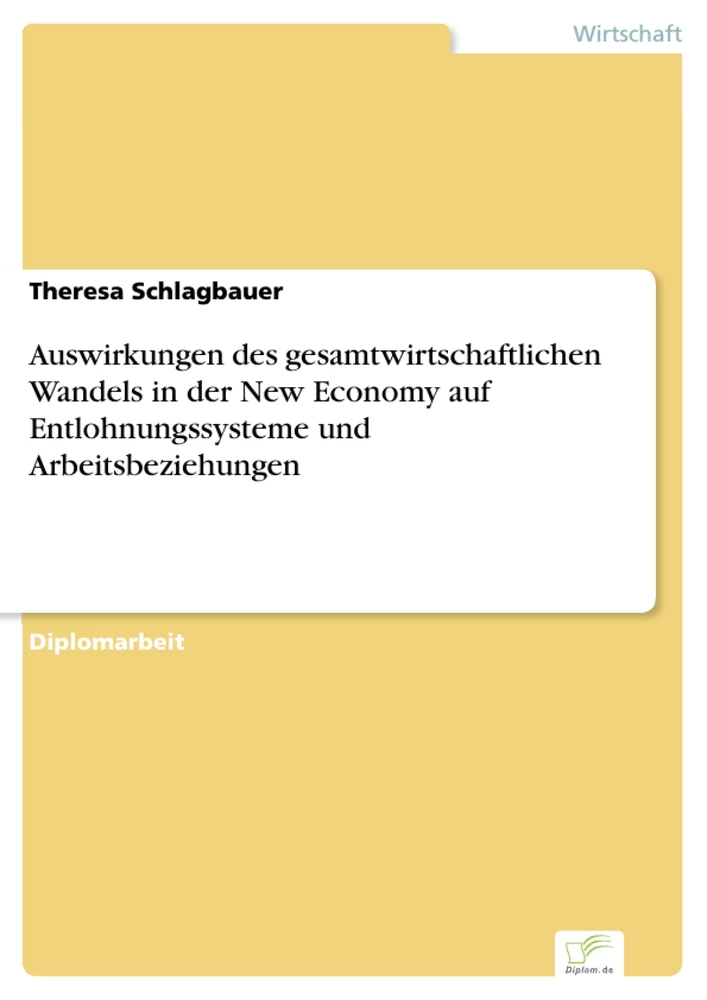Auswirkungen des gesamtwirtschaftlichen Wandels in der New Economy auf Entlohnungssysteme und Arbeitsbeziehungen
©2002
Diplomarbeit
114 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen der Wirtschaft stark verändert: die Märkte wurden dynamischer und globaler, die Unternehmen mussten lernen, flexibler, unbürokratischer und innovativer zu agieren. Neue Produkte und Dienstleistungen entstanden im Rahmen der neuen Kommunikationstechnologien. Der Übergang zur Informationsgesellschaft wurde vielfach als ebenso revolutionär wie der Entritt ins Industriezeitalter beschrieben.
Auch wenn alle Unternehmen von diesen Veränderungen betroffen sind, wird der Begriff New Economy (erstmals erwähnt im Jahr 1994) primär für jene Unternehmen verwendet, die die neuen Kommunikations- und Informationstechnologien herstellen, betreiben oder intensiv einsetzen.
Die neue Unternehmensumwelt und die neuen Strukturen in der New Economy stellen geänderte Ansprüche an den Personalbereich. Das Wissen der Mitarbeiter wird zu einem der wichtigsten Produktionsfaktoren und muss dementsprechend gefördert werden. Flexibilität und Dynamik sind auch im Personalbereich bedeutende Ziele. Der Druck von außen auf das Unternehmen wächst; ebenso wächst der Druck innerhalb des Unternehmens. Die Wissensträger sollen an das Unternehmen gebunden werden, um Leistung und Wettbewerbsvorteile erzielen zu können. Gleichzeitig soll die Arbeitnehmerschaft möglichst flexibel bleiben, um rasch auf neue Anforderungen der Unternehmensumwelt reagieren zu können.
Aber auch die Einstellungen der Arbeitnehmer haben sich gewandelt: die lebenslange Bindung an ein Unternehmen ist nicht mehr die optimale Arbeitsform für alle Arbeitnehmer. Durch die Notwendigkeit der größtmöglichen Flexibilität der Unternehmen können diese ihren Mitarbeitern keine Arbeitsplatzgarantie mehr geben; im Gegenzug schwindet auch die Loyalität der Mitarbeiter gegenüber ihrem Unternehmen. Häufige Unternehmenswechsel sind keine Seltenheit, wenn der Mitarbeiter glaubt, anderswo bessere finanzielle Möglichkeiten oder Karriereaussichten zu finden.
Auch wenn der gesamte Personalbereich gefordert ist, sich an diese neuen Charakteristika und Anforderungen der Arbeitswelt anzupassen, soll sich diese Arbeit auf die Entlohnung der Mitarbeiter in der New Economy konzentrieren.
Neue Strukturen in den Unternehmen, Marktanforderungen und Arten der Beschäftigung fordern teils neue, teils angepasste Formen der Entlohnung.
Es ist unbestritten, dass Geld nicht die einzige Motivation für Arbeit und Leistung ist, dennoch ist Entlohnung einer der […]
In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen der Wirtschaft stark verändert: die Märkte wurden dynamischer und globaler, die Unternehmen mussten lernen, flexibler, unbürokratischer und innovativer zu agieren. Neue Produkte und Dienstleistungen entstanden im Rahmen der neuen Kommunikationstechnologien. Der Übergang zur Informationsgesellschaft wurde vielfach als ebenso revolutionär wie der Entritt ins Industriezeitalter beschrieben.
Auch wenn alle Unternehmen von diesen Veränderungen betroffen sind, wird der Begriff New Economy (erstmals erwähnt im Jahr 1994) primär für jene Unternehmen verwendet, die die neuen Kommunikations- und Informationstechnologien herstellen, betreiben oder intensiv einsetzen.
Die neue Unternehmensumwelt und die neuen Strukturen in der New Economy stellen geänderte Ansprüche an den Personalbereich. Das Wissen der Mitarbeiter wird zu einem der wichtigsten Produktionsfaktoren und muss dementsprechend gefördert werden. Flexibilität und Dynamik sind auch im Personalbereich bedeutende Ziele. Der Druck von außen auf das Unternehmen wächst; ebenso wächst der Druck innerhalb des Unternehmens. Die Wissensträger sollen an das Unternehmen gebunden werden, um Leistung und Wettbewerbsvorteile erzielen zu können. Gleichzeitig soll die Arbeitnehmerschaft möglichst flexibel bleiben, um rasch auf neue Anforderungen der Unternehmensumwelt reagieren zu können.
Aber auch die Einstellungen der Arbeitnehmer haben sich gewandelt: die lebenslange Bindung an ein Unternehmen ist nicht mehr die optimale Arbeitsform für alle Arbeitnehmer. Durch die Notwendigkeit der größtmöglichen Flexibilität der Unternehmen können diese ihren Mitarbeitern keine Arbeitsplatzgarantie mehr geben; im Gegenzug schwindet auch die Loyalität der Mitarbeiter gegenüber ihrem Unternehmen. Häufige Unternehmenswechsel sind keine Seltenheit, wenn der Mitarbeiter glaubt, anderswo bessere finanzielle Möglichkeiten oder Karriereaussichten zu finden.
Auch wenn der gesamte Personalbereich gefordert ist, sich an diese neuen Charakteristika und Anforderungen der Arbeitswelt anzupassen, soll sich diese Arbeit auf die Entlohnung der Mitarbeiter in der New Economy konzentrieren.
Neue Strukturen in den Unternehmen, Marktanforderungen und Arten der Beschäftigung fordern teils neue, teils angepasste Formen der Entlohnung.
Es ist unbestritten, dass Geld nicht die einzige Motivation für Arbeit und Leistung ist, dennoch ist Entlohnung einer der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6488
Schlagbauer, Theresa: Auswirkungen des gesamtwirtschaftlichen Wandels in der New
Economy auf Entlohnungssysteme und Arbeitsbeziehungen
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniversität, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
1
1
Einleitung...3
2
Grundlagen zur Entlohnung ...6
2.1
Begriffliche Grundlagen ...6
2.2
Theoretische Grundlagen für Entgeltsysteme...7
2.2.1
Lohngerechtigkeit...9
2.3
Faktoren der Gehaltsfindung ...10
2.3.1
Interne Faktoren der Gehaltsfindung ...10
2.3.2
Externe Faktoren der Gehaltsfindung ...13
2.4
Formen der Entlohnung ...14
2.4.1
Grundlohn bzw. Zeitlohn...16
2.4.2
Leistungsentgelt...18
2.4.3
Mitarbeiterbeteiligung/ Erfolgsbezogene Entlohnung ...24
2.4.4
Soziallohn...28
3
Die New Economy...31
3.1
Begriffsdefinition...31
3.2
Die Geschichte der New Economy...34
3.3
Kennzeichen der New Economy...38
3.3.1
Neue Informations- und Kommunikationstechnologien...39
3.3.2
Gesamtwirtschaftliche Charakteristika ...44
3.3.3
Industrielle Charakteristika ...49
3.3.4
Regierung ...50
3.3.5
Arbeitswelt...51
4
Entlohnung in der New Economy...57
4.1
Der neue psychologische Vertrag ...58
4.2
Grundlohn ...60
4.2.1
Funktions oder Personenbezogene Entlohnung ...60
4.2.2
Skill-based Pay...62
4.2.3
Competency-based Pay ...64
4.2.4
Broadbanding ...65
4.3
Leistungsentgelt...67
4.3.1
Voraussetzungen für effektives Leistungsentgelt...68
4.3.2
Merit Pay...69
4.3.3
Einmalzahlung und Bonus ...71
4.3.4
Management by Objectives...71
2
4.4
Mitarbeiterbeteiligung / Erfolgsbezogene Entlohnung ...75
4.4.1
Gainsharing ...76
4.4.2
Goalsharing ...77
4.4.3
Profit Sharing/Gewinnbeteiligung ...79
4.4.4
Stock Plans und Stock Option Pläne ...79
4.4.5
Andere Arten der Eigenkapitalbeteiligung ...82
4.5
Entlohnung von Teams ...83
4.5.1
Work Teams ...84
4.5.2
Projektteams ...84
4.5.3
Parallele Teams ...85
4.5.4
Partnership Teams ...86
4.6
Soziallohn...87
4.6.1
Cafeteria-Systeme ...87
4.7
Atypische Beschäftigungsformen...92
4.7.1
Teilzeitarbeit ...93
4.7.2
Geringfügige Beschäftigung ...95
4.7.3
Befristete Beschäftigung ...95
4.7.4
Job Sharing ...96
4.7.5
Leihpersonal/Leasingpersonal...97
4.7.6
Selbständigkeit...97
4.7.7
Freie Dienstnehmer...98
4.7.8
Telearbeit/Heimarbeit...99
5
Zusammenfassung ... 102
6
Abbildungsverzeichnis ... 103
7
Tabellenverzeichnis... 103
8
Literaturverzeichnis ... 104
3
1 Einleitung
In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen der Wirtschaft stark
verändert: die Märkte wurden dynamischer und globaler, die Unternehmen mussten
lernen, flexibler, unbürokratischer und innovativer zu agieren. Neue Produkte und
Dienstleistungen entstanden im Rahmen der neuen Kommunikationstechnologien.
Der Übergang zur Informationsgesellschaft wurde vielfach als ebenso revolutionär
wie der Entritt ins Industriezeitalter beschrieben (vgl. Browning/Reiss, 2002).
Auch wenn alle Unternehmen von diesen Veränderungen betroffen sind, wird der
Begriff ,,New Economy" (erstmals erwähnt im Jahr 1994) primär für jene
Unternehmen verwendet, die die neuen Kommunikations- und
Informationstechnologien
,,herstellen, betreiben oder intensiv einsetzen"
(Gassler/Rammer, 2000, S.3).
Die neue Unternehmensumwelt und die neuen Strukturen in der New Economy
stellen geänderte Ansprüche an den Personalbereich. Das Wissen der Mitarbeiter
wird zu einem der wichtigsten Produktionsfaktoren und muss dementsprechend
gefördert werden. Flexibilität und Dynamik sind auch im Personalbereich bedeutende
Ziele. Der Druck von außen auf das Unternehmen wächst; ebenso wächst der Druck
innerhalb des Unternehmens. Die Wissensträger sollen an das Unternehmen
gebunden werden, um Leistung und Wettbewerbsvorteile erzielen zu können.
Gleichzeitig soll die Arbeitnehmerschaft möglichst flexibel bleiben, um rasch auf neue
Anforderungen der Unternehmensumwelt reagieren zu können.
Aber auch die Einstellungen der Arbeitnehmer
1
haben sich gewandelt: die
lebenslange Bindung an ein Unternehmen ist nicht mehr die optimale Arbeitsform für
1
Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wurde von einer durchgehenden Berücksichtigung weiblicher
und männlicher Ausdrucksformen (Mitarbeiter/innen, ArbeitnehmerInnen etc.) abgesehen. Mit der
gewählten Form wird der Bestimmung des §1 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Gleichbehandlung
von Mann und Frau im Arbeitsleben entsprochen.
4
alle Arbeitnehmer. Durch die Notwendigkeit der größtmöglichen Flexibilität der
Unternehmen können diese ihren Mitarbeitern keine Arbeitsplatzgarantie mehr
geben; im Gegenzug schwindet auch die Loyalität der Mitarbeiter gegenüber ihrem
Unternehmen. Häufige Unternehmenswechsel sind keine Seltenheit, wenn der
Mitarbeiter glaubt, anderswo bessere finanzielle Möglichkeiten oder
Karriereaussichten zu finden.
Auch wenn der gesamte Personalbereich gefordert ist, sich an diese neuen
Charakteristika und Anforderungen der Arbeitswelt anzupassen, soll sich diese Arbeit
auf die Entlohnung der Mitarbeiter in der New Economy konzentrieren.
Neue Strukturen in den Unternehmen, Marktanforderungen und Arten der
Beschäftigung fordern teils neue, teils angepasste Formen der Entlohnung.
Es ist unbestritten, dass Geld nicht die einzige Motivation für Arbeit und Leistung ist
(vgl. Rosenstiel, 1975, S. 112), dennoch ist Entlohnung einer der
Hauptbeweggründe, Leistung zu erbringen
Diese Arbeit beschränkt sich auf die Entlohnung als Anreizfaktor für die
Leistungserbringung in Organisationen, ohne anzweifeln zu wollen, dass Geld nicht
der einzige und vielleicht auch nicht der wichtigste Motivator ist.
Ich beschäftige mich in meiner Arbeit mit folgender Frage:
,,Welche Anforderungen stellt der gesamtwirtschaftliche Wandel und das Entstehen
der New Economy an Entgeltsysteme, welche neuen Formen der
Arbeitsbeziehungen entstehen und welche Formen der Entlohnung werden kreiert
und angewendet?"
Nach der Einleitung bietet das zweite Kapitel eine Übersicht zum Thema Entlohnung.
Begriffliche und theoretische Grundlagen werden geklärt und die wichtigsten Formen
der Entlohnung kurz erläutert.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der New Economy. Nach begrifflichen
Definitionen wird ein kurzer Überblick gegeben, wann und warum die New Economy
5
entstand und welche Charakteristika die New Economy kennzeichnen. Hier wird
besonders auf die neuen Informations - und Kommunikationstechnologien und die
Arbeitswelt in der New Economy eingegangen.
Im vierten Kapitel werden die beiden vorangegangenen Kapitel zusammengeführt
und erläutert, welche Formen der Entlohnung in der New Economy Anwendung
finden sollten und welche neuen Möglichkeiten der Entlohnung in der New Economy
entstanden sind bzw. durch das Entstehen der New Economy begünstigt wurden. Am
Ende des vierten Kapitels wird speziell auf atypische Beschäftigungsformen
eingegangen, deren Ausbreitung durch die notwendige Flexibilität in der New
Economy vorangetrieben wurde.
6
2 Grundlagen zur Entlohnung
2.1 Begriffliche Grundlagen
,,Das Entgelt ist die materielle Gegenleistung, die ein Mitarbeiter aufgrund eines
vertraglichen Arbeitsverhältnisses von der ihn beschäftigenden Organisation
erhält." (Erfort, 1998, S. 7)
Entgelt ist somit der Oberbegriff für den Lohn der gewerblichen Arbeitnehmer und
das Gehalt der Angestellten. In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Entgelt
und Vergütung synonym verwendet.
Während das Entgelt für den Arbeitnehmer meist die einzige Form von Einkommen
ist, stellt es für den Arbeitgeber Kosten und den Preis des Produktionsfaktors Arbeit
dar (vgl. Bühner, 1997, S. 157). Daraus entsteht ein Interessenskonflikt zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, da der Arbeitgeber den Kostenfaktor Entgelt
möglichst niedrig halten will, während der Arbeitnehmer ein möglichst hohes
Einkommen wünscht, um seine Bedürfnisse befriedigen zu können.
,,Das Entgeltsystem beinhaltet alle aus dem Zielsystem des Unternehmens
abgeleiteten und zu einem integrierten Maßnahmenbündel verknüpften
materiellen Anreize bzw. Belohnungen, die von der Organisation für die durch
ihre Mitglieder erbrachten Arbeitsleistungen aufzuwenden sind." (Erfort, 1998,
S. 7).
,,Der Entlohnungsgrundsatz impliziert das allgemeine, übergeordnete
Prinzip, nach dem die Entlohnung insgesamt oder in wesentlichen Teilen
geordnet ist (z.B. Zeit-, Akkord- und Prämienlohn). Davon zu unterscheiden ist
die Entlohnungsmethode als der konkrete Modus, in dem ein
Entlohnungsgrundsatz im Betrieb operationalisiert und vor Ort realisiert wird."
(Schettgen, 1996, S. 292; Hervorhebung im Original kursiv)
7
In der einschlägigen Literatur herrscht eine rege Diskussion über den Motivationswert
von finanziellen Vergütungsbestandteilen. Eine eindeutige Antwort auf diese Frage
kann allerdings nicht gegeben werden. Fest steht, dass in unserer Gesellschaft Geld
als Mittel zur Befriedigung vieler Bedürfnisse benötigt wird. Allerdings ist die
Bedeutung von Geld interindividuell stark unterschiedlich:
,,So ist es denkbar, dass für den einen Geld Selbstzweck ist, Erwerb und
Besitz von Geld ihn befriedigt, während es für einen zweiten seine Bedeutung
vom jeweils angestrebten Ziel erhält, etwa der Annäherung an das Ziel des
Eigenheimes, während für den dritten Geld soziale Geltung und Prestige, für
den vierten Macht und für den fünften ein Symbol der eigenen Leistung ist."
(Rosenstiel, 1975, S. 111)
Je nach Bedürfnisstruktur ist auch die motivationale Wirkung der finanziellen
Entlohnung verschieden. Zahlreiche Studien belegen, dass andere Faktoren
ebenfalls großen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter ausüben.
Rosenstiel nennt in seinen Arbeiten neben finanziellen Anreizen auc h soziale
Anreize, Anreize der Arbeit selbst und Anreize des organisatorischen Umfeldes (vgl.
Rosenstiel, 1975, S. 231).
2.2 Theoretische Grundlagen für Entgeltsysteme
In der Literatur werden sieben Anforderungen an Entgeltsysteme gestellt:
·
Transparenz : transparent, verständlich und offen kommuniziert und
ausgestaltet
·
Flexibilität: flexibel, anpassungsfähig und situativ entwickelbar
·
Performance-Bezug: leistungsbezogen bzw. leistungsorientiert
·
,,Gerechtigkeit": leistungs-, anforderungs-, verhaltens- und sozialgerecht
·
Wettbewerbsfähigkeit: wettbewerbsfähig auf dem internen und externen
Arbeitsmarkt, marktgerecht, marktkonform und attraktiv gestaltet
·
Wirtschaftlichkeit
8
·
Ganzheitlichkeit: auf die sonstigen personalpolitischen Maßnahmen und
Programme bezogen sowie in ein ganzheitliches Personalmanagement
integriert
(vgl. Erfort, 1998, S. 9)
Bezüglich der Ganzheitlichkeit der Entgeltsysteme sei hier nur kurz auf die
Bedeutung der Abstimmung der betrieblichen Entgeltpolitik mit den anderen
Teilbereichen und Funktione n innerhalb der Personalpolitik eines Unternehmens
hingewiesen. Entlohnung, Führung, Personalentwicklung, Arbeitsorganisation,
Personalauswahl und Leistungsmanagement sollten aufeinander abgestimmt sein
und ein integriertes ,,Personalpaket" ergeben. Bei mangelhafter Abstimmung der
einzelnen Bausteine besteht die Gefahr der Inkonsistenz in der Personalarbeit. Wird
etwa die Entwicklung zusätzlicher Fähigkeiten bei den Mitarbeitern in den
Unternehmensgrundsätzen als vorrangiges Ziel betrachtet, die benötigten
Fähigkeiten allerdings nicht intern entwickelt, sondern extern erworben, oder die
Mitarbeiter für den Erwerb zusätzlicher Qualifikationen nicht belohnt, führt sich die
Betonung auf die Personalentwicklung ad absurdum und schadet so in vielen Fällen
auch dem Image der Personalarbeit im Betrieb.
Das Unternehmen ist bei der Gestaltung eines Entgeltsystems allerdings durch
mehrere Faktoren in seinem Handlungsspielraum eingeschränkt:
·
Gesetzliche Regelungen, Kollektivverträge, Rechtssprechung:
Kollektivverträge setzen Mindestanforderungen in Bezug auf das
Arbeitsentgelt. Durch die Zwangsmitgliedschaft aller Arbeitgeber bei der
Wirtschaftskammer und die Kollektivvertragsangehörigkeit kraft Mitgliedschaft
sind die geltenden Kollektivverträge auf nahezu alle Arbeitsverträge
anzuwenden. Kollektivverträge gelten unmittelbar (d.h. sie sind ohne Zutun
der Parteien auf die Arbeitsverträge anzuwenden) und in den meisten Fällen
einseitig zwingend (d.h. es gelten nur für den Arbeitnehmer günstigere
Vereinbarungen). Auch gesetzliche Regelungen und Betriebsvereinbarungen
wirken einseitig zwingend auf Arbeitsverträge. Bestehende gesetzliche
Regelungen werden bei Bedarf durch die Rechtssprechung interpretiert.
Beispiele für gesetzliche oder kollektivvertragliche Regelungen sind das
Arbeitszeitgesetz und die im Kollektivvertrag verankerten Mindestgehälter.
9
·
Zielkonflikte: Zwischen den oben genannten Anforderungen an
Entgeltsysteme kann es zu Zielkonflikten kommen. So fordert das Ziel der
Wettbewerbsfähigkeit hohe Gehälter, während das Unternehmen aufgrund der
notwendigen Wirtschaftlichkeit möglichst niedrige Gehälter zahlen will. Es
kann unter anderem auch zu Konflikten zwischen Leistungsgerechtigkeit und
Sozial-, Verhaltens - und Anforderungsgerechtigkeit kommen.
·
Bestehende Arbeitsverträge: Bei Einführung eines neuen Entgeltsystems in
einem Unternehmen bleibt der Arbeitgeber weiterhin an die bestehenden
Verträge gebunden. Nur mit Zustimmung der Mitarbeiter können diese
Verträge abgeändert und an das neue System angepasst werden.
2.2.1 Lohngerechtigkeit
Es gibt fünf Kriterien, anhand derer man die Qualität eines Entgeltsystems in Bezug
auf Gerechtigkeit beurteilen kann:
·
Anforderungsgerechtigkeit: Die Relation zwischen den Anforderungen der
zu erfüllenden Tätigkeit und dem bezahlten Entgelt muss verhältnismäßig
sein.
·
Leistungsgerechtigkeit: Die Entlohnung muss der persönlichen Leistung des
Mitarbeiters gerecht werden.
·
Verhaltensgerechtigkeit: Die Einstellung des Arbeitnehmers in bezug auf
seine Aufgabe und das Unternehmen, seine Motivation und sein Verhalten
sollen ebenfalls in die Entlohnung miteinfließen.
·
Sozialgerechtigkeit/Bedarfsgerechtigkeit: Der tatsächliche Bedarf des
Mitarbeiters soll berücksichtigt werden. Die Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall oder das Karenzgeld beziehen den momentanen familiären und
gesundheitlichen Zustand des Arbeitnehmers mit ein, obwohl zu dieser Zeit
keine Leistung erbracht werden kann.
·
Marktgerechtigkeit/Verteilungsgerechtigkeit: Aufgrund des Gesetzes von
Angebot und Nachfrage können die bezahlten Löhne variieren.
(vgl. Nagel/Schlegtendal, 1998, 48f; Schettgen, 1996, S. 292f)
10
Durch die Beachtung dieser Kriterien soll eine möglichst gerechte Verteilung der
Löhne unter den Arbeitnehmern erzielt werden.
,,Gerechtigkeit ist dabei die Umschreibung für einen Zustand, der sowohl von
Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern akzeptiert wird, aber auch vor
außenstehenden Beobachtern Bestand hat." (Nagel/Schlegtendal, 1998, S.
49)
Da der Begriff ,,Gerechtigkeit" nie objektiv bestimmbar ist, sondern immer von den
subjektiven Werten, Bedürfnissen und Haltungen der Beteiligten beeinflusst wird, ist
eine absolute Gerechtigkeit, die von jedem Beteiligten akzeptiert werden kann, meist
nicht möglich.
2.3 Faktoren der Gehaltsfindung
2.3.1 Interne Faktoren der Gehaltsfindung
·
Formale Ausbildung: In den meisten Fällen besteht ein Zusammenhang
zwischen Ausbildung und Gehalt einer Person. In der öffentlichen Verwaltung
ist diese Beziehung besonders stark ausgeprägt. Kritisiert an der Verwendung
der Ausbildung als gehaltsbildenden Faktor wird häufig, dass es keinen
zwingenden Zusammenhang zwischen formaler Ausbildung und Leistung gibt.
Außerdem wird die Idee des lebenslangen Lernens und der
fachunabhängigen Qualifikationen wie zum Beispiel soziale Kompetenzen
(Social Skills) bei dieser Art der Gehaltsfindung vernachlässigt (vgl.
Havranek/Niedl, 1999, S. 23).
·
Qualifikation/Berufserfahrung: Die Mitarbeiter können auch auf Basis ihrer
individuellen Qualifikationen und Fähigkeiten eingestuft werden. Ziel dabei ist,
höhere Flexibilität und größere Tiefe des Wissens zu schaffen. Allerdings ist
zu beachten, das zusätzliche Qualifikationen im Unternehmen auch
angewendet werden müssen, um ein höheres Gehalt zu rechtfertigen (vgl.
Havranek/Niedl, S. 24).
11
·
Seniorität: In vielen Kollektivverträgen sind Gehaltsentwicklungen an die
Verweildauer in der Funktion, bzw. im Unternehmen, gebunden. Damit wollte
man ursprünglich Betriebstreue und Bindung an den Betrieb fördern, da
Mitarbeiterwechsel für das Unternehmen durch Rekrutierung und Einarbeitung
sehr kostspielig sind (vgl. Zander, 1990, S. 3ff). Durch die sich rascher
ändernden Anforderungen an die Arbeitnehmer sowie die Unternehmen wird
Seniorität als gehaltsbildender Faktor zunehmend kritisiert (vgl.
Havranek/Niedl, 1999, S.25). Bei Überbetonung des Senioritätsprinzips
besteht auch die Gefahr, externe Personalbeschaffung großteils
auszuschalten und so das interne Klima und die Innovationskraft des
Unternehmens nachteilig zu beeinflussen. Es kann zu einer Überalterung der
Belegschaft kommen, und die Rekrutierung neuer, leistungsfähiger
Arbeitskräfte kann erschwert oder gänzlich verhindert werden (vgl. Zander,
1990, S. 5). Inzwischen haben allerdings auch die Sozialpartner die Nachteile
des Senioritätsprinzips erkannt: der neue Branchenkollektivvertrag im
Telekombereich gilt, als erster österreichischer Kollektivvertrag ohne
Einbeziehung des Senioritätsprinzips, als richtungsweisend.
·
Festgestellter Qualifikationszuwachs: Vor allem in beratenden Berufen und
Expertenberufen steigt die Qualifikation mit der Anzahl der gemachten
Erfahrungen und Projekte. Wenn sich dieser Qualifikationszuwachs in höherer
Leistung niederschlägt, ist die Auswirkung auf das Gehalt gerechtfertigt (vgl.
Havranek/Niedl, 1999, S. 26f).
·
Komplexität der Stelle, Wertigkeit der Funktion: Die Entlohnung nach
Komplexität der Stelle ist eine Form der funktionsorientierten Entlohnung
2
.
Jede im Unternehmen zu erledigende Aufgabe stellt gewisse Anforderungen
an den Mitarbeiter.
Elemente, die die Komplexität der Stelle bestimmen sind: Ausbildung
(personenorientierter Aspekt), Berufserfahrung (Erfahrungen, die die Person
benötigt, um die Funktion erfüllen zu können), Fachanforderungen (z.B. EDV-
Kenntnisse, rechtliche Anforderungen, BWL-Kenntnisse, etc.) und
fachunabhängige Anforderungen (z.B. Führung, soziale Kompetenz, etc.). Die
Komplexität der Stelle wird mit Hilfe von Methoden der Stellenbewertung
2
im Gegensatz zur personenorientierten Entlohnung wie z.B. bei Berücksichtigung der formalen
Ausbildung
12
bestimmt (vgl. Havranek/Niedl, 1999, S. 27ff). In vielen Fällen wird anhand der
Stellenbewertung ein Gehaltsband definiert, innerhalb dessen sich der
Mitarbeiter auf Basis seiner Leistungen oder Fähigkeiten bewegen kann.
·
Leistungswert: In den meisten Kollektivverträgen ist kein Zusammenhang
zwischen Leistung und Gehalt vorgesehen. Leistung kann nur im Zuge der
Führungsaufgabe zwischen Mitarbeiter und Führungskraft festgestellt werden
(vgl. Havranek/Niedl, 1999, S. 33ff). Auf die individuelle Leistung und die
leistungsorientierte Entlohnung wird im folgenden noch näher eingegangen
·
Anwesenheit: Die Rolle, die der zeitliche Faktor Anwesenheit bei der
Entlohnung spielt, zeigt sich an Themen wie Teilzeit- und
Vollzeitbeschäftigung, Überstundenentlohnung und Mehrarbeit. Auch der
Grundlohn, der monatlich bezahlt wird, kann als Form der Entlohnung nach
Anwesenheit interpretiert werden. Es ist abzusehen, dass die Bezahlung für
bloße Anwesenheit zugunsten der Bezahlung für die individuelle Leistung
zurückgehen wird, was an der wachsenden Bedeutung von All-inclusive-
Verträgen erkennbar ist (vgl. Havranek/Niedl, 1999, S. 46f).
·
Statusprinzip: Entlohnungsunterschiede können auch durch die
innerbetriebliche politische Macht- und Einflussverteilung begründet sein (vgl.
Havranek/Niedl, 1999, S. 47). Auch die meist unterdurchschnittliche
Bezahlung von bestimmten Bevölkerungsgruppen (zum Beispiel Frauen) kann
auf die bestehenden Machtverhältnisse in Unternehmen und der
Gesamtwirtschaft zurückgeführt werden.
·
Unternehmenscharakteristika: Appelbaum/Mackenzie nennen die
Unternehmenscharakteristika als eine weitere Bestimmungsgröße für die
Lohnhöhe. Hier werden Unternehmenskultur und Führungsstil, Struktur, Ziele
der Unternehmung, Unternehmenspolitik und strategie, Technologie,
Wirtschaftlichkeit, Größe, Profitabilität und Strategie am Arbeitsmarkt
(Hochlohn- oder Niedriglohnstrategie) genannt (vgl. Appelbaum/Mackenzie,
1996, S. 32).
13
2.3.2 Externe Faktoren der Gehaltsfindung
·
Marktprinzip: Wie schon erwähnt, ist Wettbewerbsfähigkeit eine zentrale
Anforderung an ein Gehaltssystem. Wenn ein Unternehmen unter dem am
Arbeitsmarkt geltenden Gehalt zahlt, wird es kaum in der Lage sein,
qualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren. Unternehmen, die sehr hohe Gehälter
zahlen, bekommen die Auswirkungen am Betriebsergebnis zu spüren.
Marktorientierte Entlohnung ermöglicht den Unternehmen, die benötigten
Mitarbeiter am Arbeitsmarkt anzuwerben und im Unternehmen halten zu
können (vgl. Havranek/Niedl, 1999, S. 48). Auch auf dem Arbeitsmarkt gilt das
Prinzip von Angebot und Nachfrage. Je weniger Arbeitskräfte mit bestimmten
Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, desto höher ist das
Gehalt, das sie verlangen können und umgekehrt (Zander, 1990, S. 6f).
Bestimmungsgrößen sind hier die Anzahl der Arbeitssuchenden, deren
Fähigkeiten und Kenntnisse, die Angebot-Nachfrage-Situation in dem
bestimmten Gebiet sowie das Gehaltslevel der Konkurrenz (vgl.
Appelbaum/Mackenzie, 1996, S. 32).
·
Regionalprinzip: Gehälter variieren je nach Region und den
unterschiedlichen Lebenserhaltungskosten, Sozialsystemen, etc. International
gesehen kann ein niedriges Niveau der Gehälter einen Standortvorteil für
Unternehmen gegenüber teureren Gebieten bringen (vgl. Havranek/Niedl,
1999, S. 48f).
·
Branchenprinzip: Unterschiedliche Gehaltsniveaus für die gleiche Funktion in
verschiedenen Branchen sind oft historisch bedingt. Starke Gewerkschaften
haben die Macht, bei den Kollektivvertragsverhandlungen hohe Löhne zu
fordern und durchzusetzen. Auch geringer Wettbewerb in einer Branche kann
zu verhältnismäßig hohen Löhnen führen (vgl. Havranek/Niedl, 1999, S. 49f).
Weitere branchenbezogene Merkmale, die die Lohnhöhe beeinflussen
können, sind die wirtschaftliche Situation der Branche und die
Fluktuationsrate. Auch unterschiedliche Entwicklungen in den verschiedenen
Branchen werden im Gehaltsniveau der Branche widergespiegelt.
·
Gesellschafts- und wirtschaftspolitisches Prinzip: Auch der Staat kann
beispielsweise durch Festsetzung der Lohnnebenkosten oder Gewinn- und
Unternehmenssteuern Einfluss auf die Gehaltshöhe nehmen (vgl.
14
Havranek/Niedl, 1999, S. 50). Die jeweilige gesamtwirtschaftliche Situation ist
auch eine entscheidende Determinante für die Lohnhöhe (vgl.
Appelbaum/Mackenzie, 1996, S. 32).
2.4 Formen der Entlohnung
Bühner (1997, S 158f) zählt drei Komponenten auf, aus denen sich das Entgelt
zusammensetzen kann (siehe Abbildung 1):
·
Grundlohn/Zeitlohn: Der Mitarbeiter erhält einen Lohn für die von ihm
erwartete Leistung auf Basis der gestellten Anforderungen oder der vom
Mitarbeiter mitgebrachten Qualifikation. Methoden zur Festsetzung des
Grundentgeltes sind Arbeitsbewertungs- und Potentialanalysen.
·
Zusatzlohn/Leistungslohn: Wenn der Mitarbeiter mehr als die von ihm
erwartete Durchschnittleistung erbringt, erhält er zusätzlich zum Grundentgelt
einen Leistungsanteil.
·
Soziallohn: Zum Soziallohn gehören unter anderem die Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall, Urlaubsgeld sowie die betriebliche Altersversorgung.
(vgl. Bühner, 1997, S. 158f)
E n t l o h n u n g
A r b e i t s e r g e b n i s i . e . S .
A r b e i t s b e r e i c h d e s M i t a r b e i t e r s
S o z i a l s t a t u s
( p e r s ö n l i c h e M e r k m a l e
d e s M i t a r b e i t e r s )
A r b e i t s e r g e b n i s i . w . S .
( U n t e r n e h m e n s e r f o l g )
a n f o r d e r u n g s -
g e r e c h t
q u a l i f i k a t i o n s -
g e r e c h t
l e i s t u n g s -
g e r e c h t
E r f o l g s -
b e t e i l i g u n g
K a p i t a l -
b e t e i l i g u n g
g e s e t z l i c h
freiwillig
A r b e i t s -
b e w e r t u n g
-s u m m a r i s c h
-a n a l y t i s c h
Q u a l i f i k a t i o n s-
b e w e r t u n g
-P o t e n t i a l-
a n a l y s e
-B e u r t e i l u n g s -
g e s p r ä c h e
E r g e b n i s -
b e w e r t u n g
-Q u a n t i t ä t
-Q u a l i t ä t
- L e i s t u n g
- E r t r a g
- G e w i n n
-E i g e n -
k a p i t a l
-F r e m d-
k a p i t a l
- S o z i a l-
v e r s i c h e r u n g
- A r b e i t s - u n d
G e s u n d h e i t s -
s c h u t z
. . .
- G r a t i f i k a -
t i o n e n
- A l t e r s
- v e r s o r
g u n g e n
...
E n t l o h n u n g d e s
e r w a r t e t e n A r b e i t s -
e r g e b n i s s e s
E n t l o h n u n g d e s
e r w a r t e t e n A r b e i t s -
e r g e b n i s s e s
G r u n d l o h n
L e i s t u n g s l o h n
S o z i a l l o h n
Abbildung 1: Formen der Entlohnung
(Bühner, 1997, S. 159)
15
Es gibt drei Arten, die Lohnhöhe zu bestimmen. Meist kommt eine Kombination
mehrerer Varianten zum Einsatz:
·
Anforderungsgerechte Entlohnung: Es herrscht das Prinzip der Äquivalenz
von Lohn und Anforderungen, das heißt, die Lohnhöhe wird von den
körperlichen und geistigen Anstrengungen, die der Mitarbeiter zu bewältigen
hat, bestimmt. Mittel zur Feststellung des anforderungsgerechten Lohnes ist
die Arbeitsbewertung. Das Anforderungsprinzip kann bei der Festlegung der
Höhe des Grundlohnes angewendet werden (vgl. Bühner, 1997, S. 159ff).
·
Qualifikationsgerechte Entlohnung: Hier kommt das Prinzip der Äquivalenz
von Lohn und Qualifikation bei der Grundlohnfindung zur Anwendung. Der
Mitarbeiter wird entsprechend seiner Fähigkeiten und Kenntnisse entlohnt,
unabhängig davon, welche dieser Fähigkeiten er tatsächlich bei der Ausübung
seiner Arbeitsaufgabe nutzt. Die Qualifikation der Mitarbeiter kann mit Hilfe
von Potentialanalysen und Mitarbeiterbeurteilungen bestimmt werden (vgl.
Bühner, 1997, S. 165ff).
·
Leistungsgerechte Entlohnung (Pay for Performance): Nach dem Prinzip
der Äquivalenz von Lohn und Leistung wird die tatsächlich erbrachte Leistung
entlohnt und gleichzeitig ein Anreiz geboten, auch in Zukunft ein hohes
Leistungsniveau zu halten. Um bestimmen zu können, ob die tatsächliche
Leistung ausreichend für die Zahlung eines Leistungsanteils ist, ist eine Form
der Zielvereinbarung notwendig, die angibt, welche Leistung vom Mitarbeiter
erwartet wird. Die Bemessungsgrundlage für seine Leistung muss für den
Mitarbeiter transparent, eindeutig interpretierbar und überschneidungsfrei sein.
Um einen Anreiz zur Erbringung guter Leistung darstellen zu können, muss
der direkte Zusammenhang zwischen Leistung und Entlohnung für den
Mitarbeiter erkennbar sein (vgl. Bühner, 1997, S. 172ff).
"Während die anforderungs- und qualifikationsgerechte Entlohnung eine
erwartete Leistung bezahlen (ex-ante), erfolgt die Vergütung bei der
leistungsgerechten Entlohnung nach Erreichen eines vorab definierten
Arbeitsergebnisses (ex-post)." (Bühner, 1997, S. 172)
16
2.4.1 Grundlohn bzw. Zeitlohn
Der Grundlohn ist die Vergütung, die ein Mitarbeiter, unabhängig von seiner
individuellen Leistung, für die Ausführung einer Arbeitsaufgabe erhält. Die
Grundlöhne der einzelnen Mitarbeiter werden je nach Anforderungsniveau der
auszuführenden Tätigkeit differenziert.
Mittel zur Untergliederung der Tätigkeiten nach Anforderungen sind analytische und
summarische Methoden der Arbeitsbewertung. Bei der analytischen
Arbeitsbewertung werden einzelne Anforderungsmerkmale wie Können,
Verantwortung, Selbständigkeit, Kooperation und Führung mit Hilfe von
Einzelarbeitswerten bewertet und aus der Summe der Einzelarbeitswerte ein
Gesamtarbeitswert gebildet (z.B. Methode der HAY Group Unternehmensberatung).
Bei der summarischen Arbeitsbewertung wird die Arbeitsaufgabe als Ganzes
bewertet und ein Arbeitswert festgelegt bzw. die Tätigkeit wird in eine vorgegebene
Tätigkeitengruppe eingeordnet (z.B. Genfer Schema, REFA-Standards,
kollektivvertragliche Gruppen) (vgl. Nagel/Schlegtendal, 1998, S. 50; Bühner, 1997,
S. 160f).
Weitere Einflussfaktoren für die Höhe des Grundgehaltes können die Dauer der
Betriebszugehörigkeit, die Stellung in der Unternehmenshierarchie und natürlich der
Wert der Arbeitskraft und ihrer Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt sein (vgl.
Nagel/Schlegtendal, 1998, S. 49f).
Die Ermittlung des Grundlohnes kann sowohl anforderungs- als auch
qualifikationsorientiert erfolgen, wobei oft Kombinationen der beiden Methoden zum
Einsatz kommen. Die untere Grenze des Grundlohnes ist das im anzuwendenden
Kollektivvertrag vorgesehene Mindestentgelt.
Der Grundlohn wird meist in Form eines Zeitlohnes gestaltet.
17
,,Beim Zeitlohn wird der Lohn nach der aufgewendeten Arbeitszeit (Stunden,
Tage, Woche, Monat) bemessen; die in der Zeiteinheit ausgeführte
Arbeitsleistung bleibt (zunächst) außer Betracht." (Löffelholz, 1993, S. 8)
,,[Der Zeitlohn wird also] für jene Zeit berechnet, in der dieser [der
Arbeitnehmer] sein Wissen, Können und seine Arbeitskraft dem Arbeitgeber
zur Vollbringung einer wirtschaftlichen Leistung zur Verfügung stellt."
(Schrotta, 1959, S. 43)
Ändert sich die Arbeitsleistung des Mitarbeiters, wird der Grundlohn nicht verändert.
Für das Unternehmen bedeutet das eine Veränderung der Lohnkosten pro
Leistungseinheit. Bei steigender Leistung sinken die Lohnkosten pro Leistungseinheit
und vice versa (vgl. Löffelholz, 1993, S. 8f).
Auch wenn beim Zeitlohn die Leistung des Arbeitnehmers keine unmittelbare
Auswirkung auf die Höhe der Entlohnung hat, ist das Niveau der Arbeitsleistung
dennoch nach unten und oben begrenzt. Die untere Grenze ist das
Leistungsminimum, ,,das gerade noch erlaubt ist, um nicht entlassen zu werden"
(Schrotta, 1959, S. 44). Die obere Grenze ist das Leistungsniveau, ab dem eine
Gehaltserhöhung oder Beförderung gerechtfertigt ist (vgl. Schrotta, 1959, S. 45).
Auch wenn Leistungsänderungen keine direkten Auswirkungen auf die Lohnhöhe
haben, wird auch beim Zeitlohn Leistung entlohnt, nämlich die Normalleistung
innerhalb der obengenannten Grenzen, die im Arbeitsvertrag definiert ist (vgl. Lücke,
1988, S. 61). Langandauernde Abweichungen von der erwarteten
Normalarbeitsleistung ziehen als Konsequenz Kündigung oder Lohnerhöhung b eine
Beförderung nach sich.
Der Grundlohn ist heute in den meisten Unternehmen fixer Entgeltbestandteil und
wird oft durch verschiedene variable Lohnanteile und Sozialleistungen ergänzt.
Eine der grundsätzlichen Fragestellungen beim Grundlohn ist, ob der Lohn auf der
Tätigkeit oder der Person, die die Tätigkeit ausführt, basieren soll. Diese Thematik
wird im vierten Kapitel genauer erörtert.
18
Vorteile des Zeitlohnes sind die einfache Berechnung sowohl für den Arbeitgeber als
auch den Arbeitnehmer sowie die leichte Verständlichkeit für den Arbeitnehmer.
Außerdem ist eine Betonung der Qualität der Arbeitsleistung möglich, da die
Arbeitnehmer nicht ausschließlich nach Quantität der Leistung entlohnt werden (vgl.
Löffelholz, 1993, S. 10). Außerdem wirkt der Zeitlohn Überbelastungen von Mensch
und Maschine entgegen (vgl. Lücke, 1988, S. 62).
Ein Nachteil der Entlohnung ausschließlich nach dem Zeitlohnprinzip ist, dass ohne
zusätzliche variable Entgeltbestandteile kein Anreiz zu höheren Leistungen geboten
wird, da sich die Leistung nicht unmittelbar im Gehalt widerspiegelt. Das
Unternehmen allein trägt das Risiko für den Arbeitswillen der Mitarbeiter. Um die
Leistung dennoch akzeptabel zu halten, sind in vielen Fällen Kontrollmechanismen
oder eine zusätzliche leistungsabhängige Vergütung nötig (vgl. Löffelholz, 1993, S.
10). Bei der Entlohnung durch Grundlohn ohne variable Leistungskomponente
besteht außerdem die Gefahr der Unzufriedenheit bei Mitarbeitern mit
überdurchschnittlichem Leistungsgrad (vgl. Bühner, 1997, S. 173).
2.4.2 Leistungsentgelt
Das Leistungsprinzip ist ein wichtiger Grundsatz der betrieblichen Lohngestaltung.
Der Zusammenhang zwischen Leistung und Lohn ist ein wichtiger
Bestimmungsfaktor dafür, dass die Mitarbeiter ihren Lohn als gerecht empfinden.
Beim Prämienlohn ergänzt der Leistungsanteil den Grundlohn.
Leistungslohn wird für die Art und Weise (qualitativ und quantitativ) gewährt, in der
ein Mitarbeiter die ihm zugewiesene Aufgabe erledigt. Zu diesen Zweck muss
Leistung gemessen und beurteilt werden. Welche Kriterien zur Messung der Leistung
herangezogen werden ist abhängig von der jeweiligen Arbeitsaufgabe.
Wichtig ist bei jeder Art der Leistungsentlohnung der zeitliche Zusammenhang
zwischen Leistung und Gewährung des Leistungsentgelts. Liegt zwischen Leistung
und Belohnung ein zu langer Zeitraum, wird die motivationale Wirkung des
Leistungsentgelts stark eingeschränkt, da für den Mitarbeiter der Zusammenhang
19
zwischen Leistung und Belohnung nicht mehr oder nur mehr schwer
nachzuvollziehen ist.
Im folgenden soll auf den Akkordlohn und den Prämienlohn, die zwei wichtigsten
Entgeltgrundsätze, die auf dem Leistungsprinzip beruhen, eingegangen werden.
2.4.2.1 Akkordlohn
Beim Akkordlohn wird der Arbeitnehmer entsprechend seiner mengenmäßigen
Arbeitsleistung entlohnt. Der Arbeitnehmer erhält pro gefertigter Leistungseinheit
einen bestimmten Geldsatz, wobei das Verhältnis zwischen Lohn und Leistung meist
linear und proportional ist. Untergrenze ist natürlich auch beim Akkordlohn das
kollektivvertragliche Mindestentgelt.
In der Zeit, die dem Mitarbeiter für die Fertigung seines Produktionssolls vorgegeben
ist, sind neben der effektiven Arbeitszeit auch Wartezeiten, Zeiten für
störungsbedingte und persönliche Unterbrechungen, zusätzliche Tätigkeiten und
Erholung des Mitarbeiters beinhaltet (vgl. Bühner, 1997, S. 174f).
Es gibt auch die Möglichkeit, im Gruppenakkord zu entlohnen, wenn die Arbeit einer
Gruppe und nicht die der einzelnen Arbeitnehmer abgrenzbar ist. In diesem Fall wird
eine Gruppenleistung zugrunde gelegt und die Entlohnung für diese Leistung auf die
einzelnen Mitarbeiter gleich oder nach einem festgelegten Schlüssel aufgeteilt.
Für den Einzelakkord spricht, dass der einzelne Arbeitnehmer seine Leistung und
somit sein Gehalt selbst bestimmen kann.
Die Vorteile beim Gruppenakkord sind die Förderung des
Zusammengehörigkeitsgefühls und der Teamarbeit sowie die Motivation der
leistungsschwächeren Mitarbeiter durch den Gruppendruck (vgl. Löffelholz, 1993, S.
20). Es kann weiters eine Verringerung der Erfassungskosten durch weniger
Akkordzettel erreicht werden (vgl. Lücke, 1988, S. 61). Allerdings kann es durch
Gruppenakkord auch zu Spannungen zwischen leistungsstarken und
leistungsschwächeren Mitarbeitern, zur Überforderung der leistungsschwächeren
Mitarbeiter oder zur Ausnutzung der besseren Arbeiter kommen (durch die
20
sogenannten ,,Trittbrettfahrer"
3
). Auch ein ungeeigneter Gruppenführer kann die
Leistung seiner Gruppe negativ beeinflussen (vgl. Lücke, 1988, S. 61).
Voraussetzungen für die Entlohnung im Gruppenakkord sind homogene und nicht zu
große Gruppen sowie die Abstimmung der Einzelarbeitsplätze aufeinander (vgl.
Löffelholz, 1993, S. 21).
Beim Akkordlohn kommt es bei einer Änderung der Arbeitsleistung des einzelnen
Mitarbeiters nicht zu einer Modifikation der Stückkosten, sondern des bezahlten
Entgelts. Der Arbeitgeber trägt also das Risiko des Leistungsrückganges nicht (im
Gegensatz zum Zeitlohn), es geht auf den Arbeitnehmer über.
Der Akkordlohn kann nur angewendet werden, wenn die Arbeit sowohl akkordfähig
als auch akkordreif ist.
·
Akkordfähigkeit: Die Zeit und die produzierte Menge ist voll oder zumindest
überwiegend selbst steuerbar, Arbeitsmethode und verfahren müssen vorher
bekannt und zeitlich bestimmbar sein, das Arbeitsergebnis muss
mengenmäßig erfasst werden und die Vorgabezeit reproduziert werden
können (vgl. Fremmer, 1996, S. 13).
·
Akkordreife: Ein ausreichend geübter und eingearbeiteter Mitarbeiter muss
aufgrund des Arbeitplatzes, des Arbeitsvorganges und des Arbeitsablaufs in
der Lage sein, die Arbeit störungsfrei durchzuführen (vgl. Bühner, 1997, S.
175).
Auch konstante Arbeitsbedingungen sind Voraussetzung für die Anwendung des
Akkordlohnes.
Der Akkordlohn kann weiters nicht angewendet werden, wenn es keine direkte
Relation zwischen der Arbeitsleistung und dem quantitativen Ergebnis gibt.
Die Vorteile des Akkordlohnes sind die Leistungsgerechtigkeit und der Anreiz zu
überdurchschnittlicher Leistung. Weiters wird das Leistungsrisiko für den Arbeitgeber
gemindert (vgl. Bühner, 1997, S. 176).
Abgesehen von der beschränkten Anwendbarkeit ist das Hauptproblem bei der
Entlohnung im Akkord die schwierige Berechnung der Vorgabezeit (vgl. Löffelholz,
3
,,Free-rider" problem: "Individuals may shirk their assignment because they know that the team's
capabilities will make up for the loss of one person's performance" (Heneman, 2001, S. 454)
21
1993, S. 19). Dies führt zu mehreren Nachteilen: wenn Vorgabezeiten als zu kurz
betrachtet werden, steigt die Unzufriedenheit der Mitarbeiter. Überbeanspruchung
der Mitarbeiter und Maschinen können die Folge von falsch oder ungenau
berechneten Vorgabezeiten sein (vgl. Bühner, 1997, S. 176). Wenn Mitarbeiter zu
immer höheren Leistungen angespornt werden, besteht die Gefahr, dass die hohen
Stückzahlen am Markt nicht absetzbar sind und das Unternehmen zwar
Produktionskosten tragen muss, jedoch keine Umsätze für die Überschüsse
generiert. Durch die Betonung der quantitativen Leistung wird die Qualität oft
vernachlässigt und zusätzliche Qualitätskontrollen werden notwendig. Außerdem
führt die Akkordarbeit zu einem höheren Verschleiß von Betriebsmitteln und
Werkstoffen.
Durch Festlegung von Akkordobergrenzen sollen diese Nachteile abgeschwächt
werden. Akkordobergrenzen vermindern die Überlastung der Arbeitnehmer und
Maschinen, machen die Stückzahlen kalkulierbar und helfen bei der Wahrung von
Qualitätsaspekten (vgl. Nagel/Schlegtendal, 1998, S. 52). Auch degressive
Akkordsysteme, bei denen der Lohnzuwachs pro Leistungseinheit mit steigenden
Stückzahlen abnimmt, können zum Schutz vor Überanstrengung eingesetzt werden.
2.4.2.2 Prämienlohn
Beim Prämienlohn wird zusätzlich zum Grundlohn eine Prämie für
überdurchschnittliche Leistungen bezahlt, ,,wenn die Mehrleistung bzw. die Ersparnis
vom Arbeitenden in der Regel nicht erwartet werden kann." (Lücke, 1988, S. 101)
Prämien sind ,,die unterschiedlichsten Arten von Geldzuwendungen zusätzlich zum
Grundgehalt" (Fremmer, 1996, S. 27) und können sowohl prozentual zum
Grundgehalt als auch in absoluten Beträgen ausgezahlt werden (vgl.
Nagel/Schlegtendal, 1998, S. 54).
Bei der prozentualen Bemessung passt sich die Prämie automatisch an
Kollektivvertragserhöhungen an, absolute Prämien müssen immer wieder neu
ausgehandelt werden.
Im Vergleich zum Akkordlohn ist der Leistungsbegriff beim Prämienlohn weiter
gefasst. Der Prämienlohn besteht aus dem festen Grundlohn und einer
22
leistungsabhängigen Komponente, während der Akkordlohn nur von der Leistung
bestimmt wird (auch wenn die kollektivvertraglichen Mindestlöhne einen
Minimalverdienst garantieren) (vgl. Löffelholz, 1993, S. 24). Neben
Mengenleistungsprämien, die häufig angewendet werden, wenn keine genauen
Vorgabezeiten ermittelbar sind und deshalb die Voraussetzungen für den Akkordlohn
nicht gegeben ist, sind auch Qualitätsprämien, zum Beispiel für eine Senkung von
Ausschuss und Nachbearbeitungszeiten, Ersparnisprämien für sparsamen Einsatz
von Produktionsfaktoren und
Nutzungsgradprämien für optimale
Betriebsmittelnutzung möglich. Termineinhalteprämien belohnen die Termintreue,
Umsatzprämien orientieren sich am generierten Umsatz. Auch gewünschtes
Verhalten von Mitarbeitern wie zum Beispiel Flexibilität oder Bereitschaft zur
Gruppenarbeit kann in Form von Prämien entlohnt werden. Oft werden auch mehrere
Bezugsgrößen kombiniert, um unterschiedliche Ziele gleichzeitig verfolgen zu
können. Grundsätzlich können alle jene Merkmale als Bezugsgröße dienen, die
objektiv erfassbar sind, auf deren Größe die Mitarbeiter Einfluss nehmen können und
deren Verbesserung betriebswirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll ist (vgl.
Fremmer, 1996, S. 27ff). Es werden für die jeweilige Bezugsgröße Sollzahlen (die
sogenannte ,,Prämiena usgangsleistung") ermittelt, bei deren Erreichung oder
Überschreitung eine Prämie entsprechend der Form der Prämienlohnlinie ausbezahlt
wird (vgl. Löffelholz, 1993, S. 25).
Die Prämienlohnlinie gibt den Verlauf der Relation zwischen Leistung und
Prämienhöhe an. Sie kann je nach Prämienart, Einflussfaktoren und speziellen
Erfordernissen proportional (z.B. bei Mengen- und Zeitersparnisprämien), degressiv
(z.B. bei Gefahr der Qualitätsminderung, gegen Überbeanspruchung von Mensch
und Maschine), progressiv (z.B. bei Nutzungsprämien), progressiv-degressiv (um
mittlere Ergebnisse zu erhalten) und gestuft sein (vgl. Fremmer, 1996, S. 32f).
Prämienobergrenzen (auch Prämienendleistung genannt) sind dann anzuwenden,
wenn die maximale Verfolgung eines Ziels negative Auswirkungen auf andere Ziele
zur Folge haben kann (zum Beispiel der Zielkonflikt zwischen Qualität und Quantität).
Analog zum Gruppenakkord kann auch eine Gruppenprämie für das Erreichen eines
Gruppenziels gewährt werden. Vorteile der Gruppenprämie sind unter anderem die
vereinfachte Leistungsberechnung und der geringere Überwachungsaufwand durch
Selbstkontrolle in der Gruppe (vgl. Bühner, 1997, S. 187f). Allerdings müssen auch
23
hier ähnliche Voraussetzungen wie beim Gruppenakkord gegeben sein (siehe Kapitel
2.4.2.1).
Prämienlöhne sind im Gegensatz zu Akkordlöhnen breiter anwendbar. Prämien
können beispielsweise dann eingesetzt werden, wenn der Mitarbeiter die
Leistungsgröße beeinflussen kann, aber eine genaue Bestimmung der Leistung
unmöglich oder wirtscha ftlich nicht vertretbar ist (vgl. Nagel/Schlegtendal, 1998, S.
52f). Auch wenn die Beeinflussbarkeit der Ergebnisse durch den einzelnen
Mitarbeiter abnimmt, können Prämien zum Beispiel zu optimaler Nutzung
kapitalintensiver Maschinen, Reduzierung von Stillstandzeiten und Steigerung der
Mengenleistung verwendet werden (vgl. Bühner, 1997, S. 177f).
Weiters können Prämien auch bei bestimmten geistigen und kreativen Arbeiten
angewendet werden, bei denen der Einsatz des Akkordlohns nicht möglich ist (vgl.
Löffelholz, 1993, S. 27).
Durch Anwendung von kombinierten Prämien mit mehreren Leistungsgrößen wird
der Anwendungsbereich des Prämienlohns noch vergrößert.
Eine Entlohnung im Prämiensystem ist nicht möglich, wenn der Arbeitnehmer keinen
Einfluss auf die Prämienbezugsgröße hat, seine Aufgabe primär in Anwesenheit
besteht (z.B. Pförtner) oder bei Arbeitsbeginn weder das Ergebnis der Aufgabe noch
die benötigte Zeit vorherzusehen ist (z.B. Forschung, bestimmte schöpferische
Tätigkeiten) (vgl. Eckardstein/Schnelli nger, 1978, S. 181).
Vorteile des Prämienlohnes sind die universellere Anwendbarkeit im Vergleich zum
Akkordlohn, die Möglichkeit der Betonung unterschiedlichster Leistungskriterien
sowie die Leistungsgerechtigkeit.
Nachteilig ist bei der Prämienentlohnung, dass die Leistungsbestimmung in vielen
Fällen von subjektiven Einschätzungen des Beurteilers beeinflusst wird.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832464882
- ISBN (Paperback)
- 9783838664880
- DOI
- 10.3239/9783832464882
- Dateigröße
- 598 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Wirtschaftsuniversität Wien – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2003 (März)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- wirtschaft gehaltssysteme beschäftigungsformen
- Produktsicherheit
- Diplom.de