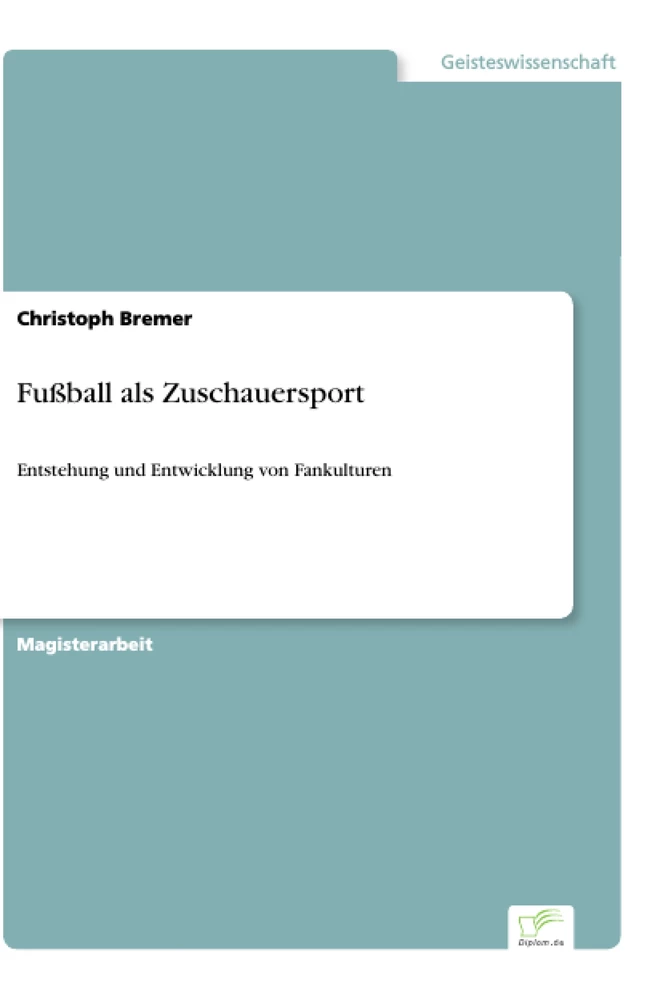Fußball als Zuschauersport
Entstehung und Entwicklung von Fankulturen
©2002
Magisterarbeit
110 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Kaum ein Feld der deutschen Sozialgeschichte wurde von der etablierten Geschichtsschreibung lange Zeit so vernachlässigt wie der Sport. Das ist vor allem daher verwunderlich, handelt es sich hierbei doch nicht um ein gesellschaftliches Randphänomen, sondern um eine Massenbewegung mit einer mehr als einhundertjährigen Geschichte. Bis heute blieb das Feld weithin Sportwissenschaftlern und Soziologen überlassen, was nur zu unbefriedigenden Ergebnissen führen konnte. So beschränkten sich Untersuchungen zur Geschichte rund um den Fußball in erster Linie auf ein reines Aufzählen und Darstellen von Erfolgen und Großereignissen. Lediglich der Arbeitersport wurde in den 1960/70er Jahren im Zuge der detaillierten Forschung zur deutschen Arbeiterbewegung einigermaßen ausgiebig behandelt. Die Konzentration auf diesen Teil der Sportbewegung führte allerdings zu einer weitgehenden Überschätzung des Arbeitersports. Tatsächlich waren selbst in dessen Hochphase, in der Weimarer Republik, weit mehr Arbeiter in den bürgerlichen Sportvereinen organisiert als im Arbeiter- Turn- und Sportbund (ATSB). Sein Wirkungskreis blieb größtenteils auf den gewerkschaftlich und parteipolitisch organisierten Teil der Arbeiterschaft beschränkt. Dem von der Mehrheit betriebenen bürgerlichen Sport hingegen, der nicht in den unmittelbaren Bannkreis der Parteien- und Ideologiegeschichte einzuordnen war, blieb eine systematische historische Erforschung vorenthalten. Er galt offenbar als zu trivial für eine ernsthafte wissenschaftliche Thematisierung. Die Mehrzahl der Historiker scheute indes das Risiko sich in die von Fachkollegen häufig belächelten Niederungen der Sportgeschichte zu begeben.
Ungeachtet dessen hat der Sport einen hohen Stellenwert in unserer freizeitorientierten Gesellschaft erreicht. Er ist ein vielschichtiges, soziales Phänomen, ja gar ein Massenphänomen, das in der ganzen Welt verbreitet ist. Es liegt nahe, dass wissenschaftliche Analysen sich in erster Linie mit dem aktiven Sportgeschehen beschäftigen oder ihr Augenmerk auf die Organisatoren des Sports richten. Weit weniger Beachtung, da auch wesentlich schwieriger zu erfassen, finden diejenigen, die den sportlichen Aktivitäten beiwohnen.
Obwohl der Sport noch immer als die schönste Nebensache der Welt gilt, ist er doch nicht nur in der Freizeit für viele zur Hauptsache geworden. Das gilt nicht nur für diejenigen, die den Sport aktiv betreiben, sondern bestätigt sich auch bei […]
Kaum ein Feld der deutschen Sozialgeschichte wurde von der etablierten Geschichtsschreibung lange Zeit so vernachlässigt wie der Sport. Das ist vor allem daher verwunderlich, handelt es sich hierbei doch nicht um ein gesellschaftliches Randphänomen, sondern um eine Massenbewegung mit einer mehr als einhundertjährigen Geschichte. Bis heute blieb das Feld weithin Sportwissenschaftlern und Soziologen überlassen, was nur zu unbefriedigenden Ergebnissen führen konnte. So beschränkten sich Untersuchungen zur Geschichte rund um den Fußball in erster Linie auf ein reines Aufzählen und Darstellen von Erfolgen und Großereignissen. Lediglich der Arbeitersport wurde in den 1960/70er Jahren im Zuge der detaillierten Forschung zur deutschen Arbeiterbewegung einigermaßen ausgiebig behandelt. Die Konzentration auf diesen Teil der Sportbewegung führte allerdings zu einer weitgehenden Überschätzung des Arbeitersports. Tatsächlich waren selbst in dessen Hochphase, in der Weimarer Republik, weit mehr Arbeiter in den bürgerlichen Sportvereinen organisiert als im Arbeiter- Turn- und Sportbund (ATSB). Sein Wirkungskreis blieb größtenteils auf den gewerkschaftlich und parteipolitisch organisierten Teil der Arbeiterschaft beschränkt. Dem von der Mehrheit betriebenen bürgerlichen Sport hingegen, der nicht in den unmittelbaren Bannkreis der Parteien- und Ideologiegeschichte einzuordnen war, blieb eine systematische historische Erforschung vorenthalten. Er galt offenbar als zu trivial für eine ernsthafte wissenschaftliche Thematisierung. Die Mehrzahl der Historiker scheute indes das Risiko sich in die von Fachkollegen häufig belächelten Niederungen der Sportgeschichte zu begeben.
Ungeachtet dessen hat der Sport einen hohen Stellenwert in unserer freizeitorientierten Gesellschaft erreicht. Er ist ein vielschichtiges, soziales Phänomen, ja gar ein Massenphänomen, das in der ganzen Welt verbreitet ist. Es liegt nahe, dass wissenschaftliche Analysen sich in erster Linie mit dem aktiven Sportgeschehen beschäftigen oder ihr Augenmerk auf die Organisatoren des Sports richten. Weit weniger Beachtung, da auch wesentlich schwieriger zu erfassen, finden diejenigen, die den sportlichen Aktivitäten beiwohnen.
Obwohl der Sport noch immer als die schönste Nebensache der Welt gilt, ist er doch nicht nur in der Freizeit für viele zur Hauptsache geworden. Das gilt nicht nur für diejenigen, die den Sport aktiv betreiben, sondern bestätigt sich auch bei […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6427
Bremer, Christoph: Fußball als Zuschauersport - Entstehung und Entwicklung von
Fankulturen
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Hamburg, Universität, Magisterarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Einleitung 1
1. Die Geschichte des Fußballsports
4
1.1 Fußball in Großbritannien
5
1.1.1 Die vorindustrielle Phase ,Volksfußball'
5
1.1.2 Fußball an den Public-Schools
8
1.1.3 Trennung der Spielvarianten
9
1.1.4 Fußball wird professionalisiert
10
1.2 Die globale Ausbreitung des Fußballs
12
1.3 Fußball in Deutschland
13
1.3.1 Fußball als Schulspiel
14
1.3.2 Nationaler Widerstand und Durchbruch des ,englischen
Imports'
15
2. Fußball als Zuschauersport
23
2.1 Die Entwicklung des Fußballs zum Zuschauersport 1860-1945
24
2.1.1 Soziale Struktur des Fußballpublikums
27
2.1.2 Zuschauerverhalten
32
2.2 Fußball als Zuschauersport nach dem Zweiten Weltkrieg
34
2.3 Fußball als Zuschauersport in den 1980er Jahren
37
2.4 Fußball als Zuschauersport in den 1990er Jahren
41
2.5 Zwischenfazit
44
3. Theoretische Hintergründe zu Fußball-Fankulturen
47
3.1 Definition des Sportzuschauers
47
3.1.1 Definition (Fußball-)Fan
51
3.1.2 Ausdifferenzierung der Fan-Szenerie
54
3.2. Kultur und Subkultur
56
3.2.1 Jugendliche Subkulturen ,peer-groups'
57
3.3 Die Subkultur jugendlicher Fußball-Fans
61
4. Fankulturen im Wandel
66
4.1 Einflüsse auf die Fußball-Fankultur
67
4.1.1 Die Durchkapitalisierung des Fußballs
67
4.1.2 Die Bedeutung der Medien
68
4.1.3 Die Bedeutung der Polizei
70
4.1.4. Die Fanprojekte
71
4.2 Identität und Identifikation
73
4.2.1 Der Alterungsprozess
74
4.2.2 Das Stadion
75
4.2.2.1 Das Stadion als Spiegel sozialer Entwicklungen
77
4.3 Strukturelle Veränderungen der Zuschauerzusammensetzung
79
4.3.1 Frauen und Fußball
79
4.3.2 Kutten, Hooligans, ,linke Fans' und Ultras
83
5. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
90
Literaturverzeichnis 96
Abbildungsnachweis
102
Kein Spieler, Manager oder Zuschauer - der Fußball entweder
intellektuell begreift oder mit seinem ganzen Gefühl, wird jemals diesen
Unsinn daherreden - der gelegentlich den Furchtsamen entfährt:
Schließlich sei es nur ein Spiel. Seit achtzig Jahren ist es eben nicht nur
ein Spiel gewesen, nämlich seit die Arbeiterklasse - hier einen Fluchtweg
aus dem Elend entdeckte und diesen Sport für sich reklamierte. Das war
nicht nur eine Randerscheinung dieses Jahrhunderts, was auf dem
Spielfeld passiert, hat große Bedeutung, die für manche Leute Lyrik hat
und für andere Alkohol. Er nimmt von der Persönlichkeit Besitz.
(Arthur Hopcraft)
1
Einleitung
Kaum ein Feld der deutschen Sozialgeschichte wurde von der etablierten
Geschichtsschreibung lange Zeit so vernachlässigt wie der Sport. Das ist
vor allem daher verwunderlich, handelt es sich hierbei doch nicht um ein
gesellschaftliches Randphänomen, sondern um eine Massenbewegung mit
einer mehr als einhundertjährigen Geschichte. Bis heute blieb das Feld
weithin Sportwissenschaftlern und Soziologen überlassen, was nur zu
unbefriedigenden Ergebnissen führen konnte. So beschränkten sich
Untersuchungen zur Geschichte rund um den Fußball in erster Linie auf
ein reines Aufzählen und Darstellen von Erfolgen und Großereignissen.
Lediglich der Arbeitersport wurde in den 1960/70er Jahren im Zuge der
detaillierten Forschung zur deutschen Arbeiterbewegung einigermaßen
ausgiebig behandelt. Die Konzentration auf diesen Teil der
Sportbewegung führte allerdings zu einer weitgehenden Überschätzung
des Arbeitersports. Tatsächlich waren selbst in dessen Hochphase, in der
Weimarer Republik, weit mehr Arbeiter in den bürgerlichen Sportvereinen
organisiert als im Arbeiter- Turn- und Sportbund (ATSB). Sein
Wirkungskreis blieb größtenteils auf den gewerkschaftlich und
parteipolitisch organisierten Teil der Arbeiterschaft beschränkt. Dem von
der Mehrheit betriebenen bürgerlichen Sport hingegen, der nicht in den
unmittelbaren Bannkreis der Parteien- und Ideologiegeschichte
einzuordnen war, blieb eine systematische historische Erforschung
vorenthalten. Er galt offenbar als zu trivial für eine ernsthafte
wissenschaftliche Thematisierung. Die Mehrzahl der Historiker scheute
indes das Risiko sich in die von Fachkollegen häufig belächelten
Niederungen der Sportgeschichte zu begeben.
Ungeachtet dessen hat der Sport einen hohen Stellenwert in unserer
freizeitorientierten Gesellschaft erreicht. Er ist ein vielschichtiges, soziales
Phänomen, ja gar ein Massenphänomen, das in der ganzen Welt verbreitet
ist. Es liegt nahe, dass wissenschaftliche Analysen sich in erster Linie mit
dem aktiven Sportgeschehen beschäftigen oder ihr Augenmerk auf die
Organisatoren des Sports richten. Weit weniger Beachtung, da auch
2
wesentlich schwieriger zu erfassen, finden diejenigen, die den sportlichen
Aktivitäten beiwohnen.
Obwohl der Sport noch immer als die schönste Nebensache der Welt gilt,
ist er doch nicht nur in der Freizeit für viele zur Hauptsache geworden.
Das gilt nicht nur für diejenigen, die den Sport aktiv betreiben, sondern
bestätigt sich auch bei Sportzuschauern. Besondere Anziehungskraft und
Faszination geht dabei vor allem vom Spitzensport aus: Leistungen wie
die perfekte Körperbeherrschung, Harmonie und Ästhetik der Bewegung
und sensationelle Höchstleistungen, sind für den Freizeitsportler
unerreichbar und üben daher einen besonderen Reiz aus. Es wäre jedoch
falsch, den Zuschauer nur auf eine passive Rolle einzugrenzen. Beobachtet
man die Bewegung, die durch eine Zuschauermenge strömt, das Rufen
und Applaudieren, überhaupt die Art und Weise wie das Sportpublikum
verschiedener Sportarten versucht, mit Stimmung die Sportler zu
unterstützen, wird deutlich, dass auch die Zuschauer aktiv am Geschehen
teilnehmen.
Unter den zahlreichen Sportarten ist Fußball der Sport, der weitaus am
meisten Interesse auf sich zieht, der die meisten Zuschauer anlockt und der
in den meisten Teilen der Welt Bestandteil einer nationalen Identität
geworden ist. Fußball gilt gemeinhin als harter Sport, der oft mit
Rowdytum, Gewalt und Schlägereien in Verbindung gebracht wird. ,,Vor
nur zwanzig Jahren gab es keinen Intellektuellen, der es gewagt hätte, sich
öffentlich zum Fußball zu bekennen" (Marias 2001, 53). Das Bild von
einem von Männern dominierten Sport hat sich in den letzten Jahren
gewandelt. Er trifft mehr und mehr den Geschmack der breiten
Öffentlichkeit, und so steht der Fußball auch immer öfter im Mittelpunkt
wissenschaftlicher Untersuchungen, nicht zuletzt deshalb, weil
Alltagsgeschichte momentan hoch im Kurs steht.
In dieser Arbeit steht das Fußballpublikum und hier vor allem der ,Fan'
und die ,Fankultur' im Vordergrund, denn sie sind heute ein fester, nicht
mehr wegzudenkender Bestandteil des modernen, kommerziellen
3
Profifußballs. Sie sind ein Teil des Spiels geworden, unverzichtbar zum
einen für die Spieler in ihrer Funktion als anfeuernde, motivierende,
lautstarke externe Unterstützung von den Rängen und - in weit höherem
Maße - unverzichtbar zum anderen für die Medien, sowie als zahlende
Konsumenten und wichtige Zielgruppe der ,Fußballindustrie'. Ohne
Zuschauer und Fans, ohne ihr Interesse am Spiel, wäre der Fußball für die
Sponsoren und die Medien ökonomisch uninteressant und nicht rentabel.
Das ,Millionengeschäft' Fußball ist demnach auf Fans und Zuschauer
angewiesen.
Zunächst wird ein historischer Überblick des aktiv betrieben Sports
Fußball, beginnend mit dessen ,Mutterland' England, geliefert. Im
Anschluss daran folgt eine Betrachtung der Entwicklung in Deutschland,
welches im weiteren Verlauf auch im Mittelpunkt der Untersuchung
stehen wird. Danach steht das Fußballpublikum im Fokus der Analyse.
Hierzu wird die Beschreibung von der Entstehung und Entwicklung des
Fussballs als Zuschauersport vorangestellt. Nach einer allgemeinen
Definition des Sportzuschauers und einer näheren Definition der
Fußballfans, soll Anhand der Begriffe Kultur und Subkultur, mit
speziellem Augenmerk auf die Subkultur der Jugendlichen, geklärt
werden, wie, wann und warum die Fankulturen entstanden sind. Hierzu
wird im Weiteren ein Überblick über die bisherigen Studien und den Stand
der Zuschauerforschung geliefert. Im letzten Kapitel wird dann der
Wandel der Fankulturen aufgrund sozialer, wirtschaftlicher und politischer
Hintergründe geklärt und ein detailliertes Bild der Zusammensetzung und
Motivation der Fußballzuschauer bis in die heutige Zeit aufgezeigt.
4
1. Die Geschichte des Fußballsports
Die Geschichte des Fußballs scheint so alt wie die Menschheit selbst. Um
die Entstehung dieser Sportart tummeln sich folglich zahlreiche Legenden.
Etliche Länder beanspruchen für sich, die Erfinder des Fußballs zu sein.
Tatsächlich stammt die älteste bekannte Darstellung eines Fußballspielers
aus China um 2600 v. Chr. Fußball ist zu dieser Zeit wahrscheinlich schon
weit verbreitet. In Japan nennt man das Spiel, welches der Legende nach
von chinesischen Fußballgeistern eingeführt wurde, ,Kemari'. Die Regeln
des ,Kemari' sind bis heute überliefert (vgl. Sport Chronik 2000, 21). Auf
europäischem Boden taucht eine bereits wettkampfbetontere Art des
Fußballs verstärkt in Italien auf, wo dieser Sport unter dem Namen ,Calcio'
seit dem 14. Jahrhundert gespielt wird. Während der Dynastie der Medici
erlebt ,Calcio' seine Blütezeit und verbreitet sich von Florenz aus über
ganz Italien. Fast 300 Jahre bleibt der ,Calcio' populär, dann vergisst man
das Spiel fast vollständig (vgl. zum Thema ,Calcio' Bredekamp 1993).
Obwohl gerne berichtet wird, die alten Ägypter hätten bereits gegen den
Ball getreten und trotz ,Kemari' und ,Calcio', darf sich England ohne
Zweifel als ,Mutterland' des Fußballs bezeichnen, denn in England liegt
die Wiege des modernen Fußballs. Als hier 1863 einige Gentlemen die
Football Association (FA) gründeten, um die unterschiedlichen
Spielweisen an den Public-Schools und den Universitäten zu
vereinheitlichen, wurde die Voraussetzung für die weltweite Verbreitung
des Spiels geschaffen. Die Gründerväter der FA machten aus einem alten
Kampf- und Wettspiel einen rational organisierten Sport, der überall und
von jedem ausgeübt werden konnte (vgl. Eisenberg 1997, 8-9). So
etablierte sich Fußball schließlich auch in Ländern wie beispielsweise
Deutschland, obwohl diese im Gegensatz zu England über keine
vorindustrielle Tradition des Spiels, ja sogar über keine Sporttradition im
Allgemeinen verfügten.
5
1. 1 Fußball in Großbritannien
London war im Jahr 1863 Schauplatz der weltweit ersten Gründung eines
Fußballverbandes und damit wurden in Großbritannien auch zum ersten
Mal allgemein gültige Regeln geschaffen. Doch wie kam es zu dieser
Entwicklung? Die Ausbildung des britischen Fußballs zu einem modernen
Sport, lässt sich in vier Phasen unterteilen:
·
Den sogenannten ,Volksfußball', den traditionellen, bis in die
vorindustrielle Zeit Englands reichenden Vorläufer des modernen
Fußballs (1.1.1)
·
Fußball an den Public-Schools, an denen er durch die Schule des
Bürgerlichen ging (1.1.2)
·
Die Gründung der FA, woraus letztlich die endgültige Trennung
von der verwandten Sportart ,Rugby' resultierte (1.1.3)
·
Die Professionalisierung des Sports, welche den Fußball schließlich
zu einem Massenphänomen werden ließ (1.1.4)
1.1.1 Die vorindustrielle Phase ,Volksfußball'
Die Geschichte des Fußballs lässt sich anhand englischer Quellen relativ
verlässlich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Seit dieser Zeit wird
von einem Ballspiel namens ,Fußball' berichtet (vgl. Elias/Dunning 1984,
85). Allerdings ,,darf man das Ausmaß des Fußballs im Mittelalter nicht
überschätzen" (Mason 1997, 22). Außerdem ist allei die Verwendung des
Begriffs ,Fußball' noch kein Beleg für das Bestehen des uns heute
bekannten ,Sportspiels'. Vielmehr handelte es sich um ein Spiel, welches
heute als ,Volksfußball' bezeichnet wird (vgl. Schulze-Marmeling 1992,
15) und auf simplen, ungeschriebenen Gewohnheitsregeln basiert. Es gab
weder eine Begrenzung der Spieldauer, noch des Spielfeldes oder der
6
Anzahl der Spieler. Oftmals standen sich ganze Dörfer oder Stadtviertel
gegenüber und spielten aufgrund der fehlenden zeitlichen Begrenzung nicht
selten bis zum Einbruch der Dunkelheit. Ziel dieser Spiele war es, einen
Gegenstand mit Händen oder Füßen zu einem der beiden, vorher
ausgemachten, Ziele zu bringen. Überdies war ,Volksfußball' äußerst rauh.
Die Betonung lag unmissverständlich auf Kraft und Gewalt, nicht auf
Geschicklichkeit. Die ungeschriebenen Regeln variierten von Region zu
Region.
Abb1: ,Volksfußball'
Ein ganz entscheidender Unterschied zum heutigen Fußball bestand vor
allem auch in dem Verhältnis von Zuschauern und Akteuren. Während
zwischen diesen beiden Gruppen heutzutage eine strikte Trennung besteht,
waren die Grenzen beim ,Volksfußball' oftmals fließend. Jeder konnte
kurzfristig in das Spielgeschehen eingreifen oder sich wieder aus dem
,Getümmel' heraushalten. Das Spiel wurde vornehmlich vom ,einfachen'
Volk betrieben. Die Aristokratie hielt sich von ihm fern, denn ,,es muss ein
7
wildes Spiel gewesen sein, ganz nach dem Geschmack der damaligen Zeit"
(Elias/Dunning 1984, 85). Kein Wunder also, dass die Obrigkeit versuchte,
dieses Treiben in Grenzen zu halten. Eines der ältesten Verbote, die das
belegt, rührt aus dem Jahre 1314, welches König Edward II durch den
Bürgermeister von London verkünden ließ:
,,Proklamation , verkündet zum Erhalt des Landfriedens ...Alldiweil
unser Herr und König in einem Krieg gegen seine Feinde in
Schottland zieht und uns besonders befohlen hat, seinen Frieden
strengstens zu wahren... und alldiweil in der Stadt großer Aufruhr
ist, durch gewisse Zusammenrottungen, die von großen Fußball-
Spielen auf öffentlichen Plätzen herrühren, wodurch viel Übles
was Gott verhüten möge entstehen könnte, befehlen wir also und
gebieten hiermit im Namen des Königs, dass, bei Strafe der
Einkerkerung, dieses Spiel fürderhin nicht mehr innerhalb der Stadt
gespielt werde"
(Elias/Dunning 1984, 85).
Das Fußball-Verbot des Bürgermeisters von London kann im
grundegenommen mit den modernen Entfremdungsprozessen, der
Versitzplatzung und auch der Fernsehvermarktung, auf eine Stufe gestellt
werden (vgl. 2.4)
Die Obrigkeit war bemüht, dieses Spiel in den Griff zu bekommen, um die
öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Man war außerdem bestrebt, das
Spiel durch sinnvolle militärische Übungen zu ersetzen, denn schwere,
durch den ,Volksfußball' hervorgerufene Verletzungen, führten oftmals zur
Militäruntauglichkeit und mitunter gab es sogar Todesfälle. Die Verbote
konnten in der Regel nur kurze Zeit aufrechterhalten werden, denn die
einfache Bevölkerung ließ sich von ihrem Spiel nicht abbringen. Erst mit
der einsetzenden Industrialisierung begann der Niedergang dieses
Vorläufers des modernen Fußballs. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts
war eine große Anzahl von ,Volksfußball'-Varianten in Vergessenheit
geraten.
8
,,Die Unterklassen wurden in ein drakonisches Fabriksystem gepresst,
welches für das wilde und unregulierte Spiel anders als die
naturorientierte Zeiteinteilung der Agrargesellschaft keine Gelegenheit
mehr ließ" (Schulze-Marmeling 1992, 15).
1.1.2 Fußball an den Public-Schools
Nachdem das ,Volksfußballspiel' nicht nur durch die einsetzende
Industrialisierung verdrängt wurde, sondern auch die Versuche der
Obrigkeit zur Unterdrückung des Spiels zunahmen, waren die englischen
Public-Schools das einzige ,Reservat', in denen das Spiel überleben konnte.
Man kann davon ausgehen, dass Fußball bereits seit dem 16. Jahrhundert
ein Schulspiel für die Kinder wohlhabender Eltern war (vgl. Mason 1997,
23). Mit der Herausbildung des Gentleman-Ideals kam es in dieser Zeit zu
einer bewussteren Körpereinstellung, wodurch sportliche Betätigungen
einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert erlangten.
Im Umfeld der Public-Schools entstanden daher keine Befürchtungen, die
den Fußball mit einer sozial-revolutionären Gesinnung in Verbindung
brachten. Vielmehr wurde dem Fußball immer häufiger ein positiver Effekt
für die Charakterbildung von Jugendlichen nachgesagt. Fortan war der
Fußball nicht mehr in der Hand des Volkes, sondern wurde von der
feudalen und bürgerlichen Jugend, welche die Public-Schools besuchte,
ausgeübt.
Die Durchsetzung des Fußballs an den Public-Schools basierte in erster
Linie auf der schwachen Autorität der Lehrer gegenüber ihren Schülern.
Diese resultierte aus einer schlechteren sozialen Stellung der Lehrer
gegenüber ihren Schülern, die in ihrem Treiben zudem von ihren Eltern
unterstützt wurden. So setzten die Schüler den Fußball häufig als
Provokationsmittel ein. In den Augen vieler Eltern waren die Public-
Schools weniger eine Bildungseinrichtung, als vielmehr ein soziales
9
Trainingsfeld. ,,Das informelle Leben (welches sich durch Macht- und
Prestigekämpfe ausdrückte. Anm. des Autors) der Public-Schools hielt die
Mehrheit der Eltern für ein nützliches Training zu Männlichkeit, Führertum
und Unabhängigkeit. Es wurde deshalb höher bewertet als Latein und
Griechisch" (Schulze-Marmeling 1992, 17). Zwischen 1830 und 1860
wurden Fußball und andere Ballsportarten im Zuge einer landesweiten
Schulreform erstmals offiziell in die Lehrpläne aufgenommen. In dieser
Phase wurde das ehemalige Volksspiel durch das Bürgertum aufgegriffen
und diesem nach und nach angepasst. Der Fußball wurde nun reguliert und
zivilisiert. ,,Das Spiel wurde seiner allzu brutalen Züge entledigt, und
anstelle eines realen Kampfes trat ein Scheinkampf, ein Wettkampf auf
höherem zivilisatorischem Niveau" (ebd.).
Ausgerechnet die Klassen also, welche den ,Volksfußball' seit dem 14.
Jahrhundert bekämpft hatten, sicherten nun seinen Fortbestand, wenn auch
mehr und mehr in abgewandelter Form.
1.1.3 Trennung der Spielvarianten
In Rugby wurde 1846 mit ,The Law Of Football As Played In Rugby
School' erstmals ein schriftliches Regelwerk für Fußball erstellt. Dieses
Regelwerk ist insofern als Basis für den heutigen Fußball anzusehen, da es
erstmals die Voraussetzungen für Vergleiche schuf. 1849 reagierte Eton
mit einem eigenen Regelwerk, welches sich im Besonderen von den Regeln
Rugbys unterschied, in dem es das Aufnehmen mit der Hand untersagte.
Zwar hatte derzeit jede Schule, in Folge von Statusrivalitäten, ihr eigenes
Regelwerk, doch mit dem ,Handling Game' und dem ,Kicking Game'
kristallisierten sich nun zwei wesentliche Grundströmungen heraus. Durch
die Regelwerke wurden außerdem bestimmte Komponenten herausgefiltert,
so dass differenziertere Sportspiele entstanden.
Im ,Volksfußball' waren die Grenzen im Vergleich dazu noch
verschwommener. Tatsächlich waren wohl mindestens sechs Sportarten,
10
wie wir sie heute kennen, in der ursprünglichen Form enthalten (vgl.
Bausenwein 1995, 88), welche sich erst in dieser Entwicklungsphase
voneinander trennten. So waren im ,Volksfußball' Komponenten von
Fußball, Rugby; Handball, Hockey, Boxen und Ringen zusammengefasst
(ebd.).
Die erste große Differenzierung im modernen Fußball entstand durch die
Betonung auf jeweils eine der beiden dem ursprünglichen Spiel zugrunde
liegenden Strategien. Im ,Volksfußball' gab es nur zwei Strategien:
Entweder die Möglichkeit der ,alle voll drauf' Schlachtstrategie oder das
Durchsetzen einer schnellen Person im ,einer gegen alle' Spiel, dem
Vorläufer des ,Dribblings'. Diese beiden Techniken ergeben mit dem
Handspiel die wesentlichen Unterscheidungn der erst später getrennten
Sportspiele ,Rugby-Football' und ,Soccer-Football'. ,,Noch war die
Spielweise dieselbe, doch unterschied man schon zwischen dem Running
Game (Rugby) und dem Dribbling Game (Eton)" (Bausenwein 1995, 362).
1863 kam es durch die Gründung der Football Association zur
vollständigen Trennung der Strategien in zwei ausdifferenzierte Sportarten.
In erster Linie war dies aber auch das Ergebnis eines gesellschaftlichen
Prestigekampfes zwischen dem aufstrebendem Bürgertum (Rugby) und der
darauf reagierenden alten Aristokratie (Eton).
1.1.4 Fußball wird professionalisiert
Nachdem sich der Fußball in der bürgerlichen Mittel- und der
aristokratischen Oberschicht horizontal ausgedehnt hatte, verlief seine
Verbreitung nun auch vertikal in Richtung der Unterschichten.
Bis Ende der 1860er Jahre rekrutierten sich englische Fußballklubs fast
ausschließlich aus ehemaligen Public-School- oder Universitäts-
mannschaften. Als es im Jahre 1870 zum endgültigen Durchbruch der 54
Std. Woche in England kam, hatten Arbeiter erstmals seit Beginn der
11
Industrialisierung wieder so etwas wie Wochenendfreizeit. Vor allem der
freie Samstagnachmittag begünstigte die Entwicklung des Fußballs. Der
Arbeitstag war in der Regel bereits am Samstagmittag beendet, so dass sich
dieser, da der Sonntag für den Kirchgang reserviert war, zum Fußballtag
entwickelte und es bis heute geblieben ist (vgl. Bausenwein 1995, 456). Es
kam also zur Reinkarnation des Fußballs in die unteren Schichten der
Bevölkerung und hier in erster Linie in die Arbeiterklasse.
Diese Entwicklung bedeutete für den Fußball letztlich den Durchbruch als
Zuschauersport. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Zuschauerzahl im
modernen Fußball auf ein paar wenige, zumeist am Spiel indirekt beteiligte
Personen, beschränkt. Bei Wettbewerben verschiedener Public-Schools
dürfte es sich bei den Zuschauern wohl vor allem um Mitschüler gehandelt
haben. Erst mit der ,Übernahme' des Spiels durch die Unterschichten
übertraf die Zuschauerzahl die Anzahl der Akteure praktisch bei jedem
Spiel. Kennzeichnend für diese Zeit war neben der Wandlung des Fußballs
zum Zuschauersport insbesondere der daraus resultierende
Professionalismus, der die Begeisterung der Unterschicht für diesen Sport
noch verstärkte. Der Fußball wurde nun auch finanziell und gesellschaftlich
für einen Arbeiter interessant. Während die Oberschicht am Amateurideal
des ,Gentlemen-Sportsmen' (vgl. Eisenberg 1999, 23-25) festhielt, wurde
die Arbeiterschaft praktisch dazu gezwungen sich dem Profitum
hinzuwenden, wollte sie den Sport weiter aktiv betreiben. ,,Die
Entwicklung des Fußballsports zum Zuschauersport, die erst möglich
wurde, als dieser nicht mehr das Reservat und Privileg der Oberschichten
war, förderte zwangsläufig den Professionalismus" (Schulze-Marmeling
2000, 102).
Im Gegensatz zu den Mitgliedern der Unterschicht, war es den Mittel- und
Oberschichten möglich, den Sport als ,schönste Nebensache der Welt' zu
betrachten. Den betuchten ,Gentlemen-Sportsmen' bot Fußball also
keinerlei finanziellen Anreiz. Für den Arbeiter galt das genaue Gegenteil.
Er konnte und wollte seine kostbare Zeit nicht umsonst mit Fußball
verschwenden. Die meisten englischen Arbeiter-Vereine rekrutierten sich
12
daher, unterstützt von Industriellen, aus Fabrikbelegschaften. So wurden
den Fußballern Privilegien bei der Arbeitszeit, der Anstellung und der
Bezahlung bewilligt. Oftmals wurden auch Spieler aus anderen Fabriken
abgeworben. Die Industriellen versprachen sich vom Fußball, neben
Sozialhygiene und Motivation, vor allem auch Ansehen für ihr
Unternehmen.
Endgültig durchsetzen konnte sich der Professionalismus in Engalnd
letztlich 1883, als mit ,Blackburn Olympic' erstmals ein Arbeiter-Team das
prestigeträchtige FA-Cup-Finale gewinnen konnte. Daraufhin zogen sich
die aristokratischen Amateurklubs aus dem FA-Cup, dem ersten und bis
dahin wichtigsten nationalen englischen Titel im Fußball, zurück. ,,Nie
wieder gewann ein Public-School oder Universitätsteam den englischen
Pokal" (Schulze-Marmeling 1992, 22). Die englischen Gentlemen wandten
sich vom Fußball ab und frönten mehr den Individualsportarten, wie z.B.
Golf, Fechten oder Tennis, die fortan eine soziale Exklusivität garantierten.
Dadurch gingen sie vor allem einer Sache aus dem Weg, denn eine
Niederlage auf dem Rasen wurde zunehmend zu einem Symbol dafür, was
man in der Oberschicht am meisten fürchtete: Die politische und
ökonomische Vernichtung durch die aufstrebende Arbeiterklasse.
Diese Entwicklungsphase des Fußballs, die etwa auf die Zeit zwischen
1850 und 1900 datiert werden kann, ist kennzeichnend für die Entfaltung
zum populären Zuschauersport in Großbritannien.
1.2 Die globale Ausbreitung des Fußballs
Von Großbritannien ausgehend, erfolgte die Ausbreitung des Fußballs in
praktisch alle Länder der Welt binnen weniger Jahre und ist durchaus im
Zusammenhang mit dem britischen Imperialismus zu sehen. Um 1900
waren es in allen Importländern britische Unternehmen, Geschäftsleute,
Techniker, Soldaten, Studenten oder Diplomaten, die das Spiel der
einheimischen Bevölkerung nahe brachten. In einigen Gegenden, in denen
13
sich keine Briten niedergelassen hatten, wurde deren Part von
Zurückkehrern übernommen, die dieses Spiel in Großbritannien
beispielsweise als Studenten kennen gelernt hatten. Lokale Traditionen,
wie etwa der beschriebene ,Calcio' in Italien, spielten wohl weniger eine
Rolle. Sie dienten lediglich einer schnelleren Akzeptanz.
Auch wenn nicht in allen Ländern der Schritt vom Gentlemen-Vergnügen
zum Bestandteil der Arbeiterkultur so schnell vollzogen wurde wie in
Großbritannien (vgl. Eisenberg 1997, 13), eines haben alle Importländer
des Fußballs gemeinsam: Nach dem ersten Weltkrieg entwickelte sich das
Spiel überall dort zu einem Massenphänomen, wo es sich bereits vor 1914
etabliert hatte.
1.3 Fußball in Deutschland
In Deutschland besteht im Vergleich zu Großbritannien keine
vorindustrielle Tradition des Fußballs. Fußball als Volksspiel existierte in
Deutschland nicht. Sport, der in England auf eine lange
Entwicklungsgeschichte zurückblickt, war in Deutschland praktisch nicht
existent (vgl. Eisenberg 1999, 78-81). Der Fußball hatte es in Deutschland
also ohnehin schon schwer, auf Akzeptanz zu treffen und hatte mit dem
Turnen auch noch eine starke Konkurrenz.
Fast zeitgleich zu den englischen ,Sports' entwickelte sich in Deutschland
die Tradition des Turnens. Als Reaktion auf die napoleonische Besatzung
und den Adel, der mit Napoleon kooperierte, entstand das Turnen aus der
demokratischen, bürgerlichen Nationalbewegung. Friedrich-Ludwig Jahn
sah das Turnen zunächst als ,,eine Vorbereitung des Guerillakrieges gegen
die französischen Besatzer" (Schulze-Marmeling 1992, 65) an, da er die
Niederlage Preußens als eine Bestätigung der geschwundenen
Volkstumskraft ansah und diese nun durch das Turnen wieder erstarken
lassen wollte. Turnen sollte die von den französischen Besatzern
eingeschränkten militärischen Möglichkeiten ersetzen.
14
Die Philosophie der Turnerbewegung war, dass alle Turner gleich seien,
und so gründete sich ihre Vereinspolitik auch auf demokratische
Ordnungen (vgl. Grüne 1995, 21). Die Turnbewegung hatte aber auch,
gemäß ihrer demokratisch-bürgerlichen Ausrichtung, die Beendigung der
Kleinstaaterei, sowie das Ende der Vorherrschaft der Aristokratie zum Ziel.
Aufgrund dessen wurde die Turnbewegung zwischen 1820 und 1840 durch
die preußische Turnsperre in den meisten deutschen Städten verboten und
,Turnvater Jahn' im Jahre 1819 verhaftet. Als die bürgerliche Bewegung
mit dem Scheitern der Revolution 1848 nahezu zerfiel und die deutsche
Einheit durch die preußische Militärherrschaft erzwungen wurde, wandelte
sich auch die innere Haltung der Turner. Die demokratischen Tendenzen
der Turnerschaft musste zugunsten nationaler und militärischer
Denkweisen weichen. Der einst revolutionäre Nationalismus der Turner
wandelte sich in einen reaktionären. Aus der von Jahn eingeführten
schlichten Kleidung wurden Uniformen, der Grundsatz ,alle Turnbrüder
sind gleich' fiel einer beinahe militärischen Hierarchie zum Opfer und das
Turnen unter Drillbedingungen ließ es zu einem billigen Abklatsch des
Militärs werden. ,,Als Leitwolf sollte sich die 1868 gegründete Deutsche
Turnerschaft (DT) bewähren" (Grüne 1995, 22).
1.3.1 Fußball als Schulspiel
Wie in Großbritannien musste der Fußball auch in Deutschland erst Einzug
in den Schulbetrieb halten, um sich schließlich langfristig etablieren zu
können. Durch die Veränderung des Turnens hin zum militärischen Drill
kam es zu einer großen Unlust unter den Schülern, an dieser Sportart
teilzunehmen. Zum anderen gab es innerhalb der bürgerlichen Jugend die
Tendenz, die feudalen Studentenschaften zu kopieren, in denen man
allerdings mehr dem Alkohol zusprach, als zu turnen. Als Folge hielten an
den Gymnasien exzessive Trinkgewohnheiten Einzug, ,,weshalb die
Behörden die Schülerverbindungen bald als öffentliches Ärgernis und
Brutstätte der Unsittlichkeit betrachteten" (Schulze-Marmeling 1992, 69).
15
Konrad Koch, ein Lehrer aus Braunschweig, nahm dies zum Anlass, etwas
in der Bewegungskultur zu verändern. Er vertrat die Auffassung, dass es
eines neuen pädagogischen Konzepts, jenseits der traditionellen Methoden
der Repression und der Belehrung, bedürfe. Er verschob den Schwerpunkt
disziplinarischen Handelns von der Fremddisziplinierung zur stärkeren
Selbstdisziplinierung. Er befand schließlich den Fußball für die Umsetzung
seiner pädagogischen Idee als weitaus tauglicher als das autoritäre und
militärische Turnen. Er versammelte 1874 einige jüngere Schüler um sich
und warf, anstatt viele Regeln zu erläutern, einen Ball in deren Mitte, so
dass sich sofort das erste Fußballspiel an einer deutschen Schule ergab.
1875 gründete man an der Schule Kochs den ersten Schülerverein, in
welchem rund 40 Schüler eine Mischung aus Rugby und Fußball spielten.
Im selben Jahr stellte Koch auch die ersten verbindlichen Fußballregeln
Deutschlands auf. 1878 wurde an Kochs Braunschweiger Gymnasium der
Fußball als verbindliches Schulspiel eingeführt (vgl. Eisenberg 1997, 98;
Schulze-Marmeling 2000, 66-71). Bis in die 1890er Jahre hinein bleibt
Fußball in Deutschland ein reiner Schulsport. Ähnlich wie in den ersten
Jahren an den Public-Schools bleibt er zunächst eine Mischung aus
,Soccer-Fußball' und ,Rugby-Fußball'
1.3.2 Nationaler Widerstand und Durchbruch des ,englischen Imports'
Wie bereits angedeutet, ist auch die Einführung des Fußballs in
Deutschland auf englische Wurzeln zurückzuführen. Es wurde vornehmlich
in Handelszentren wie Hamburg, Berlin und Frankfurt, in Residenzstädten
wie Hannover, Braunschweig und Dresden und in Modebädern wie Baden-
Baden, Wiesbaden und Cannstatt Fußball gespielt (vgl. Eisenberg 1997,
99). In Neuwied am Rhein kam es im Jahre 1860 mit englischen Schülern
zum ersten Spiel in Deutschland, welchem der spätere
Gründungsvorsitzende des DFB, Ferdinand Hueppe beiwohnt (vgl. Baroth
1992, 12). Fast immer wurden die einheimischen Jugendlichen von den
englischen Schülern zum Mitspielen aufgefordert, da ihre Mannschaften
16
hohen Fluktuationen unterworfen waren und die Anzahl der Spieler einfach
nicht ausreichte.
Mit dem Bremer Football-Club wurde 1880 der erste reine Fußballclub in
Deutschland gegründet, in dem ausschließlich die Association Variante,
also ohne Aufnehmen mit der Hand gespielt wurde. Der Bremer Football-
Club forderte häufig die Besatzungen der englischen Schiffe, die im
Bremer Hafen lagen, zu Spielen heraus (vgl. Baroth 1992, 35).
Ab 1884 galt dann Berlin als die große Fußballstadt Deutschlands. Man
fand aufgrund der zahlreichen Exerzierplätze, die das preußische Militär
den Fußballern zu Verfügung stellte, den für den Fußball nötigen Raum
vor. Ende der 1880er Jahre wurden in ganz Deutschland private
Fußballvereine gegründet, die meistens aus ehemaligen Schüler-
mannschaften hervorgingen und die immer mehr Association-Football
spielten, welches im allgemeinen Sprachgebrauch nun Fußball genannt und
vom Rugby unterschieden wurde. So können beispielsweise namhafte
Clubs wie der Hamburger SV (1887), Hertha BSC Berlin (1892), der VfB
Stuttgart (1893) oder der Karlsruher SC (1994) auf Schülerfußball-
mannschaften als Wurzeln zurückblicken.
Da sich der Fußball, seit seiner Einführung von Konrad Koch und anderen
Initiatoren, zum beliebtesten Sport unter den Jugendlichen entwickelte,
versuchten überzeugte Turner gegenzusteuern. In erster Linie versuchten
sie, auf den schwindenden Mitgliederzuspruch in der Deutschen
Turnerschaft zu reagieren.
Die DT war immer noch der mitgliederstärkste Verband in Deutschland
und behielt sich somit das Recht vor, die deutschen Ideale, im
Zusammenhang mit Leibesertüchtigungen, zu definieren. Der Streit um den
Fußball war also nicht nur aus der Konkurrenz geboren, es war vielmehr
auch ein Streit um ,Wahrheiten' und Ideologien.
17
Zunächst suchten die Fußballer noch Kontakt zu den Turnern und buhlten
um deren Anerkennung. Auf dem 1889 ausgetragenen deutschen Turnfest
in Leipzig erhielten sie die Möglichkeit, einen Schaukampf zwischen dem
,ATV Leipzig' und ,London Orion' vorführen zu lassen. Schon die
Wortwahl ,Schaukampf' und ,Vorführung' macht die Haltung der Turner
gegenüber der Sportart Fußball deutlich. Die Turner hatten andere Ideale.
So verpönten sie jede Form des Wettkampfes und den Fußball
bezeichneten sie als ,englische Krankheit'. Das turnerische Ideal war eine
straffe, schöne Körperhaltung und ein ,schönes', ästhetisches Spiel, jedoch
kein Wettkampf.
Abb2: Pamphlet gegen den Fußball
18
Konrad Koch, der durch seine liberalen Erziehungsideale weiterhin das
selbstdisziplinierte Handeln (im Fußball) dem fremddisziplinierten (beim
Turnen) vorzog, war zu Überlegungen gezwungen, wie Fußball als ein
deutsches Spiel bezeichnet werden könne. 1894 äußerte Koch in der
deutschen Turnzeitung Überlegungen, dass der Fußball seine Ursprünge
nicht in England habe, sondern schon im Mittelalter in ganz Europa und
somit auch in Deutschland gespielt wurde. Weiterhin versuchte er nun, alle
Begriffe des Fußballs in die deutsche Sprache zu übersetzen. So entstand
unter dem Druck des Zeitgeistes auch die Entscheidung für den Fußball
und gegen das Rugbyspiel, da dieses als noch englischer galt. Koch
versuchte, die angeblich deutschere Variante Fußball ein Stück weit
national einzufärben. Fußball sollte als das kleinere und daher akzeptablere
Übel dargestellt werden (vgl. Grüne 1995, 27). Wie die Pamphlete aus
dieser Zeit belegen, half dieses Vorgehen wenig gegen den zunehmenden
Protest der Turner. Das wohl bekannteste Pamphlet verfasste der von
Ferdinand Hueppe, dem ersten DFB Präsident, als ,,komische Figur"
beschriebene, Gymnasiallehrer Karl Planck. Er veröffentlichte seine
Thesen gegen den Fußball unter dem Namen ,,Fusslümmelei, über
Stauchballspiel oder die englische Krankheit" im Jahre 1894. Planck
argumentierte wie folgt: ,,Das Einsinken des Standbeines ins Knie, die
Wölbung des Schnittsbuckels, das tierische Vorstrecken des Kinns
erniedrigt den Menschen zum Affen (...) Was bedeutet aber der Fußtritt in
aller Welt? Doch wohl, dass der Gegenstand nicht Wert sei, dass man auch
nur die Hand um seinetwillen rührte. Er ist ein Zeichen der Wegwerfung,
der Geringschätzung" (zitiert nach Grüne 1995, 27). Konrad Koch stellte
dem gegenüber heraus, dass man: ,,sich vor dem Irrtum hüten müsse, das
Fußballspiel mit anderen Ballspielen auf eine Stufe zu stellen. (...) Was
aber das wichtigste ist und worauf man in England mit gutem Recht den
größten Wert legt: Es lehrt den einzelnen, sich der Gesamtheit willig
einzupassen und unterzuordnen" (ebd., 26). Das entsprach zwar nicht den
Grundprinzipien Kochs, war aber ein zugkräftiges, weil zeitgemäßes
Argument und sicherlich nur ausgesprochen, um endlich eine Anerkennung
des Fußballs durch die noch einflussreichen Turner zu erlangen. Ohnehin
trugen Argumente, die sich für den Sinn und Zweck des Fußballs
19
einsetzten, meist seltsame Blüten. Argumentationen fanden in der Regel
nur dann einen breiten Zuspruch, wenn sie national eingefärbt waren und
damit geeignet schienen, die so denkenden Turner überzeugen zu können.
Eine deutlich offensive Kritik gegen die Anfeindungen der Turner fand
deshalb auch der Pädagoge W. Wickenhagen 1895: ,,Man braucht ja nur in
unserem Volke etwas vom ,deutschen Gemüt, deutscher Schlichtheit,
deutscher Treue und Ehrlichkeit' vorzuschwafeln und recht redlich auf das
Ausland zu schimpfen, dann hat man die Bravoschreier für sich, ...und
dann die Kindergartenparole, ,wir spielen um schön und richtig zu spielen,
die Engländer spielen nur mit Rücksicht auf den Sieg'. Das sagt ein Mann
der Skatkongresse, der Mensurenholzerei und des Bierjungensports" (zitiert
nach Baroth 1992, 84). Diese Kritik galt einem Lehrer, der dem deutschen
Turnen wieder einmal eine ,moralisch-erzieherische höhere Art' zuschrieb,
als dem fremden englischen Sport Fußball.
Doch gerade die Verdrängung des Fußballs aus den Schulen seitens einer
konservativen Lehrerschaft begünstigte den Sport in seiner Entwicklung,
denn es waren, wie bereits erwähnt, die alten Schulmannschaften, die
insbesondere in den Jahren 1895/96 eine Vielzahl von privaten
Fußballvereinen gründeten. Aus den Fußballabteilungen der Turnvereine,
die auch ständigen Anfeindungen von Seiten der Turner ausgesetzt waren,
wurden ebenfalls eigenständige Sport- bzw. Fußballvereine gegründet.
Innerhalb dieses neu entstandenen Netzwerkes von Fußballclubs konnte,
wenn auch noch ohne großes Zuschauerinteresse, ungestört gespielt
werden. ,,Bald kam es zu ersten lokalen Verbandsgründungen, die kleine
Meisterschaftsrunden organisierten" (Grüne 1995, 34).
Gefördert wurde die langsame aber stetige Durchsetzung des Fußballs in
Deutschland schließlich im besonderen Maße durch die relativ große aber
traditionslose Gruppe der Angestellten, die den ebenfalls traditionslosen
Fußball als Instrument zur Stabilisierung ihres Status neben dem
*Bürgertum benutzten. Die Angestellten übernahmen für Deutschland die
Rolle, wenn auch auf eine andere Art und Weise, welche in England die
Arbeiterklasse für den Fußball gespielt hatte. (vgl. 2.1.1)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832464271
- ISBN (Paperback)
- 9783838664279
- Dateigröße
- 13.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hamburg – Sozialwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
- Note
- 1,6
- Schlagworte
- sozialgeschichte subkultur jugendkultur sportgeschichte
- Produktsicherheit
- Diplom.de