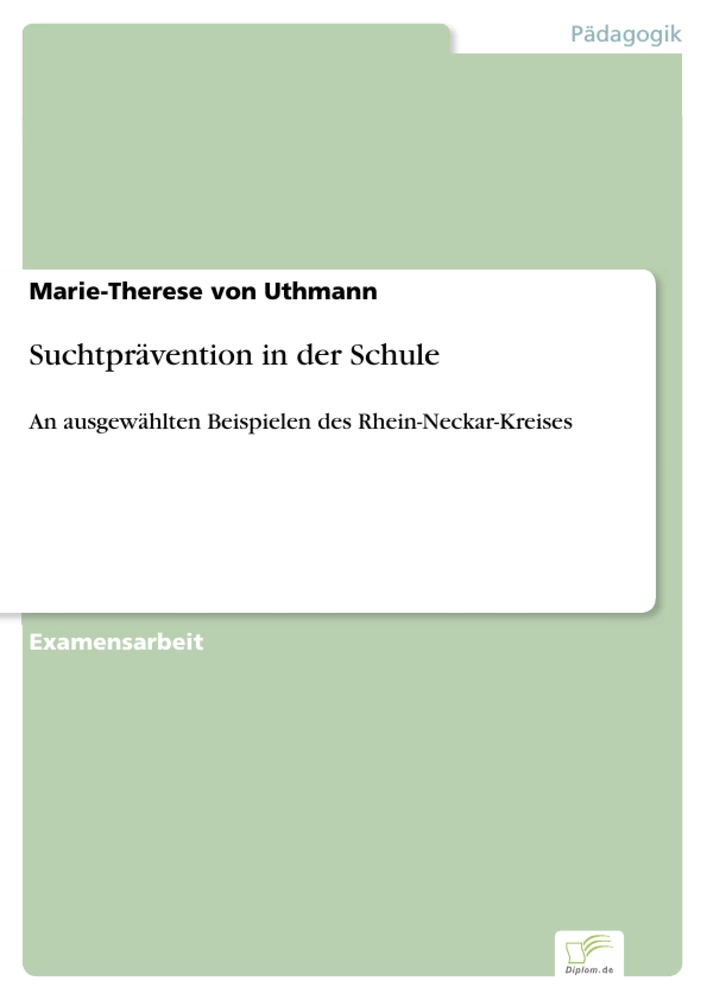Suchtprävention in der Schule
An ausgewählten Beispielen des Rhein-Neckar-Kreises
Zusammenfassung
Aufmerksamkeit erregte eine Nachricht vom Januar 2002, dass der jüngste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz Charles betrunken und unter Einfluss von Haschisch vor einem Pub beobachtet wurde. Dabei scheint ein solcher Zustand bei Jugendlichen im Alter von Prinz Harry nicht ungewöhnlich zu sein. Laut einer aktuellen Statistik der BZgA rauchen auch in Deutschland 38% der 12-25jährigen ständig. Jeder dritte trinkt mindestens drei mal in der Woche Alkohol und illegale Drogen werden von mindestens 5% regelmäßig konsumiert. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen (vgl. BZgA 2001(b), 9ff).
Der englische Prinz ist demnach als Stellvertreter der Jugendlichen unserer Gesellschaft zu sehen, auf die sich das Interesse der Öffentlichkeit richten muss, denn das Phänomen Sucht ist ein fester Bestandteil unseres Alltags. Da die Abhängigkeit eines Menschen Auswirkungen auf sein gesamtes Umfeld hat, ist die Notwendigkeit des Handelns in allen mittelbar und unmittelbar betroffenen Bereichen gegeben.
Mein persönliches Interesse für diese Thematik entwickelte sich, nachdem ich im eigenen engsten Umfeld eine Suchtentstehung miterlebt habe und die erheblichen Auswirkungen auf den Betroffenen selbst und die nahestehenden Personen beobachten konnte.
Wie kann es nun zu einer Abhängigkeit bei Jugendlichen kommen?
Es drängt sich die Frage auf, was man gegen eine solche Entwicklung tun kann.
Sucht wird oft mit einer Krankheit gleichgesetzt, die eine tiefer liegende Störung ausdrückt. Betrachtet man einzelne Suchtgeschichten, so wird immer wieder deutlich, dass der Betroffene Probleme nicht selbständig bewältigen kann. Diesem Menschen fehlen Kompetenzen, die ihn stark genug machen, einer Abhängigkeit entgegen zu treten. Genau hier setzt die Aufgabe der Prävention an. Es gilt, Jugendliche dabei zu unterstützen, zu eigenverantwortlichen, selbstbewussten und lebensbejahenden Menschen heranzuwachsen. Diese Unterstützung muss gerade auch vom näheren Umfeld der Jugendlichen ausgehen. Der Familie kommt eine große Bedeutung zu, vor allem in den ersten Lebensjahren. Später muss aber auch die Schule sich ihrer Verantwortung stellen und positiv auf die Entwicklung der Schüler einwirken.
Im Vorfeld einer Sucht muss danach gefragt werden, was einen Menschen stark macht und wie eine Abhängigkeit verhindert werden kann. Dabei ist es wichtig, dass die vorbeugenden Maßnahmen als Gemeinschaftsaufgabe gesehen werden.
Eine Abhängigkeit hat immer […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Gliederung
0. Einleitung
I. DAS PHÄNOMEN SUCHT
1. Der Weg in die Sucht
2. Begriffsklärung Sucht
2.1. Zusammenfassung der Merkmale einer Sucht
2.2. Stoffgebundene Abhängigkeit
2.3. Stoffungebundene Abhängigkeit
2.4. Psychische Abhängigkeit
2.5. Physische Abhängigkeit
3. Drogen
II. URSACHEN FÜR DIE SUCHTENTSTEHUNG BEI JUGENDLICHEN
1. Entstehung von Sucht
1.1. Multifaktorielle Suchtgenese
1.2. Das Ursachendreieck
2. Personale Risikofaktoren für Drogensucht
2.1. Genetisch-biologische Risikofaktoren
2.2. Persönlichkeit
3. Soziale Risikofaktoren für Drogensucht
3.1. Umwelt
3.2. Familie
3.3. Schule
3.4. Peer-Group
4. Theoretische Ansätze zur Erklärung der Entstehung von Drogensucht
4.1. Psychoanalytische Theorie
4.2. Lernpsychologische Theorie
4.3. Sozialpsychologische Theorie
4.4. Sinnorientierte Theorie
5. Faktoren des Suchtmittels
III. SUCHTPRÄVENTION
1. Begriffsklärung Prävention
2. Präventionskonzepte im Wandel der Zeit
2.1. 60er Jahre: Abschreckung
2.2. 70er Jahre: Aufklärung
2.3. 80er Jahre: Auseinandersetzung
2.4. Suchtprävention seit den 90er Jahren bis heute
2.4.1. Kommunikative Maßnahmen
2.4.2. Strukturelle Maßnahmen
3. Strukturen der Suchtprävention in Deutschland
4. Drei Ebenen der Prävention
4.1. Primärprävention
4.2. Sekundärprävention
4.3. Tertiärprävention
IV. SUCHTPRÄVENTION IN DER SCHULE
1. Schulische Prävention
1.1. Ziele der schulischen Prävention
1.2. Die Rolle der Lehrer
1.3. Sekundärprävention in der Schule
1.4. Erlass des Kultusministeriums Baden-Württemberg
2. Gesundheitsförderung
2.1. Begriffsklärung Gesundheit
2.2. Gesundheitsförderung im Sinne der Ottawa Charta
2.3. Gesundheitsförderung in der Schule
2.4. Unterscheidung Gesundheitsförderung - Prävention
3. Methoden der Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule
3.1. Affektive Erziehung
3.2. Standfestigkeitstraining
3.3. Life-Skill-Training
3.4. Erlebnispädagogik
V. PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG VON SUCHTPRÄVENTIONSPROJEKTEN AN SCHULEN
1. Erleben Pur - Mannheim
1.1. Lehrerfortbildung
1.2. Elternabend
1.3. Erster Projekttag
1.4. Zweiter Projekttag
1.5. Beobachtungen zum zweiten Projekttag
1.6. Beurteilung
2. Starter Programm - Heidelberg
2.1. Das Programm für die fünften Klassen
2.2. Beobachtungen am ersten Projekttag
2.3. Beobachtungen am dritten Projekttag
2.4. Beurteilung
3. Prävention durch die Polizei
3.1. Beobachtungen an einem Vormittag
3.2. Beurteilung
VI. RESÜMEE
Literaturverzeichnis
0. Einleitung
Aufmerksamkeit erregte eine Nachricht vom Januar 2002, dass der jüngste Sohn des britischen Thronfolgers Prinz Charles betrunken und unter Einfluss von Haschisch vor einem Pub beobachtet wurde. Dabei scheint ein solcher Zustand bei Jugendlichen im Alter von Prinz Harry nicht ungewöhnlich zu sein. Laut einer aktuellen Statistik der BZgA rauchen auch in Deutschland 38% der 12-25jährigen ständig. Jeder dritte trinkt mindestens drei mal in der Woche Alkohol und illegale Drogen werden von mindestens 5% regelmäßig konsumiert. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen (vgl. BZgA 2001(b), 9ff).
Der englische Prinz ist demnach als Stellvertreter der Jugendlichen unserer Gesellschaft zu sehen, auf die sich das Interesse der Öffentlichkeit richten muss, denn das Phänomen Sucht ist ein fester Bestandteil unseres Alltags. Da die Abhängigkeit eines Menschen Auswirkungen auf sein gesamtes Umfeld hat, ist die Notwendigkeit des Handelns in allen mittelbar und unmittelbar betroffenen Bereichen gegeben.
Mein persönliches Interesse für diese Thematik entwickelte sich, nachdem ich im eigenen engsten Umfeld eine Suchtentstehung miterlebt habe und die erheblichen Auswirkungen auf den Betroffenen selbst und die nahestehenden Personen beobachten konnte.
Wie kann es nun zu einer Abhängigkeit bei Jugendlichen kommen?
Es drängt sich die Frage auf, was man gegen eine solche Entwicklung tun kann.
Sucht wird oft mit einer Krankheit gleichgesetzt, die eine tiefer liegende Störung ausdrückt. Betrachtet man einzelne Suchtgeschichten, so wird immer wieder deutlich, dass der Betroffene Probleme nicht selbständig bewältigen kann. Diesem Menschen fehlen Kompetenzen, die ihn stark genug machen, einer Abhängigkeit entgegen zu treten. Genau hier setzt die Aufgabe der Prävention an. Es gilt, Jugendliche dabei zu unterstützen, zu eigenverantwortlichen, selbstbewussten und lebensbejahenden Menschen heranzuwachsen. Diese Unterstützung muss gerade auch vom näheren Umfeld der Jugendlichen ausgehen. Der Familie kommt eine große Bedeutung zu, vor allem in den ersten Lebensjahren. Später muss aber auch die Schule sich ihrer Verantwortung stellen und positiv auf die Entwicklung der Schüler einwirken.
Im Vorfeld einer Sucht muss danach gefragt werden, was einen Menschen stark macht und wie eine Abhängigkeit verhindert werden kann. Dabei ist es wichtig, dass die vorbeugenden Maßnahmen als Gemeinschaftsaufgabe gesehen werden.
Eine Abhängigkeit hat immer bestimmte Ursachen und diesen gilt es entgegenzuwirken. Es muss zunächst weit ausgeholt werden, um die Entstehung und die Ursachen einer Sucht zu beleuchten um später dann Möglichkeiten der Suchtvorbeugung ableiten zu können. Dabei werden in dieser Arbeit die einzelnen Suchtstoffe und ihre Wirkung vernachlässigt, da diese im Einzelnen für allgemeine Präventionsmaßnahmen keine Rolle spielen.
Zu Beginn der Arbeit wird das Phänomen Sucht erläutert. Dabei spielen nicht nur die Begrifflichkeit und Kriterien eine Rolle, die zu einer Sucht gehören, sondern ebenso unterschiedliche Formen von Abhängigkeit.
Anschließend werden verschiedene Risikofaktoren dargestellt, die bei Jugendlichen ein Suchtverhalten zur Folge haben können. In den beiden darauffolgenden Teilen der Arbeit wird Suchtprävention dargestellt und näher erläutert. Dabei geht es erst um die historische Entwicklung und um eine allgemeine Betrachtung der Suchtvorbeugung, dann werden im folgenden Teil die speziellen Aufgaben der Schule herausgestellt.
Schließlich werden im letzten Teil der Arbeit drei Präventionsprojekte aus dem Rhein-Neckar-Kreis vorgestellt, die die Realisierung der theoretischen Kenntnisse in der Praxis aufzeigen. Hierbei waren sehr unterschiedliche Konzepte der Suchtprävention zu beobachten, die teils einen sehr modernen Präventionsstil beinhalteten, jedoch waren gleichermaßen veraltete und überholte Strukturen sichtbar.
I. DAS PHÄNOMEN SUCHT
1. Der Weg in die Sucht
Jede Art süchtigen Verhaltens zeigt, dass die betroffene Personen Phasen und Entwicklungen einer Verhaltensweise durchlaufen, bis es zur Sucht kommt. Der Weg in die Sucht beginnt mit Konsum, geht über in den Genuss, an den sich die Phase der Gewöhnung anschließt. Aus der Gewöhnung kann eine Abhängigkeit entstehen.
Allerdings müssen Genuss und Gewöhnung nicht immer zu einer Abhängigkeit führen. Ein Individuum kann genießen und sich auch an ein Verhalten gewöhnen, ohne jemals abhängig zu werden. Andere werden jedoch von Dingen und Stoffen abhängig, an die sie sich gewöhnt haben (vgl. Bäuerle 1996 (b), 41). Es ist wichtig, bei jedem Individuum, das abhängiges Verhalten zeigt, nach den Ursachen (Kap. II) zu fragen, die vor allem in der Persönlichkeit des Betroffenen zu finden sind.
Konsum stellt einerseits den Gebrauch oder Verzehr von bestimmten Gütern oder Stoffen dar, andererseits ist Konsum aber auch die Aufnahme von Erlebnissen und Empfindungen (z.B. Fernsehen). Der Konsum muss zunächst als eine wertfreie Tätigkeit eines jeden Menschen verstanden werden, aus der zunächst keinerlei Gefahr entsteht. Konsum kann aber auch zum Genuss gesteigert werden. Dies ist der Fall, wenn der normale Konsum als angenehm empfunden wird. Der Betroffene fühlt sich nach dem Konsumieren besser als vorher. Mit diesem Schritt ist der Übergang in die Gewöhnung geebnet, denn der Betroffene wird anstreben, das angenehme Gefühl zu wiederholen. Gewöhnung - oft als rauschhafter Genuss empfunden - kann sowohl durch einen bestimmten Stoff, wie auch durch bestimmte Situationen (z.B. Besuchen eines Spielcasinos), ausgelöst werden.
Diese Gewöhnung ist ein Vorstadium des Missbrauchs oder auch der Abhängigkeit. Diesen Übergang vom kontrollierten Gebrauch zum unkontrollierten Missbrauch erkennt der Konsument meistens nicht. Die Gewöhnung geht dann so weit, dass ein Wiederholungszwang entsteht. Dieser resultiert daraus, dass nach einer bestimmten Phase der Gewöhnung eine Toleranz gegenüber dem konsumierten Stoff entsteht. Der Körper stellt sich auf bestimmte Wirkstoffe ein und durch die entwickelte Toleranz ist der Betroffene von diesem Wirkstoff körperlich abhängig (Kap. I.2.5.). In diesem Moment missbraucht die Person die Substanz, denn der “normale“ Gebrauch wird übermäßig gesteigert. Der Konsument wird ohne Rücksicht auf seine Umwelt versuchen, das eigene Recht auf Genuss durchzusetzen. Dieser Aspekt ist einer von vielen Kennzeichen von Sucht (Kap. I.2.1) (vgl. Bäuerle 1996 (a), 33f).
Bäuerle hebt hervor, dass die Verwendung des Begriffs Missbrauch nicht hinreichend ist. Dies macht er daran fest, dass Missbrauch sich auf zu unterschiedliche Definitionen stützt. Im medizinischen Verständnis ist Missbrauch dann gegeben, wenn eine Substanz übermäßig - selbst wenn nur einmalig - konsumiert wird. Im juristischen Verständnis ist Missbrauch dann vorhanden, wenn - abgesehen von jeglicher Gesundheitsschädigung - gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) verstoßen wird. Aus psychosozialer und pädagogischer Sicht, liegt Missbrauch dann vor, wenn ein Jugendlicher durch einen Konsum seine eigene Entwicklung und seine Umwelt negativ beeinträchtigt (Bäuerle 1996 (a), 33f sowie Bäuerle 1996 (b), 41f). Missbrauch sollte als Bestandteil von Sucht gesehen werden. Jede Abhängigkeit ist ein Missbrauch, während der umgekehrte Fall nicht immer gegeben sein muss. Oft ist es der Fall, dass Missbrauch und dessen Folgen einer Sucht sehr nahe kommen können, denn Abhängigkeit von einem Suchtstoff ist auch ein Missbrauch. Dieser kann aber auch einmalig geschehen, während Sucht sich durch Langfristigkeit und die extreme Beeinträchtigung des Konsumenten kennzeichnet (vgl. Solms/Steinbrecher 1975, in: ders., I/6) .
In der Literatur werden die Begriffe Sucht und Abhängigkeit meistens synonym verwendet. In den Fällen, in denen die beiden Termini unterschieden werden, gilt Sucht als Steigerung der Abhängigkeit. In dieser Arbeit wird jedoch kein Unterschied zwischen Sucht und Abhängigkeit gemacht.
2. Begriffsklärung Sucht
Im folgenden soll das Phänomen Sucht näher definiert werden, die Kennzeichen von Sucht vorgestellt und zwei Formen der Abhängigkeit dargestellt werden: diejenige, die sich auf Substanzen bezieht, und diejenige, die sich durch zwanghaft ausgeführtes Verhalten kennzeichnet. Beide Suchttypen können sowohl auf die Psyche als auf die Physis des Menschen wirken.
Etymologisch stammt das Wort Sucht von dem mittel- und althochdeutschen Substantiv “Suht“. Im Neuhochdeutschen existiert das Wort “siech“, welches krank bedeutet. Oft wird Sucht in Zusammensetzungen verwendet (Schwindsucht). In Begriffen wie Mondsucht und Eifersucht kann das Wort Sucht als krankhaftes Verlangen verstanden werden. Sucht kennzeichnete früher auch Leidenschaft und Sünde. Im neuhochdeutschen Sprachgefühl wird der Begriff oft mit “suchen“ verknüpft (vgl. Duden 2000, 789).
In der Suchtforschung existieren verschiedene Definitionen zu dem Begriff Sucht.
Bis in die sechziger Jahre unterschied man zwischen Gewöhnung und Sucht. Gewöhnung wurde in ihrem Krankheitsbild als quantitativ geringer eingeschätzt. Diese Definition galt dann als fragwürdig, als in Laborexperimenten zu beobachten war, dass ein Stoff, der zu den Gewöhnungsgiften gezählt wurde, in erhöhter Dosierung Abhängigkeit zur Folge haben konnte (vgl. Halbach 1975, in: Steinbrecher/Solms, I/28).
Da die Unterscheidung zwischen Drogensucht (drug addiction) und Drogengewöhnung (drug habituation) als unscharf deklariert wurde, führte ein Ausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1964 Abhängigkeit (dependence) als Rahmenbegriff ein. Da sich jeder Suchtverlauf individuell gestaltet, sollte von den starren Definitionen abgerückt werden. Aus diesem Grund einigte man sich auf eine Beschreibung, die sich an dem Stand der Forschung orientierte und somit veränderlich war (ebd., I/28).
Laut WHO bedeutet nun Abhängigkeit:
„Abhängigkeit ist ein Zustand (psychisch und oft auch physisch), der aus der Wechselwirkung einer Substanz mit dem lebenden Organismus entsteht und durch bestimmte Verhaltens- und andere Reaktionen charakterisiert ist, zu denen immer der Drang gehört, die Substanz periodisch oder wiederholt einzunehmen, um deren psychische Effekte zu erleben und in manchen Fällen auch um die unangenehmen Effekte seines Fehlens zu vermeiden.“
(WHO, nach: Thews et al. 1999, 697)
Diese Definition der Abhängigkeit verdeutlicht, dass alle bekannten Suchtstoffe abhängig machen können, in jedem Fall psychisch, meistens auch physisch. Gemeint ist bei „psychischen Effekten“ ein empfundener Rauschzustand. Die physischen Folgen werden dadurch gekennzeichnet, dass die „unangenehmen Effekte“ des Fehlens (Entzugserscheinungen, Kap. I.2.5.) erwähnt werden. Auch der oben beschriebene Unterschied zwischen Missbrauch und Abhängigkeit wird in dieser Definition noch einmal deutlich: Abhängigkeit definiert sich durch ein ständiges Wiederholen einer Verhaltensweise.
Eine ähnliche Definition wie die der WHO findet man bei Heckmann:
„Nach allgemeinster wissenschaftlicher Übereinstimmung ist Sucht ein zwanghafter Drang, durch bestimmte Reize oder Reaktionen Lustgefühle oder -zustände herbeizuführen oder Unlustgefühle zu vermeiden Der Zwang, unter dem der Süchtige dabei steht, ist mit einem Mangel an Selbstkontrolle gleichzusetzen. Ziel des Suchtverhaltens und Inhalt des Lustzustandes ist der Aufbau einer Scheinwelt im Sinne einer Realitätsflucht.“
(Heckmann 1980, in: Psychosozial 2, S. 115)
Heckmann schildert hier sowohl die psychische (Kap. I.2.4.), als auch die physische Abhängigkeit (Kap. I.2.5), wenn er von „Lustgefühlen“ und einem „zwanghaften Drang“ spricht. Abhängigkeit kann sich aus zwei Komponenten zusammensetzen: der psychischen und der physischen Abhängigkeit. Sucht ist also ein psychophysischer Krankheitsprozeß. Denn die Abhängigkeit betrifft sowohl den Geist, als auch den Körper. Sucht ist somit „eine gesamthafte Ausrichtung des Denkens, Fühlens und Wollens, des gesamten Lebens auf ein oder mehrere Suchtmittel oder auf ein süchtiges Verhalten.“ (Waibel 1992, S. 12)
In dieser Definition von Waibel wird herausgestellt, dass Menschen nicht nur von einem bestimmten Stoff, sondern ebenso von einer Verhaltensweise abhängig sein können. Diese Art der Sucht nennt man stoffungebundene Abhängigkeit, auf die in Kapitel I.2.3. eingegangen wird.
Die Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (DHS) hebt hervor, daß Sucht in allen Fällen Unfreiheit bedeutet. Der abhängige Mensch ist nicht mehr fähig, mit dem Suchtmittel frei zu hantieren. (vgl. DHS 1995, 2)
„Die Unfreiheit besteht darin, daß die Suchtmittel so sehr in den Mittelpunkt des Interesses rücken, daß eine freie Lebensgestaltung immer mehr eingeschränkt wird.“
(Waibel 1992, 12)
Die Persönlichkeitsentfaltung wird beeinträchtigt und alle Pläne, die die Zukunft betreffen, gelten als zweitrangig. Der Abhängige merkt nicht, dass nicht er die Droge, sondern die Droge ihn unter Kontrolle hat.
Sucht ist nach Nöcker „das Scheitern des Versuchs, dauerhafte Entlastungsmöglichkeiten zu entwickeln, ohne dabei die Kontrolle über dieses Verhalten zu verlieren.“ (Nöcker 1990, 75)
Merkmale einer Sucht 8
2.1. Zusammenfassung der Merkmale einer Sucht
Einstimmig werden in der Fachliteratur mehrere Faktoren gesehen, die Anzeichen für süchtiges Verhalten sind:
- Es ist zwanghaft: der Abhängige muß sich unter allen Umständen den Suchtstoff verschaffen, ihn konsumieren. Dabei ist das Ziel einen erlebten (Rausch-)Zustand zu wiederholen (psychisch).
- Dadurch, daß das Suchtmittel immer mehr an Bedeutung erlangt, immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses rückt, werden die sozialen Beziehungen weniger und auch frühere Interessen des Abhängigen werden vergessen. Das gesamte Leben konzentriert sich auf die Sucht und wird von ihr bestimmt. Die Schädigung betrifft nicht nur den Süchtigen, sondern auch das soziale Umfeld.
- Es entsteht eine Abstinenzunfähigkeit, das heißt der Süchtige leidet bei Unterbrechung der Einnahme an Entzugserscheinungen (physisch).
- Die Dosis wird erhöht, da nach längerem Konsum eines Suchtmittels die erwünschte Wirkung nachläßt und nur durch eine größere Menge des Stoffes wieder erreicht werden kann (Toleranz). Der Süchtige versucht das Erlebte zu intensivieren.
- Der Kontrollverlust macht es dem Süchtigen unmöglich, aus eigener Kraft aufzuhören. Es ist dem Süchtigen nach kurzer Zeit versagt, willentlich auf das Suchtverhalten einzuwirken.
- Nach einiger Zeit der Abstinenz - selbst nach einer Therapie - greift der Suchtkranke oft wieder zur Droge, nimmt die selbe Dosis oder erhöht sie. Dies beschreibt den sogenannten Rückfall.
- Ein physischer und psychischer Verfall tritt im Endstadium der Sucht auf, das heißt, der Betroffene verliert nicht nur die sozialen Bezüge, sondern stellt auch selbst „ein körperliches und seelisches Wrack dar.“ (vgl. Bäuerle 1996, 43, sowie Waibel 1992, 13 sowie Walter 1997, 16)
2.2. Stoffgebundene Abhängigkeit
Spricht man im Alltag von Sucht, so ist damit meist die Abhängigkeit von bestimmten Stoffen gemeint, wie von illegalen Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Wird von stoffgebundener Sucht gesprochen, konzentriert sich das begierdemäßige Verhalten des Süchtigen auf solche Suchtmittel. Nur diese stoffgebundenen Süchte werden vom Sozialgesetzbuch als Krankheit anerkannt. Die Finanzierung der Behandlung eines süchtigen Patienten durch einen Arzt oder Therapeuten kann von den Krankenkassen getragen werden (vgl. DHS 1995, 3).
Beispiele für stoffinduzierten Abhängigkeit sind: Sucht nach Alkohol, Nikotin, Heroin, Haschisch, Kokain, Medikamente und viele mehr.
2.3. Stoffungebundene Abhängigkeit
Abhängigkeiten, die nicht an Substanzen gebunden sind, sind als solche oft nicht zu erkennen. Doch auch dieses Suchtverhalten kann als Mittel dazu genutzt werden, ein Hochgefühl zu erreichen (vgl. DHS 1995, 3).
Grundsätzlich sind viele der Verhaltensweisen, von denen man abhängig werden kann, durchaus wichtig und von der Gesellschaft anerkannt (so beispielsweise Essen, Kaufen, Arbeiten). Nur in ihrer Übersteigerung werden sie zum Problem (vgl. Waibel 1992, 23). Denkt man an Spielsucht oder Esssucht (weitere: Arbeitssucht, Sexsucht, Kaufsucht etc.), so wird deutlich, dass es sich bei stoffungebundener Abhängigkeit um Verhaltensweisen handelt, die zwanghaft ausgeführt werden. Wie die stoffgebundene Sucht kann auch diese Form der Abhängigkeit dem Menschen seine natürliche Freiheit nehmen und somit zerstörerisch wirken.
Das Phänomen der nicht stoffgebundenen Abhängigkeit wurde in den 70er Jahren durch Untersuchungen geklärt: Der Körper produziert im Gehirn körpereigene Substanzen (Endorphin), die für gute Laune und positive Emotionen des Menschen sorgen (vgl. Gross 1991, 12). Ist ein Individuum von einer bestimmten Verhaltensweise abhängig, so ändert sich seine Befindlichkeit dadurch, dass übermäßig viele Endorphine ausgeschüttet werden. Der Mensch wird sich also nach der zwanghaften Handlung besser fühlen als vorher. Die Wiederholung des Verhaltens wird immer wieder eintreten um Unlustgefühle zu vermeiden.
2.4. Psychische Abhängigkeit
Die psychische Abhängigkeit betrifft in ihrer Ausprägung den Geist und wird daher auch als seelische Abhängigkeit bezeichnet.
Die psychische Abhängigkeit äußert sich durch eines der Hauptmerkmale von Sucht: das “Nicht-mehr-aufhören-können“, also der Zwang, einen Stoff immer wieder zu sich zu nehmen oder eine Verhaltensweise wiederholt auszuführen.
Der Zwang resultiert aus einem erlebten Hochgefühl und dem Wunsch, dieses noch einmal zu erleben. Eine bestimmte Verhaltensweise oder die Einnahme einer Droge soll dazu führen, einen veränderten Gefühls- oder Bewusstseinszustand herbeizuführen (vgl. Walter 1997, 13f.). Der Drang ist schwer bezwingbar und oft so maßlos, dass er erst durch das Beschaffen und das Zuführen der Droge befriedigt wird (vgl. DHS 1995, 4). Dieses Verlangen wird als eine grundlegende Voraussetzung für das Fortbestehen einer Sucht gesehen. (vgl. Solms/Steinbrecher 1975, in: ders., S. I/10.
Das intensive Erlebnis, das der Betroffene wiederholen möchte, ist meistens ein Rausch. Genauso kann es sich aber auch ergeben, dass eine bestimmte Räumlichkeit oder Situation die psychische Abhängigkeit hervorruft. Spielcasinos oder der Treffpunkt der Drogenszene sind solche Örtlichkeiten, die den Betroffenen in den Drang versetzen, mit dem süchtigen Verhalten fortzufahren. (vgl. Bäuerle 1996, in: Knapp, 42)
Beispielhaft sei ein Abhängiger genannt, der nach seinem Empfinden den traurigen Alltag nur bewältigen kann, indem er in regelmäßigen Abständen zu der Droge greift, die ihm wieder zu einem Hochgefühl verhilft. Jedes Mal, wenn die Traurigkeit wieder Oberhand gewinnt, wird er zur Droge greifen. Ist sein Konsum an einen bestimmten Ort gebunden, so wird er, sobald er sich an diesem Ort befindet, das starke Verlangen haben, dem ritualisierten Suchtmittelkonsum nachzugeben.
Bei einer Therapie kann meistens nur die physische Abhängigkeit bekämpft werden, denn die psychische Abhängigkeit ist manifester in der Person des Konsumenten. (vgl. Bartsch/Knigge-Illner 1987, 15). Nach erfolgreicher Entziehungskur ist die psychische Abhängigkeit demnach der Hauptgrund für einen Rückfall in die Sucht.
Dr. Lorens von der freeclinic Heidelberg schilderte in einem Gespräch, dass die Rückfälle meistens daraus resultieren, dass die ehemals Süchtigen nach einem Entzug ihren „klaren Kopf“ nicht ertragen könnten. Sie sind mit der plötzlich “realen“, rauschfreien Welt überfordert. Auch dieses Phänomen ist ein Indiz für die psychische Abhängigkeit.
2.5. Physische Abhängigkeit
Führt ein Mensch seinem Körper wiederholt einen Stoff zu, so zum Beispiel eine Droge, dann wird der Körper diese Substanz allmählich in den Stoffwechsel einbauen. Der Körper reagiert auf den zugeführten Stoff und er passt sich ihm an. Man spricht daher auch von körperlicher Abhängigkeit. Die Reaktionen des Körpers können sehr unterschiedlich ausfallen.
Wenn die gewohnte Dosis verringert oder sogar ganz abgesetzt wird, können sogenannte Entzugserscheinungen auftreten. Diese zeigen sich vor allem bei der stoffgebundenen Abhängigkeit (Kap. I.2.2.). Das Wohlbefinden des Abhängigen wird erheblich beeinträchtigt. Der Körper zeigt somatische Reaktionen, wie Schweißausbruch, Fieber oder Erbrechen. Der “Normalzustand“ wird erst wieder erreicht, wenn die verlangte Dosis eingenommen wird. (vgl. Bäuerle 1996, in: Knapp, 42 sowie DHS 1995, 2)
Ein weiterer Gesichtspunkt für die physische Abhängigkeit ist die Toleranzentwicklung. Hiermit ist die Notwendigkeit gemeint, die Dosis des Suchtstoffes immer weiter zu erhöhen, mit dem Ziel, den gewohnten Rausch in gleicher Intensität erleben zu können. Der Körper gewöhnt sich an den Stoff, und der Abhängige muss ihm eine größerer Menge des Stoffes zuführen, um die gleiche Wirkung zu erreichen (vgl. Bäuerle 1996, in: Knapp, 42).
Nicht jede Droge führt zu einer körperlichen Abhängigkeit. Laut Halbach entsteht eine solche Abhängigkeit nur durch Stoffe, die lähmend auf das zentrale Nervensystem wirken. Stoffe, die anregend wirken, haben keine somatische Abhängigkeit zur Folge (vgl. Halbach 1975, in: Solms/Steinbrecher, I/29). Je schneller die Dosis erhöht wird, um so schneller wird auch die körperliche Abhängigkeit vorangetrieben.
3. Drogen
Der Begriff Droge entstammt dem Wort “drög“, was plattdeutsch “trocken“ bedeutet. Tatsächlich bezeichnete man lange Zeit getrocknete Pflanzenteile als Drogen, aus denen man Grundstoffe für die Arzneimittelherstellung isolierte. Auch heute werden viele Drogen noch als Heilmittel verwendet (vgl. Badry/Knapp 1996, in: Knapp, 18). Gerade Morphium spielt eine große Rolle bei der Schmerzbehandlung von Krebspatienten.
Bewußtseinsverändernde Stoffe sind so alt wie die Menschheitsgeschichte. Getränke wie Wein und Bier und ihre Wirkungen kannten schon die Menschen im Alten Ägypten. In Südamerika wußten die Indianer schon lange vor der spanischen Eroberung von der Wirkung der Cocapflanze (vgl. Jaffe et al. 1981, 79).
Spricht man im Alltag von Drogen, so meint man damit meistens die sogenannten illegalen Substanzen, wie Heroin, Kokain oder Haschisch, während man nicht an Alkohol, Medikamente oder Tabak denkt. Jedoch sind diese Stoffe ebenso zu den Drogen zu zählen und ihr Missbrauch ist in der Bundesrepublik Deutschland viel verbreiteter als der Missbrauch von Heroin oder Kokain (vgl. Pott 1994, in: DHS (b), 38).
Es gibt verschiedene Ansätze den Drogenbegriff zu erklären.
Oft wird zwischen harten und weichen Drogen unterschieden. Hierbei wird das Abhängigkeitspotential berücksichtigt, wie schnell also die Einnahme eines Stoffes abhängig macht. Auch die Stärke der psychotropen Wirkung (Wirkung auf die Psyche) eines Stoffes beeinflusst diese Einteilung. Außerdem werden gesundheitliche, politische, kulturelle und wirtschaftliche Aspekte in diese Kategorisierung eingeschlossen. Demnach können Suchtmittel, die hier als “weich“ bezeichnet werden, in anderen Kulturkreisen in die Kategorie “harte“ Drogen eingeordnet werden (vgl. Ulrich 2000, in: ders., 42).
Aus medizinischer Sicht sind Drogen Substanzen, die eine psychische Veränderung bei dem Konsumenten zur Folge haben. Solche Stoffe können sowohl pflanzlichen, als auch chemisch - synthetischen Ursprungs sein (vgl. Petermann 1997, in: Petermann et al., 15). Sie werden eingeatmet, gespritzt, geraucht, geschluckt oder getrunken.
Juristisch stützt sich die Definition des Drogenbegriffs auf das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), welches 1972 das seit 1929 geltende Opiumgesetz ablöste.
In den Anlagen des Gesetzes über den “Verkehr mit Betäubungsmitteln“ vom 1.März 1994 sind die einzelnen Betäubungsmittel aufgelistet. Anlage I zählt die Stoffe auf, die in Deutschland nicht existieren dürfen. Ausgenommen von dieser Vorschrift ist die Polizei und die Forschung. In Anlage II werden die Stoffe genannt, die verkehrsfähig, aber nicht verschreibungsfähig sind. Das heißt, sie dürfen nur in ihren Rohstoffen von der Pharmaindustrie verwendet werden. Substanzen, die aus therapeutischen Gründen verschrieben werden dürfen, sind die verkehrs- und verschreibungsfähigen Substanzen. Man findet sie in der Anlage III des BtMGs (vgl. BtMG, 1994, sowie Anlagen I-III des BtMG vom 19.6.2001). Die Einteilung in illegale und legale Stoffe läßt die verschiedenen Wirkungsweisen der Substanzen und die damit verbundenen Gefahren für den Konsumenten außer Acht, was von vielen Fachleuten kritisiert wird.
Eine weitere Möglichkeit der Einteilung orientiert sich an der Wirkung auf den Konsumenten. Dies ist eine psychologisch orientierte Kategorisierung.
Außerdem existiert eine Definition nach pharmakologischen Gesichtspunkten, die die Zusammensetzung und die Inhalte von Suchtmitteln analysiert (vgl. Badry/Knapp 1996, in: Knapp, 18).
Die Weltgesundheitsorganisation definiert den sogenannten erweiterten Drogenbegriff. Dieser schließt alle Stoffe ein, die im lebenden Organismus Funktionen verändern können. Hierzu zählen demnach auch Stoffe, die im Alltag fast jeder Mensch zu sich nimmt, wie Kaffee, Tee oder Medikamente.
Die genannten Definitionen befassen sich mit der stoffgebundenen Sucht und vernachlässigen die stoffungebundenen Süchte (vgl. Israel/Priebe 1996, in: Knapp, 182). Eine Erweiterung der Definitionen in Bezug auf diesen Aspekt ist aus Gründen der Vollständigkeit nötig.
Zusammenfassend lassen sich folgende Wirkungsweisen von psychoaktiven Drogen aufreihen:
- schmerzlindernd, sie verhindern unerwünschte Zustände, wie z.B. Schlaflosigkeit, Nervosität oder Angst
- aktivitätssteigernd, sie reduzieren Trägheit und Depression
- wahrnehmungsverändernd, der Konsument hat ein verschobenes Bild von der Realität und seinem sozialen Umfeld und unterschiedliche Ebenen von Rausch-, Heiterkeits-, Schwindelgefühlen werden bewirkt
(vgl. Nowlis (1979), nach Badry/Knapp (1996), in: Knapp, S. 18)
Entstehung von Sucht 15
II. URSACHEN FÜR DIE ENTSTEHUNG EINER SUCHT BEI JUGENDLICHEN
1. Entstehung von Sucht
Zur Entstehung von Sucht gibt es verschiedene Theorien. Diese Ansätze lassen sich nicht ganz von einander trennen, sondern überschneiden bzw. ergänzen sich.
Laut DHS und anderen Autoren hat Sucht nie eine einzige Ursache, sondern entsteht aus einem komplexen Ursachengeflecht. Man spricht daher von einer multifaktoriellen Genese (Kap. II.1.1.) (vgl. DHS 1993, 4).
In diesem Teil der Arbeit sollen die wichtigsten Theorien zur Suchtgenese beschrieben werden. Diese sind in Bezug auf das Thema dieser Arbeit von großer Bedeutung, denn anhand der Ursachen lassen sich sinnvolle Konzepte für präventives Handeln entwickeln. Optimale Prävention ist schwierig, da es keine eindeutige Regel zur Entstehung der Sucht gibt. Sinnvolle Suchtprävention muss versuchen, schwerpunktmäßig auf die Hauptursachen von Abhängigkeit Rücksicht zu nehmen.
Bei den Modellen zur Entstehung von Sucht handelt es sich meist um multikausale Erklärungen, die der Komplexität des Abhängigkeitsproblems Rechnung zu tragen versuchen.
1.1. Multifaktorielle Suchtgenese
Dieser Ansatz zur Erklärung der Entstehung von Sucht geht davon aus, dass einem süchtigen Verhalten immer ein Geflecht aus Ursachen zugrunde liegt.
Verschiedene Faktoren begünstigen und bedingen sich, so dass es zu einer Abhängigkeit von Suchtmitteln kommt (vgl. Meyenberg et al. 1993, 59). Dies muss dabei so verstanden werden, dass einzelne Theorien,
Multifaktorielle Suchtgenese 16
die in der Forschung und Wissenschaft bestehen, miteinander verbunden werden.
Die Schwerpunkte, die in der Entstehung der Sucht zu sehen sind, benennt die multifaktorielle Theorie wie folgt:
- Persönlichkeit
- gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
- soziale Nahraum
- Droge
Die Persönlichkeit wird von der Psychoanalyse, der Persönlichkeitspsychologie und dem biologischen Forschungsstand in Betracht genommen.
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten einer Person. Dabei werden verschiedene Eigenschaften dieser Gesellschaft aufgezählt. Der soziale Nahraum bezieht die Familie des Suchtkranken, sowie die Peer-Groups und die Schule mit ein. Die Familie prägt in zweierlei Hinsicht: einerseits werden die Kinder von ihren Eltern erzogen, sie vermitteln ihnen Werte und Normen, andererseits fungieren Vater und Mutter auch als Vorbilder, die mit eigenem unverantwortlichem Umgang mit Drogen ihre Kinder beeinflussen können (Kap. II.4.2.) (vgl. ebd., 67f).
Der Faktor Droge wird durch die Art, Verfügbarkeit, Dosis, Wirkung und die Einnahmedauer bestimmt (vgl. Wöbke 1975, 78) .
1.2. Das Ursachendreieck
Das sogenannte “Kielholz´sche Dreieck“ stellt die Hintergründe für süchtiges Verhalten dar.
Die einzelnen Faktoren werden zwar getrennt dargestellt, doch stehen sie untereinander in Beziehung und bewirken oder verstärken sich. Ein multikausaler Zusammenhang ist mithin erkennbar.
Das Ursachendreieck 17
Jeder Einzelne verhält sich anders, hat einen anderen Hintergrund und ist unterschiedlich zur Gesellschaft gestellt (Waibel 1992, 29).
Zum Faktor Persönlichkeit zählen vor allem biologische, persönlichkeits-, entwicklungspsychologische und lerntheoretische Aspekte. Die Dimension Umwelt wird durch soziologische und sozialisationstheoretische Aspekte charakterisiert. Die Neurobiologie des Individuums beeinflusst die Wirkung der Drogen auf den Konsumenten.
Je nach Individuum und Sucht ist das Gewicht einer der drei Ecken unterschiedlich. (vgl. Petermann, in: Petermann et al., 25).
Die einzelnen Aspekte zur Entstehung von Sucht werden im folgenden Teil der Arbeit näher erläutert. Dabei werden vor allem die Faktoren in den Mittelpunkt der Arbeit gestellt, die Kinder und Jugendliche betreffen. Selbstverständlich können einzelne Ursachen auch auf andere Altersstufen übertragen werden.
Die aufgezählten Risikofaktoren stellen zugleich Schutzfaktoren dar. Wenn somit alle Faktoren als optimal anzusehen sind, so ist das Risiko einer Sucht sehr gering. Es hängt von der Ausprägung der einzelnen Faktoren ab, ob sie Schutz oder Risiko für ein Individuum bedeuten.
2. Personale Risikofaktoren für Drogensucht
2.1. Genetisch - biologische Risikofaktoren
Bestimmte Menschen sind süchtig oder suchtgefährdet, wohingegen andere dies nicht sind. Jeder Körper reagiert anders auf Einnahme von Suchtstoffen. Wie ein Körper auf eine suchterzeugende Substanz reagiert, hängt unter anderem von individuellen Prozessen im Zentralen Nervensystem ab, die wiederum genetisch bedingt sind (vgl. Bäuerle 1996 (b), in: Knapp, 51).
Untersuchungen mit eineiigen Zwillingen und Adoptivkindern zeigen, dass eine gewisse Disposition zu süchtigem Verhalten vererbbar ist. Doch zu dieser Disposition müssen bestimmte Umweltfaktoren hinzukommen oder der Betroffene muss übermäßig einen Stoff zu sich nehmen, um eine Sucht auszulösen. Bis heute ist nicht nachgewiesen worden, dass sogenannte “Suchtgene“ existieren (vgl. Topel 1991, 12). Kinder, die von alkoholkranken Eltern sehr früh zur Adoption frei gegeben wurden und bei nicht süchtigen Pflegeeltern aufwachsen, zeigen im Vergleich zu Kindern aus Elternhäusern ohne Suchtverhalten eine größere Wahrscheinlichkeit selbst süchtig zu werden. Interessant ist, dass diese Erkenntnis vor allem für Kinder männlichen Geschlechts gilt, weniger für die des weiblichen Geschlechts (Schmidt 1999, in: Freitag/Hurrelmann, 66).
Statistisch gesehen liegt die Wahrscheinlichkeit bei 25%, dass ein Kind aus einer Familie mit süchtigem Verhalten ebenfalls suchtkrank wird. Im gegensätzlichen Fall sind es nur 10% (vgl. Walter 1997, 17). Forschungen haben ergeben, dass diese Zahlen nicht nur lernpsychologisch zu erklären sind (Nachahmung), sondern dass es ebenso daran liegt, wie viele Endorphine im Hirn als Neurotransmitter tätig sind (siehe psychische Abhängigkeit). Liegt ein ausgewogenes Verhältnis von Emotionalität und Realität vor, so ist der Mensch weniger suchtgefährdet. Entsteht jedoch ein Defizit an körpereigenen Wirkstoffen, so ist die Gefahr groß, dass der Mensch versucht, die Emotionen durch Fremdeinwirkung in ein angenehmeren Stand zu bringen (Bäuerle 1996 (b), in: Knapp, 52).
2.2. Persönlichkeit
Süchtiges Verhalten kann durch die unterschiedlichsten Persönlichkeitsmerkmale begünstigt werden. Es gibt eine Reihe von Strukturen, die man an süchtigen Personen immer wieder feststellen kann.
Ein zentraler Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Unfähigkeit des Suchtgefährdeten banale Spannungen zu verarbeiten, da ihm eine Frustrationstoleranz fehlt. Ein auftretendes Unwohlsein möchte der Süchtige sofort lindern und greift zu einem Suchtmittel, um sich umgehend wieder besser zu fühlen. Weiter sehen Solms/Steinbrecher folgende Persönlichkeitsstrukturen bei Süchtigen im Vordergrund:
„emotionale Unreife und Belastungsunfähigkeit, geringe Affektkontrolle, ungeduldige Unausgeglichenheit, Verletzbarkeit, Stimmungslabilität,..., reduziertes Selbstvertrauen bei pessimistischer Grundeinstellung, autistisch-realitätsfremdes Wunschdenken ... mit der Tendenz zum Ausweichen in Tagträumereien oder in giftinduzierte Veränderungen der Befindlichkeit;... Anpassungsstörungen, Aggressionsgehemmtheit und mangelnde Durchsetzungsfähigkeit.“
(Solms/Steinbrecher 1975, in: ders., I/12)
Diese Liste von Persönlichkeitsmerkmalen zeigt, dass es sich im Grunde immer um Personen handelt, die in irgendeiner Weise geschwächt sind. Sie fühlen sich von der umgebenden Welt verlassen, erdrückt, und können gewisse Anforderungen nicht bestehen.
Waibel macht deutlich, dass es in der Grundeinstellung des Menschen liegen kann, ob eine Sucht entsteht. Sie sieht einen Unterschied in der grundsätzlichen Lebensführung und -einstellung. Jemand, der sich oft müde fühlt, der sich mit seiner Befindlichkeit ständig auseinandersetzt und sich nicht so annehmen kann, wie er ist, stellt einen schwachen Menschen dar, der Gefahr läuft, Drogen zu konsumieren (vgl. Waibel 1992, 29). Die individuelle physische und psychische Konstitution übt einen Einfluss auf die
Entwicklung der Persönlichkeit und die Lebenseinstellung eines Individuums aus und ist damit auch für den Konsum von Drogen entscheidend. Ein Jugendlicher, der immer wieder an seine körperlichen oder auch psychischen Grenzen stößt, wird gefährdeter sein, süchtig zu werden, denn mit dem Einnehmen von Drogen erreicht er Erleichterung.
Die frühe Kindheit ist für die Entstehung von Abhängigkeit von Bedeutung. Hier muss ein Urvertrauen zu den Familienangehörigen aufgebaut werden. Eine gestörte Beziehung zu den nächsten Angehörigen (fehlender Vater, vernachlässigende Mutter) kann zur Folge haben, dass der Betroffene auch ein gestörtes Verhältnis zur Gesellschaft und die ihn umgebenden Umwelt entwickelt. Ist dieses Urvertrauen nicht vorhanden, fühlt sich der Mensch sozial isoliert und es besteht die Gefahr, dass er sich in eine Sucht flieht.
Einen eindeutigen Einfluss auf die Genese von Sucht haben auch andere Persönlichkeitsfaktoren: ein ausgesprochenes Neugierverhalten, Abenteuerlust und Kommunikationsfähigkeit spielen laut Waibel eine entscheidende Rolle (vgl. ebd., 32).
Gerade die Pubertät gilt als eine bedeutende Phase der menschlichen Entwicklung für die Herausbildung süchtigen Verhaltens. Die Jugendlichen suchen nach Wegen, sich vom Elternhaus abzuspalten, und die Drogen bringen ihnen eine scheinbar andere Wirklichkeit und den erwünschten Abstand zu den Personen, die sie bisher geprägt und beeinflusst haben. Vielen Jugendlichen fällt es in diesem Lebensabschnitt schwer, Gefühle von Bestätigung und Selbstwert zu erleben. Sie empfinden eine Sinnleere, denn ihnen mangelt es an Perspektiven in ihrer Zukunftsplanung, und sie haben kaum noch überzeugende Vorbilder. Die Medien vermitteln eine Welt voller Abenteuer, doch der Alltag bietet diese nicht. Das Risiko einer Frustration ist gegeben und der Einstieg in eine Traumwelt geebnet (vgl. Hurrelmann 1997, in: Pro Jugend, 7ff). Diese kann durch den Konsum von psychotropen Stoffen erreicht werden.
Nach Stübing (vgl. ebd., 1984) spielen anlagebedingte oder erworbene Minderbegabung, sowie Psychopathien (erblich bedingtes abweichendes seelisch - geistiges Verhalten) eine Rolle. Menschen mit endogenen Psychosen können versuchen, sich mit Drogen selbst zu behandeln. Hierzu gehören auch die neurotischen Fehlentwicklungen, für die es typisch ist, dass das Individuum der Meinung ist, mit Drogen das wahre Ich zu entdecken. Ein weiterer Aspekt ist, dass der Süchtige versucht, Probleme mit Einnahme von Drogen zu lindern. Stübing nennt sie “Herunterspüler“. Diese Probleme liegen meist in der Familie oder der sozialen Umwelt der Person. Hiermit ist eine Verbindung zu den anderen Faktoren des Ursachendreiecks geschaffen. Stübing stimmt mit Hurrelmann überein, dass die Personen gefährdet sind, sich mit Drogen zu trösten, die keine Aufregung mehr erleben oder sich nicht mehr freuen können. Das Suchtmittel verhilft dann zu einer Bewusstseinserweiterung (vgl. Stübing 1984, 88f).
Jugendliche sind gefährdet, deren Persönlichkeit sich durch Probierfreudigkeit und Geltungsbedürfnis gegenüber Gleichaltrigen auszeichnet. Oft handelt es sich um Jugendliche, die das Leistungsdenken der Gesellschaft ablehnen und gegen dieses und andere Werte und Normen der Erwachsenen protestieren wollen. Depressionen und seelische Niedergeschlagenheit kommen als gefährdende Faktoren hinzu (vgl. Krüger 1989, 85).
Anders lässt sich das Geschilderte wie folgt ausdrücken: Fühlt sich ein Jugendlicher stark genug, das Leben zu meistern, so wird er weniger Stress empfinden. Belastende Situationen werden besser bewältigt und Widerstand gegen Druck von außen - sei es von Freunden, der Familie oder der Schule - ist vorhanden. Dieser Jugendliche ist auch standfest gegenüber dem Gebrauch von psychoaktiven Stoffen (vgl. Schmidt 1999, in: Freitag/Hurrelmann, 67).
3. Soziale Risikofaktoren für Drogensucht
3.1. Umwelt
Die Umwelt, sowohl das weitere Umfeld, als auch der soziale Nahraum von Jugendlichen, soll hier der Gesellschaft gleichgestellt sein. Sie beeinflusst unmittelbar den Sozialisationsprozess eines jeden Menschen. In Bezug auf Drogenkonsum spielt die Gesellschaft der Gestalt eine Rolle, in wiefern sie ein Suchtmittel akzeptiert oder auch fördert. So ist Alkoholkonsum ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der westlichen Welt. Kaum ein feierlicher Anlass ist vorstellbar, ohne dass mit Sekt angestoßen wird. Jugendliche wachsen also mit der Vorstellung auf, Alkohol sei ein fester Bestandteil des sozialen und erwachsenen Lebens.
Die soziale Schichtzugehörigkeit spielt eine große Rolle in Bezug auf Drogenkonsum. So ist laut Statistik die untere Schicht eher von Drogenmissbrauch betroffen, da ihre Mitglieder sich häufiger vor sozial ausweglos erscheinenden Situationen sehen als die der Mittel- und Oberschicht (vgl. Bohlen 1998, 77). Schmidt verweist lediglich auf den Zigarettenkonsum, der in den unteren Schichten deutlich verbreiteter ist als in gehobeneren. Doch gilt generell der Ansatz, dass Unterprivilegierung, ganz gleich auf welche Weise, ein Grund für abweichendes Verhalten sein kann (vgl. Schmidt 1999, in: Freitag/Hurrelmann, 70).
Ein weiterer Aspekt der gesellschaftlichen Verantwortung für Drogenkonsum ist die Verfügbarkeit der Suchtmittel. Die sogenannten legalen Drogen sind durch entsprechende Gesetze Jugendlichen vorenthalten, doch können Zigaretten, Alkohol und auch Medikamente mehr oder weniger leicht beschafft werden. Spricht man von legal und illegalen Drogen, so stützt sich diese Einteilung auf die gesellschaftliche Norm und Akzeptanz der Mittel.
Die meisten Menschen haben gelernt, verantwortlich mit diesen Suchtmitteln umzugehen. Doch ist auch zu beobachten, wie die Gesellschaft teilnahmslos den teilweise ruinösen Gebrauch von Drogen hinnimmt.
Die wirtschaftlichen Interessen sind in diesem Zusammenhang nicht zu vergessen. Auch wird hier bestimmt, in wieweit ein Suchtmittel verbreitet und anerkannt ist. In Deutschland sind Alkohol- und Zigarettenwerbeplakate fester Bestandteil eines Stadtbildes. Die Beeinflussungsversuche der Industrie und Werbebranche sind nicht zu übersehen. Gerade der labile Mensch wird dadurch angesprochen.
Die Erfahrung zeigt, dass Preissteigerungen, etwa durch Steuererhöhungen in der Tabakindustrie, Jugendliche von einem Konsum abhalten können, denn junge Menschen haben vielfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich teure Produkte zu leisten (vgl. Schmidt 1999, in: Freitag/Hurrelmann, 70). Denkt man jedoch an die Merkmale von Sucht, zu denen auch die Zwanghaftigkeit gehört, so kann eine Preiserhöhung nicht von solch großem Gewicht sein. Betroffen sind nur Einsteiger, die aufgrund der Kosten eventuell von einem weiteren Konsum absehen.
Von Bedeutung ist der Konkurrenz- und Leistungsdruck innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen. Die Individuen sind zunehmend auf sich selbst gestellt und der gesellschaftliche Zusammenhalt nimmt ab (vgl. Nöcker 1990, 67f). Bisherige Orientierungsmöglichkeiten, die die Gesellschaft einem Individuum lange Zeit geboten hat, lösen sich zunehmend auf, denn in einer verstärkt technologisierten Welt spielt der menschliche Zusammenhalt nur noch eine sekundäre Rolle. Diese Entwicklung bringt dem Menschen Einsamkeitsgefühle. Gleichzeitig bietet die Gesellschaft dem Menschen mehr Möglichkeiten als je zuvor, sich zu verwirklichen und das Leben selbstbestimmt zu führen. Manche Menschen sehen ihre Chancen durch diese größere Freiheit, andere werden von den vielen Möglichkeiten geradezu erschlagen. Der Drogenkonsum kann eine Methode sein, diese Überforderung zu kompensieren.
„In einer offenen Gesellschaft und mit der Befreiung aus vielen Zwängen wachsen die Chancen für den Einzelnen. Es öffnen sich ihm Möglichkeiten und Freiheiten wie nie zuvor, seine persönliche Selbstentfaltung zu suchen, seinen individuellen Weg zu gehen.
Anstelle der früher autoritären (politischen) Steuerungen sind aber andere, anonyme Machtmechanismen getreten. [...] Ein ICH-schwacher Mensch wird von keinem ‘Rahmen’ mehr gehalten, er wird faktisch fremdbestimmt von äußeren Kräften. Er bleibt orientierungslos im schwindelerregenden Angebot.“
(Fritschi (o.J.), zitiert nach Waibel 1992, 39)
Der Einfluss der Umwelt wirkt auf bestimmte Persönlichkeiten stärker als auf andere und positive oder negative Folgen haben. Dem Menschen ist es überlassen, was er aus seinem Leben macht. Ein Individuum, das nicht stark genug ist, dem Druck standzuhalten, läuft Gefahr, sich zu betäuben.
Die westliche Gesellschaft zeichnet sich heute durch Konsumorientierung und Materialismus aus. In Familien ist teils zu beobachten, dass Liebe und Zuneigung durch materielle Dinge ersetzt werden. Diese Bedürfnisbefriedigung ist schnelllebig und vordergründig. Dazu kommt, dass dem labilen Menschen die Werbung vorgaukelt, sein Glück und seinen Erfolg im Konsum zu finden. Dieser Konsum kann in gesundheitsschädliche Verhaltensmuster umschlagen. „Suchtverhalten ist Konsum in übersteigerter Form und von daher ein Zerrbild unserer Konsumideologie schlechthin.“ (Waibel 1992, 49)
3.2. Familie
Die Familie sorgt für ein Kind von Geburt an und übt sehr viel Einfluss aus. Sie ist der Ort der Förderung von Fähigkeiten und Kräften. Normen und Werte der Familie und der Gesellschaft werden von früh an dem Kind vermittelt. Hierzu gehört selbstverständlich auch das Gesundheitsverhalten (vgl. Badry/Knapp 1996, in: Knapp, 23).
Die wesentliche Rolle spielen dabei die Eltern durch die Erziehung und ihren Umgang mit dem Kind. Dabei ist auch die Geschwisterkonstellation von Bedeutung. Ein Kind, welches mit überdurchschnittlich vielen Geschwistern aufwächst, ist anderen Belastungen ausgesetzt, als ein Einzelkind, das oft im Mittelpunkt des Interesses der Eltern steht.
Grundsätzlich kann jeder extreme Erziehungsstil die Gefahr der Prädestinierung eines Kindes zum Drogenkonsum bedeuten. In Bezug auf die Gefahr einer Entwicklung von Suchtverhalten zeigen sich sowohl bei Schlüsselkindern als auch bei übertrieben versorgten und verwöhnten Kindern ähnliche Verhaltensmuster: Beide Gruppen haben nicht ausreichend gelernt, Konflikte im Alltag zu lösen. Sie werden nicht selbständig in ihren Emotionen und im sozialen Umfeld, so dass sie ihr auftretendes Mangelgefühl zu verdrängen versuchen, manchmal auch durch den Griff zur Droge (Hurrelmann 1994, in: DHS (b), 27). Kindern, denen jeder Wunsch erfüllt wird, sind schwerer zufrieden zu stellen und werden sich weniger an Regeln halten können. Wer nie durch Regelbruch an Grenzen gestoßen ist, wird anfälliger sein, Drogen zu probieren. Nur wenn Eltern deutlich “Nein“ sagen können, geben sie den Kindern eine Orientierung und die Möglichkeit zu lernen, dass nicht alles erlaubt ist. Ein weiteres Problem ist die Tendenz, Kinder immer früher als kleine Erwachsene zu behandeln. Sie sind mit den Anforderungen schnell überfordert und es besteht die Gefahr, dass sie vor der Verantwortung in den Suchtmittelkonsum flüchten.
Problematisch ist auch, wenn Kindern Normen und Werte vermittelt werden, die der Gesellschaftsstruktur und der Zeit nicht angemessen sind. Hier wird eine fehlerhafte Sozialisation begünstigt (vgl. Bohlen 1998, 80f.). Eine solche Fehlentwicklung könnte ausweichendes Verhalten zur Folge haben.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832463908
- ISBN (Paperback)
- 9783838663906
- DOI
- 10.3239/9783832463908
- Dateigröße
- 699 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Pädagogische Hochschule Heidelberg – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Februar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- drogen jugendliche abhängigkeit sucht vorbeugung
- Produktsicherheit
- Diplom.de