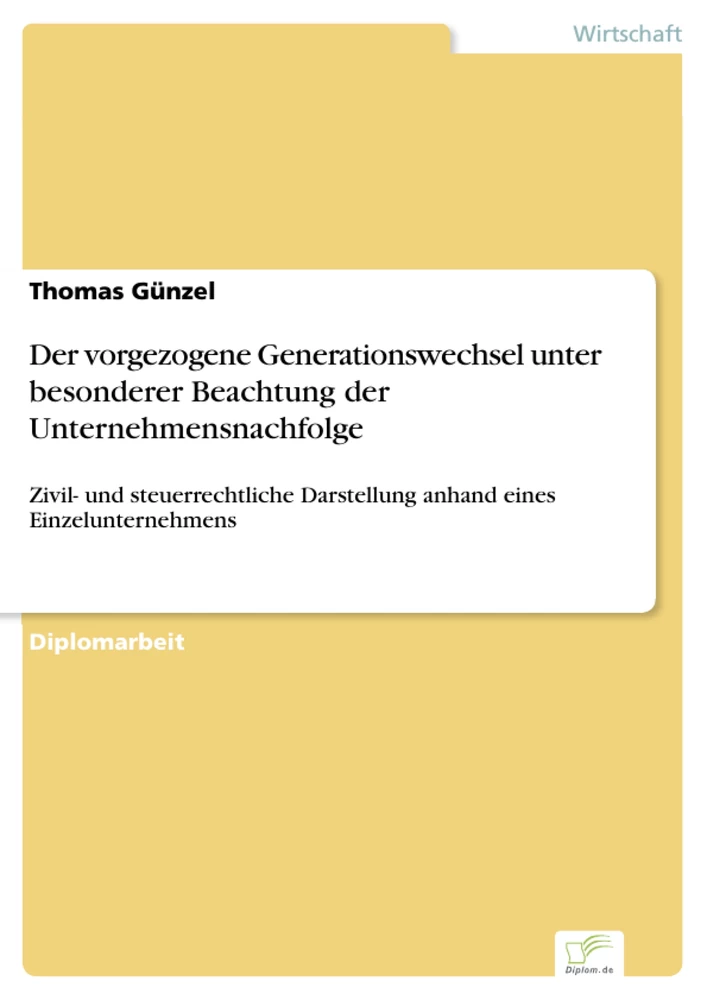Der vorgezogene Generationswechsel unter besonderer Beachtung der Unternehmensnachfolge
Zivil- und steuerrechtliche Darstellung anhand eines Einzelunternehmens
©2002
Diplomarbeit
135 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Planung ist die Grundlage für ein erfolgreiches Unternehmen. Insbesondere in der heutigen Zeit von verstärkt anstehenden Generationswechseln, vor allem im Mittelstand, gilt dies um so mehr für die Nachfolgeplanung. Denn die mangelnde Planung des Unternehmensübergangs kann zu Wachstumsverlusten oder schlimmstenfalls zur Liquidation des Betriebes führen.
Der Seniorchef kann nicht davon ausgehen, dass der Gesetzgeber alle notwendigen Vorkehrungen getroffen hat, damit die Übertragung des Unternehmens reibungslos vonstatten geht. Die gesetzliche Erbfolge des Bürgerlichen Gesetzbuches berücksichtigt nicht die Fähigkeit des Erben zur Unternehmensführung, steuerrechtliche Problemlagen und zukünftige Liquiditäts- und Kapitalbedürfnisse des Unternehmens. Das BGB begünstigt dagegen den Zerfall der Wirtschaftseinheit, da der Miterbe jederzeit die Auseinandersetzung verlangen kann. Daher empfehlen Berater die Entschärfung der Erbfolge durch die Übertragung von Vermögen bzw. Vermögensteilen noch vor dem Ableben. In der Regel versteht man darunter die Übergabe im Rahmen der sogenannten vorweggenommenen Erbfolge, die als Einleitung des vorgezogenen Generationswechsels gesehen werden kann.
Die Entscheidungen hierzu treffen in der Regel der Abgebende und der Nachfolger gemeinsam, die hierzu die richtigen und notwendigen Informationen benötigen. Insbesondere für die zivil- und steuerrechtliche Beurteilung sind die an der Nachfolge beteiligten Parteien in der Regel auf die Unterstützung von Experten angewiesen. An dieser Stelle setzt die Diplomarbeit an. Sie hat das Ziel, den Mitwirkenden die gesetzlichen Regelungen der vorweggenommenen Erbfolge aus zivil- und steuerrechtlicher Sicht im Zusammenhang darzustellen.
Da die meist verbreitete Rechtsform in Deutschland das Einzelunternehmen ist, behandelt die Darstellung ein entsprechendes praxisorientiertes Fallbeispiel. Vor diesem Hintergrund wird zunächst das Einzelunternehmen vorgestellt. Daran schließt sich die zivilrechtliche Darstellung an, die als Ausgangspunkt für die steuerrechtliche Betrachtung dient. Die Einkommen- und Erbschaftsteuerauswirkungen bilden die beiden steuerrechtlichen Schwerpunkte. Darüber hinaus wird auf die Umsatz-, Gewerbe- und Grunderwerbsteuer eingegangen, dessen Auswirkungen nicht zu unterschätzen sind, speziell wenn von der Übertragung eine wesentliche Betriebsgrundlage, z.B. das Betriebsgrundstück, ausgenommen ist.
Der umfassende Anhang enthält […]
Planung ist die Grundlage für ein erfolgreiches Unternehmen. Insbesondere in der heutigen Zeit von verstärkt anstehenden Generationswechseln, vor allem im Mittelstand, gilt dies um so mehr für die Nachfolgeplanung. Denn die mangelnde Planung des Unternehmensübergangs kann zu Wachstumsverlusten oder schlimmstenfalls zur Liquidation des Betriebes führen.
Der Seniorchef kann nicht davon ausgehen, dass der Gesetzgeber alle notwendigen Vorkehrungen getroffen hat, damit die Übertragung des Unternehmens reibungslos vonstatten geht. Die gesetzliche Erbfolge des Bürgerlichen Gesetzbuches berücksichtigt nicht die Fähigkeit des Erben zur Unternehmensführung, steuerrechtliche Problemlagen und zukünftige Liquiditäts- und Kapitalbedürfnisse des Unternehmens. Das BGB begünstigt dagegen den Zerfall der Wirtschaftseinheit, da der Miterbe jederzeit die Auseinandersetzung verlangen kann. Daher empfehlen Berater die Entschärfung der Erbfolge durch die Übertragung von Vermögen bzw. Vermögensteilen noch vor dem Ableben. In der Regel versteht man darunter die Übergabe im Rahmen der sogenannten vorweggenommenen Erbfolge, die als Einleitung des vorgezogenen Generationswechsels gesehen werden kann.
Die Entscheidungen hierzu treffen in der Regel der Abgebende und der Nachfolger gemeinsam, die hierzu die richtigen und notwendigen Informationen benötigen. Insbesondere für die zivil- und steuerrechtliche Beurteilung sind die an der Nachfolge beteiligten Parteien in der Regel auf die Unterstützung von Experten angewiesen. An dieser Stelle setzt die Diplomarbeit an. Sie hat das Ziel, den Mitwirkenden die gesetzlichen Regelungen der vorweggenommenen Erbfolge aus zivil- und steuerrechtlicher Sicht im Zusammenhang darzustellen.
Da die meist verbreitete Rechtsform in Deutschland das Einzelunternehmen ist, behandelt die Darstellung ein entsprechendes praxisorientiertes Fallbeispiel. Vor diesem Hintergrund wird zunächst das Einzelunternehmen vorgestellt. Daran schließt sich die zivilrechtliche Darstellung an, die als Ausgangspunkt für die steuerrechtliche Betrachtung dient. Die Einkommen- und Erbschaftsteuerauswirkungen bilden die beiden steuerrechtlichen Schwerpunkte. Darüber hinaus wird auf die Umsatz-, Gewerbe- und Grunderwerbsteuer eingegangen, dessen Auswirkungen nicht zu unterschätzen sind, speziell wenn von der Übertragung eine wesentliche Betriebsgrundlage, z.B. das Betriebsgrundstück, ausgenommen ist.
Der umfassende Anhang enthält […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6181
Günzel, Thomas: Der vorgezogene Generationswechsel unter besonderer Beachtung der
Unternehmensnachfolge - Zivil- und steuerrechtliche Darstellung anhand eines
Einzelunternehmens
Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Lüneburg, Fachhochschule, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
II
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS... II
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS... V
1 PROBLEMSTELLUNG ... 1
2 VORSTELLUNG DES EINZELUNTERNEHMENS ... 4
2.1 Voraussetzungen für die Untersuchung... 4
2.1.1 Betriebliche
Vorgaben... 4
2.1.2 Persönliche Vorgaben des Firmeninhabers ... 5
2.2 Gestaltungsmöglichkeiten unter Beachtung der Vorgaben ... 7
2.3 Vor- und Nachteile der Gestaltungsüberlegungen... 8
3 ZIVILRECHTLICHE DARSTELLUNG ... 11
3.1 Grundsätzliche Überlegungen... 11
3.2 Zivilrechtliche Begriffsbestimmung der vorweggenommenen Erfolge... 13
3.3 Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten ... 14
3.3.1 Gemischte
Schenkung ... 14
3.3.2 Schenkung unter Auflage ... 16
3.3.2.1 Begriff und Abgrenzung zur gemischten Schenkung ... 16
3.3.2.2 Beispiele für Auflagenschenkungen... 17
3.3.3 Absicherungsmöglichkeiten der Leistungen ... 19
3.3.4 Rückforderungsrechte... 20
3.3.4.1 Ansprüche aus dem Gesetz ... 21
3.3.4.2 Ansprüche aus dem Vertrag ... 22
3.4 Zivilrechtliche Umsetzungen im Praxisbeispiel... 23
Inhaltsverzeichnis
III
4 STEUERRECHTLICHE DARSTELLUNG... 26
4.1 Steuerrechtliche Begriffsbestimmung der vorweggenommenen Erbfolge ... 26
4.2 Ertragsteuerliche Beurteilung... 27
4.2.1 Grundsätzliche
Überlegungen ... 27
4.2.2 Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb ... 28
4.2.2.1 Voraussetzungen ... 29
4.2.2.2 Bestimmung der gewerblichen Einkünfte ... 34
4.2.3 Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ... 37
4.2.4 Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung... 39
4.2.5 Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen... 43
4.2.6 Ermittlung der sonstigen Einkünfte... 45
4.2.6.1 Voraussetzungen und Besteuerung als dauernde Last oder Leibrente... 45
4.2.6.2 Abgrenzung zu Unterhaltsleistungen ... 51
4.2.6.3 Umsetzung im Praxisbeispiel ... 52
4.2.7 Bestimmung der Einkommensteuerbelastung im Praxisbeispiel... 53
4.2.7.1 Besteuerungsmöglichkeiten des Aufgabegewinns ... 53
4.2.7.2 Besteuerung der anderen Einkünfte ... 55
4.2.7.3 Ermittlung der Steuerbelastung... 56
4.2.8 Berücksichtigung der Aufwendungen beim Nachfolger ... 58
4.2.8.1 Bilanzielle Behandlung ... 58
4.2.8.2 Ertragsteuerliche Behandlung ... 59
4.2.9 Auswirkungen von Rückfallklauseln... 62
4.3 Schenkungssteuerliche Beurteilung... 63
4.3.1 Grundsätzliche
Überlegungen ... 63
4.3.2 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Besteuerung ... 64
4.3.3 Steuerbefreiungsnormen im Schenkungssteuerrecht... 66
4.3.3.1 Sachliche Steuerbefreiung... 67
4.3.3.2 Persönliche Freibeträge ... 70
4.3.4 Ermittlung der Schenkungssteuer im Praxisbeispiel ... 71
4.3.5 Behandlung bei Rückfall an den Übergeber... 74
Inhaltsverzeichnis
IV
4.4 Auswirkungen auf sonstige Steuerarten ... 75
4.4.1 Umsatzsteuer ... 75
4.4.1.1 Überblick über die aktuelle Rechtslage... 75
4.4.1.2 Übertragung der Vorschriften auf den Praxisfall ... 78
4.4.2 Gewerbesteuer ... 79
4.4.3 Grunderwerbsteuer ... 80
5 SCHLUSSBEMERKUNG ... 82
ANHANG ... 84
LITERATURVERZEICHNIS ... 116
QUELLENVERZEICHNIS ... 121
URTEILSREGISTER... 123
VERWALTUNGSANWEISUNGEN ... 126
Abkürzungsverzeichnis
V
Abkürzungsverzeichnis
a.A.
andere
Auffassung
AO
Abgabenordung
BB
Betriebsberater
(Zeitschrift)
Bearb.
Bearbeiter
Begr.
Begründer
BewG
Bewertungsgesetz
BFH
Bundesfinanzhof
BFH/NV
Sammlung amtlich nicht veröffentlichter
Entscheidungen
des
Bundesfinanzhofes
(Zeitschrift)
BGH
Bundesgerichtshof
BMF
Bundesminister
der
Finanzen
BVerfG Bundesverfassungsgericht
DB
Der
Betrieb
(Zeitschrift)
DStR
Deutsches
Steuerrecht
(Zeitschrift)
EBT
earning bevor taxes (engl.: Gewinn vor Steuern)
EFG
Entscheidungen der Finanzgerichte (Zeitschrift)
ErbStG
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
EStDV
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
EStG
Einkommensteuergesetz
EStR
Einkommensteuerrichtlinien
FlSt.Nr. Flurstücknummer
FG
Finanzgericht
FR
Finanz-Rundschau
(Zeitschrift)
GmbHR GmbH-Rundschau
(Zeitschrift)
GrS
Großer
Senat
H.
Hinweise
i.V.m.
in
Verbindung
mit
IDW
Institut
der
Wirtschaftsprüfer
IfM
Institut
für
Mittelstandsforschung
KÖSDI
Kölner Steuerdialog (Zeitschrift)
LEXinform
DATEV-Steuerrechtsdatenbank
Abkürzungsverzeichnis
VI
m.w.N. mit
weiteren
Nennungen
NJW
Neue
Juristische
Wochenschrift
nrkr.
nicht
rechtskräftig
NWB
Neue
Wirtschafts-Briefe
(Zeitschrift)
OFD
Oberfinanzdirektion
o.V.
ohne
Verfasser
RGBl.
Reichsgesetzblatt
S.
Seite, Satz
StandOG Standortsicherungsgesetz
StBerG Steuerberatungsgesetz
Stbg
Die
Steuerberatung
(Zeitschrift)
StEuglG. Steuer-Euroglättungsgesetz
SteuerStud
Steuer und Studium (Zeitschrift)
Tz.
Textziffer
UStG
Umsatzsteuergesetz
UStR
Umsatzsteuerrichtlinien
ZEV
Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
Problemstellung
1
1 Problemstellung
Planung ist die Grundlage für ein erfolgreiches Unternehmen. Da dies den Firmeninhabern
bewusst ist, findet sich in den Unternehmen eine mehr oder weniger detaillierte Investitions-,
Absatz- und Finanzierungsplanung.
Die Nachfolgeplanung wird dagegen oft vernachlässigt und lässt daher häufig zu wünschen
übrig.
1
Die Gründe hierfür sind ganz unterschiedlich. Sie können sich sowohl auf Seiten des
Eigentümers befinden, als auch in dem Problem bestehen, den ,,richtigen" Nachfolger zu
finden. Die meisten Firmeninhaber wünschen sich die familieninterne Nachfolge,
2
bei der das
Unternehmen von der älteren an die jüngere Generation übergeben wird. Die Übergabe kann
jedoch aufgrund von Anforderungen an die nachfolgende Generation scheitern, die sowohl
willens als auch fachlich und persönlich hinreichend qualifiziert sein muss.
Die unzureichende Vorbereitung des Generationswechsels und die mangelnde Planung des
Unternehmensübergangs können zu Wachstumsverlusten oder schlimmstenfalls zur
Liquidation des mittelständischen Betriebes führen. Die Versäumnisse in der
Nachfolgeplanung und -gestaltung gefährden das Unternehmen und stellen damit ebenfalls
eine Gefahr für die Arbeitsplätze dar.
Diese Probleme hat auch die Öffentlichkeit erkannt und beschäftigt sie bereits seit mehreren
Jahren. Neben Kammern und Verbänden stehen als Berater auch Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zur Verfügung, die die Unternehmensnachfolge als neues
Geschäftsfeld nutzen. Daneben existieren auch Kooperationsverbände
3
, insbesondere im
Zusammenhang mit Banken und Sparkassen. Auch der Bundesminister für Wirtschaft und
Technologie startete im Frühjahr 2001 eine Imagekampagne zur Unternehmensnachfolge.
Gemeinsam mit Vertretern von Verbänden und Institutionen der Wirtschaft stellt der
Bundesminister die Veranstaltungen und Beiträge unter das gemeinsame Logo ,,nexxt
Initiative Unternehmensnachfolge".
4
1
Vgl. Albach, H., Nachfolgeregelung, 2000, S. 782.
2
Vgl. Institut für Mittelstandsforschung, Unternehmensnachfolge, S. 18.
3
Vgl. zum Beispiel der Kooperationsverbund ,,Unternehmensübergaben" des Verbandes beratender Ingenieure,
nebst Hinweisen auf einschlägige Unternehmensbörsen unter:
http://www.vbi.de/verband/Kontaktboerse/Unternehmensuebergaben.htm; vom 02.12.2001;
4
Vgl. www.nexxt-initiative.de/index.aspx; vom 05.01.2002.
Problemstellung
2
Der Seniorchef kann nicht davon ausgehen, dass der Gesetzgeber alle notwendigen
Vorkehrungen getroffen hat, damit die Übertragung des Unternehmens reibungslos vonstatten
geht. Die gesetzliche Erbfolge des Bürgerlichen Gesetzbuches
5
berücksichtigt nicht die
Fähigkeit des Erben zur Unternehmensführung, steuerrechtliche Problemlagen und
zukünftige Liquiditäts- und Kapitalbedürfnisse des Unternehmens. Das BGB begünstigt
dagegen den Zerfall der Wirtschaftseinheit, da der Miterbe jederzeit die Auseinandersetzung
verlangen kann.
6
Für den Erblasser besteht nur begrenzt die Möglichkeit, die
Auseinandersetzung auszuschließen.
7
Daher ist die Fortführung des Unternehmens durch eine
Erbengemeinschaft aus meiner Sicht nicht empfehlenswert.
Es besteht die Chance, die Erbfolge zu Lebzeiten durch ein Unternehmertestament zu regeln.
Es bleibt aber die Unsicherheit, ob der begünstigte Nachfolger das Erbe auch annehmen
wird.
8
Daher empfehlen Berater die ,,Entschärfung" der Erbfolge durch die Übertragung von
Vermögen bzw. Vermögensteilen noch vor dem Ableben. In der Regel versteht man darunter
die Übergabe im Rahmen der sogenannten vorweggenommenen Erbfolge
9
, die als Einleitung
des vorgezogenen Generationswechsels gesehen werden kann.
Auch wenn es für die Unternehmensnachfolge keine allgemein gültige Lösung gibt,
10
kann sie
in verschiedene Phasen eingeteilt werden,
11
die von unterschiedlichen Gesichtspunkten
geprägt sind.
12
Die erste Phase behandelt die Frage, in welcher Form eine Verbindung
zwischen dem Unternehmen und dem potentiellen Nachfolger hergestellt werden soll. Des
weiteren beinhaltet sie unter anderem die menschlichen und unternehmerischen Perspektiven,
sowie die Entscheidung über die Fortführung oder den Verkauf des Unternehmens. Die
zweite Phase betrifft den Vollzug der Unternehmensnachfolge im engeren Sinn und schließt
neben den zivil- und steuerrechtlichen Bestandteilen, auch die Versicherungs- und
Finanzierungsfragen mit ein. Die letzte Phase berührt die Gestaltung der
Organisationsstruktur für die Zeit nach dem Generationswechsel.
5
Vgl. Fünftes Buch des BGB, Erbrecht.
6
Siehe § 2042 Abs. 1 BGB.
7
Siehe § 2044 BGB.
8
So besteht die Möglichkeit des Erben, die Erbschaft auszuschlagen; siehe §§ 1942-1966 BGB.
9
Zur Begriffsbestimmung: vgl. Kapitel 3.2.
10
Vgl. ebenso Weinläder, H., Unternehmensnachfolge, 1998, S. 13.
11
Vgl. Reichert, J., Unternehmensnachfolge, 1998, S. 257.
12
Vgl. Weinläder, H., Unternehmensnachfolge, 1998, S.14.
Problemstellung
3
Die erste Phase ist für das zu betrachtende Einzelunternehmen abgeschlossen. Die
Entscheidung, das Unternehmen auf den älteren Sohn des bisherigen Inhabers zu übertragen,
erfolgte bereits. Die anschließenden zivil- und steuerrechtlichen Gesichtspunkte, ebenso wie
die Fragen der Versicherung und Finanzierung, als auch die der dritten und letzten Phase,
wurden bisher noch nicht betrachtet.
Da alle Phasen einen gewissen Sachverstand voraussetzen, benötigen die an der Nachfolge
beteiligten Parteien, insbesondere für den zivil- und steuerrechtlichen Abschnitt,
Unterstützung von Experten. Die Beteiligten sollten über diejenigen Informationen verfügen,
die aus Ihnen einen verständigen und sachkundigen Fragesteller machen.
13
Letztendlich muss
der Abgebende und der Nachfolger die Entscheidungen treffen. Hierzu benötigen sie die
richtigen und notwendigen Informationen.
An dieser Stelle wird die Diplomarbeit ansetzen. Sie hat das Ziel, den Mitwirkenden die
gesetzlichen Regelungen der vorweggenommenen Erbfolge aus zivil- und steuerrechtlicher
Sicht im Zusammenhang darzustellen. Die Dokumentation wird dabei speziell auf die
Vorgaben des Firmeninhabers und den Voraussetzungen des Unternehmens eingehen und
diese bei den Lösungsansätzen und deren rechtlichen Folgen berücksichtigen.
Vor diesem Hintergrund wird zunächst das Einzelunternehmen vorgestellt. Daran schließt
sich die zivilrechtliche Darstellung an, die als Ausgangspunkt für die steuerrechtliche
Betrachtung dient. Sie bildet den Schwerpunkt der Diplomarbeit. Ziel ist es herauszufinden,
mit welchen steuerlichen Belastungen die Beteiligten rechnen müssen.
Die im weiteren Verlauf der Unternehmensnachfolge zu klärenden Fragen zur Finanzierung
und Versicherung einschließlich der dritten Phase sollen bei dieser Untersuchung nicht bzw.
nur eingeschränkt betrachtet werden.
13
Vgl. Weinläder, H., Unternehmensnachfolge, 1998, S.18.
Vorstellung des Einzelunternehmens
4
2 Vorstellung des Einzelunternehmens
2.1 Voraussetzungen für die Untersuchung
2.1.1 Betriebliche Vorgaben
Das Einzelunternehmen wird als Sanitär- und Heizungsbetrieb geführt und erfüllt die
Voraussetzungen des Handwerksbetriebs im Sinne der Handwerksordnung
14
. Der Firmensitz
befindet sich im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Das Unternehmen wird auf einem gemischtgenutzten Grundstück betrieben, das sowohl der
betrieblichen als auch der privaten Nutzung dient. Auf diesem befindet sich das private
Wohnhaus des Firmeninhabers, die gewerblich genutzten Werkstatt- und Lagergebäude und
die Stellplätze für die Firmen- und Kundenfahrzeuge. Die dem Unternehmen dienenden
Grundstücksflächen, einschließlich der Gebäude, sind als Betriebsvermögen aktiviert worden,
wobei eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile von untergeordneter Bedeutung nicht mit in
die Bilanz aufgenommen wurden.
15
Das Grundstück steht im gemeinschaftlichen Besitz des Firmeninhabers und dessen Ehefrau.
Die Grundstücksanteile, die im Eigentum der Ehegattin stehen, sind dem Betriebsinhaber
unentgeltlich und unbefristet zur Nutzung überlassen. Die Betriebsgebäude wurden vom
Unternehmer mit Zustimmung seiner Ehefrau auf eigene Kosten errichtet.
Das Grundstück ist unbelastet. Zur Besicherung von Krediten wurden die finanzierten
Wirtschaftsgüter sicherungsübereignet.
16
Bei den in der Bilanz
17
ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich
um die fortgeführten Anschaffungskosten für Software, zum Beispiel für spezielle
Handwerker-, Buchhaltungs- und Bürokommunikationsprogramme.
14
Siehe § 1 Abs. 2 HandwO: ,,Ein Gewerbebetrieb ist Handwerksbetrieb im Sinne der HandwO, wenn er
handwerksmäßig betrieben wird und ein Gewerbe vollständig umfasst, das in der Anlage A zur HandwO
aufgeführt ist."
15
Siehe § 8 EStDV.
16
Steuerrechtlich sind die sicherungsübereigneten Wirtschaftsgüter dem Sicherungsgeber zuzurechnen;
siehe § 39 Abs. 2 Satz 2 AO.
17
Vgl. im Anhang: 2. Schlussbilanz zum 15.01.2002, a) bewertet zu Buchwerten.
Vorstellung des Einzelunternehmens
5
Unter den Bilanzpositionen ,,technische Anlagen und Maschinen" und ,,andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung" befinden sich die sonstigen betrieblichen Gegenstände,
wie z.B. Werkzeuge, Spezialmaschinen und Firmenfahrzeuge.
Die im Anlagevermögen unter Finanzanlagen aufgeführten Beteiligungen sind Anteile an
Einkaufsgenossenschaften, von denen der Unternehmer zum überwiegenden Teil seine Waren
bezieht. Für den Firmeninhaber besteht dadurch die Möglichkeit, die Materialien zu
günstigeren Konditionen zu beziehen. Durch diesen objektiven Zusammenhang zum Betrieb
stellen die Anteile gewillkürtes Betriebsvermögen dar, das in der Bilanz ausgewiesen werden
kann.
18
Der Sonderposten mit Rücklageanteil
19
wurde für die künftige Anschaffung von neuen
Maschinen und Firmenfahrzeugen gebildet.
20
Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen für
abgenutzte Wirtschaftsgüter, die im ersten Halbjahr des Jahres 2003 in Höhe von
100.000 Euro geplant sind.
21
Davon wurden 40 Prozent in den Sonderposten eingestellt.
22
2.1.2 Persönliche Vorgaben des Firmeninhabers
Der Unternehmer möchte nach seinem 60. Geburtstag seine gewerbliche Tätigkeit beenden
und sein Unternehmen an seinen ältesten Sohn übergeben. Sein zweiter Sohn steht als
Nachfolger aufgrund seiner zukünftigen beruflichen Tätigkeit als Steuerberater nicht zur
Verfügung.
23
Die Unternehmensstruktur und -organisation soll nach der Übertragung soweit wie möglich
erhalten bleiben.
Zu beachten sind weiterhin die Liquiditäts- und Steuerbelastungen für den Übernehmer und
Übergeber. Die Unterschätzung des Kapitalbedarfes zu Beginn der Existenzgründung
24
muss
vermieden werden. Unter dieser Vorgabe soll an den Übergeber sowohl ein einmaliger als
18
Siehe Abschnitt 13 Abs. 1 Satz 3 EStR.
19
Siehe § 247 Abs. 3 HGB.
20
Siehe § 7g Abs. 3 EStG.
21
Vgl. im Anhang: 9. c) Tilgungsplan zur Finanzierung von neuen Firmenfahrzeugen.
22
Siehe § 7g Abs. 3 Satz 2 EStG.
23
Siehe § 57 Abs. 4 StBerG; vgl. Gehre, H., unvereinbare Tätigkeiten, 1999, S. 232.
24
Vgl. Freiling, C. u.a., Nachfolgeplanung, 1999, S. 14.
Vorstellung des Einzelunternehmens
6
auch laufendende Beträge gezahlt werden. Der Bruder des Nachfolgers wird als Ersatz seiner
späteren Erbansprüche einen Ausgleich erhalten.
Aufgrund der fehlenden Zustimmung der Miteigentümerin und der Übertragung des
Unternehmens an nur einen Sohn soll das Grundstück im Rahmen der
Unternehmensnachfolge als einheitlicher Gegenstand erhalten bleiben. Eine Trennung der
zivilrechtlichen Inhaber erfolgt nicht. Daher werden die Gebäude und das Grundstück im
Besitz des bisherigen Firmeninhabers und dessen Ehegattin bleiben.
Der Übergeber erklärt sich bereit, nach der Übertragung dem Nachfolger in beratender
Funktion zur Verfügung zu stehen, wobei zu beachten ist, dass er für seine Tätigkeit keine
Haftung übernehmen will.
Der Firmeninhaber besitzt bis zum Vollzug der Unternehmensnachfolge die
Kaufmannseigenschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Grundsätzlich kommt jeder
Gewerbebetrieb als Handelsgewerbe in Betracht,
25
da Handwerksbetriebe gemäß der
Definition immer Gewerbebetriebe sein müssen.
26
Der Firmeninhaber ist bis zum Übergabezeitpunkt buchführungspflichtig im Sinne des
Handelsgesetzbuches,
27
aber auch über § 140 AO nach steuerrechtlichen Vorschriften. Die
Gewinnermittlung erfolgt gemäß § 5 EStG. Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der
Einzelunternehmer einen Jahresabschluss.
28
Er verzichtet dabei auf die getrennte Aufstellung
einer Handels- und Steuerbilanz und macht von der Möglichkeit, eine den steuerlichen
Vorschriften entsprechende Bilanz aufzustellen, Gebrauch.
29
Nach der Übertragung verliert der Übergeber seine Kaufmannseigenschaft, weil er seinen
Gewerbebetrieb aufgegeben hat. Er ist damit sowohl nach Handels- als auch nach Steuerrecht
nicht mehr buchführungspflichtig. Sollten sich nach dem Übergabestichtag weitere Einkünfte
aus der früheren gewerblichen Tätigkeit des ehemaligen Eigentümers ergeben, sind sie
diesen zuzuordnen.
30
Sie werden weiterhin vom Einkommensteuergesetz erfasst und bleiben
nicht etwa unberücksichtigt. Die Gewinnermittlung kann wegen der fehlenden
Buchführungspflicht nach § 4 Abs. 3 EStG erfolgen.
25
Vgl. Meyerhoff, Heinz J., Die Eintragung von Kaufleuten, 2000, S. 812.
26
Vgl. Meyerhoff, Heinz J., Der selbständige Handwerksbetrieb, 1999, S. 1255.
27
Siehe § 238 HGB.
28
Siehe § 242 Abs. 1 HGB.
29
Sogenannte Steuerbilanz; siehe § 60 Abs. 2 Satz 2 EStDV.
30
Siehe § 24 Nr. 2 EStG.
Vorstellung des Einzelunternehmens
7
2.2 Gestaltungsmöglichkeiten unter Beachtung der Vorgaben
Wenn der Übergeber seine gewerbliche Tätigkeit einstellt,
31
bestehen grundsätzlich drei
Möglichkeiten zur Unternehmensübergabe.
Der erste Weg ist die entgeltliche Methode, d.h. der Verkauf des Betriebes. Dies setzt voraus,
dass beide Parteien sich einig sind und der Kaufpreis wie unter fremden Dritten zu Stande
kommt. Die zweite Variante ist die Schenkung als unentgeltliche Übertragung. Die letzte
Möglichkeit kombiniert die beiden ersten und wird als teilentgeltliche Übertragung
bezeichnet, da sie zu einem bestimmten Anteil entgeltlich als auch unentgeltlich erfolgt. Sie
wird unter anderem bei der Vermögensübertragung auf Familienmitglieder angenommen, da
emotionale Komponenten die rationalen Überlegungen überlagern und der Kaufpreis nicht
wie zwischen Familienfremden ermittelt wird.
32
Um seinen Nachfolger einerseits nicht zu stark finanziell zu belasten und den Kapitalbedarf
zu Beginn der Existenzgründung zu verringern und andererseits die Altersversorgung des
Übergebers zu sichern, erfolgt die Übertragung des Unternehmens im Rahmen einer
Schenkung unter Auflagen.
33
Der Nachfolger hat keine hohe Abstandszahlung an seinen
Vater zu zahlen, sondern es erfolgt eine ,,Zerlegung" in einen verminderten Einmalbetrag und
laufende monatliche Zahlungen, wobei die erste Komponente in ein verzinsliches Darlehen
umgewandelt wird.
34
Der Bruder des Nachfolgers erhält ein Gleichstellungsgeld unter
Anrechnung seines künftigen Pflichtteils.
Da das Grundstück und die Gebäude nicht mit übertragen werden, wird über die zur
Ausübung des Betriebes notwendigen Immobilien ein Mietvertrag mit dem Sohn
abgeschlossen.
35
Dies dient neben den laufenden Zahlungen der weiteren Altersversorgung
des Übergebers und dessen Ehegattin.
Der Übergeber wird für seinen Sohn als Arbeitnehmer tätig werden,
36
um dem
Existenzgründer als Berater zur Verfügung zu stehen, ohne hierfür eine Haftung übernehmen
31
Damit entfallen die Möglichkeiten des Nießbrauchs und der Unternehmensverpachtung.
32
Vgl. Freiling, C. u.a., Nachfolgeplanung, 1999, S. 55.
33
Vgl. im Anhang: 1. Entwurf eines Übergabevertrages.
34
Vgl. im Anhang: 5. Entwurf eines Darlehensvertrages.
35
Vgl. im Anhang: 4. Entwurf eines Mietvertrages über gewerblich genutzte Grundstücke und Geschäftsräume.
36
Vgl. im Anhang: 3. Entwurf eines Arbeitsvertrages.
Vorstellung des Einzelunternehmens
8
zu müssen. Die Vergütung orientiert sich dabei an den für eine vergleichbare Tätigkeit in
einem anderen Unternehmen gezahlten Betrag und der vereinbarten Arbeitszeit von
20 Stunden je Woche.
Durch die Entscheidung das Unternehmen weiterhin als Einzelunternehmen zu betreiben,
bleibt die Unternehmensstruktur und -organisation weites gehend erhalten. Außerdem werden
damit die Aufwendungen für die Beratungsleistungen der Steuerberater und Rechtsanwälte
reduziert. Diese würden zum Beispiel bei der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft oder in
eine andere Gesellschaftsform entstehen.
2.3 Vor- und Nachteile der Gestaltungsüberlegungen
Da dem Unternehmer ein Nachfolger aus der eigenen Familie zur Verfügung steht und er
seine Firma schon zu Lebzeiten abgeben will, bietet sich die Übertragung im Wege der
vorweggenommenen Erbfolge
37
an.
Durch diese Möglichkeit lässt sich der Gestaltungsspielraum für die Vermögensnachfolge
erheblich erweitern. Es können zahlreiche Vorteile ausgenutzt werden, die sich nicht nur
speziell auf den zu betrachtenden Vorgang beziehen, sondern in vielen anderen Fällen
zutreffen.
Der wohl wesentlichste Vorteil besteht darin, dass der Übergeber schon zu Lebzeiten die
Vermögensübertragungen planen und kontrollieren kann. So steuert er, was er schenken will
und hat damit erheblich mehr Gestaltungsfreiheit als nach seinem späteren Ableben.
Des weiteren ergeben sich erbrechtliche Vorteile. Der künftige Erblasser kann dem
nachfolgenden Erben einen ganz bestimmten Gegenstand übertragen. Von Todes wegen
erfolgt die Zuordnung nur Kraft einer Teilungsanordnung oder im Wege eines
Vermächtnisses. Beide Instrumente verschaffen aber nur schuldrechtliche Ansprüche auf
Übertragung des Gegenstandes. Ebenso können dem Empfänger Gegenleistungen auferlegt
werden, ohne dass er hierdurch die Möglichkeit erhält, die Zuwendung auszuschlagen
38
und
den Pflichtteil zu verlangen.
39
Der zukünftige Erbe wird durch die lebzeitige Übertragung an
das Vermögen gebunden.
37
Zur Begriffsbestimmung: vgl. Kapitel 3.2.
38
Siehe §§ 1942-1966 BGB.
39
Vgl. Himmelmann, A., Zivilrechtliche Grundlagen, 2000, Teil 3/10.2, S. 1.
Vorstellung des Einzelunternehmens
9
Ein weiterer Vorteil ergibt sich dadurch, dass dem Nachfolger durch die vorgezogene
Übertragung die Möglichkeit gegeben wird, eigenes Kapital zu bilden, das nicht nur aus
finanziellen, sondern auch aus immateriellen Vermögen, wie zum Beispiel einem Firmenwert,
bestehen kann.
Die steuerrechtlichen Vorteile lassen sich wie folgt zusammenfassen. Im Einkommen-
steuerrecht ist zu berücksichtigen, dass durch die Übertragung der Einkunftsquelle auf den
Nachfolger Progressionsvorteile erzielt werden können. Außerdem wird die Besteuerung der
Veräußerungsgewinne durch Freibeträge und einem besonderen Steuersatz gemildert.
40
Bei
der Schenkungsteuer können Vergünstigungen im Zehn-Jahres-Rhythmus mehrfach in
Anspruch genommen werden, zum Beispiel die persönlichen Freibeträge des § 16 ErbStG und
der Freibetrag für Betriebsvermögen nach § 13a Abs. 1 ErbStG.
41
Die steuerlichen
Auswirkungen können zwar die rechtliche Gestaltung beeinflussen, sollten aber weder
entscheidend noch das Hauptmotiv einer lebzeitigen Übertragung von wesentlichen
Vermögensgegenständen sein.
Die Vorteile dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch Risiken zu tragen sind. Der
grundsätzliche Nachteil besteht in der fehlenden Garantie, dass sich die mit der
Vermögensübergabe beabsichtigten Ziele tatsächlich verwirklichen lassen. Dies gilt
besonders in den Fällen, in denen vom Nachfolger eine Entwicklung bzw. ein Verhalten in
eine bestimmte Richtung erwartet wird. Mit der Übergabe werden immer Rechte, zum
Beispiel Eigentum, Besitz und Nutzen, zu Lebzeiten aufgegeben. Das überlassene Vermögen
ist dann in der Regel verloren, wenn der Nachfolger die Erwartungen nicht erfüllt. Die
gesetzlichen und vertraglichen Rücktrittsrechte sowie vereinbarten Rückfallklauseln
42
können
keinen umfassenden Schutz gewähren.
Auf die zu betrachtende Übergabe des Einzelunternehmens treffen die genannten Vor- und
Nachteile ebenfalls zu. Speziell lassen sich weiterhin folgende Gestaltungsspielräume
erkennen.
Aufgrund der Tatsache, dass der Übergeber seinen Sohn nicht zu stark finanziell belasten
möchte, kommt der Verkauf des Unternehmens zum Verkehrswert nicht in Frage. Auf eine
40
Vgl. Kapitel 4.2.
41
Siehe § 14 ErbStG; § 13a Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 ErbStG.
42
Vgl. Kapitel 3.3.4.
Vorstellung des Einzelunternehmens
10
Altersversorgung kann der Übergeber aber keinesfalls verzichten, so dass eine unentgeltliche
Übertragung ebenfalls ausgeschlossen wird. Daher haben sich die Beteiligten entschieden,
eine teilentgeltliche Übergabe vorzunehmen. Sie ergibt sich aus der Aufteilung der Zahlungen
in der bereits beschriebenen Art.
Dadurch ist es ebenfalls möglich, einen Teil des Entgeltes in den gewerblichen Bereich zu
verlagern. Grundsätzlich betrifft die Abstandszahlung an den Übergeber den privaten
Bereich.
43
Sie ist nur über die Sonderbestimmung des § 10 EStG bei der
Einkommensteuerveranlagung als Sonderausgaben berücksichtigungsfähig. Durch die
gewählte Gestaltung, die Abstandszahlung zu verringern und einen Teil in Miet- und
Gehaltszahlungen ,,umzuwandeln", werden aus den privaten Beträgen Betriebsausgaben, die
bei den gewerblichen Einkünften zu berücksichtigen sind. Durch die Darlehensgewährung des
Vaters für die verminderte Abstandszahlung werden zusätzlich in Höhe der Zinszahlungen
Betriebsausgaben geschaffen. Der Vorteil besteht darin, dass sie bei den Einkünften
angerechnet werden und damit, im Gegensatz zu den Sonderausgaben des § 10 EStG, unter
anderem beim Verlustabzug im Sinne von § 10d EStG und bei der Ermittlung der zumutbaren
Belastung des § 33 Abs. 3 EStG Berücksichtigung finden.
43
Vgl. Kapitel 4.2.6.2.
Zivilrechtliche Darstellung
11
3 Zivilrechtliche Darstellung
3.1 Grundsätzliche
Überlegungen
Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, haben sich die Beteiligten entschlossen, die
Unternehmensnachfolge im Rahmen einer teilweisen Schenkung durchzuführen. Es handelt
sich um eine Schenkung unter Lebenden im Sinne der §§ 516-534 BGB.
44
Eine solche ist jede Zuwendung, um die jemand aus seinem Vermögen einen anderen
bereichert und bei der beide Parteien darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich
erfolgt.
45
Die Schenkung wird daher durch zwei Merkmale geprägt, dem objektiven und dem
subjektiven Bestandteil.
46
Der erstgenannte ist die Bereicherung des Empfängers, während der
zweite in der Einigkeit über die Unentgeltlichkeit der Übertragung besteht.
Die Schenkung hat aus dem Vermögen des anderen zu erfolgen, so dass der geschenkte
Gegenstand bereits im Vermögen des Schenkers vorhanden gewesen sein muss. Das ist bei
einem Verzicht auf einen möglichen Vermögenserwerb bzw. auf dessen Berechtigung nicht
der Fall. Diese stellen selbst noch keine Bereicherung aus dem Vermögen des Verzichtenden
dar.
47
Zum Beispiel in den Fällen der Nichtgeltendmachung eines vom Grunde nach
bestehenden Pflichtteilsanspruches oder Zugewinnausgleichsanspruchs bzw. die
Ausschlagung eines bestehenden Erbanspruchs oder testamentarisch angeordneten
Vermächtnisses kann keine Schenkung im Sinne der §§ 516 ff. BGB angenommen werden.
48
Die Bereicherung des Beschenkten muss das Ergebnis der Zuwendung sein. Eine Absicht der
Bereicherung ist nicht erforderlich. Sie liegt nicht vor, wenn der Vermögensgegenstand nur
treuhänderisch übertragen wird oder wenn ihn der Empfänger bestimmungsgemäß zu
wohltätigen oder gemeinnützigen Zwecken zu verwenden hat.
49
Insbesondere für die
schenkungssteuerrechtliche Behandlung ist es von Bedeutung, ob der Geldbetrag oder der mit
dem Geld erworbene Gegenstand geschenkt wurde. Eine Geldschenkung liegt vor, wenn der
Beschenkte mit dem Geld verfahren kann, wie er will, wenn er also Dispositions-
44
Davon zu unterscheiden sind die Schenkungen auf den Todesfall im Sinne von § 2301 BGB.
45
Siehe § 516 Abs. 1 BGB.
46
Vgl. Putzo, H., Kommentar zu §§ 433 bis 534 BGB, 2001, S. 555, Tz. 1.
47
Siehe § 517 BGB.
48
Vgl. Kussmann, M., Schenken, Erben, Steuern, 1999, S. 25, Tz. 3.
49
Vgl. Putzo, H., Kommentar zu §§ 433 bis 534 BGB, 2001, S. 555, Tz. 6.
Zivilrechtliche Darstellung
12
möglichkeiten hat.
50
Eine Sachschenkung wird angenommen, wenn zwischen den Parteien
Klarheit darin bestand, dass ein bestimmter Gegenstand mit dem Geldbetrag erworben werden
soll.
51
Die Unentgeltlichkeit einer Zuwendung liegt vor, wenn sie unabhängig von einer
Gegenleistung geschieht, was stets nach objektiven Kriterien zu beurteilen ist,
52
und sich die
Beteiligten darüber einig sind.
Die Schenkung ist ein Vertrag und bedarf der Mitwirkung beider Beteiligten. Der
Schenkungsvertrag setzt Angebot und Annahme voraus. Das Bürgerliche Gesetzbuch geht im
Regelfall von der Handschenkung aus, d.h. von einer sofort vollzogenen Schenkung. Jedoch
besteht die Gefahr, dass sie übereilt ausgesprochen wird. Um dem zu begegnen, sieht das
Gesetz mit § 518 Abs. 1 BGB für das Schenkungsversprechen die notarielle Beurkundung
vor.
53
Das Formbedürfnis kann aber durch Bewirkung der versprochenen Leistung geheilt
werden.
54
Vollzogen ist eine Schenkung erst in dem Zeitpunkt, zu dem sie die
Vermögenssphäre des Schenkers verlassen hat und ,,wenn der Schenker alles getan hat, was
von seiner Seite zum Erwerb des Schenkungsgegenstandes durch den Beschenkten
erforderlich ist"
55
.
Grundsätzlich besteht Schenkungsfreiheit. Es bestehen aber Wirkungsgrenzen für die
Vermögensverfügungen. Eine Abgrenzung setzt das Pflichtteilsrecht. Der
Pflichtteilsberechtigte kann wegen Schenkungen, die in den letzten zehn Jahren vor dem
Erbfall gemacht worden sind, eine Pflichtteilsergänzung verlangen.
56
Damit wird zumindest
für diesen Zeitraum ausgeschlossen, dass der Erblasser zu Lebzeiten wesentliche Teile seines
Vermögens verschenkt, um auf diese Weise den Pflichtteilsberechtigten nichts oder möglichst
wenig zukommen zu lassen. Von der Regelung der Pflichtteilsergänzung sind sogenannte
Anstandsschenkungen, zum Beispiel kleine Gelegenheitsschenkungen, ausgenommen.
57
50
Vgl. BGH-Urteil vom 29.05.1952.
51
Vgl. Cremer, M., Kommentar zu § 516 BGB, 1995, S. 792, Tz. 16.
52
Vgl. Putzo, H., Kommentar zu §§ 433 bis 534 BGB, 2001, S. 555, Tz. 8.
53
Bei Grundstücksschenkungen kommt § 313 BGB hinzu. Danach bedarf ein Vertrag, in dem sich jemand
verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, der notariellen
Beurkundung.
54
Siehe § 518 Abs. 2 BGB.
55
BGH vom 06.03.1970.
56
Siehe § 2325 BGB.
57
Siehe § 2330 BGB.
Zivilrechtliche Darstellung
13
3.2 Zivilrechtliche
Begriffsbestimmung der vorweggenommenen Erfolge
Der Begriff der ,,vorweggenommener Erbfolge" wird im Bürgerlichen Gesetzbuch nicht
definiert. Er wird jedoch in § 593a Satz 1 BGB ausdrücklich erwähnt. Die Erläuterung
erfolgte durch den Bundesgerichtshof, der unter ihr die ,,Übertragungen des Vermögens (oder
eines wesentlichen Teils davon) durch den (künftigen) Erblasser auf einen oder mehrere als
(künftige) Erben in Aussicht genommene Empfänger"
58
versteht. Damit handelt es sich in der
Regel um Schenkungen im Sinne der §§ 516 ff. BGB, Ausnahmen sind jedoch möglich.
59
Es
sind lebzeitige, nicht Verfügungen von Todes wegen,
60
die im Vorgriff oder in Ersetzung der
Erbfolge vom Erblasser seinen zukünftigen Erben gegenüber vorgenommen werden
61
und
nicht einseitig angeordnet werden können, sondern die Einigkeit zwischen Erblasser und
Erben voraussetzen.
Die vorweggenommene Erbfolge wird im sogenannten Übergabevertrag geregelt,
62
der im
BGB ebenfalls nicht erwähnt wird. Es ,,handelt sich um einen in der Praxis gebräuchlichen
Sammelbegriff für einen typengemischten Vertrag mit einer im einzelnen sehr
unterschiedlichen Gestaltung"
63
. Man kann ihn auch als Verpflichtung beschreiben, mit denen
Eltern ihr Vermögen, insbesondere ihren Betrieb oder privaten Grundbesitz,
64
,,auf einen oder
mehrere Abkömmlinge übertragen und dabei für sich einen angemessenen Lebensunterhalt
und für die außer dem Übernehmer nach vorhandenen weiteren Abkömmlinge
Ausgleichszahlungen ausbedingen"
65
. Das Kennzeichen ist das Nachrücken der
nachfolgenden Generation in eine die Existenz - wenigstens teilweise - begründende
Wirtschaftseinheit, bei den die Versorgungsinteressen des Übergebers und Einbeziehung der
Interessen der weichenden Geschwister berücksichtigt werden.
66
Der Vertragsinhalt wird zum
überwiegenden Teil von der Familienbeziehung der Beteiligten geprägt. In der Regel soll der
Nachfolger dabei wenigstens teilweise eine unentgeltliche Zuwendung erhalten.
67
58
BGH vom 30.01.1991.
59
Vgl. BGH vom 01.02.1995.
60
Siehe §§ 2229 ff. BGB.
61
Vgl. Baumann, W. / Schulze zur Wiesche, D., Vermögensnachfolge, 2001, S. 227, Tz. 800.
62
Vgl. Weirich, H.-A., Der Übergabevertrag, 1998, S. 438.
63
Weirich, H.-A., Der Übergabevertrag, 1998, S. 439, Tz. 1067.
64
Vgl. Gebel, D., Kommentar zu § 7 ErbStG, 2001, S. 84, Tz. 231.
65
BFH vom 05.07.1990.
66
Vgl. Weirich, H.-A., Der Übergabevertrag, 1998, S. 439, Tz. 1068.
67
Vgl. BGH vom 03.04.1981.
Zivilrechtliche Darstellung
14
Beim Übergabevertrag, und die damit geregelte vorweggenommene Erbfolge, muss es sich
nicht unbedingt um eine reine Schenkung handeln. Er beinhaltet häufig einen entgeltlichen
Teil. Inwiefern Teilentgeltlichkeit vorhanden ist oder ob in den Verpflichtungen des
Nachfolgers kein Entgelt vorliegt, soll im folgenden Kapitel näher betrachtet werden.
3.3 Vertragliche
Gestaltungsmöglichkeiten
3.3.1 Gemischte Schenkung
Als gemischte Schenkung sind Vermögensübertragungen einzustufen, die teilweise
entgeltlich und teilweise unentgeltlich sind, ohne dass der Übertragungsgegenstand selbst
teilbar ist.
68
Damit handelt es sich nicht um eine reine Schenkung, im Sinne einer völligen
Unentgeltlichkeit. Der entgeltliche Teil besteht aus den je nach der konkreten
Vertragsgestaltung vom Nachfolger zu erfüllenden Gegenleistungen. Der darüber
hinausgehende Wert des übertragendenden Vermögens stellt den unentgeltlichen Teil der
Zuwendung dar.
69
Ein objektives Missverhältnis zwischen der Leistung und Gegenleistung
genügt aber nicht. Hinzukommen muss die Erkenntnis und der Willen der Parteien, dass die
Leistungen ungleichwertig sind.
70
Eine gemischte Schenkung liegt bei zwei selbstständigen, nur äußerlich zusammengefassten
Verträgen nicht vor, wenn die höherwertige Zuwendung real teilbar ist.
71
Wird für ein
Grundstück bewusst ein überhöhter Preis gezahlt, so liegt kein Schenkungsvertrag, sondern
ein Kaufvertrag vor, der nur äußerlich mit einer Schenkung des Überschussbetrages
zusammengefasst ist. Entsprechend kann ein niedrigerer Kaufpreis unter Umständen ein
Grundstückskaufvertrag mit einer Zugabe gegeben sein. Eine gemischte Schenkung kann
damit erst angenommen werden, wenn die höherwertige Zuwendung real unteilbar ist.
Die zivilrechtliche Behandlung der gemischten Schenkung ist umstritten. Es werden die
Einheits- und Trennungstheorie vertreten.
72
68
Vgl. Himmelmann, A., Zivilrechtliche Grundlagen, 2000, Teil 3/10.3, Seite 3.
69
Für den unentgeltlichen Teil kommen die erbrechtlichen Anrechnungs- und Ausgleichspflichten gegenüber
den weichenden Geschwistern in Betracht.
70
Vgl. Putzo, H., Kommentar zu §§ 433 bis 534 BGB, 2001, S. 556, Tz. 13.
71
Vgl. Kollhosser, H., Kommentar zu § 516 BGB, 1995, S. 996, Tz. 26.
72
Vgl. Putzo, H., Kommentar zu §§ 433 bis 534 BGB, 2001, S. 556, Tz. 14.
Zivilrechtliche Darstellung
15
Nach der Einheitstheorie sind die verschiedenen Vertragstypen der gemischten Schenkung
derart verschmolzen, dass eine Zerlegung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen
Teil nicht mehr möglich ist. Demzufolge sind in der Regel Rechtsnormen, die für die
miteinander verschmolzenen Verträge gelten, kumulativ anzuwenden.
73
Die Trennungstheorie geht von der möglichen Zerlegung des Rechtsgeschäftes in einen
entgeltlichen und unentgeltlichen Teil aus. Für beide werden die Gesetzesregeln verwendet,
die bei getrenntem Vorliegen gelten würden, d.h. das Schenkungsrecht ist nur auf den
unentgeltlichen Teil anwendbar. Da aber eine reale Abtrennung der im Rahmen der
Schenkung durchgeführten Mehrleistung nicht möglich ist, muss eine wertmäßige Aufteilung
erfolgen.
74
Die Rechtssprechung ist nicht einheitlich. Der Bundesgerichtshof hat noch keine allgemeine
Aussage zum Wesen der gemischten Schenkung gemacht.
75
Bei den Entscheidungen
orientiert sich der BGH unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen am
wirtschaftlichen Zweck der jeweiligen gemischten Schenkung, insbesondere, ob der
entgeltliche oder unentgeltliche Charakter überwiegt.
76
Die Schenkungsvorschriften
beanspruchen nach ihrem Sinn und Zweck nur Geltung für den Schenkungsteil, während der
andere Teil nach den Vorschriften des jeweils passenden entgeltlichen Vertrages zu behandeln
ist.
Die unterschiedliche Betrachtungsweise hat auch Auswirkungen auf das Formbedürfnis des
Schenkungsvertrages. Geht man von der einheitlichen Betrachtung aus, ist eine Beurkundung
gemäß § 518 Abs. 1 BGB nur dann erforderlich, wenn nach den Vorstellungen der Parteien
über das Wertverhältnis der Schenkungscharakter überwiegt. Wenn dagegen das entgeltliche
Moment das größere Gewicht hat, so scheitert der ganze Vertrag, einschließlich des
unentgeltlichen Teils, nicht am Formmangel. Dieser Standpunkt ist zulässig, darf jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen, dass jedes nicht notariell beurkundetes Schenkungsversprechen
unwirksam ist. Dann kann aber ein Schenkungsversprechen, das normalerweise formpflichtig
wäre, nicht unter dem Gesichtspunkt, dass nur geringfügige unentgeltliche Bestandteile
vorhanden sind,
77
formlos wirksam werden. Andererseits spricht kein Argument dafür, dass
die Formpflicht auch auf den entgeltlichen Teil des Vertrages auszudehnen ist. Die gemischte
73
Vgl. Kollhosser, H., Kommentar zu § 516 BGB, 1995, S. 997, Tz. 27.
74
Vgl. Kollhosser, H., Kommentar zu § 516 BGB, 1995, S. 997, Tz. 28.
75
Vgl. Kollhosser, H., Kommentar zu § 516 BGB, 1995, S. 997, Tz. 29.
76
Vgl. BGH vom 03.12.1971.
77
Damit liegt nach der Einheitstheorie zum Beispiel ein Kaufvertrag vor, für den keine Formvorschriften gelten.
Zivilrechtliche Darstellung
16
Schenkung muss daher in entgeltliche und unentgeltliche Bestandteile zerlegt werden, und nur
der entgeltliche ist nach § 518 Abs. 1 BGB formpflichtig.
78
Der Trennungstheorie ist unter
diesem Gesichtspunkt den Vorzug zu geben.
Ist in einem Übergabevertrag eine Vermögensübertragung in Sinne einer gemischten
Schenkung vereinbart worden, ist von einer teilentgeltlichen Übertragung auszugehen. Die
Verpflichtungen des Nachfolgers stellen das Entgelt dar.
3.3.2 Schenkung unter Auflage
3.3.2.1
Begriff und Abgrenzung zur gemischten Schenkung
Eine Schenkung unter Auflage ist eine Schenkung im Sinne der §§ 516 ff. BGB mit der
zusätzlichen Nebenabrede, dass der Beschenkte zu einer Leistung verpflichtet sein soll, wenn
er in den Genuss des Schenkungsgegenstandes kommt.
79
Durch die Auflage kann der Beschenkte zu jedem denkbaren Tun oder Unterlassen im
Interesse des Schenkers, eines Dritten oder des Beschenkten selbst verpflichtet werden.
80
Ist
die Auflage nichtig,
81
bestimmt sich die Wirksamkeit der Schenkung nach § 139 BGB.
Danach ,,ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne
den nichtigen Teil vorgenommen sein würde"
82
.
Im Gegensatz zur gemischten Schenkung schließt die objektive Gleichwertigkeit der
Zuwendung und Auflagenleistung das Vorliegen einer Schenkung nicht aus. Es muss nur
subjektiv nach dem Parteiwillen eine, wenn auch nur geringfügige, Bereicherung des
Beschenkten verbleiben. Ist keine subjektive Bereicherung des Zuwendungsempfängers
gegeben, so kann vor allem ein entgeltliches Rechtsgeschäft vorliegen.
Liegt nach Meinung der Beteiligten eine Bereicherung des Empfängers vor, ist die
Auflagenschenkung von der gemischten Schenkung dadurch zu unterscheiden, dass bei der
letztgenannten der Zuwendungsempfänger für einen bestimmten wertmäßigen Teil eine
78
Vgl. Kollhosser, H., Kommentar zu § 516 BGB, 1995, S. 998, Tz. 32.
79
Siehe § 525 Abs. 1 BGB.
80
Vgl. Putzo, H., Kommentar zu §§ 433 bis 534 BGB, 2001, S. 560, Tz. 1.
81
Zum Beispiel wegen Formmangels (§ 125 BGB) oder wegen verbotener Rechtsgeschäfte (§ 134 BGB).
82
§ 139 BGB.
Zivilrechtliche Darstellung
17
Gegenleistung erbringt, der nicht geschenkt wird.
83
Bei der Auflagenschenkung leistet
hingegen der Beschenkte überhaupt keine Gegenleistung, sondern eine Leistung aus dem
Wert des Zuwendungsgegenstandes. Daher ist der ganze Gegenstand geschenkt und nicht nur
der nach der Erfüllung der Auflage verbleibende Teil. Eine Aufteilung in einen entgeltlichen
und unentgeltlichen Teil erfolgt nicht.
84
Liegen keine abweichenden Vereinbarungen vor, ist der Anspruch auf Vollziehung der
Auflage durch den Schenkungsvollzug aufschiebend bedingt. Die Beweislast für den
Bedingungseintritt trägt der Schenker als Vollziehungsberechtigter.
85
Die Auflage kann erst
dann vom Schenker verlangt werden, ,,wenn er seinerseits geleistet hat".
86
Die Schenkung unter Auflage ist nicht immer leicht von einer gemischten Schenkung zu
unterscheiden.
87
Oft werden Leistungen beider Art erbracht. Für die Beteiligten bedeutet die
Unterscheidung wirtschaftlich keinen Unterschied, da beiden Formen die Übergabe
wertmindernd gegenübersteht. Zweckmäßiger wäre daher, nur zwischen Duldungs- und
Leistungsauflagen zu unterscheiden.
88
Folgt man den Ausführung, ist festzustellen, dass die Schenkung unter einer Auflage keine
teilentgeltliche Vermögensübertragung ist. Die Auflage stellt keine Gegenleistung und damit
kein Entgelt dar. Die Schenkung erfolgt im vollen Umfang unentgeltlich.
3.3.2.2
Beispiele für Auflagenschenkungen
Eine Schenkung unter einer Auflage wird angenommen, wenn bei Vermögensübertragungen
im Wege der vorweggenommenen Erbfolge Abfindungsleistungen
89
an die (übrigen) Erben
des Übergebers vereinbart werden,
90
da die Verpflichtungen des Übernehmers nicht Entgelt,
sondern Ausgleichspflichten sein sollen, die aus dem zugewendeten Wert zu erfüllen sind.
83
Vgl. Kollhosser, H.: Kommentar zu § 525 BGB, 1995, S. 1044, Tz. 3.
84
Vgl. Putzo, H., Kommentar zu §§ 433 bis 534 BGB, 2001, S. 560, Tz. 8.
85
Vgl. Kollhosser, H.: Kommentar zu § 525 BGB, 1995, S. 1046, Tz. 6.
86
Siehe § 525 Abs. 1 BGB.
87
Vgl. Himmelmann, A., Zivilrechtliche Grundlagen, 2000, Teil 3/10.3, Seite 7.
88
Vgl. Weirich, H.-A., Der Übergabevertrag, 1998, S. 443, Tz. 1077.
89
Diese werden auch als Ausgleichszahlungen oder Gleichstellungsgelder bezeichnet.
90
Vgl. Kollhosser, H., Kommentar zu § 525 BGB, 1995, S. 1045, Tz. 5.
Zivilrechtliche Darstellung
18
Eine Auflagenschenkung kann auch vorliegen, wenn die Schenkung eines Grundstücks mit
der Verpflichtung erfolgt, dem Schenker oder einem Dritten ein Nießbrauchsrecht daran zu
bestellen oder ein lebenslängliches unentgeltliches Wohnrecht zu gewähren.
91
Bei der Schenkung unter einem Nießbrauchsvorbehalt überträgt der Schenker den Gegenstand
dem Beschenkten, der gleichzeitig dem anderen den Nießbrauch hieran einräumt.
92
Der
Schenker wird in diesem Fall als Nießbrauchsberechtigter bezeichnet, der sämtliche
Nutzungen aus dem belasteten Gegenstand, zum Beispiel eines Grundstückes, ziehen kann.
93
Im Gegenzug verpflichtet er sich, die Sache in ihrem wirtschaftlichen Bestand zu erhalten.
94
Weiterhin muss der Nießbrauchsberechtigte gemäß § 1047 BGB die auf der Sache ruhenden
öffentlichen, zum Beispiel Erschließungskosten, sowie die privatrechtlichen Lasten tragen,
die schon zur Zeit der Bestellung des Nießbrauchs bestanden, insbesondere die Zinsen für
eingetragene Grundpfandrechte. Da dem Nießbraucher nur der Reinertrag verbleibt, wird der
mit dem gesetzlichen Inhalt bestellte Nießbrauch auch als Nettonießbrauch bezeichnet. Wird
allerdings eine abweichende Regelung dahingehend getroffen, dass der Eigentümer alle auf
der Sache ruhenden Lasten trägt, spricht man auch von einem Bruttonießbrauch.
Das unentgeltliche Wohnrecht ist das dingliche Recht im Sinne des § 1093 BGB, ein Gebäude
oder Gebäudeteil unter Ausschluss des Eigentümers als Wohnung zu nutzen. Es steht in der
Ausgestaltung zwischen der Grunddienstbarkeit
95
und dem Nießbrauchsrecht
96
. Das dingliche
Wohnrecht ist mit dem letztgenannten vergleichbar. Daher finden zivilrechtlich auf das
Wohnrecht im wesentlichen die Vorschriften über das Nießbrauchsrecht Anwendung.
97
Die Auflage kann auch in einem Leibrentenversprechen liegen. Leibrenten
98
sind regelmäßig
wiederkehrende Bezüge in Form von gleichmäßigen, auf Geld oder andere vertretbare Sachen
gerichtete Leistungen, die auf einem einheitlichen Rentenstammrecht beruhen und deren
Dauer vom Leben einer Person abhängig sind.
99
Die Leibrente wird unter anderem durch
91
Vgl. BGH vom 02.10.1981.
92
Vgl. Nießbrauch an Sachen: §§ 1030-1067 BGB.
93
Siehe § 1030 Abs. 1 BGB.
94
Siehe § 1041 Satz 1 BGB.
95
Siehe §§ 1018-1029 BGB. Die Grunddienstbarkeit ist das Recht des jeweiligen Eigentümers eines anderen
Grundstückes, das belastete Grundstück in bestimmter Weise nutzen zu dürfen.
96
Vgl. Kussmann, M., Schenken, Erben, Steuern, 1999, S. 262, Tz. 506.
97
Siehe § 1093 Abs. 1 Satz 2 BGB.
98
Siehe §§ 759-761 BGB.
99
Vgl. Sprau, H., Kommentar zu §§ 631-810 BGB, 2001, S. 913, Tz. 1.
Zivilrechtliche Darstellung
19
einen schriftlichen Vertrag begründet, soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ist.
100
Bei einer Grundstücksübertragung in der Form einer Schenkung ist zum Beispiel die
notarielle Beurkundung nötig.
101
Von den Leibrenten sind die sogenannten dauernden Lasten dahingehend zu unterscheiden,
dass bei diesen das Merkmal der Gleichmäßigkeit der Leistungen nicht erfüllt ist. Die
dauernden Lasten sind in der Höhe abänderbar. Die Vereinbarung einer
Wertsicherungsklausel, insbesondere die Anpassung an den jeweiligen Lebenshaltungs-
kostenindex, steht einer Gleichmäßigkeit der Leistungen und damit der Anerkennung als
Leibrente nicht entgegen.
102
3.3.3 Absicherungsmöglichkeiten der Leistungen
Da sich die Gegenleistungen und Auflagen in der Regel über einen längeren Zeitraum
erstrecken und sie als Alterssicherung des Übergebers dienen, ist es notwendig, diese gegen
einen Ausfall oder Wertverlust abzusichern.
Die Bestellung eines Nießbrauchsrechts an einem Grundstück erfolgt durch Einigung und
Eintragung ins Grundbuch
103
und wird damit dinglich abgesichert. Das mit dem
Nießbrauchsrecht vergleichbare Wohnungsrecht kann mit einer beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit belastet sein.
104
Leibrenten und dauernde Lasten können durch Eintragung einer Reallast im Grundbuch
geschützt werden. Danach kann ein Grundstück ,,in der Weise belastet werden, dass an
jemanden, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, wiederkehrende Leistungen aus dem
Grundstück zu entrichten sind"
105
. Die Formulierung ,,aus dem Grundstück ... zu entrichten"
weist dabei auf die dingliche Haftung des Grundstücks hin. Eine Reallast erfordert nicht, dass
die Leistungen aus dem Grundstück gewährt werden.
106
Die Höhe der Leistung muss nicht
100
Siehe § 761 BGB.
101
Siehe §§ 313 Satz 1, 518 Abs. 1 BGB.
102
Vgl. Himmelmann, A., Zivilrechtliche Grundlagen, 2000, Teil 3/10.3, Seite 8.
103
Siehe § 873 BGB.
104
Siehe § 1090 BGB.
105
§ 1105 BGB.
106
Vgl. Himmelmann, A., Zivilrechtliche Grundlagen, 2000, Teil 3/10.3, Seite 9.
Zivilrechtliche Darstellung
20
festgelegt, sondern nur bestimmbar sein. So kann die Reallast auch eine automatische
Anpassung mit absichern.
Um bei langfristigen Verträgen die ursprünglich vereinbarten Zahlungen ohne großen
Aufwand und Auseinandersetzungen an aktuelle wirtschaftliche Gegebenheiten anpassen zu
können, werden die Leistungen an einen Index gebunden. Dies geschieht durch Preis- oder
Wertsicherungsklauseln, die auch Inflationsrisiken absichern sollen. Die Indexveränderung
von einem Zeitpunkt zum anderen wird in Prozenten (Prozentindex) oder in Veränderung der
Kaufkraft des Geldes (Preisindex) ausgedrückt. Das Statistische Bundesamt hat im Februar
1999 den neuen Preisindex für die Lebenshaltung auf der Basis 1995 bekannt gegeben, wobei
mit dem nächste Basisjahr 2000 auch die Teilindizes wegfallen werden.
107
Sind im Zusammenhang mit der Vermögensnachfolge auch Schulden übernommen
worden,
108
kann als Sicherheit die sofortige Zwangsvollstreckung in das gesamte Vermögen
des neuen Schuldners vereinbart werden, die meistens Voraussetzung für die Genehmigung
der Schuldübernahme durch die Gläubiger ist.
Wenn kein Grundstück für die Eintragung einer Reallast oder einer beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit zur Verfügung steht, können auch andere Sicherungsmittel eingesetzt werden.
Hierzu gehören beispielsweise Eigentumsvorbehalte, Forderungsabtretungen oder
Bürgschaften, die der Gläubiger akzeptiert.
3.3.4 Rückforderungsrechte
Vermögensübertragungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge können unter
bestimmten Umständen von dem Übertragenden zurückgefordert werden. Entsprechende
Rechte auf Rückforderung können sich aus dem Gesetz oder dem Übergabevertrag ergeben.
107
Vgl. Pressestelle des Statistischen Bundesamtes: http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm1999/revi.htm;
vom 10.02.2002.
108
Hierzu ist die Genehmigung des Gläubigers notwendig; siehe § 415 BGB.
Zivilrechtliche Darstellung
21
3.3.4.1
Ansprüche aus dem Gesetz
Die gesetzlichen Rückforderungsrechte sind im Schenkungsrecht des Bürgerlichen
Gesetzbuches geregelt. Sie sind unter anderem dann von erheblicher Bedeutung, wenn die
Frage nach dem Schenkungscharakter zu klären ist. Das Recht auf Rückforderung erfasst nur
den unentgeltlichen Teil oder den ganzen Gegenstand, wenn die Unentgeltlichkeit des
Geschäfts überwiegt.
109
Nach § 528 BGB begründet der Notbedarf des Schenkers ein Rückforderungsrecht. Er ist
gegeben, wenn ,,der Schenker nach der Vollziehung der Schenkung außerstande ist, seinen
angemessenen Unterhalt zu bestreiten und die ihm seinen Verwandten, seinem Ehegatten oder
seinem früheren Ehegatten gegenüber gesetzlich obliegende Unterhaltspflicht zu erfüllen"
110
.
Die Schenkung muss nicht die Ursache für den Notbedarf sein.
111
Bei Eintritt der Verarmung
kann der Schenker von dem Beschenkten die Herausgabe des Geschenkes zurückfordern. Sie
kann aber auch vom letztgenannten verweigert werden, wenn der Schenker seine
Bedürftigkeit vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit
112
herbeigeführt hat oder zum
Zeitpunkt des Notbedarf zehn Jahre seit der Schenkung vergangen sind.
113
Ist der
Notbedarfsfall vor dem Vollzug der Schenkung eingetreten, so ist der Schenker berechtigt, die
Erfüllung zu verweigern.
114
Ein Rückforderungsrecht steht dem Schenker bei einer Auflagenschenkung zu, wenn der
Beschenkte die Auflage nicht erfüllt.
115
Der Zuwendende kann aber nur insoweit den
Schenkungsgegenstand zurückfordern, als dieser zur Vollziehung der Auflage hätte
verwendet werden müssen.
116
Es handelt sich um ein eingeschränktes Recht, das neben den
Anspruch auf Erfüllung tritt. Der Schenker kann vom Beschenkten verlangen, die Auflage zu
vollziehen.
117
Eine Befreiung von beiden Verpflichtungen ist nur möglich, wenn ihm die
Vollziehung der Auflage aufgrund von Umständen, die der Beschenkte nicht zu vertreten hat,
unmöglich geworden ist.
109
Vgl. Putzo, H., Kommentar zu §§ 433 bis 534 BGB, 2001, S. 556, Tz. 16.
110
§ 528 Abs. 1 BGB.
111
Vgl. Putzo, H., Kommentar zu §§ 433 bis 534 BGB, 2001, S. 561, Tz. 5.
112
Siehe § 276 BGB.
113
Siehe § 529 Abs. 1 BGB.
114
Sogenannte Notbedarfseinrede im Sinne von § 519 BGB.
115
Siehe § 527 BGB.
116
Vgl. Putzo, H., Kommentar zu §§ 433 bis 534 BGB, 2001, S. 561, Tz. 5.
117
Vgl. Himmelmann, A., Zivilrechtliche Grundlagen, 2000, Teil 3/10.4, Seite 4.
Zivilrechtliche Darstellung
22
Schließlich gibt das Gesetz dem Schenker die Möglichkeit, die Schenkung gemäß § 530 BGB
zu widerrufen und den Gegenstand zurückzuverlangen, wenn der Beschenkte sich des groben
Undankes schuldig gemacht hat. Er muss in einer schweren Verfehlung gegenüber dem
Schenker oder dessen nahen Angehörigen bestehen.
118
Die Folge ist, dass der Rechtsgrund der
Schenkung entfällt und der Beschenkte gemäß § 531 BGB nach den Vorschriften über die
ungerechtfertigte Bereicherung
119
dem Schenker gegenüber zur Herausgabe der Sache
verpflichtet ist. Nach § 532 BGB ist der Widerruf ausgeschlossen, wenn seit dem Zeitpunkt,
zu dem der Schenker von der schweren Verfehlung Kenntnis erlangt hat, ein Jahr vergangen
ist. Auf den Schenkungswiderruf kann verzichtet werden, jedoch frühestens zu dem
Zeitpunkt, zu dem der Undank dem Widerrufsberechtigten bekannt geworden ist.
120
3.3.4.2
Ansprüche aus dem Vertrag
Bei unvorhergesehenen Ereignissen reichen die gesetzlichen Schutzrechte des Schenkers
häufig nicht aus, denn deren Durchsetzung ist auf die oben genannten Fälle beschränkt und
der Ausgang von Verfahren ist unsicher.
121
Daher können zusätzlich zu den gesetzlichen
Rückforderungsansprüchen vertragliche Rechte vereinbart werden, wenn sich zum Beispiel
der Beschenkte nicht nach den Vorstellungen des Schenkers verhält bzw. in seiner
Persönlichkeit entwickelt. In diesen Fällen greifen die Regelungen des BGB nicht.
Die vielfältigen Vorstellungen der Übergeber haben dazu geführt, dass ,,ein mehr oder
weniger umfassender Katalog von Rückübertragungsklauseln begründet wurde, insbesondere
für die folgenden Fälle:
- wenn der Schenker die Rückübertragung aufgrund eines freien Entschlusses verlangt;
- wenn der Beschenkte vor dem Schenker verstirbt, ohne eheliche leibliche Abkömmlinge
zu hinterlassen;
- wenn die Ehe des Beschenkten auf andere Weise als durch den Tod eines Ehegatten
beendet wird, ohne dass der Schenkungsgegenstand bzw. der mit ihm verbundene
118
Beispiele hierfür sind die Bedrohung des Lebens, die körperliche Misshandlung und die grundlose
Strafanzeige; vgl. BGH-Urteil vom 28.09.1990.
119
Siehe §§ 812 ff. BGB.
120
Siehe § 533 BGB.
121
Vgl. Stenger, C., Rückgängig machen des Aktes der vorweggenommenen Erbfolge, 2000, S. 310.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832461812
- ISBN (Paperback)
- 9783838661810
- DOI
- 10.3239/9783832461812
- Dateigröße
- 875 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Leuphana Universität Lüneburg – Wirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Dezember)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- unternehmensnachfolge erbfolge generationswechsel steuergestaltung rechtsnachfolge
- Produktsicherheit
- Diplom.de