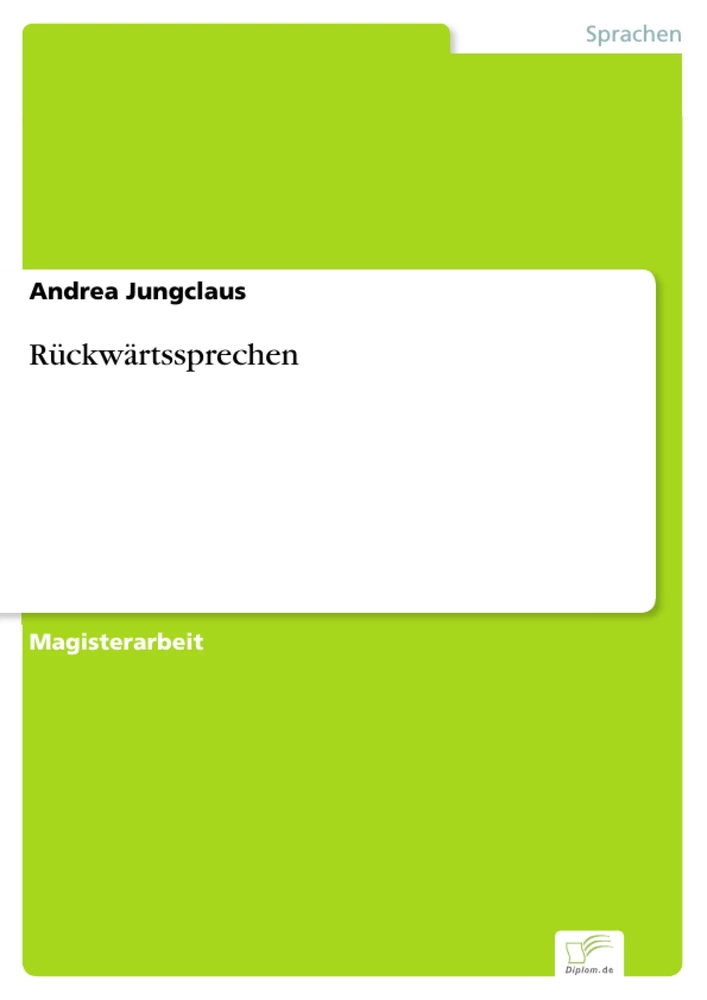Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Rückwärtssprechen ist eine sprachliche Fähigkeit, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nie Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung war. Um diese Fähigkeit untersuchen zu können, muß es jemanden geben, der rückwärts sprechen kann. Das trifft auf Bernhard Wolff zu, der einen Beruf daraus gemacht hat. Er ist professioneller Rückwärtssprecher, das heißt, er tritt seit 1988 öffentlich damit auf und erbringt den Beweis des phonetisch korrekten Rückwärtssprechens mittels eines Tonbandgerätes, das das rückwärts Gesprochene wieder vorwärts abspielt. Dieser wird im folgenden von mir als der klassische Beweis bezeichnet.
Das Rückwärtssprechen wird von Bernhard Wolff nicht nur mit rückwärts laufenden Bewegungen sowie Rückwärts-Gesang und eigener musikalischer Rückwärts-Begleitung, wie z.B. mit Kuhglocken (bei dem Lied Heidi), oder mittels einer Orgel oder eines Akkordeons angereichert, sondern auch die Ausdehnung auf das Rückwärtssprechen und Singen in englischer Sprache gehören zu seinem künstlerischem Repertoire.
Innerhalb dieser Arbeit beschränke ich mich auf die Untersuchung der gesprochenen, deutschen Sprache.
Aufgrund der noch nicht vorhandenen Forschungsbeiträge zu diesem Thema stützen sich meine Untersuchungen auf Vergleiche der vorwärts gesprochenen Sprache sowie auf die Beschreibung von Strukturierungen unseres Bewußtseins, die im wesentlichen auf der Metapherntheorie von Lakoff/Johnson (im folgenden L/J) beruhen. Auf diesem Wege versuche ich, zu einem Modell zu gelangen, das nicht nur der Persönlichkeit von Bernhard Wolff, der mit seiner spezifischen Wahrnehmungsleistung, die seine Fähigkeit, rückwärts zu sprechen, begründet, gerecht wird, sondern diese allgemeingültig nutzbar macht. Ich wende also zunächst ein induktives Verfahren an. Das deutlich erkennbare Sprachbewußtsein und beständige Bestreben nach Erweiterung dieses Bewußtseins von Bernhard Wolff kennzeichnet zugleich das Ziel dieser Arbeit und die Funktion des Rückwärtssprechens.
Die Arbeit weist sehr unterschiedliche Kapitel auf, was durch den Umstand begründet ist, daß durch sie das Fundament zum Thema Rückwärtssprechen erst gelegt wird. Zur Gewährleistung der Stabilität eines solchen Fundaments habe ich Rückwärtssprechen als Ganzes angesehen, mit seinen vielschichtigen Aspekten und immer im Hinblick auf die einzige zur Verfügung stehende Versuchsperson, ein Umstand, der prägend für diese Arbeit ist, sowie im Hinblick auf die praktische Umsetzung […]
Rückwärtssprechen ist eine sprachliche Fähigkeit, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nie Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung war. Um diese Fähigkeit untersuchen zu können, muß es jemanden geben, der rückwärts sprechen kann. Das trifft auf Bernhard Wolff zu, der einen Beruf daraus gemacht hat. Er ist professioneller Rückwärtssprecher, das heißt, er tritt seit 1988 öffentlich damit auf und erbringt den Beweis des phonetisch korrekten Rückwärtssprechens mittels eines Tonbandgerätes, das das rückwärts Gesprochene wieder vorwärts abspielt. Dieser wird im folgenden von mir als der klassische Beweis bezeichnet.
Das Rückwärtssprechen wird von Bernhard Wolff nicht nur mit rückwärts laufenden Bewegungen sowie Rückwärts-Gesang und eigener musikalischer Rückwärts-Begleitung, wie z.B. mit Kuhglocken (bei dem Lied Heidi), oder mittels einer Orgel oder eines Akkordeons angereichert, sondern auch die Ausdehnung auf das Rückwärtssprechen und Singen in englischer Sprache gehören zu seinem künstlerischem Repertoire.
Innerhalb dieser Arbeit beschränke ich mich auf die Untersuchung der gesprochenen, deutschen Sprache.
Aufgrund der noch nicht vorhandenen Forschungsbeiträge zu diesem Thema stützen sich meine Untersuchungen auf Vergleiche der vorwärts gesprochenen Sprache sowie auf die Beschreibung von Strukturierungen unseres Bewußtseins, die im wesentlichen auf der Metapherntheorie von Lakoff/Johnson (im folgenden L/J) beruhen. Auf diesem Wege versuche ich, zu einem Modell zu gelangen, das nicht nur der Persönlichkeit von Bernhard Wolff, der mit seiner spezifischen Wahrnehmungsleistung, die seine Fähigkeit, rückwärts zu sprechen, begründet, gerecht wird, sondern diese allgemeingültig nutzbar macht. Ich wende also zunächst ein induktives Verfahren an. Das deutlich erkennbare Sprachbewußtsein und beständige Bestreben nach Erweiterung dieses Bewußtseins von Bernhard Wolff kennzeichnet zugleich das Ziel dieser Arbeit und die Funktion des Rückwärtssprechens.
Die Arbeit weist sehr unterschiedliche Kapitel auf, was durch den Umstand begründet ist, daß durch sie das Fundament zum Thema Rückwärtssprechen erst gelegt wird. Zur Gewährleistung der Stabilität eines solchen Fundaments habe ich Rückwärtssprechen als Ganzes angesehen, mit seinen vielschichtigen Aspekten und immer im Hinblick auf die einzige zur Verfügung stehende Versuchsperson, ein Umstand, der prägend für diese Arbeit ist, sowie im Hinblick auf die praktische Umsetzung […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6140
Jungclaus, Andrea: Rückwärtssprechen
Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Hamburg, Universität, Magisterarbeit, 2000
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
1
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
1
2. EIN SYNERGISMUS VON KUNST UND WISSENSCHAFT
4
3. VORGEHENSWEISE
7
3.1 Der Rückwärtssprecher
7
3.2 Die Aufnahme
8
3.3 Das Corpus und die Auswahlkriterien
9
4. RÜCKWÄRTS-ARTIKULATION
13
4.1 Diphthonge
14
4.2 Stimmhafte Plosive
15
4.3 Stimmlose Plosive
16
4.4 Artikulation im Lautkontinuum
18
4.5 Geschriebene und gesprochene Sprache
21
5. DIE ZEITLICHE ANALYSE
23
Otto 24
Sinne 24
Hexerei 25
Mach das nochmal
26
Veronika, der Lenz ist da
26
Am Anfang war das Wort
27
5.1 Vergleich der Dauer der Wörter und Sätze
27
2
5.2 Vergleich der An- und Auslaute innerhalb eines vorwärts
gesprochenen Wortes
31
5.3 Vergleich der An- und Auslaute innerhalb eines rückwärts
gesprochenen Wortes
32
5.4 Vergleich vorwärts und rückwärts gesprochener An- und Auslaute
33
5.5 Vergleich vorwärts und rückwärts gesprochener Inlaute
36
5.6 Silbenverschiebungen
38
Ökologie 41
Lebensfreude 42
Hexerei 43
Sinne 44
5.7 Koartikulation
45
6. KONZEPTUELLE METAPHERN
48
6.1 Verständlichkeitsbrücken
50
6.2 Metaphern und das Begreifen
51
6.3 Die Praxis
53
7. SYNÄSTHESIE GENERIEREN?
57
8. RESÜMEE
62
9. AUSBLICK
63
LITERATURVERZEICHNIS 66
ANHANG TABELLEN
69
Angst 69
Lebensfreude 70
Unschuld 71
Geborgenheit 72
3
Strumpf 74
Früchtetee 75
Aggressionen 78
Andrea 80
Mutter 83
Eber 83
Rebe 84
Ökologie 85
Sabine 86
ANHANG SONAGRAMME
89
1
1. Einleitung
Als Leser diese Buches wünsche ich mir jeden,
der nicht imstande ist, Wissen von Sprache zu
trennen.
Oskar Pastior
Rückwärtssprechen ist eine sprachliche Fähigkeit, die bis zu diesem Zeitpunkt
noch nie Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung war. Um diese
Fähigkeit untersuchen zu können, muß es jemanden geben, der rückwärts
sprechen kann. Das trifft auf Bernhard Wolff zu, der einen Beruf daraus ge-
macht hat. Er ist professioneller Rückwärtssprecher, das heißt, er tritt seit 1988
öffentlich damit auf und erbringt den Beweis des phonetisch korrekten Rück-
wärtssprechens mittels eines Tonbandgerätes, das das rückwärts Gesprochene
wieder vorwärts abspielt. Dieser wird im folgenden von mir als der klassische
Beweis bezeichnet.
Das Rückwärtssprechen wird von Bernhard Wolff nicht nur mit rückwärts lau-
fenden Bewegungen sowie Rückwärts-Gesang und eigener musikalischer
Rückwärts-Begleitung, wie z.B. mit Kuhglocken (bei dem Lied ,,Heidi"), oder mit-
tels einer Orgel oder eines Akkordeons angereichert, sondern auch die Aus-
dehnung auf das Rückwärtssprechen und Singen in englischer Sprache gehö-
ren zu seinem künstlerischem Repertoire.
Innerhalb dieser Arbeit beschränke ich mich auf die Untersuchung der gespro-
chenen, deutschen Sprache.
Aufgrund der noch nicht vorhandenen Forschungsbeiträge zu diesem Thema
stützen sich meine Untersuchungen auf Vergleiche der vorwärts gesprochenen
Sprache sowie auf die Beschreibung von Strukturierungen unseres Bewußt-
seins, die im wesentlichen auf der Metapherntheorie von Lakoff/Johnson (im
folgenden L/J) beruhen. Auf diesem Wege versuche ich, zu einem Modell zu
gelangen, das nicht nur der Persönlichkeit von Bernhard Wolff, der mit seiner
spezifischen Wahrnehmungsleistung, die seine Fähigkeit, rückwärts zu spre-
2
chen, begründet, gerecht wird, sondern diese allgemeingültig nutzbar macht.
Ich wende also zunächst ein induktives Verfahren an. Das deutlich erkennbare
Sprachbewußtsein und beständige Bestreben nach Erweiterung dieses Be-
wußtseins von Bernhard Wolff kennzeichnet zugleich das Ziel dieser Arbeit und
die Funktion des Rückwärtssprechens.
Die Arbeit weist sehr unterschiedliche Kapitel auf, was durch den Umstand be-
gründet ist, daß durch sie das Fundament zum Thema Rückwärtssprechen erst
gelegt wird. Zur Gewährleistung der Stabilität eines solchen Fundaments habe
ich Rückwärtssprechen als Ganzes angesehen, mit seinen vielschichtigen As-
pekten und immer im Hinblick auf die einzige zur Verfügung stehende Ver-
suchsperson, ein Umstand, der prägend für diese Arbeit ist, sowie im Hinblick
auf die praktische Umsetzung dieser Arbeit, nämlich die Möglichkeit, Rück-
wärtssprechen zu erlernen und entsprechend zu nutzen.
Zunächst soll das Zusammenwirken von Kunst und Wissenschaft, das diese
Arbeit widerspiegelt, dazu anregen, dies zumindest als eine mögliche Form der
zukünftigen Art, wissenschaftlich zu arbeiten, anzusehen.
In Kapitel 3 wird die Vorgehensweise beschrieben, auf der die in Kapitel 4 und 5
ausgeführten artikulatorischen und zeitlichen Analysen, basieren. In Kapitel 6
versuche ich, mit Hilfe der schon erwähnten Metapherntheorie von L/J sowie
Bernhard Wolffs eigenen Beschreibungen von Rückwärtssprechen auf der
Satzebene, diese als eine Möglichkeit für generelle Wahrnehmungs- und Ge-
dächtnisstrukturen zu formulieren. Aus den Beobachtungen und Schilderungen
aus Kapitel 6 sowie Beobachtungen aus der Natur leite ich in Kapitel 7 eine
Theorie ab, durch die die Anwendbarkeit und Nutzbarkeit des Rückwärtsspre-
chens für das Sprachbewußtsein ersichtlich wird, was einem deduktiven Verfah-
ren entspricht.
Die Zusammenfassung meiner Ergebnisse erfolgt in Kapitel 8. Einen Ausblick
für weitere Forschungen, die ich mit dieser Arbeit zu bewirken hoffe, biete ich in
Kapitel 9 an.
Die Terminologie richtet sich weitestgehend nach der verwendeten Literatur.
Bei Bedarf habe ich praxisnahe Begriffe selbst ausgewählt. Diese Arbeit habe
ich nach den alten Rechtschreibregeln verfaßt.
3
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei einigen lieben
Menschen für die unterschiedlichsten Formen der Unterstützung zu bedanken
(in alphabetischer Reihenfolge):
bei meiner Freundin Elisabeth Klasen (gestorben 1996), für alles, was sie mir
gegeben hat, aber vor allem dafür, daß sie mir vorgelebt hat, nach dem ,,Prinzip
des liebenden Verstehens" zu leben;
bei Herbert von Laer, für die zahlreichen geistvollen Gespräche (im wahrsten
Sinne des Wortes: Gespräche voller Geist), die beständige und interessierte
Anteilnahme an dieser Arbeit, und für das so häufige, wundervolle gemeinsame
Lachen;
bei Gregor Peters, stv. Leiter des Cusanuswerkes, für die EinIadung am
2.3.2000, den vorläufigen Stand meiner Arbeit im Rahmen der Tagung ,,Gehirn:
Die Entdeckung eines Organs" präsentieren zu dürfen, sowie für die auf mehre-
ren Ebenen spannenden Vor- und Nachgespräche;
bei Ulrich Schnabel, Wissenschaftsredakteur bei der ZEIT, für den so sensibel
geschriebenen Artikel ,,Hirnakrobaten", in dem ich freundlicherweise von ihm
erwähnt wurde, und der Gregor Peters ,,auf meine Spur" geführt hat sowie für
die Idee, Herrn Prof. Dr. H.M. Emrich zu bitten, der Zweitgutachter meiner Ar-
beit zu sein;
und selbstverständlich bei Bernhard Wolff, der diese Arbeit überhaupt erst mög-
lich gemacht hat, durch seine Eigeninitiative, als Versuchsperson zu fungieren.
Außerdem danke ich ihm dafür, daß er sich von nichts und niemandem vom
Rückwärtssprechen hat abbringen lassen.
Außerdem danke ich allen, die diesem Thema gegenüber aufrichtiges Interesse
und Faszination geäußert haben.
4
2. Ein Synergismus von Kunst und Wissenschaft
Vernünftige erlernen zwar immer die Wissenschaften ihres Nutzens
wegen, aber der galantere Teil der Welt fängt erst alsdann an zu ler-
nen,wenn man ihm durch einen Beweis, der auch ein Spaß sein muß,
zeigt, daß man Wissenschaft zum Spaß erlernen kann, oder um damit
zu spielen.
Georg Christoph Lichtenberg
Von dem Nutzen, den die Mathematik einem Bel Esprit bringen kann.
aus: ,,Palindrome, Perioden und Chaoten" von K. Günter Kröber
,,Sprechen ist für die meisten Menschen so selbstverständlich und natürlich,
daß nur wenige sich die Mühe machen, über das Sprechen nachzudenken. Es
herrscht sogar die Vorstellung vor, daß das Sprechen ganz einfach sei. Daß
das Sprechen natürlich sei, soll hier keineswegs in Frage gestellt werden. Aber
Natürlichkeit bedeutet nicht gleichzeitig Einfachheit."
1
Genau diese Selbstverständlickeit ist es, die verhindert, daß Sprechen als eine
Kunst oder besondere Fähigkeit des Menschen angesehen wird. Das dringend
benötigte Bewußtsein für Sprache und Sprechen entsteht bei den meisten
Menschen leider erst durch Verlust verursacht durch einen Unfall oder eine
Aphasie infolge eines Schlaganfalls oder durch Tumore - oder zumindest Ein-
schränkung dieser Fähigkeit bei sich selbst oder einem nahestehenden Men-
schen. Es reicht schon eine Laryngitis oder auch nur die Vorstellung aus, nicht
sprechen zu können, um die gravierende Bedeutung des Sprechens für sich
selbst und sein ganzes Leben zu erfassen.
Dies muß bzw. sollte nicht so sein, denn Sprache und Sprechen sind m.E. ein
Ausdruck der Lebendigkeit und der Lebensfreude. Sie sind der Weg zu unse-
rem eigenen Bewußtsein, die Möglichkeit, sich unseres eigenen Selbst bewußt
zu werden. Aber nicht nur auf geistiger Ebene, sondern auch auf körperlicher
Ebene führt das bewußte Sprechen zur Bewußtwerdung der eigenen Körper-
lichkeit, zu einem sinnlichen und auch lustvollen Erlebnis.
Bei Kindern werden die unterschiedlichsten Formen von Sprachspielen sowie
das Herumspielen mit Sprechwerkzeugen, wie Lippen, Zunge etc. gutmütig und
1
Pétursson, 1996, S.13
5
belustigt gebilligt, während sich Erwachsene sich ein solches Verhalten keines-
falls erlauben dürfen, ohne zumindest aufzufallen. Wird eine solche Fähigkeit
auf eine Bühne verlagert, wird auf jeden Fall nicht mehr in Frage gestellt, daß
dieser Mensch dort anderen Menschen etwas zeigen und sagen will. Inwieweit
es verstanden wird, ist eine andere Frage.
Die Phonetik ist die Wissenschaft, die sich mit dem Phänomen der gesproche-
nen Sprache als ursprünglichster Form der Sprache überhaupt beschäftigt. In-
nerhalb der Sprachwissenschaften führt die Phonetik leider ein nicht gerechtfer-
tigtes Schattendasein, insbesondere im Vergleich zum Beginn des 20. Jahr-
hunderts.
Das in dieser Arbeit untersuchte Rückwärtssprechen von Bernhard Wolff soll
ein Signal setzen für die Möglichkeit, daß Kunst und Wissenschaft gleichwertig
nebeneinander existieren können und eine Verbindung von beiden Synergien
freisetzt, die wünschenswert sind.
Ich möchte anregen, sich einmal vorzustellen, die Kunst wäre eine Wissen-
schaft und die Wissenschaft wäre eine Kunst. Warum soll es bei dieser Vorstel-
lung bleiben? Ist nicht ein Stück Wahrheit darin schon jetzt enthalten? Sicher-
lich kommt es auf die Perspektive und die individuellen Erfahrungen an.
Die wissenschaftliche Betrachtung der Fähigkeiten von Sprech-, Sprach- und
Stimmkünstlern als Kunstform besitzt keinen anerkannten Stellenwert in den
akademischen Institutionen, nicht einmal in der Phonetik selbst. Inwiefern die-
ses durch mangelndes Entgegenkommen von Seiten der Künstler beeinflußt
wird, entzieht sich meiner Kenntnis; ausschließen will ich es nicht. Es scheint
eher zuviel Zurückhaltung von beiden Seiten zu bestehen.
Durch die wissenschaftliche Betrachtung erhält die Kunst das Attribut der Serio-
sität, während die Wissenschaft durch die Einbeziehung der Kunst Lebendig-
keit, Kreativität und Motivation erfährt. Was sie sich gegenseitig geben, sind
Erkenntnisse aufgrund neuer Perspektiven, die jede Disziplin der anderen bie-
tet. Mit anderen Worten, sie können voneinander lernen. In dieser Arbeit steht
über beiden, sowohl der Kunst als auch der Wissenschaft, die Würdigung des
Phänomens der menschlichen Fähigkeit, sprechen zu können, sowohl vorwärts
als auch rückwärts.
6
Da ein Künstler vermutlich das größere, vor allen Dingen aber das breitere Pub-
likum anspricht und erreicht, ermöglicht die Kunst eine Chance der Verbreitung
des geistigen Anstoßes zur Bewußtwerdung des Sprechens und der Sprache
und somit des Denkens.
Wenn Wissenschaftler Neugier und Offenheit besitzen, können sie Phänomene,
die Künstler der Öffentlichkeit nahe bringen, für die Wissenschaft nutzbar ma-
chen. Wenn Künstler sich Wissenschaftlern gegenüber öffnen, können sie de-
ren Ergebnisse integrieren und ihre Kunstform dadurch anreichern und erwei-
tern. Wenn Vertreter beider Disziplinen sich diesen Synergieeffekt vor Augen
halten, sollte es möglich sein, aufeinander zu zu gehen, um so zu fruchtbaren
Ergebnissen zu kommen. Ein solches Verhalten wäre in unserer heutigen Ge-
sellschaft auch wünschenswert im Hinblick auf unterschiedliche Wissenschafts-
diziplinen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, aber nicht interdisziplinär arbei-
ten und diskutieren.
Auf das Rückwärtssprechen bezogen, ist interdisziplinäres Arbeiten und Disku-
tieren nicht nur zwischen Kunst und Wissenschaft, sondern auch innerhalb der
Wissenschaften wünschenswert.
7
3. Vorgehensweise
Nicht
weil es schwer ist
wagen wir es nicht
sondern weil
wir es nicht wagen
ist es schwer
Seneca
Untersuchungsgegenstand ist die deutsche Sprache, vorwärts und rückwärts
gesprochen. Dazu habe ich die gesprochenen Wörter mit Hilfe eines So-
nagraphen in Sonagrammen dargestellt, anhand dieser Darstellung segmentiert
und die Dauer der einzelnen Segmente sowie der ganzen Wörter gemessen.
3.1 Der Rückwärtssprecher
Bernhard Wolff (im folgenden B.W.) ist professioneller Rückwärtssprecher, das
heißt, er tritt seit 1988 mit dieser Fähigkeit öffentlich auf und erbringt den Be-
weis des phonetisch korrekten Rückwärtssprechens mittels eines Tonbandgerä-
tes und einer Videokamera, die das rückwärts Gesprochene wieder rückwärts
abspielen. Bernhard Wolff ist 1966 geboren, war also zum Zeitpunkt der Auf-
nahmen für diese Untersuchung 31 bzw. 33 Jahre alt. Im Rahmen seines Stu-
diums der Germanistik und Wirtschaftspädagogik hat er seine Diplomarbeit
1997 über Mnemotechniken geschrieben. Als Rückwärtssprecher, Diplom-
Wirtschaftspädagoge und Zauberer steht er hauptberuflich auf deutschen Büh-
nen und ist somit einer starken Sprechbelastung ausgesetzt.
Stimmklang
Auditiver Eindruck: Bernhard Wolff hat eine harmonisch klingende Männer-
stimme mit einer sauberen und deutlichen Artikulation, sowie einer gemischten
Bauch-Zwerchfell-Flankenatmung (Costoabdominalatmung).
8
Die gemessene Grundfrequenz liegt mit 130 Hz geringfügig über dem Mittelwert
der männlichen Stimme (120 Hz). Ein relevanter Unterschied der Grundfre-
quenz ist durch das Rückwärtssprechen nicht aufgetreten.
3.2 Die Aufnahme
Die Wörter und Sätze habe ich ausgewählt und Bernhard Wolff zugeschickt. Er
hat sie mit einem Mikrophon auf sein Tonbandgerät gesprochen und dann auf
eine TDK-Cassette überspielt. Die Aufnahmen sind rauscharm, klar und deut-
lich. Die Aufnahmen wurden in einer vertrauten Umgebung des Sprachspen-
denden gemacht, so daß eine zwanglose Atmosphäre vorausgesetzt werden
kann. Die Motivation von Bernhard Wolff ist sehr hoch einzustufen, da die Un-
tersuchung seines Rückwärtssprechens von ihm gewünscht und genehmigt
wurde.
Der Sonagraph und das Programm
Es wurde der Sonagraph DSP 5500 vom Institut für Phonetik, Allgemeine
Sprachwissenschaft und Indogermanistik verwendet. Das verwendete Pro-
gramm #02# weist folgende Daten auf:
Sonagramm mit Oszillogramm
unten: Sonagramm auf Aufnahmekanal 1
Filterbreite: 300 Hz (Breitband)
Bildschirmbreite: 4 Sek.
Frequenzbereich: 0-8000 Hz
oben: Oszillogramm auf Aufnahmekanal 1
Ausgewählt habe ich dieses Programm, um bei nicht klar erkennbaren Grenzen
der Segmente beim Sonagramm eine Überprüfung und Hilfe durch das Oszil-
logramm zu erwirken.
9
3.3 Das Corpus und die Auswahlkriterien
Das Corpus besteht aus 25 Wörtern sowie 3 Sätzen, wobei ich die Wörter nach
folgenden Gesichtspunkten ausgewählt habe.
Palindrome: Glottalverschlußlaut
im
Anlaut:
Eber
Angst
Rebe
Andrea
Otto
Diphthonge:
Schwa
im
Auslaut:
Treueeid
Sinne
Sauerkraut
Sabine
Geborgenheit Schnute
Lebensfreude
Hexerei
Auslautvokalisierung:
Silbenverschiebungen:
wunderbar
urgemütlich
Mutter
Ökologie
jeder
Sinne
Sabine
Hexerei
Lebensfreude
Aggressionen
Auslautverhärtung:
H
im
Anlaut:
Unschuld
Hexerei
Treueeid
10
Affrikate:
J im Anlaut:
Strumpf ja
jeder
T als Problemlaut:
Früchtetee
Trotz
Otto
Wörter
2
Vorwärts transkribiert
Rückwärts transkribiert
Angst
[/ast]
[
|s/na/]
Lebensfreude
[lebnsfid] [difsnbel]
Unschuld
[nlt]
[
|ln]
Geborgenheit
[bnhait] [|iahna/obe]
urgemütlich
[umytl]
[
l|ymu/]
Strumpf
[tmpf]
[
fm|/]
Früchtetee
[ftte]
[
e||f]
Sauerkraut
[zaukaut]
[
|ua!auaz]
Treueeid
[ti/ait]
[
|ia/i|]
Aggressionen
[/asionn] [nnuis/a/]
Trotz
[tts]
[
s||]
Hexerei
[hksai]
[
ias/h]
Andrea
[/andea]
[
a/edna/]
Schnute
[nut]
[
|un]
Otto
[to]
[
o|]
ja
[ja]
[
aj]
11
jeder
[jed]
[
adej]
Mutter
[mt]
[
|m]
Eber
[eb]
[
abe]
Rebe
[eb]
[
be]
Ökologie
[økoloij]
[
iolo!ø]
Sabine
[zabin]
[
nibaz]
Wörter
Vorwärts transkribiert
Rückwärts transkribiert
Sinne
[zn]
[
nz]
wunderbar
[vndba]
[
abanv]
schlafen
[lafn]
[
nfal|]
Sätze
Mach das nochmal
Veronika, der Lenz ist da
Am Anfang war das Wort
Vorwärts transkribiert
Rückwärts transkribiert
[
max das nxmal]
[lamxn sad xam]
[
veonika d lns st da]
[
ad |s snl aed a!nof]
[
am anfa va das vt]
[
aov sad av |nafma ma]
Die Auswahl der Sätze hat keine speziellen phonetischen oder linguistischen
Hintergründe. Veronika, der Lenz ist da wurde von einer Studentin aus mei-
nem autonomen Seminar in der Sitzung mit B.W. vorgeschlagen, was bei ihm
2
Diese Auflistung entspricht der Reihenfolge auf der beiliegenden Cassette
12
sofort zu der Äußerung führte: ,,Ein sehr schöner Satz." Auch Am Anfang war
das Wort ist ein Vorschlag von B.W. gewesen. Die persönlichen Assoziationen
sind in Kapitel 6 nochmal genauer dargelegt. Der Satz Mach das nochmal hat
mich sofort angesprochen, aufgrund seines meiner Meinung nach wundervollen
Klanges und sicherlich, weil er einer der ersten Sätze war, die ich selber rück-
wärts sprechen konnte.
Bei den Sätzen habe ich die Dauer der Wörter, nicht aber deren einzelne Seg-
mente gemessen, da die Untersuchung auf der Wortebene durch 25 Wörter bei
weitem ausreichend für den Rahmen dieser Arbeit ist und die Untersuchung der
Satzebene für andere, nämlich lernorientierte Ansätze benötigt wurde.
13
4. Rückwärts-Artikulation
,,Guten Tag", sagte der kleine Prinz. ,,Wer bist Du?" Und er be-
trachtete den Mathematiker sehr aufmerksam, denn der sah
links so aus wie rechts und vorn so wie hinten. ,,Ich heiße Pal
Indrom und bin ein Rentner. Doch Nomen est omen. Wer mei-
nen Namen kennt, weiß, wer ich bin." Und er schaute dem klei-
nen Prinzen tief in die Augen und spiegelte sich in ihnen."
aus: ,,Palindrome, Perioden und Chaoten" von K.Günter Kröber
Um die Beschreibung der Artikulation rückwärts gesprochener Laute übersicht-
licher zu gestalten, habe ich mich zunächst von der üblichen Einteilung in Voka-
le und Konsonanten abgewandt. Ich spreche stattdessen von stabilen und in-
stabilen Lauten. Es gibt sechs instabile Laute beim Rückwärtssprechen, näm-
lich die sechs Plosive (Verschlußlaute), die drei stimmlosen [
p t k] und die drei
stimmhaften [
b d ]. Alle anderen Laute sind stabile Laute. Diese Aufteilung ist
entstanden durch die Überlegungen zu der Frage: Welche Schwierigkeiten gibt
es beim Rückwärtssprechen? Bei der Überprüfung jedes einzelnen Lautes fie-
len bei den Konsonanten die Plosive, insbesondere die Stimmlosen sofort durch
den Umstand auf, daß man diese Laute, isoliert gesprochen, nicht halten kann.
Mit halten können meine ich, die Artikulationsstelle während einer ganzen Aus-
atmungsphase bei zu behalten.
3
Die Nasale [
n m ], der uvulare Vibrant [], alle Frikative [f v s z x h], sowie
die Approximanten [
l] und [j] dagegen sind isoliert gesprochen durchaus zu hal-
ten, weshalb ich diese und alle Vokale und Diphthonge als stabile Laute be-
zeichne. Durch die Tatsache, daß das Standarddeutsch eine Teilquantitäts-
sprache
4
ist, d.h. eine Sprache mit distinktiver Vokalquantität, könnte der Ein-
druck entstehen, daß die kurzen Vokale [
oe ] nicht zu halten sind, son-
dern nur die langen Vokale [
i y u e ø o a ]. Das wäre ein Irrtum. Diese Unter-
suchung bezieht sich zwar ausschließlich auf die deutsche Standardsprache,
3
Jedem Leser steht es frei, dieses selber einmal auszuprobieren.
4
Vgl. Neppert, 1999, S. 187
14
allerdings spielt dieses bei der Artikulationsfähigkeit, den Laut zu halten, keine
Rolle, denn das ist bei allen Vokalen möglich. (Schließlich kommen die deut-
schen kurzen Vokale in anderen Sprachen durchaus als lange Vokale vor.)
4.1 Diphthonge
Alle stabilen Laute werden rückwärts ebenso artikuliert wie vorwärts, lediglich
die Reihenfolge der Lautkette wird umgedreht. Besondere Bedingungen gibt es
bei den Diphthongen.
,,Als Diphthong wird ein vokalisches Element bezeichnet, das aus zwei kontinu-
ierlich ineinander übergehenden vokalischen Klangfarben besteht und einen
Silbenkern bildet."
5
Diese Definition kennzeichnet schon die Schwierigkeit, im
Grunde die Unmöglichkeit, einen Diphthong bzw. seine vokalischen Elemente in
einem Sonagramm eindeutig zu segmentieren, meines Erachtens auch, wenn
man den Veränderungen des 1. und 2. Formanten folgt (was ich nicht getan
habe), ,,... da auch bei normal artikulierten einzelnen Vokalen immer ein gewis-
ses Maß an Formantenbewegung im Spektrum vorhanden ist."
6
Durch die Wörter Sauerkraut, Geborgenheit, Treueeid, Hexerei und Lebens-
freude sind alle drei Diphthonge [
ai au i]
7
vertreten. Beim Rückwärtssprechen
wird das [
au] in Sauerkraut beide Male isoliert gesprochen, also als [ua]. In Ge-
borgenheit, Treueeid und Hexerei wird [
ai] rückwärts zum steigenden Di-
phthong [
ia]. Dies ist nicht verwunderlich, da der Diphthong [ia] dem Wort ,,ja" so
sehr ähnelt, daß die Macht der gewohnten Artikulation dazu verleitet. Unter-
schiede treten beim [
i] auf. In Treueeid wird es rückwärts als Diphthong [i]
gesprochen, aber in Lebensfreude werden die Vokale wieder isoliert gespro-
chen als [
i]. Beim klassischen Beweis allerdings sind alle drei Diphthonge als
solche auditiv wahrnehmbar.
Durch versehentliche Löschung liegt mir der klassische Beweis dieser Wörter
leider nicht mehr vor. Dafür finden sich auf der beiliegenden Cassette mehrere
5
Pétursson, 1996, S. 104
6
Neppert, 1999, S. 151
7
Das diakritische Zeichen für einen Diphthong wird in dieser Arbeit immer unter den 2. Vokal
gesetzt und dient ausschließlich der Abgrenzung von zwei monophthongischen Vokalen.
15
Sätze, in denen alle Diphthonge vorwärts und rückwärts gesprochen sowie der
klassische Beweis vorkommen. Dabei fällt auf, daß das [
i], ebenso wie das [ai]
rückwärts unterschiedlich vorkommen, entweder als Diphthonge [
i] und [ia]
oder isoliert gesprochen als [
i] und [ia] oder auch als [ija].
8
Das [
au] allerdings
wird rückwärts immer isoliert gesprochen als [
ua].
9
4.2 Stimmhafte Plosive
Aufgrund ihrer Instabilität ergeben sich bei der Artikulation der Plosive ganz o-
der leicht veränderte Artikulationsformen. Dabei ist das Unterscheidungskriteri-
um Stimmhaftigkeit versus Stimmlosigkeit von Bedeutung.
Die stimmhaften Plosive [
b d ] werden rückwärts ebenso wie vorwärts gespro-
chen, allerdings mit einer sehr weichen Artikulation und teilweise sogar voll-
stimmhaft, insbesondere wenn sie vorwärts im Wortanlaut stehen und somit
rückwärts zum Wortauslaut werden, aber auch wenn sie rückwärts eine Silbe
auslauten lassen, zum Beispiel bei dem Wort Ge-bor-genheit.
Die weiche Artikulation läßt sich folgendermaßen beschreiben. Bei den Wörtern
Sabine, Lebensfreude, Eber, Rebe, wunderbar und Geborgenheit ist hör-
und spürbar, daß die Lippenspannung beim rückwärts gesprochenen [
b] leicht
abnimmt. Dementsprechend ist bei den Wörtern jeder und Lebensfreude, so-
wie dem Artikel das (aus: Mach das nochmal) bei dem rückwärts gesproche-
nen [
d] die Fläche der Zungenspitze, die die Alveolen berührt, kleiner und die
Spannung in der Zungenspitze geringer.
10
Beim rückwärts gesprochenen [
] ist die weiche Artikulation lediglich hörbar
durch eine zusätzlich nachstehende Aspiration, wie bei den Wörtern Aggressi-
onen, urgemütlich und Ökologie. Die rückwärts gesprochenen Laute [
b] und
[
d] weisen meistens ebenfalls Aspirationen auf, sowohl vorangehend als auch
folgend.
8
Ganz deutlich bei ,,Heidi" zu hören.
9
Bitte überprüfen durch Nach-hören!
10
Bitte selber ausprobieren.
16
Die Wörter Sabine, urgemütlich und Ökologie weisen eine Silbenverschie-
bung auf, weshalb [
b] und [] nicht silbenauslautend, sondern silbenanlautend
sind, worauf ich im Kapitel 5.6 noch eingehe.
Aufgrund der Auslautverhärtung kennen wir im Standarddeutschen, keine aus-
lautenden stimmhaften Plosive. Im Anlaut widerum werden sie lediglich teil-
stimmhaft gebildet, weshalb die weiche und z.T. vollstimmhafte Artikulation
beim Rückwärtssprechen ausgesprochen ungewohnt ist.
4.3 Stimmlose Plosive
Von den stimmlosen Plosiven scheint lediglich das [
p] ein Laut zu sein, der
rückwärts gesprochen am wenigsten Schwierigkeiten bereitet. Deshalb ist er in
meinem Corpus nur in einem Wort und als Affrikat vertreten, nämlich in dem
Wort Strumpf. Er wird wie folgt gebildet:
Die Lippen sind leicht geöffnet, wie beim vorwärts gesprochenen [
p] nach der
Verschlußlösung, Luft wird hörbar angesaugt, wobei die Lippen leicht nach in-
nen gestülpt werden, woraufhin sehr schnell, und mit starker Lippenspannung
der Mundraum verschlossen wird. Es entsteht ein knallend klingender Laut. Die
Zunge liegt die ganze Zeit an den unteren Schneidezähnen und bewegt sich
nicht eigenständig.
Im Gegensatz zu den beiden anderen stimmlosen Plosiven [
t] und [k] wird beim
[
p] vorwärts wie rückwärts ein kompletter Verschluß des Mundraumes gebildet,
weshalb er vermutlich einfacher zu artikulieren ist. Affrikaten, also eine Verbin-
dung von instabilen und stabilen Lauten, werden isoliert gesprochen, ebenso
wie vorwärts.
Das rückwärts gesprochene [
t] wird folgendermaßen gebildet: die Lippen sind
so weit geöffnet wie beim vorwärts gesprochenen [
t] nach der Verschlußlösung,
aber etwas weiter gespreizt
11
, Luft wird hörbar angesaugt, wobei die Zunge aus
der Ruhestellung heraus nach oben schnellt, indem die Zungenspitze mit viel
11
Entsprechend dem vorwärts gesprochenen [
s] oder einem mißglückten Lächeln
17
Kraft und Anspannung an die oberen oder unteren Schneidezähne schlägt. Da-
durch entsteht ein klopfender und knallender Laut.
Das rückwärts gesprochene [
k] unterscheidet sich vom rückwärts gesprochenen
[
t] im wesentlichen durch den Öffnungsgrad des Mundes und dadurch, daß die
Zungenspitze nicht an die unteren Schneidezähne schlägt: die Lippen sind so
weit geöffnet wie beim vorwärts gesprochenen [
k] nach der Verschlußlösung,
Luft wird hörbar angesaugt, wobei die Zunge aus der Ruhestellung heraus nach
oben schnellt, indem die Zungenspitze mit viel Kraft und Anspannung an die
oberen Schneidezähne und Alveolen schlägt. Dadurch entsteht ein klopfender
und knallender Laut.
Das hörbare Luftansaugen ist bei allen rückwärts gesprochenen stimmlosen
Plosiven vorhanden und ergibt auch Sinn. Es hat eine Verstärkerfunktion, und
obwohl dadurch ein größerer Luftverbrauch und auch Energieaufwand entsteht,
würde ich hypothetisch sprechökonomische Gründe vermuten. Denn wenn man
diese Laute spricht, ohne daß die Luft hörbar angesaugt wird, wird die ganze
Konzentration und Energie für die Lippenspannung bzw. für die Kraft in der
Zunge benötigt. Das reicht für die Erzeugung eines knallenden Lautes nicht
aus. Die Intensität des Ansaugens richtet sich nach der Stellung des Plosivs im
Wort sowie nach der individuellen Gewichtung und Bedeutung im Unterschied
zur lexikalischen Bedeutung, sowie nach situativen Bedingungen, die der Plosiv
im jeweiligen Wort-, und Satz-Kontext erhält. Beim Vorwärtssprechen kennen
wir das auch, z.B. wird das [
k] in zum Kotzen viel intensiver artikuliert als in im
Chor, obwohl es beide Male im Anlaut steht. Abgesehen von koartikulatori-
schen Aspekten unterscheiden sich die Ausdrücke stark in ihrem emotinalen
Gehalt, die mit der Äußerung einhergehen bzw. sie verursachen. Genauso ver-
hält es sich mit dem [
t] in Trotz und Tag.
Insgesamt sind die Rückwärts-Plosive am ehesten als eine Kombination von
Saug- und Schlaglaut zu bezeichnen. Daher werde ich sie im folgenden als
Sauglaute bezeichnen. Die drei Transkriptionssymbole der Schnalze (clicks)
habe ich für die Sauglaute verwendet, da es im Deutschen keine Schnalze gibt
und die Symbole von daher nicht doppelt belegt sind oder verwechselt werden
18
können. Bei der Zuordnung habe ich eine annähernde Entsprechung der Artiku-
lationsstelle eines Schnalzes und eines Sauglautes berücksichtigt. Die Verwen-
dung der Symbole sieht folgendermaßen aus:
Der Vorwärts - Plosiv [
p] wird rückwärts gesprochen zum Sauglaut [].
Der Vorwärts - Plosiv [
t] wird rückwärts gesprochen zum Sauglaut [|].
Der Vorwärts - Plosiv [
k] wird rückwärts gesprochen zum Sauglaut [!].
Die Sauglaute [
], [|] und [!] sind nicht wie Schnalze unabhängig von der Ein-
und Ausatmung, sondern können nur exspiratorisch gebildet werden. Trotz des
Ansaugens handelt es sich um einen pulmonal eggressiven Luftstrommecha-
nismus. Die Ausatmung ist ungewöhnlich stoßhaft, vergleichbar mit der Zwerch-
felltätigkeit beim herzhaften Lachen. Im Lautkontinuum gesprochen, ist eine
derartig schnelle Kontraktion der Bauchdeckenmuskeln nur bei Sauglauten zu
spüren. Vorwärts kann man diesen Effekt mit isoliert gesprochenen Lauten
nachahmen, wozu sich das [
s] besonders gut eignet; im Lautkontinuum tritt er
nicht auf.
Die Aspiration der Sauglaute tritt teilweise noch häufiger auf als vorwärts, auf-
grund des schon erwähnten erhöhten Energieaufwandes.
Tritt der Sauglaut
- als Auslaut auf, geht eine Aspiration vorweg
- als Anlaut auf, folgt eine Aspiration
- als Inlaut auf, folgt immer eine Aspiration oder beides
- als Silbenauslaut auf, geht eine Aspiration vorweg oder beides.
4.4 Artikulation im Lautkontinuum
Die Artikulation beim Rückwärtssprechen im Lautkontinuum unterscheidet sich
vom Sprechen isolierter Laute ebenso wie beim Vorwärtssprechen. Man hört
das sehr deutlich bei den Wörtern Treueeid und Trotz. Vorwärts ist das Anlaut-
[
t] intensiver als das Auslaut-[t] und rückwärts ist somit der Auslaut [|] intensiver
als der Anlaut [
|]. Bei Affrikaten, wie bei Trotz [ts] ist das [s] dominanter, da das
[
t] instabil ist und somit nicht die Intensität erreicht wie im Anlaut. Bei [pf] verhält
19
es sich genauso, wie z.B. in dem Wort ,,Pfropfen" [
pfpfn]. Im norddeutschen
Bereich ist sogar häufig das [
p] schon ganz verschwunden, so daß nur noch ein
[
f] artikuliert wird. Bei den Sauglauten sind die Intensitätsunterschiede am auf-
fälligsten, weil es sich um völlig neue Laute handelt, auf die stärker geachtet
wird. Wenn die Sauglaute isoliert gesprochen erstmal eingeübt worden sind,
achtet man als nächsten Schritt auf ihre korrekte Einfügung in das Lautkonti-
nuum
12
. Voraussetzungen dafür sind das Hören und die Rückmeldekreise. Im
Lautkontinuum läßt sich Rückwärtssprechen besser über Hören und die Ki-
nästhesie erlernen statt über detaillierte Artikulationsbeschreibungen
Man könnte versucht sein, Rückwärtssprechen mit dem Erlernen einer Fremd-
sprache zu vergleichen. Dies stimmt aber nicht ganz, da die Semantik und die
Grammatik vollständig herausfallen. Der Vergleich beispielsweise mit einem
fremdsprachig gesungenen Lied kommt den Lernprozessen des Rückwärts-
sprechens viel näher. Bei dem Lied hört man die Musik und die gesungene
Sprache, beim Rückwärtssprechen den Klang des rückwärts Gesprochenen.
Der nächste Schritt ist das Nachahmen, was einhergeht mit ständiger Wieder-
holung, so daß sich der Höreindruck einprägt und der Sprecher versuchen
kann, über unbewußte Wege das Gehörte nachzuahmen. Die sogenannten
Rückmeldekreise sind dafür wichtig. Sie sind Kontrollmechanismen der Selbst-
wahrnehmung: Sowohl über die Luftleitung, sogenannte äußere Schallsignale,
als auch über die Knochen und Gewebsleitung kann der Sprecher sich selber
hören und abgleichen, ob die Artikulation übereinstimmt mit dem Gehörten ei-
nes anderen Sprechers.
Die innerkörperlichen Rückmeldungen stellen sowohl eine bewußte als auch
eine unbewußte Form der Selbstwahrnehmung gesprochener Sprache dar. Die
innerkörperliche Selbstwahrnehmung von Bewegungen und Einstellungen der
Sprechorgane nennt man Kinästhesie oder kinästhetische Empfindungen, und
diese sind bewußt wahrnehmbar. Die kinästhetischen Empfindungen werden
ermöglicht durch Sensoren mit afferenten Nervenfasern in den Sprechorganen,
,,... die taktile Reize oder diesen ähnliche Reize zum Gehirn leiten."
13
12
Dies sind meine eigenen Erfahrungen und auch Beobachtungen bei B.W.
13
Pétursson, 1996, S. 41
20
Der unbewußte propriozeptive Rückmeldeweg läuft über die propriozeptiven
Rezeptoren, die in den Muskelfasern der inneren Kehlkopfmuskeln sowie in den
Zungenmuskeln zahlreich vorhanden sind. Über sie werden körpereigene Reize
aufgenommen und dem Gehirn zurückgemeldet.
Mit diesen Kontrollmechanismen ausgestattet, kann man Rückwärtssprechen
durch Nachahmen einüben, und Vergleiche abpassen, bis man korrekt Rück-
wärtssprechen kann. Mit Ausnahme der Sauglaute ist das Erlernen rückwärts
gesprochener isolierter Laute nicht nötig, da das sprachliche Material
gleichbleibt. Außerdem ist gesprochene Sprache grundsätzlich ein Lautkonti-
nuum und sollte als solches erlernt werden. Die Sauglaute sollten aufgrund ih-
rer Neuheit erst isoliert eingeübt und dann in das Lautkontinuum eingefügt wer-
den.
Um von Anfang an motiviert Rückwärtssprechen zu lernen, sollte man zunächst
mit einfachen Wörtern, d.h. Wörtern, die keine Plosive haben und einsilbig sind,
anfangen, z.B. die Wörter mich, dich, mach, ja, sich dann mit zweisilbigen
Wörtern, wie z.B. nochmal, Sinne, und schlafen und schließlich Dreisilbigen,
wie z.B. Sabine steigern. Wenn man die Wortebene verläßt und auf die Satz-
ebene geht, sollte man mit kurzen Sätzen, die aus zwei bis drei Wörtern beste-
hen, anfangen, um sich dann zu steigern.
B.W. hat das Prinzip ,vom Kleinen zum Großen` ebenfalls angewandt, seine
Kontrollmechanismen genutzt und trainiert Rückwärtssprechen beständig durch
kontinuierliche Wiederholungen. Seine zusätzliche und bewußte Methode zum
Erlernen und Erinnern von Rückwärtssprechen, ist im Kapitel 6 ausführlicher
beschrieben.
Um den Leser zu motivieren, selber einige Wörter rückwärts zu sprechen, be-
schreibe ich die Artikulation des Wortes mach mit Hilfe einer Metapher, denn:
,,Wir wissen aus der sprachpädagogischen Praxis, daß der Versuch die Aus-
sprache eines Kindes oder eines Erwachsenen durch direkten Hinweis auf die
Lage der Sprechwerkzeuge", zu steuern, ,,oft erfolglos bleibt. Wenn wir jedoch
(diesmal zielbewußt) zu den Metaphern der Grammatiker zurückgreifen und
eine härtere oder mehr lockere Aussprache, hellere Vokale usw. fordern, so
kommen wir auf diesem Umweg zumeist schneller ans Ziel."
14
14
Fónagy, 1963, S. 105
21
Das Wort mach: man gähne herzhaft (man kann Gähnen jederzeit auslösen,
indem man die Zunge ca. 5 bis 6 sec. gegen das Velum preßt) und sowie die
Ausatmungsphase beginnt, formuliert sich das Wort mach rückwärts [
am] fast
von alleine, da die Bewegung des ersten Lautes [
] bis zum [m] der Bewegung
des Gähnens entspricht, vom weit geöffneten Mund bis zur Schließung des
Mundes.
4.5 Geschriebene und gesprochene Sprache
,,Sprache begegnet uns hauptsächlich in zwei Formen: als gesprochene Spra-
che oder als geschriebene Sprache."
15
Da die gesprochene Sprache für die
meisten Menschen so selbstverständlich ist, ist es nicht verwunderlich, daß ich
beim Erlernen des Rückwärtssprechens beobachten konnte, wie die meisten
Leute versuchen, mit Hilfe der geschriebenen Sprache zum Ziel zu kommen.
Wie in dem folgenden Kapitel der zeitlichen Analyse gezeigt wird, aber auch
vorab für jeden Phonetiker erkennbar und voraussehbar ist, funktioniert das
nicht. Historisch und ontogenetisch betrachtet liegt eine Abhängigkeit der
Schriftsprache von der Sprechsprache vor, dennoch sind geschriebene und
gesprochene Sprache zwei unterschiedliche Systeme der Sprache; sie sind
eigenständig und auch gleichwertig.
16
Ich möchte betonen, daß meiner Meinung nach weder die eine noch die andere
besser oder schlechter ist. Beide Systeme haben Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede, vor allem in ihrer Funktion, aber auch in ihrer äußeren Erscheinung.
Während die geschriebene Sprache mittels des Seh- und Tastsinns manifestiert
wird und somit von Dauer ist, zeitlich unabhängig und eine räumliche Verbrei-
tung gewährleistet, ist die gesprochenen Sprache ,flüchtig`. Sie ist nur so lange
vorhanden, wie die Schallwelle andauert.
17
Sie ist an die Zeit gebunden, sofern
es sich nicht um eine Aufzeichnung handelt.
15
Pétursson, 1996, S. 13
16
Löffler, 2000, S. 59,
17
Löffler, 2000, S. 59
22
Gesprochene Sprache findet meistens dialogisch statt, so daß die zeitliche
Komponente im Vergleich der Verständnissicherung nicht relevant ist, da man
nachfragen kann, wenn man etwas nicht verstanden hat.
Da bis auf wenige Ausnahmen die Aussprache von B.W. der Standardlautung
folgt und die norddeutschen Einfärbungen nicht direkt als ein Dialekt, höchstens
als eine Varietät, ein norddeutsches Sprechregister bezeichnet werden können,
werden die Dialekte innerhalb dieser Arbeit ausgeklammert.
Die Gemeinsamkeiten von geschriebener und gesprochener Sprache sind ihre
gegenseitige Beeinflussung und ihre Beziehung zum Denken. Die wichtigste
Funktion der beide Systeme ist die der Verständigung und der Kommunikation.
Anhand von Palindromen, die vom Publikum oft vorgeschlagen werden, in der
Annahme sie klängen rückwärts ebenso wie vorwärts, was natürlich nicht sein
kann, wie Transkriptionen sofort zeigen, wird der Unterschied nochmal deutlich.
Deshalb habe ich drei Palindromwörter in meinem Corpus aufgenommen.
23
5. Die zeitliche Analyse
Ohne
Sprache
keine
Zeit
Oskar Pastior
Mit Hilfe des Sonagraphen habe ich jeweils vorwärts und rückwärts die Dauer
der ganzen Sätze, sowie auch die Dauer der ganzen Wörter und die der einzel-
nen Sprechsegmente der Wörter gemessen.
Aufgrund des auditiven Eindruckes ließ sich von Anfang an vermuten, daß
Rückwärtssprechen von längerer Dauer ist als Vorwärtssprechen. Die Messun-
gen haben diesen Eindruck weitgehend und wesentlich differenzierter bestätigt.
Die Ergebnisse der zeitlichen Messungen habe ich unter folgenden Gesichts-
punkten betrachtet:
- Vergleich der Dauer des gesamten Wortes bzw. des gesamten Satzes,
bei den Einzelsegmenten der Wörter:
- Vergleich der An- und Auslaute innerhalb eines vorwärts gesprochenen
Wortes
- Vergleich der An- und Auslaute innerhalb eines rückwärts gesprochenen
Wortes
- Vergleich vorwärts und rückwärts gesprochener An- und Auslaute
- Vergleich vorwärts und rückwärts gesprochener Inlaute
An dieser Stelle möchte ich bemerken, daß sich aufgrund des Umfangs die ge-
messenen Daten in tabellarischer Form im Anhang befinden, mit Ausnahme der
folgenden drei Wörter und Sätze:
24
Otto
Dauer des gesamten Wortes: 0,5875 sec. / 1,009 sec.
18
Vorwärts Dauer
in
ms
Rückwärts
Dauer
in
ms
118,7
250
t
93,75
315,6
87,5
|
203
o
287,5
o
240,6
Sinne
Dauer des gesamten Wortes: 0,6500 sec. / 0,7125 sec.
Vorwärts Dauer
in
ms
Rückwärts
Dauer
in
ms
z
234,4
z
281,3
68,75
193,7
n
131,2
n
181,2
215,6
56,25
18
Der erste Zahlenwert ist im folgenden immer der Vorwärtswert, der zweite der Rückwärtswert.
25
Hexerei
Dauer des gesamten Wortes: 0,9063 sec. / 1,056 sec.
Vorwärts Dauer
in
ms
Rückwärts
Dauer
in
ms
h
46,88
h
93,75
50
115,6
k
78,13
/
34,38
21,88
71,87
40,62
68,75
s
131,2
s
143,7
59,37
93,75
146,9
75
a
146,9
a
153,1
i
225
i
165,6
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783832461409
- ISBN (Paperback)
- 9783838661407
- DOI
- 10.3239/9783832461409
- Dateigröße
- 35.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hamburg – Sprachwissenschaften, Phonetik, Allgemeine Sprachwissenschaft und Indogermanistik
- Erscheinungsdatum
- 2002 (November)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- kinäthesie phonotaktik koartikulation metaphern synästhesie
- Produktsicherheit
- Diplom.de