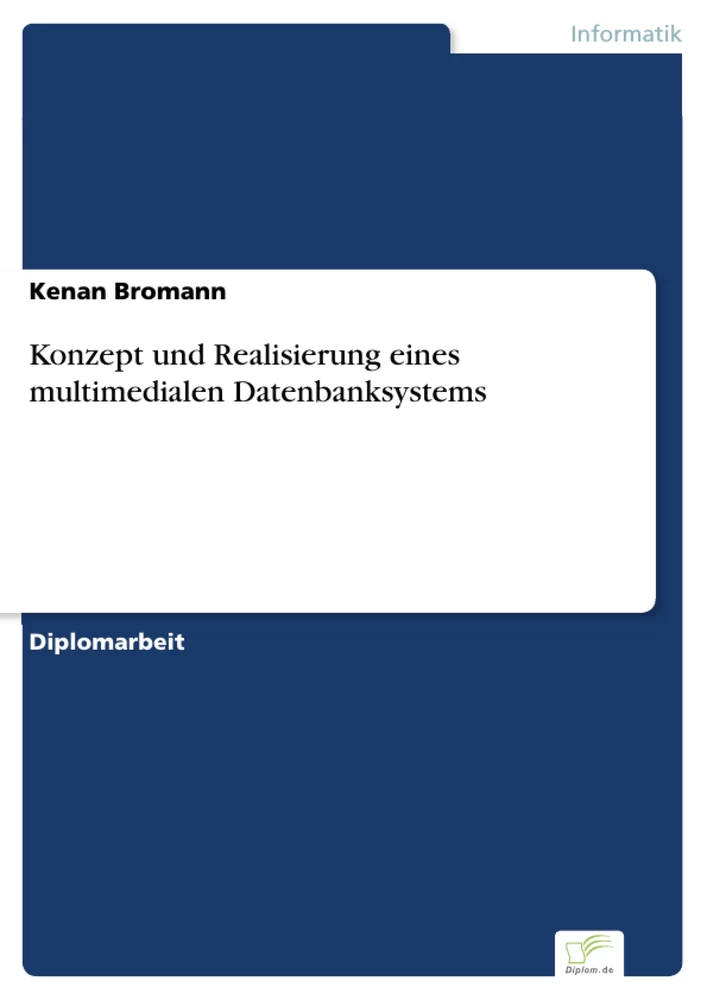Konzept und Realisierung eines multimedialen Datenbanksystems
©2002
Diplomarbeit
96 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Konzeption und der Realisierung eines multimedialen Datenbanksystems mit Hilfe der Werkzeuge der Unified Modeling Language (UML) und unter Verwendung eines mehrschichtigen Anwendungssystems. Der Prototyp wurde als Server-Applikation unter C++ entwickelt.
Das erste Kapitel widmet sich allgemeinen Fragen zu Multimedia und deren Archivierung, sowie einer Marktübersicht über beispielhafte Mediendatenbanken, im Anschluss folgt eine kurze Einführung in die verwendeten Methoden und Konzepte.
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Projektdefinition, die für die Realisierung eines komplexen Projektes, wie einer Diplomarbeit, erforderlich ist. Hier werden die Ziele und Möglichkeiten der Realisierung innerhalb dieser Arbeit behandelt.
In den Kapiteln drei und vier wird auf die einzelnen Methoden der UML, die zur Konzeption herangezogen wurden, näher eingegangen. Der Aufbau der Datenstruktur sowie die Auswahl einer geeigneten Datenbank werden beschrieben.
Kapitel fünf enthält die Ausführungen zur Realisierung des Prototyps. Dabei werden die einzelnen Komponenten des Systems und deren Funktion beschrieben und erläutert.
Das letzte Kapitel enthält eine abschließende Zusammenfassung über den Verlauf des Projektes. Es werden Probleme und Erfahrungen angesprochen und ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen des Systems gegeben.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einführung7
1.1Medienarchive7
1.1.1Medien und Multimedia7
1.1.2Archivierung von Medien10
1.1.3Probleme und Anforderungen der Archivierung11
1.1.4Unterschiede in der Archivierbarkeit12
1.1.5Vorteile digitaler Speicherung in einer Datenbank14
1.1.6Marktübersicht von Mediendatenbanken15
1.2Die Unified Modeling Language (UML)16
1.2.1Eigenschaften der Unified Modeling Language16
1.2.2Vorteile der Modellierung16
1.3Datenbanken17
1.3.1Geschichte und Übersicht über verschiedene Datenbanktypen17
1.3.2Relationale und Objektorientierte Datenbanken18
1.3.3Vorteile der relationalen Datenbank19
2.Projektdefinition20
2.1Situationsanalyse20
2.1.1Nutzergruppen21
2.2Ziele22
2.2.1Ziele des Datenbanksystems22
2.2.2Erfolgskriterien23
2.2.3Abgrenzungen23
2.3Rahmenbedingungen24
2.3.1Ressource Zeit24
2.3.2Ressource Material24
2.4Projektplanung25
2.4.1Aktivitäten25
3.Unified Modeling Language (UML)28
3.1Use-Case-Modell28
3.2Klassendiagramme29
3.3Sequenzdiagramme30
4.Datenbankdesign32
4.3SQL - […]
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Konzeption und der Realisierung eines multimedialen Datenbanksystems mit Hilfe der Werkzeuge der Unified Modeling Language (UML) und unter Verwendung eines mehrschichtigen Anwendungssystems. Der Prototyp wurde als Server-Applikation unter C++ entwickelt.
Das erste Kapitel widmet sich allgemeinen Fragen zu Multimedia und deren Archivierung, sowie einer Marktübersicht über beispielhafte Mediendatenbanken, im Anschluss folgt eine kurze Einführung in die verwendeten Methoden und Konzepte.
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Projektdefinition, die für die Realisierung eines komplexen Projektes, wie einer Diplomarbeit, erforderlich ist. Hier werden die Ziele und Möglichkeiten der Realisierung innerhalb dieser Arbeit behandelt.
In den Kapiteln drei und vier wird auf die einzelnen Methoden der UML, die zur Konzeption herangezogen wurden, näher eingegangen. Der Aufbau der Datenstruktur sowie die Auswahl einer geeigneten Datenbank werden beschrieben.
Kapitel fünf enthält die Ausführungen zur Realisierung des Prototyps. Dabei werden die einzelnen Komponenten des Systems und deren Funktion beschrieben und erläutert.
Das letzte Kapitel enthält eine abschließende Zusammenfassung über den Verlauf des Projektes. Es werden Probleme und Erfahrungen angesprochen und ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen des Systems gegeben.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einführung7
1.1Medienarchive7
1.1.1Medien und Multimedia7
1.1.2Archivierung von Medien10
1.1.3Probleme und Anforderungen der Archivierung11
1.1.4Unterschiede in der Archivierbarkeit12
1.1.5Vorteile digitaler Speicherung in einer Datenbank14
1.1.6Marktübersicht von Mediendatenbanken15
1.2Die Unified Modeling Language (UML)16
1.2.1Eigenschaften der Unified Modeling Language16
1.2.2Vorteile der Modellierung16
1.3Datenbanken17
1.3.1Geschichte und Übersicht über verschiedene Datenbanktypen17
1.3.2Relationale und Objektorientierte Datenbanken18
1.3.3Vorteile der relationalen Datenbank19
2.Projektdefinition20
2.1Situationsanalyse20
2.1.1Nutzergruppen21
2.2Ziele22
2.2.1Ziele des Datenbanksystems22
2.2.2Erfolgskriterien23
2.2.3Abgrenzungen23
2.3Rahmenbedingungen24
2.3.1Ressource Zeit24
2.3.2Ressource Material24
2.4Projektplanung25
2.4.1Aktivitäten25
3.Unified Modeling Language (UML)28
3.1Use-Case-Modell28
3.2Klassendiagramme29
3.3Sequenzdiagramme30
4.Datenbankdesign32
4.3SQL - […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6097
Bromann, Kenan: Konzept und Realisierung eines multimedialen Datenbanksystems
Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Kiel, Fachhochschule, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Abstract
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Konzeption und der Realisierung eines multimedialen
Datenbanksystems mit Hilfe der Werkzeuge der Unified Modeling Language (UML) und
unter Verwendung eines mehrschichtigen Anwendungssystems. Der Prototyp wurde als
Server-Applikation unter C++ entwickelt.
Das erste Kapitel widmet sich allgemeinen Fragen zu Multimedia und deren Archivierung,
sowie einer Marktübersicht über beispielhafte Mediendatenbanken, im Anschluss folgt eine
kurze Einführung in die verwendeten Methoden und Konzepte.
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Projektdefinition, die für die Realisierung eines
komplexen Projektes, wie einer Diplomarbeit, erforderlich ist. Hier werden die Ziele und
Möglichkeiten der Realisierung innerhalb dieser Arbeit behandelt.
In den Kapiteln drei und vier wird auf die einzelnen Methoden der UML, die zur Konzeption
herangezogen wurden, näher eingegangen. Der Aufbau der Datenstruktur sowie die Auswahl
einer geeigneten Datenbank werden beschrieben.
Kapitel fünf enthält die Ausführungen zur Realisierung des Prototyps. Dabei werden die
einzelnen Komponenten des Systems und deren Funktion beschrieben und erläutert.
Das letzte Kapitel enthält eine abschließende Zusammenfassung über den Verlauf des
Projektes. Es werden Probleme und Erfahrungen angesprochen und ein Ausblick auf
mögliche Weiterentwicklungen des Systems gegeben.
Danksagung
Diese Diplomarbeit bildet den Abschluss eines mehrjährigen Studiums an der
Fachhochschule Kiel. Ich möchte mich an dieser Stelle bei all denjenigen bedanken, die mich
während meines Studiums begleitet und bei der Durchführung dieser Arbeit unterstützt
haben.
Als Erstes möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken, die mit ihrer Unterstützung mein
Studium erst ermöglicht haben. Außerdem möchte ich hier Julia Bittkowski danken, die es
immer wieder geschafft hat, mir ihr Vertrauen zu schenken und mir geholfen hat, das
Vertrauen in mich selbst nicht zu verlieren.
Bei Herrn Eduard Thomas möchte ich mich bedanken, der meine Begeisterung für das
Planetarium erweckt hat und meine Entscheidung so zu dem Studium ,,Multimedia
Production" an der Fachhochschule maßgeblich beeinflusst hat. Ebenso gilt mein Dank allen
Mitarbeitern des Planetariums für ihre Ideen und Anregungen, die mich erst zum Thema
dieser Diplomarbeit geführt haben.
Ganz besonders möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Ulrich Samberg bedanken, der
durch seine praktischen Tipps und seine Betreuung zum Erfolg der Arbeit beitrug.
Weiterhin möchte ich mich bei Oliver Arp, Wilhelm Ermgassen und Onno Kortmann
bedanken, die sich die Zeit für eine Korrektur der Arbeit genommen haben.
Inhaltsübersicht
41
4.5 Aufbau der Tabellenstruktur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
4.4 Metadaten für verschiedene Medientypen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
4.3.2 Vorteile von SQL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
4.3.1 historische Entwicklung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
4.3 SQL - Vorteile einer standardisierten Abfragesprache
. . . . . . . . . . . . . . .
32
4 Datenbankdesign
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
3.3 Sequenzdiagramme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
3.2 Klassendiagramme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
3.1 Use-Case-Modell
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
3 Unified Modeling Language (UML)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2.4.1 Aktivitäten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2.4 Projektplanung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
2.3.2 Ressource Material
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
2.3.1 Ressource Zeit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
2.3 Rahmenbedingungen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
2.2.3 Abgrenzungen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
2.2.2 Erfolgskriterien
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
2.2.1 Ziele des Datenbanksystems
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
2.2 Ziele
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
2.1.1 Nutzergruppen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2.1 Situationsanalyse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2 Projektdefinition
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
1.3.3 Vorteile der relationalen Datenbank
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
1.3.2 Relationale und Objektorientierte Datenbanken
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
1.3.1 Geschichte und Übersicht über verschiedene
Datenbanktypen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
1.3 Datenbanken
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
1.2.2 Vorteile der Modellierung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
1.2.1 Eigenschaften der Unified Modeling Language
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
1.2 Die Unified Modeling Language (UML)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
1.1.6 Marktübersicht von Mediendatenbanken
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
1.1.5 Vorteile digitaler Speicherung in einer Datenbank
. . . . . . . . . . . . . . . . .
12
1.1.4 Unterschiede in der Archivierbarkeit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
1.1.3 Probleme und Anforderungen der Archivierung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1.1.2 Archivierung von Medien
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.1.1 Medien und Multimedia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.1 Medienarchive
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1 Einführung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
65
Anhang F Quelltexte der Programme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Anhang E Klassendiagramme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Anhang D Sequenzdiagramme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Anhang C Kommunikationsprotokoll
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Anhang B Abbildungsverzeichnis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Anhang A Literaturverzeichnis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
6.2 Ausblick
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
6.1 Rückblick
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
6 Zusammenfassung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
5.4 Skalierbarkeit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
5.3.4 Ablauf der Realisierung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
5.3.3 Datenbankanbindung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5.3.2 Socket-Kommunikation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5.3.1 Die Serverapplikation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5.3 Server-Umsetzung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
5.2 Web-Frontend
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
5.1 Gesamtsystem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
5. Realisierung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1 Einführung
In diesem Kapitel werden allgemeine Fragen zu Medien und Medienarchiven geklärt.
Im Anschluss erfolgt eine kurze Übersicht über die Unified Modeling Language (UML)
und Datenbanken.
1.1 Medienarchive
1.1.1 Medien und Multimedia
Der Begriff ,,Medien" trägt sehr vielfältige Bedeutungen. Im Lexikon ist folgende
Definition zu finden:
Medien:
Kommunikationsmittel zur Vermittlung von Informationen durch Druck,
Bild, Ton oder audiovisuell; i. e. S. die Massenmedien (Multimedia,
neue Medien).[/Brockhaus 3]
Medien lassen sich in Perzeptions-, Präsentations-, Repräsentations-, Speicher-,
Informationsaustausch- und Übertragungsmedien klassifizieren [/Steinmetz 11/S.8]:
Perzeptionsmedien beschreiben die Informationsaufnahme des Menschen. Zurzeit sind
dies primär visuelle (Text, Bild und Video/Animation) und auditive (Musik, Geräusch
und Sprache) Medien. Medien, die andere Sinne des Menschen ansprechen wie zum
Beispiel den Tastsinn (haptisch) oder den Geruchssinn (olfaktorisch), sind noch nicht
marktreif.
Präsentationsmedien sind Hilfsmittel zur Ein- und Ausgabe von Informationen. So
gehören zum Beispiel die Medien Papier, Bildschirm und Lautsprecher zu den
Ausgabemedien, Tastatur, Kamera und Mikrophon sind Beispiele für Eingabemedien.
Repräsentationsmedien kennzeichnen die Art der Informationskodierung im
Computer. Texte können zum Beispiel in ASCII
1
kodiert sein, Bilder im JPEG
2
-Format,
Videos im MPEG
3
-Format und Musik kann im WAVE
4
-Format gespeichert werden.
6
4
Standard-Dateiformat für Audio von Microsoft
3
Dateiformat der Moving Picture Experts Group für Videos
2
Dateiformat der Joint Pictures Expert Group für Bilder
1
American Standard Code for Information Interchange
Speichermedien sind die Medien, in denen Informationen gespeichert werden. Dazu
gehören neben den digitalen Medien wie Diskette, CD oder Festplatte im Computer,
auch Medien wie Papier oder VHS
5
-Kassetten.
Medien, die die Informationen zum Rezipienten weiterleiten, nennt man
Übertragungsmedien. Die Übertragung kann zum Beispiel durch Kabel
(Koaxialkabel, Glasfaser) bei digitaler Übertragung oder durch die Luft bei
Funkverkehr geschehen. Bei Übertragungsmedien muss ein kontinuierlicher
Informationsfluss stattfinden. Eine Brieftaube, die einen Brief transportiert, ist nach
dieser Definition kein Übertragungsmedium, da kein Informationsfluss statt finden
kann.
Informationsaustauschmedien bezeichnen die Vereinigung von Speicher- und
Übertragungsmedien, ein kontinuierlicher Informationsfluss ist bei dieser Definition
nicht erforderlich. Es kann zum Beispiel eine CD mit Informationen verschickt werden.
Dabei handelt es sich dann um ein Informationsaustauschmedium .
Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff ,,Medium" für Repräsentationsmedien im
Computer verwendet, also Dateien unterschiedlicher Formate, die visuelle, auditive
oder audiovisuelle Informationen enthalten.
,,Multimedia" ist ein Kompositum aus ,,multi" und ,,media". ,,Multi" kommt vom dem
lateinischen Wort ,,multus" und bedeutet ,,viel, vielfach". ,,Media" ist ein englischer
Begriff für Medien, der ursprünglich vom lateinischen Begriff ,,medium" stammt, das
für ein vermittelndes Element steht (wörtlich: ,,das in der Mitte Befindliche").
,,Multimedia" bedeutet wortwörtlich nichts anderes als ,,viele Medien".
Im Lexikon ist folgende Definition zu finden:
Multimedia [lat.],
1) allgemein: aufeinander abgestimmte Verwendung versch. Medien,
Medienverbund.
7
5
VHS = video home system
2) Computertechnik, Informatik: Zusammenwirken versch. Medientypen
(Texte, Bilder, Grafiken, Töne, Filme, Animationen) in einem
M.-System, in dem Informationen empfangen, gespeichert, präsentiert
und verarbeitet werden können. [/Brockhaus 3]
Danach wäre bereits ein Buch mit Bildern oder ein Film mit Sprache Multimedia. Diese
Definition reicht also zur Beschreibung von Multimedia nicht aus. Nicht jede
Kombination von Medien ergibt eine multimediale Anwendung. Medien lassen sich in
Bezug auf ihre zeitliche Komponente in zwei Klassen unterteilen:
a) Ein Medium wird als zeitunabhängig oder diskret bezeichnet, wenn seine
Verarbeitung zeitunkritisch ist. Bei Text, Grafik oder Bildern ist der Zeitpunkt der
Betrachtung nicht entscheidend, zu jeder Zeit werden dieselben Informationen durch ein
Bild vermittelt.
b) Ein Medium wird als zeitabhängig oder kontinuierlich bezeichnet, wenn seine
darzustellenden Informationen auch durch den zeitlichen Verlauf ihres Auftretens
bestimmt werden. Der Zeitpunkt der Betrachtung spielt bei Medien wie Video,
Animation oder Musik eine große Rolle, die übermittelten Informationen wechseln bei
einem Video zum Beispiel mehr als 25 Mal pro Sekunde.
Nach [/Steinmetz 11/S. 14] wird erst von Multimedia gesprochen, wenn mindestens ein
kontinuierliches und ein diskretes Medium vorhanden ist. Außerdem muss eine
multimediale Anwendung auf Eingaben des Benutzers reagieren, also interaktiv sein.
Als Beispiel kann hier eine Lernsoftware genannt sein, die auf die Eingaben des
Benutzers reagiert.
In der Praxis werden Multimedia-Anwendungen und multimediale Komponenten in den
verschiedensten Bereichen eingesetzt: zum Beispiel Werbung/Produktpräsentation
(POI/POS
6
), Unterhaltung (Spiele), Internet (Online-Shops), Weiterbildung
(CBT/WBT
7
), CD-ROM-Anwendungen (Interaktive Reiseführer etc.).
8
6
Point of Interest/ Point of Sale: Präsentations- und Kiosksystem, an dem Kunden
Informationen, Dienstleistungen oder Waren präsentiert oder zum Kauf angeboten
Die Basis für fast jede Multimedia-Anwendung bildet der Computer, der die Steuerung
der einzelnen Medien durchführt. Daher liegen die meisten Medien digital im Computer
vor. So bilden einige wenige Dateiformate die Grundlage für Multimedia. Für Bilder,
Ton und Video existieren einige Dateiformate, die so weit verbreitet sind, dass andere
Formate kaum Verwendung finden.
1.1.2 Archivierung von Medien
Die ersten Medien wurden in Form von Keilschrifttafeln von den Babyloniern (ca. 4000
v.Chr.) erstellt. Im Laufe der Geschichte wurden diese durch Papyrus-Rollen (Ägypter
um 2500 v.Chr.) ersetzt und später durch Pergament (Griechen um 600 v.Chr.)
abgelöst. In dieser Zeit wurden die Schriften um Illustrationen erweitert. Das Buch hielt
dann im Mittelalter Einzug in die Bibliotheken von Klöstern und Schlössern. Der
Durchbruch in der Verbreitung von Medien begann mit der Erfindung der
Druckerpresse von Johannes Gutenberg (1397-1468).
In den darauffolgenden Jahrhunderten gewannen Bücher als Informationsträger immer
mehr an Bedeutung, bis sie im 20. Jahrhundert durch neue Medien ergänzt und
zunehmend verdrängt wurden. Die Einführung der Schallplatte und später der
Musikkassette (MC
8
) verhalf den Tonträgern zu weiter Verbreitung. Ab 1982 wurde die
Compact Disc (CD) als erstes digitales Medium eingeführt und löste die analogen
Tonträger weitgehend ab.
Im Bereich des bewegten Bildes ist die Entwicklung ähnlich. Die weit verbreitete VHS
Kassette wird durch die digitale DVD
9
abgelöst.
In den letzten Jahren entstanden zu diesen Medien noch die sogenannten multimedialen
Anwendungen, also Kompositionen aus verschiedenen Medien, wie zum Beispiel
interaktive Informationssäulen in Flughäfen, Bahnhöfen etc..
9
9
digital versatile disc
8
music cassette
7
Computer Based Training / Web Based Training: Schulungsysteme auf einem
Computer oder über das Internet
werden.
Seit der Entstehung der ersten Medien hat es zu jeder Zeit auch Systeme zur
Archivierung und Aufbewahrung gegeben. Keilschrifttafeln wurden zum Beispiel in der
Palästen der Herrscher in separaten Archivkammern aufbewahrt. Die Bibliotheken von
Klöstern wurden von Mönchen verwaltet, die die Aufgabe hatten, den gesamten
Bestand zu pflegen und die Übersicht über die Bücher bewahren. Sie waren also dafür
verantwortlich, dass Bücher leicht zu finden waren und sich in einem ordentlichen
Zustand befanden.
Je umfangreicher die Bibliotheken im Laufe der Zeit wurden, desto wichtiger war es,
die Bücher systematisch zu ordnen. Die Systematik der Ordnung einer Bibliothek hat
sich im Laufe der Jahrhunderte immer weiter entwickelt.
Ab Mitte der 80er Jahre hat die EDV
10
einen wichtigen Beitrag zu der Archivierung von
Medien geleistet. Der Computer ermöglicht es, den Bestand nach bestimmten
Stichworten zu durchsuchen, um so das Archiv effektiver nutzen zu können.
Bei der Suche nach einem speziellen Autor zeigt der Computer alle Bücher dieses
Autoren und den genauen Aufbewahrungsort der einzelnen Titel an. Nun kann die
Suche zum Beispiel nach Stichworten eingeschränkt werden, bis ein Buch gefunden
wird, das diese Kriterien erfüllt.
1.1.3 Probleme und Anforderungen der Archivierung
Ein Archiv ist eine geordnete indizierte Sammlung von Medien. Der Zweck eines
Archivs ist die Aufbewahrung und der einfache Zugriff auf die archivierten Medien.
Dazu ist eine bestimmte Sortierung zum Beispiel nach Autor/Urheber o.ä. notwendig.
Außerdem ist es sinnvoll, Indizes zu erstellen, in denen nach Schlagwörtern gesucht
werden kann. Je größer der Umfang des Bestandes ist, desto wichtiger ist die Erfassung
des Bestandes im Computer, da nur so eine schnelle Suche durchgeführt werden kann.
10
10
elektronische Datenverarbeitung
1.1.4 Unterschiede in der Archivierbarkeit
Es gibt heutzutage zwei grundlegend unterschiedliche Möglichkeiten ein Archiv zu
eröffnen. Man kann entweder ein herkömmliches Archiv anlegen, in dem Medien wie
Videobänder, Bücher oder Musikkassetten archiviert werden, oder ein vollständig
digitales Archiv anlegen, in dem Filme, Musik, Bilder und Texte als Computerdateien
vorliegen. Die Art des Archivs hängt natürlich in erster Linie von den zu archivierenden
Objekten ab.
In beiden Fällen ist es möglich, die Bestände zu sortieren und Indizes zu erstellen oder
die Daten über die Medien per Computer zu verwalten. Bei vollständig digitalen
Archiven liegt es nahe, die Erfassung und Verwaltung der Medien im Computer zu
verwirklichen.
Die häufigste Anwendung wird sicherlich ein Gemisch aus beiden Formen der
Archivierung darstellen. Daher wird hier speziell auf die Verwaltung der Medien im
Computer in einem gemischten Archiv eingegangen.
Für jedes Medium gibt es einen Datensatz in dem Metadaten, also Daten über das
Medium, gespeichert sind. So sollte man zum Beispiel zu einem Text den Autor und
das Erscheinungsjahr zu speichern, bei einem Video ist weiterhin die Länge des Films
interessant. So gibt es zu jedem Medientyp einige charakterisierende Merkmale, die
sinnvoll zu speichern sind.
Ich werde auf die vier zurzeit wichtigsten Medien eingehen:
Text:
Unter dem Begriff ,,Text" wird in dieser Arbeit das geschriebene Wort.
verstanden Texte sind in der Regel Aneinanderreihungen von Sätzen. Es gibt
eine Vielzahl von möglichen Anwendungsfeldern von Texten: von
Gesprächsnotizen über Kochrezepte bis hin zu Büchern. Texte können sowohl
digital im Computer in Form von Textdateien von jedem
Textverarbeitungsprogramm, als auch physikalisch in Form von gedruckten
Büchern, Aufsätzen etc., existieren.
In jedem Fall gibt es eine Reihe von Informationen, die typisch für das Medium
Text sind. Hierzu zählen Informationen über den Autor, über die Art des Textes
11
(zum Beispiel ob es eine wissenschaftliche Abhandlung oder ein Roman ist),
über den Umfang des Textes, die Sprache usw. .
Außerdem ist interessant, in welcher Form der Text gespeichert ist. Auch dabei
gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, zum Beispiel kann er gedruckt als Buch
vorliegen oder als PDF
11
-Datei im Computer.
Bild:
Unter Bild wird hier ein grafisches Element verstanden. Es gibt eine große
Anzahl von Anwendungsfällen, die Bilder verwenden oder enthalten. Zum
Beispiel gehört dazu jede Fotografie, jede Grafik, jedes Gemälde oder jede
Skizze. Bilder können also real als Gemälde oder Zeichnungen auf Papier,
Leinwand oder aber digital im Computer vorliegen, wie zum Beispiel in Form
von JPEG-Dateien.
Bei Bildern gibt es ebenfalls eine Reihe von spezifischen Metainformationen.
Hierzu gehören Informationen über die Art des Bildes (Gemälde, Foto,
Zeichnung, etc.), über den Urheber, über das Motiv des Bildes, sowie bei
digitalen Bildern die Art der Kompression usw..
Audio:
Unter Audio versteht man jede Art von gespeicherten Tönen. Als Beispiel seien
hier die Audio-CD mit Musik genannt oder ein Tonband mit einem Interview.
Metainformationen bei auditiven Medien sind zum Beispiel Art des
Audiobeitrages (zum Beispiel klassische Musik, Geräusche einer
Dampflokomotive etc.), die Länge des Beitrages und der Urheber, außerdem
sind technische Informationen wie die Qualität der Aufnahme (Beispiel: CD mit
44,1 kHz Sampling oder
analoges Tonband) interessant.
Video:
Als Video bezeichnet man alle Kombinationen von bewegten Bildern. Als
Beispiele können hier der klassische Spielfilm, Computeranimationen sowie
Powerpointpräsentationen dienen. Metainformationen, die speziell für das
Medium Video gelten, sind zum Beispiel die Art der bewegten Bilder
12
11
Portable Document Format
(Spielfilm, Animation, etc.), oder die Art der Kodierung im Computer (MPEG,
AVI
12
oder Quicktime
13
).
1.1.5 Vorteile digitaler Speicherung in einer Datenbank
Das Speichern der Metainformationen in einer Datenbank bietet einige gravierende
Vorteile gegenüber der nicht digitalen Speicherung in Karteikästen.
Mit Hilfe des Computers ist es leichter möglich, im Datenbestand zu recherchieren und
Medien auszuwählen, die dem Gesuchten am nächsten kommen. Vor allem die
Verknüpfung von mehreren Suchbegriffen ermöglicht eine zielgenaue und schnelle
Recherche.
Ein weiterer Vorteil besteht in der Einfachheit der Verwendung von Querverweisen. So
kann man beispielsweise zu den Metainformationen eines Spielfilmes einen Verweis
auf das zugehörige Buch speichern. Dies ermöglicht eine effektivere Recherche im
Archiv.
Durch die Möglichkeiten des Internets ist es technisch ebenfalls realisierbar, die
Recherche von jedem Computer der Welt über das Internet durchzuführen, wodurch es
zum Beispiel möglich ist, von zu Hause in sämtlichen Bibliotheken der Welt nach
einem bestimmten Buch zu recherchieren.
Ein wesentlicher Vorteil der digitalen Speicherung ist die einfache Möglichkeit die
Daten zu sichern. Eine Datensicherung, ein sogenanntes Backup, ist durch die schnelle
Entwicklung im Computerbereich heute unabhängig von der Datenmenge möglich.
Dagegen ist es fast unmöglich, ein System von Karteikarten in überschaubarer Zeit zu
sichern beziehungsweise zu duplizieren.
13
13
Apple Standard für Videodateien
12
Microsoft Standard Dateiformat für Videos
1.1.6 Marktübersicht von Mediendatenbanken
1.1.6.1 Cumulus 5 - Media Management System
Die Multimediadatenbank ,,Cumulus" von Canto findet sowohl im semiprofessionellen
als auch im professionellen Bereich Verbreitung. Diese Datenbank unterstützt nahezu
jedes Dateiformat. Die Daten werden hierarchisch in Katalogen und Kategorien
abgelegt. Sie bietet eine gute Suchfunktion und lässt sich um eigene Felder erweitern,
um dadurch auch spezielle eigene Daten zu den Medien aufzunehmen.
Für 300 DM ist eine Single-User Edition erhältlich, die professionelle Client-Server
Edition kostet ca. 4.000 DM.
1.1.6.2 ACDSee 3.1
Dieses Programm ist in erster Linie ein Dateibetrachter, der aber auch einige
Funktionen einer Multimediadatenbank enthält. So unterstützt ACDSee etliche
Dateiformate und bietet eine eingeschränkte Suchfunktion, außerdem sind einige
Bildbearbeitungsfunktionen implementiert. ACDSee 3.1 kostet ca. 110 DM.
1.1.6.3 Bilderverzeichnisse
Außerdem sind eine Reihe von Bilderverzeichnissen erhältlich, die einige Funktionen
einer Mediendatenbank enthalten. Sie basieren meist darauf, von Bildern eine
Vorschau, ein sogenanntes Thumbnail, zur Verfügung zu stellen und einige
Informationen zu dem Bild zu speichern. Viele dieser Programme bieten zusätzlich
noch Suchfunktionen und eine Katalogansicht, in der die Vorschaubilder nebeneinander
angezeigt werden. Diese Programme sind meist als Freeware oder Shareware erhältlich.
14
1.2 Die Unified Modeling Language (UML)
1.2.1 Eigenschaften der Unified Modeling Language
Die Unified Modeling Language (UML) ist eine umfangreiche Sammlung von
Werkzeugen zur Beschreibung von Prozessen und Strukturen. Die Hauptanwendung
der UML liegt in der Softwareentwicklung, sie findet aber auch in anderen Bereichen
wie zum Beispiel der Abbildung von Geschäftsprozessen Anwendung. Die UML geht
zurück auf die Anfänge der objektorientierten Softwareentwicklung (Smalltalk
14
1970-1980).
Anfang der 90er Jahre legten P. Coad und E. Yourdon mit dem Buch ,,Object Oriented
Analysis" den Grundstein für die Entwicklung weiterer objektorientierter
Entwicklungstechniken, die dann die Basis für die UML bildeten.
Ab 1994/1995 formulierten Booch, Jacobsen und Rumbaugh aus diesen Methoden die
Unified Method. 1997 entstand daraus die Unified Modeling Language 1.1. [/Balzert
2/S.328]
1.2.2 Vorteile der Modellierung
Ziel des Einsatzes der UML ist es, den Prozess der Softwareentwicklung effektiver zu
gestalten. Dies gelingt vor allem dadurch, dass die Ziele in einer detaillierten, aber
anschaulichen Form dargestellt werden, die auch Außenstehenden verständlich ist.
Durch das Modellieren von Prozessen und Strukturen können inhaltliche Details
herausgearbeitet werden. Die Modellierung dient in erster Linie der Veranschaulichung
komplexer Systeme und sorgt dafür, sich in einem Team über die Inhalte verständigen
zu können. Außerdem ist so ein Überblick über das gesamte System möglich, der dazu
beiträgt, Programmteile zu vereinfachen und ggf. mehrfach zu verwenden. Weiterhin
unterstützt die UML im Design und Definitionsprozess eine klare Begriffsbildung und
Spezifikation von Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten.
15
14
Smalltalk war die erste vollständig objektorientierte Programmiersprache
1.3 Datenbanken
1.3.1 Geschichte und Übersicht über verschiedene Datenbanktypen
Die Entwicklung der elektronischen Datenverarbeitung hat es ermöglicht, dass eine
große Menge an Daten in Form von Texten, Tabellen und Grafiken, sowie in den
letzten Jahren auch Bilder, Audiodaten und Videodaten gespeichert werden können.
Um über alle Daten einen Überblick zu behalten, ist es sinnvoll, Metadaten zu
speichern. So kann man Daten über ein Buch, zum Beispiel den Autor, den Verlag,
Stichwörter und eine Zusammenfassung speichern, um es dann leichter wiederzufinden.
Da die Datenmengen immer größer wurden, war es notwendig, diese persistent, also
dauerhaft, zu speichern. Um zu gewährleisten, dass mehrere Anwendungen gleichzeitig
auf die Daten zugreifen können und die Daten sicher verwaltet werden, wurden
Datenbanken (DB) und Datenbankmanagementsysteme (DBMS) entwickelt.
Die ersten Datenbanken wurden in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts auf
Großrechnersystemen entwickelt. IBM entwickelte 1968 die erste kommerziell
verfügbare Datenbank, das System IMS (Information Management System). Bei diesem
System handelt es sich um einen Repräsentanten des sogenannten hierarchischen
15
Datenbanksystems. Da ein hierarchisches Datenmodell nur sehr umständlich die
Modellierung von gewissen Zusammenhängen der realen Welt zulässt, wurden schon
1970 Anstrengungen unternommen, das hierarchische Modell zu verbessern. Ergebnis
dieser Anstrengungen ist das relationale Datenbankmodell von E. F. Codd. Das neu
entstandene relationale Modell basiert auf mengenorientiertem Zugriff. Mit der
Entwicklung von leistungsfähigen, relationalen Datenbanken war der Grundstein für die
weitere Verbreitung dieses Systems gelegt. Die Entwicklung dieser Systeme (wie
System R, Ingres, Informix oder Oracle) begann Mitte der 80er Jahre, kommerziell
verfügbare Systeme existieren seit Anfang der 90er Jahre.
Relationale Datenbanken spielen heute eine große Rolle auf den Märkten für Klein- und
Arbeitsplatzrechner, sie erreichten ebenfalls eine starke Position im Bereich der Mittel-
und Großrechner. Dieses war der Anlass für die Standardisierung einer
Datenbanksprache für relationale Systeme, der SQL (Structured Query Language). Der
SQL-Standard, der 1988 durch das ANSI (American National Standards Institute)
16
15
Beispiel hierarchischer Strukturen ist der Microsoft Windows Datei Explorer
verabschiedet wurde, besitzt eine hohe Integrationskraft, die die Verbreitung
standardisierter, relationaler Datenbanken fördert.
Ein Datenbanksystem sorgt für die dauerhafte (persistente), zuverlässige und
unabhängige Verwaltung sowie die komfortable, flexible und geschützte Verwendung
großer, integrierter und mehrfachbenutzbarer Datenbanken. Ein Datenbanksystem
(DBS) besteht aus einer oder mehreren Datenbanken, einem Data Dictionary (DD) und
einem Datenbankmanagementsystem.
Eine Datenbank enthält die Gesamtheit aller Daten eines Anwendungsbereichs. Im Data
Dictionary wird das Datenbankschema gespeichert, das den Aufbau der Daten der
Datenbank beschreibt.
Das Datenbankmanagementsystem verwaltet und kontrolliert zentral unter
Berücksichtigung des Datenbankschemas im DD die in der Datenbank abgelegten
Datenbestände [/Balzert 2/ S 671].
Wichtig ist dabei, dass das Datenbankmanagementsystem über Mechanismen verfügt,
die die Konsistenz, die Integrität und die Unversehrtheit der Daten sicherstellen, so dass
kein Verlorengehen oder Verfälschen von Daten auf Grund von technischer Störung,
zum Beispiel während der Übertragung, möglich ist. Außerdem ist wichtig, dass alle
Daten redundanzarm gespeichert werden, auch wenn diese aus verschiedenen
Anwendungen zusammengeführt werden, um die Integrität der Daten sicherzustellen.
Es haben sich mittlerweile verschiedene Datenbankmodelle entwickelt. Im folgenden
wird auf das relationale Datenbankmodell eingegangen, da dieses eine weite Ver-
breitung gefunden hat und daher überall verfügbar ist.
1.3.2 Relationale und Objektorientierte Datenbanken
Relationale Datenbanken basieren auf dem Gedanken, dass alle Informationen in
Tabellen abgelegt sind. Eine Datenbank ist demnach eine Sammlung von Tabellen. Die
Tabellen haben unterschiedliche Spalten, in denen jeweils eine Information
untergebracht ist. Jede Zeile steht also für einen Datensatz. Der Zugriff auf die Daten
erfolgt durch die deklarative Sprache SQL
16
, durch die es möglich ist, auf einzelne
Elemente jedes Datensatzes lesend und schreibend zuzugreifen. Der Vorteil besteht in
der standardisierten Sprache. Es ist also auch möglich, auf die Daten zuzugreifen, ohne
17
16
structured query language Datenbankabfragesprache
eine Anwendung dafür programmieren zu müssen, da es standardisierte SQL-Monitore
gibt, mit denen der Zugriff auf eine SQL-Datenbank möglich ist.
Objektorientierte Datenbanken basieren auf demselben Konzept wie die
objektorientierte Programmierung. In objektorientierten Programmen kapselt ein Objekt
verschiedene zusammengehörige Daten und Methoden. Man unterscheidet zwischen
Objekten, die vorübergehend im Arbeitsspeicher gehalten werden und beim Beenden
des Programmes verloren gehen, den sogenannten transienten Objekten, und den
persistenten Objekten, die gespeichert vorliegen und beim nächsten Programmstart
wieder geladen werden können. Der Ansatz bei diesen Datenbanken ist es, nicht
zwischen transienten und persistenten Objekten zu unterscheiden. Lediglich das DBMS
hat die Aufgabe, die persistenten Objekte aufzunehmen und bei Bedarf wieder zur
Verfügung zu stellen. Bei der Programmierung einer Anwendung kann man nun einfach
wichtige Objekte in einer Datenbank sichern und damit die Vorteile von Datenbanken
genießen.
1.3.3 Vorteile der relationalen Datenbank
Die relationale Datenbank ist zurzeit sehr weit verbreitet. Die meisten dieser
Datenbanken lassen sich mit der SQL bedienen. Dieses ermöglicht einen hohen Grad an
Flexibilität einer Anwendung, da sie nicht an eine bestimmte Datenbank gebunden ist.
Es ist also möglich, eine Anwendung mit Anbindung an eine preiswerte, nicht so
leistungsstarke Datenbank zu entwickeln und später, wenn die Anforderungen größer
werden, auf eine leistungstarke Datenbank umzusteigen, ohne die Anwendung anpassen
zu müssen. Dieses Skalieren eines Systems wird immer wichtiger, da die Vernetzung es
ermöglicht, von jedem beliebigen Ort der Welt auf einem System zu arbeiten und damit
die Zahl der Nutzer zunehmen kann.
18
2 Projektdefinition
Die Projektdefinition beschäftigt sich mit den Anforderungen und den Möglichkeiten
der Realisation im Rahmen dieser Diplomarbeit. Dabei wird die Ausgangssituation
besonders genau betrachtet.
2.1 Situationsanalyse
Im Planetarium der Fachhochschule Kiel werden unterschiedliche Medien eingesetzt.
Zurzeit ist der Schwerpunkt der Anwendung von Medien im Dia zu finden. Es gibt
einen Server im Planetarium mit einer Verzeichnisstruktur, in der digitale Bilder
gespeichert werden, die dann auf einem Diabelichter ausbelichtet werden. Zum Suchen
eines bestimmten Bildes stehen also nur die Kategorie, beziehungsweise das
Verzeichnis, in der sich das Bild befindet und der Dateiname zur Verfügung. Daher
kann das Finden von bestimmten Bildern viel Zeit in Anspruch nehmen. Desweiteren
besteht ein Nachteil dieses Systems darin, dass es keine Vorschaubilder gibt, so dass
man beim Durchsehen des Bilderbestandes zuerst die Bilder in der vollen Auflösung
laden muss. Dies führt zu längeren Wartezeiten und zu einer stärkeren Belastung des
Netzwerkes, was zu Wartezeiten bei anderen Benutzern im Netzwerk führen kann. Ein
weiterer Nachteil ist dadurch gegeben, dass sich das Bild in nur einem Verzeichnis
befinden kann und damit nur einer Kategorie zugeordnet ist.
Das Fehlen von weiteren Informationen zu den Medien kompliziert die Benutzung.
Möchte man beispielsweise zu einem Bild Informationen recherchieren, hat man keine
Grundlage, von der man ausgehen kann. Hier wäre es sinnvoll, wenn die Quelle des
Bildes, zum Beispiel ein Buch, angegeben wäre.
Ein weiteres Problem ist das vernetzte Arbeiten. Da die Medien zurzeit als große
Dateien auf einem zentralen Server liegen, ist es mühsam, von anderen Computern eine
Bilderrecherche durchzuführen, weil die Übertragung der Bilder zu lange dauert.
Außer Bildern kommen im Planetarium der Fachhochschule Kiel auch eine Reihe von
anderen Medien zum Einsatz, die die Einführung einer Multimediadatenbank sinnvoll
erscheinen lässt. Neben digitalen Medien wie Bildern, Audiodateien, Videos und
Animationen sollen auch physikalische Medien wie Dias, CDs, Videokassetten und
Bücher verwaltet werden. Mit einer so umfangreichen Sammlung von Informationen
19
kann die gezielte Recherche erheblich vereinfacht werden, da Verknüpfungen zwischen
den Medien möglich sind.
Wichtig ist neben der Suchfunktion, dass das Datenbanksystem auch die digitalen
Medien aufnehmen und zur Verfügung stellen kann. Weiterhin ist es sinnvoll, dass
Beziehungen zwischen mehreren Datensätzen möglich sind. Als Beispiel kann eine
Bildfolge einer Bewegung dienen, jedes dieser Bilder könnte so auf das nächste Bild
verweisen. Eine Beziehung zwischen verschiedenen Medien wäre auch vorteilhaft: Ein
Bild könnte auf ein Buch verweisen, aus dem das Bild eingescannt wurde.
Um die Datenbank auch über längere Zeit nutzen zu können, ist es sinnvoll, diese
erweiterbar zu konstruieren. Dadurch können im Nachhinein neue Medientypen
eingebunden werden, ohne dass das System verändert werden muss.
2.1.1 Nutzergruppen
Die Nutzer der Multimediadatenbank im Planetarium der Fachhochschule Kiel
verfügen über Basiskenntnisse am PC und im Umgang mit gängiger Software wie
Office-Anwendungen
17
und Internetbrowsern
18
. Sie besitzen außerdem Kenntnisse über
die Medien, die zu archivieren sind. Eine längere Einarbeitungszeit soll vermieden
werden, daher muss die Bedienung der Multimediadatenbank so einfach wie möglich
gestaltet sein. Es ist sinnvoll, die Bedienoberfläche durch Webseiten zu realisieren, da
die Benutzung von Webbrowsern weithin bekannt ist. Die Gestaltung des Designs in
einer Webseite ermöglicht es zugleich, diese jederzeit den Wünschen der Nutzer
anzupassen.
20
18
zum Beispiel Netscape Communicator oder Microsoft Internet Explorer
17
Office-Anwendungen bezeichnen Computerprogramme wie Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation und einfache Datenbanken
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832460976
- ISBN (Paperback)
- 9783838660974
- DOI
- 10.3239/9783832460976
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Kiel – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2002 (November)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- konzept realisierung datenbanksystems
- Produktsicherheit
- Diplom.de