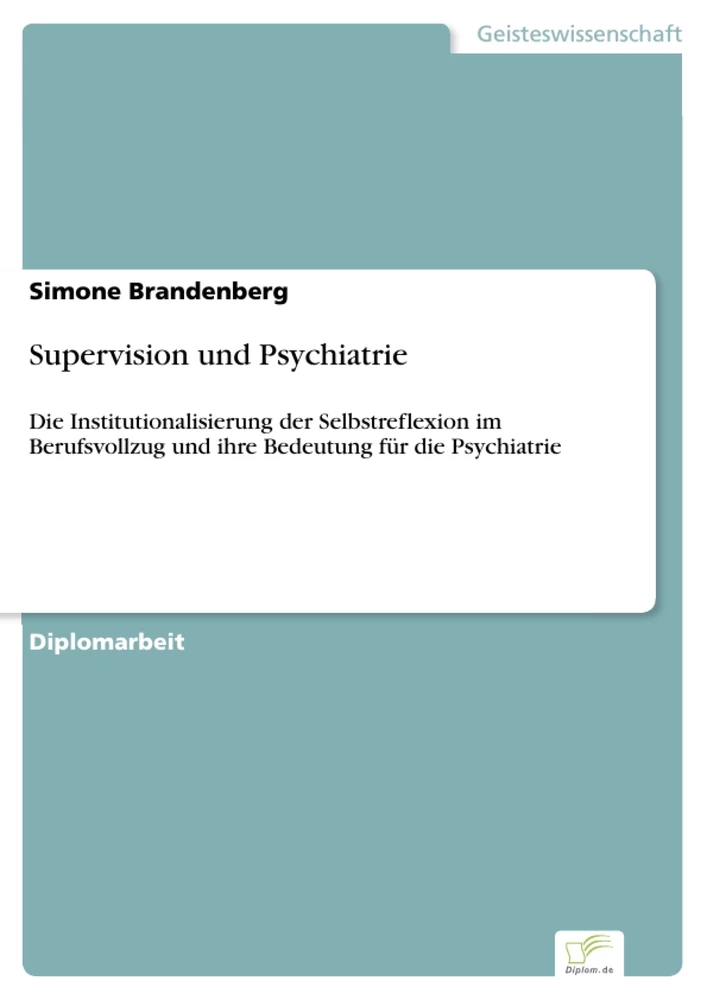Supervision und Psychiatrie
Die Institutionalisierung der Selbstreflexion im Berufsvollzug und ihre Bedeutung für die Psychiatrie
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zunächst mit dem Thema der Supervision. Dieses Beratungsverfahren stellt derweil ein bedeutendes und fest etabliertes Praxisfeld und Forschungsgebiet dar. Der Begriff Supervision umschreibt jedoch kein klar definiertes Verfahren. Form, Methodik und Zielsetzung variieren je nach Bereich, in dem Supervision angewandt werden soll.
Die Komplexität der Bereiche, in denen Supervision und Beratung heute zum Tragen kommen, verdeutlichen eine Ausweitung von dem traditionell mit Supervision verbundenen sozialen Bereich, über alle Disziplinen und Organisationsbereiche. Aufgrund dieser Ausweitung hat man begonnen, die Selbstreflexion im Berufsvollzug zu institutionalisieren. Supervision nimmt heute einen wichtigen Platz in psychotherapeutischen, psychosozialen, medizinischen, pädagogischen und organisationalen Handlungsfeldern ein.
Die Aufgaben der Supervision können demnach ausgesprochen vielfältig sein, vor allem im Hinblick auf die differenten Zielsetzungen des jeweiligen Supervisionsauftrages. Ihre Ziele können eher der Unternehmenslogik oder der Professionslogik verschrieben sein, d.h., dass der Supervisionsauftrag entweder im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation bzw. eines Unternehmens steht, oder das Gemeinwohl in den Vordergrund gestellt wird.
Supervision ist aufgrund ihres historischen Ursprungs der Gesellschaft in gewisser Weise ethisch verpflichtet. Beachtet der Supervisor die moralischen Dimensionen, steht das Postulat der sozialen Gerechtigkeit mit dem professionellen Handeln im Zusammenhang, so kann dieses Beratungsverfahren einen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten.
Zur besseren Anschaulichkeit eines Supervisionsprozesses in der Praxis wird das von M. Balint eigens entwickelte Gruppenkonzept zur beruflichen Qualifizierung von Ärzten angeführt.
Gang der Untersuchung:
Der zweite Teil der Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Institution Psychiatrie. Eine historische Betrachtung der Psychiatriegeschichte ist sinnvoll hinsichtlich des Verständnisses der derzeitigen Bedeutung von Psychiatrie. Die aktuelle Bedeutung wurde stark beeinflusst durch die tiefgreifende Erschütterung der deutschen Psychiatrie während der Zeit des Nationalsozialismus und der damit verbundenen Abwanderung bedeutender Psychiater in das Exil. Zusätzlich erschwert das spezifisch gegliederte soziale Versicherungssystem die Gleichstellung von somatisch und psychisch erkrankten […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
0. Vorwort
1. Einleitung
2. Was ist Supervision?
3. Historische Entwicklung der Supervision
3.1 Anfänge in den USA – das amerikanische Casework
3.2 Psychoanalytische Einflüsse
3.3 Rezeption der Methodenliteratur
3.4 Methodenpluralismus
4. Formen der Supervision
4.1 Einzelsupervision
4.2 Gruppensupervision
4.3 Teamsupervision
4.4 Organisationsentwicklung
4.5 Fall- vs. Teamsupervision
5. Der Supervisionsprozess
6. Balint- Gruppen
6.1 Anfänge und Grundlagen der Balint- Arbeit
6.2 Der Gruppenprozess
7. Was ist Psychiatrie?
8. Historische Entwicklung der Psychiatrie 32
8.1 Aspekte der Entstehungsgeschichte
8.1.1 Altertum und Mittelalter
8.1.2 Die Zeit bis zur Industrialisierung
8.1.3 Das 19. Jahrhundert
8.2 Anstaltspsychiatrie während des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit
8.2.1 Ideologische Veränderungen
8.2.2 Massenvernichtungen
8.2.3 Erste Reformansätze
8.3 Psychiatrie der Gegenwart
8.3.1 Grundgedanken einer gemeindenahen Sozial- Psychiatrie
8.3.2 Die Therapeutische Gemeinschaft
9. Psychiatrische Versorgungsstruktur
9.1 Behandlungsinstitutionen
9.2 Stationäre Angebote
9.3 Teilstationäre Behandlung
9.4 Ambulante Behandlung
10. Supervision und Psychiatrie
10.1 Supervision als Qualitätsmerkmal?
10.2 Supervision im institutionellen Kontext
10.3 Supervision an der Grenze zur Organisationsentwicklung
10.4 Anlässe für Supervision in der Psychiatrie
10.5 Identitäten und interpersonale Abwehr in Teams
10.6 Supervision als praktische Ethnopsychoanalyse
10.7 Das „Salzburger Modell“
11. Resümee
12. Quellennachweis
13. Bibliographie
0. Vorwort
Im Rahmen meines Studiums absolvierte ich im letzten Jahr ein Praktikum in der Klinik und Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikum Niederbergs. Das Praktikum, welches bereits seit mehreren Jahren an der Universität – Gesamthochschule - Essen als Projekt angeboten und durchgeführt wird, umfasst einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr.
Während dieser Zeit, die mir einen unerwartet umfassenden Einblick in den stationären Alltag der Patienten und Mitarbeiter verschaffte, gelang es mir eine Beziehung zu einem psychotischen Patienten aufzubauen. Diese Beziehungsarbeit wurde durch wöchentlich stattfindende Supervisionssitzungen unterstützt und im Sinne des von M. Balint entwickelten Gruppenkonzeptes durchgeführt.
Die Zeit des Praktikums gestaltete sich sehr abwechslungsreich. Es wurde mir ermöglicht, an vielen therapeutischen Angeboten, Visiten, Arzt- Patient- Gesprächen, Aufnahmegesprächen, medizinischen Untersuchungen, Fortbildungsveranstaltungen und institutionsinternen Supervisionssitzungen, teilzunehmen. Zusätzlich ergab sich die Möglichkeit, einer Gesundheitskonferenz mit dem Thema „Einrichtung eines gemeindepsychiatrischen Verbundes im Kreis Mettmann“, beizuwohnen. Zum ersten Mal wurde ich mit dem Begriff der „gemeindenahen Sozialpsychiatrie“ konfrontiert. Im darauffolgenden Gespräch mit einem Diplom- Pädagogen des Klinikum Niederbergs erfuhr ich mehrere interessante historische Zusammenhänge bezüglich der Entstehungsgeschichte der Psychiatrie.
Insgesamt erweckten das Praktikum und das bereits seit meiner Schulzeit bestehende Interesse an medizinischen Arbeitsbereichen, die Neugier an der Institution Psychiatrie.
Wie bereits erwähnt, wohnte ich ebenfalls einer einmal im Monat stattfindenden Supervisionssitzung der Mitarbeiter aller psychiatrischen Stationen bei. Ein externer Supervisor leitete das Gespräch und eröffnete die Diskussion über einen als schwierig und therapieresistent geltenden Patienten. Mir fiel sofort auf, dass sich diese Supervisionsform sehr von der durch meine Dozentin wöchentlich stattfindende Supervision unterschied. Die Mitarbeiter saßen alle kreuz und quer in einem Raum verteilt und drehten einander teilweise den Rücken zu. Diejenigen, die eingestanden, Probleme mit dem betreffenden Patienten zu haben, waren ausschließlich das Pflegepersonal und der ein oder andere Ergotherapeut oder Sozialarbeiter. Die Ärzte und Psychologen beteiligten sich weitestgehend nicht an dem Gespräch und ließen gelegentlich eine Bemerkung fallen, die eher als Anweisung und nicht als Vorschlag zu verstehen war. Ich ging aus dem Gespräch mit dem Gefühl heraus, dass nun alle so schlau waren, wie vorher. Diskussionen mit einigen Mitarbeitern eröffneten mir, dass fast alle Anwesenden diese Form der Supervision als sinnlos oder zumindest fragwürdig bezüglich des Ergebnisses betrachteten. Diese Ansichten standen jedoch vollkommen im Widerspruch zu meinen Supervisionserfahrungen, und ich stellte mir die Frage, wieso ein solcher Unterschied in der Durchführung von Supervisionssitzungen bestehen kann.
Letztendlich war mein Praktikum weitestgehend verantwortlich für die Themenwahl meiner Diplom- Arbeit. Hier wurde nicht nur mein Interesse für die Institution Psychiatrie, sondern gleichermaßen für das Thema „Supervision“ geweckt, dass derzeit im Munde vieler Leute ist, mir zum damaligen Zeitpunkt jedoch niemand zufriedenstellend erklären konnte.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit habe ich im gesamten Text nur die männliche Form benutzt. Es sind Frauen und Männer in gleicher Weise gemeint.
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zunächst mit dem Thema der Supervision. Dieses Beratungsverfahren stellt derweil ein bedeutendes und fest etabliertes Praxisfeld und Forschungsgebiet dar. Der Begriff „Supervision“ umschreibt jedoch kein klar definiertes Verfahren. Form, Methodik und Zielsetzung variieren je nach Bereich, in dem Supervision angewandt werden soll.
Die Komplexität der Bereiche, in denen Supervision und Beratung heute zum Tragen kommen, verdeutlichen eine Ausweitung von dem traditionell mit Supervision verbundenen sozialen Bereich, über alle Disziplinen und Organisationsbereiche. Aufgrund dieser Ausweitung hat man begonnen, die Selbstreflexion im Berufsvollzug zu institutionalisieren. Supervision nimmt heute einen wichtigen Platz in psychotherapeutischen, psychosozialen, medizinischen, pädagogischen und organisationalen Handlungsfeldern ein. 1
Die Aufgaben der Supervision können demnach ausgesprochen vielfältig sein, vor allem im Hinblick auf die differenten Zielsetzungen des jeweiligen Supervisionsauftrages. Ihre Ziele können eher der Unternehmenslogik oder der Professionslogik verschrieben sein, d.h., dass der Supervisionsauftrag entweder im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation bzw. eines Unternehmens steht, oder das Gemeinwohl in den Vordergrund gestellt wird.
Supervision ist aufgrund ihres historischen Ursprungs der Gesellschaft in gewisser Weise ethisch verpflichtet. Beachtet der Supervisor die moralischen Dimensionen, steht das Postulat der sozialen Gerechtigkeit mit dem professionellen Handeln im Zusammenhang, so kann dieses Beratungsverfahren einen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten.
Zur besseren Anschaulichkeit eines Supervisionsprozesses in der Praxis wird das von M. Balint eigens entwickelte Gruppenkonzept zur beruflichen Qualifizierung von Ärzten angeführt.
Der zweite Teil der Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Institution Psych-iatrie. Eine historische Betrachtung der Psychiatriegeschichte ist sinnvoll hinsichtlich des Verständnisses der derzeitigen Bedeutung von Psychiatrie. Die aktuelle Bedeutung wurde stark beeinflusst durch die tiefgreifende Erschütterung der deutschen Psychiatrie während der Zeit des Nationalsozialismus und der damit verbundenen Abwanderung bedeutender Psychiater in das Exil. Zusätzlich erschwert das spezifisch gegliederte soziale Versicherungssystem die Gleichstellung von somatisch und psychisch erkrankten Menschen.
Als Meilenstein der sozialpsychiatrischen Entwicklung in Deutschland ist die Psychiatrie- Enquête zu sehen, in der, ausgehend von einer Bestandsaufnahme, eine umfassende Reform der psychiatrischen Versorgung entworfen und geplant wurde. Seither findet u.a. ein zunehmender Ausbau des komplementären Angebotes psychiatrischer Versorgung statt.
Im letzten Teil der Ausarbeitung werden die beiden Komponenten Supervision und Psychiatrie zusammengeführt. Welche Bedeutung hat die Institutionalisierung der Selbstreflexion im Berufsvollzug für die psychiatrische Praxis, und wie sinnvoll ist ihr Einsatz in diesem Bereich? Um dies zu klären, werden zunächst verschiedene Gesichtspunkte näher erläutert. In der heutigen Zeit ist eine Verschmelzung institutioneller und organisationaler Faktoren in der Praxis unumgänglich. Daher muss der Blick in der Psych- iatrie im Zusammenhang mit professioneller Beratung ebenfalls auf die Struktur- und Aufbauorganisation gerichtet sein.
Weiterhin wird beschrieben, welche konkreten Anlässe den Einsatz dieses Beratungsverfahrens in der Psychiatrie legitimieren, und es wird der Ansatz Harald Pühls dargestellt, der Supervision im Krankenhaus als eine Art praktischer Ethnopsychoanalyse auffasst.
Im Anschluss an diese Kapitel wird das „Salzburger Modell“ vorgestellt, das deutlich macht, in welcher Form Supervision in einem Krankenhaus eingesetzt und angewandt werden kann.
2. Was ist Supervision?
„Supervision stellt ein Verfahren dar, bei dem Einzelpersonen, Teams/ Gruppen oder Organisationen mit Hilfe eines Beraters/ Supervisors arbeitsbezogene Problemstellungen in Verbindung mit Team- oder Organisationsdynamik reflektieren.“2
Der Begriff Supervision wird von dem lateinischen Wort „supervidere“ abgeleitet und bedeutet übersetzt: etwas von oben herab überblicken. Aus dem amerikanischen Sprachgebrauch übernommen bedeutet Supervision: Kontrolle, Überwachung, Aufsicht bzw. Leistungskontrolle, aber auch Erziehung aus dem neueren Sprachgebrauch.
In der heutigen Gesellschaft, in der „ein erhöhter Bedarf an Beratung und Supervision virulent ist“3, rückt diese Beratungsform bei vielen Berufsgruppen stärker in den Mittelpunkt. Psychologen, Psychotherapeuten, Lehrer, Angehörige weiterer pädagogischer, sozialer und helfender Berufe, bis hin zu Wirtschaft und Verwaltung betreffende Berufsgruppen nutzen dieses Beratungsverfahren zur Verbesserung und Modifizierung beruflicher Leistungsfähigkeit. 4 Der Wunsch nach Supervision erwächst in der Regel aus dem Bedürfnis, die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten der Mitarbeiter einer Institution oder Organisation zu optimieren und Konflikte zu überwinden. Im Vordergrund steht dementsprechend die Bearbeitung von Konflikten sowie das Herstellen von Zusammenhängen zwischen Beziehungsaspekten, institutionellen Aspekten, Lernprozessen und Arbeit. Da Ansätze aus verschiedenen Psychotherapieformen, sozialwissenschaftlichen Verfahren oder Organisationsberatungsansätzen die Basis für die Vorgehensweise des Verfahrens bilden können, ist Supervision dennoch kein klar definiertes Beratungsverfahren. 5
Weiterhin kann Supervision in unterschiedlicher Form stattfinden: Einzel-, Team-, Gruppensupervision, kollegiale Supervision oder Rollen- bzw. Leitungsberatung (auch: Coaching) implizieren unterschiedliche Beziehungsformen zwischen dem Supervisior und dem/ den Supervisanden. Eine Definition ist also abhängig von der Funktion, den Ansätzen und damit der methodischen Vorgehensweise sowie der jeweiligen Form der Supervision. Dennoch existieren bestimmte allgemeingültige Voraussetzungen, die in jeder Beratungssituation erfüllt sein sollten:
Das Beratungsverhältnis sollte eine freiwillige Beziehung zwischen einem professionellen Helfer (Berater/ Supervisior) und einem hilfebedürftigen System (Klient/ Supervisand) darstellen, in welcher der Berater versucht, dem Klienten bei der Lösung laufender und potentieller Probleme behilflich zu sein. Das Beratungsverhältnis ist als befristet anzusehen und sollte in einem vorher abzuschließenden Kontrakt festgehalten werden. Der formale Kontrakt beinhaltet Modalitäten wie beispielsweise Leistungserbringung, Zielvereinbarungen, Honorar, Ort, Dauer und Frequenz der Sitzungen sowie die Einhaltung der Schweigepflicht des Supervisors. Außerdem sollte der Berater idealtypischerweise ein Außenstehender sein, d.h. er ist nicht Teil des hierarchischen Machtsystems, in welchem der Klient sich befindet. Er sollte ein möglichst hohes Maß an Unabhängigkeit, Objektivität und Neutralität mitbringen. 6
3. Historische Entwicklung der Supervision
Am Beginn der Supervisionsgeschichte steht ein hoher ethischer Anspruch, nämlich das eigene soziale Wirken in beruflichen Zusammenhängen immer wieder kritisch zu hinterfragen. Trotz ihres gemeinsamen Ursprungs unterscheidet sich die Bedeutung der Supervision in den USA deutlich von den Aufgaben der Supervision in Deutschland. Amerikanische Führungskräfte in wirtschaftlichen Unternehmen oder in der Administration beaufsichtigen und kontrollieren ihre Mitarbeiter und die jeweiligen Funktionsabläufe. Sie verkörpern kontrollierende Instanzen, welche immanent zum System dazugehören. Ihr Ziel ist es, die Arbeit besser und reibungsloser zu organisieren, zu funktionieren, Konflikte und Probleme frühzeitig zu erkennen und dementsprechend rechtzeitig zu beseitigen, um so maximale Effektivität zu gewährleisten. 7
Was sich als profitabel bewährt hat, wird in psychosozialen und psychiatrischen Einrichtungen der USA übernommen. In der Literatur wird teilweise unterstellt, dass S. Freud, ohne es zu wissen, die erste Supervision durchgeführt hat, indem er den Vater vom „kleinen Hans“ unterweist, psychotherapeutisch auf seinen Sohn einzugehen. 7 Diese Ansicht wird von N. Belardi in seinem Buch „Supervision- Von der Praxisberatung zur Organisationsberatung“ ausdrücklich dementiert, obgleich er Freuds Lehre von Übertragung und Gegenübertragung, Widerstand und Deutung, als bedeutende Bereicherung für die Methoden der Supervision anerkennt. 8
Der Supervision in den USA sowie der Supervision in Deutschland ist jedoch gemeinsam, dass bei beiden Verfahren die auf die Arbeit gerichtete Selbstreflexion der Helfer im Vordergrund stehen soll. Die Entwicklungsgeschichte der Supervision lässt sich in einzelne Phasen unterteilen, welche die unterschiedlichen historischen Einflüsse erkennen lassen:
1870 – 1920 Supervision als Erziehung und Kontrolle
(Supervisor als Aufseher und Lehrer)
1920 – 1950 Individualisierungs- und Psychologisierungsphase der Supervision
(Supervisor als Therapeut und Pädagoge)
1950 – 1960 Pionierphase mit Definition und Methodenentwicklung der Supervision
(Supervisor als Methodenlehrer)
1960 – 1970 Expansion und Systematisierung der Supervision
(Supervisor auch Gruppensupervisor)
1970 – 1980 Supervision als Veränderungsmedium
(Supervisor als „Change- Agent”)
1980 – heute Supervision als pragmatische Profession
(Supervisor als Organisationsberater – pendelt zwischen den genannten Berufsrollen) 9
Allgemein betrachtet, ist ein deutlicher Trend von der Einzelsupervision über die Gruppen- und Teamsupervision zur Organisationsberatung erkennbar. Aus welchen Gründen es zu einer derartigen Verschiebung der Methoden und Formen dieses Beratungsverfahrens kam, wird in den nachfolgenden Kapiteln näher erläutert.
3.1 Anfänge in den USA – das amerikanische Casework
Der Grundstein für die derzeitige Supervision wird Ende des 19. Jahrhunderts in den USA gelegt. Im Jahre 1878 wird die erste Charity Organisation Society (C.O.S.) gegründet, eine kommunale Clearingstelle mit ermittelndem und vermittelndem Charakter. Freiwillige, insbesondere Frauen aus dem Bürgertum, sind in dieser Institution als „Friendly Visitors“ helfend tätig. Hier hat das amerikanische Casework seinen Ursprung. Mary Richmond, eine der Mitbegründerinnen der C.O.S., stellt Bemühungen an, die soziale Arbeit in irgendeiner Form geschäftsmäßig zu organisieren. „Die Wohlfahrtsarbeit musste effektiver werden; damit rückte die Fortbildung der Friendly Visitors durch Hauptamtliche in den Vordergrund.“10
Der sogenannte „Paid- Agent“, dessen Aufgabe in der Unterstützung der häufig enttäuschten und frustrierten Friendly Visitors begründet liegt, verkörpert den Vorgänger des heutigen Supervisors. Die Visitors besprechen ihre Fälle mit dem jeweils zuständigen Agent- Supervisor, der dann für die Entscheidung und die folgende Ausführung der Entscheidung verantwortlich ist. Aus dieser Form der Praxisberatung ergeben sich zwei charakteristische Funktionen für den Agent- Supervisor:
(1) Den in direktem Klientenbezug tätigen Visitor (auch: Sozialarbeiter) anleiten und unterstützen und
(2) administrative Funktion über die Verteilung der Arbeit sowie Kontrolle über die dementsprechenden Arbeitsvollzüge ausüben. 11
Supervision entsteht demzufolge als konstruktive Bewältigungsstrategie von Unsicherheiten früher Sozialarbeiter. Die sozialarbeiterische Tradition der Supervision besitzt fraglos Modellcharakter für viele andere Berufsgruppen, indem hier die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen gesellschaftlichen Handeln schon sehr früh institutionalisiert wird.
3.2 Psychoanalytische Einflüsse
Casework und Supervision bilden demnach in den USA eine methodische Einheit. Ihre Entstehung ist auf die dortigen gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen und das zur Gründungszeit existierende Versorgungs- und Gesundheitssystem der USA zurückzuführen.
In den 30er Jahren kommt es zu einem psychoanalytischen Entwicklungsschub für die Methoden des Casework und der Supervision. S. Freud, der Begründer der Psychoanalyse, veröffentlicht im Jahre 1892 erstmals psychoanalytisch orientierte Schriften. Im Jahre 1900 erscheint die populäre „Traumdeutung“ und einige Jahre später die „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ sowie die ersten methodische Schriften. „Zu diesem Zeitpunkt waren Casework und Supervision in den USA schon lange in der Entwicklung begriffen; beide [...] liegen in ihrer Entstehung somit eindeutig vor der Psychoanalyse, die zudem viel später erst in den USA so richtig bekannt geworden ist.“12
Freuds klassische Triebpsychologie ist eine der vier konzeptuell trennbaren Perspektiven über die Dynamik seelischer Prozesse. Im Gegensatz zu den erst später entstandenen Modellen (Ich-, Selbst- und Objektbeziehungspsychologie) stellt dieses Modell die Triebe des Menschen (Libido und Destrudo) in den Vordergrund. Der Mensch wird dementsprechend unter dem Gesichtspunkt von Bedürfnissen und Wünschen betrachtet, die in frühen körperlichen und familiären Erfahrungen geformt und in Handlungen sowie in bewussten und unbewussten Phantasien ausgedrückt werden. Die theoretische Grundlage dieser Perspektive ergibt sich aus der Annahme angeborener Triebe und sexueller Phasen, die sich epigenetisch entfalten.
Nun werden einige dieser Triebe vom Menschen als unannehmbar oder sogar gefährlich empfunden, denn sie stehen im Widerspruch zu den moralischen Wertvorstellungen des Betreffenden (psychoanalytisch: Über- Ich). Aus dieser Unvereinbarkeit resultiert häufig ein unbewusster Konflikt, und die Realität wird abgewehrt bzw. verleugnet. Folglich unterstreicht Freud in der analytischen Situation die Berücksichtigung der Zähmung, Sozialisation und Gratifikation von Trieben. Das Ziel der analytischen Situation ist die Deutung des unbewussten Konfliktes bzw. das Bewusstwerden und die Verbalisierung des bestehenden Konfliktes, um dadurch eine allmähliche Modifikation von Konflikt, Gewissen und unflexiblen Abwehrformen zu ermöglichen. 13
Eben dieses theoretische Modell hat großen Einfluss auf die Psychologisierung der Supervision genommen und ist weitestgehend mitverantwortlich für den Ist- Zustand der derzeitigen Methoden dieses Beratungsverfahrens in Deutschland.
3.3 Rezeption der Methodenliteratur
Während der Zeit des Nationalsozialismus unterbricht die gerade begonnene Methodenentwicklung in der BRD, während in den USA die Diskussion fortgeführt und die Methoden weiterentwickelt werden. Der 2. Weltkrieg impliziert eine Instrumentalisierung der Methoden der Erwachsenenbildung durch die NS- Ideologie. Sie werden missbraucht, um völkisches Gemeinschaftsgefühl und Führergehorsam zu erzeugen.
Aus diesem Grund wird die amerikanische Methodenliteratur nach 1945 mit teilweise 20jähriger Verspätung in Deutschland rezipiert. Zu diesem Zeitpunkt stellt die partiell veraltete Methodenliteratur in den USA bereits keinen aktuellen Tatbestand mehr dar. Des weiteren werden die unterschiedlichen gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten sowie die differenten sozialen Versorgungssysteme der USA und der BRD bei der Rezeption weitestgehend vernachlässigt.
In den USA entfernt sich seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts das Verständnis der Supervision zunehmend von der psychoanalytischen Orientierung. Etwa zur gleichen Zeit beginnt in Deutschland die Rezeption der in den USA bereits veralteten Methodenliteratur, und hier liegt die Ursache für die unterschiedliche Bedeutung der Supervision in den USA und der BRD begründet. Das gegenwärtige Verständnis der Supervision in den USA entspricht weitestgehend administrativen und lehrenden Aufgaben. Häufig hat der Supervisor eine hierarchische Position inne und steht zwischen den Supervisanden und der Organisationsleitung.
Die langsame Hinwendung Deutschlands zu den amerikanischen Methoden wird zusätzlich durch die Rückkehr der während des Naziregimes emigrierten deutschen (v.a. jüdischen) Wissenschaftler unterstützt. 14
3.4 Methodenpluralismus
In den Jahren 1954 bis 1992 findet eine Explosion der Publikationen der Supervisionsliteratur statt. Neben den prägenden psychoanalytischen Einwirkungen auf die Methoden dieses Beratungsverfahrens, stellen die Untersuchungen des Gestaltpsychologen K. Lewins über psychologische Vorgänge im sozialen Feld und die daraus resultierenden Anfänge der Gruppendynamik einen weiteren Meilenstein in der historischen Entwicklung der Supervision dar. Lewin konzentriert seine Untersuchungen auf das Arbeiten von Gruppen im Hier und Jetzt und entdeckt die Möglichkeit, eine Gruppe über sich selbst lernen zu lassen. Infolgedessen tritt das Prinzip der Selbstreflexion in den Vordergrund der Methodendiskussion. 15
Lewin umschreibt den Gruppenprozess mit den Begriffen
I. Unfreezing (Auflockern)
II. Change (Veränderung) und
III. Refreezing (Verfestigung des Erlernten für die weitere berufliche und private Praxis, auch „Back- Home“ genannt).
Der Gruppenleiter bekleidet in seinem Modell die Rolle des „Change- Agents“. 16
Lewins gruppendynamische Beiträge stellen eine weitere Bereicherung für die Supervision dar und bewirken eine bedeutsame Modifizierung der Methoden in Deutschland: Gruppen, Teams und Organisationen rücken immer stärker in das Zentrum supervisorischer Reflexion.
Weiterhin erhält die Supervision immer mehr Anstöße von fachfremden Disziplinen, was die Entstehung eines von den Berufsfeldern der Sozialarbeit unabhängigen Supervisors begünstigt. „Gruppendynamik und Psychoanalyse waren die Anfänge eines bis heute sich verbreitenden Methodenpluralismus, der die klassischen Arbeitsformen der Sozialarbeit abgelöst hat.“17 Die Pionierfunktion der Sozialarbeiter- Supervision, bzw. die traditionellen Konzepte der Praxisberatung, haben ihre Monopolstellung an verschiedene, meist aus den neuen Therapieverfahren entstammende Konzepte verloren. Berufsfeldorientierung und Zielgruppenorientierung rücken in den Vordergrund der institutionalisierten Selbstreflexion und ebnen den Weg für spezielle Methoden der Supervision, wie beispielsweise die in Kapitel 5 näher dargestellte Balint- Gruppensupervision. 18
4. Formen der Supervision
Der Einsatz von Supervision impliziert die Möglichkeit der Anwendung verschiedener Settings. Die Entscheidung, welche Arbeitsform angewandt werden soll, ist von den Zielen, den Klienten und der Akzentuierung des jeweiligen Supervisionskonzeptes abhängig.
Auch der o.g. historisch bedingte Aspekt des Methodenpluralismus bestimmt die Auswahl des Settings im wesentlichen mit. „Während noch vor etwa zwei Jahrzehnten die Einzelsupervision einen bevorzugten Stellenwert hatte, wird heute vielerorts [...] die Gruppensupervision als die einzig akzeptable Arbeitsform bezeichnet.“19 Die Methoden der modernen Gruppenverfahren begründen daher derzeit die Hauptorientierung der Supervision. Doch auch das Einzelsetting findet heute noch seine Anwendung und wird insbesondere von Führungskräften bevorzugt in Anspruch genommen.
4.1 Einzelsupervision
Die historischen Quellen der Einzelsupervision liegen wie bereits erwähnt im amerikanischen Casework und später in der psychoanalytischen Kontrollanalyse begründet. Diese Form der Supervision ist aufgrund der derzeitigen gesamtgesellschaftlichen Situation stark rückläufig.
Im Einzelsetting entsteht sehr schnell ein hohes Maß an Intensität und Beziehungsdichte, und es entwickeln sich ebenso schnell Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse. Der Supervisor läuft aus diesem Grund ständig Gefahr, die persönlichen Probleme des Supervisanden anstelle der Arbeitssituation zu fokussieren und zu analysieren. Die Grenze zu den therapeutischen Verfahren ist sehr schmal und wird häufig überschritten. Weiterhin fehlen die korrigierenden Dialogpartner, die mehr Arbeitsrealität in den Supervisionsprozess mit einbringen können. Huppertz kritisiert diese Form der Supervision und bezweifelt deren Erfolg: „Zu geringe Kontrolle, zu geringe Effektivität, sehr therapeutische Absichten, zu große Abhängigkeit.“20
Heute werden synonym für die Einzelsupervision auch die Begriffe Rollen-, Leitungsberatung und Coaching verwandt. Einzelsupervision hat sich zu einem Setting entwickelt, dessen Adressaten in erster Linie Führungskräfte und sogenannte „High- Potentials“ (besonders herausragende Nachwuchsführungskräfte) sind. Gründe dafür sind beispielsweise der mit dem Aufstieg in der Hierarchie eines Unternehmens verbundene steigende Leistungsdruck und die zunehmende Isolation der Führungskraft. Weiterhin ist das Einzelsetting eine sehr kostenintensive Maßnahme und setzt bei eigener Finanzierung ein entsprechendes Einkommen und somit eine dementsprechend hohe Hierarchieposition voraus. 21
Rollen- bzw. Leitungsberatung sowie Coaching sind demnach als eine neue Form der Einzelsupervision zu sehen und stellen in erster Linie eine optimale Ergänzung zu herkömmlichen Personalentwicklungsmaßnahmen dar. Dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen (Teamfähigkeit, Führungskompetenzen, Motivation zu lebenslangem Lernen...) kommt in diesen Settings eine besondere Bedeutung zu.
Diese Beratungsverfahren, die primär der Förderung bzw. Wiederherstellung beruflicher Handlungskompetenzen dienen, werden eingesetzt, um dem immer schnelleren Wandel, dem die Berufwelt unterworfen ist, und der damit verbundenen sinkenden Halbwertszeit des Wissens entgegenzuwirken. Auch die Tatsache, dass Berufserfolg heute nicht mehr nur mit einem Aufstieg in der Hierarchie und einem verbessertem Einkommen gleichgesetzt wird, sondern Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, individuelle Herausforderungen und Fortbildungsmöglichkeiten nahezu gleichwertige Faktoren geworden sind, begünstigt den Einsatz dieser Beratungsverfahren. Des Weiteren gewinnt ein Unternehmen enorm an Glaubwürdigkeit, wenn es die eigenen Mitarbeiter protegiert, weiterbildet und ihre Fähigkeiten entwickelt und dadurch die Herausbildung einer „corporate identity“ (organisationale Identität) fördert. 22
In der sozialen Arbeit findet Einzelsupervision dennoch nur in Ausnahmefällen statt. Wenn beispielsweise ein Mitglied aus einem bisher gleichberechtigten Team, ohne interne Hierarchisierung, aufgrund eines bestimmten Projektes zum Gruppenleiter befördert wird, kann das im Team als Verrat am Kollektivgeist empfunden werden und Konflikte auslösen. Eine Teamsupervision wird in solchen Fällen häufig von den Mitgliedern abgelehnt, und dem Gruppenleiter bleibt zur Lösung des Konfliktes nur die Möglichkeit, ein Einzelsetting in Anspruch zu nehmen. 23
4.2 Gruppensupervision
In der Gruppensupervision verlässt der Supervisor den Intimraum der Zweierbeziehung und präsentiert sich vor einer Gruppe. Dieses Mehrpersonen- Setting erfordert unbedingt gruppendynamische Qualifikationen auf Seiten des Supervisors. Die Gruppe sollte klein und überschaubar sein (3-20 Teilnehmer), und in den Sitzungen sollte die Entwicklung von Face- to- Face- Kontakten ermöglicht werden (z.B. durch einen Stuhlkreis). Die Sitzungen finden in der Regel in mehrwöchigem Abstand statt, und die Gruppe hat den Charakter einer „Stranger- Group“, d.h., die Teilnehmer verbinden keine realen Arbeitsplatzbeziehungen, denn sie stammen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Dies ermöglicht ein hohes Maß an Offenheit, was einen sehr wichtigen Faktor für einen konstruktiven Supervisionsprozess darstellt. 24
In der Gruppensupervision sind die multiplen Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse zu berücksichtigen, deren Analyse sich im Gegensatz zu dem Übertragungsgeschehen in der Einzelsupervision sehr viel komplexer und diffiziler gestaltet. Die Gruppe sowie der Gruppenleiter werden in diesem Setting zum Gegenstand von Selbstreflexion und Selbsterfahrung, und das gemeinsame Untersuchen des sozialen Handelns selbst führt zu sozialem Handeln. 24
In der Gruppensupervision dominiert die psychoanalytische Orientierung. Insbesondere das von Balint entwickelte Gruppenkonzept hat sich als eines der wichtigsten Supervisionsmodelle herauskristallisiert. Auch diese Methode der Gruppensupervision stellt die kritische Reflexion des eigenen beruflichen Handelns in den Vordergrund, durch die das professionelle Selbstverständnis, die persönlichen Fähigkeiten und die fachlich psychosozialen Kompetenzen der Teilnehmer gestärkt und erweitert werden sollen. 25
4.3 Teamsupervision
Die Teamsupervision stellt als eine spezielle Form der Gruppensupervision eine relativ neue Komponente dar. Vor allem multiprofessionelle Arbeitsgruppen (Arbeitsgruppen in Beratungsstellen, Heimen und im klinischen Bereich) erfordern Teamarbeit. In diesem Rahmen kommt Gesichtspunkten wie Hierarchie, Arbeits- und Aufgabendifferenzierung, Informationsprobleme und unterschiedliche berufliche Hintergründe der Teammitglieder eine besondere Bedeutung zu. Aber auch monoprofessionelle Arbeitsgruppen (Kindergarten, Jugendhaus, ASD) erzwingen immer häufiger Teamarbeit. 26
Ein Team wird zunächst einmal verstanden als kooperierende Arbeitsgruppe im Rahmen einer Institution oder Organisation auf fachlicher und persönlicher Basis, d.h., aus der „Stranger- Group“ wird hier eine „Family- Group“. Dieser Umstand stellt den Supervisor vor zusätzliche Komplikationen, da reale Arbeitsplatzbeziehungen untereinander bestehen. Die Teilnehmer haben eine Vorgeschichte und begegnen sich täglich in ihren beruflichen Rollen. Daraus resultieren charakteristische Probleme, die dieses Setting hervorbringt. Es kommen zum Beispiel überwiegend gemeinsame Arbeitsprobleme zur Sprache sowie Hierarchie- und Leitungsfragen. Beziehungen untereinander und Beziehungsstörungen sind viel häufiger Diskussionsthema als beispielsweise in der Gruppensupervision. Die Gefahr bei der Teamsupervision besteht demnach darin, dass die Klientel (also der jeweilige Fall) in den Hintergrund gerät. Weiterhin stoßen die Teams im Profit- Bereich häufig an die Grenzen der Organisation, frei nach dem Motto, „in der Team- Supervision darf man alles sagen, nur ändern darf sich nichts“. 27
Da viele Teams eher Personen sind, die im Institutionskontext nebeneinander arbeiten, hat Teamsupervision in den meisten Fällen zunächst einmal die Aufgabe, überhaupt Austausch und Teamfähigkeit herzustellen. Generell verfolgt die Teamsupervision folgende übergeordnete Ziele:
(1) Die Verbesserung der Kommunikation und Kooperation im Team und zusätzlich zwischen dem Team und den übrigen Mitgliedern der Organisation/ Institution.
(2) Die Befähigung des Teams, den eigenen Konfliktlösungsprozess in Gang zu setzen und Konflikte selbstständig zu lösen.
(3) Der Aufbau einer internen Aufgaben- und Rollenverteilung im Team (insbesondere zur Bearbeitung von Machtkonflikten) 28
Die Teamsupervision ist inzwischen die am häufigsten angewandte Supervisionsform. Sie markiert den Übergang der Supervision von der Einzelsituation über die arbeitsplatzferne Gruppensupervision bis hin zur Organisationsentwicklung.
4.4 Organisationsentwicklung
„In erster Linie ist [die Organisationsentwicklung] eine pädagogische Taktik, mit der voraus geplante organisatorische Veränderungen vorgenommen werden sollen. Die einzelnen Verfahren können äußerst verschiedenartig sein.“ 29
Die Anfänge der Organisationsentwicklung liegen im Taylorismus (1884) begründet, der eine typische Erscheinungsform des damals vorherrschenden expansiven Industriekapitalismus darstellt und dessen oberstes Ziel die maximale Ausnutzung der Arbeitskraft ist. Soziale Faktoren und Arbeitsplatzbedingungen fallen dabei weitestgehend dem Effizienzgedanken zum Opfer.
Seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts werden diese Grundsätze in zunehmendem Maße von der „Human- Relations- Bewegung“ abgelöst. Diese stellt Untersuchungen über die zentrale Bedeutung sozialer Beziehungen im Zusammenhang mit menschlicher Arbeit an. Das Resultat dieser Untersuchungen ist die Erkenntnis, dass Arbeit immer eine Gruppentätigkeit darstellt, bei der Gesichtspunkte wie positive soziale Beziehungen, Anerkennung, Wertschätzung und ein gewisser Handlungsspielraum die beruflichen Leistungen steigern können. Zusätzlich zu diesen Erkenntnissen wird das von Lewin entwickelte erste gruppendynamische Modell immer populärer. Aus diesen fortschrittlichen Entwicklungen entstammen die ersten Modelle der Organisationsentwicklung - z.B. das Modell von Benne und Birnbaum, deren Modell die Förderung menschlicher Potentiale (human ressources) und Strukturveränderungen zum Ziel hat. 30
Im Non- Profit- Bereich findet die Organisationsentwicklung erst seit Ende der 80er Jahre Eingang. Ihre Entstehung findet über einen Umweg von den psychotherapeutisch beeinflussten Methoden über die Teamsupervision und letztlich hin zur Organisationsentwicklung statt. „Möglicherweise haben die Erfolge der Organisationsentwicklung im Profit- Sektor wie ein »Berührungstabu« gewirkt. Wahrscheinlich war die Zeit zur Rezeption der Organisationsentwicklung noch nicht reif.“31
Die Organisationsentwicklung ist noch in der Entwicklung begriffen und bedeutet allgemein, dass ein externer Berater versucht, organisatorische Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Am Anfang steht in der Regel die Organisationsanalyse, d.h., es werden Untersuchungen zur Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens bzw. der Institution durchgeführt.
Das übergeordnete Ziel der Organisationsentwicklung ist die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (Effizienz) und der Leistungsfähigkeit (Effektivität) des Unternehmens. Die Erwartungen und Interessen der Mitarbeiter sollen diesbezüglich so früh wie möglich in den Entscheidungsprozess miteinbezogen werden, um dann die notwendigen Veränderungen der Strukturen und der menschlichen Verhaltensweisen in diesen Strukturen zu bewirken. Es geht also dementsprechend um die Bemühungen, eine Balance zwischen den Gesamtzielen der Organisation und den Wünschen, Interessen und Bedürfnissen der Organisationsmitglieder herzustellen. Das Gesamtsystem soll dadurch in die Lage versetzt werden, Weiterentwicklung aus eigenem Antrieb und eigenem Vermögen heraus zu betreiben. 32
4.5 Fall- vs. Teamsupervision
„Fallsupervision ist die Reflexion über den Umgang mit den Patienten und den für sie wichtigen Bezugspersonen - im Gesundheitswesen häufig den Angehörigen und den anderen Behandlern.“ 33
Das übergeordnete Ziel der Fallsupervision ist es, die beruflich bedingte Beziehung und Behandlung des Supervisanden zu dem jeweiligen Patienten zu verbessern, um dadurch konstruktiver und konfliktfreier mit ihnen umgehen zu können. Der Patient steht dementsprechend im Mittelpunkt des Supervisionsprozesses und kann direkt in die Supervisionssitzungen eingebunden werden, um an Ort und Stelle mit dem Supervisor und dem Supervisanden an dem aktuellen Konflikt zu arbeiten.
Im Rahmen der Fallsupervision gibt es viele verschiedene Methoden und Settings. Neben den Einzelsettings nennen Schlippe und Schweitzer die „Live- Supervision“ als eine der direktesten Supervisionsformen. Bei diesem Mehrpersonensetting beobachtet eine Supervisionsgruppe das Beratungsgeschehen zwischen dem Supervisor und dem Supervisanden. Ihre Beobachtungen, Reflexionen und Vorschläge für Schlussinterventionen sind wichtige Faktoren im Supervisionsprozess und gestalten dessen Ablauf im wesentlichen mit. Weitere Methoden sind die Video- und Excerptsupervision, das Rollenspiel oder die erlebnisorientiertere Methode der Skulpturarbeit. 34
Die Teamsupervision sowie die Organisationsentwicklung dienen dagegen der Lösung von Problemen, die sich in der Einrichtung permanent stellen und nicht lediglich Bezug auf einzelne Patienten nehmen. Ein externer Supervisor ermöglicht eine weitestgehend wirtschaftliche, hierarchische und emotionale Unabhängigkeit gegenüber einem zu supervidierenden Team. Daher wird diese Opportunität, ungeachtet der höheren Finanzkosten, bevorzugt in Anspruch genommen.
In vielen Fällen betrifft der bestehende Konflikt nicht nur das Team, sondern auch die unmittelbaren Vorgesetzten der Supervisionsteilnehmer. Daraus leitet sich die häufig diskutierte Frage ab, ob Leitungspersonen ebenfalls an den Sitzungen teilnehmen sollten. Bei ausbleibender Teilnahme kann es innerhalb des Teams zu einer „Verschwörung“ gegen die Vorgesetzten kommen, nehmen die Vorgesetzten hingegen an den Sitzungen teil, so ist eine vertrauensvolle Öffnung der Supervisanden fragwürdig.
Um Rollenklarheit in solchen Situationen zu bewahren, werden sogenannte „Dreieckskontrakte“ zwischen den Supervisanden, den Auftraggebern und dem Supervisor abgeschlossen (beispielsweise nach dem „Top- Down- Prinzip“). 35
[...]
1 Vergl. Fatzer 2000, Seite 9 ff
2 Caemmerer in: ebenda, Seite 54
3 Geissler in: ebenda, Seite 20
4 Vergl. Belardi 1994, Seite 11
5 Vergl. Fatzer 2000, Seite 55 ff
6 Vergl. ebenda Seite 56 und Wilker 1999, Seite 15
7 Vergl. Wilker 1999, Seite 12 ff
8 Vergl. Belardi 1994, Seite 36 ff
9 Wilker 1999, S. 6
10 Belardi 1994, Seite 34
11 Vergl. ebenda, Seite 33-36
12 Ebenda, Seite 36
13 Vergl. Pine 1990, Seite 232 ff
14 Vergl. Belardi 1994, Seite 36-39
15 Vergl. ebenda, Seite 85 ff
16 Vergl. Pühl 2000a, Seite 278 f und Fatzer 2000, Seite 58-62
17 Belardi 1994, Seite 92
18 Vergl. ebenda, Seite 93 ff
19 Ebenda, Seite 101
20 Huppertz in: ebenda, Seite 102
21 Wilker 1999, Seite 15
22 Ebenda, Seite 201 f
23 Belardi 1994, Seite 102 ff
24 Vergl. ebenda, Seite 105 ff
25 Vergl. Pühl 2000b, Seite 57 und Fatzer, 2000, Seite 143
26 Vergl. Belardi 1994, Seite 113 ff
27 Ebenda, S.114
28 Fatzer 2000, Seite 258 f
29 Bennis in: Belardi 1994, Seite 130
30 Vergl. ebenda, Seite 125 ff
31 Ebenda, Seite 128
32 Vergl. ebenda, Seite 129-132
33 Schweitzer und Schlippe in: Hennch u.a., 1998, Seite 25
34 Vergl. ebenda, Seite 25 ff
35 Vergl. ebenda, Seite 31 ff
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832460464
- ISBN (Paperback)
- 9783838660462
- DOI
- 10.3239/9783832460464
- Dateigröße
- 680 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Duisburg-Essen – Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2002 (November)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- balint-gruppen salzburger modell qualitätsmerkmal supervision coaching abwehr
- Produktsicherheit
- Diplom.de