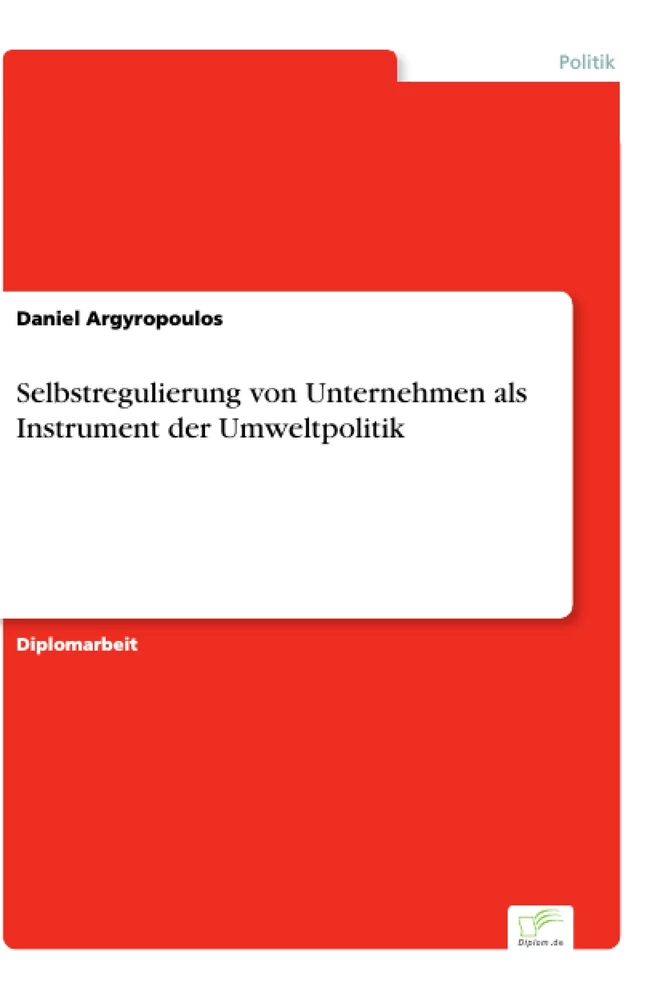Selbstregulierung von Unternehmen als Instrument der Umweltpolitik
©2002
Diplomarbeit
191 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Das Thema der Arbeit ist die Selbstregulierung von Unternehmen. Davon ausgehend, dass Umweltpolitik mit einer neuen Problemlage konfrontiert ist, und dass das herkömmliche ordnungsrechtliche Instrumentarium dabei an seine Grenzen stößt, wird nach dem Beitrag von freiwilligen umweltpolitischen Ansätzen zur Modernisierung von Umweltpolitik gefragt. Es wird die These vertreten, dass freiwillige Ansätze einen größeren Beitrag zur Bekämpfung persistenter, komplexer und globaler Umweltprobleme leisten können als bisher angenommen.
Nach der Erarbeitung einer Definition und einem Überblick über die Existenz freiwilliger Ansätze in der EU insbesondere in Deutschland und den Niederlanden und den USA wird das heterogene Feld der freiwilligen Ansätze anhand zentraler Unterscheidungskriterien strukturiert.
Anschließend werden freiwillige Ansätze aus der Perspektive der Theorie des kollektiven Handelns und des Konzeptes der ökologischen Modernisierung diskutiert. Daraus werden Hypothesen abgeleitet, die auf die durch freiwillige Ansätze gegebenen Möglichkeiten abzielen, Marktversagen einerseits und Staatsversagen andererseits zu vermeiden. Diese werden an zwei Fallbeispielen aus der chemischen Industrie überprüft.
Die Ergebnisse bestätigen die eingangs aufgestellte These nur bedingt. Es lassen sich mehrere Designfehler identifizieren, die verhindern, daß freiwillige Ansätze in der vorhandenen Form als ein Instrument der Umweltpolitik beurteilt werden können, das den Staat bei der Aufgabe des Umweltschutzes entlastet.
Abschließend werden Vorschläge formuliert, wie der zwar vielgenutzte, aber unsystematisch eingesetzte Instrumententypus in einen wirkungsvollen Instrumentenmix der Umweltpolitik eingegliedert werden können.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
2.Freiwillige Ansätze: Eine Systematisierung5
2.1Umweltpolitische Instrumente und freiwillige Ansätze5
2.2Begriffe und Definitionen7
2.3Verbreitung und Anwendungsfelder von freiwilligen Ansätzen10
2.3.1Die Europäische Union: Negotiated Agreements10
2.3.2Deutschland: Selbstverpflichtungen und freiwillige Vereinbarungen12
2.3.3Die Niederlande: Der Sonderfall der covenants13
2.3.4USA: Public Voluntary Schemes15
2.4Motive für freiwillige Ansätze16
2.5Die zentralen Unterscheidungskriterien freiwilliger Ansätze18
2.5.1Anzahl und Art der Akteure18
2.5.2Maß an Freiwilligkeit22
2.5.3Legaler Status23
2.5.4Verhältnis zu anderen umweltpolitischen […]
Das Thema der Arbeit ist die Selbstregulierung von Unternehmen. Davon ausgehend, dass Umweltpolitik mit einer neuen Problemlage konfrontiert ist, und dass das herkömmliche ordnungsrechtliche Instrumentarium dabei an seine Grenzen stößt, wird nach dem Beitrag von freiwilligen umweltpolitischen Ansätzen zur Modernisierung von Umweltpolitik gefragt. Es wird die These vertreten, dass freiwillige Ansätze einen größeren Beitrag zur Bekämpfung persistenter, komplexer und globaler Umweltprobleme leisten können als bisher angenommen.
Nach der Erarbeitung einer Definition und einem Überblick über die Existenz freiwilliger Ansätze in der EU insbesondere in Deutschland und den Niederlanden und den USA wird das heterogene Feld der freiwilligen Ansätze anhand zentraler Unterscheidungskriterien strukturiert.
Anschließend werden freiwillige Ansätze aus der Perspektive der Theorie des kollektiven Handelns und des Konzeptes der ökologischen Modernisierung diskutiert. Daraus werden Hypothesen abgeleitet, die auf die durch freiwillige Ansätze gegebenen Möglichkeiten abzielen, Marktversagen einerseits und Staatsversagen andererseits zu vermeiden. Diese werden an zwei Fallbeispielen aus der chemischen Industrie überprüft.
Die Ergebnisse bestätigen die eingangs aufgestellte These nur bedingt. Es lassen sich mehrere Designfehler identifizieren, die verhindern, daß freiwillige Ansätze in der vorhandenen Form als ein Instrument der Umweltpolitik beurteilt werden können, das den Staat bei der Aufgabe des Umweltschutzes entlastet.
Abschließend werden Vorschläge formuliert, wie der zwar vielgenutzte, aber unsystematisch eingesetzte Instrumententypus in einen wirkungsvollen Instrumentenmix der Umweltpolitik eingegliedert werden können.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
2.Freiwillige Ansätze: Eine Systematisierung5
2.1Umweltpolitische Instrumente und freiwillige Ansätze5
2.2Begriffe und Definitionen7
2.3Verbreitung und Anwendungsfelder von freiwilligen Ansätzen10
2.3.1Die Europäische Union: Negotiated Agreements10
2.3.2Deutschland: Selbstverpflichtungen und freiwillige Vereinbarungen12
2.3.3Die Niederlande: Der Sonderfall der covenants13
2.3.4USA: Public Voluntary Schemes15
2.4Motive für freiwillige Ansätze16
2.5Die zentralen Unterscheidungskriterien freiwilliger Ansätze18
2.5.1Anzahl und Art der Akteure18
2.5.2Maß an Freiwilligkeit22
2.5.3Legaler Status23
2.5.4Verhältnis zu anderen umweltpolitischen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6251
Argyrropoulos, Daniel: Selbstregulierung von Unternehmen als Instrument der
Umweltpolitik
Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Berlin, Universität, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
III
Zusammenfassung
Das Thema der Arbeit ist die Selbstregulierung von Unternehmen. Davon ausgehend,
daß Umweltpolitik mit einer neuen Problemlage konfrontiert ist, und daß das herkömm-
liche ordnungsrechtliche Instrumentarium dabei an seine Grenzen stößt, wird nach dem
Beitrag von freiwilligen umweltpolitischen Ansätzen zur Modernisierung von Umwelt-
politik gefragt. Es wird die These vertreten, daß freiwillige Ansätze einen größeren Bei-
trag zur Bekämpfung persistenter, komplexer und globaler Umweltprobleme leisten
können als bisher angenommen. Nach der Erarbeitung einer Definition und einem
Überblick über die Existenz freiwilliger Ansätze in der EU insbesondere in Deutsch-
land und den Niederlanden und den USA wird das heterogene Feld der freiwilligen
Ansätze anhand zentraler Unterscheidungskriterien strukturiert. Anschließend werden
freiwillige Ansätze aus der Perspektive der Theorie des kollektiven Handelns und des
Konzeptes der ökologischen Modernisierung diskutiert. Daraus werden Hypothesen
abgeleitet, die auf die durch freiwillige Ansätze gegebenen Möglichkeiten abzielen,
Marktversagen einerseits und Staatsversagen andererseits zu vermeiden. Diese werden
an zwei Fallbeispielen aus der chemischen Industrie überprüft. Die Ergebnisse bestäti-
gen die eingangs aufgestellte These nur bedingt. Es lassen sich mehrere ,,Designfehler"
identifizieren, die verhindern, daß freiwillige Ansätze in der vorhandenen Form als ein
Instrument der Umweltpolitik beurteilt werden können, das den Staat bei der Aufgabe
des Umweltschutzes entlastet. Abschließend werden Vorschläge formuliert, wie der
zwar vielgenutzte, aber unsystematisch eingesetzte Instrumententypus in einen
wirkungsvollen Instrumentenmix der Umweltpolitik eingegliedert werden können.
Summary
The topic of this paper is self-regulation by industry. Assuming that environmental pol-
icy will have to deal with new kinds of problems and that traditional regulating policy
reaches its limits, the question is raised as to what contribution voluntary approaches in
environmental policy can make to modernize environmental policy. This paper claims
that voluntary approaches can indeed make a bigger contribution to the abatement of
persistent, complex and global environmental problems than is generally assumed. After
developing a definition of voluntary approaches and providing an overview of their ex-
istence in the EU - in Germany and the Netherlands in particular - and in the USA, the
diverse field of these approaches is categorized by applying central criteria of differen-
tiation. Subsequently, voluntary approaches are discussed from the perspective of the
theory of collective action and the concept of ecological modernization. From the fore-
going, several hypotheses are derived on the possibilities of avoiding market and state
failure. The hypotheses are tested against two cases from the chemical industry in Ger-
many and the results confirm the main assumption in part only. Several deficiencies in
the "design" of voluntary approaches are identified which minimize their effectiveness
in their present form, as an instrument of environmental policy that would relieve the
state of its task of protecting the environment. Finally, a proposal is formulated on how
voluntary approaches (which are frequently used but in an unsystematic way) can be
integrated in an effective mix of environmental policy instruments.
V
Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung ...1
2
Freiwillige Ansätze: Eine Systematisierung...5
2.1
Umweltpolitische Instrumente und freiwillige Ansätze... 5
2.2
Begriffe und Definitionen ... 7
2.3
Verbreitung und Anwendungsfelder von freiwilligen Ansätzen... 10
2.3.1
Die Europäische Union: Negotiated Agreements... 10
2.3.2
Deutschland: Selbstverpflichtungen und freiwillige
Vereinbarungen... 12
2.3.3
Die Niederlande: Der Sonderfall der covenants... 13
2.3.4
USA: Public Voluntary Schemes ... 15
2.4
Motive für freiwillige Ansätze ... 16
2.5
Die zentralen Unterscheidungskriterien freiwilliger Ansätze... 18
2.5.1
Anzahl und Art der Akteure ... 18
2.5.2
Maß an Freiwilligkeit... 22
2.5.3
Legaler Status ... 23
2.5.4
Verhältnis zu anderen umweltpolitischen Normen ... 24
2.5.5
Reichweite und Laufzeit ... 25
2.5.6
Eingrenzung für den weiteren Verlauf der Untersuchung... 27
3 Theoretische Erklärungsansätze ...28
3.1
Die Auswahl der theoretischen Ansätze ... 28
3.2
Die Theorie des kollektiven Handelns... 29
3.2.1
Kollektives Handeln und die Umweltproblematik ... 29
3.2.2
Soziales Dilemma und free-rider-Problem ... 31
3.2.3
Lösungsansätze: Kleine Gruppengröße und selektive
Anreize... 32
3.2.4
Die Kritik an der Theorie... 36
3.2.5
Hypothesen ... 38
3.3
Ökologische Modernisierung ... 40
3.3.1
Entstehung und inhaltliche Ausrichtung des Konzepts... 40
3.3.2
Der technische Lösungsansatz... 41
3.3.3
Politische Modernisierung ... 43
3.3.4
Netzwerke als Merkmal politischer Modernisierung ... 48
3.3.5
Freiwillige Ansätze zwischen politischer Modernisierung und
Korporatismus ... 51
3.3.6
Hypothesen ... 52
4 Fallbeispiele...53
VI
4.1
Selbstverpflichtungen der chemischen Industrie... 53
4.2
Die Klimaschutzverpflichtung der chemischen Industrie ... 54
4.2.1
Die Klimaschutzverpflichtung der deutschen Wirtschaft... 54
4.2.2
Inhalt und Umsetzung der Selbstverpflichtung des VCI ... 55
4.2.3
Einordnung anhand der entwickelten Typologie ... 57
4.2.4
Überprüfung der Hypothesen ... 60
4.2.5
Zusammenfassung... 64
4.3
Die Vereinbarung zwischen der deutschen chemischen Industrie
und dem Hafen von Rotterdam... 65
4.3.1
Hintergrund und Entwicklung der Vereinbarung ... 65
4.3.2
Inhalt und Umsetzung der Vereinbarung ... 67
4.3.3
Einordnung anhand der Typologie... 69
4.3.4
Überprüfung der Hypothesen ... 70
4.3.5
Zusammenfassung... 74
5
Fazit ...75
5.1
Ergebnisse der Untersuchung ... 75
5.2
Notwendige Weiterentwicklung von freiwilligen Ansätzen ... 78
6
Literaturverzeichnis ...82
Darstellungsverzeichnis
Darstellung 1.: Typen freiwilliger Ansätze ...9
Darstellung 2.: Einfluß des jeweiligen Akteurs in den Typen freiwilliger
Ansätze ...9
Darstellung 3.: Verteilung freiwilliger Vereinbarungen in der EU...11
Darstellung 4.: Aufschlüsselung von freiwilligen Vereinbarungen in der
EU nach Industriebereichen ...12
Darstellung 5.: Verteilung der Selbstverpflichtungen nach
Problembereichen ...13
Darstellung 6.: Ein- und zweistufiges Modell freiwilliger Ansätze ...21
Darstellung 7.: Typologie freiwilliger Ansätze...27
Darstellung 8.: Interaktion der Politik- und Unternehmensebene ...80
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1.: Ziele der Vereinbarung von 1991 und tatsächliche
Reduktionen ...68
Tabelle 2.: Reduktionsziele der Vereinbarungen von 1995 und 2000.69
VII
Abkürzungsverzeichnis
AG
Aktiengesellschaft
AO
x
Halogenverbindungen
BDI
Bundesverband der Deutschen Industrie
BGW
Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft
BMU
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BMWi
Bundesministerium für Wirtschaft
BUND
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
CO
2
Kohlendioxid
COP
Conference of the Parties
CPR
Common Pool Resources
DDR
Deutsche Demokratische Republik
EPA
Environmental Protection Agency
EU
Europäische Union
FCKW
Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoff
ICPR
International Commission for the Protection of the Rhine
JEP
Joint Environmental Policies
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen
NEPP
National Environmental Policy Plan
NO
x
Stickoxide
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development
OSPAR
Oslo Paris Convention
RMPM
Rotterdam Municipal Port Management
RWI
Rheinisch-westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung
SO
2
Schwefeldioxid
SRU
Sachverständigenrat für Umweltfragen
THG
Treibhausgase
TNK
Transnationale Konzerne
UBA
Umweltbundesamt
UGB
Umweltgesetzbuch
VCI
Verband der chemischen Industrie
VIII
VDEW
Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke
VIK
Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft
VKU
Verband Kommunaler Unternehmen
1
1 Einleitung
Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Selbstregulierung von Unternehmen und
deren Bedeutung für die Umweltpolitik. Es ist ein häufig diskutiertes Thema mit vie-
len Facetten, das jedoch bislang, insbesondere durch die deutsche Politikwissen-
schaft, wenig untersucht wurde (ELNI 1998: 9). Dies mag verwundern, da die deut-
sche und die internationale Umweltpolitik durch die Entwicklung der letzten 10 Jahre
vor neue und schwierige Herausforderungen gestellt wurde, für die die Politikwis-
senschaft Lösungsvorschläge zu erarbeiten vermag.
Bezüglich der allgemeinen Qualität der Umwelt stellt der Sachverständigenrat für
Umweltfragen (SRU) trotz umweltpolitischer Teilerfolge einen ,,anhaltend negativen
Trendverlauf" (SRU 2002: 10) fest. Eine besondere Herausforderung stellen die s o-
genannten persistenten Probleme dar, d.h. solche Probleme, bei denen staatliche
Maßnahmen über einen längeren Zeitraum keine Trendverbesserung gebracht haben,
wie z.B. der Artenschwund, die Grundwasserkontamination oder die Bodenversiege-
lung. Darüber hinaus kann beobachtet werden, daß (nationale) Umweltpolitik sich
Problemtypen einer gänzlich neuen Qualität anzunehmen hat. Das Problem des Kli-
mawandels beispielsweise zeichnet sich aus durch die globale Reichweite, geringe
Sichtbarkeit, schleichende Verschlechterung, Irreversibilität und die Langfristigkeit
der Problemauswirkung.
Persistente, komplexe und globale Umweltprobleme zusammengenommen stel-
len eine deutliche Veränderung der Problemstruktur dar. Diesen kann nicht mehr,
wie den Umweltproblemen aus der Anfangszeit dieses Politikfeldes, allein anhand
von Ge- und Verboten, dem klassischen Instrumentarium des Ordnungsrechts, ange-
messen begegnet werden. Hinzu kommt, daß es gerade im Umweltbereich immer
mehr Erfahrungen gibt, die nicht gemacht werden dürfen, sondern durch die Um-
weltpolitik antizipiert werden müssen (Jänicke 1986). Ein allgemeines Struktur-
merkmal demokratisch verfaßter Systeme ist allerdings, daß Parlament und Regie-
rung einen begrenzten Zeithorizont haben und notgedrungen eine reaktive Politik
verfolgen. Es ergibt sich also ein Widerspruch zwischen den Erfordernissen einer
antizipierenden Umweltpolitik und der Wirklichkeit politischer Entscheidungspro-
zesse, die sich an Legislaturperioden orientieren. Es ist zu überlegen, wie das beste-
hende Instrumentarium, das im Sinne der Gefahrenabwehr nach wie vor unentbehr-
lich ist, sinnvoll um vorsorgende Elemente ergänzt werden kann.
2
Meines Erachtens sollte ausführlicher erörtert werden, welchen Beitrag eine Stra-
tegie, die auf eine vermehrte Selbstregulierung von Wirtschaftsakteuren setzt, leisten
kann. Viele pragmatische Gründe, aber auch bestehende politische Grundsätze wie
das Subsidiaritätsprinzip, das Kooperationsprinzip und nicht zuletzt das Konzept der
Nachhaltigkeit, das die Partizipation gesellschaftlicher Akteure fordert, sprechen
dafür, die Chancen, die die Kooperation mit der Wirtschaft bietet, stärker zu nutzen.
Mögliche Risiken dürfen dabei nicht ignoriert werden, die verschiedenen Kooperati-
onsformen müssen einer kritischen Überprüfung unterzogen werden.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich mein Interesse an der Problemstellung. Die
Arbeit versucht, eine differenzierte Betrachtung des Spannungsfeldes zwischen Um-
weltschutz und Wirtschaft anzustellen. Es wird dabei von drei Grundannahmen aus-
gegangen:
Erstens sind Unternehmen als wirtschaftliche Akteure verantwortlich für einen
beträchtlichen Teil des Umweltverbrauchs und der -zerstörung. Sie sind naturgemäß
profitorientiert; jedoch ist zu hinterfragen, ob Gewinnmaximierung und Umwelt-
schutz sich gegenseitig ausschließen.
Zweitens leisten Unternehmen durchaus einen freiwilligen Beitrag zum Umwelt-
schutz, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Es finden sich zahlreiche Beispie-
le der overcompliance, also der Übererfüllung staatlicher Umweltschutznormen. Die
Qualität der freiwillig erbrachten Leistungen divergiert jedoch sehr stark in der Ziel-
setzung.
Drittens ist festzuhalten, daß im Verhältnis Staat-Wirtschaft dem Staat bisher die
Rolle zukam, die Aktivität der Wirtschaft zu regulieren. Bezeichnend dafür ist die
Entstehung der Umweltgesetzgebung in den Industriestaaten während der letzten
Jahrzehnte. Es zeichnet sich jedoch ein Wandel der staatlichen Handlungsformen ab,
bei dem ,,weichere" Instrumente, d.h. solche, die keinen Zwang ausüben, zunehmend
in den Vordergrund treten
1
. Die Summe dieser Veränderungen stellt, wie die Unter-
suchung zeigen wird, einen Paradigmenwechsel der politischen Steuerungsmecha-
nismen dar, vom hierarchischen Modell, in dem der Staat die Rolle des Steuerungs-
1
Die Gründe für die Erweiterung des Instrumentariums sind vielfältiger Natur: Überregu-
lierung, sinkende Steuerungsfähigkeit bei klassischen Instrumenten und die Zeitdauer
ordnungsrechtlicher Verfahren sind wichtige Motive konsensualen Handelns. Das Ko-
operationsprinzip in der Umweltpolitik ist auch ein Grund, das ,,Aushandeln" dem ,,Be-
fehlen" vorzuziehen.
3
akteurs für sich beansprucht, zum kooperativen Modell, in dem Steuerung verstärkt
durch gesellschaftliche Akteure, also auch Unternehmen, stattfindet.
Vor dem Hintergrund des gesamten Spektrums privatwirtschaftlicher umwelt-
politischer Aktivitäten, zu dem z.B. auch Lobby-Arbeit gehört, meint Selbstregulie-
rung die umweltschutzmotivierte Beschränkung unternehmerischen Handelns, ohne
daß dies zwingend vom Gesetzgeber vorgeschrieben wäre. Es kann eine Vielzahl
unterschiedlicher Formen privater Selbstregulierung identifiziert werden. Dazu zäh-
len u.a. Umweltmanagementsysteme, Umweltlabeling, Kooperationen zwischen Un-
ternehmen und Umweltverbänden sowie Selbstverpflichtungen und freiwillige Ver-
einbarungen.
Der Untersuchungsgegenstand der Arbeit sind freiwillige umweltpolitische An-
sätze (voluntary approaches in environmental policy): In Deutschland sind sie haupt-
sächlich in Form von Selbstverpflichtungen und freiwilligen Vereinbarungen zu fin-
den. Diese etablieren sich zunehmend als umweltpolitisches Instrument (ELNI 1998:
9f). Die nationale und internationale Diskussion beschäftigt sich kaum noch mit der
grundsätzlichen Frage ihrer Anerkennung, vielmehr geht es darum zu identifizieren,
unter welchen Bedingungen sie erfolgreich sind (CEEM 1999). Es handelt sich um
keinen klar definierten Begriff. Das gemeinsame Merkmal freiwilliger Ansätze ist,
daß die Regulierung seitens des privaten Akteurs stattfindet und nicht von staatlicher
Seite vorgeschrieben wird. Eine genaue Definition soll durch die Untersuchung erar-
beitet werden. Gegenstand der Untersuchung sind die hauptsächlich in Deutschland
vorhandenen freiwilligen Ansätze, jedoch findet eine Einordnung in den
internationalen Kontext statt. Insbesondere die Kontrastierung mit dem
niederländischen Modell erscheint sinnvoll und wird in der Arbeit berücksichtigt.
Eine politikwissenschaftliche Herangehensweise scheint dringend erforderlich,
da eine differenzierte Betrachtung der Akteure, ihrer Einflußmöglichkeiten und In-
teraktionsformen von zentraler Bedeutung ist. Das Thema der freiwilligen Ansätze
bietet sich als interessanter und lohnender Untersuchungsgegenstand für die Politik-
wissenschaft an, da es sich im Kern um politische Auseinandersetzungen handelt,
deren Ergebnisse zwar öffentlichkeitswirksam präsentiert werden, die aber im Ver-
borgenen ausgetragen werden. Es ist zu vermuten, daß diese starke Auswirkungen
auf den Prozeß und die Ergebnisse von Umweltpolitik haben.
4
Die Fragestellung der Arbeit bezieht sich zum einen auf freiwillige Ansätze als
institutionelle Arrangements, zum anderen explizit auf die Implikationen von freiwil-
ligen Ansätzen für den Staat als umweltpolitischen Akteur. Konkret wird danach
gefragt,
· was unter freiwilligen Ansätzen zu verstehen ist und welches die zentralen Unter-
scheidungsmerkmale sind;
· unter welchen Bedingungen diese wirkungsvoll ist und
· welche Auswirkung freiwillige Ansätze auf die Steuerungsfähigkeit von - tradi-
tionell staatlich gesteuerter - Umweltpolitik haben.
Die Untersuchung gliedert sich in drei Blöcke (Kapitel 2-4), an die sich eine Zu-
sammenfassung und Diskussion der Ergebnisse anschließt. Die Arbeit ist wie folgt
aufgebaut: In Kapitel 2 findet die Definition freiwilliger Ansätze und die grundle-
gende Eingrenzung für die weitere Untersuchung statt. Nach der Identifizierung ver-
schiedener Typen freiwilliger Ansätze soll zunächst ein auf mehreren Studien beru-
hender Überblick über die Verbreitung freiwilliger Ansätze in Europa und den USA
gegeben werden. Anschließend wird der dominante Typus freiwilliger Ansätze, ne-
gotiated agreements
(freiwillige Vereinbarungen), anhand der in der Literatur identi-
fizierten zentralen Kriterien beschrieben und analysiert.
Im darauffolgenden Kapitel werden freiwillige Ansätze aus der Perspektive von
zwei theoretischen Konzepten, der Theorie des kollektiven Handelns und der ökolo-
gischen Modernisierung, diskutiert. Die am jeweiligen Abschnittsende entwickelten
Hypothesen zu freiwilligen Ansätzen werden im Anschluß anhand zweier Fallbei-
spiele überprüft: der Klimaschutzverpflichtung der chemischen Industrie und der
Vereinbarung des Verbandes der chemischen Industrie (VCI) mit der Stadt Rotter-
dam (Kapitel 4).
Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengetragen
und diskutiert. Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse soll eine begründete Ein-
schätzung darüber gegeben werden, welchen Beitrag die für die Arbeit definierte
Selbstregulierung in Form von freiwilligen Ansätzen von Unternehmen zur Lösung
von Umweltproblemen leisten kann. Aus politologischer Sicht sollen die Bedingun-
gen für ökologisch wirkungsvolle Selbstregulierung seitens der Unternehmen formu-
liert werden. Analysiert werden soll, wie freiwillige Ansätze sinnvoll in einen wir-
kungsvollen Instrumentenmix der Umweltpolitik eingegliedert werden können.
5
Die Grundlage der Arbeit bildet die vorhandene Literatur, darunter die Publika-
tionen laufender und bereits abgeschlossener Forschungsprojekte, Veröffentlichun-
gen der wirtschaftlichen Akteure und von internationalen Organisationen (OECD,
EU). Die somit auf theoretischer Basis gewonnenen Erkenntnisse werden durch In-
terviews mit Mitarbeitern des Bundesumweltministeriums (BMU), des Bundesver-
bands der Deutschen Industrie (BDI) und des Bundes für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) vertieft.
Aufgrund des festzustellenden gravierenden Datenmangels bezüglich einzelner
freiwilliger umweltpolitischer Ansätze wird bei der Behandlung der Fallbeispiele
zum einen auf zentrale empirische Studien zurückgegriffen (Klimaschutzverpflich-
tung), zum anderen wurden zusätzlich zu den Rechercheergebnissen in Form von
Dokumenten Gespräche geführt, um bestimmte Informationen zu erhalten (Rotter-
dam-Vereinbarung).
2 Freiwillige Ansätze: Eine Systematisierung
2.1 Umweltpolitische Instrumente und freiwillige Ansätze
Instrumente der Umweltpolitik können definiert werden als ,,structured activities
aimed at changing other activities in society towards environmental goals
" (Hu ppes
2001: 8). Obwohl Umweltpolitik ein staatliches Aufgabengebiet darstellt, existiert
kein staatliches Monopol auf die Anwendung von umweltpolitischen Instrumenten.
Der Frage folgend ,,Who influences whom" (Huppes 2001: 20) kann der Staat den
Staat, der Staat private Akteure oder private Akteure andere private Akteure zu len-
ken versuchen
2
.
Das umweltpolitische Instrumentarium läßt sich in ordnungsrechtliche, markt-
wirtschaftliche und freiwillige Instrumente unterteilen (OECD 1999a: 15). In
Deutschland vorherrschend sind ordnungsrechtliche Instrumente, z.B. das Vorschrei-
ben von Grenzwerten und Standards. Sie sind dort unverzichtbar, wo direkte Um-
weltschäden drohen (Jänicke et al. 1999: 101). Instrumente, die auf einem freiwilli-
gen Ansatz basieren, wie z.B. Selbstverpflichtungen und freiwillige Vereinabrungen,
sind zwar seit den 70er Jahren in Deutschland vorhanden, die Anwendung dieser Art
2
Weder Staat noch der private Akteur stellen homogene Blöcke dar. Zu den privaten
Akteuren gehören z.B. Unternehmen, Verbände, Privatpersonen. Zum staatlichen Ak-
teur gehören alle Ebenen von Politik und Verwaltung. Zum Verständnis des Begriffs
,,staatlicher Akteur" sei auf Fußnote 18 verwiesen.
6
von Instrumenten steigt erst in den 90er Jahren deutlich an (ELNI 1998: 45; SRU
1998).
Eine weitere Unterscheidung ist die in weiche und harte Instrumente. Der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen (SRU) spricht in diesem Zusammenhang von wei-
chen Instrumenten, die dem traditionellen harten Instrumentarium zur Seite gestellt
werden (SRU 1994: 68ff). Zu den erstgenannten zählen informatorische, organisato-
rische und freiwillige Instrumente, z.T. auch ökonomische Instrumente, insgesamt
diejenigen ,,Maßnahmen, die ein aktives Verhalten in Richtung eines vorbeugenden
Umweltschutzes fördern, ohne daß dies vorgeschrieben ist
" (Rennings et al. 1996:
170). Harte Instrumente dagegen sind solche, die ein bestimmtes Verhalten, z.B. das
Einhalten eines Grenzwertes, vorschreiben und die Nicht-Einhaltung sanktionieren.
Obwohl an dieser Stelle die umfangreiche Instrumentendiskussion in der Um-
weltpolitik nicht ausführlich wiedergegeben wird, soll auf die von politikwissen-
schaftlicher Seite formulierte Kritik am Instrumentalismus eingegangen werden. Die-
se bezieht sich auf den instrumentellen, d.h. auf den Einsatz von spezifischen Instru-
menten fixierten Ansatz der Umweltpolitik. Die Vorstellung, daß der Einsatz eines
einzelnen Instrumentes eine erwünschte Wirkung erzielt, läßt eine mechanistische,
modellhafte Perspektive erkennen, die die Realität nur unzureichend widerspiegelt.
Kritiker des Instrumentalismus verweisen auf die Bedeutung einer strategischen Aus-
richtung von Umweltpolitik. Sie ist gekennzeichnet durch die Zielbildung bei flexi-
blem Instrumenteneinsatz anstelle einer fehlenden oder schwachen Formulierung von
Zielen bei gleichzeitiger Fixierung auf ein spezifisches Instrument. Betont wird, daß
ein einmal festgelegtes Ziel mit einem ausgewogenen Instrumentenmix am besten zu
erreichen ist (Jänicke 2002: 69).
Zusätzlich ist auf die Bedeutung des Politikstils hinzuweisen (z.B. Jänicke 1999:
109f). Dieser ist je nach Instrument unterschiedlich und kann großen Einfluß auf die
erwünschte Wirkung haben. Ordnungsrechtliche Instrumente bedeuten einen dirigi-
stischen Politikstil, der schnell den Widerstand der Politikadressaten und den
Wunsch, die Regelung zu umgehen, hervorrufen kann. Freiwillige Ansätze dagegen
bieten die Möglichkeit, durch einen kooperativen Politikstil den Widerstand des
Adressaten zu umgehen.
Freiwillige Ansätze sind vor dem Hintergrund der dargestellten Kritik eines ein-
seitigen Instrumenteneinsatzes zu betrachten. Sie beinhalten eine Vielzahl von Aus-
7
gestaltungsmöglichkeiten und sie berücksichtigen jeweils den spezifischen Hand-
lungskontext einer Situation. Das Vorhandensein einer ,,maßgeschneiderten Lösung"
(Trute 1999: 43) und ein kooperativer Politikstil sind zentrale Eigenschaften freiwil-
liger Ansätze. Gerade aufgrund dieser Anpassungsfähigkeit sind freiwillige Ansätze
ein interessantes Untersuchungsfeld, jedoch ist festzuhalten, daß es sich weniger um
ein konkretes Instrument als um einen Instrumententypus handelt.
Die Vielfalt von freiwilligen Ansätzen erschwert deren Untersuchung. Im fol-
genden Abschnitt wird zunächst eine Definition erarbeitet, anschließend wird anhand
zentraler Kriterien versucht, den in Deutschland dominanten Typus freiwilliger um-
weltpolitischer Ansätze herauszufinden.
2.2 Begriffe und Definitionen
Das breitgefächerte Feld freiwilliger Ansätze soll zunächst erfaßt und systematisiert
werden. Dazu werden die in der Literatur vorhandenen verschiedenen Begriffe ge-
genübergestellt. Anhand zu identifizierender Haupttypen wird anschließend die
Verbreitung freiwilliger Ansätze in systematischer Form dargestellt.
Die Mehrzahl der Untersuchungen über freiwillige umweltpolitische Ansätze ist
englischsprachig. Es läßt sich eine Vielzahl von Begriffen finden: Die geläufigsten
sind voluntary agreements (ELNI 1998; EEA 1997), joint environmental policy-
making
(Mol et al. 2000) und voluntary approaches (CAVA 2001). Sämtliche Be-
griffe implizieren die Freiwilligkeit, den gemeinsamen Ansatz der beteiligten Partei-
en oder beides zusammen. In Deutschland werden fast ausschließlich die Begriffe
Selbstverpflichtung und freiwillige Vereinbarung verwendet, wobei diese nicht strikt
voneinander zu trennen sind (ELNI 1998: 45)
3
.
Der Begriff Selbstverpflichtung impliziert zwar die Eigeninitiative des Unter-
nehmens, jedoch wird in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, daß
selbst Ansätze, die von Unternehmensseite gerne als solche dargestellt werden, meist
Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Unternehmensseite und dem Staat sind
(ELNI 1998: 46). Selbst bei als unilateral bezeichneten Ansätzen ist davon auszuge-
hen, daß im Vorfeld Konsultationen oder Verhandlungen mit staatlichen Stellen
3
Daneben existieren noch eine Fülle anderer Begriffe wie freiwillige (Rahmen-) Vereinba-
rungen oder Arrangements, Verhaltenskodizes, Umweltchartas, Zusagen, Empfehlun-
gen und Sicherheitskonzepte (Faber 2001: 77f).
8
stattgefunden haben. Hucklenbruch verweist auf eine bemerkenswerte Veränderung
der Sprachregelung seitens des BMU: War vor zehn Jahren der Begriff Vereinbarung
gängig, so wird heute vornehmlich von Selbstbindung oder -verpflichtung gespro-
chen, um den Eindruck des staatlichen Paktierens mit der Wirtschaft zu vermeiden
(Hucklenbruch 2000: 78)
4
.
Der Begriff freiwillige umweltpolitische Ansätze, in Anlehnung an voluntary ap-
proaches in environmental policy,
scheint einen ausreichend breiten Zugang zu bie-
ten, um sowohl die deutsche Situation untersuchen als auch die internationale Ent-
wicklung berücksichtigen zu können
5
. Dieser soll im Folgenden verwendet werden.
Freiwillige Ansätze stellen einen Aspekt des selbstregulierenden Verhaltens von
Unternehmen dar, auf den ich mich in der Untersuchung konzentriere. Wie bereits
herausgestellt, handelt es sich dabei um kein klar abgegrenztes Instrument, und bis-
lang existiert keine Standarddefinition. Highley und Léveque definieren freiwillige
Ansätze wie folgt:
,,Voluntary approaches are commitments from polluting firms or sec-
tors to improve their environmental performance. `Voluntary ap-
proaches' is a broad term that encompasses many different kinds of
arrangements, such as self-regulation, voluntary initiatives, voluntary
codes, environmental charters, voluntary accords, voluntary agree-
ments, co-regulation, covenants, and negotiated environmental
agreements, to name just a few." (Highley et al. 2001: 4)
Die Autoren unterscheiden unilateral commitments, public voluntary schemes und
negotiated agreements
als Haupttypen freiwilliger Ansätze.
4
Dieser Punkt muß zumindest relativiert werden, da im Falle der Klimaschutzverpflich-
tung explizit von einem Pakt gesprochen wird.
5
Die Mehrzahl der verwendeten Studien stellt eine vergleichende Betrachtung an, um
nationale Spezifika herauszustellen. Obwohl in der Diplomarbeit deutsche Fallbeispiele
in Form von Selbstverpflichtungen untersucht werden, soll die vergleichende Perspekti-
ve nicht aufgegeben werden.
9
Darstellung 1.: Typen freiwilliger Ansätze
Unilateral
Commitments
Unilateral commitments consist of environmental improvement programmes set
up by firms and communicated to their stakeholders (employees, shareholders,
clients, etc.). An example would be where a firm commits itself to some combina-
tion of reducing its emissions by 20 per cent over five years [...].
Negotiated
Agreements
These are agreements between a sector or groups of sectors to meet one or
more overall targets. A common example is [...] a commitment by automobile
manufacturers to meet fuel efficiency targets in new models.
Public Voluntary
Schemes
In this model, the public authorities set standards [...] or targets to be attained,
and participating firms agree to meet these targets. An example of process type
voluntarism is compliance with the Eco Management and Auditing System
(EMAS) of the European Union [...].
Quelle: Highley et al. 2001: 5
Das zentrale Charakteristikum freiwilliger Ansätze ist, daß der Prozeß der Selbstre-
gulierung von einzelnen Unternehmen bzw. Branchen initiiert wird
6
, oder daß zu-
mindest wie im Falle von public voluntary schemes die Regulierten auf freiwilli-
ger Basis ein vom Staat erarbeitetes Konzept annehmen. Dies ist der wesentliche
Unterschied zum ordnungsrechtlichen Ansatz der top-down-Steuerung, der vom Staat
als regulierendem Subjekt und der Wirtschaft als reguliertem Objekt ausgeht. Trotz
der prominenten Rolle des privaten Akteurs ist die Betrachtung der Rolle des Staates
wichtig. Die Initiative bzw. der Einfluß des jeweiligen Akteurs stellt das Unterschei-
dungskriterium zwischen den verschiedenen Typen dar:
Darstellung 2.: Einfluß des jeweiligen Akteurs in den Typen freiwilliger
Ansätze
Einfluß privater Akteure
Einfluß staatlicher Akteure
Unilateral Commitments
hoch
niedrig
Negotiated Agreements
mittel
mittel
Public Voluntary Schemes
niedrig
hoch
Quelle: OECD 1999a; eigene Darstellung
Die empirische Untersuchung vorhandener freiwilliger Ansätze deutet daraufhin, daß
in der Europäischen Union (EU) die meisten Fälle den ersten beiden Typen zuzuord-
nen sind (DeClercq et al. 2001: 15). Die Ergebnisse der Studien hinsichtlich der
Verbreitung und der Anwendungsfelder sollen im folgenden Abschnitt dargestellt
werden.
6
Wobei die Motive, wie in Abschnitt 2.4 gezeigt wird, vielfältig sein können.
10
2.3 Verbreitung und Anwendungsfelder von freiwilligen
Ansätzen
2.3.1 Die Europäische Union: Negotiated Agreements
Mehrere Studien dokumentieren die steigende Zahl freiwilliger Ansätze in Deutsch-
land, Europa und anderen Industrienationen in den 90er Jahren (OECD 1999a, EEA
1997, CAVA 2001, ELNI 1998, CEEM 1999). Systematische empirische Untersu-
chungen sind so gut wie nicht vorhanden, die Studien konzentrieren sich auf die Un-
tersuchung jeweils einer unterschiedlichen Zahl von Fallbeispielen. Allgemeine Aus-
sagen über freiwillige Ansätze sind aufgrund ihres breiten Spektrums und der jewei-
ligen nationalen Ausgestaltung nur eingeschränkt möglich. Die Ergebnisse sollen
hier im Hinblick auf die erläuterte Typologie dargestellt werden.
Alle EU-Länder machen seit Anfang der 90er Jahre verstärkten Gebrauch von
negotiated agreements
, dem in Europa vorherrschenden Typus von freiwilligen An-
sätzen (EEA 1997: 22). Eine Untersuchung der europäischen Kommission ergab für
das Jahr 1996 300 freiwillige Vereinbarungen, die in Kraft waren. Daneben gab es
eine kleine Zahl an unilateral commitments
7
und einige wenige freiwillige public
voluntary schemes
. Es ist davon auszugehen, daß die Zahl seit 1996 weiter gestiegen
ist (OECD 1999a: 48f).
Die Zahl ist unter den EU-Staaten jedoch sehr ungleich verteilt: In Deutschland
und den Niederlanden finden sich zwei Drittel aller freiwilligen Vereinbarungen
8
,
gefolgt von Österreich (20), Dänemark (16) und Schweden (11).
7
Hauptsächlich im Rahmen des Responsible-care-Programms der chemischen Industrie.
8
Für Deutschland ermittelt das Europäische Umweltbüro 93, für die Niederlande 107
Fälle (EEA 1997).
11
Darstellung 3.: Verteilung freiwilliger Vereinbarungen in der EU
107
93
20
16
11
11
10
9
8
7
6
6
5
2
1
0
20
40
60
80
100
120
Niederlande
Deutschland
Schweden
Italien
Portugal
Frankreich
Griechenland
Spanien Belgien
Luxemburg
Finnland
Irland
Quelle: EEA 1997
Industrie (52%) und Energie (28%) sind die wirtschaftlichen Sektoren, in denen
freiwillige Vereinbarungen die meiste Anwendung finden. Der Rest verteilt sich auf
die Bereiche Landwirtschaft (17%) und Tourismus (3%) (EEA 1997). Bemerkens-
wert ist, daß ein großer Teil in den stark verschmutzenden Industrien (Metall und
Chemie) stattfindet. Die chemische Industrie hat mit 28% den Abstand größten An-
teil an allen freiwilligen Vereinbarungen in der EU (OECD 1999a: 52). Eine Auf-
schlüsselung nach Problembereichen ergibt, daß ca. die Hälfte der Vereinbarungen
im Abfall- und Klimabereich liegen (ELNI 1998: 75)
9
.
9
Mit 80 bzw. 77 Vereinbarungen, es folgen die Bereiche Wasser, Luft und Gesundheit
mit jeweils 30 Vereinbarungen.
12
Darstellung 4.: Aufschlüsselung von freiwilligen Vereinbarungen in der EU
nach Industriebereichen
52%
28%
17%
3%
Industrie
Energy
Landwirtschaft
Tourismus
Quelle: OECD 1999a: 52
2.3.2 Deutschland: Selbstverpflichtungen und freiwillige
Vereinbarungen
In Deutschland sind freiwillige Selbstverpflichtungen der dominante Typ freiwilliger
Ansätze. Die Ausgestaltung der jeweiligen Arrangements kann jedoch von Fall zu
Fall sehr unterschiedlich sein
10
. Seit den 70er Jahren bekannt, ist die Zahl der Selbst-
verpflichtungen in den 80er und insbesondere in den 90er Jahren stark gestiegen. Ein
Grund dafür ist die Entscheidung der konservativ-liberalen Bundesregierung, koope-
rative Instrumente stärker einzusetzen
11
. Mit 93 Selbstverpflichtung finden fast 30%
aller in der EU gezählten freiwilligen Ansätze in Deutschland statt, besonders stark
vertreten ist dabei die chemische Industrie.
Weiterhin ergibt die Auswertung in Deutschland, daß die Selbstverpflichtungen
in 41 Fällen produktbezogen sind und in 24 Fällen auf den Produktionsprozeß bezo-
gen (Änderung eines Teils der Produktion), 6 Fälle stellen eine Kombination aus
beidem dar (OECD 1999a: 58). Die Hälfte der Selbstverpflichtungen in Deutschland
sind sogenannte phase-out-Regelungen, die das ,,Auslaufen" bestimmter Produkte
oder Substanzen zum Ziel haben.
Die Aufschlüsselung nach Problembereichen ergibt eine ähnlich Gewichtung wie
auf der EU-Ebene: Den höchsten Anteil haben die Selbstverpflichtungen im Bereich
Energie/Klima. Darin inbegriffen sind 19 Einzelerklärungen, die in Form der Klima-
10
Siehe Abschnitt 2.5.
11
In der Koalitionsvereinbarung von 1994 zwischen CDU/CSU und FDP wird die Bedeu-
tung von Selbstverpflichtungen als Instrument der Umweltpolitik betont (ELNI 1998: 45;
SRU 1998).
13
schutzverpflichtung der deutschen Wirtschaft das prominenteste Beispiel einer
Selbstverpflichtung in Deutschland darstellen.
Darstellung 5.: Verteilung der Selbstverpflichtungen nach Problembereichen
Problembereich
Anzahl der Selbstver-
pflichtung
Energy/Climate
25*
Health Protection
17
Waste management
16
Water pollution
10
Ozone Depletion
9
Air Pollution
6
Soil Pollution
2
Multi-Issue
3
*includes 19 single declarations on CO
2
emis-
sions reduction.
Quelle: ELNI 1998: 45
Merkmal der Selbstverpflichtungen in Deutschland ist das hohe Maß an legaler Un-
verbindlichkeit: 97% der Selbstverpflichtungen stellen rechtlich nicht bindende Ver-
einbarungen dar (OECD 1999a: 54)
12
. Insbesondere im Hinblick auf den legalen Sta-
tus ist ein Vergleich mit den Niederlanden sehr lohnenswert: Hier manifestiert sich
der Unterschied zu freiwilligen Ansätzen in Deutschland am deutlichsten.
2.3.3 Die Niederlande: Der Sonderfall der covenants
Die Niederlande haben mit 107 die europaweit höchste Zahl an freiwilligen Ansätzen
(EEA 1997). Die hohe Zahl und die spezifischen Eigenschaften des niederländischen
Modells legen nahe, daß die in den Niederlanden als covenant oder target group ap-
proach
bekannten Vereinbarungen einen höheren Stellenwert in der Umweltpolitik
besitzen als in den restlichen Ländern der EU und rechtfertigen wie im folgenden
gezeigt wird die Einschätzung als Sonderfall.
In der Tat stellen die Vereinbarungen seit ihrer Verankerung im National Envi-
ronmental Policy Plan
(NEPP) von 1989 und im weiter konkretisierten NEPP Plus
von 1990 ein Schlüsselinstrument der Umweltpolitik in den Niederlanden dar
12
nur noch von Italien übertroffen (100%).
14
(OECD 1999a: 55f, 60f). Der nationale Umweltplan beinhaltet quantifizierte Zielvor-
gaben, die durch das Instrument der Vereinbarungen zwischen staatlichen und priva-
ten Akteure umgesetzt werden sollen. Verhandelt wird also nicht wie im deutschen
Modell das Zielniveau sondern lediglich die Art und Weise, wie die festgelegten
Ziele zu erreichen sind.
Als Grund für die Erweiterung des umweltpolitischen Instrumentariums in den
Niederlanden wird zum einen die lange Dauer des Gesetzgebungsprozesses und zum
anderen die mangelnde Flexibilität und Zielgenauigkeit herkömmlicher Instrumente
angeführt, da diese nur unzureichend die Voraussetzungen und Problemschwerpunk-
te des jeweiligen Unternehmens berücksichtigen können (Rosenkötter 2001: 104).
Der Einsatz der neuen Instrumente ist nicht auf bestimmte Sektoren beschränkt, die
Vereinbarungen werden in allen Industriebereichen abgeschlossen. Nur 22% sind
produktbezogene phase-out-Regelungen, während 58% einen umfassenderen Ansatz
haben und sich auf den Produktionsprozeß beziehen
13
.
Das im weltweiten Vergleich Außergewöhnliche am niederländischen Modell ist
der rechtliche Status der Vereinbarungen: 90% aller freiwilligen Vereinbarungen
sind rechtlich bindend (OECD 1999a: 54). Der Abschluß der Vereinbarung vollzieht
sich in zwei Schritten. Zunächst wird ähnlich dem deutschen Modell der Selbstver-
pflichtungen eine Absichtserklärung zwischen Regierung und einer Branche ver-
einbart. Diese gibt lediglich den Rahmen vor für den im zweiten Schritt ausgehandel-
ten Vertrag zwischen einem oder mehreren staatlichen Akteuren und dem Unterneh-
men
14
. Dieser Umweltplan des Unternehmens enthält genaue Zielvorgaben und hat
den Status eines zivilrechtlichen Vertrages (DeClercq et al. 2001: 19).
Eine enge Verknüpfung besteht mit einem Zertifikatesystem, für das detaillierte
Emissionswerte für alle Industrieanlagen definiert werden. Die Ziele der Vereinba-
rungen werden schließlich in das Zertifikatesystem integriert. Das Monitoring ge-
schieht durch die lokalen Behörden, die auch verantwortlich für die Zertifizierung
sind (OECD 1999a: 55).
13
6% stellen eine Kombination aus beidem dar und 14% sind auf andere Prozesse (z.B.
Recycling) bezogen.
14
Weist die Branche eine in Bezug auf die Größe der Unternehmen homogene Struktur
auf, so wird ein Flächenvertrag abgeschlossen; ist sie heterogen, wird mit den einzelnen
Unternehmen ein Vertrag geschlossen.
15
Als Erfolgsfall wird die im Jahr 1993 erfolgte Vereinbarung des Chemieverbands
mit den Ministerien für Umwelt, Wirtschaft und Transport bewertet. Es ist eine der
,,Pioniervereinb arungen", die als Modell für künftige Vereinbarungen gelten sollte
(ebd.: 56). Hervorzuheben ist, daß die staatliche Seite sich weigerte zu unterschrei-
ben, sollten sich weniger als 50% der Industrie an der Vereinbarung beteiligen.
Letztendlich lag die Beteiligungsrate bei 91% (ELNI 1998: 53f)
15
.
Im folgenden Abschnitt wird ein kurzer Überblick über freiwillige Ansätze in den
USA gegeben. Der Blick dorthin lohnt sich, da in den USA ein vom ,,europä ischen"
Muster grundsätzlich zu unterscheidender Typ dominiert.
2.3.4 USA: Public Voluntary Schemes
In den USA sind seit 1988 mit 42 Fällen weit weniger freiwillige Ansätze vorhanden
als in Europa. Dominierend ist hier der von der Environmental Protection Agency
(EPA) entwickelte Typ der public voluntary schemes. (31 Fälle). Rein unilaterale
Verpflichtungen sind neunmal vorzufinden, freiwillige oder verhandelte Vereinba-
rungen lediglich zweimal (OECD 1999a: 77)
16
.
Die Zahl der teilnehmenden Unternehmen an den von der EPA entwickelten Pro-
grammen ist den 90er Jahren stark gestiegen: Von 400 (1991) auf knapp 7000 Fir-
men (1996), für das Jahr 2000 wurden gar 13 000 Unternehmen angepeilt (OECD
1999a: 86).
Freiwillige Ansätze in den USA sind im Gegensatz zu europäischen Arrange-
ments in ihrer Funktion eingeschränkter, denn sie unterstützen lediglich die beste-
hende Gesetzgebung in den Bereichen Luft, Gewässer, Abfall, Sondermüll und ha-
ben keine weitreichendere, normersetzende Funktion.
Das bekannteste Beispiel ist das 1991 eingeführte 33/50 Programme. Für 17 to-
xische Substanzen wurden zunächst konkrete Reduktionsziele aufgestellt: 33% bis
1992 und 50% bis 1995. 8000 Unternehmen wurden von EPA angeschrieben, 1300
nahmen schließlich an dem Programm teil. Eine Verpflichtung, die Ziele bezogen auf
alle Substanzen zu erfüllen, bestand nicht, um an dem Programm teilzunehmen. Die
an einer Teilnahme interessierten Unternehmen konnten selbst das zu erreichende
Ziel angeben. Das Design dieses Arrangements, nämlich extreme Offenheit und Un-
15
114 von 125 Unternehmen beteiligten sich und erstellten eine individuellen Umweltplan.
16
Diese Erhebung erfaßt jedoch nur freiwillige Ansätze auf der Bundesebene.
16
verbindlichkeit, in Verbindung mit einer einfach zu erreichenden Imageverbesserung
durch die Teilnahme an dem Programm erklärt, weshalb eine ausgesprochen große
Zahl an Unternehmen teilnimmt. Trotz der institutionellen Offenheit sind laut EPA
die anvisierten Ziele erreicht worden, jeweils ein Jahr früher als geplant (OECD
1999a: 87).
Ein Grund für die geringe Verbreitung von freiwilligen Ansätzen wird im institu-
tionellen Kontext gesehen. Der Umstand, daß die Umweltbehörde nicht glaubwürdig
mit strengerer Regulierung drohen kann, führt dazu, daß Unternehmen keinen Anlaß
sehen, weitergehende Maßnahmen auf freiwilliger Basis zu ergreifen. Hier vorge-
stellte freiwillige Ansätze in den USA können daher als extrem weiche Mechanismen
bezeichnet werden (ebd.: 89).
2.4 Motive für freiwillige Ansätze
Es lassen sich zahlreiche Motive für das Entstehen von freiwilligen Ansätzen identi-
fizieren. Charakteristisch für Verhandlungslösungen ist, daß sich beide Seiten
staatliche und private Akteure Vorteile von der Vereinbarung versprechen. Manche
Aspekte stellen für eine Seite einen Vorteil dar, manche für beide Seiten. Diese sol-
len in Form eines Überblickes dargestellt werden.
Für den oder die staatlichen Akteure ergeben sich folgende Vorteile:
a) Der Erlaß einer Verordnung kann an eine Behörde hohe Anforderungen hinsicht-
lich der Begründung der einzelnen Maßnahmen stellen. Problematisch wird es,
wenn die umweltbelastende Wirkung bestimmter Stoffe (noch) nicht festgestellt
ist oder wenn bei feststellbaren Problem eine Ursache-Wirkungs-Beziehung nicht
nachgewiesen werden kann (Hagenah 1994: 488). In diesem Fall erübrigen sich
durch die Abgabe einer Selbstverpflichtung zeit- und kostenintensive Rechtsstrei-
tigkeiten.
b) Durch den kooperativen Politikstil werden Widerstände der Adressaten abgebaut
und somit Akzeptanz für die im Konsens gefundene Lösung geschaffen (Rosen-
kötter 2001: 32).
c) Die Funktion des Vollzugs und der Kontrolle werden auf die Wirtschaft oder
Dritte verlagert; Es findet eine Kostenersparnis statt, die wiederum Ressourcen
des staatlichen Akteurs freisetzt.
d) Die mit freiwilligen Ansätzen verbundene Flexibilität bedeutet für den Gesetzge-
ber die Möglichkeit, sich schnell ändernden Umständen anzupassen und ggf.
17
Standards zu erhöhen (Hucklenbruch 2000: 85). Wie im folgenden Abschnitt zu
erläutern ist, stellt die Dynamik und Anpassungsfähigkeit einer Selbstverpflich-
tung eine zentrale Motivation für den staatlichen Akteur dar. Auch ist die Ver-
einbarung eine Möglichkeit, den Sachverstand der Unternehmen nutzbar zu ma-
chen (SRU 1998).
e) Der Abschluß einer Vereinbarung kann die eine gesetzliche Regelung vorberei-
tende Funktion. Diese ist, wenn eine Vereinbarung einmal abgeschlossen wurde,
leichter gegenüber der Wirtschaft durchsetzbar (Hucklenbruch 2000: 87).
f) Nicht zuletzt ist die positive öffentliche Resonanz einer erfolgreichen Vereinba-
rung von Bedeutung.
Für den privaten Akteur lassen sich folgende Vorteile identifizieren:
a) Das Argument der Zeitersparnis gegenüber Gesetzgebungsprozessen durch kon-
sensuale Lösungen wird durch die Praxis widerlegt, oft dauern die Verhandlun-
gen jahrelang
17
. Verhandlungsprozesse können für den privaten Akteur den Vor-
teil haben, eine definitive Lösung hinauszuzögern. Wicke weist auf den ,,Ve r-
schleppungseffekt" als Element einer möglichen Verzögerungsstrategie der Wir t-
schaft hin (Wicke 1997: 27; Rosenkötter 2001: 29).
b) Die Flexibilität ist auch für den privaten Akteur ein wesentlicher Vorteil frei-
williger Ansätze. Durch die Freiheit in der Implementierung (und oftmals auch in
der Formulierung) wird eine hohe Kosteneffizienz erreicht, da Unternehmen der
Situation angepaßte statt vorgeschriebene Lösungen anwenden können (CEEM
1999: 17). Hucklenbruch betont, daß Absprachen es erlauben, Anpassungsmaß-
nahmen langfristig zu planen, so daß erforderliche Umrüstmaßnahmen im Rah-
men des Investitionszyklus erfolgen können (Hucklenbruch 2000: 84).
c) Der Kreis der Akteure bleibt klein, die Beteiligung ,,Dritter" (wie bestimmter
Ministerien oder Umweltorganisationen) kann ausgeschlossen sein. Somit lassen
sich berechenbarere Ergebnisse erzielen als durch Gesetzgebungsprozesse, deren
Ausgang unsicher ist.
d) Der publicity-Effekt stellt einen großen möglichen Vorteil für den privaten Ak-
teur dar, insbesondere für Unternehmen oder Branchen, die bekannt für umwelt-
schädigende Aktivitäten sind.
17
Wie am Beispiel der Klimaschutzverpflichtung gezeigt werden kann (Abschnitt 4.2).
18
e) Es wird Planungssicherheit hergestellt. Der Abschluß einer Vereinbarung verrin-
gert das Risiko, daß während der Laufzeit der Vereinbarung eine für Unterneh-
men ungünstige gesetzliche Regelung in Kraft tritt.
Erwähnt wurde die Heterogenität freiwilliger Ansätze. Im folgenden soll ein Über-
blick über die wichtigsten Unterscheidungskriterien gegeben werden. Die einzelnen
Aspekte lassen sich in der Realität nicht vollständig voneinander trennen, es werden
vielmehr idealtypische Situationen beschrieben. Bezug genommen wird hauptsäch-
lich auf freiwillige Ansätze in Deutschland. Es werden jedoch typische Kennzeichen
dieses Instrumententypus herausgearbeitet, die auch auf freiwillige Ansätze in der
EU zutreffen. Aus der Kombination der verschiedenen Variablen ergibt sich eine
Vielzahl von Möglichkeiten, die am Ende des folgenden Kapitels in eine Typologie
eingearbeitet werden.
2.5 Die zentralen Unterscheidungskriterien freiwilliger
Ansätze
2.5.1 Anzahl und Art der Akteure
Die in freiwilligen Ansätzen anzutreffenden Akteurskonstellationen lassen sich zu-
nächst wie folgt klassifizieren:
1) Unilaterales Handeln: Unilaterale Ansätze bleiben auf den privaten Akteur be-
schränkt, der die Initiative ergreift.
2) Bilaterales Handeln: Bei einem bilateralen Arrangement findet eine Kooperation
zwischen dem privaten und dem staatlichen Akteur statt. Die Qualität der Koope-
ration kann dabei sehr variieren. Es kann sich um eine enge Zusammenarbeit, in
der z.B. die Ziele gemeinsam festgelegt werden, oder um die einmalige Konsulta-
tion eines Ministeriums handeln. Bilaterale Arrangements neigen dazu, exklusive
Verhandlungssysteme zu sein, und stellen somit für andere Akteure ein geschlos-
senes politisches Netzwerk dar. Eine davon zu unterscheidende Art eines
bilateralen Arrangements ist die Kooperation unter Ausschluß des staatlichen
Akteurs, z.B. zwischen Unternehmen und Umweltverbänden wie im Falle des
Warenhauskonzerns Hertie und dem BUND (Jacob/Jörgens 2000: 14).
3) Tri-/multilaterales Handeln: Dabei wird das bilaterale Arrangement um weitere
Akteure wie Umweltverbände, Forschungsinstitute und/oder andere gesellschaft-
19
liche Gruppen ergänzt. In diesem Fall handelt es sich um eine stakeholdern ge-
öffnete politische Arena
18
.
Die Klassifizierung stellt eine idealtypische Unterscheidung dar, da sich das Feld der
freiwilligen Ansätze in unilaterale und kooperative Ansätze spaltet. Eine empirische
Überprüfung, wie sie in Abschnitt 2.3 dargestellt wurde, ergibt jedoch, daß rein uni-
laterale Ansätze in der Realität kaum vorhanden sind, obwohl die meisten freiwilli-
gen Ansätze durch den privaten Akteur als unilateral bezeichnet werden. Dieses fin-
det statt um das eigene Engagement stärker in den Vordergrund zu stellen. Die mei-
sten Fälle sind kooperative Ansätze, d.h. der staatliche Akteur ist am Zustandekom-
men der Selbstregulierung beteiligt. Für die weitere Untersuchung ist die Betrach-
tung unilateraler Ansätze nachrangig, da kooperative Ansätze in der EU und den
USA empirisch den Großteil der freiwilligen Ansätze ausmachen. Bemerkenswert ist
in diesem Zusammenhang die unterschiedliche Einschätzung seitens der Akteure:
,,Die Frage, ob Selbstverpflichtungen üblicherweise im Tausch gegen
staatliche Leistungen abgegeben werden, wurde von Seiten der Wirt-
schaft teilweise verneint; Selbstverpflichtungen könnten auch gänz-
lich ohne staatliche Beteiligung zustande kommen. Demgegenüber
hieß es von staatlicher Seite, ,echte' Selbstverpflichtungen durch die
sich die Erklärenden zu zusätzlichen Leistungen verpflichteten, kä-
men nur auf staatlichen Druck hin zustande."
(Hucklenbruch 2000:
79f).
Wichtiger als die Unterscheidung in unilaterale oder Kooperationslösungen ist die
Differenzierung der staatlichen und der privaten Akteure. Findet die Verpflichtung
auf nationaler Ebene statt, ist auf der Staatsseite meist das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) der Verhandlungspartner, häufig
unter Beteiligung des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi). Andere staatliche
Stellen wie das Umweltbundesamt (UBA) werden im Einzelfall hinzugezogen (ELNI
1998: 46; Hucklenbruch 2000: 72). Es zeigt sich deutlich, daß der staatliche Akteur
kein einheitlicher Akteur ist. Aus den unterschiedlichen Interessen der Ministerien
ergeben sich Konflikte, die die Verhandlungsmacht und das dahinter stehende Droh-
potential des staatlichen Akteurs insgesamt negativ beeinflussen
19
. Die Verhand-
18
Der VCI betont die Bedeutung von strategische Allianzen zwischen Chemieunterneh-
men und wissenschaftlichen Institutionen, von denen es allein in Deutschland 2000 ge-
ben soll (VCI/IG BCE 1997:22).
19
Wenn im folgenden der Einfachheit halber der Begriff des staatlichen Akteurs verwendet
wird, wird dadurch nicht ignoriert, daß es sich um einen heterogenen Akteur mit unter-
schiedlichen Interessen handelt.
20
lungsmacht des Ministeriums wird dadurch bestimmt, mit welchen staatlichen Hand-
lungsalternativen für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen seitens der Wirt-
schaft tatsächlich gerechnet wird (ebd.: 75)
20
. Findet die Verpflichtung auf der regio-
nalen Ebene statt, stellen die Länderministerien und -behörden die Akteure dar
21
.
Eine Konstellation, in der Akteure aus Bund und Ländern zusammenwirken, ist dem
Verfasser nicht bekannt.
Auf der Seite des privaten Akteurs sind Einzel- und kollektive Akteure vorhan-
den. Einzelne Unternehmen, aber auch Fach- und Spitzenverbände der Wirtschaft
treten als Akteure auf. Diese grundlegende Unterscheidung hat die Charakterisierung
von freiwilligen Ansätzen als einstufige oder zweistufige Modelle zur Folge
(Hucklenbruch 2000: 73, 97f). Im einstufigen oder vertikalen Modell finden Ver-
handlungen zwischen dem staatlichen Akteur und dem Unternehmen statt (s. Darstel-
lung 6)
22
.
Im zweistufigen Modell dagegen findet eine vertikale Absprache zwischen dem
staatlichen Akteur und einem oder mehreren Verbänden statt. Funktionsfähig wird
diese Absprache erst, wenn sie durch horizontale Absprachen zwischen dem Verband
und den Mitgliedsunternehmen konkretisiert wird. Hucklenbruch bemerkt dazu, daß
vor der Abgabe einer Verbandszusage üblicherweise eine Erhebung unter den betrof-
fenen Unternehmen stattfindet, um zu ermitteln, inwieweit diese eine Zusage unter-
stützen würden. Danach wird ein für den Verband tragbares Angebot ausgearbeitet
(Hucklenbruch 2000: 76)
23
. Die Zusage wird insofern der strategischen Positionie-
rung des privaten Akteurs dienen, als daß nicht das gesamte Reduktionspotential
offenbart werden muß, sondern oftmals die Position des schwächsten Unternehmens
eingenommen wird. Der staatliche Akteur verfügt in aller Regel nicht über das
Fachwissen um dieser Strategie etwas entgegenzusetzen. Die Aufgabe der Verteilung
der Belastung auf die einzelnen Unternehmen kann als burden sharing bezeichnet
20
Siehe dazu auch Abschnitt 2.5.2.
21
Im Falle des Umweltpaktes Bayern als bekanntestem Beispiel einer regionalen Selbst-
verpflichtung in Deutschland sind dies die Bayerische Staatskanzlei und das Bayerische
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Bayerisches Staatsmini-
sterium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2000).
22
Wie im Falle der Verpflichtung der Firma Pfersee Chemie GmbH aus dem Jahr 1996 zur
verstärkten Kontrolle des Vertriebs und des Einsatzes des Imprägniermittels Fungitex
(Hucklenbruch 2000: 37f).
23
Hucklenbruch beruft sich auf ein Gespräch mit Dr. Schendel im Fachbereich Umwelt-
schutz der Bayer AG vom 31.07.1996, der diese Praxis zumindest für den VCI bestätigt.
21
werden. Dies ist ,,the translation of an collective target into individual commitments"
(CEEM 1999: 97ff.). Wie im Laufe der Untersuchung gezeigt wird, erhöht das zwei-
stufige Modell in starkem Maße die Strategiefähigkeit der Unternehmensseite.
Darstellung 6.: Ein- und zweistufiges Modell freiwilliger Ansätze
Quelle: Hucklenbruch 2000; eigene Darstellung
Weiterhin kann eine organisatorische Rechtfertigung für die Existenz zweistufiger
Modelle angeführt werden. Der Verband übernimmt Aufgaben des Staates, für die
die Kapazitäten eines Ministeriums im Zweifelsfall nicht ausreichen: die Einzelver-
handlung mit allen Unternehmen und die Überwachung der gemachten Zusagen
(Hucklenbruch 2000: 98)
24
. Für die weitere Argumentation sind die beiden genann-
ten Funktionen des kollektiven Akteurs von großer Bedeutung. Da es sich bei den
meisten Selbstverpflichtungen und freiwilligen Vereinbarungen in Deutschland um
Verbandslösungen handelt, nimmt dieser eine zentrale Rolle ein.
Die Aussagekraft idealtypischer Modelle wird auch in diesem Punkt durch die
empirische Evidenz relativiert. Hucklenbruch argumentiert, daß Verbandslösungen
eher aus Publicitygründen als aus Gründen der effizienten Organisation entstehen.
Sie führt an, daß trotz einer Verbandszusage die Verpflichtung tatsächlich nur von
den problemverursachenden oder besonders finanzstarken Unternehmen
25
getragen
werden (Hucklenbruch 2000: 73). In der Tat muß danach gefragt werden, ob große
Unternehmen im Verband vertreten sind, da diese den Verband durch eigene perso-
24
Ein Beispiel für ein einstufiges Modell ist das erläuterte 33/50-Programme in den USA,
an dem sich von 8000 kontaktierten Unternehmen 1300 an dem Programm beteiligten.
Diese Art von Kooperation war nur möglich, da keinerlei Verhandlungen stattfanden
sondern das von der EPA erarbeitete Programm den Unternehmen angeboten wurde.
Das Monitoring wurde an ein bereits bestehendes Überwachungssystem angegliedert.
Dergestalt wurde der Arbeitsaufwand seitens des Staates minimiert.
25
Oder solchen, deren Investitionszyklus Reduktionen erlauben.
22
nelle Ressourcen unterstützen. Verbände ohne große Unternehmen sind dagegen auf
sich allein gestellt, da kleine und mittlere Unternehmen (KMU) kein Personal haben,
um politische Kontakte zu pflegen (Schneider 1988: 112). Wird der Verband durch
einige Unternehmen dominiert, so handelt es sich nach der vorgenommenen Eintei-
lung um eine Mischform zwischem ein- und zweistufigem Modell.
2.5.2 Maß an Freiwilligkeit
Das zweite Kriterium, das der Differenzierung von freiwilligen Ansätzen dient, ist
der Grad an Freiwilligkeit. Allen Ansätzen gemeinsam ist zunächst die formale
Freiwilligkeit im Gegensatz zum vorgeschriebenen Handeln durch den ordnungs-
rechtlichen Ansatz. Obwohl schwer meßbar, kann der Grad an tatsächlicher Freiwil-
ligkeit je nach Arrangement hoch, aber auch sehr niedrig sein. Die Freiwilligkeit
eines Ansatzes hängt vom Maß an staatlicher Einflußnahme ab. Sie ist stark einge-
schränkt, wenn eine gesetzliche Regelung existiert, innerhalb derer sich die Selbst-
verpflichtung inhaltlich und zeitlich zu bewegen hat.
Die Freiwilligkeit kann aber auch eingeschränkt sein, ohne daß eine Regelung
vorhanden ist: durch die Androhung einer ordnungsrechtlichen Maßnahme als Alter-
native zur Selbstverpflichtung. Entscheidend für die Strategie der ,,Rute im Fenster"
(Mayntz/Scharpf 1995: 29)
26
ist die Verhandlungsmacht des staatlichen Akteurs: Um
wirkungsvoll zu sein, muß die Drohung glaubwürdig sein. Diese setzt aber voraus,
daß der Staat in der Lage wäre, die Regelung zu implementieren. Dieser Durchset-
zungskraft des staatlichen Akteurs stehen mehrere Aspekte entgegen: Die oben ge-
nannte Fragmentierung des staatlichen Akteurs, die ,,Feindschaft" bestimmter Res-
sorts, gerade im Umweltbereich, und Querkoalitionen zwischen politisch-admini-
strativen und gesellschaftlichen Akteuren. In der Tat ist der mögliche Interessenkon-
flikt zwischen den einzelnen staatlichen Akteuren ein wichtiger Aspekt. Wie
Hucklenbruch bemerkt, kann das Vorhaben des BMU, ein Problem auf dem Verord-
nungsweg zu lösen, am ,,Veto" aus dem Wirtschaftsministerium scheitern (Huckle n-
bruch 2000: 74). Auch ist hier wie im weiteren Verlauf der Arbeit deutlich wird
auf die Bedeutung des Wissens um technische Optionen für das Drohpotential des
Staates hinzuweisen. Sie ist die Schlüsselressource hinsichtlich des Aufbaus eines
glaubwürdigen Alternativszenarios. Insgesamt läßt sich feststellen, daß -wie auch
26
Im Englischen auch: stick behind the door.
23
von Behördenseite eingeräumt wird - echte Alternativen in Form eines Gesetzes oder
einer Verordnung nicht immer verfügbar sind (Hucklenbruch 2000: 79f)
27
.
Obwohl das Verhalten der (national-)staatlichen Akteure von hoher Bedeutung,
ist die Reduzierung der Freiwilligkeit nicht nur auf diese zurückzuführen. Es lassen
sich weitere ,,Impulse" identifizieren, die private Akteure direkt oder indirekt zum
Handeln bewegen. Dazu gehören u.a. die Öffentlichkeit, die über Proteste oder Boy-
kotte wirksam Druck erzeugen kann und die Entwicklung der internationalen Um-
weltpolitik. So fand z.B. die Abgabe der Klimaschutzverpflichtung der deutschen
Wirtschaft 1995 unter dem Vorzeichen des anstehenden Berliner Klimagipfels statt
28
.
Trotz der Überlegungen bezüglich staatlicher Aktivität und der eingeschränkten
Freiwilligkeit von freiwilligen Ansätzen soll einem Steuerungsoptimismus kein Vor-
schub geleistet werden. Es können zwar staatlicherseits die Rahmenbedingungen
positiv gestaltet werden, planen läßt sich die Abgabe einer Selbstverpflichtung indes
nicht, denn ,,die Abgabe e iner Selbstverpflichtung ist in erster Linie eine Frage der
von zahlreichen weiteren Faktoren beeinflußten unternehmerischen Vernunft"
(Hucklenbruch 2000: 76).
2.5.3 Legaler Status
Das Zustandekommen einer Selbstverpflichtung gewährleistet nicht die tatsächliche
Umsetzung des Inhaltes. In der Regel besitzen freiwillige Ansätze keine rechtliche
Bindungskraft. Ein Anspruch seitens des Staates auf Erfüllung einer Zusage im
Rahmen einer Selbstverpflichtung besteht nicht, obwohl wie im Falle der Klima-
schutzverpflichtung der deutschen Wirtschaft ein ,,politischer" Vertrag unte r-
schrieben wird
29
. Eine Parallele zu rechtlich verbindlichen Verträgen besteht nur in-
soweit, als daß der Grundsatz do ut des, also des gegenseitigen Geben und Nehmens
gilt, nicht jedoch die Bindungswirkung von Verträgen pacta sunt servanda (Ren-
nings et al. 1996: 179f). Von staatlicher Seite wird oftmals die mangelnde Verbind-
lichkeit und Durchsetzbarkeit als Nachteil kritisiert.
27
Hagenah weist darauf hin, daß der Erlaß einer Rechtsverordnung besonders dann pro-
blematisch ist, wenn der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang eines Umweltproblems
nicht nachgewiesen ist. Angesichts der staatlichen Bindung an das Verhältnismäßig-
keitsprinzip ist bei unsicherer Tatsachengrundlage allenfalls eine ,,weiche" Verordnung
durchsetzbar (Hagenah 1996: 523).
28
Siehe Abschnitt 4.2.
29
Siehe Abschnitt 4.2; Analog besteht auch für den Staat keine rechtlich bindende Ver-
pflichtung, gemachte Zusagen einzuhalten.
24
Eine empirische Auswertung vorhandener Selbstverpflichtungen in Deutschland
hat ergeben, daß im Jahre 1998 85 von 88 untersuchten Fällen nicht rechtsverbind-
lich waren (ELNI 1998: 47). Demnach besteht lediglich eine moralische Verpflich-
tung für die teilnehmenden Parteien, ihre Versprechen einzuhalten; es gibt aber kei-
nerlei Möglichkeiten, abweichendes Verhalten zu sanktionieren. Trotzdem halten
sich Unternehmen wie Untersuchungen ergeben haben in der Regel an die ge-
machten Zusagen. Es bleibt festzuhalten, daß öffentlichkeitswirksame Verpflichtun-
gen einen gewissen faktischen Befolgungszwang erzeugen, da bei Nichteinhaltung
ein Imageverlust zu befürchten ist. In diesem Zusammenhang ist auf die auf die
watch-dog
-Funktion von Umweltverbänden zu verweisen.
Das niederländische Modell der covenants stellt dagegen das andere Extrem dar:
Fast alle Vereinbarungen sind rechtsverbindlich. Zwischen dem Staat und dem ein-
zelnen Unternehmen oder dem Verband wird ein zivilrechtlicher Vertrag abgeschlos-
sen.
2.5.4 Verhältnis zu anderen umweltpolitischen Normen
Freiwillige Ansätze können in die Kategorien normersetzend oder normvollziehend
eingeteilt werden (ELNI 1998: 46). Normersetzende Maßnahmen zielen auf eine
Vermeidung staatlicher Regulierung zugunsten gesellschaftlicher Selbstregulierung
ab. Diese Eigenschaft ist eine entscheidende Motivation für private Akteure, um-
weltpolitisch die Initiative zu ergreifen.
Normvollziehende Maßnahmen dagegen bewegen sich im durch Regulierung
vorgegeben Rahmen und fallen in die Kategorie der implementation based initiatives.
In den Fällen, in denen eine Selbstverpflichtung neben eine existierende Vorschrift
getreten ist, handelt es sich meist um sogenannte Absprachen, die das phasing out
bestimmter Produkte zum Inhalt haben: In den meisten Fällen wird durch freiwillige
Zusagen der vorgeschriebene Ausstiegstermin vorgezogen (Hucklenbruch 2000:
97)
30
. Bezüglich der Zielformulierung läßt sich sagen, daß als zentraler Bestandteil
normersetzender Vereinbarungen die Ziele durch die Verhandlungspartner festgelegt
30
z.B. die Selbstverpflichtung zur Einstellung der FCKW-Produktion, die gleichzeitig mit
dem Erlaß der FCKW-Halon-Verbotsverordnung abgegeben wurde. Die Selbstverpflich-
tung zur Einstellung der FCKW-Produktion verlagerte den im Montrealer Protokoll ver-
einbarten Ausstiegszeitpunkt vor.
25
werden
31
. Normvollziehende Arrangements dagegen konzentrieren sich auf die Um-
setzung vorhandener Ziele (implementation based initiatives). Auf der Bundesebene
sind fast alle freiwilligen Ansätze normersetzend; dieses ist ein Kennzeichen deut-
scher Selbstverpflichtungen und unterstreicht die zentrale Motivation der Akteure
einer Regelung vorzugreifen.
Auch hier bilden das deutsche Modell der Selbstverpflichtungen und das nieder-
ländische Modell der covenants einen Gegensatz: Aufgrund des normersetzenden
Charakters der meisten Selbstverpflichtungen und des fehlenden institutionellen
Rahmens in Deutschland werden hier die Ziele durch die Verhandlung festgesetzt,
wohingegen in den Niederlanden die Ziele die Ausgangsbasis darstellen, und die Art
der Umsetzung Gegenstand der Verhandlung ist (OECD 1999a: 59).
2.5.5 Reichweite und Laufzeit
Ansätze von Selbstregulierung können von der lokalen bis zur globalen auf allen
Ebenen stattfinden. Zu freiwilligen Ansätzen auf der lokalen Ebene kann z.B. die
nachbarschaftliche Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und den in der
Umgebung lebenden Menschen mit dem Ziel der Lärmreduzierung gezählt werden.
Das bekannteste Beispiel eines regionalen Ansatzes ist der Umweltpakt Bayern. Die
meisten freiwilligen Ansätze in Deutschland, darunter das bekannteste Beispiel, die
Klimaschutzverpflichtung der deutschen Wirtschaft, sind auf der Bundesebene zu
finden.
Darüber hinaus existiert auf der internationalen Ebene eine Vielzahl von Ansät-
zen der Selbstregulierung, wenngleich sich internationale oder globale Ansätze
von Initiativen auf der nationalstaatlichen Ebene unterscheiden und sehr heterogen
sind. Der zentrale Unterschied ist, daß es nicht ,,im Schatten der Hierarchie" sondern
vielmehr im Schatten der ,,Ana rchie" verhandelt wird. Unternehmen, die auf globaler
Ebene Ansätze formulieren, sind am besten in der Lage, die Gestaltung selbst zu
bestimmen, da es kaum Richtlinien gibt, die das Verhalten von Unternehmen effektiv
regulieren (Fichter/Schneidewind 2000). Eine Sanktionierung des Nicht-Einhaltens
von Normen, wie sie z.B. der Global Compact der Vereinten Nationen oder die Co-
des of Conduct
der OECD formulieren, ist nicht möglich (OECD 1999b; Fuchs
31
Wie im Falle der Klimaschutzverpflichtung der deutschen Wirtschaft.
26
2000). Trotz gravierender Mängel sind diese Ansätze nicht überflüssig, denn die Al-
ternative ist die völlige Abwesenheit von Regulierung.
Bei genauer Beobachtung lassen sich Ausbreitungsmuster erkennen. Der Um-
weltpakt Bayern, als Erfolgsfall der Selbstregulierung bezeichnet, ist durch mehrere
Bundesländer übernommen worden
32
. Gefragt wird zunehmend, ob der Umweltpakt
ein ,,Modell für Deutschland" d arstellt (Bayerisches Staatsministerium für Landes-
entwicklung und Umweltfragen 2000). Auch ist erkennbar, daß sich nationale Arran-
gements international ausbreiten. Das Responsible-Care-Programme beispielsweise,
nach der Bhopal-Katastrophe 1984 durch die kanadische chemische Industrie ins
Leben gerufen, hat bis heute in 46 Ländern ausgebreitet, u.a. in Deutschland (VCI
2001). Arrangements, die auf dem Marktmechanismus basieren, bieten sich zur Dif-
fusion an, da Unternehmen in vielen Fällen nicht auf dem nationalen sondern auf
dem europäischen oder auf dem Weltmarkt konkurrieren. Dabei lassen sich zwei
Diffusionsmechanismen identifizieren. Zum einen können sich nationale Initiativen
auf Unternehmen auswirken, die ihre Produkte auf dem deutschen Markt anbieten
möchten. Ein Beispiel hierfür ist die Selbstverpflichtung der europäischen Papierher-
steller an das BMU zum umweltverträglichen Chemikalieneinsatz bei Selbst-,
Durchschreibe- und Thermodruckpapier von 1996 (Hucklenbruch 2000: 35ff)
33
. Zum
anderen kann die internationale Aktivität deutscher Unternehmen zur Diffusion von
höheren Produkt- oder Prozeßstandards, die auf freiwilliger Basis beschlossen wer-
den, in andere Märkte führen.
Die Laufzeit wird im wesentlichen durch die Art der Zusage bestimmt. Während
Produktabsprachen in der nahen Zukunft liegende Ziele betreffen (bis zu 5 Jahre),
erstrecken sich prozeßbezogene Zusagen, wie z.B. Klimaschutz- oder Energieeffi-
zienzvereinbarungen auf einen deutlich längeren Zeitraum (15-22 Jahre).
Der dynamische Aspekt ist ein wichtiges Merkmal von Verhandlungslösungen
(Krarup/Ramesohl 2000). Einerseits können Ziele in Nachverhandlungen relativ fle-
xibel und unbürokratisch im Vergleich zu ordnungsrechtlichen Instrumenten einer
neuen Situation angepaßt werden, andererseits können durch am Laufen gehaltene
Verhandlungen zwischen dem staatlichen und privaten Akteur Lernprozesse ange-
32
u.a. durch Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Sachsen und auch Regionen
außerhalb Deutschlands wie z.B. Südtirol.
33
Ein weiteres Beispiel wäre der Grüne Punkt anführen, der jene global produzierten Gü-
tern kennzeichnet, die auf den deutschen Markt importiert werden.
27
stoßen werden. Letztere können zu veränderten Einstellungen und im Idealfall zu
einer kooperativeren Haltung führen. Entscheidend ist die Entwicklung von gegen-
seitigem Vertrauen. Dieser Aspekt wird in der Tat als eine wesentliche Stärke gegen-
über dirigistischen Maßnahmen gesehen.
2.5.6 Eingrenzung für den weiteren Verlauf der Untersuchung
Die wichtigsten Elemente, die der Strukturierung von freiwilligen Ansätzen dienen,
sind erläutert worden. Es wird deutlich, daß sich durch die Berücksichtigung aller
Variablen zahlreiche ,,Konstruktionen" von freiwilligen Ansätzen ergeben. Folgende
Typenbildung soll zu einer besseren Übersicht führen.
Darstellung 7.: Typologie freiwilliger Ansätze
Kriterien
Deutsches Modell (D)
Niederländisches Modell (N)
Akteurskonstellation
Hauptsächlich zweistufig
(Staat, Verband, Unternehmen)
Einstufig (Staat, Unternehmen)
und zweistufig (Staat, Verband,
Unternehmen)
Freiwilligkeit/
staatlicher Einfluß
niedriger bis hoher
staatlicher Einfluß
niedriger bis hoher
staatlicher Einfluß
Legaler Status
rechtlich nicht bindend
rechtlich bindend
Verhältnis zu
anderen Instrumenten
(vorwiegend) normersetzend
target based
(vorwiegend) normvollziehend
implementation based
Reichweite/
Laufzeit
lokal bis international
(nationale Ebene dominierend)
lokal bis international
(nationale Ebene dominierend)
Quelle: Eigene Darstellung
Mit der hier vorgenommenen Typenbildung findet eine Eingrenzung statt, da sich
beide Modelle im Rahmen der von Highley (et al.) vorgenommenen Klassifizierung
34
auf die Typen der unilateral commitments, mehr noch auf negotiated agreements
beziehen. Der in den USA dominierende Ansatz der public voluntary schemes fällt
dabei heraus.
Die Reduzierung der Komplexität mag in einigen Punkten schematisch wirken,
jedoch erfüllt sie eine für den weiteren Verlauf der Untersuchung wichtige Funktion.
Das ,,deutsche" M odell entspricht wenn auch nicht in allen Punkten freiwilligen
Ansätzen auf europäischer Ebene, ist also der empirisch vorherrschende Typ. Das
damit kontrastierte niederländische Modell stellt mit seinen spezifischen Eigenschaf-
ten einen Sonderfall dar und ist im Hinblick auf eine erfolgreiche Weiterentwicklung
freiwilliger Ansätze im weiteren Verlauf der Untersuchung zu berücksichtigen.
34
Siehe Abschnitt 2.3.
28
3 Theoretische Erklärungsansätze
3.1 Die Auswahl der theoretischen Ansätze
Freiwillige Ansätze stellen situationsspezifische, pragmatische Lösungsansätze dar
und keine theoretisch entstandenen Arrangements, wie z.B. marktwirtschaftliche
Instrumente (Chidiak et al. 1999: 4). Zwei theoretische Zugänge werden verwendet,
um Erkenntnisse über freiwillige Ansätze zu gewinnen.Die folgenden Ansätze wer-
den in der Arbeit nicht diskutiert, jedoch sollen sie der Vollständigkeit halber ge-
nannt werden.
Zu den nicht verwendeten Ansätzen gehört die (internationale) politische Öko-
nomie, die die dominierende Rolle der Industrie im allgemeinen und von TNK im
besonderen betont (Bernauer 2000, Strange 1998) und das Phänomen des policy cap-
ture
erklärt. Dieser Ansatz liefert eine sehr pessimistische Einschätzung. So wird die
These vertreten, daß freiwillige Ansätze um so stärker durch private Akteure domi-
niert oder gefangen (captured) werden, je näher das vereinbarte Ziel an einer busi-
ness-as-usual
-Entwicklung ist (OECD 1999a: 31)
35
. Im internationalen Bereich be-
handelt die Regimetheorie den Aspekt der privaten Regime (Haufler 1993, Haufler
2000).
Zu den hier verwendeten theoretischen Ansätzen gehört die Theorie des kollekti-
ven Handelns. Das der Ökonomie entnommene Modell
36
fragt nach den Bedingun-
gen unter denen Kooperation aus der Sicht der individuellen Akteure stattfinden und
nach möglichen Lösungen für das zentrale Problem des Marktversagens. Der Ansatz
bietet sich zur Untersuchung von freiwilligen Ansätzen an, da Unternehmen als Wirt-
schaftsakteure der ökonomischen Handlungslogik folgen.
In Ergänzung dazu wird das Konzept der ökologischen Modernisierung herange-
zogen. Dieses erklärt den Wandel von (Industrie-)Staaten als Reaktion auf die Um-
weltkrise. Zum einen handelt es sich um ein technisches Konzept, das technische
Innovationen als Lösung sieht, zum anderen ist die Idee der politischen Modernisie-
rung zentral. Von den Steuerungsdefiziten des Staates ausgehend, beleuchtet das
Konzept die Rolle des Staates im Modernisierungsprozeß.
35
Es wird in diesem Fall auch von ,,captured networks" gesprochen (Howlett/Ramesh
1995: 130f).
36
Dies Modell wird auch in den internationalen Beziehungen angewendet und behandelt
das Problem der Global Public Goods (Kaul et al. 1999).
29
3.2 Die Theorie des kollektiven Handelns
3.2.1 Kollektives Handeln und die Umweltproblematik
Die Theorie des kollektiven Handelns und der öffentlichen Güter beruht auf dem
rational-choice
-Ansatz und berücksichtigt die Handlungslogik der ökonomischen
Akteure: Freiwillige Ansätze werden aus dem Blickwinkel der individuellen Nut-
zenmaximierung betrachtet (Schmelzer 1999: 47). Es soll an dieser Stelle nicht aus-
führlich auf die Theorie eingegangen werden sondern auf wesentliche Punkte, die die
Funktionsweise von freiwilligen Ansätzen zu erklären helfen. Das Problem des kol-
lektiven Handelns erweist sich hierbei als zentral: Es gibt in Bezug auf die Bereitstel-
lung öffentlicher Güter einen Widerspruch zwischen dem Anreiz individuellen Han-
delns und dem erwünschten optimalen Ergebnis für die Gruppe aller Beteiligten (Flo-
rini 2000: 16). Marktversagen ist die Folge: Der Marktmechanismus sorgt in be-
stimmten Fällen nicht für eine effiziente Ressourcenallokation.
Private Akteure zeichnen sich als Akteure des kollektiven Handelns dadurch aus,
a) daß sie zu den Konsumenten des Gutes Umwelt gehören und
b) daß von der Reduzierung der ökologischen Auswirkungen ihrer Aktivität der
Zuwachs des Gutes Umwelt abhängt.
Klassische öffentliche Güter, wie z.B. Sicherheit, werden von einer dem Individuum
übergeordneten Autorität, wie dem Staat, zur Verfügung gestellt, der für diese Dien-
ste Steuern erhebt. Umwelt kann als ein öffentliches Gut betrachtet werden, das zur
Nutzung durch ein Individuum oder Unternehmen bereitsteht. Zentral für öffentliche
Güter sind die Prinzipien der Nicht-Exklusivität und der Nicht-Rivalität. Diese besa-
gen, daß niemand vom Konsum eines Gutes ausgeschlossen werden kann, und daß
Akteure nicht um das Gut konkurrieren. Für das Gut Umwelt gelten sie nur in be-
grenztem Maße (Florini 2000: 16f). So wird die freie Nutzung der Umweltmedien
Luft, Boden und Gewässer einerseits durch die entsprechende Umweltgesetzgebung,
andererseits durch die Besitzstruktur eingeschränkt.
Die Verbindung der Idee des öffentlichen Gutes mit der Umweltproblematik läßt
sich durch das Phänomen der ,,Überweidung der Allmende" verdeutlichen: Di esem
Vergleich zufolge wird das Gut Umwelt durch intensive menschliche Aktivität über-
nutzt. Die Übernutzung hat zwei ökologische Dimensionen: Zum einen verknappen
sich laufend vorhandene Ressourcen wie fossile Energieträger, nicht erneuerbare
Rohstoffe und Süßwasserressourcen, zum anderen werden Ökosysteme bis an die
30
Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit, bzw. darüber hinaus belastet. Es geht also um die
Bereit- bzw. Wiederherstellung der intakten Natur als öffentlichem Gut.
Ökonomisch betrachtet, verursacht die Regeneration der zerstörten Umwelt be-
trächtliche Kosten: Es sind dies die ,,Reparaturkosten" für die Beseitigung von durch
wirtschaftlicher Aktivität oder privatem Verbrauch entstandenen Schäden. Diese
Kosten werden externalisiert, d.h. aus der betriebswirtschaftlichen Rechnung des
Verursachers herausgenommen und der Allgemeinheit aufgebürdet. Ein anschauli-
ches Beispiel hierfür ist das Waldsterben: Der Staat trägt die Kosten für die Beseiti-
gung der Schäden, die Industrie und Verkehr verursachen. In diesem Zusammenhang
wird von negativen externen Kosten gesprochen, die durch die Nutzung öffentlicher
Güter entstehen.
Das Gut Umwelt konnte zwar durch den Staat z.T. erfolgreich wieder bereitge-
stellt werden (wie im Falle von Wäldern und Flüssen), jedoch ist die langfristige
Wirksamkeit dieses nachsorgenden Ansatzes in Frage zu stellen
37
. Verschärft wird
die Umweltproblematik dadurch, daß sich in einigen Fällen der natürliche Zustand
nur unter sehr großen Anstrengungen und Kosten oder gar nicht wiederherstellen
läßt. Im Falle irreversibler Schäden, die sich auf technischem Wege nicht beheben
lassen, sind anstelle von Reparaturkosten die Kosten für die Beseitigung der Folge-
schäden zu tragen.
Im Zuge der eingangs beschriebenen neuen Problemlage und dem als Antwort
darauf verstandenen Leitbild der nachhaltigen Entwicklung stellen sich andere Fra-
gen als die des klassischen Umweltschutzes: Es geht nicht allein um die Wiederher-
stellung des Gutes Umwelt sondern um die Gesamtbelastbarkeit des Umweltraumes
und die sich daraus ableitenden Nutzungsrechte des Einzelnen.
Langfristig gesehen ist es für alle am Nutzungssystem Teilnehmenden sinnvoll,
mit dem knapper werdenden Gut Umwelt sparsam umzugehen, um im Sinne der
Nachhaltigkeit dieses nicht zu übernutzen und die eigene Lebensgrundlage nicht zu
gefährden. Für Unternehmen hieße das umweltfreundlicher zu wirtschaften, d.h. den
Ressourcenverbrauch und die Emissionen zu senken. Dies geschieht in gewissem
37
Zwar wären strengere Auflagen denkbar, jedoch stehen dem neben dem Problem der
zunehmenden Komplexität des Ordnungsrechtes die vielfältigen Interessen innerhalb
des Staatsapparates entgegen, die sich nicht auf den Umweltschutz beschränken. Die
Sicherung von Beschäftigung, z.B. durch die Subventionierung umweltschädigender Be-
reiche wie dem Kohlebergbau, hat sich oft als ein dem Umweltschutz übergeordnetes
Interesse erwiesen.
31
Maße durch die mit dem technologischen Fortschritt zunehmende Energieeffizienz
und -produktivität. Bestimmte Umweltschutzmaßnahmen, wie Investitionen in Ener-
gieeinsparung, sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll und stellen kein gro-
ßes Hindernis dar, da sie keine zusätzlichen Kosten verursachen. Diese werden als
no-regrets
-Maßnahmen bezeichnet (Rennings et al. 1996: 151f).
Anspruchsvolle Umweltziele dagegen, die sich aus dem Leitbild der nachhaltigen
Entwicklung ergeben, wie die Reduzierung von CO
2
in Deutschland bis 2050 um
80% (BUND 1996), sind jedoch mit no-regrets-Maßnahmen und einer leicht modifi-
zierten business-as-usual-Entwicklung nicht zu erreichen. Darüber hinausgehende
und dem Unternehmen weitere Kosten verursachende Anstrengungen sind dafür nö-
tig.
3.2.2 Soziales Dilemma und free-rider-Problem
Unternimmt ein Unternehmen weitergehende Anstrengungen zur Verringerung des
Ressourcenverbrauchs und des Emissionsausstoßes, so trägt es zu einer Verbesse-
rung der Umweltqualität und somit zur Bereitstellung des öffentlichen Gutes bei, das
aufgrund seiner Nicht-Exklusivität allen zugute kommt. Die Kosten trägt es jedoch
allein. Diese Option ist für den individuellen Unternehmensakteur ökonomisch unat-
traktiv und bietet scheinbar keinen Anreiz, diesen Schritt zu unternehmen. Es ent-
steht eine Dilemma-Situation
38
. Die Folge des sozialen Dilemmas ist, daß in einer
Situation ohne regelnde Instanz niemand das öffentliche Gut bereitstellen wird, und
somit ein suboptimales Ergebnis erzielt wird.
Ein weiteres zentrales Problem ist das free-rider- oder Trittbrettfahrerverhalten.
Einzelne Akteure nutzen das öffentliche Gut, ohne zu seiner Bereitstellung beizutra-
gen. Das free-rider-Problem ist differenziert zu betrachten:
a) Zum einen stellt sich das Problem bei Selbstverpflichtungen, die von Verbänden
für eine große Anzahl von Unternehmen bzw. für Branchen gemacht werden.
Durch die rechtliche Unverbindlichkeit können einzelne Mitglieder den Beitrag
verweigern, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Allerdings ist ne-
ben der Bindungskraft der moralischen Verpflichtung insbesondere die Wirkung
eines drohenden Negativ-Images nicht zu unterschätzen. Es ist möglich, daß Be-
38
Das der Spieltheorie entnommene Gefangenen-Dilemma, das die Situation von zwei
Akteuren bezeichnet, wird zu einem sozialen Dilemma mit mehreren Akteuren erweitert
(Rosenkötter 2000: 26).
32
obachter wie z.B. Umweltverbände einzelne ,,Verweigerer" d eutlich benennen,
um ihr nichtkooperatives Verhalten öffentlichkeitswirksam anzuprangern. Inso-
fern existiert zumindest eine weiche Handhabe.
b) Zum anderen stellt sich das Problem des Trittbrettfahrerverhaltens durch Unter-
nehmen aus dem In- und Ausland, die von Anfang an nicht an der Selbstver-
pflichtung teilnehmen, und denen Wettbewerbsvorteile dadurch entstehen, daß
sie sich nicht zur Einhaltung höherer Standards verpflichtet haben. Verpflichtun-
gen, die nur einen Teil der Marktteilnehmer betreffen, führen demnach zu Wett-
bewerbsverzerrungen und zur Benachteiligung derjenigen, die sich zu einer Um-
weltschutzleistung verpflichten.
Der Logik dieses Ansatzes folgend, dürften freiwillige Ansätze in Form von
kooperativen Lösungen nicht zustande kommen. Es stellt sich daher die Frage, wie
die in der Realität vorkommende Kooperation zu erklären ist. Daraus ließen sich
dann auch Folgerungen ziehen, wie eine Situation beschaffen sein muß, um das
Trittbrettfahrerverhalten zu vermeiden. Die zentralen Erklärungsansätze werden im
folgenden diskutiert.
3.2.3 Lösungsansätze: Kleine Gruppengröße und selektive
Anreize
Eine Standard-Hypothese des Kollektiven Handelns besagt, daß die Wahrscheinlich-
keit der Kooperation mit steigender Zahl der Akteure und wachsender Heterogenität
der Gruppe sinkt (Bernauer 2000: 149; Scharpf 1994: 396f). Das wird zum einen
damit begründet, daß die wachsende Heterogenität der Gruppe steigende Transakti-
onskosten verursacht: Die Verhandlung und Koordination zwischen den Akteuren
und die Überwachung der Maßnahmen wird komplizierter. Außerdem steigt die Ge-
fahr des Trittbrettfahrerverhaltens, da sich ein einzelnes Unternehmen in einer gro-
ßen Gruppe leichter der Kontrolle entziehen kann
39
. Auf freiwillige Ansätze bezogen
heißt das, daß es schwierig ist, Vereinbarungen zwischen dem staatlichen Akteur und
einer großen Zahl von Unternehmen abzuschließen, z.B. mit allen Firmen, die Farben
herstellen.
39
Die Gefahr besteht nicht bei sehr offenen Arrangements, in denen jedes Unternehmen
die zu erreichenden Ziele für sich bestimmen kann, wie im Falle des 33/50 Programme.
33
Im Umkehrschluß läßt sich behaupten, daß die Gruppe möglichst klein und in ih-
rer Interessenlage homogen sein muß, um eben diese Probleme zu umgehen. Florini
bezieht sich auf die Argumentation von Theoretikern der internationalen Beziehun-
gen: Diese plädieren dafür, Institutionen zu schaffen, die ermöglichen, daß große
Gruppen wie kleine funktionieren (Florini 2000: 18).
Ostrom identifiziert mehrere Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die
Selbstorganisation nichtstaatlicher Akteure zu einer optimalen und nachhaltigen Res-
sourcennutzung führt. Sie bezieht sich in ihrer Untersuchung (Ostrom 1990) zwar auf
eine Unterkategorie öffentlicher Güter, auf common pool resources (CPR), die durch
hohe Rivalität in der Nutzung gekennzeichnet sind
40
, jedoch lassen sich die genann-
ten Faktoren durchaus auch auf das free-rider-Verhalten bei freiwilligen Ansätzen
übertragen. Dazu zählen:
· die Bestimmung der Kapazität der Ressource,
· die Einigung auf ein Nutzungs- bzw. Verteilungssystem,
· die Kontrolle der Einhaltung des Systems und
· die Gewährleistung der Teilnahme an der Vereinbarung.
Das Auftreten von Fach- und Spitzenverbänden der Wirtschaft als Akteure in freiwil-
ligen Ansätzen bewirkt die Reduzierung der Komplexität des Abstimmungsprozes-
ses, einerseits zwischen den privaten Akteuren, andererseits zwischen staatlichem
und privatem Akteur. Ob der private Akteur aus Unternehmen oder aus Unternehmen
und einem oder mehreren Verbänden besteht, entspricht der oben vorgenommenen
Unterscheidung in ein- oder zweistufige Modelle und ist für die folgende
Argumentation entscheidend. Verbände erleichtern den Koordinationsprozeß zwi-
schen dem Staat und den privaten Akteuren, sie stellen für den Staat einen statt vieler
Verhandlungspartner dar. Andernfalls müßten die beteiligten Ministerien wie oben
angedeutet Verhandlungen über Ziele und Zeitpläne mit jedem Unternehmen ein-
zeln führen, womit sie überfordert wären (Hucklenbruch 2000: 98).
Für die Unternehmensseite bedeutet die Einbindung in ein zweistufiges Arran-
gement einen organisatorischen und strategischen Vorteil: Sie werden ebenfalls von
der Verhandlungsarbeit entlastet. Der Verband fungiert als Vermittler und über-
nimmt einen Großteil der Koordinierungsaufgabe. Wie unter 2.5.1 erläutert, fragt der
40
Z.B. die Fischerei.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832462512
- ISBN (Paperback)
- 9783838662510
- Dateigröße
- 2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Freie Universität Berlin – Politik- und Sozialwissenschaften, Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- freiwillige ansätze selbstverpflichtung modernisierung handeln marktversagen
- Produktsicherheit
- Diplom.de