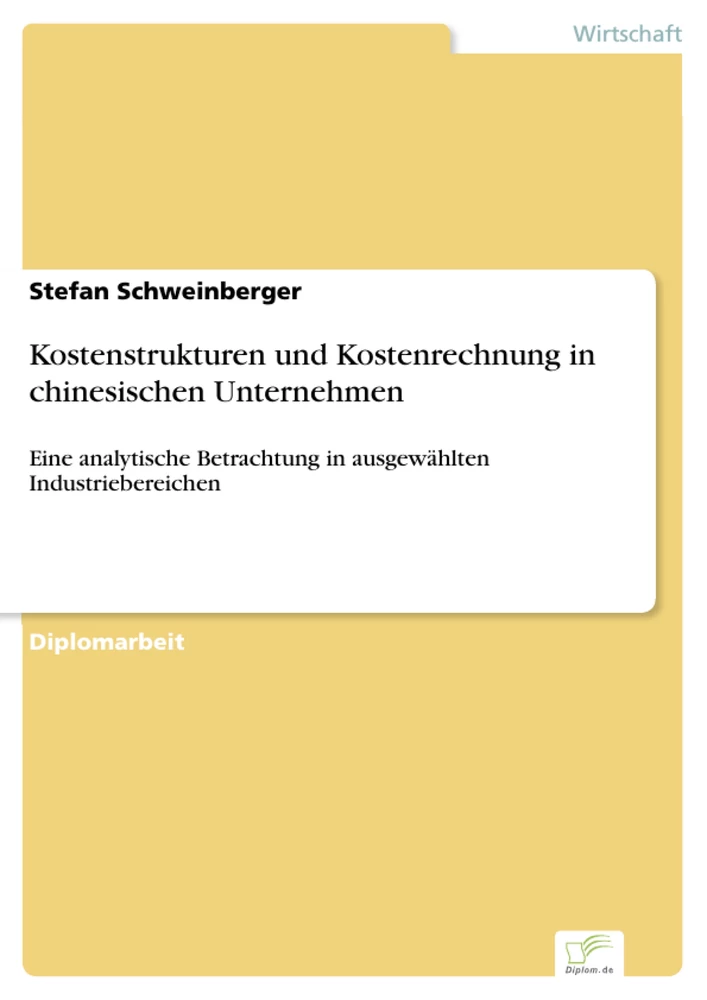Kostenstrukturen und Kostenrechnung in chinesischen Unternehmen
Eine analytische Betrachtung in ausgewählten Industriebereichen
©2002
Diplomarbeit
69 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Mit dem Beitritt zur World Trade Organization (WTO) am 10.11. 2001 verpflichtete sich die Volksrepublik China zur Öffnung ihrer Märkte für den internationalen Welthandel. Die damit ausgelöste Verschärfung des Wettbewerbes dürfte für chinesische Unternehmen mit weitreichenden Folgen verbunden sein. So dürften innerbetriebliche Fehler der Geschäftsführung, die als Folge einer mangelhaften Kostenrechnung auftreten können, wohl nicht mehr allein durch das günstige wirtschaftliche Wachstum kompensiert werden, sondern hätten auch entsprechend nachteilige Auswirkungen auf das Unternehmen selbst. Die Öffnung des chinesischen Marktes wird aber auch die Konsequenz mit sich bringen, dass sich die Unternehmen den internationalen Weltmarktpreisen stellen müssen. Der gesicherte Bestand eines Unternehmens wird somit nicht mehr allein durch Preiserhöhungen möglich sein, sondern wird auch weitreichende Kostenreduktionen im betrieblichen Produktionsprozess erfordern. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß die Kostenrechnung in chinesischen Unternehmen zur Erfüllung spezifischer Aufgaben eingesetzt wird.
Zur Untersuchung dieser Frage wurde in der Volksrepublik China eine explorative Studie durchgeführt, die Aufschluss über die Einsatzgebiete und die Ausgestaltung der Kostenrechnung in ausgewählten Unternehmen geben sollte. Schwerpunkt der Untersuchung waren insbesondere Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung, die der Automobilbranche angehörten. Die konkreten Fragestellungen dieser Arbeit lauten:
Inwiefern wird die Kostenrechnung in chinesischen Unternehmen eingesetzt?
Wie ist die Kostenrechnung in chinesischen Unternehmen gestaltet?
Was sind die Aufgaben der Kostenrechnung in chinesischen Unternehmen?
Kann die Kostenrechnung die an sie gestellten Aufgaben erfüllen?
Welche Faktoren beeinflussen die Anwendung der Kostenrechnung in chinesischen Unternehmen?
Gang der Untersuchung:
Zum besseren Verständnis der Untersuchungsergebnisse werden zuerst einige Informationen zur chinesischen Wirtschaft gegeben (Kapitel 2). Dabei werden nicht nur Entwicklung und Struktur der chinesischen Wirtschaft, sondern auch die wichtigsten Formen ausländischer Direktinvestitionen beschrieben.
Danach werden Methodik und Inhalt der Untersuchung erläutert (Kapitel 3). Neben der Vorgehensweise der Untersuchung werden auch die Merkmale der untersuchten Unternehmen vorgestellt. Während die bisherigen Kapitel nur einleitenden […]
Mit dem Beitritt zur World Trade Organization (WTO) am 10.11. 2001 verpflichtete sich die Volksrepublik China zur Öffnung ihrer Märkte für den internationalen Welthandel. Die damit ausgelöste Verschärfung des Wettbewerbes dürfte für chinesische Unternehmen mit weitreichenden Folgen verbunden sein. So dürften innerbetriebliche Fehler der Geschäftsführung, die als Folge einer mangelhaften Kostenrechnung auftreten können, wohl nicht mehr allein durch das günstige wirtschaftliche Wachstum kompensiert werden, sondern hätten auch entsprechend nachteilige Auswirkungen auf das Unternehmen selbst. Die Öffnung des chinesischen Marktes wird aber auch die Konsequenz mit sich bringen, dass sich die Unternehmen den internationalen Weltmarktpreisen stellen müssen. Der gesicherte Bestand eines Unternehmens wird somit nicht mehr allein durch Preiserhöhungen möglich sein, sondern wird auch weitreichende Kostenreduktionen im betrieblichen Produktionsprozess erfordern. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß die Kostenrechnung in chinesischen Unternehmen zur Erfüllung spezifischer Aufgaben eingesetzt wird.
Zur Untersuchung dieser Frage wurde in der Volksrepublik China eine explorative Studie durchgeführt, die Aufschluss über die Einsatzgebiete und die Ausgestaltung der Kostenrechnung in ausgewählten Unternehmen geben sollte. Schwerpunkt der Untersuchung waren insbesondere Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung, die der Automobilbranche angehörten. Die konkreten Fragestellungen dieser Arbeit lauten:
Inwiefern wird die Kostenrechnung in chinesischen Unternehmen eingesetzt?
Wie ist die Kostenrechnung in chinesischen Unternehmen gestaltet?
Was sind die Aufgaben der Kostenrechnung in chinesischen Unternehmen?
Kann die Kostenrechnung die an sie gestellten Aufgaben erfüllen?
Welche Faktoren beeinflussen die Anwendung der Kostenrechnung in chinesischen Unternehmen?
Gang der Untersuchung:
Zum besseren Verständnis der Untersuchungsergebnisse werden zuerst einige Informationen zur chinesischen Wirtschaft gegeben (Kapitel 2). Dabei werden nicht nur Entwicklung und Struktur der chinesischen Wirtschaft, sondern auch die wichtigsten Formen ausländischer Direktinvestitionen beschrieben.
Danach werden Methodik und Inhalt der Untersuchung erläutert (Kapitel 3). Neben der Vorgehensweise der Untersuchung werden auch die Merkmale der untersuchten Unternehmen vorgestellt. Während die bisherigen Kapitel nur einleitenden […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6246
Schweinberger, Stefan: Kostenstrukturen und Kostenrechnung in chinesischen
Unternehmen - Eine analytische Betrachtung in ausgewählten Industriebereichen
Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Erfurt, Fachhochschule, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
II
Vorwort
Die vorliegende Arbeit stützt sich auf eine empirische Untersuchung, die im Rahmen eines
dreimonatigen Aufenthalts in Changchun, Volksrepublik China, durchgeführt wurde. In die-
sem Zusammenhang gilt mein besonderer Dank Herrn Dr. Zhang, der durch seine großzügige
finanzielle Unterstützung erst die Durchführung dieser Arbeit ermöglicht hat. Ihm sei auch
gedankt für die Bereitstellung seiner vielfältigen Kontakte zu chinesischen Unternehmen, die
gerade in China eine große Rolle spielen. Danken möchte ich auch Herrn Prof. Prof. h.c. Dr.
Wagner vom Fachbereich 'Verkehrs- und Transportwesen' der Fachhochschule Erfurt für die
Kontaktherstellung zu Herrn Dr. Zhang.
Besonderer Dank gilt aber auch Herrn Prof. Dr. Müller für seine fachkundige Betreuung und
sein positives Bestreben zur Durchführung dieser Arbeit. Herrn Prof. Dr. Werdich möchte ich
für die Übernahme des Zweitgutachtens danken.
Zur Durchführung dieser Arbeit haben auch Frau Wu, Frau Lin und Frau Wang entscheidend
beigetragen. Ihnen möchte ich nicht nur für die Übernahme zahlreicher Dolmetscherdienste,
sondern auch für die tatkräftige Unterstützung im Rahmen des Aufenthalts danken. Darüber
hinaus sei auch allen beteiligten Firmen gedankt, die sich für die Untersuchungen bereit er-
klärt haben.
Danken möchte ich aber auch meiner Familie und meinen Freunden, die mir in vielfältiger
Hinsicht eine Hilfe waren. Besonderer Dank kommt meinem Bruder Michael zu, der mir
durch seine zahlreichen Ratschläge zur Durchführung empirischer Arbeiten geholfen hat.
Traunstein, im September 2002
Stefan Schweinberger
III
Inhaltsverzeichnis
Vorwort...II
Inhaltsverzeichnis ... III
Abkürzungsverzeichnis ...IV
Formel- und Symbolverzeichnis... V
Tabellenverzeichnis ...VI
1. Einleitung ...1
2. Wirtschaftlicher Hintergrund für Investitionen in der Volksrepublik China...3
2.1 Entwicklung und Struktur der chinesischen Wirtschaft ...3
2.2 Formen ausländischer Direktinvestitionen ...5
2.2.1 Equity Joint Venture...5
2.2.2 Contractual Joint Venture...6
2.2.3 Wholly Foreign-Owned Enterprise ...7
3. Methodik und Inhalt der Untersuchung ...8
4. Kostenstrukturen in chinesischen Unternehmen...11
5. Kosten- und Erlösrechnung in chinesischen Unternehmen...14
5.1 Grundsätzliche Anmerkungen ...14
5.2 Ermittlungsorientierte Rechnungen...16
5.2.1 Kostenartenrechnung ...16
5.2.2 Kostenstellenrechnung...18
5.2.3 Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation)...20
5.2.4 Kostenträgerzeitrechnung (Ergebnisrechnung) ...24
5.3 Planungs- und kontrollorientierte Rechnungen ...29
5.3.1 Budgetierung ...29
5.3.2 Plankostenrechnung...31
5.4 Entscheidungsorientierte Rechnungen ...36
5.4.1 Teilkostenrechnung ...36
5.4.2 Investitionsrechnung...40
6. Bewertung der Untersuchungsergebnisse ...44
7. Schlußbetrachtung...50
Anhang I: Gesamtübersicht zu den Untersuchungsergebnissen... 53
Anhang II: Fragebogen zur Durchführung der Interviews ... 55
Literaturverzeichnis ... 60
IV
Abkürzungsverzeichnis
Beschäftigungsabw. ...Beschäftigungsabweichung
Besch.bdgt. Abw...beschäftigungsbedingte Abweichung
Betriebsergebnisrchg. ...Betriebsergebnisrechnung
Bezugsgrößenkalk...Bezugsgrößenkalkulation
Budg...Budgetierung
Dept. ...Department
Differenz. Zuschlagsk...Differenzierende Zuschlagskalkulation
EK...Einzelkosten
Erweiterungsinv...Erweiterungsinvestitionen
Fertigungskostenbdg...Fertigungskostenbudget
GK ...Gemeinkosten
GuV-Rechnung...Gewinn- und Verlustrechnung
Innerbetr. Leistungsv. ...Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
IVR ...Investitionsrechnung
JV
X
...Joint Venture X
Kalk. Abschreibungen ...Kalkulatorische Abschreibungen
Kalk. Wagnisse...Kalkulatorische Wagnisse
Kalk. Zinsen...Kalkulatorische Zinsen
KAR...Kostenartenrechnung
Kostenüber-/-unterd...Kostenüber- oder -unterdeckung
KSR ...Kostenstellenrechnung
KTSR ...Kostenträgerstückrechnung
KTZR...Kostenträgerzeitrechnung
NKR...Normalkostenrechnung
No. ...Numero (= number)
PKR ...Plankostenrechnung
Planergebnisrchg...Planergebnisrechnung
Rationalisierungsinv. ...Rationalisierungsinvestitionen
RMB ...Renminbi
SOE...State-Owned Enterprise
Sonder-Ergebnisrchg. ...Sonder-Ergebnisrechnung
Summ. Zuschlagsk...Summarische Zuschlagskalkulation
TKR ...Teilkostenrechnung
Verbrauchsabw. ...Verbrauchsabweichung
VK ...Vollkostensatz
Vol. ...Volume
VR...Volksrepublik
VV-Budget...Verwaltungs- und Vertriebsbudget
VV-GK ...Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten
WFOE
X
...Wholly Foreign-Owned Enterprise X
WTO ...World Trade Organization
V
Formel- und Symbolverzeichnis
Formel 1... 33
K = Gesamtabweichung der Materialeinzelkosten des Kostenträgers
=
I
i
q
Istpreis des Produktionsfaktors i
=
P
i
q
Planpreis des Produktionsfaktors i
=
I
i
a
tatsächlicher Produktionskoeffizient des Produktionsfaktors i (je Kostenträger)
=
P
i
a
geplanter Produktionskoeffizient des Produktionsfaktors i (je Kostenträger)
=
I
x
tatsächlicher Output des Kostenträgers
=
P
x
geplanter Output des Kostenträgers
Formel 2... 34
K = Gesamtabweichung der Materialeinzelkosten des Produktionsfaktors
=
I
q
Istpreis des Produktionsfaktors
=
P
q
Planpreis des Produktionsfaktors
=
I
j
a
tatsächlicher Produktionskoeffizient des Produktionsfaktors (je Kostenträger j)
=
P
j
a
geplanter Produktionskoeffizient des Produktionsfaktors (je Kostenträger j)
=
I
j
x
tatsächlicher Output des Kostenträgers j
=
P
j
x
geplanter Output des Kostenträgers j
VI
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Merkmale der Unternehmen... 10
Tabelle 2: Kostenstrukturen der Unternehmen... 11
Tabelle 3: Kriterien zur Kostenartenrechnung in den Unternehmen... 18
Tabelle 4: Kriterien zur Kostenstellenrechnung in den Unternehmen ... 20
Tabelle 5: Kriterien zur Kostenträgerstückrechnung in den Unternehmen ... 24
Tabelle 6: Kriterien zur Kostenträgerzeitrechnung in den Unternehmen... 28
Tabelle 7: Kriterien zur Budgetierung in den Unternehmen ... 31
Tabelle 8: Kriterien zur Plankostenrechnung in den Unternehmen ... 35
Tabelle 9: Kriterien zur Teilkostenrechnung in den Unternehmen ... 40
Tabelle 10: Kriterien zur Investitionsrechnung in den Unternehmen ... 43
Tabelle 11: Unternehmensmerkmale und Untersuchungsergebnisse im Überblick... 46
1
1. Einleitung
Auf der im Jahr 1978 abgehaltenen Plenartagung der Kommunistischen Partei Chinas wurde
der Beschluß gefaßt, das planwirtschaftlich geprägte Wirtschaftssystem grundlegend zu re-
formieren. Zur erfolgreichen Gestaltung der Reformen war neben der Einführung marktwirt-
schaftlicher Elemente auch die gezielte Förderung ausländischer Direktinvestitionen notwen-
dig. Die hierzu beschlossenen Maßnahmen (z. B. Ausweisung von Sonderwirtschaftszonen,
Steuererleichterungen, unbürokratische Genehmigungsverfahren) wie auch die Größe und
Entwicklungsfähigkeit des chinesischen Marktes veranlaßten ausländische Investoren zur
Durchführung zahlreicher Direktinvestitionen (vgl. STATISTISCHES JAHRBUCH [2001],
S. 367, 369). Im Rahmen solcher Unternehmensneugründungen, die häufig als Gemein-
schaftsunternehmen gestaltet wurden, war neben dem erfolgreichen Aufbau von Produktion
und Vertrieb auch die Entwicklung des Rechnungswesens von zentraler Bedeutung. Denn
neben der Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen mußten auch entspre-
chende Rechenschaftsberichte für die ausländischen Investoren erstellt werden. In diesem
Zusammenhang wurde in der Regel auch der Aufbau einer Kosten- und Erlösrechnung be-
schlossen.
Mit dem Beitritt zur World Trade Organization (WTO) im Jahr 2001 verpflichtete sich die
Volksrepublik China zur Öffnung ihrer Märkte für den internationalen Welthandel. Durch die
damit ausgelöste Verschärfung des Wettbewerbs dürften die bisherigen zum Teil überpro-
portionalen Wachstumsraten (vgl. STATISTISCHES JAHRBUCH [2001], S. 350, 352) in
der Zukunft wohl nicht mehr erzielbar sein. Innerbetriebliche Fehler der Geschäftsführung,
die als Folge einer mangelhaften Kosten- und Erlösrechnung auftreten können, würden dann
nicht mehr allein durch das günstige wirtschaftliche Wachstum kompensiert, sondern hätten
auch entsprechend nachteilige Auswirkungen auf das Unternehmen selbst. Die Öffnung des
chinesischen Marktes wird aber auch die Konsequenz mit sich bringen, daß sich die Unter-
nehmen den internationalen Weltmarktpreisen stellen müssen. Der gesicherte Bestand eines
Unternehmens wird somit nicht mehr allein durch Preiserhöhungen möglich sein, sondern
wird auch weitreichende Kostenreduktionen im betrieblichen Produktionsprozeß erfordern.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie weit die Entwicklung der Kosten- und Er-
lösrechnung in chinesischen Unternehmen schon vorangeschritten ist und inwiefern diese die
an sie gestellten Aufgaben erfüllen kann.
Den Gegenstand dieser Arbeit bildet die Kosten- und Erlösrechnung in chinesischen Unter-
nehmen. Zu diesem Zweck wurde eine empirische Untersuchung durchgeführt, die Verwen-
2
dung und Gestaltung der Kosten- und Erlösrechnung in ausgewählten Unternehmen aufzeigen
soll. Schwerpunkt der Untersuchung waren insbesondere solche Unternehmensformen, die für
ausländische Direktinvestitionen in Frage kommen. Die konkreten Fragestellungen dieser
Arbeit lauten daher:
·
Inwiefern existiert eine Kosten- und Erlösrechnung in chinesischen Unternehmen?
·
Wie ist die Kosten- und Erlösrechnung in chinesischen Unternehmen gestaltet?
·
Was sind die Aufgaben der Kosten- und Erlösrechnung in chinesischen Unternehmen?
·
Kann die Kosten- und Erlösrechnung die an sie gestellten Aufgaben erfüllen?
·
Welche Faktoren beeinflussen die Verwendung und Gestaltung der Kosten- und Erlös-
rechnung in chinesischen Unternehmen?
Die Arbeit ist wie folgt gegliedert:
Zum besseren Verständnis der Untersuchungsergebnisse werden zuerst einige Informationen
zur chinesischen Wirtschaft gegeben (Kapitel 2). Dabei werden nicht nur Entwicklung und
Struktur der chinesischen Wirtschaft, sondern auch die wichtigsten Formen ausländischer
Direktinvestitionen beschrieben. Danach werden Methodik und Inhalt der Untersuchung er-
läutert (Kapitel 3). Neben der Vorgehensweise der Untersuchung werden auch die Merkmale
der untersuchten Unternehmen vorgestellt. Während die bisherigen Kapitel nur einleitenden
Charakter hatten, werden in den nachfolgenden Kapiteln die konkreten Untersuchungsergeb-
nisse beschrieben. Da die Kostenstrukturen der Unternehmen die grundlegende Gestaltung der
Kostenrechnung determinieren, werden diese zuerst erläutert (Kapitel 4). Danach werden die
einzelnen Ergebnisse zur Kosten- und Erlösrechnung in den untersuchten Unternehmen vor-
gestellt (Kapitel 5). Dabei wird zuerst untersucht, was die wesentlichen Aufgaben der Ko-
sten- und Erlösrechnung in chinesischen Unternehmen sind. Anschließend werden Verwen-
dung und Gestaltung der Kosten- und Erlösrechnung in den jeweiligen Unternehmen be-
schrieben. Im letzten Kapitel wird eine Bewertung der Untersuchungsergebnisse vorgenom-
men (Kapitel 6). Dabei wird untersucht, ob die Kosten- und Erlösrechnung in den jeweiligen
Unternehmen in der Lage ist, die an sie gestellten Aufgaben zu erfüllen. Danach wird geprüft,
welche Faktoren einen Einfluß auf die konkrete Verwendung und Gestaltung der Kosten- und
Erlösrechnung haben könnten.
3
2. Wirtschaftlicher Hintergrund für Investitionen in der Volksrepublik China
Zur sachkritischen Beurteilung der Untersuchungsergebnisse sind nicht nur fachliche Kennt-
nisse, sondern auch entsprechende Informationen zur chinesischen Wirtschaft notwendig.
Daher werden im folgenden neben der Entwicklung und Struktur der chinesischen Wirtschaft
auch die wichtigsten Formen ausländischer Direktinvestitionen erörtert.
2.1 Entwicklung und Struktur der chinesischen Wirtschaft
Systemimmanente Funktionsprobleme wie Versorgungsengpässe und Wachstumskrisen ver-
anlaßten die Volksrepublik China im Jahr 1978 zur Reformierung ihres bisher planwirtschaft-
lich organisierten Wirtschaftssystems. Die damit eingeleitete Transformationspolitik sah ne-
ben der Einführung von marktwirtschaftlichen Elementen auch die wirtschaftliche und politi-
sche Öffnung des Landes vor. Im Rahmen dieses Transformationsprozesses können mehrere
Phasen unterschieden werden (vgl. im folgenden BÜHLER [2000], S. 12-22). In der ersten
Phase (1978-1983) wurden mit den 'vier Modernisierungen' Verbesserungen in den Bereichen
Landwirtschaft, Industrie, Verteidigung sowie Wissenschaft und Technik angestrebt. Die
wichtigsten Beschlüsse hinsichtlich der Industrie waren die Dezentralisierung staatlicher Ent-
scheidungsbefugnisse auf lokale Regierungsbehörden und Staatsunternehmen, die Einrichtung
spezieller Sonderwirtschaftszonen zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen sowie die
Verabschiedung gesetzlicher Vorschriften zur Gründung von Gemeinschaftsunternehmen mit
chinesischer und ausländischer Kapitalbeteiligung (Joint Ventures). Die zweite Phase der
Transformationspolitik (1984-1991) sah die Verwirklichung einer 'planmäßigen Warenwirt-
schaft' vor. Wesentliche Ziele dieser Warenwirtschaft waren die Verteilung der Ressourcen
nach dem Leistungsprinzip und die Freigabe ausgewählter Preise. Mit der Umwandlung von
staatlichen Unternehmen in Aktiengesellschaften sollte außerdem die Trennung von Staatsei-
gentum und Unternehmensleitung erfolgen. Darüber hinaus wurden im Jahr 1986 gesetzliche
Vorschriften zur Gründung von Wholly Foreign-Owned Enterprises verabschiedet. Die dritte
Reformphase (1992-1996) wurde mit dem im Jahr 1992 abgehaltenen Parteitag der Kommu-
nistischen Partei Chinas eingeleitet. Auf diesem wurde die Umstrukturierung der Wirtschaft
in eine 'sozialistische Marktwirtschaft mit chinesischen Charakteristika' beschlossen. Damit
bekannte sich die chinesische Regierung erstmals zur Marktwirtschaft als vorherrschendes
Wirtschaftssystem. Neben dieser wichtigen Bestätigung des bisherigen Reformprozesses wur-
den in dieser Phase die sektorale und regionale Öffnungspolitik forciert, indem z. B. ausländi-
sche Direktinvestitionen auch in den Bereichen des Einzelhandels und der Unternehmensbera-
tung zugelassen wurden. Im Jahr 1997 wurde mit der Verabschiedung eines neuen Wirt-
4
schaftsprogramms eine weitere Reformphase eingeleitet, die der 'Theorie des Anfangsstadi-
ums des Sozialismus' folgen soll. In dieser Theorie wird die sozialistische Marktwirtschaft nur
als notwendiger Zwischenschritt gesehen, um die Rückständigkeit der Produktivkräfte über-
winden zu können. Damit versucht die chinesische Regierung eine ideologische Konformität
zwischen den bisherigen marktwirtschaftlichen Reformen und den Ideen des Sozialismus her-
stellen zu können. Das neue Wirtschaftsprogramm hatte insbesondere eine forcierte Umstruk-
turierung der Staatsunternehmen zum Ziel. Neben diversen Maßnahmen wurde beschlossen,
daß diese nicht mehr für die soziale Sicherung ihrer Mitarbeiter aufkommen müssen. Darüber
hinaus wurden der Versicherungsmarkt und der Bankensektor für ausländische Direktinvesti-
tionen zugänglich gemacht. Als ein letztes wichtiges Ereignis des wirtschaftlichen Reform-
prozesses kann der im Jahr 2001 erfolgte Beitritt der Volksrepublik China zur World Trade
Organization (WTO) gewertet werden. Damit verpflichtet sich China zur Einhaltung der
Grundprinzipien der WTO, die in den folgenden Jahren schrittweise umgesetzt werden sollen.
Neben der Senkung der Zölle werden insbesondere Anstrengungen in der Beseitigung nicht-
tarifärer Handelshemmnisse notwendig werden.
Im Rahmen der Systemtransformation wurden in verschiedenen Marktbereichen Reformen
durchgeführt, die insbesondere Auswirkungen auf die Durchführung ausländischer Direktin-
vestitionen haben (vgl. im folgenden BÜHLER [2000], S. 28-34). So wurden im Bereich des
Arbeitsmarktes Regelungen erlassen, die ausländischen Unternehmen neben der freien Aus-
wahl der künftigen Mitarbeiter auch die Verwendung leistungsabhängiger Vergütungssysteme
(z. B. Akkordlöhne) erlauben. Im Bereich des Kapitalmarktes wurden Reformen durchge-
führt, die ausländischen Investoren den Aktienerwerb von chinesischen Unternehmen sowie
die Kreditaufnahme bei chinesischen Banken ermöglichen. Da der Staat alleiniger Eigentümer
von Grund und Boden ist, wurden für den Bodenmarkt Regelungen getroffen, die für auslän-
dische Investoren den Erwerb von Landnutzungsrechten vorsehen. Damit können Grundstük-
ke je nach Nutzungszweck für eine bestimmte Zeitdauer genutzt werden. Eine Erschließung
möglicher Bodenschätze ist jedoch untersagt.
Die heutige Struktur der chinesischen Wirtschaft wird aber nicht nur durch die Verwirkli-
chung ausländischer Direktinvestitionen, sondern auch durch das neue Beziehungsgeflecht
zwischen staatlichen Behörden und Unternehmen geprägt (vgl. im folgenden HEILMANN
[2000], S. 196; SCHÜLLER [2000], S. 300; TANG/REISCH [1995], S. 28-33). Dieses hat
sich in den vergangenen Jahren herausgebildet und resultiert vorwiegend aus den umfassen-
den Verfügungsrechten der Wirtschaftsverwaltung. So nehmen Verwaltungs- und Parteikader
5
Einfluß darauf, welchen Unternehmen billige Kredite gewährt werden, wem bestimmte
Grundstücke oder Gebäude zur Nutzung überlassen werden, wer günstige Verträge abschlie-
ßen darf und letztlich wem überhaupt politische Protektion zukommt. Die Zuweisung solcher
wirtschaftlicher Privilegien hat sich in den vergangenen Jahren durch kommerziell arbeitende
Behördenstellen verstärkt, die als Ableger früherer Ministerien bezeichnet werden können.
Dieser dominierende Einfluß durch Verwaltungs- und Parteikader hat aber nicht nur ein enges
Beziehungsgeflecht zwischen Unternehmen und Staat geschaffen, sondern erschwert zugleich
das Aufkommen eines neuen Unternehmertums, das sich als autonome gesellschaftliche Kraft
etablieren könnte.
2.2 Formen ausländischer Direktinvestitionen
Ausländische Direktinvestitionen stellen immer die risikoreichste und kapitalintensivste Form
des Markteintritts dar. Für ausländische Investoren in der Volksrepublik China bieten sich
dabei mehrere mögliche Unternehmensformen an. Im folgenden werden mit dem Equity Joint
Venture, dem Contractual Joint Venture und dem Wholly Foreign-Owned Enterprise die
wichtigsten Formen ausländischer Direktinvestitionen vorgestellt.
2.2.1 Equity Joint Venture
Das Equity Joint Venture ist ein Gemeinschaftsunternehmen mit ausländischer Kapitalbeteili-
gung (vgl. im folgenden BÜHLER [2000], S. 136-139). Gesetzliche Grundlage dieser
Unternehmensform stellt das im Jahr 1979 verabschiedete 'Gesetz über sino-ausländische
Equity Joint Ventures' mit den Überarbeitungen aus dem Jahr 1990 dar. Darin ist das Equity
Joint Venture als juristische Person definiert, das von mindestens einem chinesischen und
einem ausländischen Partner gegründet werden muß. Die Einbringung des Kapitals kann von
beiden Seiten durch materielle und immaterielle Ressourcen vorgenommen werden. Als
Rechtsform kann für ein Equity Joint Venture die Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder
die Aktiengesellschaft gewählt werden. Letztere ist allerdings mit strengen Auflagen
verbunden. Als Partner eines Equity Joint Venture können von ausländischer Seite
Unternehmen, Organisationen oder Privatleute agieren. Für die chinesische Seite kommen
Staats-, Kollektiv- oder Privatunternehmen in Frage. Der Kapitalanteil des ausländischen
Investors muß zwischen 25% und 99% betragen. Für die Genehmigung eines Equity Joint
Venture müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein (z. B. Verwendung moderner
technischer Anlagen, Förderung technischer Innovationen, Export von Gütern).
6
Die Wahl eines Equity Joint Venture kann für einen ausländischen Investor verschiedene Be-
weggründe haben (vgl. hierzu BÜHLER [2000], S. 139-141). So stellt das Equity Joint Ven-
ture in einigen Industrie- und Dienstleistungsbereichen (z. B. Telekommunikations- und Au-
tomobilbereich, Versicherungen und Finanzdienstleistungen) aufgrund investitionsrechtlicher
Bestimmungen die einzige Möglichkeit einer ausländischen Direktinvestition dar. Stehen der
Wahl allerdings keine gesetzlichen Bestimmungen entgegen, wird die Form des Equity Joint
Venture aufgrund einer Reihe von Vorteilen gewählt. So kann das Beziehungsnetz (Guanxi)
des chinesischen Partners zu Behörden, Zulieferern und Distributoren als vorteilhaft gelten.
Aber auch die allgemeine Markt- und Landeskenntnis sowie der verbesserte Zugang zu Ab-
satz- und Beschaffungsmärkten können sich in einem fremden Land als vorteilhaft erweisen.
Schließlich spielt auch der Zugang zu einer lokalen Marke und der Erwerb von Marktanteilen
eine Rolle bei der Wahl eines Equity Joint Venture.
2.2.2 Contractual Joint Venture
Das Contractual Joint Venture ist ein Kooperationsunternehmen, das die Zusammenarbeit
von zwei Geschäftspartnern auf flexibler Vertragsbasis regelt (vgl. im folgenden BÜHLER
[2000], S. 141-143). Im Unterschied zum Equity Joint Venture richtet sich daher die Gewinn-
verteilung nicht nach Maßgabe des eingebrachten Kapitals, sondern nach den vertraglich fest-
gelegten Bestimmungen. Gesetzliche Grundlage des Contractual Joint Venture stellt das im
Jahr 1988 verabschiedete 'Gesetz über sino-ausländische Unternehmen gemeinschaftlicher
Kooperationen' dar. Demnach ist für ein Contractual Joint Venture keine Eigenkapitalbeteili-
gung der Partner erforderlich, wodurch sich das Kapitalverlustrisiko erheblich mindert. Als
Partner kommen für die chinesische Seite nur Unternehmen und Organisationen in Frage,
während auf ausländischer Seite auch Privatpersonen Verträge abschließen können. Das Con-
tractual Joint Venture kann als juristische Person oder als einfache Kooperation beschlossen
werden. Im Falle einer eigenen Rechtspersönlichkeit ist vom ausländischem Investor eine
Mindesteinlage von 25% erforderlich. Die Kapitaleinlage kann dabei materieller oder immate-
rieller Natur sein.
Contractual Joint Ventures können generell in allen Branchen und mit jeder Zielsetzung ge-
gründet werden. Allerdings hängt die Genehmigung letztendlich von den staatlichen Behör-
den ab. So kann davon ausgegangen werden, daß Gründungsanträgen in den Bereichen der
Medien und der Kommunikation von staatlicher Seite nicht stattgegeben werden wird, da sich
die chinesische Regierung das Informationsmonopol vorbehalten möchte (vgl. BÜHLER
[2000], S. 143). Zu den Vorteilen eines Contractual Joint Venture kann neben dem geringen
7
Kapitalverlustrisiko auch die vertraglich individuelle Ausgestaltung einer gemeinschaftlichen
Kooperation gezählt werden. Damit kann das Contractual Joint Venture als flexibles Investi-
tionsinstrument bezeichnet werden (vgl. BÜHLER [2000], S. 141).
2.2.3 Wholly Foreign-Owned Enterprise
Das Wholly Foreign-Owned Enterprise ist eine chinesische Tochtergesellschaft, die sich im
vollständigen Besitz einer ausländischen Unternehmung befindet (vgl. im folgenden BÜH-
LER [2000], S. 143-145). Die gesetzliche Grundlage bildet das im Jahr 1986 verabschiedete
'Gesetz über ausländisch-kapitalisierte Unternehmen'. Demnach ist ein Wholly Foreign-
Owned Enterprise eine juristische Person, die als Gesellschaft mit beschränkter Haftung ge-
gründet werden kann. Zur Gründung eines Wholly Foreign-Owned Enterprise muß als Vor-
aussetzung entweder die Verwendung fortschrittlicher Technologien oder eine jährliche Ex-
portquote von mehr als 50% (gemessen am Umsatz) gegeben sein.
Obwohl die Gründung eines Wholly Foreign-Owned Enterprise in bestimmen Wirtschaftsbe-
reichen (z. B. Medien, Außenhandel, Versicherungswesen, Telekommunikation) nicht erlaubt
oder nur in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Automobilbereich) genehmigt wird, ist die
Wahl dieser Unternehmensform mit weitreichenden Vorteilen verbunden (vgl. hierzu und im
folgenden BÜHLER [2000], S. 145, 146). Als wichtigster Vorteil kann die Unabhängigkeit
der Unternehmensführung bezeichnet werden. Das ermöglicht dem ausländischen Investor die
vollständige Kontrolle über sämtliche Managemententscheidungen. Darüber hinaus wird auch
der Schutz von Technologie- und Management-Know-how als vorteilhaft gesehen. Aber auch
die Beibehaltung des eigenen Unternehmensprofils kann sich als vorteilhaft erweisen.
8
3. Methodik und Inhalt der Untersuchung
Zur Gewinnung von Daten wurden von Anfang April bis Ende Juni 2002 neun chinesische
Unternehmen ausgewählt, die in einer näheren Untersuchung zur Kosten- und Erlösrechnung
befragt wurden. Zur sachgerechten Beurteilung der Untersuchungsergebnisse ist es daher
notwendig, Vorgehensweise und Inhalt der Untersuchung näher zu erläutern. Zuerst wird auf
die Untersuchungsmethodik eingegangen. Anschließend werden die Merkmale der Unter-
nehmen beschrieben.
Die Auswahl von Unternehmen, die sich für ein Interview bereit erklären, kann sich in China
als schwierig erweisen, wenn keine persönlichen Kontakte zu potentiellen Unternehmen be-
stehen. Eine Zufallsauswahl der Unternehmen war somit nur schwer möglich. Vielmehr wur-
de das Netzwerk schon untersuchter Unternehmen für die weitere Kontaktknüpfung zu ande-
ren Unternehmen genutzt. Diese Vorgehensweise wird als Schneeballtechnik bezeichnet (vgl.
DIEKMANN [1998], S. 346 f.). Die Befragungen selbst fanden in Form eines persönlichen
Face-to-face-Interviews statt. In drei der Unternehmen wurden neben der persönlichen Befra-
gung auch eigene Untersuchungen durchgeführt. Dabei konnten unternehmensspezifische
Unterlagen und Dateien sowohl eingesehen als auch eingehend analysiert werden. Neben der
Gewinnung von authentischen Informationen war damit auch der Vorteil verbunden, die bei
den anderen Unternehmen gewonnenen Befragungsergebnisse im Gesamtkontext besser beur-
teilen zu können. Die in den anderen Unternehmen durchgeführten Interviews dauerten
durchschnittlich drei Stunden lang. Interviewpartner waren in der Regel die Leiter der Abtei-
lung 'Finanzen und Rechnungswesen'.
1
In zwei Fällen wurden allerdings die Assistenten der
Geschäftsführung befragt. Sowohl die Dauer der Interviews als auch die Auswahl der befrag-
ten Personen garantierten die Gewinnung möglichst authentischer und somit valider Informa-
tionen über den Stand der Kosten- und Erlösrechnung im jeweiligen Unternehmen. Das per-
sönliche Interview wurde mit Hilfe eines englisch-sprachigen Fragebogens durchgeführt, der
standardisierte und offene Fragen enthielt. Der Fragebogen war dabei so aufgebaut, daß nach
der Befragung zu allgemeinen Unternehmensmerkmalen themenspezifische Fragen zur Ko-
sten- und Erlösrechnung folgten.
2
Bei den themenspezifischen Fragen wurden Antwortkatego-
rien nur im Bedarfsfall vorgegeben, da eine offene Befragung zu verbesserten Antwortresulta-
ten führte. Diese strukturierte, aber offene Form der Befragung wird als fokussiertes Interview
bezeichnet (vgl. DIEKMANN [1998], S. 446-449). Aufgrund der besonderen sozio-
ökonomischen Situation in der Volksrepublik China ist die persönliche Befragung einer posta-
1
Die genauen Positionen der einzelnen Interviewpartner sind im Anhang II aufgeführt.
2
Zum genauen Aufbau des Fragebogens siehe Anhang II.
9
lisch durchgeführten schriftlichen Befragung vorzuziehen.
3
Denn eine vertrauensvolle und
persönliche Atmosphäre ohne jegliche Anonymität ist für den Chinesen weitaus wichtiger als
nur ein ausgedruckter Fragebogen mit vorgegebenen Antwortkategorien. Aber auch Ver-
ständnisprobleme, die sowohl sprachlich als auch fachlich bedingt sein können, lassen sich im
Rahmen eines persönlichen durchgeführten Interviews besser aufklären als bei einer schriftli-
chen Befragung. Dieser Aspekt war im Rahmen der Untersuchung von besonderer Bedeutung,
da auch Führungskräfte die englische Sprache häufig nicht beherrschen. Die Durchführung
der Interviews wurde daher durch chinesisch-englisch-sprechende Dolmetscher unterstützt.
Außerdem konnte mit Hilfe der persönlichen Befragung gewährleistet werden, daß die eigent-
lichen Zielpersonen also die Leiter des Rechnungswesens die Fragen beantworteten. Die
persönliche Befragung gewährleistete somit möglichst authentische Informationen zum Stand
der Kosten- und Erlösrechnung in chinesischen Unternehmen. Die Auswertung der Daten
wurde mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse vorgenommen (vgl. DIEKMANN [1998], S.
510-516).
Schwerpunkt der Untersuchung waren Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung, die
der Automobilbranche angehörten. Die Auswahl beschränkte sich dabei auf die Provinzhaupt-
stadt Changchun (Provinz Jilin, Volksrepublik China), die zu den wichtigsten Standorten der
chinesischen Automobilproduktion zählt. Während acht Unternehmen der Zulieferindustrie
zugerechnet werden konnten, war das neunte Unternehmen als Automobilhersteller tätig.
Dementsprechend waren die Automobilzulieferer als kleine und mittelgroße Gesellschaften,
der Automobilhersteller hingegen als Großunternehmen zu klassifizieren. Unter den Unter-
nehmen befanden sich sechs Equity Joint Ventures, zwei Wholly Foreign-Owned Enterprises
und ein staatliches Unternehmen. Dieses wurde in die Untersuchung mit einbezogen, da staat-
liche Unternehmen häufig als Partner von Joint Ventures agieren.
Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, können die Untersuchungsergebnisse nicht als stati-
stisch repräsentativ gewertet werden. Es kann daher nur darum gehen, einen ersten Einblick in
die Anwendung und Gestaltung der Kosten- und Erlösrechnung in chinesischen Unternehmen
gewinnen zu können. Vor dem Hintergrund, daß in der Literatur bisher nur auf die allgemeine
Problematik des Management Accounting chinesischer Unternehmen eingegangen wurde,
4
ist
dieses Vorgehen plausibel. Zur besseren Beurteilung der Untersuchungsergebnisse werden in
3
Hier geht es auch um die Frage, ob in der gegebenen Situation qualitative oder quantitative Methoden der Be-
fragung zu besseren Ergebnissen geführt hätten.
4
Hierbei sei insbesondere auf die Artikel von BROMWICH/WANG (1991), JONES/XIAO (1999) und SCA-
PENS/MENG (1993) verwiesen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832462468
- ISBN (Paperback)
- 9783838662466
- DOI
- 10.3239/9783832462468
- Dateigröße
- 554 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Erfurt – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Dezember)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- rechnungswesen china kostenrechnung automobilindustrie empirische untersuchung
- Produktsicherheit
- Diplom.de