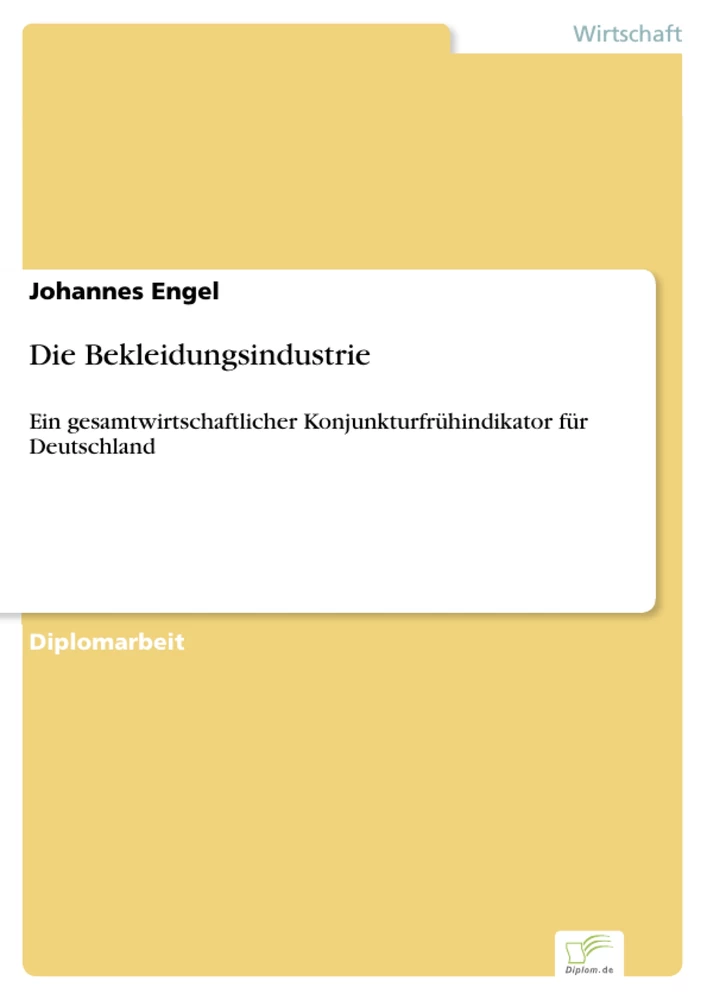Die Bekleidungsindustrie
Ein gesamtwirtschaftlicher Konjunkturfrühindikator für Deutschland
©2002
Diplomarbeit
106 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Die Wirtschaftspolitik in Deutschland ist per Gesetz seit 1967 dazu verpflichtet, in ihrem Streben nach einem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht vier Ziele zu verfolgen. Dies sind Preisniveaustabilität, hoher Beschäftigungsstand, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum und außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Man kann argumentieren, dass die beiden letztgenannten Ziele als Vorziele oder Voraussetzungen für die beiden ersten Ziele verstanden werden können. Diese Argumentation erhebt das Streben nach Preisniveaustabilität und hohem Beschäftigungsstand zu Primärzielen.
Wie an späterer Stelle (vgl. Kapitel 2.2.1) noch deutlich wird, spielt das Konjunkturphänomen im Streben nach diesen zwei Primärzielen eine zentrale Rolle. In diesem Zusammenhang ist es die Aufgabe der Wirtschaftspolitik, konjunkturelle Schwankungen möglichst gering zu halten, also mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, konjunkturellen (Fehl-)Entwicklungen entgegenzuwirken. Um diese Aufgabe erfolgreich zu erfüllen, ist es besonders wichtig für die Wirtschaftspolitik, rechtzeitig zu wissen, in welche Richtung sich die Konjunktur in Zukunft bewegen wird. Denn die Werkzeuge der Wirtschaftspolitik wirken meist mit zeitlicher Verzögerung. Sie müssen daher frühzeitig eingesetzt werden, damit sie auch die gewünschte antizyklische Wirkung erzeugen. Setzt ihre Wirkung zu spät, also möglicherweise prozyklisch ein, besteht die Gefahr, dass sie unerwünschte konjunkturelle Entwicklungen sogar noch verstärken.
Idealerweise müssten daher konjunkturelle Entwicklungen für die Wirtschaftspolitik zeitlich genau vorhersehbar sein. Wie in Kapitel 2.2.1 noch näher erläutert wird, gibt es mittlerweile mehrere Konjunkturprognoseverfahren, die der Wirtschaftpolitik ein frühzeitiges Erkennen wirtschaftlicher Fehlentwicklungen ermöglichen sollen. Kaum eines dieser Verfahren ist unumstritten. Allerdings wird einem davon ein vergleichsweise hoher Grad an Zuverlässigkeit zugesprochen: dem Einsatz von Konjunkturindikatoren, bzw. Konjunkturfrühindikatoren. Konjunkturfrühindikatoren sind konjunkturempfindliche wirtschaftliche Kennzahlen, die sich dadurch auszeichnen, dass ihre konjunkturbedingten Schwankungen mit einem regelmäßigen zeitlichen Vorlauf zur tatsächlichen Konjunktur eintreten. Es sind bisher jedoch nur wenige Kennzahlen bekannt, welche die Mindestanforderungen für eine zuverlässige Prognoseeignung erfüllen.
Anhand empirischer Untersuchungen soll nun in der […]
Die Wirtschaftspolitik in Deutschland ist per Gesetz seit 1967 dazu verpflichtet, in ihrem Streben nach einem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht vier Ziele zu verfolgen. Dies sind Preisniveaustabilität, hoher Beschäftigungsstand, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum und außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Man kann argumentieren, dass die beiden letztgenannten Ziele als Vorziele oder Voraussetzungen für die beiden ersten Ziele verstanden werden können. Diese Argumentation erhebt das Streben nach Preisniveaustabilität und hohem Beschäftigungsstand zu Primärzielen.
Wie an späterer Stelle (vgl. Kapitel 2.2.1) noch deutlich wird, spielt das Konjunkturphänomen im Streben nach diesen zwei Primärzielen eine zentrale Rolle. In diesem Zusammenhang ist es die Aufgabe der Wirtschaftspolitik, konjunkturelle Schwankungen möglichst gering zu halten, also mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, konjunkturellen (Fehl-)Entwicklungen entgegenzuwirken. Um diese Aufgabe erfolgreich zu erfüllen, ist es besonders wichtig für die Wirtschaftspolitik, rechtzeitig zu wissen, in welche Richtung sich die Konjunktur in Zukunft bewegen wird. Denn die Werkzeuge der Wirtschaftspolitik wirken meist mit zeitlicher Verzögerung. Sie müssen daher frühzeitig eingesetzt werden, damit sie auch die gewünschte antizyklische Wirkung erzeugen. Setzt ihre Wirkung zu spät, also möglicherweise prozyklisch ein, besteht die Gefahr, dass sie unerwünschte konjunkturelle Entwicklungen sogar noch verstärken.
Idealerweise müssten daher konjunkturelle Entwicklungen für die Wirtschaftspolitik zeitlich genau vorhersehbar sein. Wie in Kapitel 2.2.1 noch näher erläutert wird, gibt es mittlerweile mehrere Konjunkturprognoseverfahren, die der Wirtschaftpolitik ein frühzeitiges Erkennen wirtschaftlicher Fehlentwicklungen ermöglichen sollen. Kaum eines dieser Verfahren ist unumstritten. Allerdings wird einem davon ein vergleichsweise hoher Grad an Zuverlässigkeit zugesprochen: dem Einsatz von Konjunkturindikatoren, bzw. Konjunkturfrühindikatoren. Konjunkturfrühindikatoren sind konjunkturempfindliche wirtschaftliche Kennzahlen, die sich dadurch auszeichnen, dass ihre konjunkturbedingten Schwankungen mit einem regelmäßigen zeitlichen Vorlauf zur tatsächlichen Konjunktur eintreten. Es sind bisher jedoch nur wenige Kennzahlen bekannt, welche die Mindestanforderungen für eine zuverlässige Prognoseeignung erfüllen.
Anhand empirischer Untersuchungen soll nun in der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5984
Engel, Johannes: Die Bekleidungsindustrie - Ein gesamtwirtschaftlicher Konjunkturfrühindikator
für Deutschland
Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Bad Homburg, Wirtschaftsakademie, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Seite iii
Inhaltsverzeichnis
Seite
Abkürzungsverzeichnis ... v
Abbildungsverzeichnis... vi
Tabellenverzeichnis...viii
1
Einleitung...1
1.1
Problemstellung...1
1.2
Aufbau der Arbeit ...2
1.3
Grenzen und Prämissen ...4
2
Theoretische Grundlagen der Konjunkturanalyse...8
2.1
Der klassische Konjunkturverlauf ...8
2.1.1
Begriff und Darstellung...8
2.1.2
Kennzeichen eines klassischen Konjunkturverlaufs ...10
2.1.3
Referenzgrößen zur Messung der Konjunktur ...11
2.2
Konjunkturindikatoren ...16
2.2.1
Notwendigkeit und Methoden der Konjunkturprognose ...16
2.2.1.1
Ökonometrische Modelle...17
2.2.1.2
Iterativ-analytische Prognosen...18
2.2.1.3
Der Indikator-Ansatz...19
2.2.2
Klassifizierung von Indikatoren ...19
2.2.3
Frühindikatoren ...23
2.2.3.1
Ansprüche und Kriterien ...23
2.2.3.2
Für Konjunkturprognosen geeignete Frühindikatoren ...24
2.2.3.3
Branchenspezifische Frühindikatoren ...26
3
Konjunktur in Deutschland zwischen 1973 und 2000...29
3.1
Identifizierung des Konjunkturverlaufs nach 1973...29
3.2
Erläuterung der drei Konjunkturzyklen ...30
Inhaltsverzeichnis
Seite iv
3.2.1
1973 bis 1980 ...30
3.2.2
1980 bis 1990 ...31
3.2.3
1991 bis 2000 ...34
3.3
Darstellung des Konjunkturverlaufs anhand ausgewählter
Kennzahlen ...35
3.3.1
Kapazitätsauslastungsgrad des Verarbeitenden Gewerbes ...35
3.3.2
Nettoproduktionsindex des Produzierenden Gewerbes ...38
3.3.3
Gesamtwirtschaftlicher Beschäftigungsstand...43
4
Die Bekleidungsindustrie im konjunkturellen Verlauf...51
4.1
Kapazitätsauslastung, Nettoproduktion, Beschäftigung und
Geschäftsklima zwischen 1973 und 2000 ...52
4.1.1
Kapazitätsauslastung...52
4.1.2
Nettoproduktion...58
4.1.3
Geschäftsklima...68
4.1.4
Beschäftigungsstand...74
4.1.5
Zusammenfassung der beobachteten zeitlichen Verhaltensweisen...79
4.2
Mögliche Ursachen ...82
4.2.1
Steigende Exportquote und wachsende Importe ...84
4.2.2
Sinkender Anteil der Nachfrage nach Bekleidung an der
Gesamtnachfrage...87
4.2.3
Wachsender Anteil exklusiver Mode an der Gesamtproduktion ...88
4.2.4
Zusammenfassung...90
5
Schlussbetrachtung: Ist die Bekleidungsindustrie ein konjunktureller
Frühindikator? ...92
Literaturverzeichnis ... I
Abkürzungsverzeichnis
Seite v
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
Anm. d. A.
Anmerkung des Autors
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BIP
R
Reales Bruttoinlandsprodukt
BSP
Bruttosozialprodukt
bzw.
beziehungsweise
c.p.
ceteris paribus (lat. unter sonst gleichen Bedingungen)
ca.
zirka
d.h.
das heißt
DM
Deutsche Mark
engl.
englisch
etc.
et cetera
evtl.
eventuell
ggf.
gegebenenfalls
Hrsg.
Herausgeber
lat.
lateinisch
NBER
National Bureau of Economic Research
SVR
Sachverständigenrat (zur Begutachtung gesamtwirtschaftli-
cher Entwicklungen)
t
Zeit (engl. time)
Verf. unbek.
Verfasser unbekannt
vgl.
vergleiche
VGR
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
WP
Wendepunkt
Abbildungsverzeichnis
Seite vi
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abb. 1:
Idealtypischer Konjunkturverlauf mit Phasenbezeichnungen... 9
Abb. 2:
Unterschiedliche Extrempunkte bei Interpretation der Konjunktur als
Veränderung der Wachstumsraten des BIP ... 12
Abb. 3:
Konjunkturzyklen in Deutschland gemessen am
Kapazitätsauslastungsgrad im Verarbeitenden Gewerbe ... 29
Abb. 4:
Kapazitätsauslastungsgrad im Verarbeitenden Gewerbe ... 37
Abb. 5:
Nettoproduktionsindex für das Produzierende Gewerbe (Basisjahr:
1995)... 39
Abb. 6:
Nettoproduktionsindex für das Produzierende Gewerbe (Abweichung
vom Trend) und Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden
Gewerbe ... 40
Abb. 7:
Nettoproduktionsindex nach der Wiedervereinigung für Deutschland
und das frühere Bundesgebiet im Vergleich... 42
Abb. 8:
Erwerbstätige (bis 1990 Alte Bundesländer, ab 1991
Deutschland)... 44
Abb. 9:
Erwerbstätige 1973 bis 1990 (Alte Bundesländer): Abweichung vom
Trend... 45
Abb. 10:
Erwerbstätige 1991 bis 2000 (Deutschland): Abweichung vom
Trend... 46
Abb. 11:
Erwerbstätige und Nettoproduktionsindex (Abweichung vom
Trend) ... 47
Abb. 12:
Erwerbstätige (Abweichung vom Trend) und Kapazitäts-
auslastungsgrad ... 49
Abb. 13:
Kapazitätsauslastungsgrad für Verarbeitendes Gewerbe,
Verbrauchsgüterindustrie und Bekleidungsindustrie ... 53
Abb. 14:
Nettoproduktionsindex für Produzierendes Gewerbe,
Verbrauchsgüterindustrie und Bekleidungsindustrie ... 58
Abb. 15:
Konsumausgabenindex (Basisjahr: 1973) ... 60
Abbildungsverzeichnis
Seite vii
Abb. 16:
Exportquote des Bekleidungsgewerbes ... 60
Abb. 17:
Deutsche Exporte, Importe und Außenbeitrag für Bekleidung (in
Preisen von 1995) ... 61
Abb. 18:
Nettoproduktionsindex (Abweichung vom Trend) für Produzierendes
Gewerbe, Verbrauchsgüterindustrie und Bekleidungsindustrie ... 62
Abb. 19:
Nettoproduktionsindex (Abweichung vom Trend) für Produzierendes
Gewerbe, Verbrauchsgüterindustrie und Bekleidungsindustrie (1973 -
1987)... 64
Abb. 20:
Nettoproduktionsindex (Abweichung vom Trend) für Produzierendes
Gewerbe, Verbrauchsgüterindustrie und Bekleidungsindustrie (1987 -
2000)... 66
Abb. 21:
Geschäftsklima für Verarbeitendes Gewerbe, Verbrauchs-
güterindustrie und Bekleidungsindustrie ... 69
Abb. 22:
Geschäftsklima für Verarbeitendes Gewerbe, Verbrauchs-
güterindustrie und Bekleidungsindustrie (1973 - 1987) ... 71
Abb. 23:
Geschäftsklima für Verarbeitendes Gewerbe, Verbrauchs-
güterindustrie und Bekleidungsindustrie (1987 - 2000) ... 73
Abb. 24:
Erwerbstätige der Verbrauchsgüter- und Bekleidungsindustrie ... 74
Abb. 25:
Zahl der Erwerbstätigen (Abweichung vom Trend): Insgesamt,
Verbrauchsgüterindustrie und Bekleidungsindustrie ... 76
Abb. 26:
Zahl der Erwerbstätigen (Abweichung vom Trend): Insgesamt,
Verbrauchsgüterindustrie und Bekleidungsindustrie (höhere vertikale
Skalierung)... 77
Abb. 27:
Preisindexentwicklung seit 1965 (auf Basis von 1991) ... 87
Tabellenverzeichnis
Seite viii
Tabellenverzeichnis
Seite
Tabelle 1:
Lage der Konjunkturphasen zwischen 1973 und 2000 anhand des
Kapazitätsauslastungsgrads für Verarbeitendes Gewerbe,
Verbrauchsgüterindustrie und Bekleidungsindustrie ...52
Tabelle 2:
Amplitudenveränderungen beim Kapazitätsauslastungsgrad
zwischen konjunkturellen Hoch- und Tiefpunkten ...58
Tabelle 3:
Lage der Konjunkturphasen zwischen 1973 und 2000 anhand des
Nettoproduktionsindex (Trendabweichung) für Produzierendes
Gewerbe, Verbrauchsgüterindustrie und Bekleidungsindustrie ...63
Tabelle 4:
Amplitudenveränderungen beim Nettoproduktionsindex zwischen
konjunkturellen Hoch- und Tiefpunkten ...67
Tabelle 5:
Lage der Konjunkturphasen zwischen 1973 und 2000 anhand des
Geschäftsklimas für Verarbeitendes Gewerbe, Verbrauchs-
güterindustrie und Bekleidungsindustrie ...70
Tabelle 6:
Lage der Konjunkturphasen zwischen 1973 und 2000 anhand des
Beschäftigungsstandes (Trendabweichung) für Gesamtwirtschaft,
Verbrauchsgüterindustrie und Bekleidungsindustrie ...78
Tabelle 7:
Zeitliches Verhalten der Bekleidungsindustrie im Vergleich zum
entsprechenden Gesamtaggregat an den Wendepunkten für
Kapazitätsauslastungsgrad, Nettoproduktionsindex, Geschäftsklima
und Beschäftigtenzahl ...79
Tabelle 8:
Zeitliches Verhalten der Bekleidungsindustrie im Vergleich zum
entsprechenden Gesamtaggregat an den unteren Wendepunkten für
Kapazitätsauslastungsgrad, Nettoproduktionsindex, Geschäftsklima
und Beschäftigtenzahl ...80
Einleitung
Seite 1
1
Einleitung
1.1
Problemstellung
Die Wirtschaftspolitik in Deutschland ist per Gesetz seit 1967 dazu verpflichtet, in
ihrem Streben nach einem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht vier Ziele zu ver-
folgen. Dies sind Preisniveaustabilität, hoher Beschäftigungsstand, stetiges und an-
gemessenes Wirtschaftswachstum und außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Man
kann argumentieren, dass die beiden letztgenannten Ziele als Vorziele oder Vor-
aussetzungen für die beiden ersten Ziele verstanden werden können. Diese Argu-
mentation erhebt das Streben nach Preisniveaustabilität und hohem Beschäfti-
gungsstand zu Primärzielen.
1
Wie an späterer Stelle (vgl. Kapitel 2.2.1) noch deutlich wird, spielt das
Konjunkturphänomen im Streben nach diesen zwei Primärzielen eine zentrale Rolle.
In diesem Zusammenhang ist es die Aufgabe der Wirtschaftspolitik, konjunkturelle
Schwankungen möglichst gering zu halten, also mit den Mitteln, die ihr zur
Verfügung stehen, konjunkturellen (Fehl-)Entwicklungen entgegenzuwirken. Um
diese Aufgabe erfolgreich zu erfüllen, ist es besonders wichtig für die
Wirtschaftspolitik, rechtzeitig zu wissen, in welche Richtung sich die Konjunktur in
Zukunft bewegen wird. Denn die Werkzeuge der Wirtschaftspolitik wirken meist mit
zeitlicher Verzögerung. Sie müssen daher frühzeitig eingesetzt werden, damit sie
auch die gewünschte antizyklische Wirkung erzeugen. Setzt ihre Wirkung zu spät,
also möglicherweise prozyklisch ein, besteht die Gefahr, dass sie unerwünschte
konjunkturelle Entwicklungen sogar noch verstärken.
Idealerweise müssten daher konjunkturelle Entwicklungen für die Wirtschaftspolitik
zeitlich genau vorhersehbar sein. Wie in Kapitel 2.2.1 noch näher erläutert wird, gibt
es mittlerweile mehrere Konjunkturprognoseverfahren, die der Wirtschaftpolitik ein
frühzeitiges Erkennen wirtschaftlicher Fehlentwicklungen ermöglichen sollen. Kaum
eines dieser Verfahren ist unumstritten. Allerdings wird einem davon ein vergleichs-
weise hoher Grad an Zuverlässigkeit zugesprochen: dem Einsatz von Konjunkturin-
dikatoren, bzw. Konjunkturfrühindikatoren. Konjunkturfrühindikatoren sind konjunk-
turempfindliche wirtschaftliche Kennzahlen, die sich dadurch auszeichnen, dass ihre
1
Vgl. Pätzold (1998), S. 28f.
Einleitung
Seite 2
konjunkturbedingten Schwankungen mit einem regelmäßigen zeitlichen Vorlauf zur
tatsächlichen Konjunktur eintreten. Es sind bisher jedoch nur wenige Kennzahlen
bekannt, welche die Mindestanforderungen für eine zuverlässige Prognoseeignung
erfüllen.
Anhand empirischer Untersuchungen soll nun in der vorliegenden Arbeit herausge-
funden werden, ob die Entwicklung der deutschen Bekleidungsindustrie diesen Vor-
aussetzungen für den Einsatz als konjunktureller Frühindikator gerecht wird. Der
Anstoß zur Bearbeitung dieser Fragestellung war eine Äußerung eines Angestellten
des Aschaffenburger Arbeitsamtes. Sie lautet: ,,Wenn die Gesamtwirtschaft hüstelt,
hat die Bekleidungsindustrie schon eine Grippe." Dieser Aussage ging die Überle-
gung voraus, dass die Menschen in schlechten Zeiten, also wenn das Einkommen
niedrig ist oder ein niedriges Einkommen erwartet wird, zuerst an der Bekleidung
sparen, bevor sie auf andere Konsumgüter verzichten. Für die Siebziger Jahre bes-
tätigt auch Breitenacher vom ifo Institut für Wirtschaftsforschung in München diese
Annahme.
2
Ferner gab es vereinzelt empirische Untersuchungen, die ein konjunktu-
relles Vorlaufverhalten bestimmter Bereiche der Konsumgüterindustrie demonstrie-
ren (vgl. Kapitel 2.2.3.3).
Es scheint also Indizien zu geben, die es lohnenswert erscheinen lassen der Frage
danach, ob die Bekleidungsindustrie in Deutschland den Charakter eines Konjunk-
turfrühindikators hat, auf den Grund zu gehen. Führte diese Untersuchung tatsäch-
lich zu einem positiven Ergebnis, so wäre der Wirtschaftspolitik möglicherweise ein
weiteres Mittel an die Hand gegeben, mit dem sie konjunkturelle Fehlentwicklungen
wie Arbeitslosigkeit oder Inflation prognostizieren und damit wirkungsvoll bekämpfen
könnte.
1.2
Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist neben der Einleitung in vier weitere Teile untergliedert: Kapitel 0 bis 5.
In Kapitel 0 wird ein theoretisches Fundament gelegt, in dem die für die späteren
Analysen wichtigen Begriffe ,,Konjunktur", ,,Konjunkturprognosen" und ,,Konjunktur-
indikatoren" vorgestellt und näher erläutert werden. Kapitel 3 befasst sich konkret
mit dem Konjunkturphänomen in Deutschland während der Jahre 1973 bis 2000.
2
Vgl. Breitenacher (1975), S. 7
Einleitung
Seite 3
Anhand von in Kapitel 2.1.3 eingeführten konjunkturellen Referenzreihen (Kapazi-
tätsauslastungsgrad des Verarbeitenden Gewerbes, Nettoproduktionsindex des
Produzierenden Gewerbes und gesamtwirtschaftliche Beschäftigtenzahl) wird der
Konjunkturverlauf dieser Periode dargestellt und genauer erklärt. Nach dieser
grundlegenden Einführung in das Konjunkturphänomen (Kapitel 0 und 3) konzent-
riert sich das 4. Kapitel schließlich auf die Bekleidungsindustrie. Die in Kapitel 0 und
3 vorgestellten gesamtwirtschaftlichen konjunkturellen Referenzreihen einschließlich
dem Geschäftsklimaindex, einer der zuverlässigeren Frühindikatorreihen (vgl. Kapi-
tel 2.2.3.2), werden den entsprechenden Reihen für die Bekleidungsindustrie ge-
genübergestellt und deren Verläufe auf zeitlich-konjunkturelles Verhalten hin mitein-
ander verglichen. Zur Absicherung geschieht dasselbe auch mit den entsprechen-
den Reihen für die Konsumgüterindustrie. Nur so kann sichergestellt werden, dass
auffällige konjunkturelle Verhaltensmuster der gesamten Konsumgüterindustrie nicht
fälschlicherweise der Bekleidungsindustrie zugesprochen werden. Denn es sollen ja
gerade Muster aufgedeckt werden, die in besonderem Maße typisch für die Beklei-
dungsindustrie sind und sich damit von denen der gesamten Konsumgüterindustrie
abheben.
Die Analyse wird für insgesamt vier verschiedene Reihen durchgeführt, denn nur
unter Berücksichtigung mehrerer Kennzahlen und mit der Identifizierung von Ge-
meinsamkeiten in deren Verläufen kann näherungsweise eine Aussage über das
konjunkturelle Verhalten der Bekleidungsindustrie gemacht werden. Andernfalls
würden sich Aussagen lediglich auf ausgewählte Kennzahlen der Bekleidungsin-
dustrie nicht aber auf die Bekleidungsindustrie als solche beziehen. Selbstver-
ständlich wäre das eingangs genannte Ziel, einen weiteren zuverlässigen Konjunk-
turfrühindikator zu finden, auch oder sogar viel eher damit erreicht, wenn sich
herausstellte, dass eine der ausgewählten Kennzahlen für die Bekleidungsindustrie
einen stetigen Vorlaufcharakter besitzt. Das ist jedoch nicht das Thema dieser Ar-
beit. Es soll vielmehr untersucht werden, ob die Bekleidungsindustrie als solche eine
Tendenz zum konjunkturellen Vorlauf hat. Würde sich diese Annahme bestätigen,
könnte man in einer weiteren Untersuchung prüfen, welche der bekleidungsspezifi-
schen Kennzahlen am ehesten für Konjunkturprognosen geeignet wären.
Aus den Ergebnissen der vier Einzelanalysen wird in Kapitel 4.1.5 schließlich fest-
gestellt, ob die Bekleidungsindustrie der gesamtwirtschaftlichen Konjunktur vor-,
gleich oder nachläuft. Das Untersuchungsergebnis wird daraufhin versucht, volks-
wirtschaftlich zu begründen (Kapitel 4.2).
Einleitung
Seite 4
Wie aus dem Grundlagenteil (Kapitel 2.2.3.1) hervorgeht, ist allerdings ein konjunk-
tureller Vorlaufcharakter an sich nicht ausreichend, um den Anforderungen, die an
einen für Prognosen geeigneten Konjunkturfrühindikator gestellt werden, gerecht zu
werden. Aus diesem Grund werden im 5. Kapitel der Schlussbetrachtung zur
vollständigen Beantwortung der im Arbeitstitel gestellten Frage die vier Kennzahlen
zusätzlich noch auf die übrigen Kriterien, die ein Konjunkturfrühindikator erfüllen
muss, hin untersucht. Dieser Teil, der eher auf die einzelnen Kennzahlen als auf die
Bekleidungsindustrie insgesamt eingeht, stellt ansatzweise dar, wie eine mögliche
Untersuchung einzelner Reihen auf ihre Prognoseeignung hin aussehen könnte.
1.3
Grenzen und Prämissen
Diese Arbeit basiert auf den folgenden, die Aussagekraft unter Umständen ein-
schränkenden, Rahmenbedingungen und Grundannahmen:
1. Saisonbereinigung
3
: Da die benutzten Datenreihen teilweise aus unterschiedli-
chen Quellen stammen, können die Verfahren zur Saisonbereinigung variieren.
Teilweise wurde die Saisonbereinigung auch vom Autor selbst mit einem etwas
älteren Verfahren (BV 4) durchgeführt. Es kommt daher vor, dass Reihen mit-
einander verglichen werden, die auf unterschiedliche Weise von saisonalen
Schwankungen bereinigt worden sind, was zu geringfügigen Ungenauigkeiten
führen kann. Wenn in einer Zahlenreihe eine Saisonbereinigung durchgeführt
wurde, so wird in einer Fußnote auf das benutzte Verfahren hingewiesen.
2. Definition von Konjunktur. Auch wenn es teilweise umstritten ist, wird für diese
Arbeit wie an späterer Stelle (2.1.1) noch näher begründet wird der Begriff
,,Konjunktur" als ,,Schwankungen im gesamtwirtschaftlichen Kapazitätsauslas-
tungsgrad" definiert. Diese Definition erschien dem Autor als durchaus gerecht-
fertigt und nicht unüblich. Man sollte sich allerdings im Klaren darüber sein, dass
eine andere Definition von Konjunktur durchaus zu einem anderen Ergebnis der
Analyse führen kann.
3. Länge des Betrachtungszeitraums: Der für diese Untersuchung gewählte Be-
trachtungszeitraum (1973 bis 2000) umfasst eine Dauer von 27 Jahren. Dieser
3
Saisonbereinigung bedeutet das Herausfiltern oder Vermindern saison- oder kalendermo-
natsbedingter Schwankungen aus/in einer Kurve. Hierzu gibt es mehrere Methoden, die auf
unterschiedlichen mathematischen Rechenverfahren beruhen und daher zu leicht voneinan-
der abweichenden Ergebnissen führen.
Einleitung
Seite 5
Zeitraum wurde aus unterschiedlichen Gründen gewählt. Der wichtigste dieser
Gründe ist die Freigabe der Wechselkurse im Jahre 1973, welche alle volkswirt-
schaftlich bedeutenden Währungen betraf. Ein Vergleich der Daten davor und
danach ist deshalb insbesondere für die Gegenwart ungenau. Durch die aus-
schließliche Betrachtung der Konjunkturentwicklung nach dieser einschneiden-
den Rahmenveränderung ist eine solidere Grundlage für die Analyse geschaf-
fen. Ein weiterer Grund ist die Verfügbarkeit der Daten namentlich der monat-
lich erhobenen: Je weiter eine Zeitreihe zurückliegt, desto schwieriger ist es
besonders für einzelne Industriezweige vergleichbare Daten zu erhalten. Da-
durch, dass mit 27 Jahren ein vergleichsweise kurzer Betrachtungszeitraum ge-
wählt wurde, ist natürlich die Aussagekraft der Ergebnisse eingeschränkt. So
könnte sich ein bei 27jähriger Betrachtung festgestelltes kontinuierliches Verhal-
tensmuster bei 50jähriger Betrachtung als ein nur rein zufälliges, vorübergehen-
des Phänomen herausstellen. In den zu betrachtenden 27 Jahren liegen drei
konjunkturelle Tief- und zwei Hochpunkte. Allerdings ist der zweite dieser Hoch-
punkte von ganz besonderer Art, da er unter volkswirtschaftlich und politisch
außergewöhnlichen Bedingungen auftrat: der deutschen Wiedervereinigung. Es
ist daher nicht auszuschließen, dass sich einzelne Indikatorkurven in diesem
Boom anders verhalten, als sie es sonst täten. Streng genommen gibt es also im
gewählten Betrachtungszeitraum nur einen ,,regulären" Konjunkturhochpunkt. In
dieser Arbeit können deshalb möglicherweise handfeste Aussagen nur über
konjunkturelles Verhalten an unteren Wendepunkten (Tiefpunkten) gemacht
werden, denn nur für diese gibt es hinreichende Vergleichsmöglichkeiten.
4. Beschränkung auf Deutschland: Jede Volkswirtschaft unterscheidet sich von
anderen. Diese Arbeit beschränkt sich auf die Betrachtung der deutschen
Volkswirtschaft. Dies bedeutet, die Ergebnisse dieser Untersuchung haben auch
nur für die deutsche Volkswirtschaft Relevanz. Es ist durchaus möglich, dass ei-
ne unter ähnlichen Bedingungen in einer anderen Volkswirtschaft durchgeführte
Untersuchung zu vollkommen anderen Ergebnisse führt.
5. Europäische Integration: Die Stichhaltigkeit der Zahlenreihen kann auch darun-
ter leiden, dass seit 1973 die Europäische Integration stark fortgeschritten ist
und es dadurch Einflüsse auf die deutsche Bekleidungsindustrie gab, die nicht
immer der Konjunktur zugerechnet und aus der Analyse nicht herausgefiltert
werden konnten.
6. Veränderung der geografischen Eingrenzung aufgrund der Wiedervereinigung:
Prinzipiell wurden in den untersuchten Reihen bis einschließlich 1990 die Daten
Einleitung
Seite 6
für das frühere Bundesgebiet vor der Wiedervereinigung und ab 1991 die für das
ganze Bundesgebiet (einschließlich der Neuen Bundesländer) erfasst. Je nach
Beschaffenheit der Kurven kann es also zwischen 1990 und 1991 zu einem
Bruch kommen. Bei einigen wenigen Datenreihen liegt dieser Bruch ein paar
Jahre später, da bei manchen Quellen die Umstellung erst später erfolgte. So-
fern vom Autor allerdings eine Verminderung der Aussagekraft der Kurven durch
diesen Umstand vermutet wird, gibt es einen entsprechenden Hinweis im Text.
7. Umstellung des Systems zur Klassifizierung von Wirtschaftszweigen: Bei den
Datenreihen des Statistischen Bundesamts gibt es eine zusätzliche Ursache für
den Bruch zwischen 1990 und 1991: Das alte System zur Einteilung der unter-
schiedlichen Wirtschaftszweige (,,SYPRO") wurde Anfang der Neunziger Jahre
ersetzt durch eine neue Einteilung (,,WZ93"). Da die Datenreihen für das verei-
nigte Deutschland nur nach der neuen Klassifizierung erhältlich sind, können die
Werte vor und nach 1990 schon allein wegen der möglicherweise unterschiedli-
chen Definitionen bzw. Eingrenzungen von Wirtschaftsbereichen voneinander
abweichen.
8. Eingrenzung des Begriffs Bekleidungsindustrie: Unter Bekleidungsindustrie wird
in dieser Arbeit ,,die in Deutschland angesiedelte Produktion von Bekleidung"
verstanden. Ausgeschlossen aus dieser Eingrenzung sind Schuh- und Lederin-
dustrie, Pelzindustrie, Textilindustrie (Herstellung und Veredelung von Gewe-
ben) sowie deutsche Unternehmen, die ihre Ware im Ausland fertigen lassen
(Eigenimporte). Bei deutschen Unternehmen, die Bekleidung zum Teil im Aus-
land und zum Teil im Inland produzieren, wird nur der in Deutschland hergestell-
te Teil berücksichtigt, weil sich andernfalls Schwierigkeiten mit dem verfügbaren
Datenmaterial ergeben würden. Auch eine andersartige Definition des Begriffs
der Bekleidungsindustrie kann zu anderen Resultaten führen.
9. Wahl der Referenzreihen: Die Wahl der vier Referenzreihen, mit denen konjunk-
turelle Schwankungen dargestellt werden und anhand derer das konjunkturelle
Verhalten der Bekleidungsindustrie untersucht wird, beruht zunächst auf der De-
finition des Konjunkturbegriffs als Schwankungen des Kapazitätsauslastungs-
grads. Ferner waren die Verfügbarkeit statistischer Daten sowie die in der Litera-
tur bewertete Eignung und Zuverlässigkeit dieser Reihen für die Auswahl ent-
scheidend. Die vier Reihen sollen in dieser Arbeit dazu dienen, unterschiedliche
Aspekte der Bekleidungsindustrie darzustellen, so dass aus der Summe der Er-
gebnisse für die einzelnen Reihen Aussagen über die Bekleidungsindustrie als
solche gemacht werden können.
Einleitung
Seite 7
Wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, können Ungenauigkeiten bei den Zahlenrei-
hen nicht ausgeschlossen werden. Dennoch hält der Autor die vorliegende Analyse
für sinnvoll. Denn sollte sie zu einem positiven Ergebnis führen, bedeutete dies,
dass eine eingehendere Untersuchung der Fragestellung lohnend sein könnte.
Würde eine Frühindikatoreignung der Bekleidungsindustrie unter den vorliegenden
Prämissen hingegen nicht bestätigt werden, wäre davon auszugehen, dass auch
eine genauere, weniger eingeschränkte Untersuchung das gewünschte Ergebnis
nicht erzielen könnte. In diesem Fall wäre von einer weiteren Prüfung der These
abzuraten.
Theoretische Grundlagen der Konjunkturanalyse
Seite 8
2
Theoretische Grundlagen der Konjunkturanalyse
2.1
Der klassische Konjunkturverlauf
2.1.1
Begriff und Darstellung
Der Begriff Konjunktur bezeichnet die Schwankungen der wirtschaftlichen Aktivität
einer Volkswirtschaft.
4
Noch bis zum Zweiten Weltkrieg wurden nur absolute Verän-
derungen der wirtschaftlichen Aktivität als Konjunkturschwankungen bezeichnet.
Seit der Nachkriegszeit jedoch hat sich die Empfindlichkeit gegenüber konjunkturel-
len Veränderungen derart verstärkt, dass es sich heute definitionsgemäß bei Kon-
junkturschwankungen nicht mehr um ein absolutes Steigen und Fallen der wirt-
schaftlichen Aktivitäten oder der gesamtwirtschaftlichen Produktion handelt, sondern
vielmehr um beschleunigtes und verlangsamtes Wirtschaftswachstum.
5
Konjunktur kann daher für die heutige Zeit definiert werden als ein zyklischer und
mehr oder weniger regelmäßiger Verlauf der gesamtwirtschaftlichen Leistung einer
Volkswirtschaft, der sich in Auf- und Abwärtsbewegungen um einen generellen
Wachstumstrend bewegt. Die durchschnittliche Dauer eines Konjunkturzyklus be-
trägt zwischen drei und acht Jahren und obwohl der Ablauf normalerweise einem
ähnlichen Schema folgt, ist jeder Konjunkturzyklus unterschiedlich und daher
schwer vorhersehbar.
6
Die Unterteilung konjunktureller Schwankungen erfolgt in mindestens vier Phasen:
Expansion, Boom, Kontraktion und Depression. In einer etwas genaueren Betrach-
tung können diese vier Phasen jeweils noch wie folgt unterteilt oder erweitert wer-
den (vgl. Abb. 1):
Der Beginn der Expansion wird als Erholung bezeichnet und diese Erholung geht
bei verstärktem Aufschwung über in die Prosperität oder den Boom, welcher seinen
Höhepunkt in der Krise erfährt. Der darauf folgende Abschwung (oder Kontraktion),
der zunächst sehr steil verläuft, wird im flacheren Verlauf als Rezession bezeichnet
4
Vgl. Hennies (2001), S. 266f. und Tichy (1995), S. 7.
5
Vgl. Tichy (1994), S. 9
6
Vgl. Hennies (2001), S. 266f. und Tichy (1995), S. 7.
Theoretische Grundlagen der Konjunkturanalyse
Seite 9
und findet seinen Tiefpunkt in der Depression oder Talsohle. Diese Depression kann
auch zur Stagnation werden, wenn sich vorübergehend keine Erholung einstellt.
7
Expansion/
Aufschwung
Hochkon-
junktur /
Boom
Er-
holung
Prosperität
Krise / Peak
Kontraktion/
Abschwung
Depres-
sion / Tal-
sohle
Er-
holung
Re-
zes-
sion
BIP
R
t
ggf. Stagna-
tion
Abb. 1: Idealtypischer Konjunkturverlauf mit Phasenbezeichnungen
8
Der in Abb. 1 in Form von Sinuskurven dargestellte Konjunkturverlauf ist in so ideal-
typischer Weise noch nie beobachtet worden. Vielmehr hat man in empirischen Un-
tersuchungen der Konjunkturschwankungen während der Jahre 1969 bis 1994 die
folgenden Charakteristika festgestellt:
Anders als Sinuskurven zeichnen sich konjunkturelle Kurven insbesondere dadurch
aus, dass die Aufschwungphasen länger sind als die Phasen des konjunkturellen
Rückgangs.
9
Außerdem sind die Aufschwungphasen häufig gekennzeichnet von ei-
nem Zwischenschwung, also einem vorübergehenden Wachstumsrückgang, der je-
doch nicht stark genug ist, um als Rezession bezeichnet zu werden. Darüber hinaus
7
Vgl. Hennies (2001), S. 270ff.
8
Vgl. Hennies (2001), S. 270
9
Vgl. Tichy (1994), S. 51ff.
Theoretische Grundlagen der Konjunkturanalyse
Seite 10
ist auffällig, dass Depressionen von meist sehr kurzer Dauer, Boomphasen hinge-
gen deutlich länger sind. Depressionen bestehen also i.d.R. nur aus einem einzigen
Tiefpunkt, der gleichzeitig Wendepunkt ist, und Boomphasen treten in Form von
Hochplateaus auf.
10
(Der tatsächliche Konjunkturverlauf in Deutschland wird in Kapi-
tel 3.3 dargestellt.)
2.1.2
Kennzeichen eines klassischen Konjunkturverlaufs
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie sich in einem lehrbuchmäßigen Konjunk-
turzyklus einzelne gesamtwirtschaftliche Komponenten verhalten. Der Autor ist sich
dessen bewusst, dass es unterschiedliche Erklärungs- und Interpretationsansätze
für das Konjunkturphänomen gibt. Diesen Unterscheidungen auf angemessene
Weise Rechnung zu tragen, würde allerdings zu weit führen, weshalb sich der Autor
an dieser Stelle für die Erläuterung eines sehr allgemeinen gefassten Ansatzes ent-
schieden hat. Die vier Phasen des klassischen Konjunkturzyklus können daher wie
folgt beschrieben und begründet werden:
11
In der Erholungsphase beginnen die Wirtschaftssubjekte (d.h. in erster Linie die Un-
ternehmer) die gesamtwirtschaftliche Lage nach der Depression wieder etwas posi-
tiver zu beurteilen; sie sind jedoch noch immer etwas unsicher und daher auch noch
zurückhaltend in ihren Aktivitäten. Es wird also noch kaum investiert und die Pro-
duktion steigt zwar, befindet sich aber trotzdem noch auf einem relativ niedrigen Ni-
veau. Erst in der Phase der Prosperität werden die positiven Erwartungen der Wirt-
schaftssubjekte sicherer und schlagen sich in steigendem Produktionsniveau und
einem höheren Beschäftigungsstand nieder. Andere Indikatoren dieser Phase sind
eine steigende Gewinnquote, also ein wachsender Anteil der Unternehmensgewin-
ne am Volkseinkommen, eine steigende Kapitalnachfrage aufgrund der wachsenden
Investitionstätigkeit der Unternehmer und eine sich ankündigende Knappheit der
Produktionsfaktoren. Im Boom, also in der letzten Phase des Aufschwungs, schla-
gen erhöhte Güter- und Kapitalnachfrage sowie das Erreichen von Kapazitätsgren-
zen um in stark steigende Preise, Zinsen und später auch höhere Löhne. Ihren Hö-
hepunkt erreicht diese Entwicklung in der Krise, die vor allem durch Kapitalmangel
und Unternehmensinsolvenzen gekennzeichnet ist.
10
Vgl. Oppenländer (1995a), S. 15
11
Vgl. Hennies (2001), S. 271f.
Theoretische Grundlagen der Konjunkturanalyse
Seite 11
In der darauf folgenden Kontraktion (Abschwungphase) sinkt die gesamtwirtschaftli-
che Nachfrage und damit auch die Investitions- und Produktionstätigkeit der Unter-
nehmen; Mitarbeiter werden entlassen und das Preisniveau sinkt oder stagniert. In
den letzten beiden Phasen der Kontraktion (Rezession und Depression) sinkt die
Produktionsmenge weiter, was zu einem hohen Grad an Unterauslastung der Pro-
duktionskapazitäten führt und ein hohes Maß an konjunkturbedingter Arbeitslosig-
keit nach sich zieht. Unternehmen haben jetzt eher negative Erwartungen und sind
daher sehr zurückhaltend aus der Sorge, es könne sich eine wirtschaftliche Stagna-
tion einstellen. Ein weiterer Indikator für die Depression ist ein aus der zurückge-
gangenen Kapitalnachfrage resultierendes niedriges Zinsniveau für kurz- und lang-
fristige Kredite.
Eine Erholung kann erst dann wieder eintreten, wenn Unternehmer oder Wirt-
schaftssubjekte wieder zuversichtlich werden und dem wiedergewonnenen Vertrau-
en in eine künftig positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung eine erneute Ausdeh-
nung der Produktion folgt.
2.1.3
Referenzgrößen zur Messung der Konjunktur
Geläufige Größen oder volkswirtschaftliche Kennzahlen, die Aufschluss über die
konjunkturelle Lage einer Volkswirtschaft geben, sind jeweils nach Bereinigung
von saison- und trendbedingten Schwankungen und Entwicklungen Inlandspro-
dukt, Volkseinkommen, Beschäftigungsstand, Produktions- und Kapazitätsauslas-
tungsgrad, Preisniveau, Auftragslage, Zinsniveau und Konsumnachfrage, um nur
die wichtigsten zu nennen.
12
Es gab vor allem in der Nachkriegszeit unterschiedliche
Ansätze mit dem Ziel, über sogenannte Diffusionsindizes, also dem Vermischen
verschiedenster Kennzahlen zu einem Gesamtindex, eine Größe zu erhalten, die
den Konjunkturverlauf einer Volkswirtschaft exakt definieren kann. Der Vorteil dieser
Diffusionsindizes, wie zum Beispiel dem des National Bureau of Economic Re-
search (NBER) in den USA, liegt in erster Linie darin, dass die verschiedensten In-
dikatoren wie Aktienkurse, Auftragseingänge oder Konjunktureinschätzungen von
Experten berücksichtigt werden können. Sie finden jedoch schon seit den Siebziger
12
Vgl. Hennies (2001), S. 267f.
Theoretische Grundlagen der Konjunkturanalyse
Seite 12
Jahren kaum noch Anwendung, da man keine theoretische Basis für eine sinnvolle
Gewichtung und Auswahl der einzelnen Kennzahlen innerhalb des Index fand.
13
Auch eine Darstellung der Konjunktur anhand von Wachstumsraten des (saisonbe-
reinigten) Bruttoinlandsprodukts (oder einer anderen gesamtwirtschaftlichen Entste-
hungsgröße), die zunächst plausibel erscheinen mag, da man Konjunktur ja heute
wie weiter oben (vgl. Kapitel 2.1.1) dargestellt als verlangsamtes und beschleunig-
tes Wachstum definiert, ist aus folgendem Grund nicht sinnvoll: Selbst wenn die
Konjunktur ein Schwanken der gesamtwirtschaftlichen Leistung um einen Wachs-
tumstrend ist, so befinden sich die Wendepunkte der Konjunkturkurve (Hochkon-
junktur oder Depression) nicht dort, wo das Wachstum am stärksten respektive am
schwächsten ist, sondern dahinter.
14
Abb. 2 verdeutlicht, dass eine Interpretation
des Konjunkturverlaufs anhand von Wachstumsraten ein verfälschtes Bild ergäbe,
da der Kurvenverlauf zeitversetzt dargestellt würde.
BIP
R
t
Hochpunkt
der
Wachs-
tumsraten
kurve
Hochpunkt der
Konjunkturkurve
Tiefpunkt
der
Wachs-
tumsra-
tenkurve
Tiefpunkt
der
Konjunk-
turkurve
Abb. 2: Unterschiedliche Extrempunkte bei Interpretation der Konjunktur als Veränderung
der Wachstumsraten des BIP
Aus diesem Beispiel wird auch deutlich, wie wichtig eine klare Abgrenzung des Beg-
riffs ,,Konjunktur" ist. Oppenländer bezeichnet daher in seinen Ausführungen Kon-
13
Vgl. Tichy (1994), S. 15f. und Heubes (1991), S. 14f.
14
Vgl. Tichy (1994), S. 11f.
Theoretische Grundlagen der Konjunkturanalyse
Seite 13
junktur als ,,Schwankungen im Auslastungsgrad des Produktionspotentials"
15
. Dies
scheint plausibel, denn das trendmäßige Wirtschaftswachstum einer Volkswirt-
schaft, das vorwiegend auf Bevölkerungswachstum und technischen Fortschritt zu-
rückgeht, schlägt sich fraglos im Produktionspotenzial nieder; also in der Möglich-
keit, eine mit der Zeit wachsende Menge an Gütern zu produzieren. Je nach kon-
junktureller Lage (will heißen: Höhe der Nachfrage), wird dieses Potenzial in guten
Zeiten mehr und in schlechten Zeiten weniger ausgenutzt. Auch Tichy hält die Aus-
lastung des Produktionspotenzials für eine angemessene Kennzahl zur Darstellung
der Konjunktur. Allerdings geht er nicht so weit, daraus eine Definition für diesen
Begriff herzuleiten.
16
Da wie eingangs bereits erwähnt der Autor dem Vorbild Oppenländers folgt und
in dieser Arbeit seine Definition von Konjunktur übernimmt, wird im Folgenden näher
darauf eingegangen, mit welchen Mitteln oder Kennzahlen Konjunktur, also der ge-
samtwirtschaftliche Auslastungsgrad, gemessen werden kann.
Um den Auslastungsgrad des Produktionspotenzials einer Volkswirtschaft (oder
kurz: den Kapazitätsauslastungsgrad) bestimmen zu können, muss man wissen, wie
hoch das Produktionspotenzial ist. Da dieses sich aus mehreren Größen dem Ar-
beitskräftepotenzial, dem Kapitalstock, den natürlichen Ressourcen und Wissen
zusammensetzt, ist seine Höhe nur sehr schwer bestimmbar.
17
Es gab eine Vielzahl von Versuchen, Wege zu finden, um das Produktionspotenzial
messbar zu machen. Doch viele waren unvollständig, da sie nur Teile des gesamten
Produktionspotenzials berücksichtigten, i.d.R. nur das Arbeits- oder Kapitalpotenzi-
al. Die die meisten Teilbereiche umfassenden Ansätze waren die der Deutschen
Bundesbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF). Diese Kennzahlen be-
ruhen allerdings auf sehr komplexen Rechnungen und werden zudem nur auf jährli-
cher Basis erstellt.
18
15
Vgl. Oppenländer (1995a), S. 7
16
Vgl. Tichy (1995), S. 40
17
Vgl. Oppenländer (1995a), S. 7
18
Vgl. Tichy (1995), S. 26ff.
Theoretische Grundlagen der Konjunkturanalyse
Seite 14
Die einfachste und gleichzeitig genaueste Referenzgröße zur Darstellung des ge-
samtwirtschaftlichen Kapazitätsauslastungsgrades basiert auf den Umfragen des ifo
Instituts für Wirtschaftsforschung in München (kurz: ifo Institut). Im Rahmen dieser
Umfragen sie laufen unter der Bezeichnung ,,ifo Konjunkturtest" werden Unter-
nehmen aus 325 Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes
19
zu ihrer derzeitigen
Situation und ihren Erwartungen für die Entwicklung in naher Zukunft befragt. Eine
dieser Fragen zielt auf die Beurteilung des gegenwärtigen Kapazitätsauslastungs-
grads ab. Die meisten Umfrageergebnisse werden monatlich veröffentlicht, diejeni-
gen zur Kapazitätsauslastung vierteljährlich. Allein schon durch die schnellere Ver-
fügbarkeit und das häufigere Erscheinen ist die Referenzgröße des ifo Instituts bes-
ser für Konjunkturanalysen und -prognosen geeignet als die entsprechenden Zahlen
der Bundesbank oder des IWF.
20
Hinzu kommt, dass die Ergebnisse der ifo-
Umfragen zum Kapazitätsauslastungsgrad im Vergleich zu zwei anderen wichtigen
Referenzgrößen, die im Folgenden noch vorgestellt werden, über die letzten 20 Jah-
re einen ausgesprochen ähnlichen Verlauf haben.
21
Dies deutet darauf hin, dass der
Kapazitätsauslastungsgrad im Verarbeitenden Gewerbe wie er im ifo Konjunktur-
test gemessen wird zumindest eine gleich große Aussagekraft über den gesamt-
wirtschaftlichen Kapazitätsauslastungsgrad (also die Konjunktur) hat wie die beiden
anderen Referenzgrößen: Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Produktionsindex des
Produzierenden Gewerbes
22
.
Beim BIP, oder genauer gesagt: bei der Konjunkturkomponente des BIP, also nach
Bereinigung von saisonalen, trendmäßigen und auf zufällige Faktoren zurückzufüh-
renden Einflüssen, geht man von folgender Unterstellung aus: Der langfristige Trend
des BIP steht in einem proportionalen Verhältnis zur Entwicklung des gesamtwirt-
schaftlichen Produktionspotenzials. Diese Unterstellung ist nicht weithergeholt, denn
es ist plausibel, dass langfristiges wirtschaftliches Wachstum durch das Wachstum
des Produktionspotenzials bedingt wird. Auf Grundlage dieser Prämisse können die
19
Das Verarbeitende Gewerbe umfasst: Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe, Investi-
tionsgüter produzierendes Gewerbe, Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe und Nah-
rungs- und Genussmittelgewerbe (Statistisches Bundesamt, 2002b).
20
Vgl. Oppenländer (1995a), S. 8f.
21
Vgl. Lindlbauer (1995a), S. 74
22
Das Produzierende Gewerbe umfasst die folgenden Bereiche: Elektrizitäts- und Gasver-
sorgung, Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Bauhauptgewerbe. (Vgl. Statistisches Bun-
desamt, 2002a)
Theoretische Grundlagen der Konjunkturanalyse
Seite 15
Abweichungen vom Trend des BIP als gesamtwirtschaftlicher Auslastungsgrad in-
terpretiert werden.
23
Der große Nachteil bei der Anwendung des BIP als Referenzgröße für aktuelle Kon-
junkturanalysen ist, neben der nur vierteljährlichen Berechnung, die Tatsache, dass
die neuesten Werte oft auf Schätzungen beruhen und zum Teil noch Jahre später
revidiert werden. Für historische Analysen, hingegen, ist das BIP als Referenzgröße
sehr gut geeignet.
24
Damit der Produktionsindex des Produzierenden Gewerbes als Referenzgröße legi-
timiert werden kann, muss zunächst davon ausgegangen werden, dass die ge-
samtwirtschaftliche Konjunktur von derjenigen des Produzierenden Gewerbes an-
gemessen wiedergegeben wird. Empirische Untersuchungen bestätigen die Plausi-
bilität dieser Prämisse.
25
Darüber hinaus wird ähnlich wie beim BIP angenommen,
dass der Verlauf des Produktionstrends analog zu dem der gesamtwirtschaftlichen
Kapazität ist. Unter diesen Vorbedingungen ist der Produktionsindex des Produzie-
renden Gewerbes, der vom Statistischen Bundesamt sogar auf monatlicher Basis
veröffentlicht wird, eine bedeutsame Referenzgröße, besonders bei zeitnahen Kon-
junkturanalysen.
26
Wie eingangs angekündigt (vgl. Kapitel 1.2 und 1.3), werden als Referenzreihen für
den Konjunkturverlauf in Deutschland in dieser Arbeit der Kapazitätsauslastungs-
grad des ifo Instituts, der Produktionsindex für das Produzierende Gewerbe und die
Zahl der Erwerbstätigen herangezogen. Die Eignung der ersten zwei Reihen wurde
bereits begründet. Das Heranziehen der Erwerbstätigenzahl als zusätzliche kon-
junkturelle Orientierungsgröße bedarf jedoch einer näheren Erklärung.
Der Autor ist sich bei seiner Entscheidung zugunsten der Erwerbstätigenzahl als
Referenzgröße folgender zwei Tatbestände, die eigentlich gegen die Verwendung
einer Beschäftigungsgröße als Referenzreihe sprächen, durchaus bewusst: Zum
23
Vgl. Lindlbauer (1995a), S. 71f.
24
Vgl. Lindlbauer (1995a), S. 71f.
25
Es wird davon ausgegangen, dass der Einfluss durch das Anwachsen des Dienstleis-
tungssektors in Deutschland während der letzten Jahre die konjunkturelle Aussagekraft des
Produzierenden Gewerbes kaum merklich eingeschränkt hat. (Anm. d. A.)
26
Vgl. Lindlbauer (1995a), S. 72f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832459840
- ISBN (Paperback)
- 9783838659848
- DOI
- 10.3239/9783832459840
- Dateigröße
- 785 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- accadis Hochschule Bad Homburg – Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Oktober)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- konjunkturindikator bekleidungsbranche konjunktur kapazitätenauslastung
- Produktsicherheit
- Diplom.de