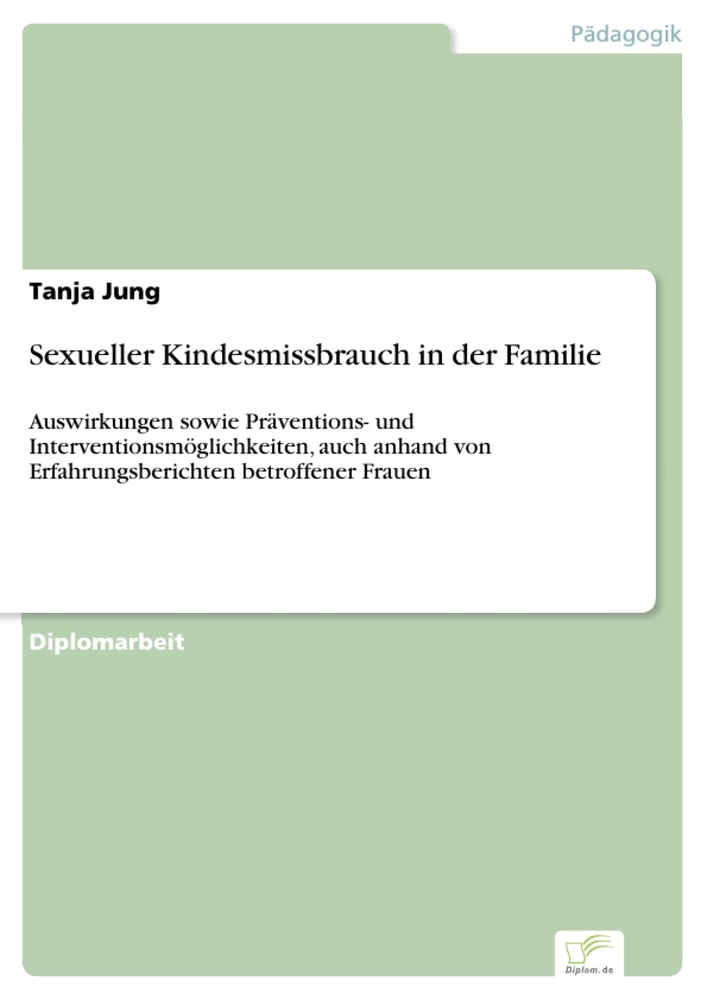Sexueller Kindesmissbrauch in der Familie
Auswirkungen sowie Präventions- und Interventionsmöglichkeiten, auch anhand von Erfahrungsberichten betroffener Frauen
Zusammenfassung
Sexueller Missbrauch ist ein Thema, das für viele Menschen ein Tabu darstellt; doch nicht der Missbrauch an sich unterliegt diesem Tabu, sondern das Sprechen darüber. So findet sexuelle Ausbeutung auch nicht erst seit heute statt, sondern hat eine jahrhundertealte Tradition. Doch erst zu Beginn der 80er Jahre rückte das Thema immer mehr in den Vordergrund. Dies ist ein Verdienst der Frauenbewegung, denn zu dieser Zeit gingen erstmals betroffene Frauen an die Öffentlichkeit und berichteten von ihren schrecklichen Kindheitserfahrungen.
Der sexuelle Missbrauch findet in überwiegender Zahl in der eigenen Familie statt und kann für die Opfer eine Vielzahl von Folgen in den verschiedensten Lebensbereichen mit sich bringen.
Ich begann mich zum ersten Mal näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen, als ich die gravierenden Auswirkungen des Missbrauchs bei einer Freundin miterleben durfte und daraufhin beschloss, mir im Rahmen meiner Diplomarbeit weitere Informationen darüber zu erarbeiten.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die große Bandbreite der Auswirkungen und Folgen des Missbrauchs für die Betroffenen herauszustellen. Es soll aufgezeigt werden, was dieses Trauma für die Opfer bedeuten kann, auch wenn es sich jeweils um individuell unterschiedliche Auswirkungen und Schweregrade der Folgen handelt.
Des Weiteren zielt sie darauf ab, Möglichkeiten der Prävention und Intervention aufzuzeigen, welche dazu beitragen, dieses Verbrechen zu verhindern bzw. frühzeitig zu beenden, um die gravierenden Folgen für die Opfer zu minimieren.
Die vorliegenden Ausarbeitungen geben vorab einen Überblick über das Thema des sexuellen Missbrauchs, indem zunächst eine Definition sowie die begriffliche Abgrenzung zu anderen, in der Literatur verwendeten Begriffen erfolgt und verschiedene Formen des Missbrauchs erläutert werden. Ebenso werden die Phasen, nach denen der Missbrauch in den überwiegenden Fällen verläuft, geschildert und die Machtstellung des Täters wird näher erläutert, um zu verdeutlichen, um welche Art von Vergehen es sich handelt.
Gang der Untersuchung:
Der Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Folgen des sexuellen Missbrauchs für die Opfer, sowie den Präventions-, Interventions- und Hilfemöglichkeiten, welche zur Verfügung stehen, um dem Missbrauch vorzubeugen bzw. den Betroffenen Unterstützung anzubieten.
JÖNSSON (1997) unterscheidet in Bezug auf die Auswirkungen der sexuellen Übergriffe, zwischen dem direkten […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Einführung in die Problematik
2.1 Definition von sexuellem Missbrauch
2.2 Formen von sexuellem Missbrauch
2.3 Begriffliche Abgrenzung
2.4 Täter
2.5 Opfer
2.6 Ausmaß & Dunkelziffer
2.7 Phasen des Missbrauchs
2.8 Machtstellung des Täters
3. Darstellung von Erfahrungsberichten
4. Psychodynamik der Opfer
4.1 Vertrauensverlust & Grenzverletzung
4.2 Wahrnehmungszweifel & Sprachlosigkeit
4.3 Schuld- & Schamgefühle
4.4 Ohnmacht & Angst
4.5 Dauerstress
4.6 Abhängigkeit & Identifikation mit dem Täter
4.7 Beziehungsfalle
4.8 Überlebensstrategien & Kompetenzen der Opfer
5. Folgen des Missbrauchs
5.1 Modell der Folgen von Finkelhor & Browne
5.2 Posttraumatische Belastungsstörung
5.3 Körperliche & Psychosomatische Beschwerden
5.4 Emotionale Reaktionen & Selbstwertgefühl
5.5 Soziale Auffälligkeiten & Sozialverhalten
5.6 Psychische Probleme & Psychosen
5.7 Soziale Beziehungen
5.8 Sexualität & Partnerschaft
6. Präventionsmöglichkeiten
6.1 Prävention in Gesellschaft und Politik
6.2 Elternarbeit
6.3 Sexualerziehung
6.4 Präventionsarbeit mit Kindern
6.5 Präventionsprogramm CAPP
6.6 Grenzen der Prävention
7. Interventionsmöglichkeiten
7.1 Erkennen des Missbrauchs
7.2 Interventionsschritte
7.3 Gespräche bei Verdacht
7.4 Konflikte im Helfersystem
7.5 Parteiliche Ansätze
7.6 Familientherapeutische Intervention
8. Hilfemöglichkeiten nach sexuellem Missbrauch
8.1 Therapiemöglichkeiten
8.2 Selbsthilfegruppen
8.3 Selbstheilung mit Hilfe von Fachliteratur
8.4 Selbsthilfe durch soziale Unterstützung
9. Schlussbemerkung
10. Literaturverzeichnis
11. Quellenverzeichnis
1. Einleitung
Sexueller Missbrauch ist ein Thema, das für viele Menschen ein Tabu darstellt; doch nicht der Missbrauch an sich unterliegt diesem Tabu, sondern das Sprechen darüber. So findet sexuelle Ausbeutung auch nicht erst seit heute statt, sondern hat eine jahrhundertealte Tradition.[1] Doch erst zu Beginn der 80er Jahre rückte das Thema immer mehr in den Vordergrund. Dies ist ein Verdienst der Frauenbewegung, denn zu dieser Zeit gingen erstmals betroffene Frauen an die Öffentlichkeit und berichteten von ihren schrecklichen Kindheitserfahrungen.[2]
Der sexuelle Missbrauch findet in überwiegender Zahl in der eigenen Familie statt und kann für die Opfer eine Vielzahl von Folgen in den verschiedensten Lebensbereichen mit sich bringen.[3]
Ich begann mich zum ersten Mal näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen, als ich die gravierenden Auswirkungen des Missbrauchs bei einer Freundin „miterleben“ durfte und daraufhin beschloss, mir im Rahmen meiner Diplomarbeit weitere Informationen darüber zu erarbeiten.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die große Bandbreite der Auswirkungen und Folgen des Missbrauchs für die Betroffenen herauszustellen. Es soll aufgezeigt werden, was dieses Trauma für die Opfer bedeuten kann, auch wenn es sich jeweils um individuell unterschiedliche Auswirkungen und Schweregrade der Folgen handelt.
Des Weiteren zielt sie darauf ab, Möglichkeiten der Prävention und Intervention aufzuzeigen, welche dazu beitragen, dieses Verbrechen zu verhindern bzw. frühzeitig zu beenden, um die gravierenden Folgen für die Opfer zu minimieren.
Die vorliegenden Ausarbeitungen geben vorab einen Überblick über das Thema des sexuellen Missbrauchs, indem zunächst eine Definition sowie die begriffliche Abgrenzung zu anderen, in der Literatur verwendeten Begriffen erfolgt und verschiedene Formen des Missbrauchs erläutert werden. Ebenso werden die Phasen, nach denen der Missbrauch in den überwiegenden Fällen verläuft, geschildert und die Machtstellung des Täters wird näher erläutert, um zu verdeutlichen, um welche Art von Vergehen es sich handelt.
Der Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Folgen des sexuellen Missbrauchs für die Opfer, sowie den Präventions-, Interventions- und Hilfemöglichkeiten, welche zur Verfügung stehen, um dem Missbrauch vorzubeugen bzw. den Betroffenen Unterstützung anzubieten.
Jönsson (1997) unterscheidet in Bezug auf die Auswirkungen der sexuellen Übergriffe, zwischen dem direkten Erleben des Missbrauchs sowie dessen kurz- und langfristigen Folgen.[4] So wird auch in den folgenden Ausarbeitungen eine Unterteilung vorgenommen, welche sich zum einen auf die Psychodynamik des Opfers und zum anderen auf die Folgen des Missbrauchs bezieht, denn um verstehen zu können, wie die zum Teil schwerwiegenden Folgen zustande kommen, muss zunächst eine Betrachtung des direkten Erlebens der Missbrauchssituation aus der Sicht des Opfers erfolgen.
Aufgrund der gravierenden Folgen für eine Vielzahl der Opfer ist es meines Erachtens nach wichtig, Hilfemöglichkeiten aufzuzeigen, welche sich zunächst auf die Prävention des Missbrauchs konzentrieren, um die Zahl der Übergriffe zu minimieren. Des Weiteren sollten sie, in Form von Intervention, auf eine frühzeitige Beendigung der Missbrauchssituation abzielen. Wenn ein Missbrauch bereits über Jahre hinweg stattgefunden hat, ist es meiner Ansicht nach ebenso wichtig, den Betroffenen adäquate Hilfemöglichkeiten zur Verarbeitung und Heilung des Traumas zukommen zu lassen.
Um den Ausarbeitungen einen praktischen Anteil zu verleihen, wurde ein Fragebogen erstellt, welchen fünf betroffene Frauen im Alter von 40-50 Jahren ausfüllten. Sie berichten über ihre Erfahrungen im Kindesalter, in Bezug auf die Folgen des Missbrauchs und die ihnen zur Verfügung stehenden Hilfemöglichkeiten. Die Erfahrungsberichte werden an geeigneten Stellen, überwiegend in den Bereichen der Folgen und der Hilfemöglichkeiten, in diese Arbeit miteinfließen, um die theoretischen Ausführungen zu veranschaulichen.
Bei der Erörterung des einführenden Teils werden beide Geschlechter gleichermaßen berücksichtigt, um einen allgemeinen Überblick zu geben. Die Bearbeitung des Hauptteils bezieht sich jedoch überwiegend auf Mädchen und Frauen, welche zu einem wesentlich höheren Prozentsatz von sexuellem Missbrauch betroffen sind.[5] Außerdem besteht der praktische Anteil ausschließlich aus Erfahrungsberichten betroffener Frauen.
2. Einführung in die Problematik
2.1 Definition von sexuellem Missbrauch
In der Literatur gibt es bisher keine einheitliche Definition von sexuellem Missbrauch. Jeder Autor setzt einen anderen Schwerpunkt und bringt andere wichtige Aspekte in seine Definition mit ein. Daher werden im Folgenden die wichtigsten Aspekte herausgearbeitet.
Zunächst stellt sich bei der Definition von sexuellem Missbrauch immer wieder die Frage: „Wo beginnt dieser eigentlich“? Besorgt sind vor allem die Väter, denn sie fragen sich z.B., wie es gedeutet wird, wenn sie mit ihrem Kind schmusen oder mit ihm gemeinsam baden, wenn sie es nackt sehen oder auch, was Erzieherinnen im Kindergarten denken, wenn das Kind seinen Vater nackt malt?
Hier ist anzubringen, dass es für die Entwicklung des Kindes lebensnotwendig ist, mit seinen Eltern Liebe, Wärme und Zärtlichkeiten auszutauschen. Es ist auf den Schutz, die Geborgenheit, die Hilfe und die Sicherheit seiner Eltern angewiesen. Nur unter diesen Voraussetzungen kann es sich emotional adäquat entwickeln.[6]
Die Grenze hin zum sexuellen Missbrauch wird dann überschritten, wenn ein Jugendlicher oder ein Erwachsener sich einem Kind gegenüber so verhält, dass er sich davon sexuelle Erregung verspricht.[7]
Sexueller Missbrauch hat nichts mehr mit Liebe oder Zärtlichkeit zu tun. Wenn ein Erwachsener die Liebe, Zärtlichkeit, die Abhängigkeit und das Vertrauen des Kindes dazu benutzt, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und dem Kind einen Geheimhaltungsdruck auferlegt, ist dies sexueller Missbrauch.
Er setzt sein Bedürfnis nach Macht und Unterwerfung durch, schädigt dadurch die Seele des Kindes und gefährdet seine Lebens- und Entwicklungsgrundlage.[8]
Ebenso beschreibt Mohaupt-Hörmann (1997) in dem Videofilm zum Medienverbundprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „Anna, komm!“ ganz deutlich, dass es nicht möglich ist, ein Kind aus Versehen zu missbrauchen. Ein Erwachsener weiß und spürt ganz deutlich, wo es Grenzen gibt und wo diese überschritten werden. Die Verantwortung in Bezug auf den Kontakt zum Kind liegt ganz allein bei ihm.[9]
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend definiert sexuellen Missbrauch wie folgt:
„Sexueller Mißbrauch ist alles, was das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des Kindes verletzt. Das beginnt u. a. bei sexualisierten Liebkosungen und verbalen Anzüglichkeiten und endet bei genitalem, oralem oder analem Geschlechtsverkehr. Der Übergang von vertrauter Zärtlichkeit zu sexuellem Mißbrauch wird durch die Absicht des Erwachsenen bestimmt, der das Kind als Objekt zu seiner eigenen sexuellen Befriedigung berührt oder benutzt.“[10]
2.2 Formen von sexuellem Missbrauch
Sexueller Missbrauch lässt sich in unterschiedliche Formen unterteilen. So unterscheiden Hobbs et al. (1991) & Jungjohann (1993) den Missbrauch ohne körperlichen Kontakt, wie z. B. den Exhibitionismus, das Fotografieren kindlicher Genitalien, das Zeigen von Pornographie, verbale Übergriffe oder sexuelle Erregung durch Blicke oder Berührungen; solchen mit nichtpenetrativem Körperkontakt, wie z.B. Berühren, Streicheln, Zungenkuss, Schenkelverkehr, Ejakulation auf den Körper und solchen mit penetrativem Kontakt, wie z.B. genitale, orale oder anale Penetration, teilweise oder ganz, mit dem Penis, den Fingern oder anderen Gegenständen. Außerdem nennen sie Perversionsformen, wie das Auffordern der Kinder zu gegenseitigen sexuellen Handlungen, das Aufnehmen pornografischer Filme oder Fotos, körperliche Verletzungen, die zur Steigerung der Erregung beitragen, oder das Zwingen des Kinder zur oralen Aufnahme von Kot oder Urin.
Fürniss (1993) nennt des Weiteren den Missbrauch in Sexringen und den rituellen Missbrauch.[11]
Engfer (1998) unterteilt die sexuellen Übergriffe in leichtere Formen, wie den Exhibitionismus, das Zeigen von pornografischem Material oder das Beobachten der Kinder beim Baden, was gegen deren eigenen Willen geschieht; schwere Missbrauchshandlungen, wie das Berühren der Genitalien oder das Masturbieren vor dem Kind und den intensivsten Missbrauch, wie das Versuchen oder Vollziehen oraler, analer oder vaginaler Vergewaltigung.[12]
Diese verschiedenen Formen können alle Bestandteile eines sexuellen Missbrauchs sein.
2.3 Begriffliche Abgrenzung
In der Fachliteratur werden eine Vielzahl unterschiedlicher Begriffe in Bezug auf den sexuellen Missbrauch synonym verwandt, ohne diese genau voneinander abzugrenzen. So werden z.B. der „sexuelle Missbrauch“, die „sexuelle Kindesmisshandlung“, der „Inzest“, die „sexuellen Übergriffe“ und die „sexuelle Gewalt“ genannt.
Remschmidt (1989) unterscheidet den sexuellen Missbrauch von der sexuellen Kindesmisshandlung, indem er dann von sexueller Kindesmisshandlung spricht, wenn es zur Gewaltanwendung kommt und die sexuellen Handlungen gegen den Willen des Kindes herbeigeführt werden. Sexueller Missbrauch dagegen ist nach seiner Ansicht auch dann gegeben, wenn die sexuellen Handlungen nicht ausdrücklich gegen den Willen des Kindes und ohne Anwendung von Gewalt erfolgen.
Born (1994) zufolge hat sich diese Begriffsbestimmung bisher nicht in der Literatur durchgesetzt und ist auch weniger sinnvoll, da sie übersieht, dass es sich in beiden Fällen um eine Form sexueller Gewalt handelt.[13]
Selbst wenn einem Kind keine körperliche Gewalt zugefügt wird, ist es jedoch immer psychischer Gewalt ausgesetzt, welche das Geschehen an sich mit sich bringt.
Unter dem Begriff „Inzest“ ist im engeren Sinne der Geschlechtsverkehr zwischen Verwandten ersten und zweiten Grades zu verstehen.[14] Daher wird in der Literatur eher von intra- und extrafamilialem sexuellem Missbrauch gesprochen, da dies sich nicht nur auf den sexuellen Verkehr, sondern auf alle Formen des sexuellen Missbrauchs bezieht.
Born (1994) schlägt außerdem vor, die Begriffe „sexuelle Gewalt“ und „sexuelle Übergriffe“ als Oberbegriffe zu verwenden.[15]
In den folgenden Ausführungen werden ebenso die beiden Oberbegriffe mit einbezogen, jedoch wird überwiegend der in der Literatur gängigste Begriff des „sexuellen Missbrauchs“ verwendet.
2.4 Täter
Sexueller Missbrauch an Kindern kommt in allen Teilen der Bevölkerung vor, unabhängig von Schichtzugehörigkeit oder Berufsgruppe. Täter können sowohl Lehrer, Pfarrer, Sozialarbeiter, Professoren, Ärzte als auch Arbeiter sein. Der sexuelle Missbrauch wird in den seltensten Fällen von sogenannten „Triebtätern“ begangen, wobei diese Taten eher ans Licht kommen als solche, die in der eigenen Familie geschehen. In der Regel sind es ganz „normale Menschen“, die Kinder missbrauchen. Menschen, die wir kennen und denen niemand eine solche Tat zutrauen würde.[16]
Nach der polizeilichen Kriminalstatistik von 1987 sind die Täter jedoch zu 98 Prozent Männer.[17] Dies bestätigen auch Coulborn Faller (1989) & Finkelhor (1984); Frauen sind dagegen nach ihren Angaben nur höchstens zu 2 Prozent die Täterinnen.[18]
Die Statistik des Bundeskriminalamtes von 1995 besagt, dass die Täter bezogen auf das gesamte Bundesgebiet zu 96,4 Prozent Männer und zu 3,6 Prozent Frauen sind.[19]
Hier ist zu erkennen, dass auch im Laufe der Jahre keine Veränderung der Statistik in Bezug auf diese Zahlen stattgefunden hat.
Baurmann (1983) schreibt, dass den Kindern in den meisten Fällen die Täter bekannt sind, nur ca. 6 Prozent sind ihnen völlig fremd. Laut Finkelhor (1984), Furniss (1986) & Trube-Becker (1982) sind es meist Familienangehörige, wie Väter, Stiefväter, Großväter, Brüder oder Onkel. Wenn der Missbrauch in der Familie stattfindet, geschieht er in 50-75 Prozent der Fälle durch den Vater oder den Stiefvater.[20]
Falardeau (1998) geht davon aus, dass Vertrautheit und Nähe vor inzestuösen Übergriffen schützt. Das heißt, wenn Väter sich viel um ihr Kind, speziell den Säugling oder das Kleinkind kümmern, es pflegen und versorgen, bekommen sie dadurch einen Bezug zu ihrem Kind. Somit können sie sich in das Kind einfühlen und sind unter dieser Voraussetzung kaum dazu fähig, es zu missbrauchen. Dadurch sinkt also die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich an ihrem Kind sexuell vergehen.
Auch Bange (1992) bestätigt in einer wissenschaftlichen Untersuchung, dass es eine wesentliche Rolle in Bezug auf sexuellen Missbrauch spielt, ob Väter eine sorgende Erfahrung mit ihren Kleinkindern gemacht haben oder nicht.[21]
Das Bundeskriminalamt hat in seiner Schriftreihe (Band 47) eine Liste mit Täterprofilen von Sexualstraftätern zusammengestellt. Danach kann es sich um eine Person handeln, die keinen Unterschied zwischen Zärtlichkeit mit Erwachsenen und Zärtlichkeit mit Kindern sieht; die noch unreif ist und Schwierigkeiten mit der eigenen sexuellen Entwicklung hat; die selbst noch ein Junge und nur wenig älter als das Kind ist und gemeinsam mit ihm Sexualspiele durchführt; die es vorzieht, Kinder als erotische und sexuelle Partner zu haben; die unsicher und gehemmt ist und nur schwer Kontakt zu Menschen ihres Alters findet; die älter und unauffälliger ist und deren Persönlichkeit sich im Alter verändert hat; die seelisch krank ist, unglückliche Erfahrungen z.B. mit Frauen hinter sich hat oder um Personen aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis, die plötzlich und überraschend Gewalt anwenden, um zu ihrem sexuellen Ziel zu gelangen.
Somit handelt es sich nie um „den Täter“, sondern es gibt verschiedene Tätertypen, die auch unterschiedliche Gefährdungen für die Kinder mit sich bringen.[22]
2.5 Opfer
Die Opfer von sexuellem Missbrauch sind nach Lamers-Winkelman (1995) zu 70-75 Prozent Mädchen und zu 25-30 Prozent Jungen, wobei die Dunkelziffer bei Jungen höher vermutet wird. In einer Untersuchung von Egle, Hoffmann, Joraschky (1993) waren von 604 missbrauchten Kindern zu 49 Prozent sieben Jahre und jünger und zu 26 Prozent über zwölf Jahre.[23]
Laut Russel (1986) ist jedes vierte Mädchen von sexueller Gewalt betroffen.[24] Sexueller Missbrauch kann einem Kind jeden Alters widerfahren, doch nach Furniss (1986), Finkelhor (1984) & Peters (1976) sind Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren am meisten gefährdet. Nach Erfahrungen von Steinhage (1994) sind Mädchen unter sechs Jahren jedoch genauso häufig betroffen.
Während Mädchen überwiegend von Tätern aus dem engeren Familienkreis wie z.B. von Vätern, Stiefvätern, Adoptivvätern, Großvätern oder Brüdern missbraucht werden, stehen Jungen zwar auch männlichen Tätern gegenüber, aber weniger den eigenen Vätern, sondern mehr solchen Personen aus dem Bekanntenkreis wie dem Lehrer, Pfarrer, Bademeister oder dem Nachbarn.[25]
Laut Kastner (1998) finden sexuelle Übergriffe an Kindern jeglichen Alters statt, doch für 50 Prozent beginnen die Übergriffe weit unter dem Alter von sechs Jahren, zu einer Zeit, wo die Vorfälle kaum mehr zu erinnern sind. Je jünger die Kinder zu Beginn der Übergriffe, desto länger dauern diese in der Regel an. Wenn sie vor dem zehnten Lebensjahr beginnen, dauern sie meist sechs bis sieben Jahre an.[26]
Ein Opfer sexueller Gewalt kann zunächst einmal jedes Kind werden, doch es gibt verschiedene Umstände, die den Missbrauch begünstigen. Nach Untersuchungen des Landeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen werden häufiger die Kinder Opfer, die in ungünstigen sozialen Verhältnissen aufwachsen, für die kein Geld, Raum und Zeit vorhanden ist, die dem hohen Erwartungsdruck ihrer Eltern nicht gewachsen sind, die sich nicht wehren können (z.B. kleine oder schwache Kinder), deren Erziehung besondere Aufmerksamkeit erfordert, die überfordert werden, die sich überwiegend ausgeliefert, schwach und gedemütigt fühlen und solche, die nicht in die Familie integriert werden können wie z.B. Stiefkinder oder Prügelknaben.[27]
2.6 Ausmaß & Dunkelziffer
Angaben über genaue Zahlen des sexuellen Missbrauchs können aufgrund der hohen Dunkelziffer nicht gemacht werden. Aus Statistiken des Bundeskriminalamtes (1987) geht hervor, dass jährlich ca. 10 000 Fälle von sexuellem Missbrauch nach § 176 StGB (sexueller Missbrauch von Kindern; unter 14 Jahren[28] ) angezeigt werden. Dazu kommen noch ca. 10 000 exhibitionistische Vorfälle.[29]
Nun besteht aber das Problem, dass der Missbrauch nur in den seltensten Fällen angezeigt wird und vor allem dann nicht, wenn die Täter aus dem nahen Verwandten- bzw. Bekanntenkreis stammen, was jedoch, wie aus den Zahlen deutlich wurde, überwiegend der Fall ist.
In einer Untersuchung von Bange (1992) haben von 130 Studentinnen und 28 Studenten, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurden, nur drei Personen eine Anzeige erstattet. Und in diesen drei Fällen handelte es sich auch noch um fremde Exhibitionisten. Somit wird also nur ein ganz geringer Teil der Missbrauchsdelikte in der eigenen Familie an die Öffentlichkeit gebracht.
Daher muss angenommen werden, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. Somit wird in Deutschland von einer geschätzten Gesamtzahl von 300 000 betroffenen Kindern ausgegangen.
Das bedeutet, jede dritte bis vierte Frau ist in ihrer Kindheit Opfer sexueller Übergriffe geworden. Aus eigenen Erfahrungen hält Falardeau (1998) diese Schätzungen aufgrund einiger Berichte über sexuellen Missbrauch aus ihrem Bekanntenkreis für realistisch.[30]
Baurmann (1978/83) hat in mehreren repräsentativen Untersuchungen erwachsene Frauen nach sexuellen Übergriffen in ihrer Kindheit und Jugend befragt. Danach wurde eine Dunkelziffer von 1:18 bis 1:20 errechnet. Das bedeutet, dass von 18-20 sexuellen Gewalttaten an Mädchen nur eine Tat der Polizei gemeldet wird. Wenn man diese Dunkelziffer mit den jährlich angezeigten Fällen multipliziert, kommt man schätzungsweise auf eine Zahl von 300 000 Kindern, die pro Jahr sexuell missbraucht werden.[31]
2.7 Phasen des Missbrauchs
Hane (1996) hat den Verlauf des sexuellen Missbrauchs in verschiedene Phasen unterteilt. Der Missbrauch verläuft zwar in jeder Familie unterschiedlich, dennoch zeichnet sich ein gewisses Muster ab, welches bei allen Missbrauchshandlungen ähnlich ist.
Vorbereitung
In dieser ersten Phase verbringt der Täter viel Zeit damit, sich dem Opfer zu widmen. Er versucht intensiv das Vertrauen des Kindes zu gewinnen und bringt großes Interesse für es auf.[32]
Wenn der Vater der Täter ist, versucht er das Vertrauensverhältnis zu fördern, in dem er das Kind den anderen Familienmitgliedern vorzieht. Dadurch isoliert er es von der Mutter und den Geschwistern, so dass es ihm später schwer fällt, sich ihnen zu offenbaren.[33]
Das Kind freut sich, dass diese Person soviel Zeit mit ihm verbringt. Dadurch entsteht mit der Zeit ein enges Vertrauensverhältnis. Doch nach einiger Zeit beginnt der Täter dann mit den sexuellen Übergriffen, z.B. durch ein scheinbar ungewolltes Berühren, ein zufälliges Anfassen an den Brüsten oder dem Po, sich nackt zeigen, oder ähnliches. Häufig verwickelt der Täter das Kind in ein Gespräch über Sexualität und die angeblich zufälligen Berührungen bezeichnet er als „Aufklärungsunterricht“ oder als „Spiel“.
Das Kind geht zunächst auch davon aus, dass die Berührungen nur versehentlich geschehen sind. Es ahnt nur selten, dass diese Taten bewusst und mit Absicht erfolgen.
Nun beginnt der Täter das Kind zum einen materiell und zum anderen durch vermehrte Aufmerksamkeit und Zuwendung zu belohnen, wenn es bei den sexuellen Handlungen mitmacht. Er will bewirken, dass sich das Kind bei ihm wohlfühlt und ihm dadurch eine Distanzierung vom Täter erschwert wird. Diese Vorbereitungs- oder Annäherungsphase verläuft meist ohne Drohungen oder Gewaltanwendung.[34]
Der Täter hat seine Vorgehensweisen genau geplant. Er sucht und arrangiert die passenden Gelegenheiten, um mit dem Kind alleine zu sein. Hier nutzt der Täter das Zärtlichkeitsbedürfnis und das Vertrauen des Kindes aus, welche ihm die sexuellen Übergriffe auch ohne Gewaltanwendung ermöglichen.[35]
Zerban (1997) zufolge zeichnet sich der Täter durch eine hohe emotionale Bedürftigkeit aus, auf die Kinder reagieren und welche sie auszugleichen versuchen.[36]
Missbrauch
Hier steigern sich die Übergriffe des Täters und es kommt zu eindeutigen sexuellen Gewalthandlungen in den unterschiedlichsten, wie bereits genannten Formen.[37]
Nach Wörz-Polachowski (1990) werden 85 Prozent aller Sexualstraftaten vollendet und nur 11 Prozent bleiben im Versuchsstadium stehen. Die Übergriffe, welche häufig innerhalb der Familie verübt werden, sind bei 7-15 Prozent von schwerer und massiver Natur.[38]
Geheimhaltung
In dieser Phase versucht der Täter das Kind zu überreden oder zu zwingen, die Vorfälle geheim zu halten. Er spricht Drohungen aus, wie z.B. „Wenn du jemandem etwas sagst, dann komme ich ins Gefängnis und du musst ins Heim“; oder „Du wolltest es doch auch und es hat dir gefallen“. Dadurch versucht der Täter die Schuld bzw. eine Mitschuld auf das Kind zu übertragen, was bewirkt, dass dieses nicht von den Vorfällen berichtet, da es glaubt, den Missbrauch selbst verschuldet zu haben.
Der Geheimhaltungsdruck wird durch die Verwirrung des Kindes über den Täter zusätzlich verstärkt. Es erlebt ihn plötzlich sehr verändert. Auf der einen Seite verletzt er das Kind und auf der anderen Seite ist er die geliebte Bezugsperson, die mit ihm spielt. Ebenso werden an das Kind ganz unterschiedliche Rollenerwartungen gestellt. Zum einen ist es der Sexualpartner und zum anderen das Kind, welches noch in den Kindergarten geht. Mit dieser Situation wird es völlig überfordert und bekommt ein Gefühl tiefer innerer Zerrissenheit.[39]
Hinzu kommen noch große Schamgefühle. Das Kind ist der Meinung, es ist das Einzige auf der Welt, dem so etwas geschieht und es hat Angst, das niemand ihm Glauben schenkt, wenn es sich mitteilt. Es fühlt sich schlecht und wertlos, kann sich das Verhalten des Täters nicht erklären und sucht daher die Schuld bei sich. Ebenso erschwert das Schweigen zu Beginn, später von der Tat zu berichten.
Zudem ist den Kindern bewusst, dass sie den Familienzusammenhalt gefährden, wenn sie sich mitteilen. Diese Dinge halten sie davon ab, um Hilfe zu bitten. Daher senden sie meist verschlüsselte Signale, die sich beispielsweise in Verhaltensauffälligkeiten ausdrücken, in der Hoffnung, dass jemand darauf aufmerksam wird.[40]
Aufdeckung
Sexueller Missbrauch geschieht in vielen Fällen über mehrere Jahre hinweg. Wenn er durch dritte Personen oder durch die Offenbarung des Opfers aufgedeckt wird, isoliert sich das Kind meist immer mehr von anderen Personen. Es hat Angst, vor einem erneuten Missbrauch, vor der Aufdeckung des Geheimnisses und dem Gefühl dadurch anders zu sein. Daher ist es wichtig, Verhaltensauffälligkeiten und Signale von Kindern ernst zu nehmen und diesen frühzeitig nach zu gehen.
Unterdrückung
Nach dem der Missbrauch aufgedeckt wurde, versucht der Täter häufig das Kind zu unterdrücken. Er will es dazu bewegen, seine Anschuldigungen zurückzunehmen. Wenn der Missbrauch in der Familie geschieht, versucht der Täter ebenfalls die anderen Familienmitglieder unter Druck zu setzen, um eine Strafanzeige zu verhindern. Wenn dies gelingt, werden die Folgen des Missbrauchs geleugnet und die Hilfeangebote abgewiesen.[41]
Ebenso kommt das Kind in dieser Phase so sehr in Loyalitätsbindungen zu beiden Elternteilen, dass es am liebsten alles zurücknehmen würde. Häufig leugnet es dann den Missbrauch wieder, da es sich für das Überleben der Familie entschieden hat.[42]
2.8 Machtstellung des Täters
Bei sexuellem Missbrauch der von Männern begangen wird besteht Einigkeit darüber, dass es sich dabei um eine Machtausübung handelt, die durch Sexualität ausgedrückt wird. Nach Erfahrungen von Frei (1993) begehen Männer sexuellen Missbrauch an Kindern nicht als Ersatz für ein fehlendes Sexualleben mit einer erwachsenen Partnerin. Dem Täter geht es um die Macht, die er über das Kind hat. Er kann es verängstigen, in Abhängigkeit halten, unter Druck setzen und ihm ungestraft Schmerzen zufügen. Ebenso muss er beim Missbrauch nicht auf Wünsche und Anforderungen einer gleichberechtigten Partnerin eingehen und ist keinen Versagensängsten ausgesetzt.[43]
Sexuelle Übergriffe sind Gewalthandlungen, welche vor allem gegenüber Frauen ausgeübt werden. In feministischen Analysen wurde herausgefunden, dass gesellschaftliche Aspekte eine zentrale Rolle spielen. Die ungleiche Machtaufteilung zwischen den Geschlechtern und die einseitige Festlegung von Frauen auf Ehe und Familie durch die geschlechtsspezifische Sozialisation, werden für den wichtigsten Grund des Ausmaßes sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen angesehen.[44]
Bei sexuellem Missbrauch handelt es sich um Machtmissbrauch, da der Täter das Kind zu einem „Objekt“ seiner Begierde macht. Nach Untersuchungen von Finkelhor liegt die Zentrale Bedeutung und Funktion der meisten sexuellen Missbrauchshandlungen in der Befriedigung männlicher Dominanz- und Herrschaftsansprüche. Kinder sind aufgrund ihrer körperlichen, emotionalen, sozialen und geistigen Entwicklung zum einen nicht in der Lage, sich gegen die Übergriffe des Erwachsenen zu wehren bzw. sich vor diesem zu schützen. Zum anderen können sie die gesamte Tragweite des Geschehens noch nicht erfassen und daher auch keine Einwilligung in das Geschehen geben, bzw. dieses bewusst ablehnen. Wenn der Täter eine Bezugs- und Vertrauensperson des Kindes ist, steht es noch zusätzlich in einem Abhängigkeitsverhältnis, da es dieser Person vertraut und sie sehr gerne hat. Somit macht sich der Erwachsene sein Autoritätsverhältnis zu nutze, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Ebenso nutzt er die Abhängigkeit des Kindes aus. Daher spielen Machtstrukturen und Abhängigkeitsverhältnisse in der Familie eine große Rolle.[45]
3. Darstellung von Erfahrungsberichten
An dieser Stelle erfolgt eine kurze Darstellung der Daten und Erfahrungen der betroffenen Frauen, wobei die Namen der Befragten geändert wurden.
Die einzelnen Erfahrungen der Betroffenen werden erläutert, um die Rahmenbedingungen, wie das Alter, den Zeitpunkt und die Dauer ihrer Missbrauchserfahrungen sowie die Personen, von denen sie missbraucht wurden, darzustellen.
- Martina ist 41 Jahre alt. Die sexuellen Übergriffe in ihrer Kindheit fanden zwischen dem 11. und 13. Lebensjahr ungefähr ein Mal in der Woche statt. Suchte sich der Missbraucher andere Frauen oder Mädchen als seine Opfer, ließ er eine zeitlang von Martina ab. Bei dem Täter handelte es sich um ihren Vater, den sie seit dem nur noch ihren „Erzeuger“ nennt, da er für sie kein Vater war.
Sie nennt noch zwei weitere Vorfälle von sexuellen Übergriffen. Bei dem einen war sie 15 Jahre und bei dem anderen 17 Jahre alt und wurde von Bekannten, aber nicht zur Familie gehörenden Männern, angefasst.
Ihr ist es beim Ausfüllen des Fragebogens sehr schwer gefallen, über ihre Erlebnisse zu berichten. Sie hatte zunächst das Gefühl, besser über ihre Erfahrungen schreiben zu können, doch dazu ist sie noch nicht in der Lage.
- Monika ist 44 Jahre und wurde ungefähr im Alter von drei Jahren sexuell Missbraucht. Der Missbrauch fand vielleicht zehn Mal, vielleicht aber auch nur ein Mal statt, nähere Erinnerungen an das Geschehen fehlen ihr noch. Die Täter waren der Vater und zwei Freunde des Vaters.
Diese Übergriffe waren ihr nicht mehr bewusst. Die Erinnerungen kamen erst in einer Gruppentherapie hoch, als andere Personen über ihre Missbrauchserfahrungen berichteten. In diese Therapie begab sich Monika erst nach einer Vielzahl anderer Probleme in ihrem Leben.
- Astrid ist 43 Jahre alt. Sie wurde ungefähr im Alter von 6 oder 7 Jahren bis zum 14. Lebensjahr von ihrem Onkel, dem Schwager ihres Vaters, sexuell missbraucht. Die Übergriffe fanden bei jeder sich bietenden Gelegenheit statt, sobald sie mit dem Täter alleine und die Situation günstig war.
Der Missbrauch wurde bei ihr erst durch eine räumliche Trennung zum Täter beendet, als sie mit 15 Jahren, auf eigenen Wunsch hin, in ein Klosterinternat kam.
Sie berichtet von zwei weiteren Übergriffen, zum einen durch den Nachbarsjungen, welcher versuchte, ihr „an die Wäsche“ zu gehen. Er war etwa 20 Jahre und sie etwa 11 Jahre alt. Und zum anderen durch den Vater einer Schulfreundin, welcher ebenso im Nachbarhaus wohnte und „im vorbeigehen“ sexuelle Handlungen an ihr vornahm, indem er ihre Brüste berührte, sich an ihr rieb und versuchte, sie zu küssen.
- Anna ist 48 Jahre alt und wurde bereits als Säugling von ihrem Vater missbraucht und fast umgebracht. Weitere Übergriffe fanden durch den Onkel, den Bruder der Mutter, im Alter von 4-8 Jahren statt. Dieser bedrohte Anna bei jedem Besuch erneut, wenn sie von den Vorfällen berichte, bringe er sie um. Diese Drohungen verfolgten sie bis ins Erwachsenenalter.
Ebenso berichtet sie von sexuellen Übergriffen durch einen Bekannten der Familie (ca. 50 Jahre), als sie vier Jahre alt war und von solchen durch ihren Cousin (28 Jahre) im Alter von zehn Jahren.
Die Erinnerungen an den Missbrauch im Säuglingsalter kamen erst durch die Regression in einer Psychotherapie ans Licht. Anna begab sich mit 40 Jahren in die Therapie, da sie ständig das Gefühl hatte, mit ihr stimmt etwas nicht. Sie hatte Schwierigkeiten zu leben. Ihre Freude am Leben war sehr gering und sie hatte viele Probleme in den verschiedensten Lebensbereichen.
- Johanna ist 53 Jahre alt und wurde ungefähr im Alter von 10 bis 12 Jahren von ihrem Patenonkel, dem Bruder des Vaters, sexuell missbraucht. Sie hatte das Geschehen gänzlich verdrängt. Als Probleme in der Partnerschaft und der Sexualität auftraten, wusste sie nicht, woher diese kamen. Sie wollte sich eigentlich ihrem Partner gegenüber nicht so abweisend verhalten und wusste lange nicht, warum sie so blockiert war. Erst in einer Therapie fand sie heraus, was die Ursache ihres Verhaltens war und konnte langsam anfangen, daran zu arbeiten.
Die Auswirkungen des Missbrauchs auf das Leben der betroffenen Frauen werden überwiegend in den Kapiteln der „Folgen“ sowie der „Hilfemöglichkeiten“ an passender Stelle miteinfließen, ebenso wie die von ihnen in Anspruch genommenen Maßnahmen, welche ihnen zur Unterstützung dienten und zur Verarbeitung des Geschehens beitrugen. Diese Erfahrungsberichte sollen die theoretischen und zum Teil unvorstellbaren Sachverhalte veranschaulichen.
4. Psychodynamik der Opfer
Aus zahlreichen Studien geht hervor, dass der sexuelle Missbrauch bei fast allen Opfern unangenehme Gefühle hervorrief. Dies empfanden auch 92-98 Prozent der Befragten in einer Untersuchung nach Herman & Hirschman (1981). Nach Untersuchungen von Finkelhor (1979) beurteilten fast alle ihre Erlebnisse als ungewollt und traumatisch. Die Mädchen erlebten den Missbrauch zu 58 Prozent als angstauslösend und furchterregend, 26 Prozent waren schockiert und 20 Prozent überrascht. Nur wenige behaupteten, ihn neutral erlebt zu haben.[46]
Nach Aussagen von Falardeau (1998) erleben Kinder, die sexuell missbraucht werden dieses Ereignis als lebensbedrohlich. Sie haben Angst und Panik durch die Gewaltanwendung getötet zu werden. Wenn sich der Missbrauch sehr oft wiederholt, sterben sie viele seelische Tode. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit ihren normalen Lebensrhythmus zu finden. Das grausame Ereignis begleitet sie ständig. Durch verschiedene Auslöser erleben sie das Geschehen immer wieder so, als hätte es gerade erst stattgefunden. Dieses Trauma ist in ihrem Gedächtnis gespeichert.[47]
Im Folgenden werden die Grundgefühle sexuell missbrauchter Kinder dargestellt, welche Aufschlüsse auf die Psychodynamik des Opfers geben.[48]
4.1 Vertrauensverlust & Grenzverletzung
Das Vertrauen des Kindes in die eigene Umgebung, die vertrauten Personen und in sich selbst wird durch sexuellen Missbrauch zu tiefst erschüttert. Es erfährt sexuelle Übergriffe durch eine Person, der es vertraute, bei der es sich sicher und geborgen fühlte. Dieses Vertrauen wird ausgenutzt und somit zerstört. Kinder entwickeln ein grundsätzliches Misstrauen ihrer Umwelt gegenüber, welches auch alle weiteren Beziehungen prägt.[49]
Durch die Auferlegung des Redeverbots vom Täter, hat das Kind keine Möglichkeit, sich anderen Personen mitzuteilen und ist daher in mehrfacher Hinsicht verlassen. Es lernt mit der Zeit, dass Vertrauen heißt, missbraucht zu werden, was es dazu veranlasst, seiner gesamten Umwelt mit Misstrauen zu begegnen. Dies kann ebenso dazu führen, dass das Vertrauen des Kindes in sich selbst erschüttert wird und es sich im Erwachsenenalter für nicht vertrauenswürdig hält.[50]
Des Weiteren sind Kinder in der Regel von einem Schutzwall umgeben, welcher es ihnen ermöglicht, Selbstsicherheit, Kraft und Zuversicht auszustrahlen. Nun wird bei sexuellem Missbrauch die persönliche Grenze des Kindes verletzt und sein Schutzraum gewaltsam durchbrochen. Dadurch wird das Kind von überwältigenden Reizen überflutet, denen es nicht gewachsen ist. Auf diese schädigenden Reize von außen reagiert das Kind und erlebt sehr bedrohliche und angstauslösende Gefühle.
Roeb (1998) zufolge erleben sexuell missbrauchte Kinder über lange Zeiträume hinweg massive Grenzverletzungen. Sie machen die Erfahrung, dass sie keinen Einfluss auf und keine Kontrolle über das Geschehen haben und es erschüttert sie zu tiefst, dass ihre Versuche, eine Grenze zu ziehen und „Nein“ zu sagen, ignoriert und missachtet werden.[51]
Bei sexuellem Missbrauch wird ein Kind körperlich, emotional und sexuell überstimuliert, wodurch es in einen Erregungs- und Schockzustand gerät. Beim Inzest ist dieser Zustand besonders stark, da das Kind nun von einem sehr vertrauten Erwachsenen die Körperlichkeit erfährt, die normalerweise im Alltag tabu ist. Ebenso verändert sich der Gesichtsausdruck und der Atem des Erwachsenen und seine sexuelle Erregung, die mit Aggressivität verbunden sein kann, macht dem Kind Angst. Die Reize, die auf das Kind von außen zum Teil gewaltsam zukommen, überfluten es mit Gefühlen von Angst und Ohnmacht und können sogar Todesängste auslösen. Dies ist vor allem bei oralem Missbrauch der Fall, wo Erstickungsängste auftreten können, die das Kind mit Todeserfahrungen konfrontieren.[52]
4.2 Wahrnehmungszweifel & Sprachlosigkeit
Die Übergriffe durch eine vertraute Person bringen eine starke emotionale Verwirrung mit sich und verunsichern die Realitätswahrnehmung des Kindes.[53]
Kinder können und wollen nicht wahr haben, was mit ihnen geschehen ist. Sie haben das Gefühl, ihren eigenen Sinnen nicht trauen zu können. Es übersteigt ihre Vorstellungskraft, dass eine vertraute Person ihnen so etwas antut. Nach außen ist es z.B. der sorgende Familienvater, dem niemand eine solche Tat zutrauen würde. Zu Beginn des Missbrauchs tarnt der Täter seine Übergriffe so, dass das Kind zunächst denkt, die Berührungen seien Zufall und würden nicht wieder vorkommen. Da der Missbrauch in der Regel auch keine sichtbaren Spuren hinterlässt, wachsen die Zweifel an der eigenen Wahrnehmung.[54] Diese wird zusätzlich getäuscht, wenn die Übergriffe nachts stattfinden und der Missbraucher sich tagsüber so verhält, als sei nichts gewesen.[55]
Sexueller Missbrauch macht Kinder sprachlos. Da er meist sehr früh beginnt, können sie nicht nachvollziehen, was eigentlich mit ihnen geschieht. Ebenso fehlen ihnen zum Teil noch die Worte, um das Geschehen ausdrücken und mitteilen zu können.
Das Schweigegebot und der Druck, der vom Täter ausgeübt wird, veranlasst sie zusätzlich, nichts zu erzählen. Wenn der Vater der Täter ist, gerät das Kind in einen weiteren Konflikt, da es diesen auf keinen Fall verlieren will und es spürt ganz genau, was alles von seinem Schweigen abhängt.
Des Weiteren spielt das gesellschaftliche Tabu dieses Themas eine Rolle. Weil niemand darüber redet, hat auch das Opfer zu schweigen. Wenn das Kind sich mitteilt, macht es zudem häufig die Erfahrung, dass ihm niemand glaubt und es als Lügner/in hingestellt wird. In Anbetracht dieser Zusammenhänge ist es kein Wunder, dass Kinder sich zurückziehen und ihre Sprache verlieren.[56]
4.3 Schuld- & Schamgefühle
Kinder sind auf die Zärtlichkeit und Zuwendung von Erwachsenen angewiesen und genießen diese auch. Der Täter gestaltet die Übergänge von Zärtlichkeit hin zu sexuellem Missbrauch fließend, so dass ein Kind dies nicht bewusst registriert und daher aus Angst nicht in der Lage ist, die Handlungen abzuwehren. Aufgrund dessen bekommt es das Gefühl selbst daran beteiligt und schuld an den Übergriffen zu sein. Der Täter unterstützt dies zusätzlich, indem er dem Opfer einredet, es habe die Übergriffe selbst gewollt und sie haben ihm doch auch gefallen.[57] Zudem ist es der Annahme, dass ihm allein so etwas passiert und es selbst den Anlass zu den Übergriffen gegeben hat. Daher hat es das Gefühl, falsch, schmutzig und böse zu sein und nimmt die Schuld und Verantwortung für das Geschehen auf sich.[58]
An diesen Schuldgefühlen leiden die Opfer noch im Erwachsenenalter. Sie fühlen sich für alles was geschieht verantwortlich und schuldig. Daher ist offensichtlich, wie vernichtend sich der Missbrauch auf das Selbstwertgefühl der Opfer auswirkt.[59]
So berichtet auch Johanna, sich für alle Probleme in ihrem Leben schuldig gefühlt zu haben. Die Schwierigkeiten in ihrer Ehe, die Probleme der Kinder und für ihre abweisende Haltung in Bezug auf die Sexualität.
Ebenso wird durch den Missbrauch die Schamgrenze des Kindes verletzt. Es schämt sich für den erfahrenen Missbrauch, die ihm zugefügten Verletzungen, für den Täter, die gesamte Familie und vor allem für die eigene Existenz.
So berichtet auch Anna von dem Gefühl, sich für alles, was geschehen ist, schuldig zu fühlen und sich sogar für die eigenen Existenz zu schämen.
Wenn der Missbrauch auf widerwärtige Art und Weise geschehen ist, sind diese Schamgefühle wesentlich stärker. Die Opfer sind der Annahme, sie hätten sich die Übergriffe gefallen lassen und sich nicht zur Wehr gesetzt. Sie möchten vor Scham im Boden versinken; vor allem, wenn sie trotz des Widerstands sexuelle Erregung empfunden haben.
Die Schamgefühle verhindern zusätzlich die Hilfesuche des Opfers. Sie können erst überwunden werden, wenn professionelle und private Kontaktpersonen diese Scham verstehen und die Opfer dort den Mut finden, sich mitzuteilen.[60]
4.4 Ohnmacht & Angst
Der sexuelle Missbrauch spricht dem Kind jegliches Recht auf Selbstbestimmung ab. Es wird zum Objekt der Bedürfnisbefriedigung Erwachsener und sein eigener Wille wird gebrochen. Die Widerstandsformen des Kindes werden vom Täter ignoriert und somit überfällt es ein Gefühl der Ohnmacht und Verzweifelung. Es wird überflutet von Reizen und sieht keinen Ausweg aus dieser Situation.
Häufig richten Opfer sexueller Gewalt diese Gefühle in Form von Autoaggressionen, Depressionen oder Selbstmordversuchen gegen sich selbst. Aus einer holländischen Untersuchung geht hervor, dass bei 100 suizidalen Frauen 75 sexuelle Gewalterfahrungen gemacht haben.[61]
Balzer (1991), Heigl-Evers & Kruse (1991) sehen die Erfahrungen der Passivität und die Ohnmacht gegenüber den schädigenden Reizen als ein zentrales Moment für die Traumatisierung der Opfer. Ihr eigenes „Ich“, welches die Funktion des Reizschutzes gegenüber der Außenwelt hat, versagt. Durch diesen Verlust wird das „Selbst“ in seiner Existenz bedroht. Das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein des Kindes wird dadurch zerstört.[62]
Angst ist ein weiteres zentrales Lebensgefühl, welches die Opfer in ihrem Alltag begleitet. Sie haben beispielsweise Angst vor weiteren Übergriffen, vor dem Zerfall der Familie, vor dem „Öffentlichwerden“ des „Geheimnisses“ und vor den Reaktionen der Umwelt. Ihre eigene Stärke und Widerstandskraft wird durch diese Angst gelähmt und geschwächt. Selbst im Erwachsenenalter spüren sie noch, wie sie sich als Kind zu Tode gefürchtet haben.
Die Angst im Erwachsenenalter besteht auch darin, in die Psychiatrie eingewiesen zu werden und in Wahnsinn zu verfallen, da die Erinnerungen, die alte Trauer und Wut ständig wieder zum Vorschein kommen.[63]
Von diffusen Angstzuständen, unter denen sie jahrelang litt, berichtet auch Monika. Sie beschreibet die Angst „wie eine dunkle Wolke“ über ihr. Sie hatte Angst vor Männern, kein Interesse, Beziehungen einzugehen und auch die Angst, in eine Psychiatrie eingewiesen zu werden.
Ebenso berichtet Anna von starken Angst- und Ohnmachtgefühlen. Aus lauter Angst vor weiteren Übergriffen wollte sie aufhören zu Atmen, um nicht vom Täter bemerkt zu werden.
4.5 Dauerstress
Durch die mit dem sexuellen Missbrauch einhergehende Grenzverletzung des Kindes, wird es mit Reizen überflutet, die große Ängste bei ihm auslösen und es extremem emotionalem Stress aussetzen. Dieser Stress ist wesentlich bedrohlicher als übliche Stresserfahrungen, da das Kind in ständiger Angst vor weiteren Übergriffen lebt. Es ist immer auf der Flucht vor dem Täter.
Wenn ein Kind unter derartigem Dauerstress steht kommt es zu Konzentrationsschwierigkeiten, die sich besonders auf die schulischen Leistungen negativ auswirken. Somit treten auch häufig Lernstörungen bei Inzestopfern auf.
Das Kind ist ununterbrochen damit beschäftigt, mit seinen inneren Spannungen fertig zu werden, es wippt z.B. ständig auf seinem Stuhl hin und her oder will sich ununterbrochen mitteilen.
Symptome, die häufig bei sexuellem Missbrauch auftreten sind Erschöpfung, körperliche und emotionale Schwäche, Ausdruck des Leidens, Schreckhaftigkeit etc. Diese Symptome hängen mit dem Missbrauch zusammen, aber auch mit dem ständigen Stress und der Angst vor weiteren Übergriffen, mit der Anstrengung, das Trauma zu bewältigen und ebenso mit dem Schweigen und „Vertuschenmüssen“ der Tat.[64]
So stand auch Anna ständig unter Angst und Druck, wenn sie mit dem Missbraucher zusammen war. Eigentlich sollte sie sich bei ihrem Vater doch geborgen und sicher fühlen, doch sie hatte ständig Angst vor weiteren Übergriffen und fühlte sich in seiner Gegenwart bedroht. So war sie ständig auf der Flucht und versuchte ihm aus dem Weg zu gehen. Die Erfahrungen der Angst und Bedrohung erlebte sie auch noch im Erwachsenenalter und nicht nur in Bezug auf ihren Vater. Sie sah sich im Umgang mit Personen, die in ihr die Erfahrungen an das Geschehen wieder hervorriefen, ständig einer Bedrohung oder Gefahr ausgesetzt.
[...]
[1] Vgl. Enders (Hrsg.) 1990, S. 11; Bange/Deegener 1996, S. 11
[2] Vgl. Steinhage 1994, S. 11 ff.
[3] Vgl. Braecker/Wirtz-Weinrich 1994, S. 13 u. 42
[4] Vgl. Jönsson 1997, S. 22
[5] Vgl. Böhmer/Eggert/Krüger 1995, S.9
[6] Vgl. Hane 1996, S.29; Falardeau 1998, S. 14 f.
[7] Vgl. Falardeau 1998, S. 15
[8] Vgl. Internet: www.ardennen.com/deutsch/kinderschutz/wasistmissb.html 2000; Hane 1996, S. 29 ff.
[9] Vgl. Videofilm zum Medienverbundprogramm des Bmfsfj 1997 Sexueller Kindesmißbrauch
[10] Vgl. Begleitbuch zum Medienverbundprogramm des Bmfsfj Sexueller Kindesmißbrauch, S. 25
[11] Vgl. Motzkau in: Egle, Hoffmann, Joraschky (Hrsg.) 1997, S. 60
[12] Vgl. Engfer in: Oerter/ Montada (Hrsg.)1998, S. 1008
[13] Vgl. Born 1994, S. 18 f.
[14] Vgl. Pfäfflin in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.) 1997, S.508
[15] Vgl. Born 1994, S. 19
[16] Vgl. Steinhage 1994, S. 13 f.; Kastner 1998, S.12
[17] Vgl. Steinhage 1994, S. 13
[18] Vgl. Steinhage1992, S. 11
[19] Vgl. Hane 1996, S. 20
[20] Vgl. Steinhage 1994, S. 13 f.
[21] Vgl. Falardeau 1998, S. 62 f.
[22] Vgl. Hane 1996, S. 22 f.
[23] Vgl. Motzkau in: Egle, Hoffmann, Joraschky (Hrsg.) 1997, S. 60
[24] Vgl. Steinhage 1992, S. 10
[25] Vgl. Steinhage 1994, S. 14 f.
[26] Vgl. Kastner 1998, S. 11
[27] Vgl. Hane 1996, S. 27
[28] Vgl. Gesetze für Sozialwesen 1999, §176 StGB
[29] Vgl. Steinhage 1994, S. 13
[30] Vgl. Falardeau 1998, S. 17
[31] Vgl. Kavemann/ Lohstöter 1993, S. 28
[32] Vgl. Hane 1996, S. 32
[33] Vgl. Braecker/ Wirtz-Weinrich 1994, S. 26 f.
[34] Vgl. Hane 1996, S. 32 f.
[35] Vgl. Braecker/ Wirtz-Weinrich 1994, S. 21 ff.
[36] Vgl. Zerban in: Hanns-Seidel-Stiftung (Hrsg.) Politische Studien Sonderheft 2/1997, S. 66
[37] Vgl. Hane 1996, S. 33
[38] Vgl. Linder 1997, S. 55
[39] Vgl. Hane 1996, S. 33 f.
[40] Vgl. Braecker/ Wirtz-Weinrich 1999, S.29 f.
[41] Vgl. Hane 1996, S. 33 ff.
[42] Vgl. Zerban in: Hanns-Seidel-Stiftung (Hrsg.) Politische Studien Sonderheft 2/1997, S. 67
[43] Vgl. Frei 1993, S. 21 f.
[44] Vgl. May 1997 S. 262 ff.
[45] Vgl. Friedrich 1998, S. 12 f.; Fey in: Büscher u.a. (Hrsg.) 1991, S. 43
[46] Vgl. Brockhaus/Kolshorn 1993, S. 147
[47] Vgl. Falardeau 1998, S. 37 f.
[48] Vgl. Enders/Stumpf in: Enders (Hrsg.) 1990, S. 39
[49] Vgl. Roeb in: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 1998, S. 428
[50] Vgl. Enders/Stumpf in: Enders (Hrsg.) 1990, S. 40 ff.; Linder 1997, S. 54
[51] Vgl. Roeb in: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 1998, S. 428
[52] Vgl. Falardeau 1998, S. 36 f.
[53] Vgl. Steinhage 1994, S. 21 f.
[54] Vgl. Enders/Stumpf in: Enders (Hrsg.) 1990, S. 52 ff.; Linder 1997, S. 55
[55] Vgl. Steinhage 1994, S. 22
[56] Vgl. Enders/Stumpf in: Enders (Hrsg.) 1990, S. 42 ff.
[57] Vgl. Enders/Stumpf in: Enders (Hrsg.) 1990, S. 44 f.
[58] Vgl. Roeb in: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 1998, S. 428
[59] Vgl. Enders/Stumpf in: Enders (Hrsg.) 1990, S. 44 ff.
[60] Vgl. Enders/Stumpf in: Enders (Hrsg.) 1990, S. 48 f.
[61] Vgl. Enders/Stumpf in: Enders (Hrsg.) 1990, S. 50
[62] Vgl. Roeb in: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 1998, S. 428
[63] Vgl. Enders/Stumpf in: Enders (Hrsg.) 1990, S. 56 f.
[64] Vgl. Falardeau 1998, S. 38 ff.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783832459680
- ISBN (Paperback)
- 9783838659688
- DOI
- 10.3239/9783832459680
- Dateigröße
- 838 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Koblenz - Standort RheinAhrCampus Remagen – Sozialwesen
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Oktober)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- überlebende vertrauensverlust grenzverletzung therapie schamgefühle schuldgefühle
- Produktsicherheit
- Diplom.de