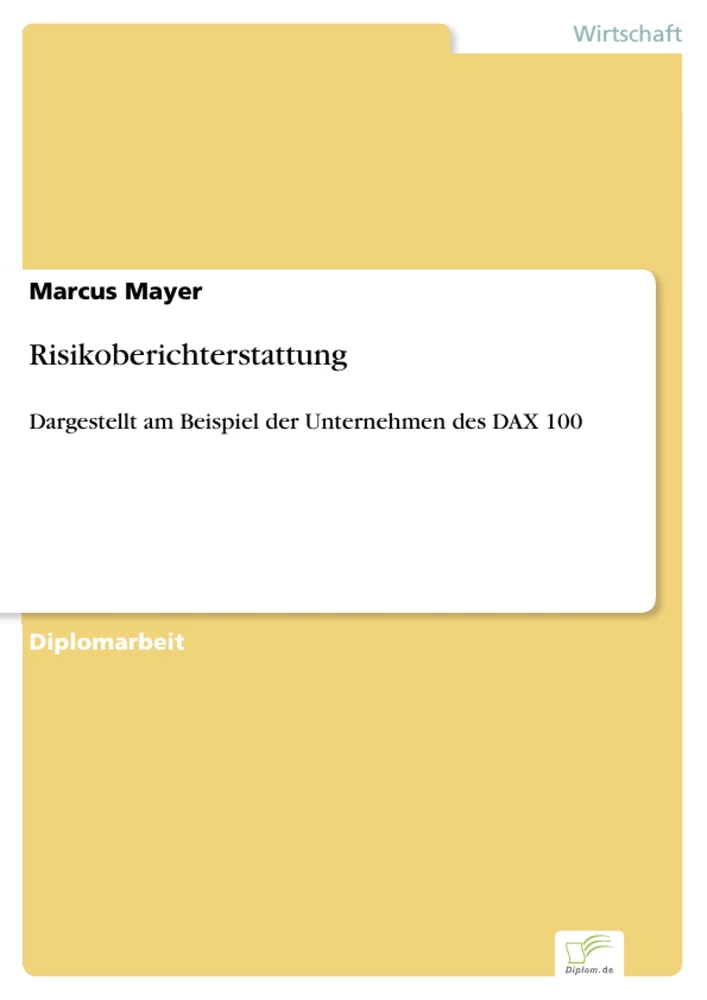Risikoberichterstattung
Dargestellt am Beispiel der Unternehmen des DAX 100
©2002
Diplomarbeit
81 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Als Reaktion auf die spektakulären Unternehmenszusammenbrüche in den neunziger Jahren und der damit verbundenen Kritik an den Abschlussprüfern und Aufsichtsräten, verabschiedete der Deutsche Bundestag am 6. März 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, kurz KonTraG. Das Gesetz trat am 1. Mai 1998 in Kraft.
Dabei wurden unter anderem die Vorschriften zur Lage- und Konzernberichterstattung (§ 289 Abs. 1 HGB und § 315 Abs. 1 HGB) geändert. Diese beiden Vorschriften wurden um den Zusatz: ... dabei ist auch auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen ergänzt. Diese sehr allgemein gehaltene Pflicht zur Risikoberichterstattung wurde vom Deutschen Standardisierungsrat durch Verabschiedung des DRS 5 am 3. April 2001 konkretisiert.
Welche Berichtspflichten sich daraus ergeben und wie die tatsächliche Berichterstattung über die Risiken der künftigen Entwicklung bei den Unternehmen des DAX 100 erfolgt, ist Gegenstand dieser Arbeit. Auf der Basis einer empirischen Untersuchung von 90 Risikoberichten wurden 23 Tabellen erstellt und ausgewertet, die die Diskrepanz zwischen den theoretischen Anforderungen und der Publizitätspraxis deutscher Großunternehmen verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1.Problemstellung
2.Der Lagebericht als konstitutiver Rahmen für den Risikobericht
2.1Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht
2.1.1Vorschriften des HGB
2.1.1.1Pflicht zur Aufstellung und Offenlegung
2.1.1.2Inhalt des Lageberichts
2.1.2Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
2.1.2.1Zielsetzung
2.1.2.2Wesentliche Änderungen
2.2Zweck und Aufgaben des Lageberichts
2.3Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung
2.3.1Grundsatz der Richtigkeit
2.3.2Grundsatz der Vollständigkeit
2.3.3Grundsatz der Klarheit
2.3.4Grundsatz der Vergleichbarkeit
2.3.5Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bzw der Wesentlichkeit
2.3.6Grundsatz der Informationsabstufung nach Art und Größe des Unternehmens
2.3.7Grundsatz der Vorsicht
2.4Grenzen der Berichterstattung
3.Der Risikobericht
3.1Berichtspflichtige Risiken
3.2Ermittlung der berichtspflichtigen Risiken
3.3Formale und materielle Anforderungen an den Risikobericht
3.4Der Deutsche Rechnungslegungs Standard 5 (DRS 5)
3.4.1Gegenstand und Geltungsbereich des DRS 5
3.4.2Anforderungen des DRS 5
3.4.2.1Berichtspflichtige […]
Als Reaktion auf die spektakulären Unternehmenszusammenbrüche in den neunziger Jahren und der damit verbundenen Kritik an den Abschlussprüfern und Aufsichtsräten, verabschiedete der Deutsche Bundestag am 6. März 1998 das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, kurz KonTraG. Das Gesetz trat am 1. Mai 1998 in Kraft.
Dabei wurden unter anderem die Vorschriften zur Lage- und Konzernberichterstattung (§ 289 Abs. 1 HGB und § 315 Abs. 1 HGB) geändert. Diese beiden Vorschriften wurden um den Zusatz: ... dabei ist auch auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen ergänzt. Diese sehr allgemein gehaltene Pflicht zur Risikoberichterstattung wurde vom Deutschen Standardisierungsrat durch Verabschiedung des DRS 5 am 3. April 2001 konkretisiert.
Welche Berichtspflichten sich daraus ergeben und wie die tatsächliche Berichterstattung über die Risiken der künftigen Entwicklung bei den Unternehmen des DAX 100 erfolgt, ist Gegenstand dieser Arbeit. Auf der Basis einer empirischen Untersuchung von 90 Risikoberichten wurden 23 Tabellen erstellt und ausgewertet, die die Diskrepanz zwischen den theoretischen Anforderungen und der Publizitätspraxis deutscher Großunternehmen verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1.Problemstellung
2.Der Lagebericht als konstitutiver Rahmen für den Risikobericht
2.1Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht
2.1.1Vorschriften des HGB
2.1.1.1Pflicht zur Aufstellung und Offenlegung
2.1.1.2Inhalt des Lageberichts
2.1.2Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
2.1.2.1Zielsetzung
2.1.2.2Wesentliche Änderungen
2.2Zweck und Aufgaben des Lageberichts
2.3Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung
2.3.1Grundsatz der Richtigkeit
2.3.2Grundsatz der Vollständigkeit
2.3.3Grundsatz der Klarheit
2.3.4Grundsatz der Vergleichbarkeit
2.3.5Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bzw der Wesentlichkeit
2.3.6Grundsatz der Informationsabstufung nach Art und Größe des Unternehmens
2.3.7Grundsatz der Vorsicht
2.4Grenzen der Berichterstattung
3.Der Risikobericht
3.1Berichtspflichtige Risiken
3.2Ermittlung der berichtspflichtigen Risiken
3.3Formale und materielle Anforderungen an den Risikobericht
3.4Der Deutsche Rechnungslegungs Standard 5 (DRS 5)
3.4.1Gegenstand und Geltungsbereich des DRS 5
3.4.2Anforderungen des DRS 5
3.4.2.1Berichtspflichtige […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5873
Mayer, Marcus: Risikoberichterstattung - Dargestellt am Beispiel der Unernehmen des
DAX 100
Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Berlin, Fachhochschule für Wirtschaft, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
____________________________
Inhaltsübersicht
I
__________________________
Inhaltsübersicht
1. Problemstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Der Lagebericht als konstitutiver Rahmen für den
Risikobericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht . . . . . . . . . . .
2.2 Zweck und Aufgaben des Lageberichts . . . . . . . . . . . . .
2.3 Grundsätze
ordnungsmäßiger
Lageberichterstattung . .
2.4 Grenzen der Berichterstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Der Risikobericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Berichtspflichtige Risiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Ermittlung der berichtspflichtigen Risiken . . . . . . . . . . . .
3.3 Formale und materielle Anforderungen an den
Risikobericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Der Deutsche Rechnungslegungs Standard 5 (DRS 5) .
4. Empirische Untersuchung der Risikoberichte der
Unternehmen des DAX 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Darstellung der Grundgesamtheit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Untersuchungskriterien
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Auswertung der Berichterstattung . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Vergleich zwischen den theoretischen Anforderungen und
der Publizitätspraxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3
3
13
14
20
22
22
24
26
28
33
33
33
37
38
58
60
____________________________
Inhaltsverzeichnis
II
__________________________
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inhaltsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Problemstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Der Lagebericht als konstitutiver Rahmen für den
Risikobericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht . . . . . . . . . . .
2.1.1 Vorschriften des HGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1.1 Pflicht zur Aufstellung und Offenlegung . . . . .
2.1.1.2 Inhalt des Lageberichts . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2.1 Zielsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2.2 Wesentliche Änderungen . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Zweck und Aufgaben des Lageberichts . . . . . . . . . . . . .
2.3 Grundsätze
ordnungsmäßiger
Lageberichterstattung . .
2.3.1 Grundsatz der Richtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Grundsatz der Vollständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3 Grundsatz der Klarheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4 Grundsatz der Vergleichbarkeit . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.5 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bzw. der
Wesentlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.6 Grundsatz der Informationsabstufung nach Art
und Größe des Unternehmens . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.7 Grundsatz der Vorsicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Grenzen der Berichterstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Der Risikobericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
II
V
VI
1
3
3
4
4
6
9
10
11
13
14
16
16
17
17
18
19
19
20
22
22
24
3.1 Berichtspflichtige Risiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Ermittlung der berichtspflichtigen Risiken . . . . . . . . . . . .
____________________________
Inhaltsverzeichnis
III
__________________________
3.3 Formale und materielle Anforderungen an den
Risikobericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Der Deutsche Rechnungslegungs Standard 5 (DRS 5) .
3.4.1 Gegenstand und Geltungsbereich des DRS 5 . . . .
3.4.2 Anforderungen des DRS 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2.1 Berichtspflichtige Risiken . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2.2 Detaillierungsgrad der
Risikoberichterstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2.3 Erläuterung des Risikomanagements . . . . . . .
3.4.2.4 Formale Gestaltung des Risikoberichts . . . . .
4. Empirische Untersuchung der Risikoberichte der
Unternehmen des DAX 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Darstellung der Grundgesamtheit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Untersuchungskriterien
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Formale Untersuchungskriterien . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Materielle Untersuchungskriterien . . . . . . . . . . . . .
4.4 Auswertung der Berichterstattung . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1 Auswertung nach formalen Untersuchungskriterien
4.4.1.1 Umfang der Risikoberichterstattung . . . . . . . .
4.4.1.2 Stellung und Bezeichnung der
Risikoberichterstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1.3 Risikokategorisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2 Auswertung nach materiellen
Untersuchungskriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
28
29
29
29
30
31
32
33
33
33
37
37
37
38
38
38
40
43
44
44
46
47
49
4.4.2.1 Umfang und Inhalt des Berichts über das
Risikomanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2.2 Angaben zu bestandsgefährdenden und zu
sonstigen Risiken mit wesentlichem Einfluss
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
4.4.2.3 Gegenstandsbereiche und Häufigkeit der
genannten Risiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2.4 Präzisionsgrade der Risikoberichterstattung .
____________________________
Inhaltsverzeichnis
IV
__________________________
4.4.2.5 Beschreibung der Maßnahmen zur
Risikobegrenzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2.6
Zeithorizonte der Risiken . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2.7 Eintrittswahrscheinlichkeiten der Risiken . . . .
4.4.2.8
Auswirkungen der Risiken . . . . . . . . . . . . . . .
5. Vergleich zwischen den theoretischen Anforderungen und
der Publizitätspraxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
53
55
56
58
60
63
____________________________
Abbildungsverzeichnis
V
__________________________
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Bestandteile des (Konzern-) Lageberichts . . . . . . .
Abbildung 2: Das System der Grundsätze ordnungsmäßiger
Lageberichterstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung 3: Bestätigungsvermerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung 4: Systematisierung der Grundgesamtheit nach
Pflicht zur Anwendung des DRS 5 . . . . . . . . . . . . .
Abbildung 5: Systematisierung der Grundgesamtheit nach
Branchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung 6: Systematisierung der Grundgesamtheit nach
der Konzernbilanzsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung 7: Umfang der Risikoberichterstattung nach
Größenklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung 8: Umfang der Risikoberichterstattung nach
Branchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung 9: Prozentualer Anteil der Risikoberichterstattung
am Lagebericht nach Größenklassen . . . . . . . . . . .
Abbildung 10: Prozentualer Anteil der Risikoberichterstattung
am Lagebericht nach Branchen . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung 11: Stellung der Risikoberichterstattung . . . . . . . . . . . .
Abbildung 12: Bezeichnung der Risikoberichterstattung . . . . . . . .
Abbildung 13: Risikokategorisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung 14: Umfang des Berichts über das
Risikomanagement nach Branchen . . . . . . . . . . . .
Abbildung 15: Umfang des Berichts über das
Risikomanagement nach Größenklassen . . . . . . . .
Abbildung 16: Inhalt des Berichts über das Risikomanagement . .
Abbildung 17: Angaben über bestandsgefährdende Risiken . . . . .
Abbildung 18: Angaben über Risiken mit wesentlichem Einfluss
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage . . . .
Abbildung 19: Gegenstandsbereiche und Häufigkeiten der
genannten Risiken nach Branchen . . . . . . . . . . . . .
6
15
35
35
36
36
39
39
40
40
41
42
44
44
45
46
46
47
48
____________________________
Abbildungsverzeichnis
VI
__________________________
Abbildung 20: Gegenstandsbereiche und Häufigkeiten der
genannten Risiken nach Größenklassen . . . . . . . .
Abbildung 21: Präzisionsgrade der Risiken nach
Gegenstandsbereichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung 22: Beschreibung der Maßnahmen zur
Risikobegrenzung nach Gegenstandsbereichen . .
Abbildung 23: Zeithorizonte der Risiken nach
Gegenstandsbereichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbildung 24: Angaben zu Eintrittswahrscheinlichkeiten der
Risiken nach Gegenstandsbereichen . . . . . . . . . . .
Abbildung 25: Angaben zu Auswirkungen nach
Gegenstandsbereichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
51
53
54
56
57
____________________________
Abkürzungsverzeichnis
VII
__________________________
Abkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung
Abs. Absatz
AG
Aktiengesellschaft; Die Aktiengesellschaft
AktG Aktiengesetz
Anm. d. V.
Anmerkung des Verfassers
Art. Artikel
Aufl. Auflage
BB Betriebs-Berater
BBK Buchführung
Bilanz Kostenrechnung
BFuP
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
bzw. beziehungsweise
ca. circa
DB Der
Betrieb
d.h. das
heißt
DRS Deutsche
Rechnungslegungs Standards
DRSC
Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee
DStR Deutsches
Steuerrecht
ebd. ebenda
EG Europäische
Gemeinschaft
etc. et
cetera
EU Europäische
Union
f. folgende
ff. fortfolgende
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GoL Grundsätze
ordnungsmäßiger Lageberichterstattung
HFA Hauptfachausschuss
HGB Handelsgesetzbuch
Hrsg. Herausgeber
IAS
International Accounting Standards
IDW Institut
der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IT Informationstechnologie
____________________________
Abkürzungsverzeichnis
VIII
__________________________
KapCoRiLig Kapitalgesellschaften- und Co-Richtlinien-Gesetz
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KonTraG
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich
nF neue
Fassung
NWB Neue
Wirtschaftsbriefe
PS Prüfungsstandard
PublG Publizitätsgesetz
Rn. Randnummer
RS Rechnungslegungsstandard
S. Seite
Stbg Steuerberatung
Tz. Textziffer
u.a. und
andere
US-GAAP Generally
Accepted Accounting Principles
usw.
und so weiter
vgl. vergleiche
WP Wirtschaftsprüfer
WPg Die
Wirtschaftsprüfung
WPK-Mitt. Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen
z.B. zum
Beispiel
ZfbF Schmalenbachs
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche
Forschung
ZIR
Zeitschrift interne Revision
Problemstellung
1
1. Problemstellung
Als Reaktion auf die spektakulären Unternehmenszusammenbrüche in
den neunziger Jahren und der damit verbundenen Kritik an
Abschlussprüfern und Aufsichtsräten, verabschiedete der Deutsche
Bundestag am 6. März 1998 das Gesetz zur Kontrolle und
Transparenz im Unternehmensbereich, kurz KonTraG.
1
Das Gesetz
trat am 1. Mai 1998 in Kraft.
2
Die Neuerungen des
Handelsgesetzbuches sind erstmals für die Geschäftsjahre
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 beginnen.
3
Laut der allgemeinen Begründung des Gesetzentwurfs, werden mit
dem KonTraG die folgenden zwei Ziele verfolgt:
4
· Die Schwächen des Unternehmenskontrollsystems sollen
korrigiert werden und
· den Informationsbedürfnissen internationaler Investoren soll
Rechnung getragen werden.
Um diese Ziele zu erreichen, wurden durch das KonTraG unter
anderem die Vorschriften zur Lage- und Konzernberichterstattung (§
289 Abs. 1 HGB und § 315 Abs. 1 HGB) geändert. Diese beiden
Vorschriften wurden um den Zusatz: ,,... dabei ist auch auf die Risiken
der künftigen Entwicklung einzugehen"
5
ergänzt.
6
1
Vgl. Baetge/Schulze, S. 937.
2
Vgl. Wiechers, S. 1153.
3
Vgl. Moldzio, S. 3713.
4
Vgl. Begründung Referenten Entwurf eines Gesetzes zu Kontrolle und Transparenz
im Unternehmensbereich, S. 23, zitiert nach: Brebeck/Herrmann, S. 381.
5
§ 289 Abs. 1 2. Halbsatz HGB und § 315 Abs. 1 2. Halbsatz HGB.
6
Vgl. Dörner/Bischof, S. 445.
Problemstellung
2
Welche Berichtspflichten sich aus dieser Neuregelung ergeben und
wie die tatsächliche Berichterstattung über die Risiken der künftigen
Entwicklung (im Folgenden auch als Risikobericht oder
Risikoberichterstattung bezeichnet) bei den Unternehmen des DAX
100 erfolgt, ist Gegenstand dieser Arbeit.
Da der Risikobericht einen Teil des Lageberichts bzw. des
Konzernlageberichts darstellt, wird zunächst näher auf die
gesetzlichen Rahmenbedingungen des Lageberichts eingegangen. Im
HGB sind die Pflicht zur Aufstellung und Offenlegung sowie der Inhalt
des Lageberichts gesetzlich normiert. Die Pflicht zur Aufstellung eines
Risikoberichts ist auf das KonTraG zurückzuführen, daher ist es zum
allgemeinen Verständnis notwendig, die Zielsetzung und die
wesentlichen Änderungen des KonTraG darzustellen. Im Folgenden
wird dann auf die Funktion des Lageberichts, auf die Grundsätze
ordnungsmäßiger Lageberichterstattung und die Grenzen der
Berichterstattung näher eingegangen.
Um die theoretischen Anforderungen an die Risikoberichterstattung
selbst herauszuarbeiten, ist es weiterhin unerlässlich, die
berichtspflichtigen Risiken und wie sie ermittelt werden können,
darzustellen. Diese decken sich im Wesentlichen mit den Regelungen
des DRS 5, welcher sich mit der Risikoberichterstattung befasst.
Kapitel vier widmet sich der empirischen Untersuchung der
Risikoberichte der Unternehmen des DAX 100. Hier werden zunächst
die Untersuchungskriterien kurz vorgestellt und danach die
gewonnenen Erkenntnisse in Tabellen veranschaulicht und erläutert.
Abgerundet wird die Arbeit mit einem Vergleich zwischen Theorie und
Praxis und einem Resümee, in dem die wesentlichen Ergebnisse noch
einmal zusammengefasst werden.
Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht
Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht
3
2. Der Lagebericht als konstitutiver Rahmen
für den Risikobericht
In diesem Teil der Arbeit werden vorab die Anforderungen an einen
ordnungsgemäßen Risikobericht dargestellt, die dann später mit den
Ergebnissen der empirischen Untersuchung verglichen werden. Dazu
ist es notwendig zuerst den Rahmen in den der Risikobericht gebettet
ist den Lagebericht genauer zu betrachten, bevor auf die speziellen
Anforderungen an die Risikoberichterstattung eingegangen werden
kann.
2.1 Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht
Ursprünglich entstand der Lagebericht aus dem sogenannten
Geschäftsbericht, den Aktiengesellschaften und
Kommanditgesellschaften auf Aktien nach § 160 AktG von 1965 ab
dem 1. Januar 1966 neben dem Jahresabschluss erstellen mussten.
Durch das BiRiLiG von 1985, welches die 4., 7. und 8. EG-Richtlinie in
deutsches Recht umsetzte, wurden die Vorschriften vom Aktiengesetz
1965 ins HGB verlagert. Damit waren sie auch für die GmbH
verpflichtend. Dabei wurde der Begriff Geschäftsbericht aufgegeben,
aus ihm ging der Anhang, als dritter Teil des Jahresabschlusses, und
der Lagebericht, als eigenes Rechnungslegungsinstrument, hervor.
7
Seither wurden die Anforderungen an die Lageberichterstattung
mehrfach verändert; zuletzt durch das KapCoRiLiG von 2000. Die für
diese Arbeit entscheidende Änderung brachte das KonTraG von 1998.
§ 289 Abs.1 und § 315 Abs. 1 wurden mit dem Zusatz ,,dabei ist auch
auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen"
8
ergänzt,
woraus sich die Pflicht zur Erstellung eines Risikoberichts ergibt.
7
Vgl. Selch, S. 357 ff.
8
§ 289 Abs. 1 2. Halbsatz HGB und § 315 Abs. 1 2. Halbsatz HGB.
Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht
4
2.1.1 Vorschriften des HGB
2.1.1.1
Pflicht zur Aufstellung und Offenlegung
Gemäß § 264 Abs. 1 HGB sind die gesetzlichen Vertreter mittlerer und
großer Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KGaA) verpflichtet, in den
ersten drei Monaten eines Geschäftsjahres neben dem
Jahresabschluss auch einen Lagebericht für das abgelaufene
Geschäftsjahr aufzustellen und innerhalb von 12 Monaten offen zu
legen (§ 325 HGB). Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe
branchenspezifischer Sondervorschriften zur Erstellung des
Lageberichts, auf die hier aber nicht weiter eingegangen wird. Für
kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB besteht
bezüglich der Lageberichterstattung ein Wahlrecht.
9
Sollten kleine Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften
freiwillig einen Lagebericht aufstellen, so unterliegt dieser den gleichen
Anforderungen wie ein Lagebericht, der aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung erstellt wurde. Dies wird unter anderem damit begründet,
dass mit dem Begriff (Konzern-) Lagebericht ein in § 289 bzw. § 315
HGB festgelegter Inhalt verbunden ist.
10
Diese Auffassung vertritt auch
das IDW.
11
Mutterunternehmen haben die Möglichkeit, Lagebericht und
Konzernlagebericht zusammengefasst aufzustellen und offen zu legen
(§§ 315 Abs. 3 HGB in Verbindung mit § 298 Abs. 3 HGB).
12
Bestimmte Mutterunternehmen haben darüber hinaus die Möglichkeit,
einen befreienden Konzernabschluss nach §§ 291, 292 und 292a HGB
zu erstellen.
13
In diesem Zusammenhang stellt sich auch im Hinblick auf die
empirische Untersuchung dieser Arbeit die Frage, ob eine
9
Vgl. Baetge/Schulze, S. 937; Lechtape/Krumbholz, S. 57 f.
10
Vgl. Dörner/Bischof, S. 454.
11
Vgl. IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung, Tz. 8.
12
Vgl. Lechtape/Krumbholz, S. 58.
13
Vgl. Dörner/Bischof, S. 451.
Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht
5
Berichterstattung über die Risiken der künftigen Entwicklung
notwendig ist, um die befreiende Wirkung zu erlangen.
Börsennotierte Mutterunternehmen, die einen Abschluss nach
internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IAS oder US-GAAP)
erstellen, sind gemäß §292a Abs. 1 HGB von der Aufstellung von
Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach HGB befreit. Weder
IAS noch US-GAAP sieht ein dem Lagebericht vergleichbares
Rechnungslegungsinstrument vor, dennoch sind Abschlüsse nach
diesen Vorschriften um einen Konzernlagebericht zu ergänzen, da der
Gesetzgeber in § 292a Abs. 2 Nr. 2 HGB dies explizit fordert. Hierbei
ist auch auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen, sonst
ist die in § 292a Abs. 2 Nr. 3 HGB geforderte Gleichwertigkeit der
Aussage der befreienden Unterlagen zu einem Konzernabschluss und
Konzernlagebericht nach HGB aufgrund der zentralen Bedeutung des
Risikoberichts für den Informationsgehalt des Konzernlageberichts
nicht gegeben.
14
Auch für die befreiende Wirkung eines Konzernabschlusses eines
Mutterunternehmens mit Sitz in der EU ist für dessen deutsche
Zwischenholding nach § 291 Abs. 1 Satz 1 HGB ein
Konzernlagebericht erforderlich. Dieser muss lediglich nach dem im
Einklang mit der 7. EG-Richtlinie stehenden für das
Mutterunternehmen maßgeblichen Recht aufgestellt sein. Eine
Berichterstattung über die Risiken der künftigen Entwicklung im Sinne
des § 315 Abs. 1 2. Halbsatz HGB ist insoweit nicht erforderlich.
15
Sitzt das Mutterunternehmen außerhalb der EU, hängt die
Berichtspflicht über die Risiken der künftigen Entwicklung davon ab, ob
das Drittlandunternehmen, außer der deutschen, weitere
Zwischenholdings im Geltungsbereich der EU hat, die durch
Offenlegung des befreienden Konzernabschlusses tatsächlich von
ihrer Teilrechnungslegungspflicht befreit werden würde. Ist dies der
Fall, so besteht eine Berichtspflicht nicht. Wird dagegen nur die
deutsche Zwischenholding durch Offenlegung des befreienden
14
Vgl. ebd., S. 451 ff.
15
Vgl. ebd., S. 453.
Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht
Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht
6
Konzernabschlusses von ihrer Teilkonzernrechnungslegungspflicht
befreit, besteht eine Berichtspflicht bezüglich der Risiken der künftigen
Entwicklung.
16
2.1.1.2
Inhalt des Lageberichts
Gesetzlich normiert ist der Inhalt des Lageberichts in § 289 Abs. 1 und
2 HGB und der des Konzernlageberichts in § 315 Abs. 1 und 2 HGB.
Dies lässt sich wie folgt grafisch veranschaulichen:
Abb. 1: Bestandteile des (Konzern-) Lageberichts
Quelle: Coenenberg, S. 842
Die Angaben zum Geschäftsverlauf, zur Lage und zu den Risiken der
künftigen Entwicklung nach § 289 Abs. 1 bzw. § 315 Abs. 1 HGB, auch
als Wirtschaftsbericht bezeichnet, sind die zentralen Elemente des
Lageberichts und werden daher auch als ,,Kern des Lageberichts"
bezeichnet.
17
Aus der Formulierung: ,,...sind zumindest ...
darzustellen..."
18
geht hervor, dass es sich hierbei um Pflichtangaben
handelt.
Die Formulierung ,,... soll auch eingehen auf: ..."
19
im zweiten Absatz
der eben genannten Paragrafen, ist nicht als ein Wahlrecht der
Unternehmen zu sehen, nach Belieben einen Prognose-, Nachtrags-,
16
Vgl. ebd., S. 455.
17
Vgl. Baetge (1996), S. 10.
18
§ 289 Abs. 1 HGB; § 315 Abs. 1 HGB.
19
§ 289 Abs. 2 HGB; § 315 Abs. 2 HGB.
Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht
7
Forschung- und Entwicklungs- oder Zweigniederlassungsbericht zu
erstellen. Damit soll lediglich zum Ausdruck gebracht werden, dass im
Regelfall berichtet werden muss und nur in Ausnahmefällen darauf
verzichtet werden kann.
20
Ein solcher Ausnahmefall liegt vor, wenn die
Kapitalgesellschaft dazu in objektiver Form nicht in der Lage ist. Damit
soll verhindert werden, dass Angaben gemacht werden, deren
Grundlagen nicht genügend gesichert sind.
21
Wichtig ist die Zuordnung zu Absatz eins oder zwei im Hinblick auf die
Bußgeldvorschriften des § 334 HGB. Diese besagen in Absatz 1 Nr. 3
bzw. 4, dass eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, wenn gegen § 289 Abs.
1 bzw. § 315 Abs. 1 HGB verstoßen wird. Diese Ordnungswidrigkeit
kann gemäß § 334 Abs. 3 mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Deutsche
Mark geahndet werden.
Gegenstand dieser Arbeit ist der Risikobericht. Aus Gründen der
Vollständigkeit werden aber auch die anderen Berichtsteile kurz
erläutert. Da der Inhalt von Lagebericht und Konzernlagebericht, mit
Ausnahme des Zweigniederlassungsberichts (dieser ist nicht Teil des
Konzernlageberichts), identisch ist, gelten die folgenden Angaben
soweit nicht anders erwähnt sinngemäß auch für den
Konzernlagebericht.
· Darstellung des Geschäftsverlaufs:
Hier ist ein Überblick über die Unternehmensentwicklung in der
Berichtsperiode zu geben und eine Beurteilung dieser
Entwicklung vorzunehmen. Dabei sind folgende Bereiche
berichtspflichtig, sofern sie für die Darstellung des
Geschäftsverlaufs der Gesellschaft wesentlich sind:
22
o Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft
o Umsatz- und Auftragsentwicklung
o Produktion
o Beschaffung
20
Vgl. Lange, S. 2448.
21
Vgl. Coenenberg, S. 841.
22
Vgl. IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung, Tz. 23 f.
Gesetzliche Vorschriften zum Lagebericht
8
o Investition
o Finanzierung
o Personalbereich
o Umweltschutz
o Sonstige wichtige Vorgänge im Geschäftsjahr
· Darstellung der Lage
In diesem Berichtsteil ist die wirtschaftliche Lage (Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage) entsprechend den tatsächlichen
Verhältnissen zu vermitteln.
23
Es handelt sich dabei um eine
Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Verhältnisse zum
Abschlussstichtag.
24
Dabei ist auf die selben Bereiche
einzugehen wie bei der Darstellung des Geschäftsverlaufs.
· Hinweis auf die Risiken der künftigen Entwicklung
Siehe Kapitel 3. Der Risikobericht
· Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des
Geschäftsjahres (Nachtragsbericht):
Damit sind Vorgänge gemeint, die, wären sie bereits vor dem
Abschlussstichtag eingetreten, eine andere Darstellung der
Lage zur Folge hätten (z.B. signifikante
Wechselkursschwankungen).
25
· Voraussichtliche Entwicklung (Prognosebericht):
Dieser Berichtsteil soll darstellen, welcher Geschäftsverlauf in
Zukunft erwartet wird. Die Berichtsbereiche sind mit denen aus
der Darstellung des Geschäftsverlaufs und der der Lage
identisch.
26
23
Vgl. Coenenberg, S. 841 ff.
24
Vgl. Baetge u.a. (1989), S. 32.
25
Vgl. IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung, Tz. 38 ff.
26
Vgl. Baetge (1996), S. 643.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832458737
- ISBN (Paperback)
- 9783838658735
- DOI
- 10.3239/9783832458737
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin – Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2002 (September)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- risikobericht lagebericht
- Produktsicherheit
- Diplom.de