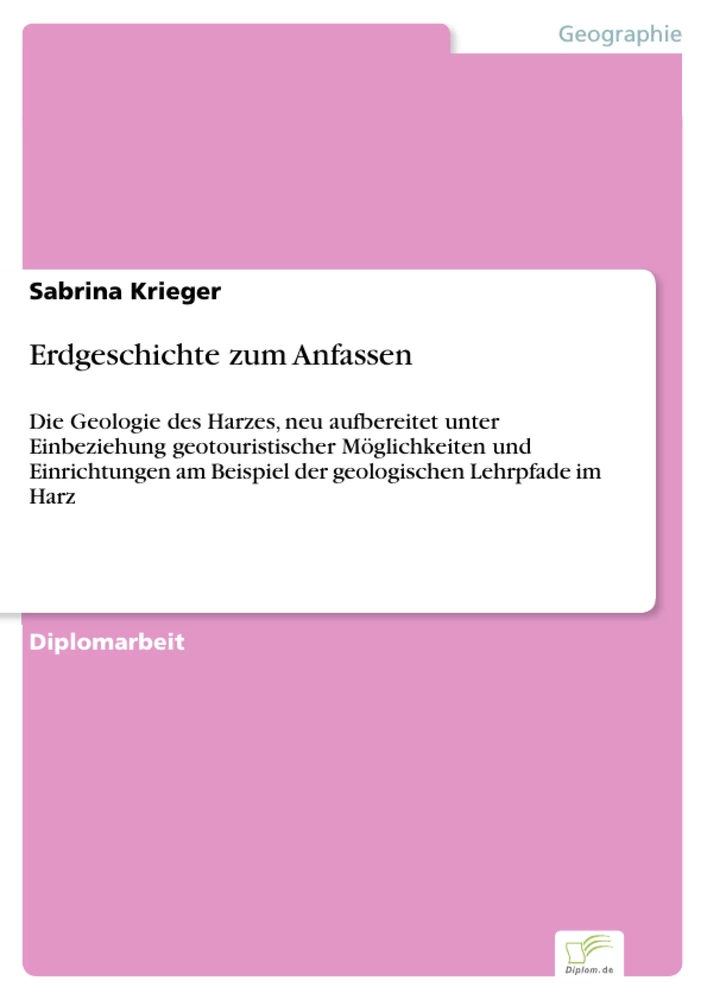Erdgeschichte zum Anfassen
Die Geologie des Harzes, neu aufbereitet unter Einbeziehung geotouristischer Möglichkeiten und Einrichtungen am Beispiel der geologischen Lehrpfade im Harz
©2002
Diplomarbeit
126 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie Geologie in der heutigen Zeit praxisnah und interessant nicht nur dem Fachpublikum, sondern vor allem dem interessierten Laien vermittelt und für die jeweilige Region vermarktet werden kann.
Im Jahre 2001 wurde das Projekt Geopark Harz ins Leben gerufen. Die Verfasserin nimmt dies zum Anlass, Gestaltungsmöglichkeiten für einen solchen Park aufzuzeigen.
Zusätzlich entwirft sie einen kurzen geologischen Führer für Harzbesucher.
Die ausführliche Abhandlung der historischen Geologie des Harzes erfolgt in Kapitel 3. Es handelt sich dabei nicht nur um eine wissenschaftliche Zusammenfassung aus verschiedenen Quellen, sondern dem Leser soll ein Roter Faden in die Hand gegeben werden, der sich kontinuierlich vom Präkambrium bis zum Quartär zieht (was geschah wann im Harz).
Zahlreiche Photos von gut zugänglichen und beschriebenen (Straßen-) Aufschlüssen vermitteln dem Leser das Aha-Erlebnis vor Ort.
Der Harzer Bergbau und die Wasserwirtschaft werden in gesonderten Kapiteln abgehandelt.
Den eigentlichen Anstoß zu dieser Arbeit gaben aber die zahlreichen geologischen Lehrpfade, die sich über den gesamten Harz verteilen und sich in einem mehr oder weniger guten Zustand befinden. Siebzehn solcher Pfade konnten von der Verfasserin ausfindig, abgewandert und bewertet werden. Zusätzlich wird eine kritische Bewertung der wichtigsten Exkursionsführer für den Harz vorgenommen, da diese Führer als Handwerkszeug unerlässlich waren.
Nach Beschreibung und Bewertung der einzelnen Lehrpfade werden im letzten Kapitel Merkmale eine guten Geopfades aufgelistet, sowie auf die Gestaltung und Planung zukünftiger Lehrpfade eingegangen.
Der Arbeit ist ein ausführliches Glossar für den geologisch interessierten Laien beigefügt. Es kann interaktiv durch Anklicken der unterstrichenen Fachwörter im Text sofort abgerufen werden.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.0Einführung1
1.1Geopfade im Harz - Vermittlung geologischer Inhalte an Umwelt, Bildung und Fremdenverkehr1
1.2Vermittlung geologischer Inhalte2
1.2.1Wie ist Geologie vermittelbar?3
1.2.2Ist die reine Geologie für den Laien interessant?4
1.2.3Kann Geologie vermarktet werden?5
1.2.4Die Vermittlung geologischer Inhalte über Lehrpfade6
2.0Das Projekt Geopark Harz7
2.1Planung und Grundlagen7
2.2Beispiele8
2.2.1Teufelsmauer8
2.2.2Beispiel Lange Wand von Ilfeld8
2.3Kleine […]
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie Geologie in der heutigen Zeit praxisnah und interessant nicht nur dem Fachpublikum, sondern vor allem dem interessierten Laien vermittelt und für die jeweilige Region vermarktet werden kann.
Im Jahre 2001 wurde das Projekt Geopark Harz ins Leben gerufen. Die Verfasserin nimmt dies zum Anlass, Gestaltungsmöglichkeiten für einen solchen Park aufzuzeigen.
Zusätzlich entwirft sie einen kurzen geologischen Führer für Harzbesucher.
Die ausführliche Abhandlung der historischen Geologie des Harzes erfolgt in Kapitel 3. Es handelt sich dabei nicht nur um eine wissenschaftliche Zusammenfassung aus verschiedenen Quellen, sondern dem Leser soll ein Roter Faden in die Hand gegeben werden, der sich kontinuierlich vom Präkambrium bis zum Quartär zieht (was geschah wann im Harz).
Zahlreiche Photos von gut zugänglichen und beschriebenen (Straßen-) Aufschlüssen vermitteln dem Leser das Aha-Erlebnis vor Ort.
Der Harzer Bergbau und die Wasserwirtschaft werden in gesonderten Kapiteln abgehandelt.
Den eigentlichen Anstoß zu dieser Arbeit gaben aber die zahlreichen geologischen Lehrpfade, die sich über den gesamten Harz verteilen und sich in einem mehr oder weniger guten Zustand befinden. Siebzehn solcher Pfade konnten von der Verfasserin ausfindig, abgewandert und bewertet werden. Zusätzlich wird eine kritische Bewertung der wichtigsten Exkursionsführer für den Harz vorgenommen, da diese Führer als Handwerkszeug unerlässlich waren.
Nach Beschreibung und Bewertung der einzelnen Lehrpfade werden im letzten Kapitel Merkmale eine guten Geopfades aufgelistet, sowie auf die Gestaltung und Planung zukünftiger Lehrpfade eingegangen.
Der Arbeit ist ein ausführliches Glossar für den geologisch interessierten Laien beigefügt. Es kann interaktiv durch Anklicken der unterstrichenen Fachwörter im Text sofort abgerufen werden.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.0Einführung1
1.1Geopfade im Harz - Vermittlung geologischer Inhalte an Umwelt, Bildung und Fremdenverkehr1
1.2Vermittlung geologischer Inhalte2
1.2.1Wie ist Geologie vermittelbar?3
1.2.2Ist die reine Geologie für den Laien interessant?4
1.2.3Kann Geologie vermarktet werden?5
1.2.4Die Vermittlung geologischer Inhalte über Lehrpfade6
2.0Das Projekt Geopark Harz7
2.1Planung und Grundlagen7
2.2Beispiele8
2.2.1Teufelsmauer8
2.2.2Beispiel Lange Wand von Ilfeld8
2.3Kleine […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5868
Krieger, Sabrina: Erdgeschichte zum Anfassen - Die Geologie des Harzes, neu aufbereitet
unter Einbeziehung geotouristischer Möglichkeiten und Einrichtungen am Beispiel der
geologischen Lehrpfade im Harz
Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Heidelberg, Universität, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen der Diplomprüfungsordnung Geologie am Geologisch-
Paläontologischen Institut der Universität Heidelberg angefertigt.
Zusammen mit Herrn Firouz Vladi, Diplom-Geologe und Fachbereichsleiter bei der
Kreisvolkshochschule in Osterode, wurde die ungewöhnliche Aufgabenstellung für die vorliegende
Arbeit entwickelt.
Herr Vladi verschaffte mir auch die notwendigen Kontakte und wichtiges Informationsmaterial, damit
diese Arbeit im Rahmen der Prüfungsordnung durchgeführt werden konnte.
Mein Dank geht auch an Herrn Prof. Jürgen Schneider vom Geowissenschaftlichen Zentrum der
Universität Göttingen (GZG), der die Diplomarbeit als solche annahm, betreute und mich ebenfalls mit
aktuellen und wichtigen Informationsmaterialien versorgte.
Herr Prof. Hans Ruppert und Dipl.-Geol. Matthias Deicke (beide GZG) unterstützten mich speziell zu
den Bereichen Umweltgeologie und Verkarstung.
Fachkundigen Rat und Hintergrundwissen für geotouristische Einrichtungen wie die Geologischen
Lehrpfade sowie die Planung von Geoparks in Deutschland und Europa erhielt ich von Herrn Dr.
Matthias Thomae vom Geologischen Landesamt in Halle, der sich sehr stark im Bereich Geotourismus
engagiert.
Bedanken möchte ich mich aber auch bei Herrn Prof. Wolfgang Dachroth, Mitglied des
Prüfungsausschusses des Geologisch-Paläontologischen Instituts der Universität Heidelberg, der
grünes Licht für die Erstellung dieser besonderen Art der Diplomarbeit gab, und auf dessen Buch
,,Baugeologie in der Praxis" ich bei der Abhandlung der Talsperren im Harz immer wieder gerne
zurückgriff.
Eine Diplomarbeit über den gesamten Harz anzufertigen, erfordert sehr viel Zeit im Gelände und einen
enormen fahrtechnischen Aufwand.
Diese Arbeit wäre niemals zustande gekommen, wenn mir nicht liebevolle und hilfsbereite Menschen
zur Seite gestanden hätten, die mich ab und zu von meinem Mutterdasein entlasteten und meine
kleine Tochter Sara unter ihre Fittiche nahmen.
Ein ganz besonderes Dankeschön geht daher an Ivanca, an Melanie, an Heike und vor allem an
meinen Mann, der seine wenigen freien Abende und viele, viele Wochenenden für die Betreuung
unserer Tochter opferte.
Meiner Tochter Sara möchte ich diese Diplomarbeit widmen, wenngleich dies unüblich ist.
Sie jedoch war die treibende Kraft für diese Art von Arbeit. Ihre Ausdauer während unserer
Wanderungen, ihre Neugier und Begeisterung für die Gesteinswelt und die Natur des Harzes
inspirierten mich immer wieder zu neuen Ideen in der vorliegenden Arbeit.
Bad Sachsa, Januar 2002
FÜR SARA
STEIN-ZEIT
Stein beherrscht die Erde
Gibt ihr ein Gesicht und einen Namen
Zeit ist relativ
Gebirge kommen und gehen
Ozeane entstehen und schließen sich
Kontinente mal groß, mal klein driften über die Erde hinweg
Klein und unscheinbar kriecht das Leben
- wie eine schleimige Masse -
über
das Gestein
Und nur ganz kurz eilt der Mensch vorüber
man nimmt ihn kaum wahr
Wenn Steine reden könnten,
was würden sie uns erzählen?
Inhaltsverzeichnis
1.0
Einführung
1
1.1
,,Geopfade im Harz Vermittlung geologischer Inhalte an Umwelt,
Bildung
und
Fremdenverkehr"
1
1.2
Vermittlung
geologischer
Inhalte
2
1.2.1
Wie
ist
Geologie
vermittelbar?
3
1.2.2 Ist die ,,reine" Geologie für den Laien interessant?
4
1.2.3
Kann
Geologie
,,vermarktet"
werden?
5
1.2.4 Die Vermittlung geologischer Inhalte über Lehrpfade
6
2.0
Das
Projekt
,,Geopark
Harz"
7
2.1
Planung
und
Grundlagen
7
2.2
Beispiele
8
2.2.1
Teufelsmauer
8
2.2.2
Beispiel
,,Lange
Wand
von
Ilfeld" 8
2.3
,,Kleine Einführung in die Geologie des Harzes" für den Harzbesucher
9
3.0
Die Geologie des Harzes als
,,Zeitreise"
13
3.1
Überblick
13
3.1.1
Einflüsse
des
Klimas
15
3.2
Präkambrium
15
3.3
Ordovizium
17
3.3.1
Die
Wippraer
Zone
19
3.4
Silur
20
3.5
Devon
20
3.5.1
Die
Harzgeröder
Zone
22
3.5.2
Die
Blankenburger
Zone 23
3.5.3
Der
Oberharzer
Devonsattel
23
3.5.4
Der
Elbingeröder
Komplex
24
3.5.5
Der
Iberg/Winterberg-Komplex
24
3.5.6
Die
Siebermulde 25
3.5.7
Die
Südharz-
und
Selkemulde
25
3.6
Karbon
34
3.6.1
Tanner
Grauwackenzug
36
3.6.2 Der Acker-Bruchberg-Zug
36
3.6.3
Der
Oberharzer
Diabaszug
36
3.6.4
Clausthaler
Kulmfaltenzone
37
3.6.5
Die
Sösemulde
37
3.6.6
Magmatismus
im
Harz
37
3.7
Perm
45
3.7.1
Das
Ilfelder
Becken
46
3.8
Trias
50
3.9
Jura
52
3.10
Kreide / Die Aufrichtung des Harzer Nordrandes
55
3.11
Tertiär
59
3.12
Pleistozän
und
Holozän
59
3.13
Karstlandschaft
des
Südharzes
61
3.13.1
Der
Karstwanderweg
63
4.0
Der Bergbau
64
4.1
Erzlagerstätte
Rammelsberg
67
4.2
Roteisenerze des Oberharzer Diabaszuges
69
4.3
Iberger
Eisenerze
69
4.4
Kupferschiefer am westlichen und südlichen Harzrand
69
4.5
Ober-
und
Mittelharzer
Erzgänge
70
4.6
Oolithische
Eisenerze
der
Kreidezeit
70
4.7
Nutzbare
Gesteine
des
Westharzes
71
4.8
Der
Steinkohlebergbau
im
Ilfelder
Becken
71
4.9
Der
Ilfelder
Braunsteinbergbau 72
5.0
Die
Harzer
Wasserwirtschaft
73
5.1
Talsperren
früher...
73
5.2
Talsperren
heute...
73
5.3
Stauanlagen
74
5.4
Der Oderteich
75
5.5
Die
Nordhäuser
Talsperre
76
5.6
Die
Odertalsperre
76
5.7
Die
Sösetalsperre
76
5.8
Die
Zillierbachtalsperre 77
5.9
Eckertalsperre
77
5.10
Okertalsperre
77
5.11
Bodewerk
Rappbodetalsperre
79
5.12
Die
Innerstetalsperre
80
5.13
Die
Granetalsperre
81
5.14
Bedrohung
der
Trinkwasserqualität
im
Harz
81
6.0
Geopfade
im
Harz
82
6.1
Einführung:
Thematisch
gebundene
Wege
82
6.2 Exkursionsführer
82
6.2.1 K. Mohr: ,,Die klassische Quadratmeile der Geologie"
82
6.2.2 K. Mohr: ,,Geologische Wanderungen rund
um
die
Westharzer
Talsperren"
83
6.2.3
K.
Mohr:
,,Harz,
Westlicher
Teil"
83
6.2.4 F. Knolle: ,,Der Harz Geologische Exkursionen"
84
6.3
Geologische
Lehrpfade 85
6.3.1 Der Eisensteinlehrpfad in Lerbach bei Osterode
85
6.3.2
Geologischer
Wanderpfad
Goslar
85
6.3.3 Der geologische Pfad im Teufelstal, Bad Grund
85
6.3.4 Geologisch-Bergbauhistorischer Wanderweg Beerberg,
Sankt
Andreasberg
85
6.3.5 Gesteinskundlicher
Lehrpfad
Jordanshöhe, St. Andreasberg
87
6.3.6
Naturlehrpfad
Rübeland 87
6.3.7 Der naturkundliche-geologische Lehrpfad Hasserode
88
6.3.8 Wald- und Gesteinslehrpfad ,,Knüppeldamm" im Wippertal
91
6.3.9
Wanderweg
Altbergbaugebiet
Tilkerode
92
6.3.10
Geologischer
Wanderweg
Blankenburg
93
6.3.11 Bergbaulehrpfad Röhrigschacht bei Wettelrode
94
6.3.12
Bergbauhistorischer
Lehrpfad
llfeld
96
6.3.13 Bergbaugeschichtlicher Lehrpfad bei Elbingerode
97
6.3.14
Naturkundlicher
Lehrpfad
Ilsetal 97
6.3.15 Geologische Schautafeln rund um den Ortsteil
Sieber
(Herzberg
a.
Harz)
99
6.3.16
Das
Bodetal
99
6.3.17 Der Karstwanderweg im Südharz
102
6.3.18 Geführte Wanderungen
102
7.0
Ergebnisse für die Planung und Gestaltung zukünftiger Lehrpfade
103
7.1
Merkmale eines ,,guten" Geopfades
103
7.2
Fazit
103
8.0
Glossar
105
Zeittafel
1
113
Zeittafel
2
114
Quellennachweis
115
1
1.0 Einführung
1.1
,,Geopfade im Harz Vermittlung geologischer Inhalte an Umwelt, Bildung und
Fremdenverkehr"
So lautete der Arbeitstitel der Diplomarbeit. Als ich mit der Diplomarbeit begann, hatte ich eine
bestimmte Vorstellung davon, wie diese Pfade auszusehen hätten: ,,Jeder für sich
repräsentiert einen kleinen Einblick in die regionale Geologie des Harzes. Alle zusammen
liefern mir ein mehr oder weniger vollständiges geologisches und bergbauhistorisches Bild
über die einmalige und überaus komplexe Landschaft."
In der Realität sieht es leider anders aus. Den Harz in seiner Gesamtheit zu erfassen, ist
aufgrund seiner Vielgestaltigkeit und seines Themenreichtums nahezu unmöglich, außerdem
ist die Geologie des Harzes nicht ganz einfach und noch heute teilweise heftig umstritten.
Nachfolgend möchte ich nur einige wenige Punkte aufzählen, die für die Tatsache
verantwortlich sind, daß die Lehrpfade im Harz eben nicht das sind, was ich von ihnen
erwartet habe:
-
Der Harz war bis zum Jahre 1989 durch die innerdeutsche Grenze zweigeteilt. Ein
zusammenhängendes Bild des Harzes bis dato zu entwerfen, war überaus schwierig.
-
Unter welchen Aspekten wurden die Lehrpfade entworfen? So sind die geologischen
Wanderungen von K. M
OHR
keine Wanderungen im eigentlichen Sinne, sondern lediglich eine
Markierung der im Harz besonders wertvoller geologischer Zeugnisse, die nur unter
beträchtlichem zeitlichen Aufwand abgefahren und abgearbeitet werden können.
-
Das immer größer werdende Problem des Vandalismus: die Schautafeln vieler Lehrpfade
werden oft mutwillig zerstört oder beschädigt. Die Erhaltungskosten für solche Lehrpfade sind
z.T. erheblich, und oft fehlt das Geld für die Instandsetzung. So existieren manche der Pfade
nur noch rudimentär oder überhaupt nicht mehr.
-
Es existiert kein einheitliches Profil. Drei Bundesländer (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen) teilen sich den Harz; davon hat Sachsen-Anhalt den weitaus größten Teil des
Harzes inne, Thüringen nimmt nur ein kleines Stück im Süden für sich in Anspruch.
Über den niedersächsischen Teil des Harzes wiederum existieren die meisten geologischen
und populärwissenschaftlichen Schriften, sowie zahlreiche Wander- und Exkursionsführer.
-
Die Bergbaugeschichte nimmt im Harz einen sehr großen Stellenwert ein. Viele Lehrpfade
beschäftigen sich fast ausschließlich mit den montanhistorischen Sehenswürdigkeiten.
-
Wo befinden sich diese Pfade überhaupt? Es ist derzeit nicht möglich, sich eine Übersicht
über die bestehenden Pfade mittels eines Kurzführers oder einer Karte zu machen. Es
bedurfte oft intensiver Recherche, bis einige dieser Pfade ausfindig gemacht worden waren.
Da fragt man sich schon, mit welchem Ziel diese Pfade erstellt wurden und wem sie eigentlich
nutzen sollen?
Ziel der vorliegenden Diplomarbeit sollte zum einen eine möglichst anschauliche Darstellung
der Harz-Geologie sein, zum anderen eine Übersicht über die vorhandenen geologischen
Lehrpfade geben und überprüfen, inwieweit die Geologie in all ihren Facetten über diese
abgedeckt und vermittelt wird.
Die Idee, einen eigenen Geologischen Lehrpfad zu entwickeln, in dem die Geologie des
Harzes vollständig enthalten sein sollte, verwarf ich bereits kurze Zeit später wieder, da das
Überangebot an geologischer-bergbauhistorischer Information im Harz nicht innerhalb einer
einzigen Exkursionsroute abgedeckt werden kann.
Wollte ich jeden Aspekt sei es historische Geologie, Bergbau, Wasserwirtschaft,
Verkarstung auch nur ansatzweise einbringen, so hätte ich nicht weniger als 50 Stationen,
die anzufahren wären. Außerdem müßte ein erheblicher Fahraufwand in Kauf genommen
werden, da die einzelnen Aufschlußpunkte über die riesige Fläche des Harzes verstreut
liegen.
2
Dennoch wollte ich von meinem Vorhaben nicht ablassen, einen roten Faden in diese
undurchsichtige Informationsflut zu ziehen.
Unter der Schirmherrschaft der UNESCO sollen in Europa in den nächsten Jahren sog.
Geoparks (s. Kap. 2.0) eingerichtet werden. Für Deutschland sind 2 solcher Einrichtungen
vorgesehen.
Da der Harz aufgrund seiner geologischen Vielfalt einen ,,heißen" Anwärter in der Auswahl für
einen zukünftigen
Geopark
in Deutschland darstellt, bietet sich mir die Möglichkeit, mir
Gedanken zu machen, wie so ein Geopark in Zukunft aussehen und gestaltet werden könnte.
Deshalb möchte ich zu Beginn der Diplomarbeit einige Vorschläge zur Gestaltung eines
Geoparks Harz machen, ohne jedoch weiter in Details zu gehen, denn dies würde den
Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Es folgt eine kurze Beschreibung der
Harzgeologie, die den interessierten Laien wie auch den Fachmann ansprechen soll.
Nachdem ich alle bekannten und weniger bekannten in der Literatur beschriebenen
Aufschlußpunkte aufgesucht hatte, soweit das überhaupt möglich war, kam ich weiterhin zu
dem Entschluß, die interessantesten Aufschlüsse in chronologischer Reihenfolge zu sortieren
und in die geologische Historie einzubinden.
Für die Auswahl der Aufschlüsse waren für mich 2 Dinge entscheidend:
1.
Die Aufschlußpunkte mußten leicht und schnell erreichbar sein
2.
Dem Besucher sollte bei der Betrachtung sofort ein ,,Aha"-Erlebnis vermittelt werden.
Die Beschreibung der geologischen Ereignisse werden zunächst wissenschaftlich
zusammengefaßt, darüber hinaus wird an manchen Stellen auch versucht, die Geschehnisse
in einfachen Worten für den geologisch interessierten Laien wiederzugeben. Natürlich kann
eine solche Arbeit, die sich mit einer Vielzahl geologischer Phänomene beschäftigen muß,
keine Einführung in die allgemeine und historische Geologie sein. Das würde zu weit führen.
Wichtige Fachbegriffe werden aber bereits im Text erklärt oder finden sich im Glossar am
Ende der Arbeit.
Im zweiten Teil erfolgt eine Auflistung und kritische Bewertung der wichtigsten geologischen
Exkursionsführer durch den Harz sowie der vorhandenen Geologischen Lehrpfade. Letztere
konnten leider nicht in den ersten Teil miteingebaut werden, da sie oft bergbauhistorisch oder
landschaftsbezogen orientiert sind.
Mit dem geologischen ,,Zeitreiseführer" durch den Harz und den weiterführenden Kapiteln
wurde meines Erachtens jedoch ein solides Basiswissen über den Harz geschaffen.
Da die Gestaltung der Lehrpfade oft zu wünschen übrig läßt, wurden von mir eigene
Vorschläge entwickelt, inwieweit Geologie über solche Lehrpfade aktiv vermittelt werden kann,
ohne daß immense Kosten dafür aufgewendet werden müssen oder die Natur Schaden
nimmt.
1.2
Vermittlung geologischer Inhalte
Allgemein stellen sich bei der Vermittlung geologischer Inhalte 3 Fragen:
Wie ist Geologie vermittelbar?
Ist die ,,reine" Geologie für den Laien interessant?
Wie kann Geologie ,,vermarktet" werden?
Die Geologie als Naturwissenschaft nimmt in unserem kulturellen Bildungsstandard immer
noch einen ganz kleinen Stellenwert ein. Im Stundenplan unserer Kinder finden wir regelmäs-
sig und wie selbstverständlich Biologie, Physik und Chemie. Geologie ist, wenn überhaupt,
Bestandteil des Faches Umweltkunde (auch Erdkunde, Weltkunde etc. genannt). Kein Fach
hat größere Probleme mit seinem Namen und der Vermittlung seines Sinnes und seiner
Inhalte. Allein während meiner 13-jährigen Schulzeit in den 70er und 80er Jahren hat dieses
Fach dreimal seinen Namen geändert!
Im ersten Semester meines Geologiestudiums fragte ein Dozent uns, in welche
erdgeschichtliche Epoche wir die Schwäbische Alb einordnen würden? 30 angehende
3
Geologiestudenten saßen im Raum und nur ganz wenige wußten etwas mit dem Begriff ,,Jura"
anzufangen. Im geologischen Sinne natürlich! Das stimmt bedenklich.
Nicht erst seit dem Bekanntwerden der teilweise niederschmetternden Ergebnisse der PISA-
Studie in Deutschland, in der der Wissenstand unserer Schüler unter die Lupe genommen
wurde, wissen wir, wie mangelhaft unsere Schulen und Ausbildungsstätten im Vergleich zu
den Nachbarländern seit Jahren abschneiden.
Man werfe einmal einen Blick über den großen Ozean hinüber in die USA.
Deren Schulsystem läßt sicher auch viel zu wünschen übrig, aber Wissensvermittlung hört in
den USA nicht nach Schulschluß auf. ,,Learning by doing" ist das Motto und wird dort auch auf
Schritt und Tritt praktiziert.
Geologie wird als gleichberechtiger und wichtiger Teil der Umwelt angesehen.
Geologie findet in der Öffentlichkeit statt, nicht im Verborgenen.
Natürlich - werden Sie jetzt denken ist es in Amerika leichter, Geologie zu zeigen und dafür
Interesse zu wecken. Wo sonst gibt es eine derart monumentale Vielfalt der Gesteinswelt, und
wo sonst ist sie auch noch relativ leicht zugänglich?
Man darf dabei die Relation nicht vergessen. Deutschland hat mit einer Fläche von 357 000
km
2
gerade mal die Größe eines US-Bundesstaates (US-Bundesstaat Montana: 381 000 km
2
),
im Vergleich dazu aber wesentlich mehr geologische Vielfalt zu bieten.
Der Yellowstone-National-Park in Wyoming entspricht im kleinen unserer Eifel.
Utah hat den Zion- und den Arches N.-P. - Deutschland das Elbsandsteingebirge und
Helgoland.
Das Dinosaur N.-M. in Colorado als Fossilienattraktion. Der Solnhofener Plattenkalk in der
Fränkischen Alb und die Grube Messel bei Darmstadt - im übrigen Weltkulturerbe! - sind nicht
weniger interessant!
Die Appalachen im Osten der USA? - Variszisches Grundgebirge hat Deutschland mehr als
genug: Schwarzwald, Harz, Rheinisches Schiefergebirge...
Natürlich kann Deutschland nicht mit einem Grand Canyon aufwarten.
Aber werfen Sie einen Blick ins Bodetal bei Thale im Nordharz. Wandern sie den alten
Jägerpfad hinunter zur Teufelsbrücke und Sie werden ähnlich berührt sein wie im Grand
Canyon. Garantiert!
1.2.1 Wie ist Geologie vermittelbar?
Wie bei allen Naturwissenschaften gehört ein solides Basiswissen zum Handwerkszeug eines
jeden Geologen. Basiswissen wird vor allem in theoretischen Publikationen, also über
Fachliteratur, in Sachbüchern und Lexika vermittelt. Anschaulich darstellen kann man
Naturwissenschaft passiv über Abbildungen und Bilddokumentationen oder über Filmmaterial.
Die aktive und spannendste Erfahrung bietet aber die Natur selbst. Die meisten Eltern gehen
mit ihren Kindern in den Zoo oder in den botanischen Garten. Welches Kind lauscht nicht
gerne den Vogelstimmen im Wald, entdeckt die Verschiedenartigkeit der einheimischen
Gehölze? Wie entsteht ein Regenbogen, warum regnet es?
Eltern hingegen, die ihrem Kind erklären (können), wie Gesteine entstehen, warum der Ätna
immer wieder ausbricht oder Los Angeles auf das große Erdbeben wartet, warum aber Filme,
in denen New York von Vulkanausbrüchen heimgesucht wird, ,,an den Haaren herbeigezogen"
sind, gibt es nur wenige.
Es ist schon verwunderlich, daß gerade auf diesem Gebiet so wenig Wissen besteht, wo wir
doch alle tagtäglich damit zu tun haben. Ich selbst habe eine Tochter von 2 Jahren. Sie ist
ganz versessen auf Steine. Fast jeder Stein wird aufgehoben und genau begutachtet.
Aktive Erfahrung kann so leicht sein, besonders in der Geologie, denn Steine gibt es überall.
4
1.2.2 Ist die ,,reine" Geologie für den Laien interessant?
Abstraktes Wissen, das nicht auf den ersten Blick irgendwo anwendbar ist, ist niemals
interessant. Was nützt mir eine Sprache, wenn ich sie nicht sprechen kann? Das macht es für
den Lateinlehrer oft auch so schwierig, seine Schüler für diese ,,tote" Sprache zu begeistern.
Vielen Menschen können keinen Bezug zwischen der klassischen Geologie und ihrer Umwelt
herstellen. Geologen werden mißtrauisch beäugt. Das sind ,,Verrückte", die auf jeden Vulkan
rennen, wenn er gerade am Brodeln ist, und die man an Straßenrändern beim Steineklopfen
sieht.
Geologen treten oft erst dann in der Öffentlichkeit auf, wenn irgendwo auf der Welt eine
Naturkatastrophe passiert ist.
,,Was macht man denn damit?" höre ich in 90% der Fälle, wenn ich nach meiner Ausbildung
gefragt werde.
Doch gerade über die Medien kann Interesse geweckt werden. Weshalb gibt es Erdbeben?
Wo sind Sie möglich? Was hat es mit dem Ätna auf sich?
Warum werden derartige Themen nicht je nach aktueller Lage in den Schulen diskutiert?
Geschieht jedoch in der Politik oder in der Wirtschaft ein Ereignis von wesentlicher Tragweite,
dann reagieren die Medien mit einer übersättigenden Informationsflut. Es herrscht dann
geradezu Informationspflicht.
Es gibt sehr viele Gebiete auf der Erde, in denen die Menschen sehr wohl an Geologie
interessiert sind. Sie kommen an ihr nicht vorbei, weil das Wissen um die natürlichen
Vorgänge für diese Menschen dort oft überlebenswichtig ist.
Auf Hawaii z.B. interessiert sich jeder für Geologie, weil die Auswirkungen der geologischen
Ereignisse allgegenwärtig sind: Vulkanausbrüche, Lavaströme, Erdbeben, Tsunamis.
Die Geologie ist Teil ihres Lebens. Geologische Erläuterungen richten sich dort vor allem an
Laien, geologische Literatur für Kinder ist selbstverständlich, an vielen Stellen in der Natur
finden sich Informationstafeln.
Mittlerweile gibt es erste Ansätze auch bei uns in Deutschland, diesem Informationsdefizit
entgegenzuwirken. Die Einrichtung von Naturparks (Nationalparke) nach amerikanischen
Vorbild, Ausstellungen zur Erdgeschichte (z.B. in Speyer: September 2001 - April 2002:
,,Eiszeit"), Angebote der Volkshochschulen zu geologischen Exkursionen, Wanderführer zur
regionalen Geologie, Sachbücher für Kinder, die sich mit den Naturgewalten der Erde
beschäftigen, leisten einen wichtigen Beitrag.
Und trotzdem will in Deutschland kein geologisches ,,Bewußtsein" aufkommen, nach wie vor
bleibt die Geologie Randthema in der Gesellschaft.
Im Rahmen meiner Diplomkartierung am Rande des Odenwaldes bezog ich auch so manche wertvollen Hinweise zu
meiner Aufgabenstellung über das Informationszentrum des Naturparks Neckartal-Odenwald in Eberbach / Baden. Da
diese Einrichtung mich in ihrem Aufbau und ihrer Funktion damals schon beeindruckte, möchte ich sie hier kurz
anführen.
Sie wird von der dort ansässigen Bevölkerung, insbesondere von Schulen, sehr geschätzt.
Auszug aus der Diplomkartierung ,,Geologische Kartierung am Südostrand des Odenwaldes" (K
RIEGER
2000), Kap. 7:
Exkursionsvorschläge:
Wer sich generell für die Naturkunde sowie die geologische Entstehungsgeschichte des Neckartals und
Buntsandstein-Odenwaldes interessiert, dem sei ein Besuch im Informationszentrum des Naturparks Neckartal
Odenwald in Eberbach empfohlen. In liebevoller und intensivster Kleinarbeit wurden hier ein dreidimensionales
geologisches Modell des Naturparks Neckartal-Odenwald erstellt, das sich von Heidelberg über Eberbach Mosbach
bis nach Adelsheim erstreckt.
Die in der hauseigenen Werkstatt hergestellten Hinweisschilder, die in der freien Natur den geologisch und
naturkundlich Interessierten über die regionalen Besonderheiten informieren, sind - auf mehrere Stockwerke verteilt -
auch Bestandteil des Info-Zentrums und beeindrucken in Text und Darstellung nicht nur den Laien.
In einer 25minütigen Multivisionsshow werden die geologische und historische Vergangenheit dem ,,Istzustand" des
weitläufigen Naturparks gegenübergestellt. Dem Besucher wird in übersichtlicher Erzählweise und eindrucksvollen
Bildern den Sinn und die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung vor Augen geführt.
Nicht nur der naturkundlich Interessierte, sondern vor allem Kinder und Jugendliche sollen für ihre natürliche
Umgebung wieder mehr sensibilisiert werden. Wissenschaftliche Untersuchungen werden so auf höchst anschauliche
Weise dargestellt. Für kleine ,,Wissenschaftler" stehen Binokulare, ein Stereoskop und eine reichhaltige Bibliothek zur
Verfügung.
Das seit 3 Jahren eingerichtete Informationszentrum in der Altstadt von Eberbach wird ständig aktualisiert.
Öffnungszeiten:
Di Fr 10 12 Uhr,14 17 Uhr, Mai-Okt.: So 12 17 Uhr
Tel.: 0 6271 / 7 29 85
5
NUR in ganzheitlichen Betrachtungen unserer Umwelt haben wir die Möglichkeit, Geologie
gesellschaftsfähig zu machen. Keine Wissenschaft kann für sich alleine existieren, und es
sollte uns in der heutigen Zeit möglich sein, unserer Umwelt begreiflich zu machen, wie sehr
das Bewußtwerden um die natürlichen Vorgänge um uns herum unser Leben beeinflussen
und ändern kann.
Ich möchte zum Abschluß dieses Kapitels eine kleine Anekdote dazu erzählen:
Als ich mit meinem Mann, einem Geologen, im September 1994 das erste Mal zusammen in USA Urlaub machte,
besuchten wir natürlich auch den Grand Canyon. Von Geologie hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch sehr wenig
Ahnung, ich sollte erst im Oktober mein Studium aufnehmen.
Voller Begeisterung führte er mich zu der Schlucht, und neugierig blickte ich hinab. Ein seltsames Gefühl machte sich
in mir breit. Ich hatte soviel vom Grand Canyon gehört, ich hatte etwas unwahrscheinlich Spektakuläres erwartet, und
nun schaute ich in 1800 m Tiefe und sah nichts als steile Felswände und ein kleines Flüßchen von dreckiger, brauner
Farbe sich tief unten dahinschlängeln. Ich war enttäuscht und konnte noch nicht mal sagen, weshalb.
Mein Mann sah mir die Enttäuschung an und machte den Vorschlag, wenigstens am nächsten Tag in die Schlucht
hinabzuwandern, um meinem sportlichen Ehrgeiz Genüge zu tun.
Das hob meine Stimmung wieder etwas, aber trotzdem blieb ein ungutes Gefühl der Verständnislosigkeit und etwas
verpaßt zu haben, bei mir zurück.
1997 - ich befand mich mittlerweile im Hauptstudium - standen wir auf meinen Wunsch hin wieder an der gleichen
Stelle.
Meine Gefühle in diesem Augenblick, als ich zum zweiten Mal in die Schlucht starrte, waren ungeheuerlich. Ich war
von tiefer Ehrfurcht ergriffen und brannte darauf, hinabzusteigen, um den Gesteinen am Grund des Canyon näher zu
sein, sie berühren zu können und mir vorzustellen, daß ich beim Hinabsteigen eine Zeitreise von 1,7 Milliarden Jahre
machen würde; so alt sind nämlich die ältesten Gesteine des Canyon, der Vishnu Schist.
Der Canyon läßt mich seitdem nicht mehr los
1
.
Wie gerne möchte man dann diese unbeschreiblichen Gefühle, die man empfindet, wenn
einem ,,bewußt wird", wie groß die Kräfte der Erde sind, und wie unbedeutend der Mensch
daneben ist, mit seiner Umwelt teilen. Und wie ernüchternd trifft einem dann die Erkenntnis,
daß die Menschen um einem herum mit der gleichen Verständnislosigkeit und dem Unwissen
am Rand des Canyon stehen, die einem selbst drei Jahre zuvor um dieses ungeheuerliche
Erlebnis brachten. Wieviel reicher an Erfahrungswerten und Emotionen könnte das Leben
eines jeden sein, wenn er ein wenig mehr Verständnis und Wissen um die natürlichen
Vorgänge um sich herum hätte.
Dazu ist kein Studium nötig, aber Chancen sollten genutzt werden, die Gesellschaft sensibler
für derartige Dinge um sie herum zu machen. Das kann man z.B. mittels Diavorträgen,
Exkursionsangeboten, oder auch in der Gestaltung von Lehrpfaden.
1.2.3 Kann Geologie ,,vermarktet" werden?
Das Beispiel USA zeigt, daß es möglich ist, ,,zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen":
Die Öffentlichkeit zu informieren und gleichzeitig den Naturtourismus anzukurbeln.
Es ist bei weitem nicht so, daß sich in Deutschland niemand für Natur interessiert. Aktiver
Naturtourismus und Naturschutz schließen sich dabei nicht aus. Aufgrund unserer hohen
Bevölkerungsdichte stehen mittlerweile die wenigen weitgehend noch intakten
Naturlandschaften unter Naturschutz. Das ist in den USA von der Relation her gesehen nicht
anders. Die Besucher fahren auf bequemen Straßen zu den Highlights und werden durch
Parkplätze an hervorragenden Aussichtspunkten auf Abstand gehalten. Die vorgegebenen
Wege dürfen nicht verlassen werden. Lediglich ein schmales anstrengendes Wegenetz (10%)
gehört dem anspruchsvollen Naturliebhaber und dort herrschen eiserne Regeln und
Vorschriften zum Schutz der Natur.
Die Einfahrt in die National Parks ist kostenpflichtig, beim Besuch mehrerer Parks gibt es
Ermäßigungen. Erste Anlaufstelle sind üblicherweise großzügige Besucherzentren, in denen
auch hervorragendes Informationsmaterial in jeder Preislage erhältlich ist.
In den Besucherzentren gibt es kostenlose Schauerlebnisse (Filme, Vorträge,
Informationstafeln, wichtige Hinweise) sowie geschultes Personal.
Die Parkranger erfüllen ihre Funktion als Ansprechpartner für die Besucher und treten weniger
als Polizei in Erscheinung.
Es wird dem Besucher psychologisch geschickt die Erkenntnis vermittelt, daß die Natur
wertvoll und einmalig ist, und deshalb ihren Preis hat.
1
Lit.-empf.: W.H. Calvin: Der Strom, der bergauf fließt. Eine Reise durch die Evolution (dtv)
6
Ähnliche Bemühungen finden mittlerweile auch hier in Deutschland statt. Aber die erhoffte
Resonanz bleibt bisher aus.
Und das vor allem aus einem Grund: die Bevölkerung erfährt nur wenig von diesen Aktivitäten
und Einrichtungen, ihrem Sinn und Nutzen. Die Bereitschaft, außerhalb der schulischen
Vergangenheit neue Dinge zu erfahren und zu lernen, ist in großen Teilen der Bevölkerung
klein, so lange kein ,,Spaß"-Erlebnis mitverbunden ist.
Der Naturfreund kann aus einer Fülle von Freizeitangeboten wählen und er wird diejenigen
auswählen, bei denen er unter möglichst wenig Zeitaufwand die für ihn optimale Befriedigung
herausholen kann.
Bei der Vorbereitung zu dieser Diplomarbeit habe ich selbst erlebt, wie sehr die Begeisterung,
Geologische Lehrpfade abzuwandern, in ein Gefühl der Lustlosigkeit bis hin zu Frustation
umschlagen kann, wenn kostbare Zeit dafür aufgewendet werden muß, solche Wege
mühselig ausfindig zu machen, und dann - abgesehen von dem oft katastrophalen Zustand
derselben feststellen zu müssen, daß sie dem interessierten Laien nur wenig Informatives
bieten.
1.2.4 Vermittlung geologischer Inhalte über Lehrpfade
Geologie aktiv erleben kann man nur in der Natur. Geologiestudenten müssen in ihrem Stu-
dium eine bestimmte Anzahl geologischer Exkursionen aufweisen, um zur Prüfung zugelassen
zu werden. Und nur in diesen Exkursionen und in ihrer Nachbereitung ist Geologie greifbar
und wirklich interessant.
Meines Erachtens sind gerade geologische Lehrpfade das ideale Mittel, um mit möglichst
wenig Kostenaufwand viele Besucher und Naturliebhaber für die Gesteinswelt zu
sensibilisieren (s. Kap. 7.0): Auf Wanderwegen, Radwegen, Höhlenbesuchen, Bergwerks-
besichtigungen, Steinbruchführungen. Das alles kann Teil der Lehrpfade sein...
Die Gelegenheit ist günstig wie nie, den Harz als geologische Sehenswürdigkeit in den Köpfen
der ,,breiten Masse" zu etablieren!
7
2.0
Das Projekt ,,Geopark Harz"
2.1
Planung und Grundlagen
Geoparks werden als in sich geschlossene Gebiete definiert, die von einer besonderen
geologischen Bedeutsamkeit zeugen.
Der Harz ist ein solches Gebiet. Aufgrund seiner Morphologie läßt er sich zudem gut
eingrenzen. Auf jeder Karte sticht er als Pultscholle deutlich hervor.
Hat man die Grenzen festgelegt, stellt sich die Frage nach den Eingängen. Irgendwo sollen
die Touristen in den ,,geologischen Harz" symbolhaft eingelassen werden. Diese Eingänge
sollten als diese auch gut zu erkennen sein. Natürlich kann man von überall her in den Harz
einfahren, daran würde sich ja nichts ändern, aber der Geopark an sich könnte über spezielle
Eingänge in Form von ,,Visitor-Centern" (Besucherzentren) verfügen, die dem Touristen als
Anlaufstelle für seine Fragen, Wünsche und Informationsbedürfnisse zur Verfügung stünden.
Die Sehenswürdigkeiten sollten nicht allzu weit davon entfernt liegen. Die Möglichkeit zur
Übernachtung und/oder Einkehrmöglichkeiten sind mit zu berücksichtigen.
Bei der Auswahl der möglichen ,,Tore in den Harz" eignen sich 5 Städte aufgrund ihrer
geographischen Lage besonders gut: Osterode, Goslar, Thale, Mansfeld und Ilfeld:
1. Alle drei Bundesländer, die Anteil am Harz haben, verfügen somit über mindestens
einen Zugang zum Geopark
2. Die verschiedensten Aspekte der Harzgeologie werden über diese Städte und
Gemeinden abgedeckt und sie bilden einen Gürtel um den Harz. Aus jeder
Himmelsrichtung wird man in den Geopark eingelassen.
3. Die geologischen Highlights sind von dort aus leicht zu erreichen.
4. Goslar, Thale und Ilfeld sind touristisch erfahren. Osterode und Mansfeld könnten aus
dieser neuen Situation als ,,Tor zum Harz" auch wirtschaftlich profitieren und ihren
Bekanntheitsgrad steigern.
Die Highlights um Osterode:
1.
Der Iberg bei Bad Grund
Die Highlights um Goslar:
2.
Erzbergwerk Rammelsberg
3.
Romkerhaller Wasserfälle / Kästeklippen
Die Highlights um Thale:
4.
Bodetal (Rambergpluton), Geologischer
Lehrpfad
5.
Teufelsmauer
Weiterfahrt durch Rübeland:
6.
Elbingeröder Riffkomplex, Baumanns- und
Hermannshöhle
Die Highlights um Mansfeld:
7.
Schaubergwerk Röhrigschacht bei Wettelrode
mit
Bergbauhistorischem
Lehrpfad
Die Highlights um Ilfeld:
8.
Naturdenkmal ,,Lange Wand" (mit Kupfer-
schieferbergwerk)
9.
Rabensteiner Stollen (Kohle) eines der
wenigen
Kohleschaubergwerke
Deutschlands!
(keine
karbonische,
sondern
permische
Koh-
le!)
10.
KZ-Lager Mittelbau-Dora
(riesiges Stollensystem im Anhydrit zur
Schaffung eines unterirdischen Zentrallagers
für
Kraftstoffe)
Im Harzinneren:
11.
Der Brocken als höchster Berg
des Harzes
8
Nun sind aber alle Sehenswürdigkeiten recht zeitintensiv und auf keinem Fall in einem,
geschweige denn in 2 Tagen zu schaffen.
Sind diese Stationen jedoch Teil eines geologischen Rahmenprogramms, so weiß der Tourist,
wo er sich befindet, was er sieht und bekommt natürlich zu dieser Sehenswürdikgeit auch
weiterführendes Informationsmaterial.
2.2 Beispiele
2.2.1 Teufelsmauer:
Der Besucher steht an der Teufelsmauer, hält eine geologische Übersicht, z.B. in Form eines
Prospektes oder eines kleinen Exkursionsführers in Händen, wird darin informiert, daß er sich
nun geologisch gesehen in der Kreide befindet, ferner, wie die Teufelsmauer entstanden ist.
Er wird aufgefordert, sich doch auch die Gegensteine von Ballenstedt anzuschauen oder auf
die Harznordrandstörung verwiesen, die er - fährt er die B 6 von Goslar bis Ballenstedt - an
manchen Steinbrüchen und morphologischen Besonderheiten sehen kann (Wolfstein,
Butterberg).
2.2.2 Beispiel ,,Lange Wand von Ilfeld":
Nachdem der Besucher erfahren hat, daß er sich nun im Perm befindet, und wie es zu den
Ablagerungen kam, die an der Langen Wand zu beobachten sind, wird ihm anhand des
Führers auch beschrieben, wie sehr dieses Zeitalter die Landschaft des Südharzes prägte
(Verkarstung, Vulkanismus). Die Straße von Bad Sachsa nach Ellrich über Walkenried bietet
wunderschöne Einblicke in das permische Zeitalter (Steinbrüche (Führungen!), Walkenrieder
Rotliegendsande, Erdfälle etc.). Die Problematik des landschaftverzehrenden Gipsabbaus
muß hier ebenfalls zur Sprache gebracht werden. Weiterführende Aufschlußpunkte bieten sich
hier entweder als Hinweis auf den berühmten Karstwanderweg oder das Naturdenkmal
Felsentor in Neustadt. Weitere Beispiele sind denkbar wie der Periodische See von Roßla, die
Alabasterknollen in Questenberg oder der Rüdigsdorfer Schweiz.
9
2.3
,,Kleine Einführung in die Geologie des Harzes" für den Harzbesucher
(Kap. 2.3 ist ein Zusammenfassung des anschließenden Kapitels 3.0 und für den interessierten Laien gedacht, der
sich kurz und knapp über die Entstehungsgeschichte des Harzes informieren möchte. Die Verfasserin hat dieses
Kapitel mit in ihre Arbeit aufgenommen, da die Möglichkeit besteht, einen kurzen geologischen Führer Harz zu
entwickeln, der sich an interessierte Touristen wenden soll. Skizzen oder Photos zu Kap. 2.3 wären wünschenswert,
in der vorliegenden Arbeit wird darauf weitgehend verzichtet, da Kap. 3.0 reich bebildert und mit erklärenden Skizzen
versehen wurde.
Unterstrichene Fachwörter werden in alphabetischer Reihenfolge im Glossar im Anhang erläutert (das Glossar ist mit
dem Textteil in der PC-Version verknüpft und durch Anklicken sofort abrufbar).
Kap. 3.0 beschäftigt sich ausführlicher mit der Harzgeologie. Dort sind dann auch die geologischen Aufschlüsse zum
jeweiligen Event eingebunden. Kap. 2.3 und 3.0 sind jeweils als selbständige Einheiten zu betrachten.
Wiederholungen sind, da die Kap. 2.3 die Kurzfassung von Kap. 3.0 ist, nicht zu vermeiden.)
Der Harz ist das nördlichste deutsche Mittelgebirge. Seine Entstehung beginnt vor mehr als
450 Mio. Jahren im Erdzeitalter des Ordoviziums. Damals waren weite Teile Europas vom
Meer bedeckt. Auch das Gebiet des heutigen Harzes war Teil eines großen Ozeans, in
dessen Becken je nach Ablagerungsverhältnissen Sandsteine, Grauwacken, Tonschiefer und
Kalksteine abgelagert wurden. Tonschiefer werden als Tonschlämme in tiefen Stellen des
Ozeans abgelagert. Dort herrschen aufgrund der mangelnden Luftzufuhr und der geringen
Wasserbewegung sauerstoffarme Verhältnisse. Nur feinste Teilchen gelangen bis in diese
Tiefen, da größere Gesteinsbruchstücke aufgrund ihrer Schwere bereits früher am Rand von
Tiefbereichen zur Ablagerung kommen. Steigender Auflastdruck des überlagernden Materials
läßt diese Schlämme in Jahrmillionen zu Stein werden. Eigentlich heißt diese Gestein dann
korrekterweise Schieferton. Erst wenn dann noch der komplizierte Vorgang der Faltung und
einer leichten
Metamorphose
, d.h. eine erneute Umwandlung des festgewordenen Schlamms
einsetzt, wird von Tonschiefer gesprochen. Tonschiefer sind oft recht fossilreich, denn in der
sauerstoffarmen Umgebung (im euxinischen Milieu) bleiben hartschalige Überreste
verstorbener Lebewesen, die dahin abgesunken und zur Ablagerung gekommen waren, gut
erhalten, weil sie aufgrund der strömungsarmen und lebensfeindlichen Milieus nicht durch
andere Lebewesen zerstört werden.
Kalksteine dagegen können nur dort entstehen, wo das Meer Leben zuläßt, also in geringen
Tiefen und in strömungs- und sauerstoffreichem Wasser. Es gibt verschiedene Möglichkeiten
der Kalksteinentstehung, z.B. durch Lebewesen, die Kalkskelette tragen. Nach deren Tod
sammeln sich die kalkigen Überreste am Meeresboden an und versteinern. Ganze
Riffgemeinschaften (Korallen, Schwämme) können so zu Kalkgestein werden. Dafür gibt es im
Harz viele Beispiele (z.B. der Iberg und Elbingeröder Komplex).
Eine weitere, aber weitaus seltenere Möglichkeit ist die chemische Ausfällung. Die obersten
Meerwasserschichten sind generell mehrfach übersättigt an Kalziumkarbonat (CaCO
3
).
CaCO
3
liegt im Wasser normalerweise in gelöster Form vor. Bei steigender Konzentration der
Salzgehalte infolge ariden Klimas kann es zu Ausfällungen kommen, d.h. Kalk wird
ausgeschieden. Das heißt aber, es müssen rund 75 % der Wassermenge verdunsten, bevor
Karbonat ausfällt
2
.
Sandsteine entstehen aus Sanden, dem durch Flüsse und Bäche transportierten
Verwitterungsschutt von Gebirgsmaterial. Sie werden hauptsächlich in Küstennähe abgelagert
(Strände und Vorstrände). Die quarzreichen kleinen Körner verbacken zu hartem Gestein.
Grauwacken
sind ein besonderes Phänomen. Im Aussehen eher langweilig und unscheinbar
grau, erzählen sie jedoch eine ganze Menge. Der Begriff ,,Grauwacke" ist bergmännisch und
stammt sogar aus dem Harz (die ,,graue Wacke des Harzes"). Es gibt sie hier fast überall.
Es handelt sich aber dabei um ,,unreine" Sandsteine, denn zusätzlich enthalten sie einen
großen Anteil an gröberen Gesteinsbruchstücken. Diese sind meist eckig ausgebildet.
Grauwacken entstehen aus dem Abtragungsschutt gebirgsbildender Gesteinsmassen und
haben ein ausgedehntes Liefergebiet. Es sind mechanisch gebildete Sedimentgesteine von
Landoberflächen, die nur wenig transportiert wurden.
In Form von Trübeströmen (turbidity currents) sind sie dann vom Schelf in tiefe Meeresteile
abgeglitten. Zunächst lagerten sich dabei die gröberen Bestandteile ab, in den folgenden
2
Unter natürlichen Bedingungen kam bei den
Evaporit
becken der geologischen Vergangenheit noch der Umstand hinzu, daß in
den flachen Salinenbecken eine große Biomasse (Mikrobenmatten) vorhanden war. Deren Photosyntheseprodukte u.ä. konnten
Komplexe (stabile Verbindungen) mit Ca-Ionen bilden und so die Keimbildung, bzw. Ausfällung von Karbonat verhindern. Nach
SCHNEIDER
(1995) gibt es bisher keinen Nachweis für eine rein anorganische Ausfällung von Karbonat in normalem
Meerwasser.
10
Zeitabschnitten die feinen und feinsten Sedimentpartikel. In den einzelnen Bänken ist deshalb
eine Korngrößenabnahme von unten nach oben zu erkennen (,,B
OUMA
-Sequenz" oder ,,fining-
upward"), typ. Merkmal für
Turbidit
e. Die Hauptbildungszeit solcher Grauwacken fällt in das
Paläozoikum.
Im Harz entstanden sie im Zuge der Gebirgsbildung, die ihren Anfang im Oberdevon vor 370
Mio. Jahren nahm und ca. 60 Mio. Jahren andauerte. Im Dreieckschema wird die Einordnung
und Klassifikation der Grauwacken veranschaulicht:
Der Harz ist Teil des sog. Variszischen Gebirges, dessen Name sich von einem Volkstamm in
Nordbayern ableitet. Der Ozean, das Gebiet, in dem unser heutiger Harz liegt, wurde im
Verlauf des
Oberdevon
s und
Unterkarbon
s immer mehr eingeengt. Süd- und Nordküste
zweier großer Kontinente näherten sich immer weiter an. Der Ozeanboden kam in Bewegung,
Spalten bildeten sich, erste vulkanische Erscheinungen traten auf. Das heiße Magma gelang
an die Oberfläche des Meeresbodens, kühlte im kalten Wasser ab und zurück blieben
rundliche Gebilde, die als ,,
Pillowlaven
" (Kissenlava) bezeichnet werden. Aber auch Dämpfe
und wässrige Lösungen stiegen auf und es kam zu den ersten Vererzungen (Rammelsberg).
Erze sind metallhaltige Gesteine. Die Dämpfe und heißen Lösungen enthielten Metalle in
gelöster Form, die sich in den Spalten und Klüften, durch die sie sich einen Weg nach oben
bahnten, abschieden.
Im
Karbon
(354 290 Mio. Jahren) fand die eigentliche Gebirgsbildung statt. Nachdem sich
die Kontinentalränder immer weiter annäherten, eine Kontinentalplatte sich über die andere
schob, wurde der Ozeanboden nun auch noch versenkt und gefaltet. Dabei war er sehr
großen Drücken und hohen Temperaturen ausgesetzt (z.B. durch Reibung, Hitze aus dem
Erdinneren). Die Sedimente wurden dadurch ,,metamorph" überprägt, d.h. es kam zu erneuten
Veränderungen im bereits bestehenden Gestein. Neue Strukturen bildeten sich und aufgrund
von Mineralneubildungen im Gestein veränderte sich auch sein Aussehen in Farbe und
Körnigkeit.
Je nachdem, wie stark so eine Metamorphose auf seine Umgebung einwirkt, wird auch das
Gestein verschieden stark verändert. Manche metamorphisierten Gesteine ähneln ihrem
Ursprungsgestein in keinster Weise mehr, andere lassen wenigstens ansatzweise noch
Strukturen wie z.B. Schichtungen erkennen.
Als die Kontinente aufeinanderprallten, hoben sich auch die gefalteten Serien an und das
Gebirge türmte sich langsam auf. Wieder kam es zu Verfaltungen und bruch
tektonischen
Veränderungen. Gegen Ende der gebirgsbildenden Vorgänge drangen große Mengen Magma
in die gefalteten Gesteinsserien ein. Sie bilden heute das Brocken- und Rambergmassiv sowie
den Okergranit, wurden aber erst im Verlauf der Gebirgsabtragung (Erosion) freigelegt. Da ein
Gebirge nicht von einem auf den anderen Tag entsteht, ist es im gleichen Maße, wie es zur
Aufrichtung kam, der Verwitterung, also der Abtragung, unterworfen. Das Variszische Gebirge
Abb. 1 (aus Füchtbauer 1988)
Grau-
wacke
Quarz
Feldspat
Gesteinsbruchstücke
11
war bereits im darauffolgenden Zeitalter, dem
Perm
(290-248 Mio. Jahre) wieder fast völlig
eingeebnet. Das Klima im frühen Perm war wüstenhaft: trocken und heiß. Die
Rotliegendsande von Walkenried belegen dies.
Kontinentalverschiebung heißt der Mechanismus, durch den die Gipsfällung im Zechsteinmeer
erst möglich war. Im Perm lag, was dann Europa wurde, am Äquator. Trockenes, heißes
Klima brachte das Meerwasser zum Eindampfen, so wie im Toten Meer. In der heutigen
kühlen Nordsee wäre dies ganz unmöglich!
Nachdem die Gebirgsbildung abgeschlossen war, kam es im Untergrund zu Dehnungen in der
Erdkruste. Klingt unlogisch, ist aber leicht zu erklären. Durch die Vereinigung von Kontinental-
platten zu einem großen Kontinent (in diesem Fall bildete sich bis zum Perm der
Superkontinent Pangaea, d.h. alle damaligen Kontinente waren für kurze Zeit miteinander
verbunden) entsteht unter der Erdkruste ein enormer Hitzestau, der nicht nach oben
entweichen kann. Dieser Druck zerrt an Schwachstellen der großen Platte und versucht, einen
Weg zu finden, sich zu entlasten. Dies führt zu Spannungen und Dehnungen in der Erdkruste,
solange, bis diese auseinanderreißt und der Druck entweichen kann (vgl. den Versuch mit
Styroporplatten in einem Topf mit kochenden Wasser Kap. 3.7). So fand flüssiges
Gesteinsmaterial seinen Weg nach oben durch die sich ausdünnende Erdkruste und ergoß
sich an der Oberfläche. Der permische Vulkanismus war kurz, aber heftig. Der Ravensberg
von Bad Sachsa, der Kleine und der Große Knollen bei Bad Lauterberg entstanden in dieser
Zeit. Das Ilfelder Steinkohlerevier hatte ebenfalls seinen Ursprung im vulkanischen
Geschehen. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden die bestehenden Braunkohleflöze zu
Glanzkohle umgewandelt.
Die vulkanischen Phasen bildeten mitunter auch die Grundlage für die Bildung der
Erzlagerstätten im Südosten des Harzes (Wettelrode, Sangerhausen).
Dort wurde bis vor wenigen Jahren noch Kupferschiefer abgebaut.
Beim Kupferschiefer handelt es sich um ehemaliges Faulschlammsediment, das sich vor ca.
256 Mio. Jahren im Zechsteinmeer unter sauerstoffarmen Verhältnissen ablagerte. Im
Tiefenwasser und im Faulschlamm herrschten aus Mangel an Sauerstoff ,,reduzierende"
Bedingungen, Bakterien zersetzten die organischen Substanzen und produzierten
Schwefelwasserstoffgas, das die Eigenschaft hatte, zahlreiche im Wasser gelöste
Schwermetalle als Sulfide zu fällen. Besonders hohen Metallgehalt zeigt der Kupferschiefer in
ehemaligen Küstenbereichen, wo auf dem Festland vulkanisches Gesteinsmaterial aus dem
frühen Perm verwitterte und relativ metallreiche Flußwässer ins Meer gelangten.
Wie bereits angedeutet, kam es im Perm trotz des wüstenhaften Klimas immer wieder zu
Meeresvorstößen aus dem Norden, aus einem Gebiet nördlich von Grönland. Dieses Meer
war jedoch nicht besonders tief, aber aufgrund der hohen Verdunstungsrate sehr salzhaltig.
Es überflutete Norddeutschland, die heutige Nordsee und Ostgrönland. Seine südlichen
Ausläufer reichten bis zum unteren Neckar, zum Thüringischen Schiefergebirge, Erzgebirge
und den Sudeten.
Gipse und andere Salze wurden ausgeschieden und sammelten sich als Schlamm am
Meeresboden an. Mächtige Schichtfolgen bildeten sich, die heute noch die Landschaft des
Südharzes prägen.
Bewegung kam erst vor 180 Mio. Jahren, im
Jura
, wieder in das Gebiet des heutigen Harzes.
Bis dahin blieb der Harz Flachmeergebiet und die permische Landoberfläche war bereits
wieder mit großen Mengen an Sedimentabfolgen überdeckt worden.
Die erneute Hebungsphase dauerte bis in die Oberkreide vor 95 Mio. Jahren und erfolgte nicht
überall zur gleichen Zeit. Nach neuesten Untersuchungen wurde zuerst der Harzer Nordrand
im Osten angehoben, erst wenig später im Bereich um Goslar. Insgesamt kam es zu einem
Versatz um fast 3000 m. Mit der Aufrichtung des Harzer Nordrandes kam es ebenfalls wieder
zum Aufstieg heißer Lösungen. Ihnen verdanken wir die Entstehung der Ober- und
Mittelharzer Gangzüge. Unter der Harz-Nordrand-Störung verstehen wir also eine komplizierte
Bruchzone, an der die Deckschichten des Harzes aufgefaltet wurden und sich gleichzeitig eine
starke Absenkung des bereits bestehenden Beckens im Harzvorland entwickelte
(Subhercynes Becken).
Da der Harz im Norden so steil herausgehoben wurde und mit wenigen Grad nach Südwesten
einfällt, spricht man auch von einer Pultscholle.
12
Das
Känozoikum
(Tertiär bis heute) prägte die Landschaftsformen des heutigen Harzes.
Das feuchtwarme Klima führte zu einer sehr starken Verwitterung der Granite und zur
Verkarstung des Südharz-Gipses mit all seinen spektakulären Erscheinungsformen.
Karstlandschaften im Sulfatgestein sind sehr selten.
Der Südharzkarst ist bewaldet und von Weiden und Äckern bedeckt. Das unterscheidet ihn
von vielen Karstgebieten der Erde, die durch die Überweidung oft durch vegetationslose oder
karge Flächen auffallen (Jugoslawien, Irland).
Im
Pleistozän
während der Eiszeiten kam es zu einer intensiven Talbildung (Okertal, Odertal,
etc.). Besonders der Ostharz war von Vergletscherungen betroffen. In den Kaltzeiten gingen
die Täler teilweise im Schutt unter, in den Warmzeiten prägten Erdfälle und Dolinen das
Landschaftsbild mit.
13
3.0
Die Geologie des Harzes als ,,Zeitreise"
(Die Verfasserin ist keine ,,Einheimische" und mußte sich erst in mühevoller Detailarbeit mit den geographischen und
geologischen Besonderheiten des Harzes vertraut machen. Sich einen strukturellen und geologischen Überblick über
den Harz zu verschaffen, ist trotz der Vielfalt der vorhandenen Harzliteratur - und vielleicht auch gerade deshalb -
recht schwierig. Der Verfasserin ist kein Werk bekannt, in dem der Harz in seiner geologischen Gesamtheit unter
Berücksichtigung der zeitlichen Einordnung (von seiner Entstehung bis heute) abhandelt wird. Kap. 3.0 entstand, weil
sich die Verfasserin ein Bild über die geologische Geschichte des Harzes unter Einbindung der regionalgeologischen
Strukturen verschaffen wollte und mußte, um ihre eigentliche Aufgabe, die Suche nach Geologischen Lehrpfaden und
ihrer Bewertung, optimal lösen zu können.)
3.1 Überblick
Die geologische Geschichte des Harzes, das am nördlichsten gelegenen Mittelgebirge
Deutschlands, reicht fast nahtlos bis ins mittlere Ordovizium, d.h. ca. 470 Mio. Jahre weit
zurück. Einzig die Eckergneisscholle ist noch ein wesentliches Stück älter.
Unglücklicherweise wurde der Harz durch die innerdeutsche Grenze jahrelang in 2 Hälften
geteilt, so daß eine einheitliche Forschung erschwert und teilweise unmöglich war. Die
Grenzziehung erfolgte an einer Linie entlang Walkenried über Hohegeiß - Braunlage bis
östlich von Bad Harzburg. Seit der Einheit im Jahre 1989 aber wird der Harz in seiner
geologischen Gesamtheit erforscht.
Der Harz gilt geologisch als direkte nordöstliche Fortsetzung des Rheinischen
Schiefergebirges im Westen Deutschlands.
Morphologisch
stellt er eine nach SW gekippte,
ca. 90 km lange und 30 km breite Pultscholle dar, die an ihrem Nordostrand steil aus
mesozoischem
Deckgebirge aufsteigt und auf das Harzvorland überschoben wurde, an der
Südseite taucht sie flach unter permische Deckschichten ab. Unterschiede zum Rheinischen
Schiefergebirge sind zum einen das freigelegte
magmatische
Tiefengestein (Brockengranit,
Rambergpluton) sowie eiszeitliche Spuren von Vergletscherungen.
Der innere Aufbau des Harzes wird durch erzgebirgisch
streichende
Bauelemente
gekennzeichnet (SW-NE), während seine äußere Form
hercynische Streichrichtung
aufweist
(WNW-ESE).
Durch die typischen erzgebirgischen streichenden Elemente der Wippraer Zone, des Tanner
Zuges und des Acker-Bruchberg-Zuges läßt sich der Harz in drei Großbereiche gliedern: dem
Ober-, Mittel- und Unterharz.
Der Oberharz umfaßt den Oberharzer Devonsattel, die Clausthaler Kulmfaltenzone, den
Oberharzer Diabaszug, die Sösemulde und den Acker-Bruchberg-Zug sowie Teile des
Brocken-Massivs. Zum Mittelharz gehören die Sieber-Mulde, Teile des Brocken-Massivs,
die Blankenburger Zone mit Ramberg-Pluton, der Elbingröder Komplex und die Tanner Zone.
er südöstlich sich anschließende Unterharz besteht aus der Harzgeröder Zone, der
Südharz- und der Selke-,,Mulde" und der Wippraer Zone. Südharz- und Selke-,,Mulde" sind
nach heutiger Sicht Relikte eine aus dem Bereich der Wippraer Zone stammenden
Ostharzdecke (W
ALTER
1995).
Die
jungtertiären
Rumpfflächen des Harzes erreichen im Oberharz bis 1142 m ü.NN
(Brocken), im Mittel und Unterharz zwischen 300 und 600 m ü. NN. Damit überragt der Harz
das Rheinische Schiefergebirge um ca. 200 m.
14
Abb.2: Die geologisch-strukturellen Einheiten des Harzes
15
3.1.1 Einflüsse des Klimas
Die feuchtwarmen Bedingungen im Tertiär bedingten eine hohe Niederschlagsrate. Die
Verwitterung der Gesteine ging schnell voran, das verwitterte Material wurde durch die
wasserreichen Flüsse schnell abtransportiert. Diese erosiven Vorgänge führten zur Anlage
breiter, ausladender Täler, sog. Flachmuldentälern.
Für die heutige Oberflächenform des Harzes sind vor allem die letzten Vereisungszeiten sehr
entscheidend gewesen. Die extremen Klimaschwankungen führten zu einer
Härtlingslandschaft.
Im Hochharz waren im Pleistozän weite Bereiche von Dauerfrostböden eingenommen. Das
typische Auftauen der oberen Bodenschichten führte schon bei geringem Gefälle zu
Solifluktion (,,Bodenfließen"). Der aufgetaute Boden rutschte auf dem noch gefrorenen
Untergrund ab. Dabei wurden oft zentnerschwere Gesteinsbrocken mittransportiert und es
entstanden weit verbreitete Schutt- und Blockhalden. Deren Material kam vor allem aber auch
durch die Frostverwitterung zustande, denn sie sprengte die Gesteine durch das Gefrieren
des in die Spalten eingedrungenen Wassers.
Die bizarren Felsen und Klippen im Brockengebiet sind ebenfalls das Ergebnis tertiärer und
pleistozäner Klimabedingungen. Der durch das feuchtwarme Klima im Tertiär angewitterte
Granit bildete Spalten aus, in die nun der Frost eindrang und das Material unter der
Oberfläche auseinandersprengte (physikalische Verwitterung). Die auseinandergesprengten
Gesteinsblöcke wurden durch die weitere Verwitterung abgerundet. Es kam zur Ausbildung
der vom Granit bekannten ,,Wollsackformen".
Der Harz stellt in klimatischer Hinsicht auch heute noch eine Besonderheit dar. Darauf wird
vor allem unter dem Kapitel ,,Talsperren" noch näher eingegangen.
3.2
Präkambrium
Die Erde entstand vor ca. 4,6 Milliarden Jahren. Das Präkambrium stellt jenen Zeitabschnitt
dar, der von der Entstehung der Erde bis zur Entwicklung erster hartschaliger Lebewesen an
der Basis des Kambriums vor ca. 570 Mio. Jahren reicht
3
.
Als eines der ältesten Gesteinskomplexe des Harzes gilt der Eckergneis, der südlich von Bad
Harzburg zwischen dem Harzburger
Gabbro
im Westen und den Graniten des
Brockengebietes im Osten gelegen an der Eckertalsperre aufgeschlossen ist.
Interpretiert wird er als ein vom Brockenpluton kontaktmetamorph überprägter cadomischer
Gneis (
Cadomische Orogenese
, d.h. Gebirgsbildung, zur Wende Präkambrium-Kambrium vor
ca. 570 Mio. Jahren)
sedimentären
Ursprungs, der aus dem tieferen Untergrund mitgeschleppt
wurde.
Als Gneise werden Gesteine bezeichnet, die unter starker Auflast und Bewegungen, also
durch Druck und Hitze umgewandelt wurden (Metamorphose). Da die Metamorphose hier ein
großes Gebiet erfaßte und durch tiefe Versenkung und starke tektonische Kräfte in der Erde
verursacht wurde, spricht man auch von Regionalmetamorphose.
Zusätzlich zur Regionalmetamorphose ist der Eckergneis, der vermutlich vom Granitmagma
aus der Tiefe mitgeschleppt wurde, durch Hitzeeinwirkung am Kontakt zu diesem stark
umgewandelt worden (Kontaktmetamorphose). Untersuchungen am Gneis ergaben ein
Hauptmetamorphosealter von 500-600 Mio. Jahren (
U-Pb-Datierung
an Zirkonen), das der
Kontaktmetamorphose konnte anhand von Messungen im
Titanit
auf 290 Mio. Jahre
festgesetzt werden (W
ALTER
1995).
Der 6 km lange und ca. 2 km breite Eckergneiskomplex soll bei Temperaturen von 580 bis
770°C und Drücken um die 6 kbar entstanden sein. Typisch für den Gneis ist seine lagige
Textur
; feldspat- und quarzreiche Lagen wechseln mit glimmerreichen Lagen (Biotit-Cordierit-
Schieferhornfels). Charakteristisch sind seine cm-dm großen Falten. Der Eckergneis ist mittel-
bis grobkörnig und grau (M
OHR
1989).
Wahrscheinlich bildete der Eckergneis das primäre Dach des Gabbros, er fällt als flache Platte
unter dem Brockengranit nach Osten ein.
Eine Übersicht über den aktuellen Stand der Eckergneisforschung ist bei F
RANZKE
(1996)
nachzulesen.
3
s. auch Zeittafel im Anhang
16
Zusammenfassung: Die Entstehung des Eckergneises
An der Wende Präkambrium Kambrium kam es zur Gebirgsbildung. Sedimentäres Gestein wurde versenkt und
durch den enormen Druck und der Temperaturänderung, die durch die Faltung erfolgten, zu Gneis umgewandelt. In
den Millionen Jahren danach wurde dieses Gebirge wieder abgetragen, Meer überdeckte bis ins Karbon (355 290
Mio. Jahre) Mitteleuropa, neue, mächtige Sedimente wurden abgelagert. Was jetzt noch vom damaligen Gebirge
übrig war, lag tief unter der Erdoberfläche vergraben. Beim Aufstieg des Magmas im Oberkarbon, also zum Zeitpunkt
der Entstehung des Brockenplutons, wurde die alte Gneisscholle mit nach oben gerissen und vor allem durch die
erneute Hitzeeinwirkung nochmals metamorph überprägt. Das Entstehungsalter des Ursprungsgestein kann nicht
mehr festgestellt werden, wohl aber das Hauptmetamorphosealter, also der Zeitpunkt, als das Sedimentgestein zum
ersten Mal metamorphisiert wurde. Und das konnte anhand feinst verteilter Zirkone (ein bei der Metamorphose
entstehendes Mineral) auf 500-600 Mio. Jahre datiert werden.
Abb.3: Regional- und Kontaktmetamorphose (P
RESS
&
SIEVER
1995)
(a) Regionalmetamorphose
(b) Kontaktmetamorphose
Schichtung
(Schieferton u.a.)
Transversal-
schieferung
(Tonschiefer)
Kristalline
Schieferung
Bänderung
(Gneis)
Zunahme der Kristallgröße
---------------------------------
Zunehmender Abstand der
Schieferungsflächen
---------------------------------
Abb. 4: Klassifikation geschieferter Gesteine (P
RESS
& S
IEVER
1995)
17
3.3 Ordovizium
Vom Ordovizium bis ins Karbon nahm ein weiter Ozean das Gebiet des heutigen
Mitteleuropas ein. Durch Hebungs- und Senkungsbewegungen der Erdkruste entwickelten
sich zahlreiche - durch Schwellenregionen - getrennte Becken, in die hinein über Jahrmillionen
gewaltige Massen von Sedimenten geschüttet wurden.
Vor 510 Mio. Jahren gehörten Teile des nördlichen Mitteleuropas zu Baltica, einem relativ
kleinen Kontinent. Baltica driftete damals vom Südpol in Richtung Norden und erreichte im
Mittelsilur, also ca. 90 Mio. Jahre später, den Äquator. Das Klima im Ordovizium war für das
Gebiet um den heutigen Harz entweder gemäßigt oder subtropisch, das Meer nicht besonders
tief.
Abb.5: Lage der Festlandsmassen im mittleren
Ordovizium (S
TANLEY
1994)
Abb.6:
Bewegung von ,,Baltica"
während des
Ordoviziums nach
Norden. Die Karte zeigt
die Paläogeographie
des mittleren
Ordoviziums; der
schwarze Pfeil deutet in
die Richtung, in der
Baltica, Süd-Irland und
England während des
oberen Ordoviziums
drifteten.
Die vergrößerte
Darstellung des
Ostseegebietes zeigt
die ausgedehnte
Verbreitung von
marinem Kalkstein in
diesem Gebiet während
des mittleren
Ordoviziums.(S
TANLEY
1994)
18
Die Zone von Wippra im äußersten Südosten des Harzes beherbergt sieht man vom
Eckergneis einmal ab - die ältesten Gesteine des Harzes. Dabei handelt es sich überwiegend
um
Grünschiefer
,
Metagrauwacken
und
Metakieselschiefer
, also durchweg Gesteine, die einer
relativ schwachen P-/T-Metamorphose (P= Druck, T= Temperatur) unterlagen und deren
originäre (ursprüngliche) Strukturen somit noch erkennbar sind. Biostratigraphisch konnte dort
Phytoplankton (gr.
Pflanze, das Umhergetriebene) aus dem Llanvirn
(Mittleres Ordovizium) nachgewiesen werden.
Exkurs in die Plattentektonik:
Wenn wir unsere Zeitreise im Ordovizium beginnen, müssen wir uns bewußt sein, daß die Kontinente und deren
Lage, wie wir sie heute gewohnt sind, damals so noch nicht existierten. Der obere Teil der Erde (Erdkruste und der
obere Teil des Oberen Mantels) setzt sich aus Platten zusammen, die auf dem zähflüssigen Teil darunter
,,schwimmen". Dabei driften sie in die unterschiedlichsten Richtungen, stoßen zusammen, tauchen unter einer
anderen Platte ab und verschwinden oder entstehen an anderer Stelle neu. Beim Zusammenprall zweier Platten
kommt es zu Gebirgsbildungen. Bewegen sich Platten voneinander weg, so kommt es zu Dehnungen in der
Erdkruste. Sie dünnt aus, und neues, flüssiges Gesteinsmaterial sucht sich seinen Weg an diesen Schwachstellen
nach oben. Oft sind Ozeanböden solche ,,Spreizungszentren", da hier die Erdkruste besonders dünn ist. Amerika und
Europa entfernen sich jährlich um ca. 1-2 cm, da der Atlantik sich noch immer ausdehnt. Am Ozeanischen Rücken
entsteht ständig neuer Ozeanboden; dieser Vorgang vergrößert den Atlantischen Ozean.
Abb.7: Einordnung der Grünschieferfazies
innerhalb der metamorphen Fazieseinheiten
(P
RESS
&
SIEVER
1995)
Abb.8: Die Lithosphäre (die äußerste Schale der Erde)
ist eine starre, feste Schicht, die aus der Kruste und
den äußeren Bereichen des Mantels besteht. Sie
schwimmt auf dem plastischen, teilweise
geschmolzenen Bereich des Erdmantels, der
Asthenosphäre genannt wird (P
RESS
&
SIEVER
1995)
Abb.9:
Die Plattenbewegung von
einer divergierenden hin
zu einer konvergierenden
Grenze. Dargestellt sind
die damit verbundenen
geologischen
Erscheinungen. Die
Lithospäre wächst im
Bereich der
Spreizungszone, wobei
das Seafloor-Spreading
mit Vulkanismus und
Erdbeben einhergeht. An
den konvergierenden
Grenzen kommt es
ebenfalls zu geologischen
Prozessen, die mit dem
Entstehen und Aufsteigen
von Magma verknüpft
sind: Plutonismus,
Vulkanismus,
Gebirgsbildung,
Entstehung von Tiefsee-
rinnen und Erdbeben.
(P
RESS
&
SIEVER
1995)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832458683
- ISBN (Paperback)
- 9783838658681
- DOI
- 10.3239/9783832458683
- Dateigröße
- 14.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2002 (September)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- harz geopfade geopark geotouristik bergbau
- Produktsicherheit
- Diplom.de