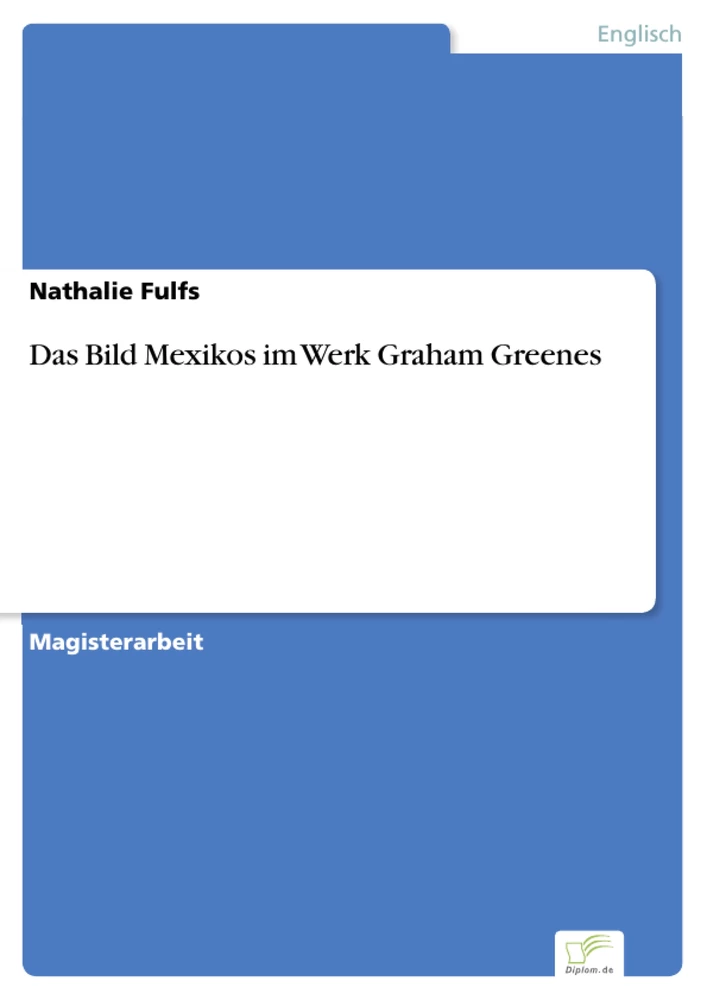Zusammenfassung
Diese Arbeit untersucht das Bild Mexikos im Werk Graham Greenes anhand seiner journalistischen Essays und Kurzgeschichten, seines Reiseberichts The Lawless Roads (1939) und des Romans The Power and the Glory (1940).
Obwohl die Relation zwischen den großepischen Werken hinsichtlich der Quellenfunktion des Reiseberichts für den Roman eine bereits von der Literaturwissenschaft vielfach diskutierte und in den Ergebnissen redundante Fragestellung darstellt, bemühen sich nur wenige Forschungsarbeiten um eine umfangreichere Analyse der Darstellung Mexikos und berücksichtigen selten Greenes gesamten mexikanischen Textkorpus. Dieser Tendenz versucht diese Arbeit entgegenzuwirken, indem der Reisebericht vor allem wegen des Milieus und der historischen Argumentation sowie der autobiographischen Bedeutung berücksichtigt wird, während der Roman auf einer symbolischen Ebene die Transformation dieser Reiseeindrücke darstellt. Aufgrund der Essays und Kurzgeschichten wird eine eindeutige Aussage über Greenes Darstellung des mexikanischen Landes erwartet.
Diese Arbeit unterstützt den von der jüngeren Literaturwissenschaft verfolgten mehrdimensionalen Interpretationsansatz und strebt an, diesen hinsichtlich der Mexikothematik zu konkretisieren. Graham Greene wird zu Recht als ein bedeutender katholischer Schriftsteller bezeichnet, der in seinen großen Romanen, zu denen auch das in dieser Arbeit berücksichtigte Werk zu zählen ist, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Dogmen und der katholischen Frömmigkeit verfolgt. Der zunehmende Abstand von der religiös dominierten Deutung des Werkes ist dennoch als zweckmäßig zu erachten, da bereits in der mexikanischen Thematik religiöse und politische Aspekte miteinander verflochten sind. Gerade hinsichtlich der expliziten Fragestellung dieser Arbeit erweist sich ein ausschließlich religiöser Deutungsansatz als zu restriktiv und könnte nur einen Teil des mexikanischen Gesamtbildes berücksichtigen. Diese Arbeit wird zeigen, daß sich Greene neben religiösen Fragestellungen auch mit anderen gesellschaftlichen Themen konfrontiert sah und die eindimensionale Interpretation Greenes Ideologie mißachtet.
Darüber hinaus wird diese Arbeit beweisen, daß Greenes Mexikobild sehr stark selbstprojektiv verzerrt ist. Mit dieser Selbstprojektion ist gemeint, inwiefern der Schriftsteller die äußeren Umstände der Reise auf seine eigene Vor- und Einstellung bezieht und wie er so die Umgebung ordnet und bewertet. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einführung in den Untersuchungsgegenstand
1.1 Problemstellung
1.2 Gang der Untersuchung
1.3 Einordnung innerhalb der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre
1.4 Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes
2 Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre
2.1 Entscheidungstheoretische Ansätze
2.1.1 Begriff der Entscheidungstheorie
2.1.2 Klassifizierung der Entscheidungstheorie
2.1.3 Betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie
2.2 Betrieblicher Entscheidungsvorgang
2.2.1 Deskriptiver Ansatz als Grundüberlegung
2.2.2 Ablauf des betrieblichen Entscheidungsprozesses
2.3 Grundmodell der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre
2.3.1 Grundlagen der Modellbildung
2.3.2 Aufbau und Wirkungsweise des Grundmodells
2.3.3 Elemente des Grundmodells
2.3.3.1 Entscheidungsträger
2.3.3.2 Zielsystem
2.3.3.2.1 Zielklassifizierungen
2.3.3.2.2 Präferenzen
2.3.3.2.3 Entscheidungsregeln
2.3.3.3 Entscheidungsfeld
2.3.3.3.1 Handlungsalternativen
2.3.3.3.2 Umweltzustände
2.3.3.3.3 Ergebnisfunktion
2.3.3.4 Ergebnismatrix
2.3.3.5 Entscheidungsmatrix
2.3.4 Andere Darstellungsformen
3 Entwicklung eines steueroptimalen Entscheidungsmodells
3.1 Zusätzliche Prämissen des Modellansatzes
3.2 Personengesellschaft als Entscheidungsträger
3.2.1 Begriff der Personengesellschaft und des Gesamthandsvermögens
3.2.2 Personengesellschaft im Steuerrecht
3.3 Zielsystem der Personengesellschaft
3.3.1 Ziele der Personengesellschaft
3.3.2 Zielbeziehungen und Präferenzen
3.3.3 Nutzenzuweisung durch Entscheidungsregeln
3.4 Entscheidungsfeld der Personengesellschaft
3.4.1 Teilungsvorgänge als Handlungsalternativen
3.4.1.1 Spaltung
3.4.1.1.1 Umwandlungsrechtliche Spaltungsarten
3.4.1.1.2 Formen der Spaltung
3.4.1.2 Realteilung unter gleichzeitiger Auflösung der Personengesellschaft
3.4.1.2.1 Definition der Realteilung
3.4.1.2.2 Formen der Realteilung
3.4.1.3 Gesellschafteraustritt mit Sachwertabfindung
3.4.1.4 Sonstige Vermögensübertragungen
3.4.1.5 Zwischenfazit nach Abgrenzung der Teilungsvorgänge
3.4.2 Bestimmung der Umweltsituation
3.4.3 Unternehmenspolitische Ergebnisfunktion
3.4.4 Steuerliche Ergebnisfunktion
3.4.4.1 Auswahl der steuerlichen Ergebniskriterien
3.4.4.1.1 Wertansatz des zu teilenden Vermögens
3.4.4.1.2 Einkommensteuerliche Folgen
3.4.4.1.3 Gewerbesteuerliche Folgen
3.4.4.2 Steuerliche Konsequenzen der Spaltungsvorgänge
3.4.4.2.1 Grundsätzliche steuerliche Behandlung
3.4.4.2.2 Wertansatzwahlrecht der aufnehmenden Gesellschaft
3.4.4.2.3 Steuerfolgen der Spaltungen auf Personengesellschaften
3.4.4.2.3.1 Einkommensteuerliche Behandlung bei Übertragung von Teilbetrieben, Mitunternehmer- und Kapitalgesellschaftsanteilen
3.4.4.2.3.2 Einkommensteuerliche Behandlung bei Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern
3.4.4.2.3.3 Gewerbesteuerliche Behandlung
3.4.4.2.4 Steuerfolgen der Spaltung auf Kapitalgesellschaften
3.4.4.2.4.1 Einkommensteuerliche Behandlung bei Übertragung von Teilbetrieben und Mitunternehmeranteilen
3.4.4.2.4.2 Einkommensteuerliche Behandlung bei Übertragung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
3.4.4.2.4.3 Einkommensteuerliche Behandlung bei Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern
3.4.4.2.4.4 Gewerbesteuerliche Behandlung
3.4.4.3 Steuerliche Folgen der Realteilung
3.4.4.3.1 Einkommensteuerliche Behandlung der Realteilung
3.4.4.3.1.1 Überführung ins Privatvermögen
3.4.4.3.1.2 Übertragung in Einzelunternehmen oder Sonderbetriebsvermögen
3.4.4.3.1.3 Übertragung auf Personengesellschaften
3.4.4.3.1.4 Übertragung auf Kapitalgesellschaften
3.4.4.3.2 Gewerbesteuerliche Behandlung der Realteilung
3.4.4.3.3 Besonderheiten beim Spitzenausgleich
3.4.4.4 Steuerliche Behandlung des Gesellschafteraustritts
3.4.4.4.1 Einkommensteuerfolgen der Sachwertabfindung
3.4.4.4.1.1 Übertragung ins Privatvermögen
3.4.4.4.1.2 Übertragung in Einzelunternehmen oder Sonderbetriebsvermögen
3.4.4.4.1.3 Übertragung in Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften
3.4.4.4.2 Gewerbesteuerfolgen der Sachwertabfindung
3.4.4.5 Steuerliche Auswirkungen der Vermögensübertragungen
3.5 Darstellung der unternehmenspolitischen und steuerlichen Folgen in Ergebnismatrizen
3.6 Bestimmung der steueroptimalen Alternative
4 Praktische Anwendung des Entscheidungsmodells
4.1 Grundsätzliche Anwendbarkeit des Modells
4.2 Anwendung auf ausgewählte Beispielsfälle
4.2.1 Beispiel
4.2.2 Beispiel
4.2.3 Beispiel
4.2.4 Beispiel
5 Zusammenfassende Würdigung
Literaturverzeichnis
Rechtsquellenverzeichnis
Rechtsprechungsverzeichnis
Verwaltungsvorschriftenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Phasen des psychologischen Entscheidungsprozesses
Abbildung 2: Phasen der Wertanalyse
Abbildung 3: Betrieblicher Entscheidungsprozess
Abbildung 4: Aufbauschema des Grundmodells
Abbildung 5: Beispiel eines Flussdiagramms
Abbildung 6: Beispiel eines Entscheidungsbaumes
Abbildung 7: Ziele der Personengesellschaft
Abbildung 8: Nutzenzuweisung durch Entscheidungsregel
Abbildung 9: Nutzenzuweisung durch Entscheidungsregel
Abbildung 10: Spaltungen auf Personengesellschaften
Abbildung 11: Spaltungen auf Kapitalgesellschaften
Abbildung 12: Realteilungsformen
Abbildung 13: Formen der Sachwertabfindung
Abbildung 14: Sonstige Teilbetriebsübertragungen
Abbildung 15: Flussdiagramm zur Alternativeneliminierung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Ergebnismatrix bei einer Zielgröße
Tabelle 2: Beispiel einer Entscheidungstabelle
Tabelle 3: Buchwertübertragungen mit Einzelwirtschaftsgütern
Tabelle 4: Ergebnismatrix für unternehmenspolitische Zielaspekte
Tabelle 5: Ergebnismatrix für steuerliche Zielaspekte
Tabelle 6: Entscheidungsmatrix zur Bestimmung der steueroptimalen Alternative
Tabelle 7: Auseinandersetzungsbilanz der ABC-OHG
Tabelle 8: Bemessungsgrundlagen für A, B und C
Tabelle 9: Bilanz der BC-GbR in den Realteilungsfällen
Tabelle 10: Bilanz der BC-OHG nach der Sachwertabfindung
Tabelle 11: Auseinandersetzungsbilanz der DEF-OHG
Tabelle 12: Auseinandersetzungsbilanz GHIJ-OHG
Tabelle 13: Rechtsformneutrale Übernahmebilanzen
Tabelle 14: Rechtsformvergleich
Tabelle 15: Auseinandersetzungsbilanz KLM-OHG
Tabelle 16: Bilanzen nach der Abspaltung
1 Einführung in den Untersuchungsgegenstand
1.1 Problemstellung
Unabhängig von ihrem unternehmerischen Erfolg kann es bei einer Personengesellschaft irgendwann zu der Situation kommen, dass ihre Gesellschafter das bestehende Gesellschaftsvermögen nicht mehr in der bisherigen Zusammensetzung betrieblich fortführen wollen. Wenn zusätzlich der Wunsch besteht, dass das Vermögen nicht an außenstehende dritte Personen veräußert wird, sondern im Besitz einzelner, mehrerer oder aller Gesellschafter verbleibt, müssen sich die Gesellschafter für eine der vielen Möglichkeiten zur Teilung des Vermögens entscheiden. Hierbei sind sowohl Aufteilungen des Vermögens unter den Gesellschaftern als auch Vermögensverteilungen auf verschiedene Gesellschaften in unterschiedlichen Ausgestaltungen denkbar.
Für die Beantwortung der Frage, wie die Gesellschafter das Problem der Entscheidung für die richtige von vielen möglichen Teilungsalternativen lösen, ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Hintergründen und den Zielen eines solchen Teilungsvorhabens notwendig. Der Wunsch nach einer Teilung des Gesellschaftsvermögens kann vor allem im Hinblick auf gesellschafts- oder zivilrechtliche sowie betriebswirtschaftliche Aspekte entstehen. Auch private Umstände im persönlichen Umfeld der Gesellschafter sind eine mögliche Ursache.
Demgegenüber stellen steuerliche Gründe nur sehr selten den Auslöser für den Wunsch nach einer Teilung des bestehenden Gesellschaftsvermögens dar. Da die verschiedenen Teilungsvorgänge jedoch sehr unterschiedliche steuerliche Auswirkungen und hierdurch entstehende Belastungen für die Finanz- und Liquiditätslage der Gesellschaft verursachen, üben die Art und der Umfang der steuerlichen Behandlung der Teilung einen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidung aus, in welcher zivil-, gesellschafts- bzw. umwandlungsrechtlichen Form die Teilung durchgeführt werden soll. Insofern kommt der Zusammenstellung der steuerlichen Folgen jeder einzelnen Teilungsalternative eine wichtige Bedeutung zu.
In der vorliegenden Arbeit soll die Lösung des Problems der Gesellschafter, sich für die aus ihrer Sicht optimale Teilungsform zu entscheiden, methodisch erarbeitet werden. Hierbei wird das Ziel der steueroptimalen Gestaltung der Teilung mit anderen unternehmerischen Zielen verknüpft. Einen derartig umfassenden Vergleich verschiedener Teilungsvorgänge unter Berücksichtigung mehrerer Zielsetzungen mit den Standardmethoden der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre zu erstellen, bereitet erhebliche Schwierigkeiten. Die betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre bietet jedoch die Möglichkeit, die dargestellte Ausgangsproblematik in einem Entscheidungsmodell abzubilden. Daher soll ein Modell entwickelt werden, das nicht nur die steueroptimale Lösung der Teilungsproblematik liefern, sondern darüber hinaus auch außersteuerliche Zielsetzungen berücksichtigen und somit ein gesamtes betriebswirtschaftliches Entscheidungsproblem bewältigen kann.
1.2 Gang der Untersuchung
Die vorliegende Arbeit ist in fünf Abschnitte unterteilt und wie nachfolgend beschrieben aufgebaut.
Zunächst wird der Untersuchungsgegenstand im dritten und vierten Unterabschnitt der Einführung innerhalb der verschiedenen Aufgabenbereiche der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre eingeordnet und durch Abgrenzungen zu verwandten Tatbeständen konkretisiert.
Anschließend erfolgt im zweiten Abschnitt eine Beschreibung der Grundlagen der Betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre, da diese üblicherweise nicht zum Basiswissen der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre zu zählen sind. Die Beschreibung beschränkt sich auf einige allgemeine Grundsätze sowie auf die Darstellung des Aufbaus und der Wirkungsweise des Grundmodells der normativen betriebswirtschaftlichen Entscheidungstheorie, da dieses Modell das Fundament der darauf folgenden Abschnitte bildet.
Der dritte Abschnitt stellt den Kernbereich dieser Untersuchung dar. In ihm soll gezeigt werden, wie auf der Basis des allgemeinen entscheidungstheoretischen Grundmodells ein spezielles Entscheidungsmodell entwickelt werden kann, das in der Lage ist, Lösungsansätze für die eingangs geschilderte Problematik zu liefern. Hierbei werden die Besonderheiten der Ausgangssituation auf sämtliche Modellelemente übertragen, so dass eine enge konzeptionelle Verknüpfung zum zweiten Abschnitt besteht. Eine besondere Stellung nimmt die Darstellung des Entscheidungsfeldes der Personengesellschaft ein. Dezidiert werden die einzelnen Teilungsvorgänge und insbesondere ihre unterschiedlichen steuerlichen Folgen untersucht und voneinander abgegrenzt. Hierbei kann nicht in sämtlichen steuerrechtlichen Problembereichen auf einen durch übereinstimmende Steuergesetzgebung, Finanzrechtsprechung, Verwaltungsauffassung und Literaturmeinungen gesicherten Rechtsstand zurückgegriffen werden. Dennoch entsteht ein komplettes Entscheidungsmodell, das Lösungen für die Ausgangsproblematik liefern kann.
Im vierten Abschnitt soll die Anwendbarkeit und Handhabung des Entscheidungsmodells anhand von ausgewählten Zahlenbeispielen veranschaulicht werden. Die vier ausführlich geschilderten Beispielsfälle zeigen, wie das komplexe Modell praktische Problemstellungen lösen kann und welche Modifikationen bzw. Erweiterungen des Modells hierfür hilfreich sind.
Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Würdigung, in der die wichtigsten Ergebnisse und die daraus gewonnenen Erkenntnisse der Untersuchung dargestellt werden.
1.3 Einordnung innerhalb der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre
Zunächst ist festzuhalten, dass der vorliegende Untersuchungsgegenstand dem Bereich der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre zugeordnet werden muss, da ein betriebliches Entscheidungsproblem vorliegt, das im Wesentlichen von steuerlichen Einflüssen geprägt wird.
Die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre beschäftigt sich grundsätzlich mit den durch die Besteuerung hervorgerufenen mikroökonomischen Auswirkungen auf das betriebliche Geschehen. Rechtsvorschriften und Gerichtsurteile betrachtet sie dabei als fest stehende Daten, deren Interpretation sie der Steuerrechtswissenschaft überlässt.[1] Hinsichtlich ihrer Hauptaufgaben und Teilbereiche lässt sich die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre weiter untergliedern. Hierbei sind die folgenden vier Teilgebiete besonders hervorzuheben.
Die Grundlage aller Untersuchungen bildet die Steuernormenlehre, welche die für weitere Analysen benötigten Kenntnisse der steuerlichen Vorschriften vermitteln soll.[2] Daran anknüpfend untersucht die Steuerwirkungslehre den Einfluss der Besteuerung auf betriebliche Aufbauelemente und Hauptfunktionen.[3] Auf der Grundlage der Kenntnis der Steuerwirkungen versucht die Steuergestaltungslehre (oder „Steueroptimierungslehre“[4] ), Entscheidungshilfen zur Realisierung betrieblicher Zielsetzungen zu entwickeln.[5] Da die Steuerwirkungslehre der Steuergestaltungslehre direkt vorangehen muss, werden diese beiden Aufgaben der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre oft zusammengefasst.[6] Als weitere Hauptaufgabe wird überwiegend die Normative Steuerlehre genannt, die auf der Grundlage von Steuerrechtskenntnissen und Ergebnissen aus der Steuerwirkungs- und Steuergestaltungsanalyse Empfehlungen für die zukünftige Ausrichtung der Steuergesetzgebungspolitik geben möchte und daher auch als Steuerrechtsgestaltungslehre bezeichnet wird.[7]
Darüber hinaus wird die Analyse des Einflusses der Besteuerung auf das betriebliche Rechnungswesen teilweise als eigenständige Aufgabe der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre angesehen, da die Art der Anwendung der Buchführungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften erhebliche steuerliche Folgen auslösen kann.[8] Schließlich wird z.T. von einer Steuerberatungslehre gesprochen, die eine Weiterentwicklung der Steuergestaltungslehre darstellt und praktische Empfehlungen i.S. einer Steuerberatungstätigkeit geben möchte.[9]
Auf der Grundlage der vorgenannten Untergliederungsmaßstäbe ist der Untersuchungsgegenstand der Steuergestaltungslehre zuzuordnen, da durch eine analytische Modellbildung versucht wird, das Ausgangsproblem zu lösen und Gestaltungsempfehlungen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Zielsetzungen zu geben. Es ist aber zu beachten, dass auch die Steuerwirkungslehre nicht unberücksichtigt bleibt, da für eine problemlösungsoptimierende Gestaltungsempfehlung zunächst die jeweiligen Steuerwirkungen der betrieblichen Maßnahmen herausgearbeitet werden müssen.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass das im Verlauf der Untersuchung verwendete Grundmodell der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre zwar auf die entscheidungsorientierte Betriebswirtschaftslehre zurückgeht. Es wird jedoch als Instrument im Rahmen der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre eingesetzt, um zu angemessenen Lösungen zu kommen.
1.4 Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes
Um den Umfang der Untersuchung nicht zu sprengen, werden eine Reihe vereinfachender, die Verdeutlichung des Untersuchungsgegenstandes jedoch nicht gefährdender Prämissen aufgestellt, die gleichzeitig den Untersuchungsgegenstand von ähnlichen Tatbeständen und benachbarten Gebieten abgrenzen.
Bei dem zu teilenden Subjekt soll es sich um eine Personengesellschaft in der Rechtsform einer GbR, OHG oder KG handeln. Andere Personengesellschaftstypen und steuerliche Mitunternehmerschaften, wie z.B. die typisch oder atypisch stille Gesellschaft und die Partnerschaftsgesellschaft, werden nicht untersucht. Die zu betrachtende Personengesellschaft ist mehr als im geringfügigen Maße[10] gewerblich und im übrigen ebenfalls mit Einkünfteerzielungsabsicht tätig, so dass ihre gesamte Tätigkeit gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG einen Gewerbebetrieb bildet. Gleichzeitig erfüllt sie die Voraussetzungen eines Gewerbebetriebs i.S. des § 2 Abs. 1 GewStG. An der Personengesellschaft sind nur unbeschränkt einkommensteuerpflichtige natürliche Personen beteiligt, so dass insbesondere die Sonderrechtsform der GmbH & Co. KG unberücksichtigt bleibt.
Die Teilung des Vermögens der Personengesellschaft soll im Wege der Übertragung auf ein Privat- oder Betriebsvermögen der an der Personengesellschaft beteiligten Gesellschafter erfolgen. Auf der Empfängerseite sollen nur Personen stehen, die auch Gesellschafter der übertragenden Personengesellschaft sind. Demnach dürfen auch an aufnehmenden Personen- oder Kapitalgesellschaften nur Gesellschafter der übertragenden Personengesellschaft beteiligt sein. Bestandteil dieser Arbeit sind nur unentgeltliche Vermögensübertragungen, die jedoch unter Minderung bzw. Gewährung von Gesellschaftsanteilen erfolgen können. Entgeltliche Teilungsvorgänge, wie z.B. Veräußerungen, werden nicht untersucht. Ebenso bleiben Zahlungen zur Abgeltung eines etwaigen Wertausgleichs unter den Gesellschaftern unberücksichtigt.[11] Auch grenzüberschreitende Vermögensübertragungen werden nicht behandelt.
Der Begriff der Steueroptimalität orientiert sich ausschließlich an möglichst günstigen ertragsteuerlichen Folgen des Teilungsvorganges. Umsatzsteuerliche und grunderwerbsteuerliche Aspekte bleiben unberücksichtigt. Durch den Ausschluss der GmbH & Co. KG entfällt auch eine Einbeziehung körperschaftsteuerlicher Wirkungen. Aus Praktikabilitätsgründen beschränkt sich die Untersuchung auf sechs noch zu konkretisierende Aspekte, die Auswirkungen auf die Einkommen- und Gewerbesteuerfestsetzungen der Personengesellschaft und ihrer Gesellschafter haben. Die Annexsteuern zur Einkommensteuer (Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) bleiben aus Vereinfachungsgründen unberücksichtigt. Dies ist gerechtfertigt, da diese Beträge direkt von der Höhe der Einkommensteuer abhängen und somit in einer proportionalen Beziehung zur Einkommensteuer stehen.
Für die Beschreibung der steuerlichen Folgen ist der Rechtsstand zum 1.1.2002 maßgebend.[12] Soweit ein steuerlicher Übertragungsstichtag gemäß § 20 Abs. 8 UmwStG bis zu acht Monate vor den tatsächlichen Teilungsvorgang zurückbezogen werden kann, ist davon auszugehen, dass hierdurch kein älterer Rechtsstand zur Geltung kommt.
Das betriebswirtschaftliche Entscheidungsproblem wird als eine Aufgabenstellung interpretiert, in der sämtliche betrieblichen Belange aus allen unternehmerischen Teilbereichen einfließen. Zur Vereinfachung der Problemlösung im Wege der Modellbildung ist jedoch davon auszugehen, dass die unter Berücksichtigung der unternehmenspolitischen und steuerlichen Zielsetzungen gefundenen optimalen Teilungsvorgänge weder bemerkenswert positive noch bemerkenswert negative Auswirkungen auf die übrigen Unternehmensteile haben. Auch in umgekehrter Richtung wird unterstellt, dass sonstige betriebliche Effekte keinen Einfluss auf die steuerliche Betrachtung haben und somit vernachlässigt werden können.
2 Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre
2.1 Entscheidungstheoretische Ansätze
2.1.1 Begriff der Entscheidungstheorie
Für das Verständnis dafür, was als wissenschaftliche Entscheidungstheorie angesehen wird, ist zunächst eine Auseinandersetzung mit dem reinen Entscheidungsbegriff notwendig. Die in der Literatur existierenden Definitionsansätze beinhalten z.T. sehr unterschiedliche Einzelkomponenten. Am häufigsten werden der Wahlakt des Entscheidungsträgers sowie das Vorhandensein von mindestens zwei Handlungsalternativen als grundlegende Bestandteile des Entscheidungsbegriffs angesehen.[13] Darüber hinaus werden die zusätzlichen Komponenten „Willensakt“[14], mehr oder weniger „bewusstes“[15] Handeln, „zur Erreichung eines Ziels“[16] sowie die „Veränderung der Situation ..., die im Entscheidungszeitpunkt vorliegt“[17], genannt. Schließlich wird angeführt, dass die Auswahl für eine Handlungsalternative nur dann zur Entscheidung wird, wenn der Entscheidungsträger verpflichtet ist, seinen Entschluss auch auszuführen.[18] Durch eine Zusammenführung dieser Elemente ist eine Entscheidung als ein Wahlakt anzusehen, bei dem (mehr oder weniger) bewusst eine von mehreren die Ausgangssituation verändernden Handlungsalternativen zur Erreichung eines Zieles ausgewählt wird und bei dem der Entscheidungsträger verpflichtet ist, die gewählte Handlungsalternative durch einen Willensakt auch tatsächlich auszuführen.
Ausgehend von diesem Entscheidungsbegriff untersucht die Entscheidungstheorie im Wege der logischen oder empirischen Analyse das rationale oder intendiert rationale Entscheidungsverhalten von Individuen und Gruppen.[19] Im wissenschaftlichen Sinne ist die Entscheidungstheorie interdisziplinär angelegt und kann u.a. wirtschaftliche, soziale und psychische Ausrichtungen haben.[20] Ihre Aufgabe besteht nicht nur in der Analyse und Erklärung des Entscheidungsverhaltens von rational handelnden Subjekten. Sie soll vielmehr auch im Sinne einer Beratungsfunktion empirisch gehaltvolle Thesen für den Entscheider zur Verfügung stellen.[21]
2.1.2 Klassifizierung der Entscheidungstheorie
Das Gebiet der Entscheidungstheorie lässt sich nach Art und Betrachtungsperspektive weiter unterteilen. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Untergliederung in die normative und die deskriptive Entscheidungstheorie.
Die normative oder präskriptive Entscheidungstheorie baut auf dem Grundgedanken der Entscheidungslogik auf.[22] Sie versucht, durch die vollständige Analyse einer Entscheidungssituation Handlungsempfehlungen zu finden, die sie dem Entscheidungsträger vorschlagen kann.[23] Dies geschieht auf der Grundlage rationalen Verhaltens, so dass soziologische und psychologische Aspekte weitgehend unberücksichtigt bleiben.[24] Innerhalb der normativen Entscheidungstheorie lassen sich wiederum drei Richtungen unterscheiden. Ist dem Entscheidungsträger die Festlegung des von ihm angestrebten Zieles überlassen und erfolgt die theoretische Untersuchung nur hinsichtlich der optimalen Alternativenauswahl, spricht man von der praktisch normativen Entscheidungstheorie. Im Gegensatz dazu schreibt der bekennend normative Ansatz dem Entscheidenden zusätzlich vor, welches Ziel am zweckmäßigsten für ihn sei.[25] Schließlich können über die Rationalität des Entscheidungsträgers noch ethische oder moralische Werte gestellt werden, die letztlich die wertoptimale Entscheidung beeinflussen. Einen solchen Ansatz bezeichnet man als ethisch-normativ.[26]
Die deskriptive oder empirisch realistische Entscheidungstheorie hat die Zielsetzung, zu beschreiben und zu erklären, wie Entscheidungen in der Realität getroffen werden, um hieraus empirisch gehaltvolle Hypothesen über das Entscheidungs- und Problemlösungsverhalten von Individuen und Gruppen zu erarbeiten.[27] Es soll vor allem untersucht werden, von welchen Motiven sich der Entscheidungsträger leiten lässt, um zuverlässige Prognosen für künftige Entscheidungssituationen erstellen zu können.[28] Aufgrund dieses verhaltenswissenschaftlichen Forschungsansatzes und der fehlenden Entscheidungslogik wird die deskriptive Entscheidungstheorie den Sozialwissenschaften zugeordnet.[29]
Da die normative Entscheidungstheorie der ältere der beiden Ansätze ist, stellte er in den meisten Fällen die Grundlage für Untersuchungen im entscheidungstheoretischen Umfeld dar. Im Laufe der Zeit wurde jedoch die Bedeutung und Relevanz der deskriptiven Betrachtungsweise zur Unterstützung des normativen Ansatzes erkannt.[30] Insbesondere dadurch, dass der deskriptiven Theorie eigene Modellansätze zugewiesen wurden, eröffneten sich neue Forschungsfelder, die noch längst nicht vollständig erschlossen sind.[31] Bemerkenswert ist, dass die formale Entscheidungslogik der normativen Theorie im Rahmen des deskriptiven Ansatzes durch eine subjektive Psycho-Logik bei individuellen Entscheidungen sowie durch eine intersubjektive Sozio-Logik bei kollektiven Entscheidungsprozessen ersetzt werden kann.[32]
2.1.3 Betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie
Die grundsätzlich interdisziplinär angelegte allgemeine Entscheidungstheorie weist aufgrund der herausragenden Bedeutung betrieblicher Entscheidungen für den Unternehmenserfolg eine enge Beziehung zur Betriebswirtschaftslehre auf. Bei der Untersuchung, inwieweit diese beiden Wissenschaftszweige miteinander verzahnt sind, müssen verschiedene Ansätze betrachtet werden.
Schon vor mehr als dreißig Jahren ist der Begriff der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre geprägt worden.[33] Grundlage für die Begriffsprägung war, dass die Betriebswirtschaftslehre auf Basis der deskriptiven Theorie versucht, den Ablauf von Entscheidungsprozessen auf unternehmerischer Ebene zu erklären und Verhaltensempfehlungen zu geben, um so die generelle Erklärungs- und Gestaltungsaufgabe der Betriebswirtschaftslehre zu erfüllen.[34] Auch die durch Einbeziehung der Unternehmenskulturen entstehenden Besonderheiten in Entscheidungsprozessen können berücksichtigt werden.[35]
In jüngerer Zeit wird die Betriebswirtschaftslehre sogar als eine angewandte oder spezielle Entscheidungstheorie bezeichnet.[36] Dies ist gerechtfertigt, da die betrieblichen Entscheidungen nur einen Teil des gesamten im Rahmen der Entscheidungstheorie untersuchten Spektrums an Auswahlproblemen ausfüllen können, so dass die entscheidungsorientierte Betriebswirtschaftslehre als Teilbereich der Entscheidungstheorie anzusehen ist.
Außerdem ist zu beachten, dass für das Erzielen befriedigender Ergebnisse sowohl in der betriebswirtschaftlich orientierten Entscheidungstheorie als auch in der entscheidungsorientierte Betriebswirtschaftslehre eine Verknüpfung der Elemente aus den normativen und deskriptiven Ansätzen unerlässlich ist. Nur durch die Synthese der beiden Ansätze können realitätsnahe und fundierte Entscheidungsmodelle entworfen werden, die sowohl die Gestaltungs- als auch die diesen vorgelagerten Erklärungsaufgaben bewältigen können.[37]
2.2 Betrieblicher Entscheidungsvorgang
2.2.1 Deskriptiver Ansatz als Grundüberlegung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unter einem betrieblichen Entscheidungsvorgang ist nicht bloß der tatsächliche Auswahlakt im Zeitpunkt der Entscheidungsfindung zu verstehen. Vielmehr ist er als ein mehrstufiger Prozess anzusehen, der in verschiedene Phasen unterteilt werden kann. Ausgehend davon, dass der Mensch als Entscheidungsträger fungiert und dessen soziales und psychisches Umfeld den Ausgangspunkt für Entscheidungen bildet, stellt der verhaltensorientierte deskriptive Ansatz der Entscheidungstheorie die Grundlage für Überlegungen zur Strukturierung eines Entscheidungsprozesses dar.[38] Im Bereich der empirischen Entscheidungsforschung können für die Systematisierung eines psychologischen Entscheidungsprozesses die nachfolgend dargestellten fünf Phasen unterschieden werden:[39]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Phasen des psychologischen Entscheidungsprozesses
Als Anregung bezeichnet man die Aufgeschlossenheit des Individuums, einen empfangenen Impuls nicht zu ignorieren, sondern als Aufruf zum Handeln in einer als unbefriedigend empfundenen Situation zu interpretieren. Da noch Unklarheiten über die mit der möglichen Entscheidungsproblematik zusammenhängenden Ziele und Alternativen bestehen, schließt sich eine Phase der Unorientiertheit an. Diese wird durch zielgerichtetes Suchen nach Informationen und Alternativen, dem Erarbeiten von Lösungswegen und der damit verbundenen Orientierung abgelöst. Es folgt eine Phase der Distanzierung, in der in Form einer geistigen Ruhepause Abstand zum Entscheidungsproblem gewonnen werden soll. Schließlich wird diese Ruhephase durch das endgültige Treffen der Entscheidung und der sich daran anschließenden Ausführung der ausgewählten Handlungsalternative beendet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Man kann dieses 5-Phasen-Schema als wellenförmiges Zeitablaufschema interpretieren, in dem sich drei Aktiv- und zwei Passiv-Phasen abwechseln und ein zu langes Verharren in den beiden Passiv-Phasen die Gefahr einer Veränderung der Entscheidungssituation mit sich bringt.[40] Diese fünf Phasen sind u.a. auch im Verfahren zur Wertanalyse wiederzufinden, in dem sie gemäß der nachfolgenden Abbildung im Gegensatz zum psychologischen Entscheidungsprozess eine deutlich größere Zweckorientierung aufweisen.[41]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Phasen der Wertanalyse
Ein anderer Ansatz der verhaltensorientierten Entscheidungsforschung geht ebenfalls von fünf Phasen aus, wobei die ersten drei Phasen der Anregung, der Suche und der Optimierung der Willensbildung dienen, während die sich anschließenden Realisations- und Kontrollphasen für die Willensdurchführung stehen.[42]
Allen Ansätzen gemein ist das Bestreben, das individuelle menschliche Verhalten in den Mittelpunkt der Strukturierungsversuche zu stellen und von den streng sachlich orientierten Abläufen zunächst zu abstrahieren.
2.2.2 Ablauf des betrieblichen Entscheidungsprozesses
Aus der deskriptiven Grundüberlegung heraus ist nun ein Schema für einen betrieblichen Entscheidungsprozess zu entwickeln, das zusätzlich konkret auf die sachlichen Erfordernisse einer strukturierten Problemlösung eingeht. In der Literatur sind viele Vorschläge für eine Problemlösungsstruktur gemacht worden,[43] die sich zu folgendem Ansatz vereinigen lassen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Betrieblicher Entscheidungsprozess
Die Problemformulierung beinhaltet grundsätzlich die zuvor erfolgte Problemerkennung und umfasst die Strukturierung des Problems sowie eine ausführliche Situationsanalyse zur Bewertung der Dimension der zu bewältigenden Aufgabe. Anschließend muss sich der Entscheidungsträger über die Richtung und das Ausmaß seiner Ziele klar werden. Die Präzisierung des Zielsystems dient u.a. dazu, die Anzahl der Handlungsalternativen einzugrenzen und einen Beurteilungsmaßstab für die Alternativenauswahl zu liefern.[44] Die daran anschließende Erforschung der Alternativen führt von der Prüfung aller möglichen Handlungsmöglichkeiten über die Ermittlung der Restriktionen möglicher Alternativen bis zur konkreten Suche nach problemlösungsadäquaten Handlungsalternativen und deren Bewertung im Hinblick auf die Erreichbarkeit der vorgegebenen Ziele. Der Entschluss beinhaltet die endgültige Alternativenauswahl und bildet den zentralen Akt des Entscheidungsprozesses. Anschließend erfolgt die Anweisung zur Durchführung der ausgewählten Handlungsalternative. Abgeschlossen wird der Entscheidungsprozess durch die Kontrolle der Zweckmäßigkeit des Entscheidungsvorgangs, die z.B. in Form einer Abweichungsanalyse durchgeführt werden kann.[45]
Mit Hilfe eines solchen allgemeinen Schemas für Entscheidungsprozesse lassen sich fast alle auftretenden Entscheidungssituationen so strukturieren, dass ein zielstrebiger Problemlösungsablauf erreicht werden kann. Besonders zu beachten ist, dass nicht der Entscheidungsablaufs eines Individuums, sondern der eines gesamten betrieblichen Organismus geschildert wird, wodurch innerbetriebliche Interdependenzen den sorgsam strukturierten Prozessablauf beeinträchtigen können. Zu nennen sind die nachfolgend beschriebenen vier Verbundeffekte, die zwischen zwei Entscheidungsbereichen desselben Unternehmens auftreten können.[46]
Bei einem Restriktionsverbund sind die Handlungsmöglichkeiten in einem Betriebsbereich von den Aktionen in einem anderen Bereich abhängig; bspw. ist das Ausmaß der Absatzmöglichkeiten eines Produktes von der gefertigten Menge abhängig. Daher müssen die Entscheidungen in diesen beiden Bereichen aufeinander abgestimmt werden. Ähnlich gelagert ist der Fall eines Erfolgsverbundes. Wenn der betriebliche Gesamterfolg nicht durch einseitige Veränderungen in einem Betriebsbereich gesteigert werden kann, ohne dass auch in anderen Teilbereichen Entscheidungen getroffen werden müssen, ist eine Optimierung nur durch Koordination möglich. Auch das Problem abhängiger zufallsabhängiger Beziehungen zwischen Aktionen in verschiedenen Bereichen (Risikoverbund) kann nur durch eine Gesamtrisikobetrachtung gelöst werden. Schließlich kann auch ein Bewertungsverbund vorliegen, wodurch die Bewertung von Einzelaktionen in verschiedenen Bereichen im Gesamtbetriebsinteresse aufeinander abgestimmt werden muss.
Die Beachtung dieser zusätzlichen Verbundeffekte führt dazu, dass im betrieblichen Bereich einzelne Entscheidungsprozesse nicht isoliert betrachtet werden können, sondern in einem Gesamtentscheidungsprozess zusammengeführt werden müssen.
2.3 Grundmodell der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre
2.3.1 Grundlagen der Modellbildung
Zur Vereinheitlichung von Entscheidungsprozessen und zur Ableitung rationaler Problemlösungen für praktische Entscheidungssituationen hat sich in der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre ein Grundmodell herausgebildet. Dieses Grundmodell weist zwei Merkmale auf, die für die meisten betriebswirtschaftlichen Modelle charakteristisch sind. Zum einen stellt das Modell eine vereinfachende Abbildung realer Tatbestände dar, weil einem Modellelement mehrere als äquivalent zu bezeichnende Elemente oder Eigenschaften des Realbereichs zugeordnet werden. Zum anderen ist trotz der möglichen Komplexität der realen Tatbestände eine weitgehende Strukturgleichheit oder zumindest -ähnlichkeit zwischen Realbereich und Modell gegeben.[47]
Betriebswirtschaftliche Modelle lassen sich allgemein nach verschiedenen Kriterien untergliedern (z.B. Art der Information, Darstellungsform, Einsatzzweck oder Art der Abstraktion).[48] Auch im Bereich der Entscheidungslehre ist eine Klassifikation der Modelle sinnvoll, um sich einen Überblick über die verschiedenen Gesichtspunkte der Modellbildungsmöglichkeiten zu verschaffen. Eine Einteilung der Entscheidungsmodelle kann nach folgenden Kriterien erfolgen:[49]
- Eine oder mehrere Zielsetzungen,
- Sicherheits-, Ungewissheits- oder Risikosituationen,
- Individuum oder Gremium als Entscheidungsträger,
- statische oder dynamische Zeitdimension.
Darüber hinaus kann eine Einteilung in ein aufbauorientiertes oder ein ablauforientiertes Grundmodell vorgenommen werden. Beim aufbauorientierten Grundmodell steht die Entscheidung mit ihren Bausteinen und Elementen im Mittelpunkt der Betrachtung, während der ablauforientierte Ansatz vordringlich auf eine Analyse des Entscheidungsprozesses und seines Ablaufs abstellt.[50]
Obwohl derart feine Untergliederungen und die Berücksichtigung zahlreicher Unterscheidungskriterien die Glaubwürdigkeit einer realitätsnahen Abbildung der Wirklichkeit durch das jeweilige Modell steigern, muss auf die praktische Anfälligkeit des Grundmodells hingewiesen werden. Die Konstruktion eines Entscheidungsmodells ist in so hohem Maße von subjektiven Umständen des jeweiligen Entscheiders abhängig, dass ein stark vereinfachendes Grundmodell nicht unbedingt die praktikabelste Lösung bietet. In komplexen Fällen kann das Entscheidungsmodell daher nur der Entscheidungsvorbereitung dienen, wonach der Entscheidungsträger erneut prüfen und abwägen muss.[51] Eine weitere Problematik ist darin zu sehen, dass betriebswirtschaftliche Entscheidungsmodelle oft durch die Vernachlässigung oder unzureichende Berücksichtigung von betrieblichen Interdependenzen gekennzeichnet sind. Integrative, restriktive, produktionstechnische und zeitliche Zusammenhänge zwischen einzelnen Unternehmensteilen und Betriebsabläufen können erhebliche Erweiterungen des Modells erforderlich machen, was jedoch oft nicht beachtet wird.[52]
Beim Einsatz von betriebswirtschaftlichen Entscheidungsmodellen muss daher besonders darauf geachtet werden, ob trotz des vereinfachenden Abbildungsvorgangs die Realität insoweit wiedergegeben wird, dass eine durch das Modell ermittelte Entscheidung ohne zusätzliche Prämissen als optimal angesehen werden kann.
2.3.2 Aufbau und Wirkungsweise des Grundmodells
Das allgemein als Grundmodell der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre bekannte Modell ist präziser als „aufbauorientiertes Grundmodell der normativen Entscheidungstheorie“[53] zu bezeichnen. Im Mittelpunkt des Modells stehen die Elemente, die auch Entscheidungsprämissen genannt und in faktische, wertende und methodische Prämissen unterteilt werden.
Elemente, die der Entscheidungsträger als unbeeinflussbar hinnehmen muss, wie Handlungsalternativen, Umweltzustände, Wahrscheinlichkeiten und Ergebnisse, bilden die faktischen Entscheidungsprämissen. Als wertend (oder normativ) bezeichnet man hingegen die Prämissen, die vom Entscheidungsträger direkt beeinflusst werden können, wie Ziele, Präferenzen, Entscheidungsverhalten und Entscheidungsregeln.[54] Zusätzlich existieren methodische Entscheidungsprämissen in Form von mathematischen Methoden zur Lösung des Problems.[55]
Diese Entscheidungsprämissen werden in einem Modell vereinigt, das die jeweilige Entscheidungssituation möglichst realitätsnah abbilden soll. Hierzu dient in erster Linie das Entscheidungsfeld, das aus einer Vielzahl von Handlungsalternativen und Umweltzuständen sowie den sich aus den Kombinationen dieser beiden Elemente ergebenden Ergebnissen besteht.[56] Während der Entscheidungsträger auf die Zusammensetzung des Entscheidungsfeldes keinen Einfluss nehmen kann, bestimmt er das Zielsystem nach seinen Vorstellungen selbst. Einerseits stellt er aufgrund seiner persönlichen Wertschätzung Präferenzen auf, die zu Entscheidungsregeln transformiert werden und in die Entscheidungsmatrix eingehen. Andererseits setzt er durch geeignete Ergebnisdefinitionen fest, in welcher Form die jeweiligen Handlungskonsequenzen in der Ergebnismatrix dargestellt werden.[57] Eine grafische Zusammenfassung des Modells enthält die folgende Abbildung.[58]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Aufbauschema des Grundmodells
Für die Lösung praktischer Entscheidungsprobleme ist zu beachten, dass das Grundmodell aufgrund der großen Menge real existierender Handlungsalternativen schnell unübersichtlich und unpraktikabel wird. In der Praxis werden daher oft einzelne Alternativen oder Umweltzustände im vorhinein ausgeschlossen. Diese Vorgehensweise riskiert jedoch, dass möglicherweise nicht die beste Entscheidung getroffen wird.[59] Vereinfachungen des Grundmodells sollten daher nicht leichtfertig vorgenommen werden.
2.3.3 Elemente des Grundmodells
2.3.3.1 Entscheidungsträger
In den meisten Beschreibungen des Grundmodells der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre wird der Entscheidungsträger nicht explizit als Modellelement aufgeführt. Dies liegt z.T. daran, dass die Besonderheiten der Person des Entscheidenden bereits indirekt in die Formulierung der Ziele, Präferenzen und Entscheidungsregeln eingeht.[60] Ein weiterer Grund ist, dass das Grundmodell der normativen Entscheidungstheorie gerade nicht das Verhalten des Entscheidungsträgers, sondern die rational-optimale Lösung des Entscheidungsproblems in den Mittelpunkt stellt. Dennoch erscheint die Berücksichtigung des Entscheidungsträgers bei den Grundelementen gerechtfertigt, da dieser eine zentrale Stellung einnimmt und wichtige Weichenstellungen für die Definition des Zielsystems vornehmen kann.
Eine besondere Bedeutung für den Ablauf des Entscheidungsprozesses kommt der Anzahl der Entscheidungsträger zu. Während bei unipersonalen Entscheidungsträgern (hierzu zählen neben Einzelpersonen auch völlig einheitlich agierende Gruppen) nur individuelle (intrapersonelle) Konflikte auftreten können, sind bei multipersonalen Entscheidungsträgern (Gruppen, Gremien, Institutionen oder Organisationen) oft eine Vielzahl interpersoneller Konflikte zu lösen.[61]
Wenn eine kollektiv entscheidende Gruppe oder Organisation als Entscheidungsträger in ein Modell eingebaut werden soll, müssen vielfältige Zielkonflikte beachtet werden. Jedes Einzelmitglied verfolgt neben den Kollektivzielen auch eigene Zielvorstellungen. Sowohl Kollektiv- als auch Individualziele sind jedoch nicht immer von vornherein exakt formuliert, da sich einige Vorstellungen erst im Laufe des Entscheidungsprozesses konkretisieren. Geht man nun davon aus, dass es innerhalb einer Organisation noch mehrere Untergruppierungen gibt, können diverse präzise und unpräzise formulierte Individual- und Gruppenziele miteinander konkurrieren.[62] Zu der schon grundsätzlich schwierigen Lösung dieser Zielproblematik stoßen in größeren Betrieben noch verstärkt Kommunikationsprobleme hinzu, die Kompromisse erschweren und Einigungen verschleppen können.[63] Zur Lösung interpersoneller Zielkonflikte bei Kollektiventscheidungen wurden Gruppenentscheidungs- und Abstimmungsregeln entworfen. Da jedoch selbst diese Regeln keine klare und gerechte Einigung gewährleisten,[64] kann das interpersonelle Koordinationsdilemma das eigentliche sächliche Entscheidungsproblem leicht in den Hintergrund drängen.
Aus diesen Gründen betrachtet das Grundmodell der normativen Entscheidungstheorie nur unipersonale Entscheidungsträger.
2.3.3.2 Zielsystem
2.3.3.2.1 Zielklassifizierungen
Ein Entscheidungsproblem kann nur dann erfolgreich gelöst werden, wenn der Entscheidungsträger konkrete Zielvorstellungen besitzt, so dass die Konsequenzen der unterschiedlichen Handlungsalternativen diesen Zielen zugeordnet und entsprechend bewertet werden können. Aufgrund der vom Entscheidenden festgelegten Zielgrößen scheiden bereits jene Handlungsalternativen aus, die keine Relevanz für eine der gewählten Zielgrößen aufweisen.[65]
Hinsichtlich der Klassifizierung von Zielgrößen sind vielfältige Unterscheidungsmöglichkeiten denkbar, z.B. eine Unterteilung in finanzielle und nicht-finanzielle Zielgrößen.[66]
Eine überaus wichtige Differenzierung wird im Hinblick auf die Optimierungskriterien vorgenommen, indem zwischen Fixierungs-, Satisfizierungs- und Extremierungszielen zu unterscheiden ist. Ein Ziel mit Fixierungscharakter ist dadurch gekennzeichnet, dass es entweder exakt oder gar nicht erreicht werden kann. Der Entscheidungsträger strebt nach einer konkreten Ausprägung seiner Zielgröße. Satisfizierende Ziele sind durch die Festlegung eines Anspruchsniveaus, das mindestens erreicht werden muss, charakterisiert. Bei einer Übererfüllung des Anspruchsniveaus wird grundsätzlich von einer indifferenten Bewertung ausgegangen, d.h. ein Überschreiten der Zielgröße um 30% muss nicht besser sein als eine Übererfüllung um 20%. Bei extremierenden Zielen soll die jeweilige Zielgröße den höchstmöglichen oder den niedrigstmöglichen Wert annehmen. Im ersten Fall spricht man von der Maximierung der Zielgröße (z.B. Unternehmensgewinn), im zuletzt genannten von der Minimierung (z.B. Kosten).[67]
Darüber hinaus lassen sich Ziele auch danach klassifizieren, in welchem Verhältnis sie zu anderen Zielen stehen. Als die drei wichtigsten Beziehungen sind hierbei die Zustände der Neutralität (oder Indifferenz), Komplementarität und Konkurrenz voneinander abzugrenzen.[68] Von Zielneutralität spricht man, wenn Maßnahmen zur Verbesserung einer Zielerreichung keine Auswirkungen auf das Erreichen andere Zielgrößen haben. Komplementär ist dagegen der Zusammenhang zwischen zwei Zielen, wenn ein verbesserter Erreichungsgrad einer Zielgröße auch zu einer Verbesserung der Erreichung eines anderen Zieles führt. Schließlich bezeichnet man die Konfliktsituation zwischen zwei Zielgrößen als Zielkonkurrenz. Hierbei führt die Verbesserung einer Zielerreichung zu einer Verschlechterung des Erreichungsgrades eines anderen Zieles. Innerhalb eines großen Zielsystems können zwischen den einzelnen Zielen untereinander verschiedenartige Beziehungen bestehen. In diesen Fällen spricht man von partieller Neutralität, partieller Komplementarität oder partieller Konkurrenz. Nur eine geringe Bedeutung kommt den Beziehungen der Zielidentität und der Zielantinomie zu,[69] die daher nicht weiter erläutert werden.
2.3.3.2.2 Präferenzen
Die Festlegung von relevanten Zielgrößen wird in den meisten Fällen nicht ausreichen, um ein komplexes Entscheidungsproblem zu lösen, da i.d.R. mehrere Handlungsalternativen die Zielvorgaben erfüllen werden. Es ist daher zusätzlich notwendig, dass sich der Entscheidungsträger darüber bewusst wird, welche Zielausprägungen er in welchem Maße bevorzugt. In der Entscheidungstheorie werden hierfür die folgenden vier wichtigen Präferenzen unterschieden.[70]
(1) Höhenpräferenz: Die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit einer Alternative hängt primär von der Höhe der aus ihr resultierenden Konsequenz ab. Dies wird häufig bei Extremierungs- und z.T. auch bei Satisfizierungszielen zum Ausdruck gebracht. Eine höhere Ausprägung bedeutet dann z.B. einen höheren Zielerreichungsgrad.
(2) Artenpräferenz: Wenn mehrere Zielkriterien betrachtet werden sollen und diese (zumindest teilweise) in Konkurrenz zueinander stehen, muss der Entscheidungsträger festlegen, welche Zielarten für ihn besonders wichtig sind. Die Bedeutung der einzelnen Zielkriterien kann dabei aufgrund einer hierarchischen Zielordnung oder durch Gewichtung festgelegt werden.
(3) Zeitpräferenz: Bei dynamischen oder mehrperiodischen Entscheidungsmodellen kann die Bedeutung eines Ergebnisses u.U. stark davon abhängen, zu welchem Zeitpunkt die jeweilige Alternative durchgeführt wird bzw. wann die Konsequenzen der Alternative eintreten. In Entscheidungsmodellen der Investitionsrechnung erfolgt die Berücksichtigung der Zeitpräferenz z.B. durch die Abdiskontierung von Zahlungsströmen.
(4) Sicherheits- oder Risikopräferenz: Für den Fall, dass keine vollständige Gewissheit über den Eintritt sämtlicher Umweltzustände besteht, muss der Entscheidungsträger seine persönliche Risikobereitschaft in das Entscheidungsmodell einfließen lassen. Die Bewertung der Alternativen erfolgt dann nicht nur hinsichtlich ihrer Konsequenzen, sondern auch anhand der Wahrscheinlichkeit des Eintretens des jeweils relevanten Umweltzustandes.
Unter Berücksichtigung der genannten Präferenzen führt die Bewertung der Handlungskonsequenzen bereits zu hinreichend differenzierenden Werturteilen. Zusätzlich ist die Bildung einer Durchführungspräferenz möglich, wodurch den verschiedenen Durchsetzungsschwierigkeiten unterschiedlicher Entscheidungen Rechnung getragen wird.[71] Außerdem ist zu beachten, dass die Präferenzen im jeweiligen Modell ordinal oder kardinal formuliert werden können. Während ordinale Präferenzen lediglich die Vorziehenswürdigkeit einer Alternative gegenüber einer anderen in Bezug auf das zu betrachtende Merkmal bestimmen, geben kardinale Präferenzen auch den Umfang der Unterschiede der Vorteilhaftigkeit an.[72]
2.3.3.2.3 Entscheidungsregeln
Hat der Entscheidungsträger seine Zielvorstellungen geäußert und seine individuellen Präferenzen angegeben, können hieraus Entscheidungsregeln abgeleitet werden. Als Entscheidungsregeln bezeichnet man „formalisierte Bewertungsverfahren, die jeder Ergebnismenge einer Alternative einen Nutzen (reelle Zahl) gemäß den Präferenzen des Entscheidungsträgers zuordnen“[73]. Die Entscheidungsregel setzt sich aus einer Präferenzfunktion und einem Optimierungskriterium zusammen.[74] Abzugrenzen ist die Entscheidungsregel von dem Entscheidungsprinzip, das zwar gewisse Anforderungen an Präferenzfunktionen stellt, dem Entscheidungsträger aber noch die freie Wahl zwischen diesen Funktionen lässt. Eine Entscheidungsregel bezieht sich nur noch auf eine einzige Präferenzfunktion, so dass eindeutige Rangordnungen der Handlungsalternativen aufgestellt werden können. Entscheidungsprinzip und Entscheidungsregel werden unter dem gemeinsamen Oberbegriff Entscheidungskriterium zusammengefasst.[75]
Welche Entscheidungsregel zur Anwendung kommt, hängt u.a. von der Sicherheitssituation ab. Bei Entscheidungen unter Sicherheit sind z.B. gar keine Entscheidungsregeln nötig, wenn nur ein Ziel betrachtet wird oder wenn sich die Ziele untereinander komplementär verhalten. Liegen jedoch konkurrierende Ziele vor, muss eine Entscheidungsregel angewandt werden. Die Ziele können hierbei unterschiedlich gewichtet oder aber derart in ein Haupt- und mehrere Nebenziele unterteilt werden, dass das Hauptziel optimiert und hinsichtlich der Nebenziele lediglich ein bestimmtes Anspruchsniveau erfüllt werden muss.[76] Des weiteren besteht die Möglichkeit, das Verfahren der Zieldominanz oder ein Zielschisma anzuwenden.[77]
In Risikosituationen ist grundsätzlich auf Entscheidungsregeln zurückzugreifen. Es bieten sich hierbei u.a. die Möglichkeiten, Sicherheitsäquivalente oder Risikoprämien in die Bewertung mit einzubeziehen, statistische Kenngrößen wie Erwartungswert, Varianz oder Standardabweichung zu verwenden, das Bernoulli-Prinzip anzuwenden oder individuelle Risikobereitschaften durch Indifferenzkurven zu berücksichtigen, worauf jedoch im Einzelnen nicht detailliert eingegangen werden soll.[78]
Auch bei den Entscheidungsregeln für Ungewissheitssituationen wird auf umfassende Ausführungen verzichtet. Zu nennen sind hier die Minimax- und Maximin-Regeln, das Hurwicz-Prinzip, die Laplace-Regel sowie die Regel von Niehans und Savage.[79]
2.3.3.3 Entscheidungsfeld
2.3.3.3.1 Handlungsalternativen
Die Grundlage des Entscheidungsfeldes wird von den zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen oder Aktionen gebildet. Als Handlungsalternative ist sowohl eine Einzelmaßnahme als auch ein Bündel von Maßnahmen anzusehen.[80] Die Gesamtheit aller möglichen, für das Entscheidungsproblem in Betracht kommenden Aktionen wird als Aktionsraum bezeichnet, der durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist.[81]
(1) Prinzip der Vollständigkeit: Der Entscheidungsträger muss alle möglichen Alternativen kennen und im Modell berücksichtigen. Dies impliziert, dass er auch alle Kombinationen von Einzelmaßnahmen erfasst hat.
(2) Prinzip der Abgeschlossenheit: Zum Zeitpunkt der Entscheidung gilt die Prämisse, dass keine zusätzlichen Information beschaffbar sind, so dass der Aktionsraum als abgeschlossen bezeichnet werden kann.
(3) Prinzip der vollkommenen Alternativenstellung: Der Aktionsraum ist so zu wählen, dass der Entscheidungsträger einerseits gezwungen ist, eine der betrachteten Alternativen zu ergreifen (ggf. die Unterlassungsalternative), andererseits aber auch nur eine einzige der Alternativen verwirklichen kann. Letzteres bedeutet, dass die Wahl jeder Alternative die Verwirklichung einer anderen Alternative ausschließt (Exklusionsprinzip).
(4) Prinzip der Vergleichbarkeit: Alle Alternativen müssen vollständig im Ergebnisraum erfasst werden, damit sie auch dann miteinander verglichen werden können, wenn sie durch einen unterschiedlichen Mitteleinsatz gekennzeichnet sind.
(5) Prinzip der Indifferenz: Der Entscheidungsträger zieht aus der Wahl einer Alternative keinen eigenständigen Nutzen. Der Wert einer Alternative wird erst durch die Konsequenz der gewählten Handlung bestimmt.
(6) Prinzip der Endlichkeit: In den meisten Fällen wird schon aus Praktikabilitätsgründen von einer endlichen Anzahl von möglichen Aktionen ausgegangen, auch wenn dies nicht immer der Realität entspricht.
Als Hauptproblem der Generierung von Alternativen wird die subjektive Vorselektion oder (un-)bewusste Unterdrückung von Aktionsmöglichkeiten durch den Entscheidungsträger gesehen.[82] Aus Gründen der einfacheren Handhabung werden nicht alle Aktionen im Entscheidungsmodell erfasst. Eine zuverlässige Optimierung kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn die aufgeführten Prinzipien eingehalten werden.
2.3.3.3.2 Umweltzustände
Äußere Einflüsse, die sich auf die Bewertung der Alternativen auswirken, aber keine Entscheidungsvariablen darstellen, bezeichnet man als Umweltzustände. Diese können sich aus einem oder mehreren Umweltparametern oder Umweltdaten zusammen setzen. Je nach Zeitpunkt des Eintritts der Umweltdaten unterscheidet man vergangenheitsbezogene und zukunftsbezogene Daten.[83] Die Menge aller relevanten Umweltzustände bildet den Zustandsraum, der folgenden Prinzipien genügen muss.[84]
(1) Exklusionsprinzip: Die Umweltzustände müssen sich gegenseitig ausschließen.
(2) Prinzip der Vollständigkeit: Im Zustandsraum müssen alle denkbaren Umweltzustände erfasst werden. Hierbei sind sämtliche Kombinationen einzelner Umweltparameter zu berücksichtigen.
(3) Prinzip der nutzenrelevanten Zerlegung: Die Zerlegung des Zustandsraumes in Einzelzustände darf einerseits nicht zu grob sein, da sonst der Einfluss spezieller Umweltparameter vernachlässigt wird, was zu Ergebnisverfälschungen führen kann. Andererseits darf die Zerlegung auch nicht zu fein sein, da die Lösung des Entscheidungsproblems u.U. einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde.
(4) Prinzip der Unbeeinflussbarkeit: Es ist darauf zu achten, dass die Umweltzustände unveränderliche Daten darstellen, auf die der Entscheidungsträger keinen Einfluss nehmen kann.
Die reine Kenntnis und das Erfassen aller Umweltzustände reichen für das Grundmodell jedoch nicht aus. Um das Entscheidungsproblem realitätsnah beurteilen zu können, sind zusätzliche Angaben über den Kenntnisstand des Entscheiders über den Eintritt der wahren Zustände notwendig. Hierbei unterscheidet man i.d.R. Sicherheits-, Risiko- und Ungewissheitssituationen.[85]
In einer Sicherheitssituation ist dem Entscheidungsträger der wahre Umweltzustand bekannt, so dass für jede Alternative das Ergebnis sicher bestimmt werden kann.
Liegt demgegenüber eine Risikosituation vor, kennt der Entscheider lediglich subjektive oder objektive Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten verschiedener Umweltzustände. Entsprechend kann auch die Sicherheit des Eintritts der jeweiligen Handlungskonsequenzen nur aufgrund der Wahrscheinlichkeitsverteilungen angegeben werden.
Wenn hingegen nur bekannt ist, dass gewisse Zustände eintreten können, dem einzelnen Zustand aber keine Eintrittswahrscheinlichkeit zugewiesen werden kann, spricht man von einer Entscheidung unter Ungewissheit oder unter Unsicherheit i.e.S.
2.3.3.3.3 Ergebnisfunktion
Die Verknüpfung zwischen den Handlungsalternativen und den Umweltzuständen wird durch die Ergebnisfunktion hergestellt. Auf der Grundlage von natur-, sozialwissenschaftlicher oder sonstiger Gesetzmäßigkeiten werden jeder Kombination aus den Elementen des Aktionsraumes und den Elementen des Zustandsraumes entsprechende Handlungskonsequenzen zugeordnet. Auch hinsichtlich dieser Konsequenzen können Sicherheits-, Risiko- oder Ungewissheitssituationen unterschieden werden, die vom jeweiligen Informationsstand des Entscheidungsträgers abhängig sind. I.d.R. geht man jedoch im Rahmen der Ergebnisfunktion von einem sicheren Erkenntnisstand über die eintretenden Konsequenzen aus.[86]
Bei der Ergebnisfunktion handelt es sich grundsätzlich um eine Funktion zweier unabhängiger Variablen, nämlich einer Alternative und eines Umweltzustandes. Durch die Abbildung der angestrebten Ergebnisart werden die Ergebnishöhe und die Sicherheit des Ereignisses zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt. Formal ergibt sich für die Handlungsalternativen Ai (i=1,2,..,n) und die Umweltzustände Sj (j=1,2,..,m) mit den dazugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeiten wj (j=1,2,..,m) der Ergebnisvektor Eij aus der folgenden Funktion:
Eij = f (Ai, wj • Sj)
Wenn die Wertvorstellungen des Entscheidungsträgers jedoch zusätzlich von Variationen nach Art und Zeit der Ereignisse abhängen, kann die Ergebnisfunktion zu einer Vektorfunktion, die als Ergebnisraum eine Matrix abbildet, ausgebaut werden.[87] In diesen Fällen werden jeder Kombination aus Handlungsalternative und Umweltzustand mehrere Ergebnisausprägungen zugeordnet.
2.3.3.4 Ergebnismatrix
In der Ergebnismatrix sollen die Wirkungszusammenhänge der Elemente des Entscheidungsfeldes zusammengefasst werden. Hierbei kommt es jedoch nicht zu einer simplen Transformation der Ergebnisfunktion in eine Matrix[88], da die Vielfalt der möglichen Ergebnisausprägungen den Rahmen einer übersichtlichen Darstellung sprengen würde. Es ist vielmehr die Aufgabe des Entscheidungsträgers, geeignete Ergebnisdefinitionen zu liefern, um nur die konkret erwünschten Ergebniskriterien in einer einzigen Ergebnisvariablen oder einem Ergebnisvektor anzeigen zu können.[89] Zusätzlich sind in Risikosituationen die Wahrscheinlichkeitsangaben der jeweiligen Umweltzustände anzugeben. Für den Beispielsfall dreier Handlungsalternativen Ai (i=1,2,3) und dreier Umweltzustände Sj (j=1,2,3) mit den dazugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeiten wj (j=1,2,3) ergibt sich unter Berücksichtigung einer Zielgröße die in Tabelle 1 dargestellte Ergebnismatrix mit den Ergebnisvariablen Eij.[90]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Ergebnismatrix bei einer Zielgröße
Durch die Einbeziehung mehrerer Zielsetzungen oder verschiedener erwarteter Zeitpunkte der Ergebnisrealisation lässt sich diese Matrix erweitern[91], so dass auch komplexere Entscheidungsprobleme in dieser Form dargestellt werden können. Wenn die Anzahl der Handlungsalternativen, Umweltzustände oder Zielkriterien jedoch unüberschaubar groß wird, ist durch die Ergebnismatrix keine Übersicht über das Entscheidungsproblem mehr gewährleistet, so dass ggf. eine andere Darstellungsform vorzuziehen ist.[92]
2.3.3.5 Entscheidungsmatrix
Durch die Ergebnismatrix hat der Entscheidungsträger bereits einen Überblick über die ggf. nach bestimmten Kriterien ausgesuchten Konsequenzen aller in Betracht kommenden Handlungsalternativen. Zur endgültigen Lösung des Entscheidungsproblems müssen diese Ergebnisse noch an die jeweiligen Zielvorstellungen angepasst werden. Auf der Grundlage seiner persönlichen Präferenzen stellt der Entscheidungsträger konkrete Entscheidungsregeln auf, die auf die Resultate der Ergebnismatrix angewendet werden müssen. Üblicherweise erfolgt die Abbildung der vom Entscheidungsträger bewerteten Ergebnisse in Form einer Nutzenfunktion.[93] Jeder Ergebniskombination wird durch diese Funktion ein bestimmter Nutzenwert zugeordnet, wobei sowohl ordinale Nutzengrößen, die nur die absolute Rangfolge der Nutzenwerte angeben, als auch kardinale Nutzengrößen, die zusätzlich den Abstand einzelner Nutzenwerte untereinander messen, verwendet werden können.[94]
Die Transformation der Ergebnismatrix in die Entscheidungsmatrix erfolgt üblicherweise dadurch, dass die einzelnen Ergebnisvariablen durch den entsprechenden Nutzenwert ersetzt werden.[95] Zur Bestimmung der optimalen Entscheidung müssten dann aber noch sämtliche Partialnutzen jeder Handlungsalternative durch Addition oder erneute Gewichtung zusammengefasst werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, für jede Handlungsalternative gleich einen Gesamtnutzen zu bilden, der in einer der Ergebnismatrix zusätzlich angehängten rechten Spalte dargestellt werden kann.[96] Diese Darstellungsform hat den Vorteil, dass man auf einen Blick sowohl sämtliche aus den Alternativen resultierenden Konsequenzen als auch den jeweils entstehenden Gesamtnutzen erkennen kann.
Unabhängig von der Darstellungsform ist letztlich allein entscheidend, dass diejenige Alternative, die dem Entscheidungsträger den an seinen persönlichen Präferenzen ausgerichteten höchsten Gesamtnutzen bringt, auch tatsächlich die optimale Entscheidung liefert.
2.3.4 Andere Darstellungsformen
Wie bereits erwähnt, kann die Darstellung eines Entscheidungsproblems in einer Ergebnis- bzw. Entscheidungsmatrix unzweckmäßig sein, wenn die Anzahl der zu betrachtenden Handlungsalternativen, Umweltzustände oder Zielkriterien unüberschaubar groß ist. Auch bei mehrstufigen Entscheidungsprozessen ist es günstiger, auf andere Darstellungsformen zurückzugreifen. Die drei wichtigsten sonstigen Darstellungsformen sind die Entscheidungstabelle, das Flussdiagramm und der Entscheidungsbaum.[97]
Eine Entscheidungstabelle besteht in den Zeilen aus den Umweltvariablen sowie den Alternativen. In den Spalten werden durch Ja/Nein-Bedingungen sämtliche Kombinationen der Umweltvariablen erfasst und diese durch Entscheidungsregeln den Alternativen zugeordnet (siehe hierzu beispielhaft Tabelle 2). Obwohl die Spaltenanzahl durch logische Ausschlüsse bei den Kombinationen der Umweltvariablen verringert werden kann, eignet sich die Entscheidungstabelle nicht für komplexe Entscheidungsprobleme. Ein Nachteil besteht zudem in der fehlenden Anzeige der Ergebnisfunktion.[98]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Beispiel einer Entscheidungstabelle
Flussdiagramme können vor allem bei sich wiederholenden Entscheidungsprozessen eingesetzt werden. Wesentliche Elemente dieser Darstellungsform sind Bedingungen in Ja/Nein-Form und Handlungsanweisungen.[99] Beispielhaft kann ein Flussdiagramm die in Abbildung 5 dargestellte Form aufweisen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Beispiel eines Flussdiagramms
Sehr gebräuchlich in der Darstellung von Entscheidungsproblemen ist der Einsatz von Entscheidungsbäumen. Diese Darstellungsform wird insbesondere in Risikosituationen und bei mehrstufigen Entscheidungen verwendet. In ihr kommt besonders der sequentielle Ablauf eines Entscheidungsprozesses zum Ausdruck, da sich i.d.R. Handlungsalternativen und Umweltzustände an den Ästen des Baumes abwechseln.[100] In einfacher Form kann ein Entscheidungsbaum die Gestalt der Abbildung 6 haben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Beispiel eines Entscheidungsbaumes
Welche Darstellungsform jeweils gewählt werden sollte, richtet sich nach den besonderen Umständen des Einzelproblems.
3 Entwicklung eines steueroptimalen Entscheidungsmodells
3.1 Zusätzliche Prämissen des Modellansatzes
Anhand des allgemeinen Grundmodells der normativen Entscheidungstheorie wird nun ein Entscheidungsmodell entwickelt, das auf die Besonderheiten der Ausgangsproblematik eingeht und sinnvolle Ansätze zur Lösung des Entscheidungsproblems liefern kann. Bevor die einzelnen Modellelemente charakterisiert werden, sind einige zusätzliche Prämissen aufzustellen.
Zunächst ist festzuhalten, dass die Einflüsse der deskriptiven Entscheidungstheorie unberücksichtigt bleiben. Es muss unterstellt werden, dass der Entscheidungsträger seine Entscheidung auf der Grundlage eines rational orientierten Verhaltens trifft. Die Ausrichtung der Entscheidung erfolgt ausschließlich nach den vom Entscheidungsträger festgelegten Zielvorstellungen und Präferenzen. Aus Vereinfachungsgründen ist die Personengesellschaft hierbei als ein Kollektiv anzusehen, das zwar aus mehreren Einzelgesellschaftern besteht, aber hinsichtlich der Optimierung der steuerlichen Folgen der Vermögensteilung als ein einzelner Entscheidungsträger mit einheitlichem Willen auftritt. Um die zusätzliche Berücksichtigung von Abstimmungs- und Einigungsvorgängen zu vermeiden, wird unterstellt, dass alle Gesellschafter nach einer Minimierung der Gesamtsumme aus den Steuerbelastungen der Gesellschaft und den Steuerbelastungen der Gesellschafter streben, unabhängig davon, wie sich die Steuerlast auf die Steuersubjekte verteilt. Der höchste Gesamtnutzen wird erreicht, wenn die Gesamtsteuerlast am geringsten ist.
Hinsichtlich der Personengesellschaft, deren Vermögen geteilt werden soll, ist zu unterstellen, dass diese nicht durch Umwandlung aus einer Kapitalgesellschaft innerhalb der letzten fünf Jahre entstanden ist und dass auch keine Vermögensübertragung von einer Kapitalgesellschaft in diesem Zeitraum vorlag, so dass keine gewerbesteuerlichen Belastungen aufgrund des § 18 Abs. 4 UmwStG entstehen.
Sofern in der weiteren Untersuchung der Begriff des Teilbetriebs aufgeführt ist, wird dieser nicht weiter problematisiert. Es ist davon auszugehen, dass jeweils ein Teilbetrieb vorliegt, der die jeweiligen Anforderungen der steuerlichen Normen erfüllt.[101] Insofern ist von einer überwiegend funktionalen Betrachtungsweise auszugehen. Der Teilbetrieb muss einer vom Restbetrieb abgrenzbaren Tätigkeit dienen, durch die eine eigenständige unternehmerische Leistung am Markt erbracht werden kann.[102]
Wenn im Fall einer doppelstöckigen Personengesellschaft Mitunternehmeranteile der Untergesellschaft übertragen werden, kann es hierdurch zu einem anteiligen Untergang des Verlustabzuges i.S. des § 10a GewStG auf der Ebene der Untergesellschaft kommen.[103] Im Rahmen der Modellbetrachtung werden solche Effekte vernachlässigt, da sich die Untersuchung auf die Auswirkungen der Teilungsvorgänge hinsichtlich des Gewerbeverlustes der Obergesellschaft beschränken soll.
Das Modell orientiert sich vornehmlich an einer einperiodigen Betrachtungsweise. Es werden daher hauptsächlich die Steuerfolgen des Veranlagungs- bzw. Erhebungszeitraumes untersucht, in dem die Teilung des Gesellschaftsvermögens erfolgt. Hierin einbezogen sind rückwirkende Änderungen der steuerlichen Bemessungsgrundlagen, die sich aufgrund des Nichteinhaltens einer Sperrfrist ergeben können. Hinsichtlich künftiger Veranlagungs- und Erhebungszeiträume wird lediglich festgestellt, inwiefern ein vortragsfähiger Gewerbeverlust mit künftigen positiven Gewerbeerträgen verrechnet werden kann, und ob durch den Teilungsvorgang einbringungsgeborene Anteile i.S. des § 21 UmwStG entstehen, die besondere Steuerfolgen nach sich ziehen können. Sonstige steuerliche Auswirkungen, wie bspw. veränderte Abschreibungsmöglichkeiten, bleiben in den Folgejahren der Teilung unberücksichtigt.
Ebenfalls unberücksichtigt bleibt der Einfluss der Teilung auf sonstige betriebliche Erfolgskomponenten (z.B. Absatz, Organisation). Hierdurch ist gewährleistet, dass der Entscheidungsträger diejenige Handlungsalternative als optimal auswählen kann, die seine unternehmenspolitischen Zielsetzungen erfüllt und die geringsten ertragsteuerlichen Belastungen verursacht.
3.2 Personengesellschaft als Entscheidungsträger
3.2.1 Begriff der Personengesellschaft und des Gesamthandsvermögens
Zur Beschreibung des Entscheidungsträgers ist zunächst eine Auseinandersetzung mit dem zivilrechtlichen Begriff der Personengesellschaft notwendig. Hierdurch wird gleichzeitig erläutert, weshalb sich die Untersuchung auf die Gesellschaftsformen GbR, OHG und KG beschränkt.
Unter der Bezeichnung Personengesellschaft werden üblicherweise folgende Gesellschaftstypen zusammengefasst:[104]
- die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (oder BGB-Gesellschaft),
- die offene Handelsgesellschaft,
- die Kommanditgesellschaft,
- die stille Gesellschaft,
- die Partenreederei,
- die Freiberufliche Partnerschaft (oder Partnerschaftsgesellschaft),
- die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung.
Diese Gesellschaftsformen lassen sich sowohl von den Vereinen als auch von deren wichtigster Unterform, den Körperschaften, abgrenzen. Während eine Personengesellschaft insbesondere hinsichtlich ihres Fortbestandes von der Individualität ihrer Gesellschafter abhängig ist, stellt ein Verein eine weitgehend verselbständigte Rechtsfigur dar, die auch bei Gesellschafteraustritten und -wechseln unverändert fortbestehen bleibt.[105] Die besondere Gesellschafterbezogenheit der Personengesellschaft kommt durch deren Selbstorganschaft zum Ausdruck. Während Körperschaften und andere Vereine fremdorganschaftlich strukturiert sind, üben die Gesellschafter einer Personengesellschaft die Geschäftsführung und Vertretung in eigener Person aus.[106]
Die Grundform aller Personengesellschaften stellt die GbR dar.[107] Sie kann grundsätzlich für jeden erlaubten gemeinsamen Zweck der Gesellschafter gegründet und auf Dauer oder nur vorübergehend betrieben werden.[108]
Wenn eine Gesellschaft jedoch ein Handelsgewerbe betreibt, ist es zwingend erforderlich, die Rechtsform der OHG oder der KG zu wählen. Diese beiden Gesellschaftstypen werden daher auch als Personenhandelsgesellschaften bezeichnet.[109] OHG und KG sind zwar keine juristischen Personen, können aber unter dem Namen ihrer Firma Rechte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum an Grundstücken erwerben und vor Gericht klagen oder verklagt werden, während bei der GbR stets alle Gesellschafter in ihrer Gesamtheit Träger von Rechten und Pflichten sind.[110]
Gemeinsam ist den Rechtsformen der GbR, OHG und KG die gesamthänderische Bindung des Gesellschaftsvermögens. Alle Vermögenspositionen der Gesellschaft stehen den Gesellschaftern zur gesamten Hand zu, ohne dass ein einzelner Gesellschafter unmittelbare Teilrechte an einzelnen Wirtschaftsgütern besitzt und auch nicht über einzelne Gegenstände eigenmächtig verfügen kann. Daher spricht man in diesem Zusammenhang auch von der Gesamthandsgemeinschaft oder Gesamthandsgesellschaft.[111] Umstritten ist hierbei, ob die Gesamthand als ein gebundenes Sondervermögen der Gesamthänder oder aber als ein eigenständiges Rechtssubjekt anzusehen ist.[112]
Im Gegensatz zur GbR, OHG und KG, die im Wirtschaftsleben offen als Gesellschaft auftreten, bildet die Stille Gesellschaft eine reine Innengesellschaft. Der stille Gesellschafter ist nur durch eine Kapitaleinlage mit der Gesellschaft verbunden und lediglich am Gewinn und ggf. am Verlust, nicht aber am Vermögen des Inhabers des Handelsgeschäfts i.S. des § 230 Abs. 1 HGB beteiligt. Daher liegt kein gesamthänderisches Vermögen vor.[113]
Die Sonderrechtsformen Partnerschaftsgesellschaft, Partenreederei und EWIV werden aufgrund ihrer relativ geringen praktischen Bedeutung nicht weiter behandelt. Als mögliche Entscheidungsträger verbleiben daher nur die Gesellschaften in der Rechtsform einer GbR, OHG und KG, da die stille Gesellschaft kein Gesamthandsvermögen besitzt, das unter den Gesellschaftern geteilt werden kann.
Hinsichtlich des Umfangs der Geschäftsführungsbefugnis wird unterstellt, dass die Entscheidung für eine bestimmte Teilungsvariante eine Handlung i.S. des § 116 Abs. 2 HGB darstellt, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgeht. Hierdurch wird über § 164 Satz 1 letzter Halbsatz HGB sichergestellt, dass auch die Kommanditisten einer KG auf den Entscheidungsvorgang einwirken können.[114]
3.2.2 Personengesellschaft im Steuerrecht
Wenn die Gesellschafter einer Personengesellschaft als Entscheidungsträgergemeinschaft versuchen, das Problem der steueroptimalen Teilung des Vermögens der Gesellschaft zu lösen, müssen sie beachten, dass die verschiedenen Teilungsvorgänge nicht nur steuerliche Konsequenzen auf der Gesellschaftsebene, sondern auch Auswirkungen im persönlichen Bereich der Gesellschafter hervorrufen. Dies liegt daran, dass die Personengesellschaft nur als ein partielles (oder teilrechtsfähiges) Steuerrechtssubjekt angesehen wird.[115]
Im Einkommensteuerrecht werden die gewerblichen Einkünfte einer Personengesellschaft im Rahmen des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erfasst. Die Voraussetzung hierfür ist, dass die Personengesellschaft eine Mitunternehmerschaft bildet, in der jeder Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen ist, d.h. ein Mitunternehmerrisiko trägt und eine Mitunternehmerinitiative entfaltet.[116] In dem zweistufigen Verfahren zur Einkunftsermittlung der Mitunternehmer ist die Personengesellschaft jedoch ausschließlich auf der ersten Stufe als Gewinn- oder Einkunftsermittlungssubjekt beteiligt, während auf der zweiten Stufe die betreffenden Einkünfte auf die Gesellschafter verteilt werden. Die anschließende Besteuerung der Einkünfte findet nur noch in der privaten Einkommensteuersphäre der Gesellschafter statt.
Im gewerbesteuerlichen Sinne ist eine Steuerrechtssubjekteigenschaft der Personengesellschaft gegeben, da diese durch ihre gewerbliche Tätigkeit gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 GewStG zum Steuerschuldner wird.[117] Die objektive Gewerbesteuerpflicht verbleibt jedoch durch die in § 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG enthaltene Verweisung auf § 15 EStG bei den einzelnen Gesellschaftern.[118]
Zusätzlich müssen die Entscheidungsträger beachten, dass das zu teilende Vermögen der Gesellschaft im steuerlichen Sinne umfassender als das zivilrechtliche Gesamthandsvermögen ist. Neben dem gesamthänderisch gehaltenen Gesellschaftsvermögen, das als Betriebsvermögen in der Gesamthandsbilanz der Gesellschaft ausgewiesen wird, kann jeder einzelne Gesellschafter über Sonderbetriebsvermögen verfügen, wenn er, allein oder mit mehreren Gesellschaftern zusammen, Wirtschaftsgüter besitzt, die dem Betrieb der Personengesellschaft dienen oder zur Stärkung der Beteiligung des Mitunternehmers eingesetzt werden.[119] Dieses Sonderbetriebsvermögen, das in Sonderbilanzen für jeden einzelnen Gesellschafter festgehalten wird, ist für die Bestimmung des steuerlichen Gesamtvermögens einer Personengesellschaft ebenso zu erfassen wie das Vermögen aus Ergänzungsbilanzen. In einer Personengesellschaft kann die Erstellung von Ergänzungsbilanzen erforderlich werden, wenn personenbezogene Steuervergünstigungen nur für einzelne Gesellschafter anteilig in Anspruch genommen werden können, wenn ein Gesellschafterwechsel erfolgt oder wenn Wirtschaftsgüter in eine Personengesellschaft eingebracht werden.[120]
Im Rahmen des Modells beschränken sich die Analysen der Steuerfolgen aus Vereinfachungsgründen im wesentlichen auf die Teilung des Gesamthandsvermögens. Auf das Sonderbetriebsvermögens wird lediglich in einzelnen Unterabschnitten hingewiesen.
3.3 Zielsystem der Personengesellschaft
3.3.1 Ziele der Personengesellschaft
Das der Ausgangsproblematik zugrunde liegende Hauptziel der Personengesellschaft liegt in der Teilung des gesellschaftlichen Gesamtvermögens. Diese Zielsetzung kann jedoch nur dann sinnvoll sein, wenn durch die Teilung ein bestimmter Zweck verfolgt werden soll. Daher muss die Hauptzielsetzung durch betriebliche Gründe konkretisiert werden. Im Rahmen dieser Untersuchung werden drei strategisch ausgerichtete Zielsetzungen aus dem unternehmenspolitischen Sektor betrachtet, die als Gründe für eine Teilung des Gesellschaftsvermögens herangezogen werden können.
Der erste Grund für die Teilung des Vermögens könnte die Überlegung sein, dass ein aus mehreren Betriebsteilen bestehender Gewerbebetrieb durch seine Größe oder Zusammensetzung unrentabel geworden ist, da z.B. aufgrund eines riesigen Verwaltungsapparates Entscheidungswege zu lang oder die Koordinierung von Abläufen zu kompliziert geworden sind. Daher kann angestrebt werden, die funktional bereits isolierten Betriebsteile auch auf gesellschaftsrechtlicher Ebene voneinander zu trennen. Weitere Anlässe für diese Form der Dekonzentration von Unternehmensbereichen können die Unterschiedlichkeit einzelner Geschäftszweige, regionale Aspekte, die Konzentration auf ein Kerngeschäft sowie die Ausgliederung neuer Geschäftsfelder sein. Hierbei wird für die weitere Untersuchung davon ausgegangen, dass die Betriebsteile jeweils dem steuerrechtlichen Teilbetriebsbegriff entsprechen. Außerdem werden 100%-ige Beteiligungen an Kapitalgesellschaften als Betriebsteile angesehen, da auch der Wunsch nach einer Auslagerung von reinen Holdingfunktionen zu einer solchen Zerlegung des Betriebes führen kann.
Als zweiter Grund für die Teilung soll die Trennung von Gesellschafterstämmen betrachtet werden. Eine solche Trennung kann notwendig werden, wenn Gesellschafterstämme zerstritten sind oder nicht mehr effektiv miteinander zusammenarbeiten können.[121]
Schließlich kann eine Teilung des Gesellschaftsvermögens durch die Auflösung der Gesellschaft veranlasst sein. Die Teilung des Vermögens dient in diesem Falle hauptsächlich der Befriedigung der Ansprüche der einzelnen Gesellschafter. Auf konkrete Auflösungsgründe soll nicht weiter eingegangen werden.[122]
Als Nebenziel soll diese Teilung steueroptimal durchgeführt werden. Hierunter ist das operative Ziel zu verstehen, die durch die Teilung ggf. hervorgerufenen zusätzlichen Steuerbelastungen möglichst gering zu halten. Die Betrachtung beschränkt sich hierbei auf die Minimierung der Ertragsteuerbelastung durch die Gewerbesteuer bei der Personengesellschaft und die Einkommensteuer bei den Gesellschaftern. Negative Besteuerungsfolgen drohen hierbei vor allem, wenn die im zu teilenden Vermögen ruhenden stillen Reserven aufgedeckt werden müssen. Daher werden die Gesellschafter der Personengesellschaft im Regelfall eine Buchwertfortführung anstreben. Darüber hinaus besteht für die Gesellschafter der Personengesellschaft die Zielsetzung, nach der Teilung einen möglichst hohen Anteil des ggf. bestehenden vortragsfähigen Gewerbeverlustes i.S. des § 10a GewStG zu behalten, um diesen mit zukünftigen positiven Gewerbeerträgen verrechnen zu können.
Zur Klassifizierung der Zielsetzungen ist anzumerken, dass es sich bei den unternehmenspolitischen Zielen um Fixierungsziele handelt, da jeweils ein bestimmter Zustand angestrebt wird. Bei den steuerlichen Zielen liegen hingegen Extremierungsziele vor, da die Ertragsteuerbelastung minimiert und der Erhalt des vortragsfähigen Gewerbeverlustes maximiert werden sollen.
Zusammenfassend ergibt sich folgende Übersicht über die in diesem Modell zu betrachtenden Ziele der Personengesellschaft:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Ziele der Personengesellschaft
[...]
[1] Vgl. TIPKE (2000), S. 19 f.
[2] Vgl. HABERSTOCK/ BREITHECKER (2000), S. 108; KUSSMAUL (2000), S. 2.; SCHULT (1998), S. 4 f.; GROTHERR (1995), S. 101.
[3] Vgl. HABERSTOCK/ BREITHECKER (2000), S. 1; Lang, in: TIPKE/LANG (1998), § 1 Rz. 47; WÖHE/ BIEG (1995), S. 1.
[4] GROTHERR (1995), S. 101.
[5] Vgl. HABERSTOCK/ BREITHECKER (2000), S. 1; WÖHE/ BIEG (1995), S. 1.
[6] Vgl. KUSSMAUL (2000), S. 2; WÖHE/ BIEG (1995), S. 1; WÖHE (1988), S. 25.
[7] Vgl. HABERSTOCK/ BREITHECKER (2000), S. 2; KUSSMAUL (2000), S. 2 f.; SCHULT (1998), S. 5; Lang, in: TIPKE/ LANG (1998), § 1 Rz. 51; GROTHERR (1995), S. 101 f.; WÖHE/ BIEG (1995), S. 2; WÖHE (1988), S. 25 f.
[8] Vgl. Lang, in: TIPKE/ LANG (1998), § 1Rz. 50; WÖHE/ BIEG (1995), S. 1 f.; WÖHE (1988), S. 25.
[9] Vgl. TIPKE (2000), S. 23; sowie Lang, in: TIPKE/ LANG (1998), § 1 Rz. 49, die von Steuerberatungswissenschaft sprechen.
[10] Zur Abgrenzung zum Urteil des FG Münster vom 7.12.2000, EFG 2002, S. 129, in dem eine geringfügige gewerbliche Betätigung nicht zur Einkünfteinfektion nach § 15 Abs. 3 Satz 1 EStG führt.
[11] Lediglich bei der Realteilung wird in einem Exkurs auf den Spitzenausgleich eingegangen, siehe Unterabschnitt 3.4.4.3.3 auf Seite 78.
[12] Alle Gesetzesangaben im Text beziehen sich auf diesen Stand, es sei denn, im Text wird ausdrücklich auf ältere Gesetzesfassungen verwiesen.
[13] Siehe die Definitionsansätze bei: ROMMELFANGER/ EICKEMEIER (2002), S. 1; KAHLE (1998), S. 9; LAUX (1998), S. 1; SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 1; WERNER (1992), S. 10; REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 11; PFOHL (1972), S. 306.
[14] SCHNEIDER (1995), S. 1; PFOHL (1972), S. 306.
[15] ROMMELFANGER/ EICKEMEIER (2002), S. 1; LAUX (1998), S. 1; SCHNEIDER (1995), S. 1; SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 1; REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 11; SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 4; PFOHL (1972), S. 306.
[16] ROMMELFANGER/ EICKEMEIER (2002), S. 1.
[17] KAHLE (1998), S. 9.
[18] Vgl. REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 11; SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 4.
[19] Vgl. ROMMELFANGER/ EICKEMEIER (2002), S. 2; BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 1; REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 11.
[20] Vgl. SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 2.
[21] Vgl. FLEISCHMANN (1975), S. 61.
[22] Vgl. BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 3; LAUX (1998), S. 2; REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 12.
[23] Vgl. MEYER (1999), S. 2.
[24] Vgl. LAUX (1998), S. 2; SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 1; sowie BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 3 f., die jedoch von „subjektiver Rationalität“ ausgehen.
[25] Vgl. SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 2.
[26] Vgl. BITZ (1981), S. 5.
[27] Vgl. LAUX (1998), S. 2; SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 3.
[28] Vgl. MEYER (1999), S. 2; BITZ (1981), S. 6.
[29] Vgl. REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 12 f.
[30] So z.B. SCHNEIDER (1995), S. 11 f.; FLEISCHMANN (1975), S. 61.
[31] Hierauf weisen BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 6 f. hin.
[32] Vgl. PFOHL/ BRAUN (1981), S. 74 f.
[33] Vgl. HEINEN (1969), S. 207.
[34] Vgl. HEINEN (1969), S. 210 f.; HEINEN (1971), S. 430.
[35] Vgl. HEINEN (1985), S. 980-989.
[36] So bei BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 11; LAUX (1998), S. 2; SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 5-7.
[37] Vgl. BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 11 f.; KAHLE (1998), S. 24 f.
[38] Dies wird deutlich herausgestellt von: REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 201-203.
[39] Vgl. BRONNER (1999), S. 16 f.; KAHLE (1998), S. 42 f.; WITTE (1964), S. 114-122.
[40] Vgl. BRONNER (1999), S. 16 f. unter besonderer Beachtung des Diagramms auf S. 16.
[41] Vgl. KAHLE (1998), S. 43, KORTE (1977), S. 53.
[42] Vgl. REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 221, die sich auf HEINEN (1976), S. 205-213 beziehen.
[43] Siehe z.B.: 5-Phasen-Prozess von LAUX (1998), S. 8-12; 4-Phasen-Prozess von ADAM (1996), S. 31-35; 7-Stufen-Planungsmodell von SCHNEIDER (1995), S. 22-29; Problemlösungszyklus von LAAGER (1978), S. 7-11; 5-Phasen-Gliederung von BUTH (1977), S. 105 f.; 8-Phasen-Schema von IRLE (1971), S. 47-51; 3-Phasen-Aufbau von SZYPERSKI (1971), S. 42 f.
[44] Vgl. LAUX (1998), S. 9.
[45] Vgl. LAAGER (1978), S. 10.
[46] Vgl. LAUX (1998), S. 5-7.
[47] Vgl. BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 13 f.
[48] Vgl. ADAM (1996), S. 81-95 mit weiteren Erläuterungen.
[49] Vgl. ROMMELFANGER/ EICKEMEIER (2002), S. 25 f., sowie BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 40-43, die zusätzlich noch das Kriterium eines spieltheoretischen Gegenspielers erwähnen.
[50] Vgl. PFOHL/ BRAUN (1981), S. 21.
[51] Vgl. LAUX (1998), S. 52-54.
[52] Vgl. KAHLE (1998), S. 83-89.
[53] PFOHL/ BRAUN (1981), S. 23.
[54] Vgl. SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 40.
[55] Vgl. PFOHL/ BRAUN (1981), S. 25.
[56] Vgl. REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 15.
[57] Eine explizite Beschreibung der einzelnen Elemente erfolgt in Unterabschnitt 2.3.3 auf Seite 16.
[58] Vgl. die Darstellungen bei SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 16; SCHEFFLER (1992), S. 241; SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 41.
[59] Vgl. LAUX (1998), S. 41; SCHNEEWEISS (1966), S. 128-130.
[60] Lediglich bei REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 43, und bei SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 44, finden sich Hinweise auf den Entscheidungsträger als Modellbestandteil.
[61] Vgl. SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 44 f.
[62] Vgl. PFOHL/ BRAUN (1981), S. 433.
[63] Vgl. zu dieser Problematik KAHLE (1998), S.165-178.
[64] Siehe hierzu die Zusammenstellung bei MEYER (1999), S. 135-160.
[65] Vgl. BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 28; PFOHL/ BRAUN (1981), S. 40.
[66] Siehe hierzu BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 29.
[67] Vgl. LAUX (1998), S. 25; DINKELBACH/ KLEINE (1996), S. 15-19; BITZ (1981), S. 35-38.
[68] Vgl. z.B. ROMMELFANGER/ EICKEMEIER (2002), S. 17; LAUX (1998), S. 65-67; ADAM (1996), S. 107; REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 47-49.
[69] Siehe hierzu KAHLE (1998), S. 29 f.
[70] Vgl. BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 29 f.; ADAM (1996), S. 104 f.; SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 23-27; REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 57-69; PFOHL/ BRAUN (1981), S. 44 f.
[71] Siehe SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 48.
[72] Vgl. SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 29.
[73] REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 69.
[74] Vgl. LAUX (1998), S. 25.
[75] Vgl. LAUX (1998), S. 28; PFOHL (1972), S. 311.
[76] Vgl. PFOHL (1972), S. 315 f.
[77] Näher erläutert bei BITZ (1981), S. 29.
[78] Es sei u.a. verwiesen auf: LAUX (1998), S. 143-236; BITZ (1981), S. 87-213; PFOHL (1972), S. 316-321.
[79] Für Einzelheiten siehe u.a. BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 131-138; SELLMAIER (2000), S. 15-18; MEYER (1999), S. 37-42; LAUX (1998), S. 103-118; PFOHL (1972), S. 321-325.
[80] Vgl. BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 16; SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 17; REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 23; PFOHL/ BRAUN (1981), S. 27; SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 41.
[81] Siehe BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 16-18; SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 16-18; REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 23-26; PFOHL/ BRAUN (1981), S. 26-28.
[82] Siehe hierzu z.B. SCHNEEWEISS (1966), S. 128 f.; KAHLE (1998), S. 49 f. (Vgl. auch Fn. 59 auf Seite 16).
[83] Vgl. REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 29.
[84] Vgl. REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 30-33; PFOHL/ BRAUN (1981), S. 29 f.
[85] Vgl. BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 19; MEYER (1999), S. 18; LAUX (1998), S. 22 f.; PFOHL/ BRAUN (1981), S. 31.
[86] Vgl. BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 23-26.
[87] Vgl. SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 20 f.
[88] So aber SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 43.
[89] Vgl. SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 21; BITZ (1981), S. 10 f.
[90] Vgl. die Darstellungen bei: MEYER (1999), S. 20; LAUX (1998), S. 35; PFOHL/ BRAUN (1981), S. 39.
[91] Vgl. BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 26 f.
[92] Vgl. REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 86. Siehe zu anderen Darstellungsformen Unterabschnitt 2.3.4 auf Seite 26.
[93] Vgl. BAMBERG/ COENENBERG (2000), S. 36 f.; SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 30 f.
[94] Siehe SCHNEEWEISS (1966), S. 126.
[95] Siehe hierzu die Ausführungen und Matrizen bei MEYER (1999), S. 61, SCHNEEWEISS (1966), S. 126; sowie PFOHL/ BRAUN (1981), S. 48 f., SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 48 f., die von der Nutzenmatrix sprechen.
[96] Vgl. REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 86 f.
[97] Weitere Formen findet man z.B. bei KAHLE (1998), S. 53-59.
[98] Vgl. KAHLE (1998), S. 58-60; REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 90 f.; SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 50-52.
[99] Vgl. KAHLE (1998), S. 56 f.; SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 50 f.
[100] Vgl. SELLMAIER (2000), S. 86-93; KAHLE (1998), S. 54-56; SIEBEN/ SCHILDBACH (1994), S. 38; REHKUGLER/ SCHINDEL (1990), S. 87 f.; BITZ (1981), S. 324-327; SZYPERSKI/ WINAND (1974), S. 49 f.
[101] Z.B. § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG, § 20 Abs. 1 Satz 1 UmwStG.
[102] Vgl. KUPFER (2000), S. 204.
[103] Vgl. von Twickel, in: BLÜMICH (06/1997), § 10a GewStG Rz. 89; sowie HERZIG/ FÖRSTER/ FÖRSTER (1996), S. 1032, die zwischen Realteilungs- und Einbringungsfällen differenzieren.
[104] Vgl. KRAFT/ KREUTZ (2000), S. 3; K. SCHMIDT (1997), S. 47.
[105] Vgl. EISENHARDT (2000), Rz. 12 f.; K. SCHMIDT (1997), S. 47; C. MÜLLER (1993), S. 7.
[106] Vgl. KESSLER/ SCHIFFERS (1999), § 1 Rz. 17; KÜBLER (1998), S. 21.
[107] Vgl. ROTH (2001), Rz. 187; EISENHARDT (2000), Rz. 12; KRAFT/ KREUTZ (2000), S. 95.
[108] Vgl. GIEFERS (1996), Rz. 1.
[109] Vgl. KESSLER/ SCHIFFERS (1999), § 1 Rz. 5.
[110] Vgl. GIEFERS (1996), Rz. 8, der jedoch auch auf Meinungen zur Befürwortung der Rechtsfähigkeit einer GbR verweist.
[111] Vgl. ROTH (2001), Rz. 202; KRAFT/ KREUTZ (2000), S. 53 f.; HALLERBACH (1999), S. 15; KÜBLER (1998), S. 27 f.
[112] Vgl. K. SCHMIDT (1997), S. 205 m.w.N.; C. MÜLLER (1993), S. 9.
[113] Vgl. ROTH (2001), Rz. 379; NEU (1999), § 13 Rz. 3; K. SCHMIDT (1997), S. 1837 f.
[114] Vgl. Hopt, in: BAUMBACH/ HOPT (2000), § 164 Rz. 2.
[115] Vgl. HERRMANN (1998), S. 87; sowie BODDEN (1996), S. 73 f.; jeweils unter Hinweis auf den BFH-Beschluss vom 25.6.1984, BStBl. II 1984, 751.
[116] Vgl. BFH-Beschluss vom 25.6.1984, BStBl. II 1984, 761-763.
[117] Vgl. KATTERBE (1999), Rz. 295; BODDEN (1996), S. 74.
[118] Vgl. KATTERBE (1999), Rz. 294 unter Hinweis auf die ständige BFH-Rechtsprechung; a.A. Walpert in: SUDHOFF (1999), 5.A Rz. 72; BODDEN (1996), S. 74.
[119] Siehe R 13 Abs. 2 EStR 2001.
[120] Vgl. Hottmann, in: ZIMMERMANN (2000), B Rz. 220.
[121] Vgl. DIERS (2001), S. 430; Sagasser/ Sickinger, in: SAGASSER/ BULA/ BRÜNGER (2000), N Rz. 29.
[122] Siehe zu möglichen Auflösungsgründen: Hörstel, in: SUDHOFF (1999), 2.T Rz. 2 f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1998
- ISBN (eBook)
- 9783832458027
- ISBN (Paperback)
- 9783838658025
- DOI
- 10.3239/9783832458027
- Dateigröße
- 1.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hamburg – Fachbereich Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2002 (September)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- greeneland reiseliteratur katholizismus lateinamerika böker
- Produktsicherheit
- Diplom.de