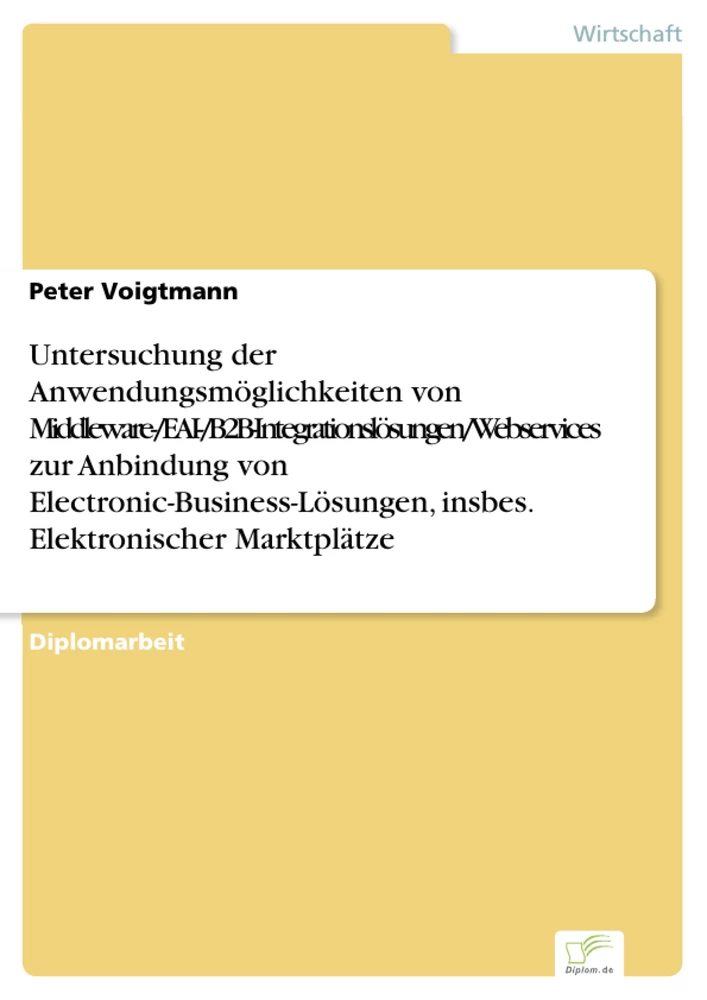Untersuchung der Anwendungsmöglichkeiten von Middleware-/EAI-/B2B-Integrationslösungen/Webservices zur Anbindung von Electronic-Business-Lösungen, insbes. Elektronischer Marktplätze
©2002
Diplomarbeit
81 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die vorliegende Arbeit leitet die Kriterien der Leistungsfähigkeit von Integrationslösungen für elektronische Marktplätze her. Weiterhin werden aktuelle Lösungen im Bereich Middleware, Application Server, Enterprise Application Integration und B2B Application Integration unter-sucht.
Ferner wird bestimmt, welche der konkret am Markt verfügbaren Systeme sich für die Integration von elektronischen Marktplätzen eignen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anhand von Case Studies in einen praxisnahen Kontext gebracht.
Im Rahmen der Arbeit erarbeitet der Autor einen ersten Ansatz eines Referenzmodells für Integrationslösungen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
AbstractI
InhaltsverzeichnisII
AbbildungsverzeichnisIV
AbkürzungsverzeichnisV
1.Einleitung1
2.Elektronische Marktplätze und deren Integrationsanforderungen3
2.1Ausprägungen elektronischer Marktplätze4
2.1.1Unterscheidung nach Beziehungen der Marktplatzteilnehmer zueinander4
2.1.2Unterscheidung nach Geschäftsmodellen6
2.1.3Unterscheidung nach verwendeten Katalog-Typen7
2.2Referenzmodell elektronischer Märkte und Marktplätze8
2.3Kriterien der Leistungsfähigkeit elektronischer Marktplätze10
2.3.1Kriterien der Leistungsfähigkeit von Koordinationssystemen10
2.3.2Kriterien der Leistungsfähigkeit im Referenzmodell12
2.3.2.1Effizienz12
2.3.2.2Flexibilität13
2.4Zielformulierung für Integrationslösungen13
3.Merkmale von Integrationslösungen16
3.1Modelle zur Klassifikation von Integrationslösungen16
3.2Ebenen der Kommunikation18
3.3Standardisierung21
3.4Systemtopologie25
3.5Schnittstellen28
3.6Ansatz eines Referenzmodells für Integrationslösungen30
4.Aktuelle Standards32
4.1Standards für die technische Übertragung33
4.2Standards für das Format der auszutauschenden Daten34
4.3Standards für die Bedeutung der auszutauschenden Daten35
4.4Standards für Aktions- und Reaktionsregeln36
4.5Ausblick36
5.Aktuelle Integrationssysteme38
5.1Basisdienste39
5.2Middleware39
5.2.1Database Access Middleware40
5.2.2Remote Procedure Calls40
5.2.3Message Oriented Middleware41
5.2.4Distributed Object Technology41
5.2.5Transaction Processing Monitors41
5.3Application Server42
5.4Enterprise Application Integration43
5.5B2B Application Integration45
5.6Business Process Integration46
5.7Rolle der Webservices46
6.Case Studies48
6.1Kopplung an Ingram Macrotron am Beispiel Compaq48
6.2Kopplung an Newtron am Beispiel Heidelberger Druckmaschinen51
6.3Kopplung […]
Die vorliegende Arbeit leitet die Kriterien der Leistungsfähigkeit von Integrationslösungen für elektronische Marktplätze her. Weiterhin werden aktuelle Lösungen im Bereich Middleware, Application Server, Enterprise Application Integration und B2B Application Integration unter-sucht.
Ferner wird bestimmt, welche der konkret am Markt verfügbaren Systeme sich für die Integration von elektronischen Marktplätzen eignen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anhand von Case Studies in einen praxisnahen Kontext gebracht.
Im Rahmen der Arbeit erarbeitet der Autor einen ersten Ansatz eines Referenzmodells für Integrationslösungen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
AbstractI
InhaltsverzeichnisII
AbbildungsverzeichnisIV
AbkürzungsverzeichnisV
1.Einleitung1
2.Elektronische Marktplätze und deren Integrationsanforderungen3
2.1Ausprägungen elektronischer Marktplätze4
2.1.1Unterscheidung nach Beziehungen der Marktplatzteilnehmer zueinander4
2.1.2Unterscheidung nach Geschäftsmodellen6
2.1.3Unterscheidung nach verwendeten Katalog-Typen7
2.2Referenzmodell elektronischer Märkte und Marktplätze8
2.3Kriterien der Leistungsfähigkeit elektronischer Marktplätze10
2.3.1Kriterien der Leistungsfähigkeit von Koordinationssystemen10
2.3.2Kriterien der Leistungsfähigkeit im Referenzmodell12
2.3.2.1Effizienz12
2.3.2.2Flexibilität13
2.4Zielformulierung für Integrationslösungen13
3.Merkmale von Integrationslösungen16
3.1Modelle zur Klassifikation von Integrationslösungen16
3.2Ebenen der Kommunikation18
3.3Standardisierung21
3.4Systemtopologie25
3.5Schnittstellen28
3.6Ansatz eines Referenzmodells für Integrationslösungen30
4.Aktuelle Standards32
4.1Standards für die technische Übertragung33
4.2Standards für das Format der auszutauschenden Daten34
4.3Standards für die Bedeutung der auszutauschenden Daten35
4.4Standards für Aktions- und Reaktionsregeln36
4.5Ausblick36
5.Aktuelle Integrationssysteme38
5.1Basisdienste39
5.2Middleware39
5.2.1Database Access Middleware40
5.2.2Remote Procedure Calls40
5.2.3Message Oriented Middleware41
5.2.4Distributed Object Technology41
5.2.5Transaction Processing Monitors41
5.3Application Server42
5.4Enterprise Application Integration43
5.5B2B Application Integration45
5.6Business Process Integration46
5.7Rolle der Webservices46
6.Case Studies48
6.1Kopplung an Ingram Macrotron am Beispiel Compaq48
6.2Kopplung an Newtron am Beispiel Heidelberger Druckmaschinen51
6.3Kopplung […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5777
Voigtmann, Peter: Untersuchung der Anwendungsmöglichkeiten von Middleware-/EAI-
/B2B-Integrationslösungen/Webservices zur Anbindung von Electronic-Business-
Lösungen, insbes. Elektronischer Marktplätze
Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
I
Abstract
Die vorliegende Arbeit leitet die Kriterien der Leistungsfähigkeit von Integrationslösungen für
elektronische Marktplätze her. Weiterhin werden aktuelle Lösungen im Bereich Middleware,
Application Server, Enterprise Application Integration und B2B Application Integration unter-
sucht. Ferner wird bestimmt, welche der konkret am Markt verfügbaren Systeme sich für die
Integration von elektronischen Marktplätzen eignen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden
anhand von Case Studies in einen praxisnahen Kontext gebracht.
Im Rahmen der Arbeit erarbeitet der Autor einen ersten Ansatz eines Referenzmodells für
Integrationslösungen.
II
Inhaltsverzeichnis
Abstract...I
Inhaltsverzeichnis ...II
Abbildungsverzeichnis ...IV
Abkürzungsverzeichnis...V
1
Einleitung ...1
2
Elektronische Marktplätze und deren Integrationsanforderungen ...3
2.1
Ausprägungen elektronischer Marktplätze...4
2.1.1
Unterscheidung nach Beziehungen der Marktplatzteilnehmer zueinander...4
2.1.2
Unterscheidung nach Geschäftsmodellen ...6
2.1.3
Unterscheidung nach verwendeten Katalog-Typen...7
2.2
Referenzmodell elektronischer Märkte und Marktplätze ...8
2.3
Kriterien der Leistungsfähigkeit elektronischer Marktplätze ...10
2.3.1
Kriterien der Leistungsfähigkeit von Koordinationssystemen...10
2.3.2
Kriterien der Leistungsfähigkeit im Referenzmodell...12
2.3.2.1
Effizienz ...12
2.3.2.2
Flexibilität...13
2.4
Zielformulierung für Integrationslösungen ...13
3
Merkmale von Integrationslösungen...16
3.1
Modelle zur Klassifikation von Integrationslösungen...16
3.2
Ebenen der Kommunikation ...18
3.3
Standardisierung ...21
3.4
Systemtopologie ...25
3.5
Schnittstellen ...28
3.6
Ansatz eines Referenzmodells für Integrationslösungen ...30
4
Aktuelle Standards...32
4.1
Standards für die technische Übertragung ...33
4.2
Standards für das Format der auszutauschenden Daten ...34
4.3
Standards für die Bedeutung der auszutauschenden Daten ...35
4.4
Standards für Aktions- und Reaktionsregeln...36
4.5
Ausblick ...36
III
5
Aktuelle Integrationssysteme ...38
5.1
Basisdienste ...39
5.2
Middleware...39
5.2.1
Database Access Middleware ...40
5.2.2
Remote Procedure Calls ...40
5.2.3
Message Oriented Middleware...41
5.2.4
Distributed Object Technology...41
5.2.5
Transaction Processing Monitors...41
5.3
Application Server...42
5.4
Enterprise Application Integration ...43
5.5
B2B Application Integration ...45
5.6
Business Process Integration ...46
5.7
Rolle der Webservices ...46
6
Case Studies ...48
6.1
Kopplung an Ingram Macrotron am Beispiel Compaq...48
6.2
Kopplung an Newtron am Beispiel Heidelberger Druckmaschinen...51
6.3
Kopplung an das Payback-System von Loyalty Partner...54
6.4
Kopplung an SAP R/3 am Beispiel Grundig ...56
6.5
Kopplung an die Google-Plattform...58
7
Zusammenfassung ...60
Literaturverzeichnis ...VII
Ergebnisse im Überblick ... XV
IV
Abbildungsverzeichnis
Bild 1
Einordnung von elektronischen Marktplätzen ...3
Bild 2
Beziehungen der Marktplatzteilnehmer zueinander und zum eMP...5
Bild 3
Merkmale zur Differenzierung von eMP ...7
Bild 4
Katalog-Typen ...8
Bild 5
Referenzmodell elektronischer Marktplätze ...9
Bild 6
Elektronische Koordination und Kriterien für deren Leistungsfähigkeit...11
Bild 7
Effizienz im Referenzmodell eMP ...12
Bild 8
Zielformulierung für Integrationslösungen ...13
Bild 9
Merkmale mit wesentlichem Einfluss auf Effizienz und Flexibilität...18
Bild 10
Ebenen der Kommunikation und Ebenen der Integration...19
Bild 11
Mögliche Konstellationen beim Einsatz von Standards...22
Bild 12
Betrachtung der Standardisierung auf jeder Ebene der Integration...23
Bild 13
Alternative Systemtopologien ...25
Bild 14
Systemtopologie ohne Integrationssystem...26
Bild 15
Initialisierung, Steuerung und Ablauf von Datenaustauschprozessen...26
Bild 16
Systemtopologie mit Integrationssystem ...27
Bild 17
Schnittstellen eines Anwendungssystems ...28
Bild 18
Ansatz eines Referenzmodells für Integrationslösungen...31
Bild 19
Der Beitrag von Standards zu den Ebenen der Kommunikation...32
Bild 20
Abdeckung der Ebenen der Kommunikation durch Integrationslösungen ...38
Bild 21
Kopplung an Ingram Macrotron am Beispiel Compaq...49
Bild 22
Steigerung der Effizienz bei Ingram Macrotron und Compaq...50
Bild 23
Kopplung an Newtron am Beispiel Heidelberger Druckmaschinen...53
Bild 24
Kopplung an das Payback-System von Loyalty Partner ...55
Bild 25
Kopplung an SAP R/3 am Beispiel Grundig...57
Bild 26
Kopplung an die Google-Plattform ...58
V
Abkürzungsverzeichnis
A2A
Administration to Administration
A2C
Administration to Consumer
ACID
Atomic, Consistent, Isolated, Durable
ADO
Activex Data Objects
ALE
Application Link Enabling
B2A
Business to Administration
B2B
Business to Business
B2C Business
to
Consumer
C2C Consumer
to
Consumer
CMS
Content Management System
COM/DCOM
Component Object Model/Distributed Component Object Model
CORBA
Common Object Request Broker Architecture
CSV
Comma Separated Values
DIN
Deutsche Industrie Norm
DNS
Domain Name System
DOT
Distributed Object Technologie
EAI
Enterprise Application Integration
eBusiness Electronic
Business
eCommerce Electronic
Commerce
EDI
Electronic Data Interchange
eMP
Elektronischer Marktplatz bzw. Elektronische Marktplätze
eProcurement Electronic
Procurement
ERP
Enterprise Resource Planning
FTP
File Transfer Protocol
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
HTTPS
Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer
IDOC Intermediate
Document
IM
Ingram Macrotron Distribution GmbH
VI
IPv4 Internet
Protocol
Version
4
IPv6 Internet
Protocol
Version
6
ISO
International Organization for Standardization
IV Informationsverarbeitung
J2EE Java
2
Enterprise
Edition
JDBC
Java Database Connectivity
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen
LP Loyalty
Partner
GmbH
MOM
Message Oriented Middleware
MRO
Maintenance, Repair und Operation
N Newtron
AG
ODBC
Open Database Connectivity
ODETTE
Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe
OMG
Object Management Group
OSI Open
Systems
Interconnection
PW Partnerweb
RFC Remote
Function
Call
RPC Remote
Procedure
Call
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol
SOAP
Simple Object Access Protocol
TBC
Transaction Broker Client
TBS
Transaction Broker Server
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TPM
Transaction Processing Monitors
UML
Unified Modeling Language
URL Uniform
Resource
Locator
WWW
World Wide Web
XML
Extended Markup Language
1
1 Einleitung
Elektronische Marktplätze (eMP) sind internetbasierte Handelsplattformen, auf denen Verkäu-
fer und Käufer in virtueller Weise aufeinander treffen. Prominente Beispiele sind Amazon,
Newtron und Emaro [Amaz02; Ntrn02a; Emar02].
Speziell im Business-to-Business-Bereich (B2B) haben eMP in den letzten Jahren stark an
Bedeutung gewonnen und für die Zukunft wird ein weiteres Wachstum prognostiziert. So hat
sich die Zahl der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ihre Beschaffung über das
Internet abwickeln, von 1999 (26%) bis Ende 2001 (49%) nahezu verdoppelt [PWC02, 9;
BMWi02; ECIN02].
Ein zentraler Erfolgsfaktor für den Handel via Internet ist der optimale Austausch von Informa-
tionen zwischen dem eMP und den innerbetrieblichen Anwendungssystemen der teilnehmen-
den Unternehmen [WiRa00, 7]. Dazu müssen der eMP und die innerbetrieblichen Anwen-
dungssysteme gekoppelt werden. Hierfür sind Integrationslösungen erforderlich. Unter Integ-
rationslösungen werden verschiedene Technologien zusammengefasst, die eine automatische
Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungssystemen ermöglichen.
Ziel dieser Arbeit ist es, aktuelle Integrationslösungen nach Einsatzmöglichkeiten bei der eMP-
Integration zu untersuchen. Dazu wird wie folgt vorgegangen:
Kapitel 2 untersucht im ersten Teil eMP nach charakteristischen Merkmalen. Für die folgende
allgemein gültige Definition der Kriterien der Leistungsfähigkeit wird das Referenzmodell für
eMP zugrunde gelegt. Die gefundenen Kriterien der Leistungsfähigkeit (Effizienz und Flexibi-
lität) sind Ausgangspunkte für die abschließende Zielformulierung der möglichen Integra-
tionslösungen.
Kapitel 3 betrachtet Merkmale von Integrationslösungen nach Ihrem Beitrag zu Effizienz und
Flexibilität. Da für Integrationslösungen kein vollständiges Referenzmodell existiert, werden
einzelne zentrale Merkmale detailliert untersucht. Abschließend wird auf Basis der Ergebnisse
ein erster Ansatz eines Referenzmodells für Integrationslösungen formuliert.
Der Schlüssel für die aufgestellte Zielformulierung in Kapitel 2 liegt in der Standardisierung.
Dies ist ein zentrales Ergebnis von Kapitel 3. Daher widmet sich Kapitel 4 detailliert der Be-
trachtung aktueller Standards und ihren Beiträgen zu Integrationslösungen.
2
Kapitel 5 klassifiziert auf der Grundlage der vorangegangenen Resultate aktuelle Integrations-
systeme und zeigt die jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten für eine eMP-Integration auf.
Kapitel 6 fasst die gewonnenen Erkenntnisse in einem praxisnahen Kontext zusammen. Dazu
werden fünf Case Studies ausführlich beschrieben und nach Effizienz und Flexibilität, den
Kriterien für die Leistungsfähigkeit, untersucht.
3
2 Elektronische Marktplätze und deren
Integrationsanforderungen
Markt, Hierarchie und Netzwerk sind die drei wirtschaftlichen Koordinationssysteme
[Powe91; ThFr91; Lind00, 36ff; Zbor96, 45ff]. Wenn die Informationsverarbeitung (IV) zur
Realisierung der Koordination eingesetzt wird, kann analog von elektronischem Markt, elekt-
ronischer Hierarchie und elektronischem Netzwerk gesprochen werden [Zbor96, 57]. Als
Oberbegriff für diese elektronischen Koordinationssysteme hat sich Electronic Business
(eBusiness) durchgesetzt.
Eine Ausprägung des eBusiness ist Electronic Commerce (eCommerce) [Merz02, 17;
Wams00, 52]. eCommerce nutzt die Koordinationsmechanismen des Marktes. Eine andere
Ausprägung des eBusiness ist Supply-Chain-Management [Zell01], das sich vor allem netz-
werkartiger Koordinationsmechanismen bedient, vergleiche Bild 1.
eCommerce
Supply-Chain-
Management
...
eBusiness
Technologische
Basis
Elektronische
Marktplätze
(eMP)
Bild 1 Einordnung von elektronischen Marktplätzen
[Eigene
Darstellung]
Die technologische Basis für eCommerce ist der eMP. Der Begriff eMP wird in der Literatur
häufig synonym zu E-Market [ScSc00], elektronischem Handelssystem [Zbor96] oder allge-
mein für eCommerce-Anwendungen [Hent01; Kelk01; Merz02] verwendet.
Aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist ein eMP der Ort, an dem Angebot und Nachfrage auf
elektronischem Wege aufeinander treffen [GrRe95, 400f].
Aus Sicht der Informationsverarbeitung (IV) ist der eMP eine konkrete Implementierung,
bestehend aus mehreren Anwendungssystemen, die die elektronische Abwicklung der Trans-
aktionsphasen des Kaufprozesses ermöglichen und unterstützen [Mert00, 61; Zbor96, 138ff;
4
Merz02, 18f; Lind00, 36]. Beispiele für entsprechende Anwendungssysteme sind elektro-
nische Kataloge, Shop-Systeme mit Warenkorb oder Software für dynamische Preisfindungs-
methoden.
Für die Analyse der Integrationsanforderungen von eMP werden im Folgenden
verschiedene Ausprägungen von eMP dargestellt,
die Ausprägungen in einem Referenzmodell zusammengefasst,
Kriterien der Leistungsfähigkeit für eMP hergeleitet
und daraus die Zielsetzungen für Integrationslösungen abgeleitet.
2.1 Ausprägungen elektronischer Marktplätze
eMP können aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Im Folgenden stehen
dabei die betriebswirtschaftlichen Aspekte im Vordergrund. Die Untersuchung der IV-techni-
schen Gesichtspunkte ist Kapitel 3 vorbehalten.
2.1.1 Unterscheidung nach Beziehungen der Marktplatzteilnehmer zueinander
Eine pragmatische Unterscheidung, in deren Kategorien sich jeder eMP einordnen lässt und
die in der Literatur weite Verbreitung findet, liefert die Betrachtung der Beziehungen der
Marktplatzteilnehmer zueinander.
Unter Marktplatzteilnehmern sind Käufer und Verkäufer zu verstehen, die sich in drei ver-
schiedenen Varianten gegenüberstehen können [WiMa01; ScSc00, 55ff; Hent01, 28ff;
Zbor96, 123ff], vergleiche Bild 2 oberer Bereich.
5
Sell-Side-Lösung
K
Virtueller Marktplatz
Buy-Side-Lösung
K
K
V
V
V
eMP
K
K
K
V
eMP
K
V
V
V
eMP
Legende:
V
K
Verkäufer (Marktplatzteilnehmer)
Käufer (Marktplatzteilnehmer)
Einzelbeziehung
Verhältnis der Marktplatzteilnehmer
Maximale Anzahl unterschiedlicher Einzelbeziehungen
1 : n
m : n
m : 1
1 + n m + n
m + 1
Bild 2 Beziehungen der Marktplatzteilnehmer zueinander und zum eMP
[Eigene
Darstellung]
Die Sell-Side-Lösung ist ein 1:n-Verhältnis zwischen einem Verkäufer und mehreren Käufern.
Ein eMP als Sell-Side-Lösung wird in der IV-Infrastruktur des Verkäufers oder auch eines un-
abhängigen Dienstleistungsunternehmens betrieben.
Der virtuelle Marktplatz ist ein m:n-Verhältnis zwischen mehreren Verkäufern und mehreren
Käufern. Eine untergeordnete Rolle spielt hierbei, ob der eMP für alle Teilnehmer frei zugäng-
lich ist, oder der Zugang bestimmten Verkäufer- oder Käufergruppen vorbehalten ist. Ein vir-
tueller Marktplatz wird zumeist durch einen Intermediär betrieben.
Die Buy-Side-Lösung ist ein m:1-Verhältnis zwischen mehreren Verkäufern und einem Käu-
fer. Ein eMP als Buy-Side-Lösung wird häufig in der IV-Infrastruktur des Käufers betrieben.
Keine Berücksichtigung findet bei dieser Unterscheidung die direkte Anbindung zwischen ei-
nem Verkäufer und einem Käufer in Form eines 1:1-Verhältnisses, da diese direkte Beziehung
unabhängig von einem eMP funktioniert.
Für die Frage nach den Integrationsanforderungen für eMP sind die Beziehungen zwischen
den einzelnen Marktplatzteilnehmern und dem eMP detaillierter zu betrachten. Technologisch
gesehen ist jede Anbindung eines Marktplatzteilnehmers an einen eMP eine 1:1-Beziehung,
aufgrund der Vielzahl der heute verbreiteten Technologien und Standards können sich im
Extremfall alle diese Anbindungen voneinander unterscheiden, vergleiche Bild 2 unterer
Bereich.
6
Neben den Marktplatzteilnehmern (Verkäufer und Käufer) sind weiterhin Marktplatz-Dienst-
leistungsunternehmen (z. B. Kreditinstitute, Speditionen) bei der Beschreibung der Integra-
tionsanforderungen zu berücksichtigen.
Fazit 1: Die zu erwartende Anzahl an unterschiedlichen Integrationsanforderungen an einen
eMP ist abhängig von der Anzahl der Marktplatzteilnehmer einschließlich der zugehörigen
Dienstleistungsunternehmen.
Fazit 2: Der virtuelle Marktplatz als eine Ausprägung des eMP stellt die größte technische
und organisatorische Herausforderung dar, da er zumeist in der IT-Infrastruktur eines unab-
hängigen Intermediärs betrieben wird.
2.1.2 Unterscheidung nach Geschäftsmodellen
Die vorangegangene Differenzierung ermöglicht eine eindeutige, aber grobe Klassifizierung von
eMP. Um einen eMP aus betriebswirtschaftlicher Sicht präziser beschreiben zu können, sind
weitere Merkmale zu berücksichtigen [Koll01, 33ff; ScSc00, 98ff; WiMa01; BuKr02;
PWC02, 11ff]. Einen Überblick über die in der Literatur am weitesten verbreiteten Merkmale
gibt Bild 3.
Die einzelnen Merkmalsausprägungen in Bild 3 bedingen sich zumeist gegenseitig. So werden
z. B. MRO-Produkte (Maintenance, Repair und Operation) heute üblicherweise auf einem ge-
schlossenen B2B-eMP in Form einer Buy-Side-Lösung zu Festpreisen gehandelt [Hent01,
51]. Diese Kombination von Merkmalsausprägungen wird auch als Electronic-Procurement
(eProcurement) bezeichnet und stellt ein spezielles Geschäftsmodell für eMP dar [Stäh01,
41f].
Eine Kombination von Merkmalsausprägungen definiert ein eigenes charakteristisches Ge-
schäftsmodell mit speziell ausgeprägten Transaktionsphasen innerhalb des Kaufprozesses. Die
unterschiedlichen Geschäftsmodelle erfordern spezifische Integrationsszenarios.
7
Merkmal
Merkmalsausprägungen
Betreiber
Verkäufer | Käufer | Intermediär
Preisfindung
Festpreis | Börse | Auktion | Power-Shopping | Ausschreibung
Konstellation der
Marktplatzteilnehmer
B2B | B2C | B2A | A2A | C2C |A2C
Branchenorientierung
horizontal | vertikal | einfach
Zugangsstruktur
geschlossen | offen
Wertschöpfungsstufe
der Güter
Rohstoffe | Komponenten | Vorprodukte | MRO-Produkte
Körperlichkeit
der Güter
materiell | immateriell
Beitrag zur Wertschöpfung
A-Güter | B-Güter | C-Güter
Bild 3 Merkmale zur Differenzierung von eMP
[Eigene
Darstellung]
Keines der Geschäftsmodelle dominiert. Die unterschiedlichen Modelle passen zu unter-
schiedlichen Unternehmen und zu unterschiedlichen Typen der Interaktion zwischen Unter-
nehmen [344]. Bei der Definition von Integrationsanforderungen müssen deshalb möglichst
alle erdenklichen Geschäftsmodelle berücksichtigt werden.
Fazit 3: Die zu erwartende Anzahl an unterschiedlichen Integrationsanforderungen an einen
eMP ist abhängig von der Anzahl und den Varianten der zu realisierenden Geschäfts-
modelle.
2.1.3 Unterscheidung nach verwendeten Katalog-Typen
Unabhängig von allen oben genannten Merkmalen ist die Basis eines jeden eMP der elektro-
nische Katalog. Speziell für den Handel von standardisierten Gütern ist ein Katalog unabding-
bar [Hent01, 13; Phil91, 4; WiMa01]. Ein Katalog, der die Produkte eines einzelnen Liefe-
ranten umfasst, wird als Single-Supplier-Katalog bezeichnet.
Bei den eMP-Varianten Buy-Side-Lösung und virtueller Marktplatz erwächst darüber hinaus
der Bedarf, mehrere Lieferanten in einem so genannten Multi-Supplier-Produktkatalog zu-
sammen zu führen und die Produkte einheitlich zu klassifizieren [Hent01, 51ff; Phil91, 14ff],
vergleiche Bild 4.
8
Der komplexeste Typ eines Kataloges ist ein aus einem allgemeinen Multi-Supplier-Katalog
abgeleiteter privater Multi-Supplier-Produktkatalog. Neben einer Konsolidierung aus ver-
schiedenen Lieferantenkatalogen bietet er eine an den Käufer individuell angepasste Zusam-
menstellung der Produkte. Private Multi-Supplier-Produktkataloge werden heute zum Teil auf
virtuellen Marktplätzen verwendet und sind auch bei Buy-Side-Lösungen zu finden.
Kataloge
nicht konsolidierte
Kataloge
konsolidierte
Kataloge
Single-Supplier-
Kataloge
Multi-Supplier-
Kataloge
private Multi-Supplier-
Kataloge
Bild 4 Katalog-Typen
[Eigene
Darstellung]
Für die spezifische Katalogbereitstellung haben sich Content-Provider als Dienstleistungs-
unternehmer für Marktplätze spezialisiert.
Fazit 4: Die zu erwartende Anzahl an unterschiedlichen Integrationsanforderungen an einen
eMP ist abhängig von der Anzahl unterschiedlicher Produktkataloge und Klassifizierungen
von Produkten sowie dem Grad der Individualisierung.
2.2 Referenzmodell elektronischer Märkte und Marktplätze
Kapitel 2.1 stellte aus unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Perspektiven verschiedene
Ausprägungen von eMP dar und verdeutlichte die Vielzahl der resultierenden Integrationsan-
forderungen. Als Basis für weitere Überlegungen werden im Folgenden die theoretisch mög-
lichen Varianten von eMP in einem Referenzmodell zusammengefasst.
Das Referenzmodell elektronischer Märkte wurde durch die Forschungsgruppe ,,Elektronische
Märkte" des Instituts für Medien- und Kommunikationsmanagement der Universität St. Gallen
entwickelt [Schm99; UniG02; erstmals in LiSc02] und mit besonderer Ausrichtung auf das
Internet, speziell für eMP, verfeinert [Lind00].
9
eMP werden im Referenzmodell durch zwei unabhängige Dimensionen beschrieben, verglei-
che Bild 5:
Die horizontale Achse bildet die einzelnen Transaktionsphasen innerhalb des Kaufpro-
zesses ab.
Die vertikale Achse unterscheidet vier Modellierungsschichten, die der Komplexitäts-
reduktion dienen und die organisatorisch-strategischen von den technologisch-opera-
tiven Charakteristika trennen [Lind00, 27].
Acquire
Information
Signal
Intentions
Negotiate
Contracts
Exchange
Resources
Transaction Infrastructure
Market Community
Processes
Knowledge
Phase
Intention
Phase
Agreement
Phase
Settlement
Phase
Community
View
Implementation
View
Transaction
View
Infrastructure
View
operative,
technological
organizational,
strategical
Bild 5 Referenzmodell elektronischer Marktplätze
[In Anlehnung an: HeSa99, 42; Lind00, 118]
Im Referenzmodell für eMP stellt eine Schicht der jeweils darüber liegenden Schicht Dienste
zur Verfügung und nutzt selbst die Dienste der darunter liegenden Schicht.
Die unterste Schicht (Infrastucture View) betrifft alle Aspekte der IV-technischen Infrastruktur
des eMP, z. B. TCP/IP, Datenbanken, Datenaustauschformate.
Die zweite Schicht von unten (Transaction View) umfasst alle funktionalen Aspekte des eMP.
Vereinfacht betrachtet wird für jede Transaktionsphase innerhalb des Kaufprozesses ein
spezialisierter Dienst zur Verfügung gestellt, z. B. Marktinformation, Produktkatalog, Vertrags-
abschluss und Logistik-Verfolgung.
10
Die zweite Schicht von oben (Implementation View) enthält die einzelnen Geschäftsprozesse,
die durch die übergeordnete Schicht (Community View) determiniert sind und durch Nutzung
der funktionalen Dienste der untergeordneten Schicht (Transaction View) ausgeführt werden.
Die oberste Schicht (Community View) setzt den Fokus auf das Geschäftsmodell und den
Zweck des eMP, z. B. eine eProcurement-Lösung.
Das Referenzmodell betrachtet in abstrakter Weise die bestimmenden Faktoren eines eMP.
Daher haben aus dem Referenzmodell abgeleitete Integrationsanforderungen Allgemeingültig-
keit.
Fazit 5: Das Referenzmodell fasst alle Ausprägungen von eMP zusammen und kann als
Grundlage für die Definition und Überprüfung von Integrationsanforderungen verwendet
werden.
2.3 Kriterien der Leistungsfähigkeit elektronischer Marktplätze
Mit der Integration von Anwendungssystemen werden verschiedene Ziele verfolgt, die sich als
Steigerung der Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems zusammenfassen lassen. Dazu wird im
Folgenden der Begriff der Leistungsfähigkeit näher untersucht und die resultierenden Integra-
tionsanforderungen werden bestimmt.
2.3.1 Kriterien der Leistungsfähigkeit von Koordinationssystemen
Wie bereits in am Anfang des Kapitels 2 dargestellt, ist der Markt neben Hierarchie und Netz-
werk eines der drei wirtschaftlichen Koordinationssysteme.
Zur Messung der Leistungsfähigkeit eines Koordinationssystems unterscheidet die Koordina-
tionstheorie die zwei generellen Kriterien Effizienz und Flexibilität, vergleiche Bild 6. Beson-
ders der Markt als eine der drei Koordinationsformen hat den Anspruch, Effizienz und Flexibi-
lität gleichzeitig in einem hohen Maß abzudecken [Lind00, 88]. Für elektronische Koordina-
tionssysteme gelten die Kriterien Effizienz und Flexibilität analog, vergleiche Bild 6.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832457778
- ISBN (Paperback)
- 9783838657776
- DOI
- 10.3239/9783832457778
- Dateigröße
- 719 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2002 (August)
- Schlagworte
- standards standardisierung referenzmodell
- Produktsicherheit
- Diplom.de