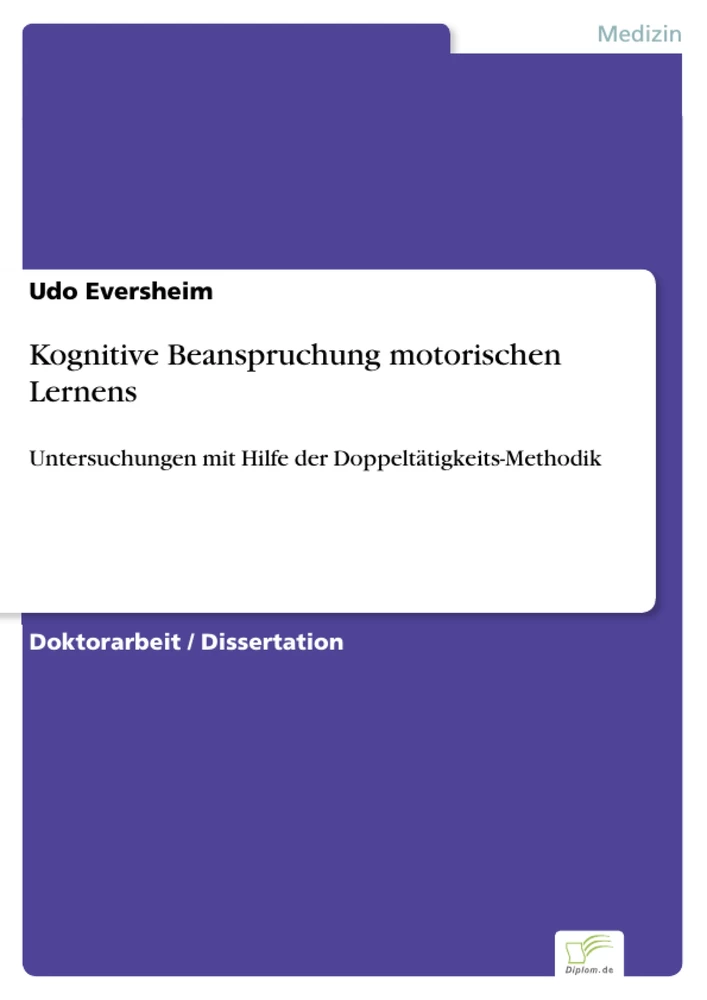Kognitive Beanspruchung motorischen Lernens
Untersuchungen mit Hilfe der Doppeltätigkeits-Methodik
©2002
Doktorarbeit / Dissertation
94 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Motorisches Lernen in Sport und Alltag beinhaltet aufwendige Anpassungsprozesse unseres zentralen Nervensystems. Zahlreiche Phasenmodelle motorischen Lernens gehen davon aus, dass solche Anpassungsprozesse in charakteristischen Abschnitten mit jeweils vorherrschenden informationsverarbeitenden Prozessen ablaufen. Daher wurde postuliert, dass der Bedarf an kognitiven Rechenressourcen während des Lernens ansteigt, und dass spezifische Ressourcen zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Lernens dominant beansprucht werden.
Diese Arbeit untersuchte den Ressourcenbedarf einer Adaptation an veränderte visuelle Feedbackbedingungen mit Hilfe der Doppeltätigkeits-Methodik. Dazu führten Versuchspersonen mit ihrer dominanten Hand eine Trackingaufgabe unter verschiedenen Feedback-Bedingungen und gleichzeitig mit der anderen Hand verschiedene Zweitaufgaben durch. Die Zweitaufgaben bestanden aus unterschiedlichen Reaktionszeit-Aufgaben, welche jeweils spezifische informationsverarbeitende Prozesse beinhalteten. Im Vergleich zu einer Kontrollbedingung beanspruchte eine Zweitaufgabe besonders viel Aufmerksamkeit, eine andere dagegen eine visuell-räumliche Rotation und eine weitere Zweitaufgabe eine aufwendige Bewegungsprogrammierung.
Zu Beginn des Lernens stieg die Doppeltätigkeits-Interferenz zwischen Tracking- und Zweitaufgaben stark an und reduzierte sich im weiteren Verlauf des Übens wieder. Dabei war in einer frühen Phase des Lernens die aufmerksamkeitsbeanspruchende Zweitaufgabe und die Aufgabe mit räumlicher Drehung besonders störend für die Trackingleistung. Im Gegensatz dazu interferierte die Zweitaufgabe mit komplexer Bewegungsprogrammierung und -ausführung vorherrschend zu einem späteren Zeitpunkt des Lernens.
Diese Ergebnisse liefern somit seltene empirische Hinweise für die These, dass sich der Ressourcenbedarf während des motorischen Lernens quantitativ und qualitativ verändert.
Die Anpassung an modifizierte Feedback-Bedingungen benötigt vermehrt kognitive Ressourcen, deren Bedarf im Verlauf des Lernens im Allgemeinen immer mehr abnimmt. Außerdem kommt es für bestimmte Ressourcen, welche zu verschiedenen Zeitpunkten des Lernens vorherrschend beansprucht werden, zu einer zunehmenden Belastung. Die Interferenzmuster deuten dabei auf eine spezifische Ressourcenbeanspruchung hin, welche mit den postulierten Inhalten der Phasenmodelle gut übereinstimmt. Eine frühe Phase des Lernens scheint vermehrt Aufmerksamkeit und […]
Motorisches Lernen in Sport und Alltag beinhaltet aufwendige Anpassungsprozesse unseres zentralen Nervensystems. Zahlreiche Phasenmodelle motorischen Lernens gehen davon aus, dass solche Anpassungsprozesse in charakteristischen Abschnitten mit jeweils vorherrschenden informationsverarbeitenden Prozessen ablaufen. Daher wurde postuliert, dass der Bedarf an kognitiven Rechenressourcen während des Lernens ansteigt, und dass spezifische Ressourcen zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Lernens dominant beansprucht werden.
Diese Arbeit untersuchte den Ressourcenbedarf einer Adaptation an veränderte visuelle Feedbackbedingungen mit Hilfe der Doppeltätigkeits-Methodik. Dazu führten Versuchspersonen mit ihrer dominanten Hand eine Trackingaufgabe unter verschiedenen Feedback-Bedingungen und gleichzeitig mit der anderen Hand verschiedene Zweitaufgaben durch. Die Zweitaufgaben bestanden aus unterschiedlichen Reaktionszeit-Aufgaben, welche jeweils spezifische informationsverarbeitende Prozesse beinhalteten. Im Vergleich zu einer Kontrollbedingung beanspruchte eine Zweitaufgabe besonders viel Aufmerksamkeit, eine andere dagegen eine visuell-räumliche Rotation und eine weitere Zweitaufgabe eine aufwendige Bewegungsprogrammierung.
Zu Beginn des Lernens stieg die Doppeltätigkeits-Interferenz zwischen Tracking- und Zweitaufgaben stark an und reduzierte sich im weiteren Verlauf des Übens wieder. Dabei war in einer frühen Phase des Lernens die aufmerksamkeitsbeanspruchende Zweitaufgabe und die Aufgabe mit räumlicher Drehung besonders störend für die Trackingleistung. Im Gegensatz dazu interferierte die Zweitaufgabe mit komplexer Bewegungsprogrammierung und -ausführung vorherrschend zu einem späteren Zeitpunkt des Lernens.
Diese Ergebnisse liefern somit seltene empirische Hinweise für die These, dass sich der Ressourcenbedarf während des motorischen Lernens quantitativ und qualitativ verändert.
Die Anpassung an modifizierte Feedback-Bedingungen benötigt vermehrt kognitive Ressourcen, deren Bedarf im Verlauf des Lernens im Allgemeinen immer mehr abnimmt. Außerdem kommt es für bestimmte Ressourcen, welche zu verschiedenen Zeitpunkten des Lernens vorherrschend beansprucht werden, zu einer zunehmenden Belastung. Die Interferenzmuster deuten dabei auf eine spezifische Ressourcenbeanspruchung hin, welche mit den postulierten Inhalten der Phasenmodelle gut übereinstimmt. Eine frühe Phase des Lernens scheint vermehrt Aufmerksamkeit und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5666
Eversheim, Udo: Kognitive Beanspruchung motorischen Lernens: Untersuchungen mit Hilfe der
Doppeltätigkeits-Methodik / Udo Eversheim - Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Köln, Sporthochschule, Dissertation / Doktorarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1.
EINLEITUNG ...1
1.1 Motorisches Lernen...2
1.2 Leistungsverbesserungen durch motorisches Lernen...5
1.3 Theorien motorischer Lernprozesse...6
1.3.1 Phasenmodelle motorischer Lernprozesse...7
1.3.1.1 Zweiphasige Modelle ...7
1.3.1.2 Dreiphasige Modelle ...8
1.3.1.3 Zusammenfassung...10
1.4 Empirische Studien zu motorischen Lernprozessen ...11
1.4.1 Korrelationsstudien...11
1.4.2 Studien mit unterschiedlichem Training...12
1.4.3 Studien mit Doppeltätigkeiten...13
1.4.3.1 Interpretation von Doppeltätigkeits-Interferenz...13
1.4.3.2 Frühere Doppeltätigkeits-Studien ...18
1.5 Intention der eigenen Untersuchungen...21
2.
ALLGEMEINE METHODIK UND MATERIAL...24
2.1 Versuchspersonen...24
2.2 Apparatur...25
2.3 Motorische Lernaufgabe...25
2.4 Zweitaufgaben ...27
2.5 Versuchsablauf...28
2.5.1 Einführungssitzung...29
2.5.2 Experimentelle Sitzung...29
3.
EXPERIMENT A ...31
3.1 Spezielle Methode...31
3.1.1 Lernaufgabe...31
3.1.2 Zweitaufgaben...32
3.2 Ergebnisse...33
3.2.1 Lernaufgabe...33
3.2.2 Zweitaufgaben...38
3.3 Diskussion...39
Inhaltsverzeichnis
4.
EXPERIMENT B ...43
4.1 Spezielle Methode...43
4.1.1 Lernaufgabe...43
4.1.2 Zweitaufgaben...44
4.2 Ergebnisse...44
4.2.1 Lernaufgabe...44
4.2.2 Zweitaufgaben...47
4.3 Diskussion...49
5.
EXPERIMENT C ...51
5.1 Spezielle Methode...52
5.1.1 Lernaufgabe und Zweitaufgaben...52
5.2 Ergebnisse...52
5.2.1 Lernaufgabe...52
5.2.2 Zweitaufgaben...55
5.3 Diskussion...56
6.
EXPERIMENT D ...58
6.1 Spezielle Methode...59
6.1.1 Lernaufgabe...59
6.1.2 Zweitaufgaben...59
6.2 Ergebnisse...61
6.2.1 Lernaufgabe...61
6.2.2 Zweitaufgaben...63
6.3 Diskussion...64
7.
ALLGEMEINE DISKUSSION...66
7.1 Ressourcenbedarf motorischen Lernens ...66
7.2 Zusammenhang mit spezifischer Gehirnaktivität...68
7.3 Schriftliche Vorinformation verändert den Ressourcenbedarf...70
7.4 Doppeltätigkeits-Interferenz aufgrund peripherer Mechanismen...71
7.5 Weiterentwicklung der Doppeltätigkeits-Methodik...72
8.
ZUSAMMENFASSUNG ...74
9.
LITERATUR ...77
ANHANG A ... A
ANHANG B ... B
1. Einleitung
1
1. Einleitung
Der Mensch gilt anthropologisch als ein auf Lernen angelegtes Wesen. Sowohl der
Erwerb kognitiver Fähigkeiten als auch das Lernen neuer motorischer Fertigkeiten ist
von fundamentaler Bedeutung für die Entwicklung des Menschen. Dabei ist das
Erlernen neuer und verbesserter Bewegungsabläufe von fast täglicher Präsenz in
Beruf und Alltag und hat darüber hinaus bei jeglicher sportlicher Aktivität einen
besonderen Stellenwert.
Wie wohl jeder aus eigener Erfahrung weiß, bereitet das Lernen einer neuen
Bewegung oder Sportart zu Beginn oft große Schwierigkeiten. Umso größer ist die
Freude, wenn nach einiger Zeit immer weniger Fehler gemacht werden und die
Bewegung zunehmend genauer und fließender wird. Nach ausreichender
Übungsdauer, welche sich allerdings über Jahre erstrecken kann, beherrscht man die
Bewegung dann mit so konstanter und guter Qualität, dass man sich gleichzeitig auf
andere Dinge konzentrieren kann. Welche Prozesse ermöglichen es uns, neue
Bewegungen zu erlernen, und welche Beanspruchungen stellen sie an das
sensomotorische System des Menschen? Sind die gleichen Prozesse sowohl zu
Beginn als auch in späteren Abschnitten des Lernens wirksam, oder verändern sie
sich während des Lernens? Obgleich die Wissenschaft hierzu zahlreiche
Erkenntnisse hervorgebracht hat, sind viele der zugrundeliegenden Mechanismen
von Lernprozessen noch weitgehend unklar. Diese Arbeit versucht einen kleinen
Beitrag zu leisten, um etwas mehr Licht ins Dunkel des Erlernens neuer Bewegungen
zu bringen.
Im ersten Abschnitt der Einleitung wird eine mögliche Definition motorischen
Lernens und der sich daraus ergebenden Konsequenzen vorgenommen. Auf der Basis
dieser Sichtweise werden dann Modelle motorischer Lernprozesse vorgestellt und
diskutiert. Anschließend folgt eine Einführung in die Untersuchungsmethodik von
Lernprozessen, insbesondere in die Methodik der Doppeltätigkeit. Zum Abschluss
der Einleitung werden frühere Studien zusammenfassend vorgestellt und die
Zielsetzung der eigenen Untersuchung dargelegt.
1. Einleitung
2
1.1 Motorisches Lernen
Motorisches Lernen bezeichnet keinen singulären Vorgang, sondern steht vielmehr
für eine Reihe komplexer sensomotorischer Prozesse, welche die Ausführung und
Aneignung neuer Bewegungsmuster beinhalten. Man unterscheidet verschiedene
Formen motorischen Lernens: nicht-assoziatives, konditioniert-assoziatives,
adaptives und das Erlernen neuer Fertigkeiten (Leonard 1997). In seiner einfachsten
Form verläuft Lernen nicht-assoziativ, z.B. durch Habituierung oder Sensitivierung.
Bei einer Habituierung wird eine Reaktion auf einen sich oft wiederholenden Reiz
zunehmend unterdrückt, während sich eine Reaktion durch Sensitivierung allmählich
steigert. Als klassisches Beispiel konditioniert-assoziativen Lernens, auch Reiz-
Reaktions-Lernen genannt, ist Pawlows Konditionierungs-Experiment bekannt.
Pawlows Hund lernte, einen bestimmten Stimulus assoziativ mit der Fütterung zu
verknüpfen, so dass nach einiger Zeit der Stimulus alleine ausreichte um
Speichelfluss auszulösen. Adaptation bezeichnet die Anpassung des motorischen
Systems an veränderte sensorische Informationen, beispielsweise bei der Gewöhnung
an eine neue Korrekturbrille. Diese produziert neben einer höheren Schärfe auch oft
Verzerrungen, an die sich das visuelle System anpassen muss. Adaptationen werden
häufig für experimentelle Untersuchungen verwendet, da sie sich leicht unter
Laborbedingungen erzeugen und kontrollieren lassen, wie beispielsweise eine
Adaptation an Prismengläser, welche die visuelle Wahrnehmung verändern (z.B.
Stratton 1897; Helmholz 1925; Kohler 1955; Ingram et al. 2000; Redding & Wallace
2000). Das Lernen von Bewegungsfertigkeiten umfasst in erster Linie den Erwerb
von neuen oder neuartigen Bewegungsmustern, welche zu einer Verbesserung der
Bewegungsleistung hinsichtlich Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz führen
(Donoghue et al. 1996). Zu einem gewissen Grade greift aber auch das Erlernen
neuer Fertigkeiten auf bereits vorhandene Bewegungsmuster zurück.
Grundsätzlich beinhalten die verschiedenen Formen motorischen Lernens sowohl
spezifische als auch gemeinsame Prozesse und Mechanismen. Vor allem das Lernen
neuer Fertigkeiten und die Adaptation sind inhaltlich oft nur schwierig voneinander
zu trennen: Bedeutet klassischer Skilanglauf beispielsweise das Erlernen neuer
Bewegungsprogramme oder adaptiere ich "n ur" meinen Gang an Gleiten und
1. Einleitung
3
Abstoßen? Daher werden beide Bezeichnungen von vielen Autoren synonym
verwendet. In dieser Arbeit wird Adaptation als eine mögliche Form motorischen
Lernens betrachtet, welche viele grundsätzliche Prinzipien des motorischen Lernens
beinhaltet.
Assoziatives Lernen, nicht-assoziatives Lernen und das Erlernen einfacher
Fertigkeiten wird einem, aus der Tradition des Behaviorismus stammenden, Lern-
und Gedächtnismechanismus zugeschrieben, der als prozedural-implizit bezeichnet
wird. Prozedural-implizites Lernen erfolgt ohne Beteiligung des Bewusstseins und
ohne ausgeprägte kognitive Auseinandersetzung mit der Aufgabe (Squire & Zola-
Morgan 1991; Knowlton et al. 1996). Es erfolgt kein Zugriff auf bereits vorhandene
Gedächtnisinhalte. Des weiteren können während des Lernens erworbene Inhalte
später nicht bewusst wiedergegeben werden.
Dem prozedural-impliziten Lernen wird das deklarativ-explizite Lernen
gegenübergestellt, welches seinen Ursprung in der Kognitionspsychologie des letzten
Jahrhunderts hat. Deklarativ-explizites Lernen bezeichnet einen bewussten Erwerb
und Abruf von Fakten und Ereignissen (Squire 1987). Dabei werden Inhalte des
Kurzzeitgedächtnisses durch ständiges aktives Wiederhohlen ins Langzeitgedächtnis
überführt und so eine überdauernde Gedächtnisspur, das Engramm, gebildet. Dieser
Vorgang wird als Konsolidierung bezeichnet (Alvarez & Squire 1994; Brashers-Krug
et al. 1996).
Obgleich das Lernen von Fertigkeiten und die Adaptation klassischer Weise dem
prozedural-impliziten Lernen zugeordnet wird, beinhalten komplexe motorische
Lernprozesse oft auch explizite Wissensaneignung (Kandel et al. 1995). Lernt man
z.B. Windsurfen, so bedeutet dies nicht nur einen impliziten Erwerb neuer
Bewegungsmuster, sondern auch eine kognitive Verarbeitung von Informationen.
Beispielsweise werden erfolgreiche und nicht erfolgreiche Versuche interpretiert,
sowie neue Wind- und Wasserbedingungen nach Möglichkeit vorab analysiert.
Andererseits können durch konstantes Üben explizite Gedächtnisinhalte in implizite
Formen überführt werden. So benötigt das Fahren eines Autos zu Beginn sehr viel
1. Einleitung
4
Aufmerksamkeit und bewusste Kontrolle, wird aber später oft zu einem
automatischen und unbewussten Bewegungsablauf.
Lernen ist Forschungsgegenstand zahlreicher Wissenschaften, beispielsweise von
Teilgebieten der Psychologie (z.B. experimentelle Psychologie), der Biologie (z.B.
Neurobiologie) und der Sportwissenschaft (z.B. Bewegungsphysiologie und
Trainingslehre), welche motorische Lernprozesse auf z.T. sehr unterschiedlichen
Ebenen des Systems Mensch untersuchen. So kann man Lernen beispielsweise auf
einer molekularen Ebene, einer Ebene neuronaler Netze oder auf einer Ebene
"äußer lich sichtbarer" Veränderungen von Bewegungen erforschen.
Aus einer Perspektive des beobachtbaren Verhaltens lässt sich folgende Definition
von motorischem Lernen formulieren:
Motorisches Lernen stellt eine Reihe von Prozessen dar, welche mit Übung und
Erfahrung verbunden sind und zu relativ dauerhaften Veränderungen von
Bewegungsfertigkeiten führen (verändert nach Schmidt & Lee 1999).
Diese Definition impliziert bestimmte Charakteristika des motorischen Lernens. So
besteht motorisches Lernen aus einer Reihe von Übungsprozessen, d.h.
Bewegungsmuster werden wiederholt, möglichst verbessert und erneut wiederholt.
Diese Übungsprozesse führen dann, bei ausreichend langer Dauer, zu verbesserten
Bewegungsfertigkeiten. Motorisches Lernen ist demnach zu unterscheiden von
Reifung im Sinne von Veränderungen durch ontogenetische Prozesse. Die
individuelle Entwicklung, wie beispielsweise die des zentralen und peripheren
Nervensystems, kann aber sehr wohl Grundlage für motorisches Lernen sein, auf
deren Basis dann neue Fertigkeiten entstehen. Des weiteren sind durch motorisches
Lernen entstandene Verbesserungen von relativ stabiler und dauerhafter Natur, d.h.
sie sind, zumindest teilweise, auch noch nach einer bestimmten Zeitspanne ohne
Bewegungsausführung vorhanden. Lernen unterscheidet sich dadurch klar von
Leistungsverbesserungen, welche auf Veränderungen temporärer Variablen wie
beispielsweise Motivation, Ermüdung, Trainingszustand, Aufmerksamkeit oder
1. Einleitung
5
Biorhythmus beruhen und deshalb nicht von Dauer sind. Der Kontrolle temporärer
Variablen fällt daher bei Lernexperimenten eine kritische Rolle zu, zumal nicht jede
Verbesserung der Leistung zwangsläufig einen Lernprozess darstellt (Shea &
Morgan 1979). Anders formuliert, nicht jede Leistungskurve, welche eine
zunehmend bessere Bewegungsausführung beschreibt, repräsentiert gleichzeitig eine
Lernkurve.
Eine weitere Schwierigkeit von Untersuchungen motorischen Lernens besteht darin,
ablaufende innere Prozesse zu registrieren. Lernt man beispielsweise Tennis zu
spielen, so können die dabei auftretenden Veränderungen des zentralen
Nervensystems, wie etwa neue synaptische Verbindungen, in den meisten Fällen
nicht erfasst werden. Sehr wohl messbar sind jedoch äußerlich sichtbare
Leistungsverbesserungen, wie etwa Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz
einer Schlagbewegung. Werden dabei temporäre Variablen konstant gehalten, so
kann man auf innere Lernprozesse rückschließen.
1.2 Leistungsverbesserungen durch motorisches Lernen
Die vorrangige, aber dennoch nicht triviale Beobachtung von Lernen ist eine
Verbesserung der Leistung. Oft ist diese ausgeprägt und offensichtlich, sie kann aber
auch unmerklich sein und nur durch besondere Untersuchungsmethoden sichtbar
werden. So kann es beispielsweise dazu kommen, dass keine Leistungsverbesserung
mehr registriert wird, aber dennoch weiteres Lernen stattfindet, z.B. im Sinne einer
zunehmenden Automatisierung. Das Plateau einer Leistungskurve muss demnach
nicht immer mit einer Stagnation des Lernprozesses korreliert sein. Durch die
Anwendung besonderer Methoden, wie beispielsweise der gleichzeitigen Ausführung
einer weiteren Aufgabe (Doppeltätigkeits-Methodik, s.u.), können auch in solchen
Fällen Lernprozesse weiterhin untersucht werden (vgl. Schmidt & Lee 1999).
Die Leistungsverbesserung ist zu Beginn des Lernens meist rapide und sprunghaft
und wird im weiteren Übungsverlauf kontinuierlich geringer. Leistungskurven, als
graphische Darstellung von Bewegungsleistungen gegen die Übungszeit, ähneln
1. Einleitung
6
deshalb gewöhnlich exponentiellen Funktionen. Statt der absoluten Werte kann man
ebenso den Logarithmus der Leistung gegen den Logarithmus der Übungszeit
darstellen, welches dann eine lineare Funktion ergibt und als "law of practice"
bezeichnet wird (Snoddy 1926)
1
. Dieses impliziert, dass das Ausmaß der
Leistungsverbesserung zu einem beliebigen Zeitpunkt des Übens umgekehrt
proportional zu der noch restlich möglichen Leistungssteigerung ist. Anders
formuliert bedeutet dies, je höher das Leistungsniveau ist, desto langsamer lernt man
dazu. Daraus ergibt sich des weiteren, dass auch auf hohem Leistungsniveau weitere
Verbesserungen zwar schwierig, aber bei entsprechend langer Übungsdauer dennoch
möglich sind. So erhöhte sich beispielsweise die Leistung von Arbeitern einer
Zigarrenfabrik auch nach 7 Jahren und mehr als 10 Millionen angefertigten Zigarren
immer noch (Crossman 1959).
Die in den letzten beiden Paragraphen beschriebenen Veränderungen durch Lernen
lassen sich bei einer weiten Bandbreite motorischer Aufgaben beobachten (vgl. Fitts
1964). Sie sind allerdings nur eine Beschreibung des Zusammenhangs von Leistung
und Übung und liefern keinen weiteren Aufschluss über die dem Lernen
zugrundeliegenden Prozesse.
1.3 Theorien motorischer Lernprozesse
Schon gegen Ende des 19ten Jahrhunderts formulierte James (1890) als einer der
Ersten die Vorstellung, dass Lernprozesse von einer bewusst kontrollierten
Steuerung hin zu einer immer mehr aufmerksamkeitsfreien, d.h. automatisierten
Ausführung verlaufen. Empirische Befunde für sein Modell konnte er allerdings
nicht präsentieren.
1
"Law of practice" als logarithmische Darstellu ng: Log(Z) = Log(a) b(Log P); Z = Zeit eine Aktion
zu beenden, P = Praxisumfang, a und b = Konstanten.
1. Einleitung
7
Bryan und Harter (1897, 1899) untersuchten motorische Prozesse während des
Erlernens der Telegraphie. Ihre Daten zeigten einen Lernfortschritt, welcher in
abwechselnden Phasen von Verbesserung, Stagnation mit Plateaubildung und
erneuter Verbesserung voranschritt. Sie interpretierten dies als eine stufenartige
Aneignung hierarchisch aufgebauter sogenannter "Habits".
Im 20sten Jahrhundert entwickelte sich vermehrt die Modellvorstellung, dass Lernen
sukzessive Phasen oder Ebenen durchläuft und dass jede Phase jeweils typische
sensomotorische Prozesse beinhaltet. Shiffrin und Schneider (Schneider & Shiffrin
1977; Shiffrin & Schneider 1977) präsentierten eine Reihe von Experimenten,
welche hauptsächlich aus visuellen "Wiedererkennungsaufgabe n" von Zahlen und
Buchstaben bestanden. Sie postulierten eine Veränderung im Verlauf des Lernens
von einer kontrollierten Informationsverarbeitung, charakterisiert als langsam,
bewusst, seriell und aufmerksamkeitsabhängig, hin zu einer automatischen
Informationsverarbeitung mit schnellen, unbewussten, parallelen und
aufmerksamkeitsunabhängigen Prozessen. Ähnliche Modelle sind auch für
motorische Lernprozesse vorgeschlagen worden, welche im Folgenden dargestellt
werden.
1.3.1 Phasenmodelle motorischer Lernprozesse
1.3.1.1 Zweiphasige Modelle
Als Erster postulierte Snoddy (1926) ein Modell, welches motorisches Lernen als
einen in zwei Phasen ablaufenden Prozess beschrieb. Seine Versuchspersonen malten
geometrische Figuren, während sie als visuelles Feedback nur das Spiegelbild ihrer
Hand sahen. Snoddy unterteilte den Lernprozess in eine "adaptive Stufe", in welcher
die Aneignung der erforderlichen Bewegungsmuster erfolgte und eine anschließende,
die Leistungsfähigkeit verbessernde "Erleichterungsstufe".
Adams (1971) beschrieb, aufbauend auf seiner "closed loop" Theorie, zwei Phasen
eines motorischen Lernprozesses. Eine frühe "verbal-motorische Phase", in welcher
1. Einleitung
8
mittels eines Abgleichs von erzieltem Ergebnis (knowlegde of results) und eigener
Wahrnehmung der Bewegungsausführung Abweichungen des Sollwertes erkannt,
verbalisiert und zur Fehlerkorrektur verwendet werden. Dieser schließt sich eine
"motorische Phase" an, in der durch eine zunehmend ausgebildete
Wahrnehmungsspur (perceptual trace) eine weitere Verbesserung und Stabilisierung
der Bewegung auch ohne explizite Verarbeitung der Rückinformation stattfindet.
Gentile (1972) unterscheidet ebenfalls zwei Phasen des motorischen Lernens, denen
sie unterschiedliche Verarbeitungsprozesse zuordnete. In einer ersten Phase geht es
darum, das Ziel der Bewegung zu erkennen (getting the idea of the movement).
Charakterisierend hierfür sind u.a. Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit,
Entwicklung eines Bewegungsplanes und Feedback-Verarbeitung. Diesem schließt
sich eine zweite Phase an, die von der Art der Bewegungsaufgabe abhängig ist. Für
"closed skills", d.h. vorhersagbare Aufgaben, wird das beste Bewegungsmuster
stabilisiert (fixation). Für "open skills" mit wechselnden äußeren Bedingungen geht
es um den Erwerb von Bewegungsvariationen (diversification), welche an die
jeweilige Situation angepasst werden.
1.3.1.2 Dreiphasige Modelle
Ein oft zitiertes Modell ist das von Fitts (1964), welches drei aufeinanderfolgende
Phasen des motorischen Lernens unterscheidet. In einer "kognitiven Phase" zu
Beginn des Lernens versucht der Übende, die Anforderungen der Aufgabe zu
begreifen und mögliche Lösungsstrategien zu entwickeln. Dies ist oft geprägt durch
eine bewusste Verbalisierung und Selbstinstruktion der Aufgabe bzw. der
Sollbewegung. Adäquate Lösungen werden beibehalten, schlechte verworfen. Diese
Phase ist oft verbunden mit großen und sprunghaften, aber noch sehr unbeständigen
Leistungsverbesserungen.
In einer sich anschließenden "assoziativen Phase" erfolgen feinmotorische
Verbesserungen und eine Ökonomisierung der Bewegung. Sie ist gekennzeichnet
durch langsame, aber kontinuierliche und stabile Leistungsverbesserungen.
1. Einleitung
9
Durch weiteres Üben gelangt der Lernende schließlich in die "autonome Phase" .
Diese ist gekennzeichnet durch überwiegend automatisierte Bewegungsprozesse mit
einhergehender Reduzierung der notwendigen Aufmerksamkeit. Es können jetzt,
gleichzeitig zur Bewegungsausführung, weitere Informationen ohne
Leistungseinbußen zusätzlich verarbeitet und genutzt werden, beispielsweise für
taktische Handlungen oder Bewegungsvariationen.
Den drei Phasen von Fitts entsprechen bei Anderson (1982) zwei
aufeinanderfolgende Phasen mit einem Übergangsprozess. Diese basieren auf
Andersons ACT-Modell, dem eine Unterscheidung von deklarativem und
prozeduralem Wissen zugrunde liegt. Die initiale Phase zu Beginn des Lernens nennt
Anderson "deklarative Ebene" . Notwendige Informationen werden kontinuierlich im
Arbeitsgedächtnis wiederholt, oft verbunden mit verbaler Selbstinstruktion. Durch
weiterführendes Üben kommt es zu einem graduellen Prozess der
"Wissensaneignung" . Diese Phase charakterisiert einen Übergangsprozess und
entspricht Fitts assoziativer Phase. Nach erfolgter Aneignung gelangt man in die
"prozedurale Ebene" , in der es zu einer weiteren Feinabstimmung des
Bewegungsmusters kommt.
Meinel und Schnabel (1998) unterscheiden ebenfalls zwischen drei Lernphasen. In
der Phase der "Entwicklung der Grobkoordination" kommt es zu einem Erfassen der
Lernaufgabe, welches eine grobe, vorwiegend optische Vorstellung des
Bewegungsablaufes beinhaltet. Hieraus entwickelt sich ein noch ungenaues und
instabiles Bewegungsprogramm. Während der "Entwicklung der Feinkoordination"
werden zunehmend kinästhetische Informationen mit einbezogen. Vor allem die
Bewegungskoordination wird fortlaufend verfeinert und optimiert, kann jedoch durch
äußere Faktoren noch relativ leicht gestört werden. Schließlich werden in der Phase
der "Stabilisierung der Feinkoordination und Entwicklung der variablen
Verfügbarkeit" die Bewegungsmuster zunehmend verfestigt und die
Informationsverarbeitung auf die wesentlichen Aspekte der Bewegung konzentriert.
Immer weniger Aufmerksamkeit wird für die Bewegungsausführung benötigt und
1. Einleitung
10
steht somit für andere Prozesse, wie beispielsweise Bewegungsvariationen, zur
Verfügung.
1.3.1.3 Zusammenfassung
Unabhängig von den unterschiedlichen Begrifflichkeiten und theoretischen
Hintergründen weisen die verschiedenen Modelle von Lernprozessen bestimmte
Gemeinsamkeiten auf.
Grundsätzlich wird angenommen, dass in einer frühen "kognitiven Phase" des
Lernens die Betonung auf der Ausbildung einer Bewegungsvorstellung liegt. In
dieser Phase geht um ein Erfassen der Bewegungsanforderungen, d.h. der Lernende
fragt sich "Was muss ich machen?". Für Fehlerkorrekturen wird besonders visuelles
Feedback verwendet. Die vorherrschenden informationsverarbeitenden Prozesse
können beschrieben werden als kognitiv, (selbst-) verbalisierend, bewusst und
aufmerksamkeitsabhängig.
In späteren Abschnitten des Lernens kommt es zu einer stetigen Verbesserung und
Ausdifferenzierung des Bewegungsmusters, vermehrt durch die Verarbeitung
kinästhetischer Rückinformation. Nun steht die Frage "Wie muss ich es machen?" im
Vordergrund. Unnötige motorische Anteile fallen weg und die Bewegung wird
kontinuierlich ökonomischer, koordinierter und feinmotorischer. Diese Phase wird
deshalb oft als "motorische Phase" bezeichnet.
Im weiteren Verlauf des Lernens wird die Bewegung zunehmend verfestigt und
automatisiert. Damit ist fortschreitend weniger Aufmerksamkeit für die
Bewegungsausführung nötig, welche daher auf andere Aspekte gerichtet werden
kann. Dieser Abschnitt des Lernens lässt sich deshalb als "autonome Phase"
kennzeichnen.
Einer Einteilung von motorischen Lernprozessen in diskrete Phasen, unabhängig
davon ob zwei oder drei Phasen unterschieden werden, liegt die Vorstellung
zugrunde, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Lernens spezifische
1. Einleitung
11
sensomotorische Verarbeitungsprozesse dominieren. Dabei sind die Übergänge
zwischen den Phasen oft fließend, so dass die Prozesse ineinander übergehen.
1.4 Empirische Studien zu motorischen Lernprozessen
Untersuchungen von motorischen Lernprozessen sind mit besonderen
Schwierigkeiten verbunden. Betrachtet man "natürliche" Lernprozesse aus Beruf und
Alltag, dann ist es sehr schwer, die zahlreich wirksamen Variablen (z.B. Übungszeit
und Umgebungsbedingungen) so zu kontrollieren, dass eine wissenschaftliche
Interpretation möglich ist. Untersucht man statt dessen Lernprozesse unter
Laborbedingungen, so werden (z.B. aus Zeitgründen) meist simple Lernaufgaben
verwendet. Hieraus ergibt sich wiederum die Problematik, ob die Ergebnisse von
eher einfachen Lernprozessen auch auf komplexere Lernprozesse übertragen werden
können.
Mögliche experimentelle Methoden motorisches Lernen zu untersuchen sind
Korrelationsstudien, Studien mit unterschiedlichem Training und Studien mit
Doppeltätigkeiten.
1.4.1 Korrelationsstudien
In Korrelationsstudien über individuelle Unterschiede wird die Bewegungsleistung
zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Lernens korreliert mit spezifischen Fähigkeiten
der Versuchsperson, welche in vorherigen Tests ermittelt wurden (Fleishman &
Hempel 1954, 1955; Fleishman & Rich 1963). So bestand beispielsweise die
Lernaufgabe von Fleishman und Rich (1963) darin, einem sich zweidimensional
bewegenden Punkt mit einem Cursor zu folgen, wobei jede Hand eine
Achsenrichtung des Cursors steuerte. Vorab wurden in zwei Vortests die
kinästhetische Differenzierungsfähigkeit sowie die räumliche Orientierungsfähigkeit
der Versuchspersonen bestimmt. Fleishman und Rich fanden eine hohe Korrelation
von guten Bewegungsleistungen in frühen Phasen des Lernens mit guten Leistungen
im Vortest über räumliche Orientierungsfähigkeit. Des weiteren hatten
1. Einleitung
12
Versuchspersonen mit guten Leistungen im Vortest über kinästhetische
Differenzierungsfähigkeit gute Bewegungsleistungen in späteren Phasen des
Lernens. Ihre Ergebnisse sind interpretierbar als Hinweise dafür, dass in frühen
Phasen des Lernens vermehrt räumliche Orientierung und in späteren Phasen eher
kinästhetische Verarbeitung dominante Prozesse für eine gute Leistung darstellen.
1.4.2 Studien mit unterschiedlichem Training
Wenn zwei Gruppen von Versuchspersonen die gleiche Bewegungsaufgabe mit
unterschiedlichem Training erlernen und sich dabei Unterschiede in der
Leistungsverbesserung ergeben, so kann dies auf spezifische Auswirkungen des
Trainings zurückgeführt werden. Bei Müller (1995) mussten die Probanden eine
grobmotorische Ganzkörperbewegung ("große Körperwelle vorwärts") erlernen. Er
untersuchte den Einfluss von "observativ -mentalem Training" (ständige Vorgabe der
Sollbewegung ohne eigene Bewegungsausführung) und "physischem Training"
(nach einmaliger Vorgabe nur eigene Bewegungsausführung), sowohl in frühen als
auch in späten Abschnitten des Lernens. Seine Ergebnisse zeigten höhere
Leistungsverbesserungen der Gruppe mit observativ-mentalem Training zu einem
frühen Übungszeitpunkt, was als eine Dominanz kognitiv-konzeptbildender
Teilprozesse in frühen Phasen des motorischen Lernens interpretiert wurde. Für späte
Abschnitte des Lernens konnten allerdings keine signifikanten Unterschiede
bezüglich der beiden Trainingsmethoden gezeigt werden, so dass keine Hinweise für
eine erhöhte Bedeutung motorisch-adaptiver Teilprozesse in späten Phasen des
Lernens gefunden wurden.
Sowohl Studien mit unterschiedlichem Training als auch Korrelationsstudien
beziehen sich auf interindividuelle Unterschiede und sind deshalb unsensibel für
mögliche Veränderungen während des Lernens innerhalb einer Versuchsperson.
1. Einleitung
13
1.4.3 Studien mit Doppeltätigkeiten
Eine weitere Möglichkeit motorische Lernprozesse zu untersuchen ist die Methode
der Doppeltätigkeit (für eine generelle Übersicht siehe Heuer 1996). Hierbei wird
eine motorische Lernaufgabe kombiniert mit der gleichzeitigen Ausführung einer
weiteren Aufgabe, welche als Zweitaufgabe bezeichnet wird. Die Zweitaufgabe hat
dabei oftmals eher kognitiven Charakter.
1.4.3.1 Interpretation von Doppeltätigkeits-Interferenz
Werden zwei Aufgaben gleichzeitig ausgeführt, so geschieht dies häufig auf Kosten
einer Verschlechterung der Leistung einer oder beider Aufgaben im Vergleich zu
einer zeitlich separaten Durchführung beider Aufgaben. Eine derartige Reduzierung
der Leistung wird allgemein als Doppeltätigkeits-Interferenz bezeichnet (z.B. Navon
& Gopher 1979; Heuer 1996).
Eine Möglichkeit, Interferenz-Effekte von Doppeltätigkeiten zu erklären, ist die
Annahme, dass beide Aufgaben um gleiche peripher-sensomotorische Mechanismen
konkurrieren (Kahnemann 1973; Navon & Miller 1987).
Ein offensichtlicher Wettbewerb zweier Aufgaben um periphere Mechanismen tritt
auf bei einem gleichzeitigen Zugriff auf physische Strukturen mit identischen Ein-
und Ausgabevorrichtungen (Heuer 1996). So kann beispielsweise die Hand zu einem
bestimmten Zeitpunkt nur an einem Ort im Raum sein. Genauso können die Augen
nur eine Signalquelle zur gleichen Zeit fokussieren, so dass zwei weit auseinander
liegende visuelle Reize nur mir zeitlichem Verlust verarbeitet werden können. Neben
einer solchen offensichtlichen Unvereinbarkeit zweier Aufgaben wird Interferenz
aber auch bei einer Kopplung von Ausgabesystemen erkennbar, wie dies
beispielsweise bei der gleichzeitigen Bewegung beider Arme der Fall ist. Besonders
bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten kommt es zu einer Kopplung homologer
Muskelgruppen, welche bevorzugt simultan (in-phasig) oder alternierend (gegen-
phasig) aktiviert werden (Kelso 1984). Durch entsprechendes Training können
1. Einleitung
14
jedoch auch andere Koordinierungsmuster der Arme erlernt werden (Zanone &
Kelso 1992; Wenderoth & Bock 2001).
Generell wird angenommen, dass sich die Interferenz um periphere Mechanismen
erhöht, je ähnlicher sich Input- und Output-Modalitäten beider Aufgaben sind
(Damos & Wickens 1980). Einem ähnlichen Ansatz folgend postulierte Kahnemann
(Kahnemann 1973), dass Interferenz auftritt, wenn zwei Tätigkeiten gleiche
Rezeptoren oder Effektoren benötigen. Tatsächlich fand man höhere Interferenz für
eine Kombination zweier manueller Aufgaben im Vergleich zu einer Kombination
einer manuellen mit einer verbalen Aufgabe (McLeod 1980). Ebenso ergaben sich
generell bessere Doppeltätigkeits-Leistungen wenn verschiedene Stimulus-
Modalitäten verwendet wurden (für eine Übersicht siehe Damos 1985).
Viele Umstände jedoch, unter denen Doppeltätigkeits-Interferenz zustande kommt,
lassen sich nicht oder nur zum Teil durch eine Konkurrenz um periphere
Mechanismen erklären (vgl. Wickens 1991; Heuer 1996). So ergaben
Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeit eines Autounfalls durch gleichzeitiges
Telefonieren, dass während der Wahl der Telefonnummern die Unfallgefahr bei der
Benutzung eines "Handtelefons" im Vergleich zu einer Freisprechanlage erhöht war
(Briem & Hedman 1995). Dies kann als Zeichen einer peripheren Interferenz von
manuellen Prozessen des Autofahrens und der manuellen Bedienung des
Autotelefons interpretiert werden. Darüber hinaus zeigte sich aber, dass die
Wahrscheinlichkeit eines Unfalls während des Gespräches für beide Telefontypen
gleich war (Redelmeier & Tibshira 1997). Die Leistung der Autofahrer während des
Telefonats verschlechterte sich demnach unabhängig von einer motorischen
Handhabung des Telefons und kann daher nicht durch Konkurrenz um periphere
Mechanismen erklärt werden. Vielmehr deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass sich
die kognitive Beanspruchung des Telefonierens störend auf das Autofahren
auswirkte. Neben peripheren Mechanismen muss es also noch andere eher kognitive
Prozesse geben, die zu einer Interferenz zweier Aufgaben führen können.
Eine weitere Möglichkeit Doppeltätigkeits-Interferenz zu erklären, ist die Annahme
einer Konkurrenz um zentral-kognitive Ressourcen (Kahnemann 1973; Navon &
1. Einleitung
15
Gopher 1979; Wickens 1991). Ressourcen werden dabei als limitierte innere
Einheiten des zentralen Nervensystems betrachtet, welche für die Durchführung von
Verarbeitungsprozessen notwendig sind (Navon 1984). Die ersten Ansätze,
Doppeltätigkeits-Leistungen durch begrenzte Ressourcen zu erklären, gingen von
einer einzigen zentralen Ressource aus (z.B. Broadbent 1958; Kahnemann 1973). Es
zeigte sich jedoch, dass dieses "Ein -Ressourcen-Modell" nicht alle Ergebnisse von
Doppeltätigkeits-Studien zufriedenstellend erklären konnte. Ein
Interpretationsproblem trat beispielsweise auf, wenn zwei Aufgaben von nicht
trivialer Schwierigkeit ohne Leistungsverlust miteinander kombiniert werden
konnten, jede der beiden jedoch mit anderen Aufgaben zu Interferenz führte
(McLeod 1977; vgl. auch Wickens 1991). Eine mögliche Erklärung wäre die
Beanspruchung unterschiedlicher Ressourcen durch beide Aufgaben, so dass es zu
keiner Konkurrenz kam. Beide könnten jedoch bei einer Kombination mit anderen
Aufgaben, welche jeweils ähnliche Ressourcen benötigen, Interferenz erzeugen.
Als eine Erweiterung des "Ein -Ressourcen-Modells" kam es daher zu dem Konzept
der multiplen Ressourcen (Navon & Gopher 1979; Wickens 1980), welches von der
Existenz einer unbestimmten Anzahl verschiedener Ressourcen ausgeht.
Unterschiedliche Aufgaben können demnach verschiedenartige Ressourcen
beanspruchen, so dass Doppeltätigkeits-Interferenz von den spezifischen
Anforderungen der Aufgabe abhängt. Generell herrscht die Vorstellung, dass
ähnliche Aufgaben ähnliche Ressourcen benötigen und dadurch zu mehr Interferenz
führen. Als eine mögliche Klassifikation von Ressourcen, welche als eine grobe
Vorhersagemöglichkeit von Aufgabenähnlichkeit bzw. Doppeltätigkeits-Interferenz
fungieren kann, schlugen Wickens et al. (1983) drei Dimensionen vor. In der ersten
Dimension, der Verarbeitungs-Ebene, gibt es zwei Ressourcen: die eine ist
verantwortlich für kognitiv-wahrnehmende Prozesse, die andere für Prozesse der
Programmierung einer Reaktion. Die zweite Dimension unterscheidet zwischen der
Verarbeitung von räumlicher oder verbaler Information. Entscheidend für die dritte
Dimension ist die Modalität der Aufgabe, hier wird speziell differenziert zwischen
akustischen und visuellen Aufgaben.
1. Einleitung
16
Ein wichtiger Aspekt der Ressourcen-Theorie ist der Gedanke der Limitiertheit. Jede
Ressource hat eine begrenzte Kapazität, wird diese durch eine gegebene
Ressourcenbeanspruchung überschritten, kommt es zu Leistungseinbußen. Eine
solche Überschreitung der Kapazität kann beispielsweise durch das Hinzufügen einer
Zweitaufgabe zustande kommen.
Ein weiterer bedeutender Gesichtspunkt ist die Vorstellung der Aufteilbarkeit, d.h.
die Kapazität einer Ressource kann variabel auf zwei oder mehrere Aufgaben
aufgeteilt werden. Je nach Gewichtung der Aufgaben kommt es zu einer typischen
Verschiebung der Ressourcen-Zuteilung und somit zu einer Veränderung der
Leistungen in beiden Aufgaben. Dieser Zusammenhang ist als sogenannte
"Performance -Operating-Characteristic" beschrieben worden (POC, siehe
Abbildung 1.1).
L eistung A ufgabe A
schlecht
gut
gut
L eistungskurve
bei D oppeltätigkeit
L
ei
st
un
g
A
uf
ga
be
B
Abb. 1.1. Schematische Darstellung einer theoretischen Performance-Operating-Characteristic zweier
simultaner Aufgaben (verändert nach Wickens 1991). Eine gegebene Leistung von Aufgabe A führt
zu einer bestimmten Leistung in Aufgabe B, markiert durch die gestrichelte Linie. Anhand einer
gedachten Leistungskurve kann bei einer Veränderung der Priorität die relative Leistung beider
Aufgaben vorhergesagt werden.
Die POC beruht auf der Annahme, dass zwei gleichzeitig ausgeführte Tätigkeiten um
einen begrenzten Ressourcenbedarf konkurrieren. Je mehr Ressourcen von einer
Tätigkeit beansprucht werden, desto weniger Ressourcen verbleiben für die andere.
Eine Leistungsverbesserung in einer der beiden Aufgaben ist somit verbunden mit
einer Verschlechterung der Leistung der anderen Aufgabe. Veränderungen der
1. Einleitung
17
Leistung durch eine Verschiebung der Priorität können sowohl bewusst herbeigeführt
werden als auch unbewusst ablaufen. Eine typische Veränderung der Leistung zweier
Aufgaben durch eine bestimmte Prioritätsverteilung, wie sie durch eine POC
vorhergesagt wird, ist auch für empirische Daten gefunden worden (Schmidt et al.
1984).
Leistungseinbußen, welche durch die gleichzeitige Ausführung zweier Aufgaben
entstehen, werden im allgemeinen durch Übung immer geringer und verschwinden
oft gänzlich. Eine Kombination zweier Aufgaben ohne Interferenz wurde daher als
Definitionskriterium für automatische Prozesse vorgeschlagen (Neumann 1984).
Aufgrund empirischer Studien wurde diese Sichtweise jedoch zunehmend relativiert
(Neumann 1987). Denn selbst für alltägliche Prozesse mit einem sehr hohen Grad an
Automatisation lassen sich mögliche Zweitaufgaben finden, welche zu einer
Beeinträchtigung führen. Doppeltätigkeits-Interferenz ist demnach nicht nur von dem
Leistungsniveau einer gegebenen Aufgabe abhängig, sondern auch von den
spezifischen Anforderungen der hinzugefügten Zweitaufgabe. Generell lässt sich
jedoch sagen, dass reduzierte Doppeltätigkeits-Interferenz ein Zeichen für
zunehmende Automatisation sein kann (Neumann 1987).
Ein weiterer Ansatz zur Erklärung von Doppeltätigkeits-Leistungen während eines
Lernprozesses ist das Konzept der strukturellen Verlagerung und strukturellen
Einschränkung (Heuer 1984). Werden zwei Aufgaben geübt, so kommt es nach
Heuer zu struktureller Einschränkung, d.h. die Ausführung wird zunehmend
aufgabenspezifischer und ihre Doppeltätigkeits-Leistung dadurch generell besser.
Strukturelle Einschränkung kann deshalb als Zeichen einer fortschreitenden
Ökonomisierung und Automatisation der Bewegung gedeutet werden. Darüber
hinaus kann es zu struktureller Verlagerung kommen, indem sich die Anforderung
einer Aufgabe im Verlauf des Lernens ändert. Eine Zunahme der Doppeltätigkeits-
Interferenz während des Übens wäre daher ein Zeichen für strukturelle Verlagerung.
Letztere ist von besonderem Interesse, da sie zunehmende Beanspruchungen
während eines Lernprozesses darstellt. Heuer (1984) erklärte entstehende
Leistungseinbußen bei Doppeltätigkeiten durch einen Zugriff beider Aufgaben auf
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832456665
- ISBN (Paperback)
- 9783838656663
- DOI
- 10.3239/9783832456665
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Deutsche Sporthochschule Köln – Sportwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Juli)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- lernphasen motorik doppelaufgaben interferenz adaptation
- Produktsicherheit
- Diplom.de