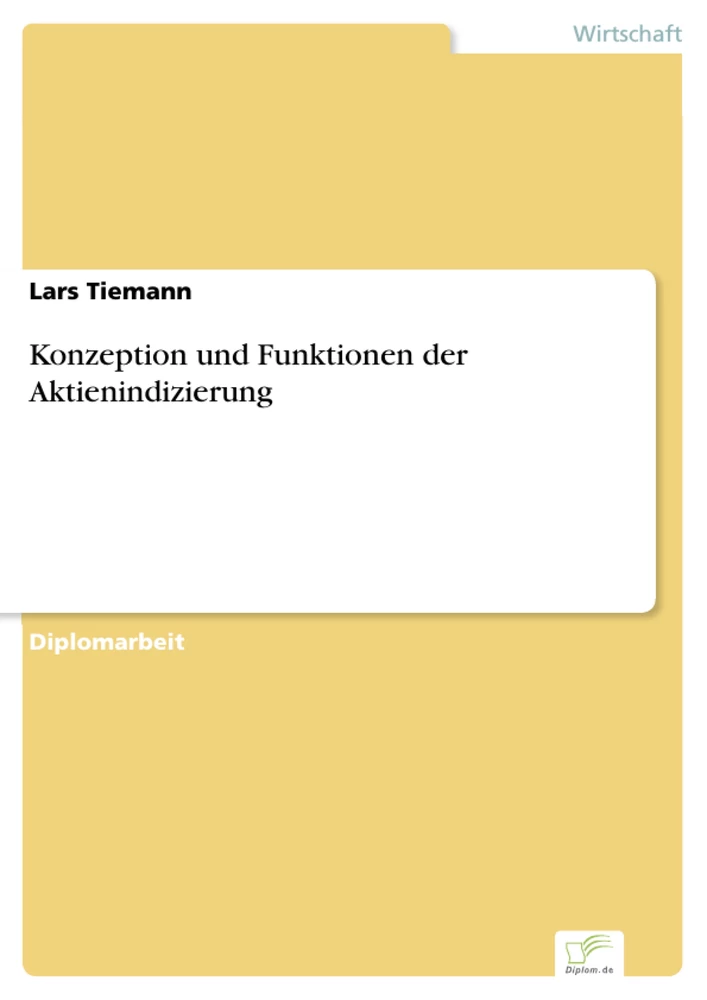Konzeption und Funktionen der Aktienindizierung
©2002
Diplomarbeit
184 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Zahl der Aktienindizes hat Anfang des 21. Jahrhunderts weltweit eine Größenordnung von über 33000 erreicht und nimmt ständig weiter zu. In den Medien sind Aktienindizes mittlerweile präsenter als die zugrundeliegenden Aktien selber. Der breiten Bevölkerung sind Aktienindizes, wie der DAX oder der Dow Jones-Index, bekannt. Fundierte Kenntnisse liegen i.d.R. jedoch nicht vor.
Für am Börsengeschehen interessierte Benutzer von Aktienindizes sind Hintergrundinformationen von entscheidender Natur. Diese Informationen und ihre Zusammenhänge sind zwingend, um ein rationales Urteil über die Aussagekraft der jeweiligen Aktienindizes zu bilden.
Die bedeutendsten deutschsprachigen Werke zur Aktienindizierung stammen aus den Jahren 1966 bis 1992. Bleymüller stellte 1966 zum ersten Mal eine Arbeit zu Aktienindizes zusammen. Andere wesentliche Arbeiten folgten von weiteren Verfassern. Nach 1992 erschienen keine umfassenden wissenschaftlichen Werke mehr, die sich primär mit Konzeptionen und Funktionen der Aktienindizierung befaßten. In den letzten Jahren publizierten hauptsächlich Anbieter von Aktienindizes aktuelle und konkrete Auslegungen ihrer eigenen Indizes. Seitdem fehlt es an einem konzeptionellen Werk, das allgemein und zugleich zeitgemäß die Aktienindizierung diskutiert.
Diese Arbeit stellt ein umfassendes Werk zu diesem Thema dar. Das Ziel liegt darin begründet, die angeführte Lücke in der Wissenschaft zu schließen, indem konzeptionelle Ansätze unter aktuellen Bedingungen kritisch diskutiert werden. Zudem setzt sich dieses Werk mit den Funktionen der Aktienindizierung umfangreich auseinander, da sich diese in den letzten Jahren erheblich erweitert haben. Angereichert wird diese Diskussionsgrundlage mit vielen praktischen Beispielen bedeutender Aktienindizes. Darüber hinaus werden ausführlich die aktuellen Gewichtungsumstellungen auf den Free-Float behandelt, sowie die Versuche einiger Anbieter, die Qualität ihrer Aktienindizes durch restriktivere Auswahlkriterien zu steigern.
Gang der Untersuchung:
Diese Arbeit besteht aus acht Kapiteln. Dazu greift sie zunächst allgemeine und für das Verständnis notwendige Grundlagen auf, die im zweiten Kapitel dargestellt werden. Anschließend werden im dritten Kapitel ausführlich die verschiedenen Ansätze der Aktienindizierung diskutiert, bevor im vierten Kapitel mit der Konzeption ein zentraler Bestandteil dieses Werks umfassend und zeitgemäß erörtert wird. Im fünften Kapitel wird […]
Die Zahl der Aktienindizes hat Anfang des 21. Jahrhunderts weltweit eine Größenordnung von über 33000 erreicht und nimmt ständig weiter zu. In den Medien sind Aktienindizes mittlerweile präsenter als die zugrundeliegenden Aktien selber. Der breiten Bevölkerung sind Aktienindizes, wie der DAX oder der Dow Jones-Index, bekannt. Fundierte Kenntnisse liegen i.d.R. jedoch nicht vor.
Für am Börsengeschehen interessierte Benutzer von Aktienindizes sind Hintergrundinformationen von entscheidender Natur. Diese Informationen und ihre Zusammenhänge sind zwingend, um ein rationales Urteil über die Aussagekraft der jeweiligen Aktienindizes zu bilden.
Die bedeutendsten deutschsprachigen Werke zur Aktienindizierung stammen aus den Jahren 1966 bis 1992. Bleymüller stellte 1966 zum ersten Mal eine Arbeit zu Aktienindizes zusammen. Andere wesentliche Arbeiten folgten von weiteren Verfassern. Nach 1992 erschienen keine umfassenden wissenschaftlichen Werke mehr, die sich primär mit Konzeptionen und Funktionen der Aktienindizierung befaßten. In den letzten Jahren publizierten hauptsächlich Anbieter von Aktienindizes aktuelle und konkrete Auslegungen ihrer eigenen Indizes. Seitdem fehlt es an einem konzeptionellen Werk, das allgemein und zugleich zeitgemäß die Aktienindizierung diskutiert.
Diese Arbeit stellt ein umfassendes Werk zu diesem Thema dar. Das Ziel liegt darin begründet, die angeführte Lücke in der Wissenschaft zu schließen, indem konzeptionelle Ansätze unter aktuellen Bedingungen kritisch diskutiert werden. Zudem setzt sich dieses Werk mit den Funktionen der Aktienindizierung umfangreich auseinander, da sich diese in den letzten Jahren erheblich erweitert haben. Angereichert wird diese Diskussionsgrundlage mit vielen praktischen Beispielen bedeutender Aktienindizes. Darüber hinaus werden ausführlich die aktuellen Gewichtungsumstellungen auf den Free-Float behandelt, sowie die Versuche einiger Anbieter, die Qualität ihrer Aktienindizes durch restriktivere Auswahlkriterien zu steigern.
Gang der Untersuchung:
Diese Arbeit besteht aus acht Kapiteln. Dazu greift sie zunächst allgemeine und für das Verständnis notwendige Grundlagen auf, die im zweiten Kapitel dargestellt werden. Anschließend werden im dritten Kapitel ausführlich die verschiedenen Ansätze der Aktienindizierung diskutiert, bevor im vierten Kapitel mit der Konzeption ein zentraler Bestandteil dieses Werks umfassend und zeitgemäß erörtert wird. Im fünften Kapitel wird […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5645
Tiemann, Lars: Konzeption und Funktionen der Aktienindizierung / Lars Tiemann - Hamburg:
Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Bielefeld, Fachhochschule, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Gliederung
III
Gliederung
Inhaltsverzeichnis
ab Seite: IV
Abbildungsverzeichnis
VII
Tabellenverzeichnis
XI
Abkürzungsverzeichnis
XII
Textteil
(Seiten 1-129)
Anhang
XIV
Literaturverzeichnis
XLIX
Versicherung
LV
Inhaltsverzeichnis
IV
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Einführung
ab Seite: 1
Kapitel
2:
Grundlagen
3
2.1 Motive und Ziele der Aktienindizierung
3
2.2
Vorstellung
der
Index-Theorie 4
2.2.1
Einführung
4
2.2.2
Elementarindizes
6
2.2.3
Generalindizes 8
2.2.4
Gewichtete
Indizes
10
2.3 Historie
10
2.3.1
Aktienindizierung
weltweit
10
2.3.2
Aktienindizierung
in
Deutschland
13
2.4
Emmitenten
von
Aktienindizes 15
2.5 Anforderungen an die Aktienindizierung
17
Kapitel 3: Arten
20
3.1
Einführung
20
3.2
Kurs-
und
Performanceindizes 21
3.3
All-Share-
und
Auswahlindizes 23
3.4
Marktsegmentierte
Indizes
25
3.5
Subindizes
28
Kapitel
4:
Konzeption
29
4.1
Einführung
29
4.2
Basierung 30
4.3
Berechnungsformeln
32
4.3.1
Einführung
32
4.3.2
Formel
nach
Laspeyres
33
4.3.3
Formel
nach
Paasche 34
4.3.4
Wertindex
35
4.3.5 Ungewogener arithmetischer Kursdurchschnitt
36
Inhaltsverzeichnis
V
4.3.6
Zusammenfassung
37
4.4
Gewichtungsgrundlagen
40
4.4.1
Einführung
40
4.4.2
Marktkapitalisierung
41
4.4.3
Free-Float
42
4.4.4
Börsenumsatz 44
4.4.5
Kursgewichtung
45
4.4.6
Zusammenfassung
46
4.5
Auswahlgrundlagen
49
4.5.1
Einführung
49
4.5.2
Anzahl
der
Aktien
50
4.5.3
Auswahlverfahren
51
4.5.4
Bedingungen
54
4.5.5
Zusammenfassung
56
Kapitel 5: Laufende Anpassungen
59
5.1
Einführung
59
5.2
Korrekturen
59
5.2.1
Dividendenbereinigungen
59
5.2.2
Kapitalveränderungen 62
5.3 Änderungen der Indexzusammensetzung
66
5.4
Verkettungen
68
5.5
Zusammenfassung
71
Kapitel 6: Deskriptive Funktionen
73
6.1
Einführung
73
6.2
Aktienerfolg
73
6.3
Benchmarking
75
6.3.1
Einführung
75
6.3.2
Aktienmärkte
76
6.3.3
Anlageformen
77
6.3.4
Individuelle
Anlagestrategien 78
6.3.5
Aktienfonds
78
6.3.6
Unternehmensergebnisse
80
Inhaltsverzeichnis
VI
6.3.7
Anlageempfehlungen 81
6.3.8
Zusammenfassung
82
6.4
Prognose 83
6.4.1
Einführung
83
6.4.2
Charts
84
6.4.3
Trends
und
Zyklen
85
6.4.4
Methoden
87
6.4.5
Zusammenfassung
92
6.5
Abweichungsanalyse
93
6.5.1
Einführung
93
6.5.2
Konzept
der
Volatilitäten
94
6.5.3
Konzept
der
Beta-Faktoren
97
6.5.4
Zusammenfassung
99
6.6
Konjunkturindikator
101
Kapitel 7: Operative Funktionen
104
7.1
Einführung
104
7.2 Grundlage für Terminmarktinstrumente
105
7.2.1
Einführung
105
7.2.2
Motive
106
7.2.3
Aktienindex-Futures
108
7.2.4
Aktienindex-Optionen 110
7.2.5
Weitere
Instrumente
113
7.2.6
Zusammenfassung
115
7.3
Indexnachbildung
117
7.3.1
Einführung
117
7.3.2
Programmhandel
118
7.3.3
Indexfonds
120
7.3.4
Indexzertifikate 123
7.3.5
Zusammenfassung
124
Kapitel 8: Fazit
126
Abbildungsverzeichnis
VII
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Die ersten DJIA-Werte am 26.05.1896
(Seite 12)
Quelle: Rühle, Alf-Sibrand (1991):
Aktienindizes in Deutschland,
Wiesbaden,
DUV,
S.32
Abbildung 2:
Die ersten Werte der Börsenindexziffer vom 01.09.1920
(Seite 13)
Quelle: Rühle, Alf-Sibrand (1991):
Aktienindizes in Deutschland,
Wiesbaden,
DUV,
S.46
Abbildung 3:
Die ersten DAX-Werte vom 30.12.1987
(Seite 15)
Quelle: Janßen, Birgit; Rudolph, Bernd (1992):
Der Deutsche Aktienindex DAX,
Frankfurt a.M., Fritz Knapp, S.10
Abbildung 4:
Aktienindizes und Emmitenten
(Seite 16)
Quelle: Deutsche Börse AG (2002):
Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse,
Frankfurt a.M., Deutsche Börse, S.41 ff.
Abbildung 5:
Entwicklung vom DAX-Kursindex und
(Seite 23)
DAX-Performanceindex
Quelle: Deutsches Aktieninstitut (2000):
Aktienindizes,
Frankfurt a.M., Deutsches Aktieninstitut, S.21
Abbildung 6:
Entwicklung des DAX (Auswahlindex) und des
(Seite 24)
CDAX (Composite-DAX)
Quelle : Deutsches Aktieninstitut (2000):
Aktienindizes,
Frankfurt a.M., Deutsches Aktieninstitut, S.23
Abbildungsverzeichnis
VIII
Abbildung 7:
Abgrenzungsarten für Aktienindizes
(Seite 27)
Quelle: Deutsches Aktieninstitut (2000):
Aktienindizes,
Frankfurt a.M., Deutsches Aktieninstitut, S.25
Abbildung 8:
Entwicklungen verschiedener Berechnungsformeln
(Seite 39)
Quelle: Eigene Darstellung
Abbildung 9:
Indexformeln wichtiger Aktienindizes
(Seite 39)
Quelle: Deutsches Aktieninstitut (2000):
Aktienindizes,
Frankfurt a.M., Deutsches Aktieninstitut, S.16
Abbildung 10:
Streubesitz in verschiedenen Ländern
(Seite 48)
Quelle: Deutsches Aktieninstitut (2000):
Aktienindizes
Frankfurt a.M., Deutsches Aktieninstitut, S.18
Abbildung 11:
Umfang bedeutender Aktienindizes
(Seite 51)
Quelle: Eigene Darstellung
Abbildung 12:
Mögliche Auswahlkriterien
(Seite 52)
Quelle: Eigene Darstellung
Abbildung 13:
Überprüfungstermine der Deutschen Börse AG
(Seite 67)
Quelle: Deutsche Börse AG (2002):
Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse,
Frankfurt a.M., Deutsche Börse, S.21
Abbildung 14:
Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte
(Seite 76)
Quelle: O.V: So verändern sich die Aktienmärkte,
in: Finanztest vom 01.05.2002
Abbildung 15:
Benchmarking auf 20 Jahre mit diversen Anlageformen
(Seite 77)
Quelle: http://www.creditsuisse.com (30.06.2001)
Abbildungsverzeichnis
IX
Abbildung 16:
Linienchart, Balkenchart und Point-and-Figure-Chart
(Seite 85)
Quelle: http://www.consors.de (20.04.2002)
Abbildung 17:
Durchschnittslinien beim DJIA am 24.04.2002
(Seite 89)
Quelle: http://www.consors.de (24.04.2002)
Abbildung 18:
Trendlinien und Trendkanäle
(Seite 90)
Quelle: Perridon, Louis; Steiner, Manfred (1999):
Finanzwirtschaft der Unternehmung,
München, Vahlen, S.245
Abbildung 19:
Widerstands- und Unterstützungslinien
(Seite 91)
Quelle: Perridon, Louis; Steiner, Manfred (1999):
Finanzwirtschaft der Unternehmung,
München, Vahlen, S.246
Abbildung 20:
Mehrdeutigkeit von Formationen
(Seite 92)
Quelle: Perridon, Louis; Steiner, Manfred (1999):
Finanzwirtschaft der Unternehmung,
München, Vahlen, S.249
Abbildung 21:
Trendlinien und Trendkanäle
(Seite 94)
Quelle: Sautter, Jörg (1996):
Messung und Prognose von Volatilitäten,
Frankfurt a.M., HfB, S.5
Abbildung 22:
VDAX und CDAX
(Seite 96)
Quelle: http://de.finance.yahoo.com (26.04.2002)
Abbildung 23:
Konjunkturindikatoren
(Seite 101)
Quelle: Peto, Rudolf (2001):
Grundlagen der Makroökonomik,
München, Oldenbourg, S.173 f.
Abbildungsverzeichnis
X
Abbildung 24:
Systematisches und unsystematisches Risiko
(Seite 107)
Quelle: Janßen, Birgit; Rudolph, Bernd (1992):
Der Deutsche Aktienindex DAX,
Frankfurt a.M., Fritz Knapp, S.48
Abbildung 25:
Entwicklung eines Futures
(Seite 109)
Quelle: Janßen, Birgit; Rudolph, Bernd (1992):
Der Deutsche Aktienindex DAX,
Frankfurt a.M., Fritz Knapp, S.60
Abbildung 26:
Entwicklung einer Kaufoption
(Seite 112)
Quelle: Janßen, Birgit; Rudolph, Bernd (1992):
Der Deutsche Aktienindex DAX,
Frankfurt a.M., Fritz Knapp, S.90
Abbildung 27:
Entwicklung einer Verkaufoption
(Seite 112)
Quelle: Janßen, Birgit; Rudolph, Bernd (1992):
Der Deutsche Aktienindex DAX,
Frankfurt a.M., Fritz Knapp, S.90
Abbildung 28:
Positionierung bei Optionen
(Seite 113)
Quelle: Perridon, Louis; Steiner, Manfred (1999):
Finanzwirtschaft der Unternehmung,
München, Vahlen, S.316
Abbildung 29:
Terminbörsen
(Seite 115)
Quelle: http://www.traders-online.de/boersen.htm
(30.03.2002)
Abbildung 30:
Anzahl der Kontrakte von Terminbörsen
(Seite 116)
Quelle: Eurex Frankfurt AG (2000):
Eurex The European Derivatives Market
Frankfurt a.M., Eurex Frankfurt AG, S.8
Tabellenverzeichnis
XI
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:
Entwicklung eines Elementarindexes
(Seite 6)
Quelle: Eigene Darstellung
Tabelle 2:
Veränderung des Wertes im Basiszeitpunkt
(Seite 7)
Quelle: Eigene Darstellung
Tabelle 3:
Entwicklung eines Basiszeitraums
(Seite 7)
Quelle: Eigene Darstellung
Tabelle 4:
Entwicklung eines ungewogenen Indexes
(Seite 9)
Quelle: Eigene Darstellung
Tabelle 5:
Entwicklung eines Generalindexes mit der Mittelwertbildung
(Seite 9)
Quelle: Eigene Darstellung
Tabelle 6:
Volatilität und Beta-Faktoren (250 Tage)
(Seite 100)
des DAX am 26.04.2002
Quelle:
http://www.deutsche-boerse.com (29.04.2002)
Abkürzungsverzeichnis
XII
Abkürzungsverzeichnis
a.a.O.:
am angeführten Ort
Abb.:
Abbildung
AG:
Aktiengesellschaft
BIP:
Bruttoinlandsprodukt
BSP:
Bruttosozialprodukt
bzw.:
beziehungsweise
ca.:
circa
CAC:
Compagnie des Agents de Change
CBOT:
Chicago Board of Trade
CDAX:
Composite Deutscher Aktienindex
CME:
Chicago
Mercantile
Exchange
COE:
Chicago
Options
Exchange
c.p.:
ceterius
parius
DAX:
Deutscher
Aktienindex
d.h.:
das
heißt
DJIA:
Dow Jones Industrial Average
DJTA:
Dow Jones Transportation Average
DTB:
Deutsche
Terminbörse
Ebd.:
Ebenda
ETF:
Exchange
Traded
Funds
Eurex:
European
Exchange
f.:
folgende
(Seite)
ff.:
fortfolgende
(Seiten)
F.A.Z.:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
FTSE:
Financial Times Stock Exchange
GmbH :
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
IAS:
International
Accounting
Standards
IBZ:
Index
der
Börsen-Zeitung
i.d.R.:
in
der
Regel
Inc.:
Incorporated
IT:
Informationstechnologie
Abkürzungsverzeichnis
XIII
KAGG:
Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften
KGAA:
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KGV:
Kurs-Gewinn-Verhältnis
LIFFE:
London International Financial Futures Exchange
Ltd.:
Limited
MDAX :
Mid Cap-Deutscher Aktienindex
Mio.:
Millionen
Mrd.:
Milliarden
MSCI:
Morgan Stanley Capital International
Nasdaq:
National Association of Securities Daily Adjusted Quotes
NEMAX: Neuer-Markt-Index
NYMEX:
New York Mercantile Exchange
NYSE:
New York Stock Exchange
o.a.:
oben
angeführten
OTC:
Over-The-Counter
o.V.:
ohne
Verfasser
REX:
Deutscher
Rentenindex
S.:
Seite
S.A.:
Société
Anonyme
SMAX:
Small Cap Index
SWX:
Swiss
Exchange
S&P:
Standard
and
Poor`s
Tab.:
Tabelle
u.a.:
und andere / unter anderem
US:
United
States
USA:
United States of America
US-GAAP: United States Generally Accepted Accounting Principles
VDAX: Volatilitäts-Deutscher Aktienindex
Vgl.:
Vergleiche
WpÜG:
Gesetz zur Regelung von öffentlichen Angeboten von
Wertpapieren und von Unternehmensübernahmen
XTF:
Exchange
Traded
Funds
z.B.:
zum
Beispiel
z.Z.:
zur
Zeit
Kapitel 1: Einführung
1
Kapitel 1: Einführung
Die Zahl der Aktienindizes hat Anfang des 21. Jahrhunderts weltweit eine
Größenordnung von über 33000 erreicht und nimmt ständig weiter zu.
1
In den
Medien sind Aktienindizes mittlerweile präsenter als die zugrundeliegenden
Aktien selber. Der breiten Bevölkerung sind Aktienindizes, wie der DAX oder
der Dow Jones-Index, bekannt. Fundierte Kenntnisse liegen i.d.R. jedoch nicht
vor.
Für am Börsengeschehen interessierte Benutzer von Aktienindizes sind
Hintergrundinformationen von entscheidender Natur. Diese Informationen und
ihre Zusammenhänge sind zwingend, um ein rationales Urteil über die
Aussagekraft der jeweiligen Aktienindizes zu bilden.
Die bedeutendsten deutschsprachigen Werke zur Aktienindizierung stammen
aus den Jahren 1966 bis 1992. Bleymüller
2
stellte 1966 zum ersten Mal eine
Arbeit zu Aktienindizes zusammen. Andere wesentliche Arbeiten folgten von
weiteren Verfassern. Nach 1992 erschienen keine umfassenden
wissenschaftlichen Werke mehr, die sich primär mit Konzeptionen und
Funktionen der Aktienindizierung befaßten. In den letzten Jahren publizierten
hauptsächlich Anbieter von Aktienindizes aktuelle und konkrete Auslegungen
ihrer eigenen Indizes. Seitdem fehlt es an einem konzeptionellen Werk, das
allgemein und zugleich zeitgemäß die Aktienindizierung diskutiert.
Diese Arbeit stellt ein umfassendes Werk zu diesem Thema dar. Das Ziel liegt
darin begründet, die angeführte Lücke in der Wissenschaft zu schließen, indem
konzeptionelle Ansätze unter aktuellen Bedingungen kritisch diskutiert werden.
Zudem setzt sich dieses Werk mit den Funktionen der Aktienindizierung
umfangreich auseinander, da sich diese in den letzten Jahren erheblich
erweitert haben. Angereichert wird diese Diskussionsgrundlage mit vielen
praktischen Beispielen bedeutender Aktienindizes. Darüber hinaus werden
1
Nach: Deutsche Börse AG (2000a): Vision + Money (Juli), Frankfurt a.M., S.14
2
Bleymüller, Josef (1966): Theorie und Technik der Aktienkursindizes, Wiesbaden, 154 Seiten
Kapitel 1: Einführung
2
ausführlich die aktuellen Gewichtungsumstellungen auf den Free-Float
behandelt, sowie die Versuche einiger Anbieter, die Qualität ihrer Aktienindizes
durch restriktivere Auswahlkriterien zu steigern.
Diese Arbeit besteht aus acht Kapiteln. Dazu greift sie zunächst allgemeine und
für das Verständnis notwendige Grundlagen auf, die im zweiten Kapitel
dargestellt werden. Anschließend werden im dritten Kapitel ausführlich die
verschiedenen Ansätze der Aktienindizierung diskutiert, bevor im vierten Kapitel
mit der Konzeption ein zentraler Bestandteil dieses Werks umfassend und
zeitgemäß erörtert wird. Im fünften Kapitel wird dieser Teil fortgesetzt, indem
die konstituierende Konzeption des vierten Kapitels unter Aktualisierungs-
bestrebungen betrachtet wird. Ab dem sechsten Kapitel wird der zweite zentrale
Teil dieser Arbeit diskutiert. Dieser betrifft zunächst die unterschiedlichen
deskriptiven Aufgabenbereiche der Aktienindizierung. Abschließend werden im
siebten Kapitel die operativen Aufgaben erläutert, welche deutlich an
Bedeutung gewonnen haben und die Konzeption beeinflussen. Die deskriptiven
und operativen Funktionen werden umfassend dargestellt, jedoch beschränkt
sich der Verfasser auf die wesentlichen Inhalte. Für jeweils vertiefte
Darstellungen wird auf die einschlägige Literatur verwiesen. Das achte Kapitel
rundet die Arbeit mit einem Fazit ab.
Der Begriff Aktienkursindex, welcher in den Standardwerken eine zentrale
Stellung einnimmt, hat im Jahr 2002 eine andere Bedeutung gewonnen.
Während die Autoren, geprägt von Bleymüller, den Begriff im Zusammenhang
mit dem statistischen Vergleich von Preisen in Form von Kursen sahen, ist
heute der Sinn in der Beziehung von Aktienkursindizes zu
Aktienperformanceindizes zu suchen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit sind die
Begriffe Aktienindex und Index synonym zu verwenden. Das Gleiche gilt i.d.R.
für die Ausdrücke Aktie, Wert und Titel. Als Grundlage dienen die weiterhin
gültigen Regeln der alten deutschen Rechtschreibung. Das Internet hat bei der
Beschaffung von aktuellen Informationen für die Anfertigung dieser Arbeit eine
bedeutende Stellung eingenommen. Im Bewußtsein von teilweise unseriösen
Informationen im Internet hat sich der Verfasser auf die glaubwürdigen Quellen
in diesem Medium beschränkt.
Kapitel 2: Grundlagen
3
Kapitel 2: Grundlagen
2.1 Motive und Ziele der Aktienindizierung
Grundsätzliche Ziele stehen am Anfang jeder Arbeit. Sie gelten als
Voraussetzung der Planung und Realisation, sowie der abschließenden
Kontrolle. Ziele geben die einzuschlagende Richtung vor und dienen als
Orientierungshilfe.
1
Selbst wenn in dieser Arbeit kein neuer idealer Aktienindex
abgeschlossen konzipiert wird, ist dieser Ausgangspunkt von Bedeutung für die
Beurteilung und den Vergleich von bestehenden Konzepten, die später
diskutiert werden. Weiter können aufgrund von Zielen konzeptionelle
Verbesserungen angeführt werden, die die vielfältigen Funktionen von
Aktienindizes erweitern bzw. verfeinern. Die grundlegenden Ziele zur Bildung
von Aktienindizes sind in deskriptive und operative Ziele zu differenzieren.
Deskriptive Betrachtung: Der Hintergrund des deskriptiven Ziels ist das
ursprüngliche Motiv für die Existenz von Aktienindizes: Ein Aktienmarkt mit
vielen einzelnen Kursen, aber ohne Systematik bei der Kursinformation, ist
wenig geeignet, eine typische Aussage über den gesamten Markt
hervorzubringen. Gerade diese Aussage benötigen die Marktteilnehmer und
andere Nutzer für ihre vielseitigen Zwecke, die im weiteren Verlauf noch
dargestellt werden. Das deskriptive Ziel von Aktienindizes ist daher, die
Entwicklung des betreffenden Aktienmarktes möglichst charakteristisch zu
beschreiben und anzuzeigen. Der Index aggregiert die Summe einzelner Kurse
zu einer Aussage
2
, zu einem Indexstand, und ermöglicht damit allgemeine
Kapitalmarktentwicklungen zu beobachten.
3
Diese Informationen dienen als
Grundlage für Entscheidungen und finden Anwendung in verschiedenen
Funktionen von Aktienindizes.
1
Nach: Wöhe, Günter (2000): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, München,
S.139
2
Nach: Janßen, Birgit; Rudolph, Bernd (1992): Der Deutsche Aktienindex DAX, Frankfurt a.M.,
S.2
3
Nach: Deutsches Aktieninstitut (2000): Aktienindizes, Frankfurt a.M., S.7
Kapitel 2: Grundlagen
4
Operative Betrachtung: Von operativer Natur ist das andere Motiv.
Kapitalmarktteilnehmer suchen nach Formen, um neben klassischen Fonds
auch repräsentative Marktportfolios, sprich Aktienindizes, handeln zu können.
Anbieter von Finanzprodukten verfügen demnach über erweiterte
Möglichkeiten, ihren Kunden maßgeschneiderte Anlageformen anbieten zu
können. Aktienindizes lassen sich nicht nur in einer passiven und
beschreibenden Form vorstellen, sondern können indirekt auch selbst
Gegenstand des Börsenhandels werden. Dieser Handel wird durch Derivate
oder indexnahen Instrumenten, die entweder von Indizes abgeleitet werden
oder in enger Beziehung zu ihnen stehen, ermöglicht. Der Index ist handelbar
zu gestalten. Die beschriebene Ausrichtung von Aktienindizes auf diesen Zweck
stellt das zweite und operative Ziel der Indexbildung dar.
4
Unter Investitionsgesichtspunkten ist ein weiteres Motiv erkennbar.
Aktienindizes werden i.d.R. von privaten Institutionen emmitiert. Diese verfolgen
das Ziel der Gewinnmaximierung. Aktienindizes werden selbst zu einem
Geschäftsgegenstand, da mit Verkäufen von Lizenzen für später noch zu
erläuternde Indexprodukte Erträge erzielt werden können. Dieses Motiv und das
damit verbundene Ziel der Gewinnerzielung gewann aufgrund der steigenden
Börsenakzeptanz in der breiten Bevölkerung in den letzten Jahren immer mehr
an Einfluß. Zwar ist der Börsenboom, speziell der IT-Boom, im Frühjahr 2000
vorläufig zu Ende gegangen, dennoch hat sich das Indexgeschäft bis ins Jahr
2002 stetig weiterentwickelt.
2.2 Vorstellung der Index-Theorie
2.2.1 Einführung
Um die Entwicklung eines Marktes mit seinen vielen einzelnen Preisen
transparenter darzustellen, wird eine quantitative Aussage benötigt, die
möglichst den gesamten Markt repräsentativ abdeckt und zugleich knapp und
anschaulich ist. Dazu sind Kennzahlen geeignet, die sich in folgende zwei
4
Vgl. ausführliche Darstellungen zu den deskriptiven und operativen Funktionen ab S.73 im
sechsten Kapitel und ab S.104 im siebten Kapitel
Kapitel 2: Grundlagen
5
Gruppen gliedern: Die absoluten Kennzahlen und die relativen Kennzahlen.
Eine absolute Zahl vermittelt keinen Sinnzusammenhang, da sie isoliert von
anderen dargestellt wird.
5
Deshalb erscheinen nur relative Kennzahlen als
geeignet, die mindestens aus zwei einzelnen Informationen gebildet werden.
Sie aggregieren eine Vielzahl von einzelnen Informationen zu einer kompakten
Größe oder Aussage.
6
Relative Kennzahlen oder Verhältniszahlen kommen in
der Statistik in drei Ausprägungen vor: Als Gliederungszahlen,
Beziehungszahlen oder Indexzahlen
7
.
Gliederungszahlen: Sie geben das Verhältnis eines Teils zu einem Ganzen
an. Der Dividend ist in diesem Fall dem Divisor untergeordnet. Als Beispiel
würde gelten, daß gelistete Softwareaktien einen bestimmten Teil der
insgesamt gelisteten Aktien an einer Börse ausmachen.
Beziehungszahlen: Sie geben das Verhältnis von zwei gleichrangigen Größen
zueinander an. So stehen hier der Dividend und der Divisor auf einer Ebene.
Die einzelnen Größen können wesensverschieden sein, sollten aber in einem
Zusammenhang stehen. Ein verständliches Beispiel wäre das Verhältnis von
gelisteten Softwareaktien zu gelisteten Automobilaktien.
Indexzahlen: Sie geben im Gegensatz zu den oben genannten Kennzahlen
statt einer Momentaufnahme einen Vergleich einer Entwicklung wieder. Die
oben aufgeführten Größen können daher als statisch angesehen werden,
während die Indexzahlen als dynamisch gelten. Indexzahlen werden in der
Literatur nicht einheitlich betrachtet. Es existieren Elementarindizes (auch
einfache Indizes genannt) und Generalindizes
8
(auch zusammengesetzte
Indizes genannt). Da i.d.R. Preise Grundlage des statistischen Vergleichs sind,
wird allgemein von Preisindizes gesprochen.
5
Nach: Ploch, Hans Uwe (1971): Konstruktion und Anwendung von Aktienkursindizes,
Dissertation, Wien, S.18
6
Nach: Janßen, Birgit; Rudolph, Bernd (1992): a.a.O., S.2
7
Begriff: Index (lateinisch): Anzeiger; auch als Indexziffern, Meßzahlen oder Meßziffern bekannt
8
Nach: Bohley, Peter: Statistik (1992): Einführendes Lehrbuch für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftler, München, S.30 ff.
Kapitel 2: Grundlagen
6
2.2.2 Elementarindizes
Der Elementarindex stellt die Grundlage bei der Annäherung an einen
umfassenden Index dar. Bei einer Meßzahl nach Bücker (damit ist der
Elementarindex gemeint) wird nur eine Zeitreihe betrachtet, die die zeitliche
Entwicklung eines Merkmals wiedergibt.
9
Die zu betrachtende Zeitreihe wird
basiert, d.h., es wird ein Basiszeitpunkt gewählt, in dem die dazugehörige
Ausprägung durch eine Berechnung mit der unten aufgeführten Formel die
Meßzahl 1 oder 100% annimmt. In diesem Fall sind Basiszeitpunkt und
Vergleichszeitpunkt gleich. Die Formel für Elementarindizes lautet:
o
t
t
o
p
p
P
=
(
Formel 1: Elementarindizes)
mit:
t
o
P
= Meßzahl
t
p
= aktueller Preis
o
p
= Preis zum Basiszeitpunkt
Alle folgenden Ausprägungen der Zeitreihe sind auf diesen Wert proportional
anzupassen. Verglichen wird eine Ausprägung anschließend nur noch mit der
des Basiszeitpunkts. Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht diesen
Zusammenhang:
Kurs Aktie in
Jahresende
Indexzahl %
150 1997 100
200 1998 133
250 1999 167
320 2000 213
100 2001 67
Tab. 1: Entwicklung eines Elementarindexes
Quelle: Eigene Darstellung
9
Nach: Bücker, Rüdiger (1999): Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, München, S.70
Kapitel 2: Grundlagen
7
Die Basierung, im obigen Beispiel 100% zum Jahresende 1997, ist typisch für
Indizes. Ohne dieses Merkmal würde es sich nicht um Indizes handeln. Die
Bestimmung des geeigneten Basiszeitpunktes mit der entsprechenden
Ausprägung stellt eine der größten Herausforderungen der Indexbildung dar, da
alle folgenden Indexwerte auf ihn zurückgehen. Dieser sollte charakteristisch für
den Gegenstand der Untersuchung sein. Wäre dieser Wert ein Sonderfall, z.B.
bei einem Aktienkurs durch eine große Spekulation verursacht, ist die
Aussagekraft des gesamten Indexes gemindert. Im nächsten Beispiel, aus
Tabelle 1 folgend, ist der Basiswert in 1997 statt 150 nur 130 . Die
Auswirkungen auf die Indexstände der Folgejahre sind signifikant abweichend:
Kurs Aktie in
Jahresende
Indexzahl %
130 1997 100%
200 1998 154%
250 1999 192%
320 2000 246%
100 2001 77%
Tab. 2: Veränderung des Wertes im Basiszeitpunkt
Quelle: Eigene Darstellung
Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, statt einem Zeitpunkt einen Zeitraum
als Basis zu bilden. Dieser kann durch eine Mittelwertbildung von
Ausprägungen mehrerer Zeitpunkte erfolgen. Die folgende Aussage wäre
charakteristischer, ist aber aufgrund des Aufwands in der Praxis nicht relevant.
Die Tabelle 3 zeigt die Entwicklung eines Basiszeitraums von einem Jahr,
ermittelt aus dem arithmetischen Mittel der vier Quartale:
Kurs Aktie in
Quartalsende
Summe der Kurse in
150 1.Quartal
635
170 2.Quartal
160
3.Quartal
Arithmetisches Mittel in
155 4.Quartal
158,75
Tab. 3: Entwicklung eines Basiszeitraums
Quelle: Eigene Darstellung
Kapitel 2: Grundlagen
8
2.2.3 Generalindizes
Die bisher aufgeführten Kennzahlen genügen nicht den Anforderungen, die ein
ganzer Markt, wie der Aktienmarkt, mit vielen Merkmalen fordert. Indizes sollen
eine Auskunft über die Entwicklung eines ganzen Bündels von Merkmalen
geben, einer ganzen Situation.
10
Dieses leisten Generalindizes. Hier werden
die Ausprägungen mehrerer Merkmale eines Zeitpunktes zusammengesetzt
und daraus der Index gebildet. Aus mehreren Elementarindizes wird ein
Generalindex.
Es bestehen mehrere Möglichkeiten einen Generalindex zu bilden.
Beispielsweise können die Ausprägungen aufsummiert und anschließend mit
der Summe des Basiszeitpunktes verglichen werden. Es entsteht ein
ungewogener Index. Bei diesem Index besteht die Gefahr, daß einzelne,
besonders hohe Ausprägungen, das Bild dominieren und alle anderen,
kleineren Ausprägungen, vernachlässigt werden.
11
Die Formel in der folgenden
Darstellung zeigt die allgemeine Vorgehensweise.
=
=
=
n
i
i
o
n
i
i
t
t
o
p
p
P
1
)
(
1
)
(
(
Formel 2:Ungewogene Generalindizes)
mit:
t
o
P
= ungewogene lndexzahl
t
p
= aktueller Preis
o
p
= Preis zum Basiszeitpunkt
Die Tabelle 4 verdeutlicht den beispielhaft genannten Zusammenhang. Obwohl
sich drei Werte verdoppelt haben, verändert sich der Indexstand nur um 15%.
10
Nach: Bücker, Rüdiger (1999): a.a.O., S.70
11
Nach: Bohley, Peter (1992): a.a.O., S.32
Kapitel 2: Grundlagen
9
Kurse Aktien in
Summe in
Indexzahl %
Basis 1997
Ende 2001
in 1997: 295
in 1997: 100
A: 10
A: 20
in 2001: 340
in 2001: 115
B: 15
B: 30
C: 20
C: 40
D: 250
D: 250
Tab. 4: Entwicklung eines ungewogenen Indexes
Quelle: Eigene Darstellung
Eine weitere Möglichkeit einen Generalindex zu bilden, wäre eine
Mittelwertbildung von Meßzahlen. Bei dieser Mittelwertbildung werden nicht
mehr die absoluten Ausprägungen, sondern die einzelnen Meßzahlen oder
Elementarindizes eines Zeitpunktes summiert, durch die Anzahl der Indizes
dividiert und anschließend mit dem Basiszeitpunkt verglichen. Denkbar sind
neben dem hier angeführten arithmetischen Mittel auch geometrische und
harmonische Mittel, die aber in der Praxis aufgrund ihrer schweren
Kommunizierbarkeit gegenüber der Öffentlichkeit nicht geläufig sind.
12
Jeder
Elementarindex hat bei der Mittelwertbildung den gleichen Einfluß. Der
Generalindex ist weiter ungewogen. Die entsprechende Formel ist nachfolgend
dargestellt:
=
=
n
i
i
t
o
t
o
p
n
P
1
)
(
1
(
Formel 3: Mittelwert von mehreren Elementarindizes)
mit:
t
o
P
= durchschnittliche lndexzahl
t
o
p
= Elementarindizes
n
= Anzahl der Elementarindizes
Die Veränderung des Indexstandes in Tabelle 5 ist nachweislich deutlicher als
die Veränderung in Tabelle 4:
Meßzahlen 1997 Meßzahlen 2001
Arithmetisches Mittel
Indexzahl %
A: 100
A: 200
in 1997: 100
in 1997: 100
B: 100
B: 200
in 2001: 175
in 2001: 175
C: 100
C: 200
D: 100
D: 100
Tab. 5: Entwicklung eines Generalindexes mit der Mittelwertbildung
Quelle: Eigene Darstellung
12
Nach: Fisher, Irving (1967): The Making of Index Numbers, New York (New York), S.29 ff.
Kapitel 2: Grundlagen
10
2.2.4 Gewichtete Indizes
Da Merkmale verschiedenartige Bedeutungen aufweisen können, wie z.B. beim
Index der Lebenshaltungskosten
13
, ist eine entsprechende Gewichtung der
Ausprägungen notwendig. Damit werden die tatsächlichen Verhältnisse
genauer abgebildet. Aus diesem Zusammenhang sind gewogene Indizes
entstanden. Die bekanntesten Indizes sind: Der Index nach Laspeyres, der
Index nach Paasche, sowie der Wertindex.
Diese Indizes gewichten ihre Merkmale mit der jeweiligen Bedeutung. Bei den
drei Erstgenannten kann die Gewichtung sowohl die Menge als auch der Preis
sein. Allerdings ist für einen Preisindex, der die Veränderung von Preisen oder
Kursen aufzeigen soll, nur die Gewichtung mit Mengen relevant. Im anderen
Fall entsteht ein Mengenindex, der durch Preise gewichtet ist. In beiden
Konstruktionen ist die Gewichtungsgrundlage, also Menge oder Preis, über den
Vergleichszeitraum konstant, da sonst die zu ermittelnde andere Größe nicht
isoliert betrachtet werden kann.
Dieser Abschnitt stellt nur eine allgemeine Einführung in die Indextheorie dar.
Die oben angeführten Indizes nach Laspeyres, Paasche und der Wertindex,
sowie die Kenngröße aus einem ungewogenen arithmetischen Mittel werden
weiter im vierten Kapitel ab Seite 32 beschrieben. Hier findet dann die
Verbindung zum Untersuchungsgegenstand Aktienindex statt.
2.3 Historie
2.3.1 Aktienindizierung weltweit
Aktienindizes haben ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Der weltweit erste Aktienindex ist untrennbar mit dem Namen Dow verbunden.
Charles Henry Dow wurde am 06.11.1851 in Sterling, Connecticut, geboren. Er
wuchs als Sohn einer Bauernfamilie auf, und schon früh wandte er sich dem
Journalismus zu. Folgerichtig fand Dow in Springfield, Massachusetts, bei der
13
Erläuterung: Der Index der Lebenshaltungskosten ist gewichtet mit der unterschiedlichen
Bedeutung der enthaltenen Güter.
Kapitel 2: Grundlagen
11
dortigen Zeitung, dem ,,Springfield Republican", seine erste Beschäftigung. Mit
28 Jahren zog er 1879 nach New York City, wo Dow zunächst als
Wirtschaftsreporter tätig war. Im November 1882 gründete er hier zusammen
mit Edward D. Jones und Charles M. Bergstresser ein Unternehmen: Die Dow
Jones & Company, Inc.
Das Unternehmen war zunächst eine Nachrichtenagentur, welches für
Brokerhäuser an der Wall Street täglich kurze Mitteilungen vom
Börsengeschehen verfaßte. Ein Jahr später, im November 1883, wurde zum
ersten Mal eine Zeitung herausgegeben, der ,,Customer`s Afternoon Letter". In
dieser Zeitung, einem Vorläufer vom ,,Wall Street Journal", veröffentlichte Dow
am 03.07.1884 seinen ersten Aktienindex.
Obwohl Dow als einziger der drei Partner über keine akademische Ausbildung
verfügte, hatte er überlegt, daß Amerika etwas benötigte, um den Aktienmarkt
auf einen Blick im Griff zu haben.
14
Aus diesen Beweggründen entwickelte er
zunächst unter der Überschrift ,,Average Movement of Prices" einen
Aktienindex, der aus elf Aktien bestand. Der damaligen Bedeutung des
Eisenbahnbaus entsprechend, stammten die umsatzstärksten Aktien beim
Handel an der Wall Street von Eisenbahnunternehmen. Aus diesem Grund
waren zehn Aktien der Eisenbahnbranche im Index enthalten, und es setzte
sich die Bezeichnung Railroad Average durch. Später wurde dieser Aktienindex
umbenannt in Dow Jones Transportation Average, kurz DJTA, und umfaßt seit
1897 20 Werte. Der Index besteht heute hauptsächlich aus Werten der
Automobil- und Luftfahrtbranche.
Dow entwickelte einen weiteren Aktienindex, der auch die aufstrebende
Industriebranche berücksichtigen sollte. Es entstand der Dow Jones Industrial
Average, kurz DJIA, der erstmalig am 26.05.1896 im von Dow
herausgegebenen ,,Wall Street Journal" veröffentlicht wurde. Er hat seine
Heimat, wie auch der Dow Jones Transportation Average, an der New Yorker
Börse, der New York Stock Exchange, kurz NYSE. Der DJIA umfaßte damals
die folgenden zwölf Werte:
14
Nach: Stillman, Richard (1986): Dow Jones Industrial Average, Homewood (Illinois), S.18
Kapitel 2: Grundlagen
12
American Cotton Oil
Laclede Gas
American Sugar
National Lead
American Tobacco
North American
Chicago Gas
Tennessee Coal & Iron
Distilling and Cattle Feeding
U.S. Leather Preferred
General Electric
U.S. Rubber
Abb. 1: Die ersten DJIA-Werte am 26.05.1896
Quelle: Rühle, Alf-Sibrand (1991): Aktienindizes in Deutschland, Wiesbaden, S.32
Die Berechnung erfolgte aus der Summe der Kurse dividiert mit der Anzahl. Der
erste Indexwert betrug 40,94.
2
Ein Zeitbezug, typisch für einen Index, war nicht
gegeben. Im Jahr 1916 erhöhte sich die Anzahl der Werte im Index auf 20 und
im Jahr 1928 auf 30, wobei es bis heute geblieben ist. 1929 kam ein weiterer
Aktienindex hinzu, der Dow Jones Utility Average, welcher aus 15 Aktien der
Versorgungsbranche bestand. Der Dow Jones Composite Average rundete das
Bild der Indexfamilie ab, indem er eine Aussage über die gesamten 65 Werte
wiedergab.
Heute existieren diese vier Aktienindizes weiter, doch wenn in der Gegenwart
vom Dow Jones-Index gesprochen wird, ist damit der bedeutende
Industrieindex gemeint. Der DJIA hat sich bis zum Jahr 2002 zum wohl
populärsten Aktienindex der Welt entwickelt. General Electric, Inc. ist das
einzige Unternehmen, welches von den ursprünglich im DJIA gelisteten Werten
auch noch heute dort zu finden ist. Da diese Aktienindizes unbasiert berechnet
werden, stellen sie im statistischen Sinn keine Indizes dar, sondern bilden nur
einen aktuellen Kursdurchschnitt ab. Es fehlt der Zeitbezug, die Basierung, die
typisch für Indizes ist.
Der Value Line Composite Index stellte im Februar 1982 den ersten Aktienindex
dar, auf den Terminkontrakte als Basiswerte gehandelt wurden. Handelsobjekt
war damals ein Aktienindex-Future an der Börse von Kansas City, dem Kansas
City Board of Trade. Im April 1982 konnte erstmalig mit Derivaten auf den
bekannten S & P 500 gehandelt werden. Vor dieser Zeit existierten auch schon
Terminkontrakte auf Aktienindizes, allerdings wurden diese in nicht
standardisierter Form abseits von reglementierten Börsen gehandelt.
15
Nach: Stillman, Richard (1986): a.a.O., S.41
Kapitel 2: Grundlagen
13
2.3.2 Aktienindizierung in Deutschland
Der erste Aktienindex in Deutschland war die Börsenindexziffer der ,,Frankfurter
Zeitung". Diese Börsenindexziffer setzte sich aus den Kursen von 25 Aktien und
10 Anleihen zusammen.
16
Berechnet wurde sie aus der Summe aller Kurse und
als absolute Zahl ab dem 01.09.1919 veröffentlicht. Ein Zeitbezug fehlte. Dieser
folgte im Jahr 1920 bei einem Indexstand von 8767 Punkten am 01.01.1920 mit
der Basierung 100.
17
Von diesem Zeitpunkt an kann erst von einem Index im
statistischen Sinn gesprochen werden.
AEG AG
Kleyer AG
Akkumulatoren Hagen AG
Laurahütte AG
Aschaffenburger Papier AG
Mannesmann AG
Badische Anilin AG
Maschinen Augsburg-Nürnberg AG
Baltimore and Ohio AG
Orenstein und Koppel AG
Brauerei Schultheiß
Scheidenanstalt AG
Deutsche Bank AG
Spinnerei Pfersee AG
Deutsche Erdöl AG
Vereinigte Glanzstoff AG
Deutsche Überseebank AG
Waggonfabrik Fuchs AG
Dresdner Bank AG
Westeregeln AG
Gelsenkirchen AG
Zementwerk Heidelberg AG
Hapag AG
Zuckerfabrik Frankenthal AG
Harpen AG
Abb. 2: Die ersten Werte der Börsenindexziffer vom 01.09.1919
Quelle: Rühle, Alf-Sibrand (1991): a.a.O., S.46
Bei der Auswahl der Aktien entschied man sich für eine beschränkte Zahl
möglichst charakteristischer Papiere, wobei man sich bemühte, jede Branche
zu berücksichtigen.
18
Die Börsenindexziffer existiert heute nicht mehr, jedoch
sind noch drei Werte aus der oben angeführten Auswahl im aktuellen
Deutschen Aktienindex, kurz DAX, zu finden: BASF AG, Deutsche Bank AG
und MAN AG.
Eine Kontinuität bei der Aktienindexierung, wie sie die USA mit den Dow Jones-
Indizes seit fast 118 Jahren kennen, war in Deutschland aufgrund zweier
Weltkriege nicht möglich. Entweder waren die kriegsbedingten wirtschaftlichen
16
Nach: O.V.: Unsere Börsenindexziffer, in: Frankfurter Zeitung vom 05.09.1920; zitiert nach:
Rühle, Alf-Sibrand (1991): Aktienindizes in Deutschland, Wiesbaden, S.45
17
Ebd.: -/S.45
18
Nach: Rühle, Alf-Sibrand (1991): a.a.O., S.33
Kapitel 2: Grundlagen
14
Verzerrungen verantwortlich für eine mangelnde Vergleichbarkeit, oder es
wurden überhaupt keine Kurse festgestellt. Nach dem 2. Weltkrieg war es das
Statistische Bundesamt, welches ab Mai 1956 wieder einen Aktienindex
einführte. Der Index wurde rückwirkend vom Jahr 1950 an berechnet. Die
Grundlage waren 430 Aktien, die zu der Zeit in der Bundesrepublik Deutschland
gehandelt wurden. Aufgrund der damit verbundenen hohen
Repräsentationsquote galt er als einer der präzisesten deutschen
Aktienindizes.
19
1967 wurde seine Berechnung grundlegend geändert.
Der Commerzbank-Index von 1953 ist der Aktienindex, der am längsten
kontinuierlich berechnet wird. Er umfaßt seit 49 Jahren 60 deutsche
Standardwerte und wird einmal börsentäglich berechnet. Allerdings ist seine
Bedeutung gering.
Bedeutender und bekannter ist der ebenfalls täglich berechnete F.A.Z.-Index
der ,,Frankfurter Allgemeinen Zeitung". In ihm werden seit 1958 100 deutsche
Aktien zusammengefaßt. Hier erfolgt allerdings eine Rückrechnung für
ausgewählte Börsentage bis 1950 zurück.
Der heute entscheidende Aktienindex in Deutschland ist der Deutsche
Aktienindex. Er wird seit dem 01.07.1988 veröffentlicht, wobei die Berechnung
auf den 30.12.1987 mit einem Indexstand von 1000 Punkten zurückgeht. Die
Deutsche Börse AG als Emmitent berechnet den Indexstand seitdem als
Laufindex in kurzen Abständen neu. Damit ist eine Voraussetzung gegeben, um
zeitnah mit Terminmarktinstrumenten auf einen Aktienindex als Basiswert
handeln zu können, was im November 1990 zum ersten Mal geschah. Der DAX
umfaßt 30 deutsche Standardwerte. Verknüpft wurde er mit dem Index der
Börsen-Zeitung, kurz IBZ, (Berechnung seit 1981) und dem Hardy-Index
(Berechnung seit 1959), um ihm eine Vergangenheit zu geben.
20
In der ersten
Zusammensetzung des DAX von Ende 1987 waren folgende Werte enthalten:
19
Nach: Rühle, Alf-Sibrand (1991): a.a.O., S.54
20
Nach: Janßen, Birgit; Rudolph, Bernd (1992): a.a.O, S.7
Kapitel 2: Grundlagen
15
Allianz Holding AG
Hoechst AG
BASF AG
Karstadt AG
Bayer AG
Kaufhof AG
Bay. Hypo- & Wechselbank AG
Linde AG
Bayerische Vereinsbank AG
Lufthansa AG
BMW AG
MAN AG
Commerzbank AG
Mannesmann AG
Continental AG
Nixdorf Computer AG
Daimler-Benz AG
RWE AG
Degussa AG
Schering AG
Deutsche Babcock AG
Siemens AG
Deutsche Bank AG
Thyssen AG
Dresdner Bank AG
VEBA AG
Feldmühle Nobel AG
VIAG
Henkel KGAA
Volkswagen AG
Abb. 3: Die ersten DAX-Werte vom 30.12.1987
Quelle: Janßen, Birgit; Rudolph, Bernd (1992): Der Deutsche Aktienindex DAX,
Frankfurt a.M., S.10
16 Werte von damals sind am 13.05.2002 nicht mehr im DAX vertreten, wobei
es bei fünf Unternehmen zu Fusionen oder Übernahmen gekommen ist, bei
denen sich nur der Name des Unternehmens geändert hat.
2.4 Emmitenten von Aktienindizes
Hinter Aktienindizes stehen Institutionen, die diese konstruieren und dem Markt
anbieten. Dabei handelt es sich entweder um die einzelnen Börsen selber oder
es sind externe Institutionen beteiligt, die dem Börsenwesen nahe stehen, wie
Verlage mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt, Banken oder andere
börsenorientierte Organisationen. Da Aktienindizes i.d.R. mit dem Namen ihres
Emmitenten verbunden sind, werden diese Institutionen im Zusammenhang mit
Meldungen vom Börsengeschehen in den Medien vielfach genannt und bleiben
im Bewußtsein der Öffentlichkeit. Die Emmitenten erhoffen sich mit dieser
Verbindung einen Kompetenzzuwachs in Wirtschaftsfragen. Allerdings
berechnen auch öffentliche Organisationen Aktienindizes, wie das Statistische
Bundesamt. Hier stehen rein statistische Beweggründe im Vordergrund. Die
folgende Abbildung ausgewählter Indizes verdeutlicht die Herkunft von
bedeutenden Aktienindizes:
Kapitel 2: Grundlagen
16
Aktienindex Emmitent
Branche
DAX
Deutsche Börse AG
Börse
Nemax 50
Deutsche Börse AG
Börse
F.A.Z.-Index Frankfurter
Allgemeine Zeitung GmbH
Verlag
Dow Jones
EuroStoxx 50
Stoxx Ltd.: Konsortium aus Dow Jones &
Company, Inc., Deutsche Börse AG,
Euronext Paris Bourse S.A. &
SWX Swiss Exchange AG
Verlag & Börse
FTSE 100
FTSE International Ltd.: Konsortium aus
Financial Times Ltd. &
London Stock Exchange Ltd.
Verlag & Börse
DJIA
Dow Jones & Company, Inc.
Verlag
S & P 500
Standard & Poor`s Index Services, Inc.
Rating-Agentur
Nasdaq 100
The Nasdaq Stock Market, Inc.
Börse
MSCI World
Morgan Stanley Capital Investment, Inc. Investmentbank
Abb. 4: Aktienindizes und Emmitenten
Quelle: Deutsche Börse AG (2002): Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse,
Frankfurt a.M., S.41ff.
Der Emmitent ist verantwortlich für die Gestaltung von Aktienindizes. So obliegt
es ihm anfangs, die einzelnen Merkmale zu erarbeiten, auszufüllen und später
laufend zu überprüfen. Da viele Marktteilnehmer sich an Aktienindizes
orientieren, erhalten die Emmitenten indirekt einen starken Einfluß auf das
Börsengeschehen.
21
Die emmitierende Institution bildet i.d.R. ein Gremium, das den
Entscheidungsträger berät. Bei der Deutschen Börse AG ist das der
Arbeitskreis Aktienindizes, der Vorschläge für den letztendlich zu
entscheidenden Vorstand erarbeitet.
22
Dem Arbeitskreis Aktienindizes gehören
Mitarbeiter der Deutschen Börse AG und Abgesandte von Banken und
Investmentgesellschaften an. Er tritt viermal im Jahr zusammen.
Große Indexanbieter, wie Stoxx Ltd. oder FTSE International Ltd., sind bereits
eigenständige Unternehmen, die von Verlagen und Börsen gegründet worden
sind. Der Gegenstand dieser Anbieter ist ausschließlich das Geschäft mit
Indizes. Außer der Imagewerbung für verbundene Unternehmen profitieren
diese Anbieter auch von Lizenzgebühren für Indexprodukte
23
auf ihre Indizes,
wie z.B. für Derivate, oder für die Veröffentlichung von Indexinformationen, wie
21
Vgl. dazu ausführliche Darstellungen ab S.104 im siebten Kapitel
22
Nach: Deutsche Börse AG (2002): Leitfaden zu den Aktienindizes der Deutschen Börse,
Frankfurt a.M., S.16
23
Ebd: S.16
Kapitel 2: Grundlagen
17
z.B. von MSCI, die von Banken oder ähnlichen Institutionen in Anspruch
genommen werden.
24
Die größeren Emmitenten bieten i.d.R. eine Vielzahl von Aktienindizes an, um
jedes Segment marktgerecht abdecken zu können. Die Deutsche Börse AG
berechnet täglich 98 Aktienindizes aus den unterschiedlichsten Segmenten.
25
Die Gesamtheit der Indizes eines Anbieters wird auch als Indexfamilie
bezeichnet.
26
MSCI, Inc. ist mit 11000 Indizes der größte Anbieter weltweit.
27
2.5 Anforderungen an die Aktienindizierung
Um den bereits genannten Motiven und Zielen gerecht zu werden, müssen bei
der Bildung von Aktienindizes börsenspezifische Anforderungen eine
Berücksichtigung finden. Diese Anforderungen werden in der folgenden
Darstellung qualitativ erläutert, bevor sie im vierten Abschnitt quantitativ
konkretisiert und gelöst werden.
Repräsentativität: Eine der wichtigsten Bedingungen an einen Aktienindex ist
die Repräsentativität. Der Index sollte das betreffende Segment weitgehend
typisch abbilden, um eine Aussage über die charakteristische Entwicklung des
Marktes zu ermöglichen. Die repräsentative Abbildung umfaßt, neben der
Auswahl von typischen Werten, den Versuch Schwerpunkte des Marktes, wie
Branchenschwerpunkte, abzudecken. Auch die unterschiedliche Bedeutung der
Bestandteile sollte mittels einer entsprechenden Gewichtung berücksichtigt
werden. Veränderungen des Marktes sind ebenso anzupassen.
Exaktheit: Der Anspruch an die Exaktheit des Indexes ergibt sich bereits aus
den oben genannten Punkten. Zusätzlich ist die Berechnung methodisch genau
durchzuführen und das Ergebnis exakt zu veröffentlichen, um die Entwicklung
des betreffenden Marktes nicht zu verfälschen.
24
Nach: http://www.grzebeta.de/indizes/img0.htm (30.06.2001)
25
Nach: Deutsche Börse AG (2002): a.a.O., S.13 ff.
26
Anlage: Die Indexfamilie der Deutschen Börse AG ist im Anhang 1 abgebildet.
27
Erläuterung: Die Angabe umfaßt neben Aktienindizes auch Rentenindizes u.a. Nach: MSCI,
Inc. (2001): MSCI Methodology Book, New York (New York), S.1
Kapitel 2: Grundlagen
18
Aktualität: Weiter ist die Aktualität von enormem Interesse. Der betreffende
Aktienindex ist so zu gestalten, daß er aktuell veröffentlicht wird. Waren früher
noch tägliche Veröffentlichungen die Regel und ausreichend, erfordert heute die
hohe Volatilität am Aktienmarkt eine fortlaufende Ermittlung während der
Handelszeit.
28
Um die geforderte Aktualität weiter zu gewährleisten, ist es
notwendig, daß die zugrundeliegenden Werte liquide im Handel an der Börse
sind, da sonst Verzerrungen durch nicht feststellbare Kurse entstehen. Dieses
ist besonders bei den operativen Funktionen nötig, da die Marktteilnehmer hier
laufend faire Indexstände für ihre Anlageentscheidungen erwarten.
Einfachheit: In der Gegenwart werden Aktienindizes sowohl von privaten wie
auch von institutionalisierten Marktteilnehmern, wie Banken, Versicherungen
oder Kapitalanlagegesellschaften, benutzt. Für jeden Marktteilnehmer sollte das
Ergebnis, der jeweilige Indexstand, transparent und schnell nachvollziehbar
sein. Der Index hat somit nicht zwingend allen formal-mathematischen Kriterien
zu entsprechen.
29
Der Aktienindex ist vielmehr einfach zu gestalten, um eine
entsprechende Akzeptanz unter den Marktteilnehmern zu erhalten.
Bekanntheit: In diesem Zusammenhang steht auch die Bekanntheit. Nur
bekannte Aktienindizes genießen das Interesse von Marktteilnehmern. Die
weniger bekannten Indizes stehen im Schatten. Letztere rentieren sich für den
Emmitenten nicht, da der erwähnte Imageeffekt ausbleibt und Lizenz- und
Infogebühren von Banken aufgrund mangelnder Vermittlungschancen ausfallen.
Vertrauen: Ähnlich ist das Vertrauen in einen Index zu sehen. Nur wenn der
Aktienindex seriös erscheint, wird er von der Öffentlichkeit akzeptiert und
beachtet. Gerade dieser Punkt ist in den letzten Monaten zu einer der
wichtigsten Anforderungen geworden. Der Neue Markt hat in Deutschland bis
ins Jahr 2002 hinein durch Unstimmigkeiten wie Insolvenzen, Bilanz-
fälschungen oder Betrügereien viel Vertrauen verloren. Die mangelnden
Gewinne der enthaltenen Gesellschaften lassen an einer Ernsthaftigkeit der
Indizes in diesem Segment zweifeln.
28
Nach: Deutsches Aktieninstitut (2000): a.a.O., S.11
29
Nach: Richard, Hermann-Josef (1992): Aktienindizes, Bergisch-Gladbach, S.24
Kapitel 2: Grundlagen
19
Vergleichbarkeit: Stammen Aktienindizes von einem großen Indexanbieter,
der eine ganze Familie von Indizes emmitiert, ist bei all diesen Aktienindizes die
Vergleichbarkeit untereinander von Bedeutung. Die Gestaltung dieser ist
konsistent vorzunehmen.
30
Auch der zeitliche Vergleich ist wichtig. Die
Entwicklung des Aktienmarktes ist von einem charakteristischen Zeitpunkt an
vorzunehmen, damit die Ergebnisse nicht verfälscht werden. Dazu sollte der
Index in diesem Zeitpunkt einen einprägsamen Indexwert annehmen, um
Vergleiche deutlicher zu gestalten.
Historie: Aktienindizes dienen auch für langfristige Vergleiche. Er ist im Idealfall
so zu konzipieren, daß für die Zeit vor der erstmaligen Veröffentlichung eine
Zeitreihe, die dem Aktienindex ähnelt, besteht und mit derer die Entwicklungen
der Vergangenheit abgebildet werden können. Hier wird eine entsprechende
Historie gefordert.
Die angeführten Anforderungen stehen nicht immer konform zueinander.
Vielmehr widersprechen sich einige. In diesem Fall sind individuelle
Schwerpunkte zu setzen. Eine repräsentative und in vielen Einzelheiten
aufwendige Abbildung erscheint schwer möglich, wenn gleichzeitig ein knapper
und einfacher Aufbau des Aktienindexes gefordert wird. Zusätzlich widerspricht
die statistisch möglichst exakte Berechnungsmethode der schnellen und
einfachen Nachvollziehbarkeit.
Zumindest eine konträre Beziehung ist gelöst worden: Die geforderte aktuelle
und schnelle Verfügbarkeit der Indexstände steht nicht länger im Widerspruch
zu einer exakten und aufwendigen Berechnung, welche zudem repräsentativ
abbildet, denn die Möglichkeiten der Informationstechnologie vereinfachen den
Aufwand für die Berechnungen erheblich. Da einige Anforderungen aufgrund
ihrer Selbstverständlichkeit und leichten Umsetzbarkeit nicht weiter konkretisiert
werden müssen, werden bei der Konzeption im vierten Kapitel nur die
bedeutsamsten näher erläutert und gelöst.
30
Nach: http://www.grzebeta.de/indizes/img0.htm (30.06.2001)
Kapitel 3: Arten
20
Kapitel 3: Arten
3.1 Einführung
Bei der Aktienindizierung existieren mehrere grundlegende Ansätze. Diese sind
in Form von verschiedenen Arten zu bestimmen, bevor mit einer konkreten
Konzeption begonnen werden kann. Die Art der Aktienindizierung gibt eine
spezifische Aussage über den jeweiligen Aktienmarkt wieder. Eine ähnliche,
aber abweichende Art wird bei gleicher Konzeption prinzipiell unterschiedliche
Ergebnisse aufzeigen und eine andere Aussage treffen.
Differenziert werden wesentliche Ansätze zur Bestimmung des Wertes einer in
einem Index enthaltenen Aktie, womit ein Vergleich von Kurs- zu
Performanceindizes angeführt wird.
Ferner betrifft die Differenzierung von Arten auch den Umfang von
Aktienindizes. Die angeführte Unterscheidung bezieht sich auf All-Share- und
Auswahlindizes.
Zusätzlich ist festzulegen, über welchen Aktienmarkt eine Aussage getroffen
werden soll. Dazu ist eine Marktsegmentierung notwendig, welche durch
verschiedene Abgrenzungsarten dargestellt wird.
Abschließend werden in diesem Kapitel Subindizes diskutiert. Diese stehen in
Verbindung zu anderen Aktienindizes. I.d.R. betrifft dieser Punkt Mitglieder
einer Indexfamilie. Bei einzeln zu konzipierenden Indizes entfällt diese
Betrachtung.
Kapitel 3: Arten
21
3.2 Kurs- und Performanceindizes
Eine wichtige Differenzierung bei den Arten der Aktienindizierung findet sich bei
der Gegenüberstellung von Kursindizes zu Performanceindizes
1
. Grundsätzlich
gelten Aktienindizes als Preisindizes, weisen jedoch einen bedeutenden
Unterschied zu ihnen auf. Aktien verändern nicht nur ihren Wert, sondern
werden auch mittels Ausschüttungen begünstigt. Diese erfolgen i.d.R. durch
jährliche Dividendenzahlungen von Seiten der Aktiengesellschaften. Auch
einmalige Ausschüttungen sind denkbar.
2
Da ausgeschüttete Werte nicht mehr zum Unternehmen gehören, der Kurs
einer Aktie aber durch den Wert eines Unternehmens bestimmt wird, beeinflußt
eine derartige Auszahlung den Kurs einer Aktie negativ und damit den Stand
eines Indexes.
3
Werden die Ausschüttungen bei der Berechnung eines
Aktienindexes miteinbezogen, handelt es sich um einen Performanceindex
4
,
bleiben sie unbeachtet, liegt ein reiner Preisindex, auch Kursindex
5
genannt,
vor.
Die ersten Aktienindizes waren reine Kursindizes. Dieses lag einerseits in der
einfacheren Berechnungsweise begründet. Andererseits sollten Aktienindizes
nach Dow nur eine Aussage zum durchschnittlichen Niveau der Aktienkurse
geben.
6
Die Kapitalmarktforschung interessierte sich bald für eine Methode, die
den ganzen Anlageerfolg in Aktien, auch Performance
7
genannt, wiedergab. Da
dieser nicht nur durch Kurse, sondern auch durch Ausschüttungen bestimmt
wird, mußten diese ebenso berücksichtigt werden. Die daraus entwickelten
Aktienindizes wurden Performanceindizes genannt.
1
Begriff: Auch bekannt als Total-Return-Index
2
Erläuterung: Dazu zählen neben Sonderausschüttungen auch Erträge, die im Zusammenhang
mit Bezugsrechten bei Kapitalerhöhungen anfallen. Dabei ist die Einordnung von Erträgen aus
Bezugrechten in der Wissenschaft nicht eindeutig geklärt, denn einige bedeutende Autoren
bereinigen diese auch in den Kursindizes. Der Verfasser dieser Arbeit aber zählt diese Werte,
genauso wie alle anderen Erträge, nur zu den Performanceindizes, um den einheitlichen
Charakter zu wahren.
3
Nach: Deutsches Aktieninstitut (2000): a.a.O., S.19
4
Nach: O.V. (2000): Performanceindex, in: Die Börse, München, S.164
5
Nach: O.V. (2000): Kursindex, in: Die Börse, München, S.164
6
Nach: Rühle, Alf-Sibrand (1991): a.a.O., S.29
7
Erläuterung: Bezeichnet die gesamte Wertentwicklung einer Investition oder eines Portfolios.
Kapitel 3: Arten
22
Dividendenzahlungen werden bei Performanceindizes berücksichtigt, indem der
jeweilige Ausschüttungsbetrag entsprechend seiner Gewichtung imaginär im
Index enthalten bleibt. Diese Vorgehensweise unterstellt, daß ein Investor die
erhaltenen Zahlungen wieder in die betreffende Aktie reinvestiert und damit der
Erfolg insgesamt beurteilt werden kann. Eine andere Möglichkeit der
Reinvestition ist die Wiederanlage in das gesamte Indexportfolio.
8
Da die
genannten Wiederanlagen
9
in der Realität bei Investoren nicht andauernd der
Fall sind, können die Ergebnisse von Performanceindizes eine leicht bessere
Entwicklung vortäuschen.
Kursindizes werden heute verwendet, wenn ausschließlich das allgemeine
Niveau der gesamten Kurse wiedergegeben werden soll. Performanceindizes
werden verwendet, wenn der gesamte Anlageerfolg in Aktien im Vordergrund
der Betrachtungen steht. Der letzte Punkt erscheint weitreichender, daher wird
der Einfluß von Performanceindizes zunehmend größer.
Die Deutsche Börse AG berechnet den DAX-Performanceindex jede 15.
Sekunde neu, wobei der DAX-Kursindex
10
nur einmal börsentäglich errechnet
wird.
11
Diese Tatsache allein verdeutlicht die unterschiedliche Bedeutung von
Kurs- und Performanceindizes im 21. Jahrhundert.
12
Aufgrund der angeführten Reinvestitionen von Ausschüttungen, wie
Dividenden, entwickelt sich ein Performanceindex regelmäßig besser als ein
Kursindex. Die folgende Darstellung verifiziert dieses. Weitergehende
Ausführungen zu diesem Thema, besonders zu Dividendenzahlungen, sind ab
Seite 59 im fünften Kapitel hinterlegt.
8
Nach: Richard, Hermann-Josef (1992): a.a.O., S.83
9
Erläuterung: Eine dritte Möglichkeit der Reinvestition ist die Anlage in Anleihen. Diese Form
erscheint anlagenfremd und ist daher in der Praxis unbedeutend. In dieser Arbeit wird von einer
Anlage in die entsprechenden Aktien ausgegangen. Bei einigen Aktienindizes wird nach einer
gewissen Zeit von dieser Form zu einer Reinvestition in das Indexportfolio übergegangen. Vgl.
dazu ausführliche Darstellungen ab S.59 im fünften Kapitel und S.118 im siebten Kapitel
10
Erläuterung: Erträge aus Kapitalveränderungen, was im wesentlichen Bezugsrechtswerte
sind, werden beim DAX-Kursindex bereinigt. Nach: Deutsche Börse AG (2002): a.a.O., S.25 ff.
11
Nach: Deutsche Börse AG (2002): a.a.O., S.10
12
Erläuterung: Diese Anmerkung gilt nur für den deutschsprachigen Raum. Weltweit nimmt der
Kursindex noch eine bedeutende Stellung ein. Vgl. dazu ausführliche Beispiele bedeutender
Aktienindizes in den Anhängen 2 und 3.
Kapitel 3: Arten
23
Abb. 5: Entwicklung vom DAX-Kurs- und DAX-Performanceindex
Quelle: Deutsches Aktieninstitut (2000): a.a.O., S.21
3.3 All-Share- und Auswahlindizes
Eine weitere wesentliche Unterscheidung der mit einem Aktienindex
verbundenen Aussage findet beim Umfang statt. Hier kann zwischen einem All-
Share-Index
13
und einem Auswahlindex
14
differenziert werden. Ein All-Share-
Index repräsentiert alle Aktien, die am Markt gelistet sind. Dagegen werden bei
einem Auswahlindex nur wenige, für den Markt besonders typische Titel
berücksichtigt.
Ein All-Share-Index erfüllt bereits eine wichtige Anforderung. Aufgrund der
gesamten Einbeziehung aller gelisteten Aktien ist er repräsentativ für einen
Aktienmarkt. Eingeschränkt wird diese Aussage zunächst noch von einer
marktüblichen Gewichtung der einzelnen Aktien, da anzunehmen ist, daß nicht
jede Aktie die gleiche Bedeutung am Aktienmarkt aufweist.
15
Der Anspruch an
die Repräsentativität wird bei Auswahlindizes durch die Annahme beachtet, daß
die angeführten typischen Titel in einem solchen Index den gesamten
Aktienmarkt wiederspiegeln.
13
Begriff: Auch bekannt als Composite-Index oder Gesamtmarktindex
14
Vgl. dazu ausführliche Darstellungen ab S.49 im vierten Kapitel
15
Vgl. dazu ausführliche Darstellungen ab S.40 im vierten Kapitel
Kapitel 3: Arten
24
All-Share-Indizes sind aufgrund ihres Umfangs besonders geeignet, wenn das
Marktgeschehen vollständig abgebildet werden soll.
16
Die noch darzustellenden
deskriptiven Funktionen
17
erhalten nahezu optimale Informationen über die
Entwicklung des Aktienmarktes.
18
Stehen operative Funktionen im Vordergrund,
erscheinen Auswahlindizes mit wenigen Titeln eher geeignet. Dieses liegt darin
begründet, daß die meisten Auswahlindizes in kurzen Abständen neu berechnet
werden, um als Grundlage für den Handel mit indexorientierten Derivaten
regelmäßig aktuelle Indexstände aufweisen zu können. Wird ein Aktienindex
von zu vielen Titeln bestimmt, liegt die Gefahr nahe, daß auch unbedeutendere
und damit illiquide Aktien enthalten sind, die mit teilweise nur historischen
Kursen
19
das aktuelle Bild verzerren.
20
Darüber hinaus erschweren
umfangreiche Aktienindizes die geforderte schnelle Nachvollziehbarkeit.
21
Bis auf den Nasdaq Composite sind alle bedeutenden Aktienindizes dieser Welt
Auswahlindizes. Die Fokussierung auf Auswahlindizes bringt ein höheres
Indexniveau mit sich, da sich das Interesse der Marktteilnehmer auf die starken
und liquiden Titel, die nur in Auswahlindizes sind, konzentriert. Die folgende
Darstellung verdeutlicht diesen Zusammenhang:
Abb. 6: Entwicklung des DAX (Auswahlindex) und des CDAX (Composite-DAX)
Quelle: Deutsches Aktieninstitut (2000): a.a.O., S.23
16
Nach: Richard, Hermann-Josef (1992): a.a.O., S.46
17
Vgl. dazu ausführliche Darstellungen ab S.73 im sechsten Kapitel
18
Nach: Deutsches Aktieninstitut (2000): a.a.O., S.23
19
Erläuterung: Weil kein Handel stattfindet und damit der letzte Kurs berücksichtigt wird.
20
Nach: Richard. Hermann-Josef (1992): a.a.O., S.44
21
Ebd.: S.23
Kapitel 3: Arten
25
3.4 Marktsegmentierte Indizes
Für die letzte wichtige Unterscheidung von Arten der Aktienindizierung dient die
Abgrenzung des Aktienmarktes. Dazu dient als Oberbegriff die
Marktsegmentierung. Der gesamte Aktienmarkt, weltweit mit allen Titeln, ist
wenig geeignet, um differenzierte Aussagen zu treffen
22
. Viele Bereiche dieses
Marktes sind für die meisten Marktteilnehmer uninteressant. Unter Beobachtung
stehen eher die Entwicklungen von Teilmärkten, auf die sich die
Marktteilnehmer spezialisiert haben oder von denen sie am meisten erwarten.
Daher wird der Aktienmarkt segmentiert. Die Aktienindizes geben nur noch eine
Aussage zum betreffenden Marktsegment. Die Bestimmung des Segmentes ist
eine der wichtigsten Aufgaben bei der Planung von Indizes.
Regionale Aktienindizes: Die bekannteste Marktsegmentierung ist die
Abgrenzung nach Regionen. Länderindizes stellen hier die Entwicklung von
nationalen Aktienmärkten dar, wie der DAX für Deutschland. Vorstellbar sind
auch kleinere Segmente, wie Indizes für Bundesländer oder Bundesstaaten.
Hier bilden die politischen Grenzen die Abgrenzung. Länderübergreifende
Indizes können die Entwicklung von wirtschaftlich oder geographisch
zusammenhängenden Regionen nachzeichnen.
23
Als Beispiel können die
paneuropäischen Aktienindizes gelten, wie der EuroStoxx 50. Weltindizes sind
abschließend für globale Aussagen und Entwicklungen geeignet.
Bei länderübergreifenden Segmenten sind die Umstände wichtig, unter denen
die Aktien im jeweiligen Land gehandelt werden. Die Bedingungen sollten sich
zumindest ähneln. Zudem ist eine Vergleichbarkeit der Kurse bei
unterschiedlichen Währungen zu gewährleisten.
Branchenindizes: Eine weitere Abgrenzung folgt den verschiedenen
Branchen. Es existieren für alle wichtigen Branchen eines Aktienmarktes
Branchenindizes, die die einzelnen Entwicklungen jeder Branche wiedergeben.
In Deutschland sind Branchenindizes wie der DAX 100 Banken-Index oder der
22
Vgl. dazu ausführliche Darstellungen ab S.4 im zweiten Kapitel
23
Nach: Deutsches Aktieninstitut (2000): a.a.O., S.24
Kapitel 3: Arten
26
DAX 100 Chemie-Index bekannt. Falls ein Unternehmen in mehreren Branchen
tätig und nicht eindeutig einer Branche zuzuordnen ist, dient als Abgrenzung
i.d.R. der Umsatz. Das Unternehmen ist der Branche zuzuordnen, in der anteilig
der größte Umsatz erwirtschaftet wird.
24
Unternehmensgrößebedingte Aktienindizes: Verbreitet sind auch Ab-
grenzungen hinsichtlich der Unternehmensgröße. Aktienindizes werden für
große, mittlere und kleine börsennotierte Aktiengesellschaften gebildet.
Kriterien der Unternehmensgröße können der Umsatz, die Anzahl der
Mitarbeiter oder die Bilanzsumme sein. Börsenbedingt ist die
Marktkapitalisierung, folglich die wertmäßige Summe aller Aktien eines
Unternehmens, von großer Bedeutung.
Stylebedingte Aktienindizes
25
: Bei dieser Abgrenzung handelt es sich um
eine neue Differenzierung. Die in einem Aktienindex enthaltenen Werte werden
hinsichtlich ihrer Wachstums- und Ertragschancen unterschieden. Titel, die seit
Jahren ertragsstark sind, werden unterschieden von Titeln, bei denen die
Unternehmen stark wachsen oder die Aussichten auf ein Wachstum sehr gut
erscheinen. I.d.R. sind stark wachsende Unternehmen noch relativ neu und
ertragsschwach. Diese Unternehmen können von einer kleinen Basis aus
überproportional wachsen, welches sehr kapitalintensiv ist und noch keine
großen Gewinne ermöglicht. Dagegen wachsen ertragsstarke Werte nur noch
durchschnittlich, da diese bereits eine gewisse Größe auf hohem Niveau
aufweisen.
Der Neue Markt in Deutschland ist ein Segment für wachstumsstarke Titel aus
allen Branchen. Der DAX dagegen beinhaltet hauptsächlich ertragsstarke Titel.
Die folgende Darstellung faßt die gesamten Ergebnisse noch einmal
zusammen.
24
Nach: Deutsche Börse AG (2002): a.a.O., S.8
25
Nach: Deutsches Aktieninstitut (2000): a.a.O.,S.25
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832456450
- ISBN (Paperback)
- 9783838656458
- DOI
- 10.3239/9783832456450
- Dateigröße
- 1.9 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Bielefeld – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Juli)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- aktienmarkt aktienindex aktienindizes aktien kapitalmarkt
- Produktsicherheit
- Diplom.de