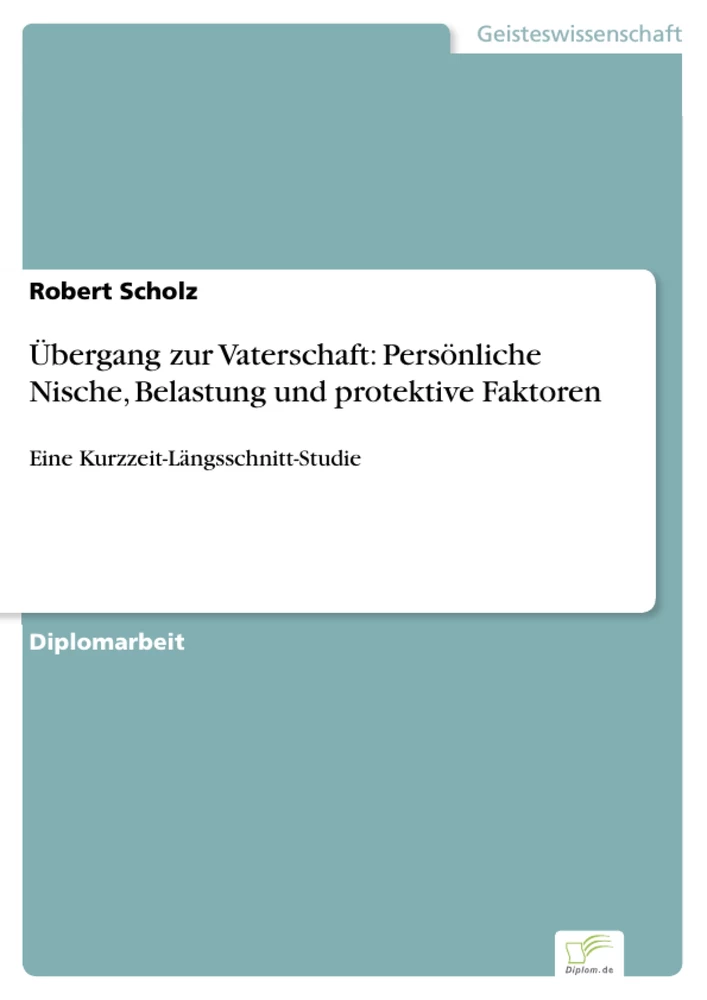Übergang zur Vaterschaft: Persönliche Nische, Belastung und protektive Faktoren
Eine Kurzzeit-Längsschnitt-Studie
Zusammenfassung
Männer, die Väter werden, sind mit einer Vielzahl unterschiedlichster Aussagen und Informationen darüber konfrontiert, was sich beim Übergang zur Elternschaft verändert. Erste Informationsquelle für die sich abzeichnenden Veränderungen sind dabei die eigenen Partnerinnen, die während der Schwangerschaft meist früher beginnen, sich mit den sich ändernden Lebensumständen zu befassen. Inzwischen gibt es eine große Zahl von Paaren, die gemeinsam Geburtsvorbereitungs- und Säuglingspflegekurse besuchen. Inhalte dieser Kurse sind z.B. Entspannungsverfahren, Aufklärung über den Geburtsverlauf und Hinweise und Übungen zur Pflege und Ernährung des Säuglings. Weniger thematisiert werden dabei die psychologischen Veränderungen und die Auswirkungen, die der Übergang zur Elternschaft auf die Partnerschaft hat oder haben kann. Nach übereinstimmender Auskunft von Kursleiterinnen solcher Kurse scheint dies weniger mit mangelnden Angeboten zusammenzuhängen. Es mussten im Gegenteil immer wieder Kurse wegen zu geringer Beteiligung abgesagt werden, die sich mit den psychologischen Besonderheiten und den Lebensumständen junger Eltern auseinandersetzen. Dabei bestünde für das Paar genug Anlass, sich bereits im Vorfeld mit Veränderungen der Paarbeziehung und möglichen Quellen späterer Unzufriedenheit, z.B. hinsichtlich der Rollenaufteilung zwischen den Partnern, auseinander zu setzen. An dieser Stelle wenden erfahrene Eltern ein, sie hätten sich die Qualität und Massivität der Veränderungen durch die Geburt eines Kindes im Vorfeld ohnehin nicht vorstellen können. Vielleicht wäre aber schon etwas gewonnen, wenn Paare mehr über die Zusammenhänge sprechen würden, welche Situationen als besonders belastend und welche als besonders erfreulich erlebt werden und worin Unterschiede in der individuellen Wahrnehmung zwischen den Partnern liegen könnten. Solche vertraulichen Gespräche werden tendenziell durch eine entspannte, ruhige Atmosphäre begünstigt, in der keiner der beiden Partner das Gefühl haben muss, angegriffen oder beschuldigt zu werden. Aber gerade solche Situationen sind in der ersten gemeinsamen Zeit mit einem Kind selten.
Stress, der mit Belastungen aus unterschiedlichsten Quellen zusammenhängt, kann beispielsweise dazu führen, dass sich ein Familienvater, der sich von den widersprüchlichen Rollenanforderungen überfordert fühlt, aus einem Teil seiner Verantwortung zurückzieht (z.B. bleibt ein Vater länger im Büro, als er eigentlich müsste; […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Männer, die Väter werden, sind mit einer Vielzahl unterschiedlichster Aussagen und Informationen darüber konfrontiert, was sich beim Übergang zur Elternschaft verändert. Erste Informationsquelle für die sich abzeichnenden Veränderungen sind dabei die eigenen Partnerinnen, die während der Schwangerschaft meist früher beginnen, sich mit den sich ändernden Lebensumständen zu befassen. Inzwischen gibt es eine große Zahl von Paaren, die gemeinsam Geburtsvorbereitungs- und Säuglingspflegekurse besuchen. Inhalte dieser Kurse sind z.B. Entspannungsverfahren, Aufklärung über den Geburtsverlauf und Hinweise und Übungen zur Pflege und Ernährung des Säuglings. Weniger thematisiert werden dabei die psychologischen Veränderungen und die Auswirkungen, die der Übergang zur Elternschaft auf die Partnerschaft hat oder haben kann. Nach übereinstimmender Auskunft von Kursleiterinnen solcher Kurse scheint dies weniger mit mangelnden Angeboten zusammenzuhängen. Es mussten im Gegenteil immer wieder Kurse wegen zu geringer Beteiligung abgesagt werden, die sich mit den psychologischen Besonderheiten und den Lebensumständen junger Eltern auseinandersetzen (vgl. Anders, 1997). Dabei bestünde für das Paar genug Anlass, sich bereits im Vorfeld mit Veränderungen der Paarbeziehung und möglichen Quellen späterer Unzufriedenheit, z.B. hinsichtlich der Rollenaufteilung zwischen den Partnern, auseinander zu setzen. An dieser Stelle wenden erfahrene Eltern ein, sie hätten sich die Qualität und Massivität der Veränderungen durch die Geburt eines Kindes im Vorfeld ohnehin nicht vorstellen können. Vielleicht wäre aber schon etwas gewonnen, wenn Paare mehr über die Zusammenhänge sprechen würden, welche Situationen als besonders belastend und welche als besonders erfreulich erlebt werden und worin Unterschiede in der individuellen Wahrnehmung zwischen den Partnern liegen könnten. Solche vertraulichen Gespräche werden tendenziell durch eine entspannte, ruhige Atmosphäre begünstigt, in der keiner der beiden Partner das Gefühl haben muss, angegriffen oder beschuldigt zu werden. Aber gerade solche Situationen sind in der ersten gemeinsamen Zeit mit einem Kind selten.
Stress, der mit Belastungen aus unterschiedlichsten Quellen zusammenhängt, kann beispielsweise dazu führen, dass sich ein Familienvater, der sich von den widersprüchlichen Rollenanforderungen überfordert fühlt, aus einem Teil seiner Verantwortung zurückzieht (z.B. bleibt ein Vater länger im Büro, als er eigentlich müsste; vgl. Rosenkranz et al., 1998). Auch wenn solche Mechanismen dem Vater selber vielleicht gar nicht bewusst sind: Ein Rückzug eines einzigen Familienmitgliedes betrifft die gesamte Familie. Um bei diesem Beispiel zu bleiben: Wenn der Vater, der nach der Arbeit auf das Kind aufpassen sollte, länger im Büro bleibt als erwartet, muss dessen Partnerin länger beim Kind bleiben. Damit wird sie vielleicht ihrerseits einen lange geplanten Schwimmbadbesuch absagen müssen, den sie so dringend zur Erholung gebraucht hätte. Der Ärger, den sie darüber empfindet, kann sich auf die Interaktion zum Kind auswirken, das seinerseits mit Verunsicherung reagiert und infolgedessen unruhiger wird und mehr schreit. Aus der Perspektive des Vaters, dem sein Rückzug vielleicht gar nicht bewusst war, hat er sich durchaus entsprechend der traditionellen Rollenerwartung verhalten, auch wenn er gleichzeitig Erwartungen seiner Partnerin an ihn enttäuscht hat. Es könnte somit sein, dass er beim nach Hause Kommen auf eine entnervte Partnerin und ein quengelndes Kind trifft, ohne zunächst die Zusammenhänge zu ahnen.
In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, welche psychologischen Aspekte und Bedingungen der Umgebung sich auf den wahrgenommenen Stress der Väter auswirken könnte. Dabei soll insbesondere der Versuch unternommen werden, Veränderungen beim Übergang zur Vaterschaft zu beschreiben und zu erklären. Daneben sollen Faktoren vor der Geburt identifiziert werden, die sich auf die spätere Belastung nach der Geburt verstärkend oder moderierend auswirken könnten. Insbesondere soll darauf eingegangen werden, welche Rolle hierbei Humor und Empathie spielen.
2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen von Elternschaft
Kinder zu bekommen ist heute in den hochindustrialisierten Ländern weder eine ökonomische Notwendigkeit noch eine naturwüchsige Selbstverständlichkeit (Thomä, 1992). Der zeitgenössische gesellschaftliche Pluralismus steht im Kontrast zu einer historischen Gesellschaft, in der die eigene Biographie durch Faktoren wie Herkunft und Geschlecht weitgehend vorherbestimmt war. Das Leben in den westlichen Industrienationen wird vom Prinzip bestimmt, wonach alles dem Gesetz nach Legitime auch möglich ist („ Anything goes “; vgl. Schnarrer, 2000). Auf der anderen Seite sind nicht alle Optionen auf die Gestaltung des eigenen Lebenslaufs gesellschaftlich tatsächlich erwünscht und akzeptiert. Persönliche Entscheidungen, die dem öffentlichen Common Sense zuwider laufen, drohen an Grenzen zu stoßen, die in ganz konkreten gesellschaftlichen Strukturen liegen, oder die durch mehr oder weniger subtile soziale Interaktionen den Menschen, die Neuland betreten, vermittelt werden. In Bezug auf die Motive einer einzelnen Person, Kinder in die Welt zu setzen (d.h., Generativität im soziologischen Sinn), werden in der Soziologie -neben der Berücksichtigung der sozioökonomischen Lage- drei Faktoren als relevant angesehen:
- das physische Können (d.h. die biologischen Gegebenheiten wie die Zeugungs- und Gebärfähigkeit sowie die durch das Lebensalter gegebenen Begrenzungen)
- das soziale Dürfen (z.B. Normen und Gesetze d.h. soziale Schranken und Normen hinsichtlich der als erwünscht angesehenen Kinderzahl pro Familie als auch in bezug auf Altersnormen, die die Person im Zuge ihrer Sozialisation übernimmt)
- das persönliche Wollen (Motivation d.h. die individuelle und willentliche Gestaltung des generativen Verhaltens, die z.B. im persönlichen Kinderwunsch zum Ausdruck kommt) (Mackenroth, 1953).
Da es aber vor allem Paare sind, die sich mit dem Gedanken an ein Kind tragen (oder durch eine ungeplante Schwangerschaft damit konfrontiert sind), erscheint es nicht ausreichend, allein solche „persönlichen“ Motive zu betrachten. Der gesellschaftliche Hintergrund zur Zeit der Niederschrift der o.g. drei Faktoren für Generativität von Mackenroth war noch nicht davon geprägt, dass beide Partner eine eigene berufliche Karriere als Lebensziel hätten anstreben können.
Im Hinblick auf das oben angesprochene Prinzip des „ Anything goes “ gilt, dass für Paare heute mehr als früher die unterschiedlichsten Optionen dafür bestehen, wie etwa Betreuung und Erziehung des Kindes und Erwerbsarbeit aufgeteilt und organisiert werden können. Elternschaft gerät gerade dadurch heute in großem Maß zu einem biografischen Geschehen, das gut überlegt, genau geplant und hinsichtlich möglicher Konsequenzen auch in Detailfragen nach verschiedenen damit assoziierten Entscheidungsalternativen, sorgfältig abgewogen werden muss. Und das nicht nur in Hinblick auf das eigene Leben, sondern auch auf das des Partners. In den meisten Fällen scheinen es jedoch die Frauen zu sein, die sich um Kind und Haushalt kümmern (vgl. Petzold, 1995). Wenn Paare beschließen, die Arbeitsteilung zwischen Kinderbetreuung, Haushalt und Berufstätigkeit anders als im traditionellen Modell vorgesehenen, zu regeln, ist dies deren Privatangelegenheit. Die politischen und sozialen Institutionen in Deutschland gehen nach wie vor von dem Modell Hausfrau/Mutter auf der einen und Vollerwerbs-Familienvater auf der anderen Seite aus (Kamerman, 1983). Überlegungen, wie Kinder- und Berufsarbeit besser miteinander vereinbart werden könnten, werden im allgemeinen nicht darüber angestellt, wie dieses Ziel für Männer besser erreichbar wäre. Solche Fragen scheinen eher in enger Verbindung zur Frauenbewegung diskutiert zu werden, in der darauf gepocht wird, die Bedingungen für das Leben mit Kindern Modelle zur Vereinbarkeit mit der Berufsarbeit im Sinne einer größeren Familienfreundlichkeit und Chancengleichheit für Frauen zu verbessern.
Nicht nur auf dem beruflichen Sektor werden bewusste Entscheidungen im Sinne einer umfassenden "Lebensplanung" erwartet. Bei konsequenter Betrachtung stellt sich bereits im Vorfeld der Partnerwahl die Frage, welcher Partner zu dem angestrebten Lebensentwurf in komplementärer Weise passt. Tatsächlich denken einige Autoren in diese Richtung (vgl. Gloger-Tippelt, 1988; Wiegmann, 1999). So ist zum Beispiel Hurrelmann (1999) der Ansicht, dass für eine sorgfältige Vorbereitung der Familiengründung Planungs- und Handlungskompetenzen erforderlich wären, die durch die Schule nicht vermittelt werden. Er schlägt vor, solches „Familien-Know-how“ durch ein systematisch und flächendeckend eingeführtes Elterntraining zu vermitteln. Angesichts solcher Vorschläge stellt sich die Frage, welchen Einfluss die zunehmende Professionalisierung einmal als natürlich erlebter Lebensbereiche auf die Betroffenen selber (in psychologischen Konstrukten z.B. fassbar über Selbstwirksamkeitserwartung oder Kontrollüberzeugung) und für deren Verhalten (z.B. Compliance vs. Reaktanz) haben könnte. Es wird auch weniger gefragt, ob Informationen zu Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft, die das Resultat von systematischer Beforschung dieser Bereiche sind, tatsächlich eine breite Bevölkerungsmehrheit erreichen, oder ob es auch hier in Zukunft die Tendenz zu einer 2-Klassen-Gesellschaft geben wird. Die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim sieht die gegenwärtigen gesellschaftlichen Gegebenheiten durch ein Planungsdenken gekennzeichnet, das...
„...nicht bloß Ausdruck persönlicher Neigungen, Zwänge, Neurosen [ist]. Es ist kein individueller Wahn, kein plötzlich auftauchender Virus, der aus unerfindlichen Gründen immer mehr Zeitgenossen befällt. Es ist vielmehr Teil des Gesamtprojekts der Moderne, weist zurück auf die neue Gestaltbarkeit des Lebenslaufes mitsamt den darin angelegten neuen Chancen, Kontrollen und Zwängen. Hier wie in anderen Bereichen auch, sei´s Ausbildung, Berufswahl, Konsum usw.-, überall wird das alltägliche Handeln vor neue Anforderungen gestellt, der Zeithorizont wird erweitert, verlängert: Die Gegenwart wird immer mehr unter einen ‚Zwang zur Zukunft’ gestellt." (Beck-Gernsheim, 1998, S.83)
Der Philosoph Dieter Thomä geht in seinem Buch „Eltern: Kleine Philosophie einer riskanten Lebensform“ noch weiter und spricht weniger von einem gesellschaftlichen Zwang zur Planung als von einer moralischen Dimension der Verantwortung der Eltern für die Welt:
"Wenn es heute eine Entscheidung über die Kinderfrage gibt- und keinen naturwüchsigen und ökonomischen Automatismus mehr -, dann liegt es nahe, dabei auch über die in Zukunft zu erwartenden Chancen und Nöte des Lebens auf der Erde Vermutungen anzustellen; schließlich hängen davon das Wohl des Kindes und d.h. auch die Modalitäten der elterlich-kindlichen Lebensgemeinschaft ab." (Thomä, 1992, S. 31)
Eltern sollen hiernach also nicht nur wohlüberlegte Entscheidungen über die eigene Lebensplanung treffen, sondern die vielfältigen globalen, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mitbedenken und eine verantwortungsbewusste Entscheidung auch im Sinne des noch gar nicht gezeugten Kindes treffen. Und diese Raison zur Verantwortung, die z.B. Politiker immer so gerne beschwören, geht nach Ansicht von Beck-Gernsheim nach der Geburt weiter:
"Unter den Bedingungen der modernen, sozial mobilen Gesellschaft wird - so der Tenor unzähliger Ratgeberbücher, Zeitschriften, Kursangebote für Eltern - die "optimale Förderung" des Nachwuchses zum Gebot. Gleichzeitig weist die moderne hochindustrielle Gesellschaft eine "strukturelle Kinderfeindlichkeit" (Giddens 1997) auf, d.h. ihre Vorgaben passen nicht mit den Bedürfnissen, dem Bewegungsdrang, dem Zeitrhythmus von Heranwachsenden zusammen (man denke z.B. an Wohnungsbau, Straßenverkehr, Schadstoffe in Luft und Nahrung). Einerseits optimale Förderung, andererseits strukturelle Kinderfeindlichkeit - in diesem Widerspruch müssen die, die für Kinder verantwortlich sind, sich dauernd bewegen, müssen kompensieren und ausbalancieren, nach allen Seiten verhandeln, zwischen den Fronten vermitteln, und immer wieder: das Schlimmste verhüten. Unter diesen Umständen (die, im ganz wörtlichen Sinne, dauernde Umstände machen) wächst die Arbeit für Kinder an, dehnt sich aus, wird zum komplexen Agieren zwischen Widerständen verschiedenster Art. Bleibt nur zu fragen: Wer soll sie leisten?" (Beck-Gernsheim, 1998, S. 94)
Auf der einen Seite steigen also die Ansprüche, die an Eltern von der Gesellschaft gestellt werden. Gleichzeitig ist der Wunsch nach weiblicher Gleichberechtigung und beruflicher Selbstverwirklichung der Frauen inzwischen zum Thema geworden, dessen Relevanz von kaum einer gesellschaftlichen Instanz mehr in Frage gestellt wird. In Verbindung mit der Emanzipationsbewegung der Frauen sind auch die Ansprüche gestiegen, die Frauen an Männer als Partner stellen. Wenn Frauen in einer Partnerschaft sich in gleichem Maß wie die Männer beruflich engagieren, muss zwischen den Partnern auch ausgehandelt werden, wie berufliche Arbeit und die Arbeit zu Hause aufgeteilt werden soll. Schmidt-Denter (1996) nennt diesen Konflikt zwischen divergierenden Rollen, die ein Individuum einnehmen kann Inter-Rollenkonflikt. Er bemerkt an gleicher Stelle (S. 164), dass es mit steigender Komplexität der Sozialstruktur schwieriger für die Individuen wird, gegensätzliche Rollenanforderungen zu erfüllen. Andererseits sei diese Komplexität sozialer RolIen nicht per se als negativ anzusehen. Sie könne zur Komplexität der Persönlichkeit beitragen und als Grundlage eines erfüllten Lebens empfunden werden. Trotzdem ist bei näherem Hinsehen offensichtlich, dass der zu verteilenden Arbeit, unabhängig davon, wie belastend oder erfreulich die Individuen sie selber empfinden, zumindest ein unterschiedlicher gesellschaftlicher Stellenwert beigemessen wird.
In Bezug auf verrichtete Arbeit im Haushalt oder in Verbindung mit der Kinderbetreuung, die die Grundlage aller übrigen Berufsarbeit darstellt, spricht Ivan Illich in seinem Beitrag zur Emanzipationsdiskussion von „Schattenarbeit“ (Illich, 1995), der in geringem Maße überhaupt jene Qualitäten bescheinigt werden, der Arbeit im gesellschaftlichen Kontext üblicherweise zukommt (sonst würde sie vermutlich bezahlt werden). Immer noch die meisten Eltern entscheiden sich bei der Aufteilung von Berufsarbeit und „Schattenarbeit“ für das traditionelle Rollenmodell, bei dem der Mann vollzeiterwerbstätig ist und die Frau zu Hause bleibt. Trotzdem scheinen im Laufe der letzten Jahre erhöhte Anforderungen an die Männer gestellt zu werden, sich mehr in Sachen Kinderbetreuung und –Erziehung zu engagieren und ihren Beitrag zur Hausarbeit zu leisten. Auch wenn heute viele Männer diesem Anspruch nachkommen, wird ihnen jedoch von feministischer Seite Arbeitssucht und Fahnenflucht vorgeworfen:
„Die neuen Väter? Bei der Geburt atmen sie noch mit, aber danach geht ihnen schnell die Luft aus. Danach machen sie sich das Vater-Sein, dem alten Sprichwort zum Trotz, mindestens genauso leicht wie das Vater-Werden.“ (Benard & Schlaffer, 1993, S. 7)
Auch wenn Männer sich heute noch nicht in dem Maße in der Kindererziehung engagieren, wie es wünschenswert wäre, wird doch zumindest eines deutlich: Das Vaterbild hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt, wobei jedoch weder die Richtung klar ist, noch wann dieser Wandlungsprozess abgeschlossen sein wird.
2.2 Das Bild vom Vater im Wandel
Die Frage danach, was ein Vater ist, wird, sieht man von der unfraglich (im Hinblick auf die Fortschritte in der Reproduktionsmedizin müsste man fast sagen: noch; vgl. Beck-Gernsheim, 1998, S.123ff.) eindeutigen biologischen Beteiligung am Entstehen eines Kindes ab, quer durch die Ratgeberliteratur durchaus unterschiedlich beantwortet. Das entstehende Bild scheint von einer allgemeinen Verunsicherung darüber geprägt zu sein, wodurch sich ein Vater auszeichnet. In der Antike war dies noch anders:
"In der römischen Familie wird mit dem Terminus "pater familias" der Hausvater bezeichnet, das mächtigste männliche Familienmitglied als Vorstand aller zum erweiterten Familienverband gehörender Personen, die seiner patria potestas unterstellt sind. Er besitzt eine lebenslängliche, unbeschränkte Vollgewalt über alle Personen, die rechtlich zum Familienverband gehören, bis hin zur Todesstrafe und der Tötung von Neugeborenen." (Macha, 1999)
Die Beschreibung eines solchen, nahezu omnipotenten römischen Vaters lässt außer acht, das sich die römische Kultur Sklaven bediente und auch der erwähnte Hausvater eine Ausnahme darstellte, die vor allem in privilegierten Schichten der römischen Gesellschaft anzutreffen war. Diese Einschränkung hat nicht verhindern können, dass der „pater familias“, der vor allem als Träger von Macht fungiert, dem Vaterbild, spätestens nach dem Missbrauch des Vaters durch die kurzwährende Neuauflage des "Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation" durch die Nationalsozialisten (Geiss, 1986), zwar Respekt aber keinen guten Ruf beschert hat:
"Genauso, wie wir die Mütter dafür verantwortlich machen, dass sie ihren Kindern Schaden zufügen, schreiben wir den Vätern die Schuld an Katastrophen und Tragödien in größerem Stil zu. Die Zerstörungskraft einer Frau macht bei ihren Kindern halt. Die Zerstörungskraft von Männern erscheint uns grenzenlos: Präsidenten und Generäle, die beim Golfspielen über bakteriologische Kriegsführung entscheiden oder darüber, welche nuklearen Sprengköpfe sie einsetzen; der Nazi, der Mozart hörte, während er Juden in die Gaskammern schickte. Auch wenn eine Mutter grausam sein kann ist es schwer vorstellbar, dass sie an globaler Zerstörung herumbastelt, eiskalt den Befehl zum Abschlachten von Menschenmassen gibt oder Apparaturen für eine beispiellose Vernichtung ersinnt". (Swigart, 1991, 136).
Macht und Gewalt (nicht nur wirtschaftliche und politische; auch die kriminelle; R.S.) sind zwar weltweit immer noch überwiegend in männlicher Hand, die Rolle des Vaters scheint sich jedoch fast vollständig und ersatzlos aufgelöst zu haben:
„Das Vaterbild hat sich gewandelt [...]. Seine Autorität ist nicht mehr gefragt und unangezweifelt begründet. Als Beschützer wird er nicht mehr gebraucht, oder er muss angesichts der Probleme versagen. Also bleibt nur noch eins übrig, der Vater als Geldverdiener. Jahrzehntelang galt das tatsächlich als Aufgabe, die nur der Mann, der Vater lösen konnte. Selbst in der wissenschaftlichen Literatur wurden Ansichten vertreten, die den Vater auf diese Aufgabe beschränkten. Aus allem anderen, was das Kind betraf, Versorgung und Erziehung, hatte er sich weitgehend herauszuhalten“ (Müller-Mees, 1994, 126).
Auch in der psychologischen Forschung wurde dem Vater bis in die 70er Jahre für die Kindererziehung keine schwerwiegende Bedeutung beigemessen:
„Der Vater ist von keinerlei direkter Bedeutung für die Entwicklung des Kleinkindes, er kann nur insofern von indirektem Wert sein, als er die finanzielle Absicherung gewährt und oft eine emotionale Stütze für die Mutter ist.“ (Bowlby, zit. nach Meyer-Kramer, 1980, S. 87)
Seit dieser Aussage von Bowlby hat sich manches geändert. So ist z.B. inzwischen unbestritten, dass Vätern für die Entwicklung ihrer Kinder eine große Bedeutung zukommt. Auch sind Männer heute in weit größerem Umfang bereit, Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder zu übernehmen und sind eher bestrebt, ihre Partnerinnen bei den alltäglichen häuslichen Aufgaben zu entlasten. Bei der Beschäftigung mit dem Thema fällt auf, dass eine Motivation, sich als Vater und gleichberechtigter Partner zu engagieren, offenbar ein „schlechtes Gewissen“ den Frauen gegenüber ist. Die Männer haben sich die Argumente des Feminismus zur gesellschaftlichen Benachteiligung der Frauen zueigen gemacht. Aber statt sich mit dem Hinterfragen dieser gesellschaftlichen Realität zu beschäftigen, reagieren sie eher individuell mit Schuldgefühlen darauf, dass sie im Vergleich zu ihren Partnerinnen als Mann von besseren Randbedingungen für Beruf und Karriere profitieren können. Die Beteiligung an Haushalt und Kinderpflege wird überwiegend als Pflichterfüllung gegenüber den benachteiligten und überlasteten Partnerinnen betrachtet, wobei, auch wenn es zutrifft, leicht eines aus den Augen gerät: Gerade die Vorstellung, mit allen Anforderungen von außen alleine fertig werden zu können –und sei es, nach einem anstrengenden und aufreibenden Job noch für Frau und Kinder voll da sein zu wollen- und der Versuch, dieses ungeachtet der eigenen Belastung und unter Negierung der eigenen Erschöpfung durchzustehen, zeugt von der eigentlichen Nähe solcher Männer zu althergebrachten männlichen Tugenden (Interessant ist, dass gerade im Zusammenhang mit Kinderpflege und Erziehung von Männern Begriffe wie „Pflicht“ und „Arbeit“ ins Spiel gebracht werden). Dass eine Integration emanzipatorischer Gedanken auch mit der Wahrnehmung eigener Bedürfnisse zusammenhängt, gerät in den Hintergrund:
„...keine Frau wird es auf die Dauer mitmachen, dass ihr Mann immer nur mit dem Kind spielt und seine Schokoladenseiten genießt, die unangenehmen Arbeiten aber ihr überlässt. Sich um sein Kind kümmern heißt eben auch, es zu wickeln, wenn es wie ein Berserker schreit und ihm der Kot schon aus dem Kragen quillt; heißt, auch mal nachts aufzustehen und es zu beruhigen oder eine Dreiviertelstunde an seinem Bett zu sitzen und Lieder zu grunzen. Nur wer seine Frau wirklich entlastet, Zeit für sein Kind aufbringt und bereit ist, einen Anteil der Arbeit zu übernehmen, kann in meinen Augen ein echter Vater sein.“ (Schlenz, 1994, S.146).
Diese Ausführungen von Schlenz lassen die Schlussfolgerung zu, dass Männer zwar die Frau entlasten sollen, sie den Umgang mit einem Kind jedoch nicht lustvoll-bereichernd erleben dürfen, wenn sie z.B. „immer nur mit dem Kind spielen“ (s.o.) wollen. Es liegt jedoch die Vermutung nahe, dass auch Müttern der Umgang mit ihrem Kind mitunter Spaß macht. Dabei ist vielleicht auch für das Kind ein ausgelassener, entspannter Vater, der „ganz bei der Sache“ (besser: beim Kind) ist, förderlicher als ein abgearbeiteter Vater, der genervt und aus bloßer Pflichterfüllung für einige Stunden seiner Frau das Kind „abnimmt“. Gleiches gilt für die Mütter, die dann für die Entwicklung ihrer Kinder förderlicher sein können, wenn sie selber ausgeglichen und im großen und ganzen mit ihrem Leben zufrieden sind (Schmidbauer, 2001). Wenn Schlenz das Schreien des Kindes („wie ein Berserker“) hervorhebt, drückt er damit vor allem Hilflosigkeit im Umgang mit dem Kind aus. Männliche Unsicherheit im Umgang mit Kindern könnte aber vor allem aus einem Mangel an Erfahrung stammen: Wer im Alltag viel mit einem kleinen Kind zusammen ist und sich gefühlsmäßig darauf einlässt (das sind eben meist die Mütter), wird feststellen, dass moralische Appelle, was mit einem Kind zu tun sei, insofern unnötig sind, als das Kind die eigenen Bedürfnisse sehr wohl selber artikulieren kann. Selten wird im Zusammenhang mit der Verpflichtung der Väter erwähnt, dass der Umgang mit einem Kind mit Erfahrungen einhergehen kann, die kaum in einem anderen Lebensbereich gesammelt werden können:
„Die Fürsorglichkeit, die wir Kindern angedeihen lassen, hat unmittelbare Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir die Welt sehen und mit ihr umgehen. In dem Maß, in dem Männer eine intime und liebevolle Beziehung zu ihren Kindern aufbauen, machen sie sich mehr Gedanken über die Welt und über die Zukunft“.(Swigart, 1991, S. 164)
Angesichts solcher Überlegungen stellt sich die Frage, warum nicht mehr Männer, ebenso wie manche Frauen, darauf bestehen, zumindest phasenweise mehr Zeit mit ihrem Kind zu verbringen, obwohl es in Deutschland auch immerhin 30% der Frauen begrüßen würden, wenn ihr Mann die volle Verantwortung für das Kind übernähme (Schmidt-Denter, 1996). Wenn ausreichend Raum und Zeit in einer entspannten Umgebung vorhanden ist, werden mehr Männer die Erfahrung machen, wie sehr das Zusammensein mit einem Kind Gefühle wecken kann, gebraucht zu werden und etwas Sinnvolles zu tun: Wenn mehr Männer diese positive Erfahrung an ihre eigenen Kinder und vor allem an ihre Söhne weitergeben, könnte sich langfristig etwas an der gegenwärtig noch vorherrschenden ungleichen Verteilung der Aufgaben ändern.
Für den Münchner Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer birgt Elternschaft zum einen Risiken, die mit den massiven Veränderungen des Lebens durch ein Kind zusammenhängen. Zum anderen sieht er sie auch als Chance, wenn diese Veränderungen bewältigt werden. Eine der Hauptgefahren im Zusammenhang mit der Elternschaft sieht er darin, dass das Kind für den Elternteil, der den Beruf aufgibt und zu Hause bleibt (meist die Mutter) eine übersteigerte narzisstische Bedeutung erhält. Fehlt diesem Elternteil diese gewohnte narzisstische Bestätigung aus dem Arbeits- und Berufleben, muss das Kind stellvertretend diese Bedürfnisse erfüllen. Das hat Auswirkungen auf die psychische Entwicklung des Kindes und die Beziehung zum Partner. Er sieht darin auch eine der Ursachen für den Rückzug des Vaters von Kind und Partnerin (Schmidbauer, 2001; vgl. Atkins, 1984). Unter diesem Aspekt ist es bedeutsam, nach den Motiven für Vaterschaft zu fragen und zu untersuchen, wie die aktuelle Lebenssituation von Vätern ist und in welcher emotionalen Qualität sie erlebt wird.
2.3 Elternschaft und die Rolle des Vaters
2.3.1 Psychoanalytische Konzepte: Motive des Kinderwunsches
Vor hundert Jahren stand für Menschen weniger die Frage im Vordergrund, ob sie Kinder in die Welt setzen oder nicht. Da eine Eheschließung nahezu unlösbar mit der Elternschaft verknüpft war, stellte sich bestenfalls die Frage nach einer Alternative zur Lebensform der Ehe. Was Freud sich 1898 noch ersehnte und als einen der größten Triumphe der Menschheit betrachtete –"...wenn es gelänge, den verantwortlichen Akt der Kinderzeugung zu einer willkürlichen und beabsichtigten Handlung zu erheben, und ihn von der Verquickung mit der notwendigen Befriedigung eines natürlichen Bedürfnis loszulösen" (Freud 1989, S.507) ist eingetreten: Elternschaft ist ein Ereignis geworden, das zur Lebensgeschichte von Menschen nicht mehr fast zwangsläufig dazu gehört. Statistisch gesehen bekommt heute jede Frau in Deutschland durchschnittlich nur noch 1,48 Kinder (Im Jahr 1965 lag der Vergleichswert bei 2,51; Höhn, 1993). Damit gewinnt die Frage nach den Motiven, die Paare dazu bewegen, Eltern zu werden, an Bedeutung. Diamond (1991) hat bezüglich der Motivation eines Mannes zur Vaterschaft folgende Wünsche beschrieben:
- Sublimierte Abhängigkeitswünsche: In der Identifikation mit dem Kind kann ein Mann seine eigenen Abhängigkeitswünsche befriedigen; die Identifikation mit der Väterlichkeit des eigenen Vaters dient der Versicherung der eigenen Männlichkeit.
- Generative Wünsche nach der Kontinuität des Selbst (und der narzisstische Wunsch, durch die eigenen Kinder, speziell durch die des gleichen Geschlechts, zu überleben). Generativität ist für Erickson (s. u., 1963) eine wichtige psychosexuelle und psychosoziale Aufgabe.
- Wünsche nach der Erweiterung des Selbst (die Herausforderungen, die durch ein Kind entstehen, führen zu einer Zunahme an Verantwortlichkeit, Rücksichtnahme, Einfühlung u.a.m. beim Mann).
- Wünsche nach der Erweiterung der Partnerschaft durch zunehmende Wechselseitigkeit (der Kinderwunsch kann einen erlebten Mangel an Sinnerfüllung in der Partnerschaft lindern oder gar aufheben);
- Reparative und identifikationsstiftende Wünsche mit dem Ziel, die eigenen Eltern wiederzubeleben (ein Kind soll den Eltern als Enkelkind das zurückgeben, was man ihnen selbst aufgrund der Loslösung von ihnen ‚weggenommen’ hat).
Neben diesen (oft unbewussten) Motiven, die für Diamond im Zusammenhang mit dem männlichen Kinderwunsch stehen und die als der Elternschaft vorausgehend angesehen werden können, ist es auch die Situation, die durch ein neu geborenes Kind selber geprägt ist, die ihrerseits einen Motor der Entwicklung darstellt. Gutmann (1985) spricht in diesem Zusammenhang vom „ elterlichen Imperativ “ als der Entwicklungsaufgaben, mit der Menschen quasi universell konfrontiert sind, wenn sie eigene Kinder haben. Schmidt-Denter (1996) berichtet von biographischen Interviews, die in verschiedenen Kulturkreisen durchgeführt wurden. Die Ergebnisse lassen zwei universelle Faktoren, die im Zusammenhang mit dem elterlichen Imperativ stehen, schließen: Die Verschärfung der Geschlechtsrollenunterschiede, die mit der Arbeitsteilung bei der Betreuung des Kindes zusammenhängt, meint die Tendenz zur Traditionalisierung, die beim Übergang zur Elternschaft häufig zu beobachten ist. Neben ökonomischen Gründen (z.B. Einkommensunterschiede zwischen den Partnern) und der sozialen Erwünschtheit eines bestimmten Rollenverhaltens wäre es denkbar, dass eine traditionelle Rollenaufteilung mit geringerem psychischen Aufwand verbunden sein könnte als er bei einer egalitären Aufteilung von Berufs- und Hausarbeit zu erwarten wäre: Eine egalitäre Aufteilung aller Arbeiten erfordert für die Partner ein höheres Maß an Disziplin, Organisationsaufwand und die Bereitschaft, sich über die Abstimmung in vielen Detailfragen kontinuierlich auszutauschen. Den Paaren, die eine eher egalitäre Aufgabenverteilung anstreben, könnte es an Vorbildern und Modellen hierzu fehlen. Eine „konventionelle“ Rollenaufteilung bietet dagegen für Paare den Vorteil, dass die Detailfragen, wie häusliche und berufliche Aufgaben verteilt werden, quasi durch das Rollenscript vorgegeben werden. Noch dazu kommt, dass viele heutige Eltern bei einer traditionellen Rollenaufteilung auf das Vorbild ihrer eigenen Eltern zurückgreifen können. Folgt man dieser Argumentation wäre es naheliegend, von einer erhöhten Stressbelastung bei solchen Paaren auszugehen, die eine eher egalitäre Verteilung der Aufgaben bevorzugen. Russel (1982) konnte solche Überlegungen in gewisser Weise empirisch bestätigen. Insbesondere Frauen, die mit ihren Partnern eine Zeit lang eine nicht-traditionellen Rollenaufteilung praktiziert hatten und später wieder zur traditionellen Rollenaufteilung zurückkehrten, lehnten eine egalitäre Rollenaufteilung im nachhinein eher ab. Den traditionellen Lebensstil sahen diese Mütter als vorteilhaft an, da er mit weniger Stress verbunden sei und eine Stärkung der Mutter-Kind-Beziehung bewirke.
Neben der Verschärfung der Geschlechtsrollenunterschiede nennt Schmidt-Denter (1996) als einen der gewichtigsten Entwicklungsaufgaben, die sich für Eltern stellen, die Transformation des Narzissmus. Im Unterschied zur Phase des jüngeren Erwachsenenalters, in der sich Wünsche, Träume und Gedanken zur Zukunft auf die eigene Person konzentrieren, verschiebt sich nach der Geburt eines Kindes die Perspektive. Die eigene Sterblichkeit rückt stärker ins Bewusstsein und narzisstische Phantasien und Wünsche in bezug auf die Zukunft werden eher aufs Kind projiziert. Damit geht nach Schmidt-Denter ein Gefühl der stärkeren Eingebundenheit des eigenen Lebenszyklus in die Abfolge der Geberationen einher. Diese empirisch gewonnenen Ergebnisse bestätigen einen Teil der Annahmen zu den drei (von insgesamt acht) Entwicklungsstadien des Lebens, die der Psychoanalytiker Erik H. Erickson (1966/ 1988) in seiner Arbeit „Identität und Lebenszyklus“ beschrieben hat. Diese Entwicklungsstadien werden jeweils mit einem kontrastierenden Begriffspaar charakterisiert, das für das Scheitern oder Bewältigen einer in dieser Phase anstehenden Entwicklungsaufgabe steht:
1. Intimität und Distanzierung vs. Selbstbezogenheit
Am Ende von Kindheit und Jugend steht die Entwicklungsaufgabe an, sich in vertraulichen Beziehungen anderen Menschen mitzuteilen und zu offenbaren, um so zu einer Definition der eigenen Identität zu gelangen. Diese Intimität kann auch auf das andere Geschlecht gerichtet sein, Sexualität ist aber nur ein Teil davon. Auf der anderen Seite gehört Distanzierung im Sinne von Abgrenzung der eigenen Identität von den Interessen und Einflüssen anderer Menschen zu einer gelungenen Identitätsbildung.
2. Generativität vs. Stagnierung
Aus der „wahren Genitalität“ sexueller Partner entspringt der Wunsch, mit vereinter Kraft ein gemeinsames Kind großzuziehen. Dieser Wunsch ist auf die nächste Generation gerichtet (siehe auch die Aussagen von Diamond weiter oben). Werden die generativen Wünsche nicht integriert, kann sich für die Betroffenen ein Gefühl von Stillstand und Verarmung im zwischenmenschlichen Bereich einstellen. Erickson betont, dass Elternschaft per se kein Kriterium dafür sein muss, dass die Aufgaben dieses Entwicklungsstadiums auch tatsächlich gelöst sind. Als Gründe für eine solche Stagnierung („Identitätskrise“) sieht er eine unheilvolle Identifikation mit den eigenen Eltern oder übermäßige Eigenliebe, wenn eine eigene Identität nur mühsam erreicht wurde.
3. Integrität vs. Verzweiflung und Ekel
Diese Entwicklungsphase beinhaltet die Erkenntnis der Einmaligkeit der eigenen Existenz und des eigenen Lebenszyklus und der Menschen, die für die eigene Entwicklung notwendig da sein mussten und durch keine anderen ersetzt werden könnten. Dazu gehört die Aussöhnung mit den eigenen Eltern, das Gefühl der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft aller Menschen und die Integration der Angst vor dem Sterben.
Im Zusammenhang mit dem Konzept von Erickson wurde von Ochse und Plug (1986) ein Fragebogenverfahren entwickelt, das auf die von ihm formulierten Entwicklungsstadien zurückgreift. Dieser Fragebogen wurde im Rahmen einer kulturübergreifenden Studie empirisch überprüft. Danach scheint die Nichtbewältigung einer Entwicklungsaufgabe im Zusammenhang mit der Entstehung einer persönlichen Krise zu stehen.
Neben den Motiven der Vaterschaft und den Konsequenzen, die die Geburt eines Kindes für die Eltern hat, ist es bedeutsam zu betrachten, wie sich die Beziehung zwischen Vätern und deren Kindern auf die Kinder selber auswirkt. Diese Frage erhält bei einer Auffassung von Beziehungen und deren Konsequenzen als transaktionales Geschehen einen besonderen Stellenwert.
2.3.2 Die Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung
In der Nachkriegszeit wuchsen viele Kinder ohne ihre Väter auf, die im Krieg geblieben waren. Diese Abwesenheit spielt für die psychische Entwicklung der Kinder eine Rolle und war bis zum Beginn der 70er Jahre Gegenstand vielfältiger Forschung (Lehr, 1974; Biller, 1981). Alexander Mitscherlich (1972) geht in seinem Buch „Die vaterlose Gesellschaft“ besonders auf die psychologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der kriegsbedingten Vaterabwesenheit ein. In jüngerer Zeit hat sich Schmidbauer (1998) mit dem Thema beschäftigt, welche Folgen die psychische Traumatisierung von Vätern auf deren Kinder hatte, und welche Spuren sie bei deren inzwischen erwachsenen Kindern hinterlassen haben könnte. Studien, die sich mit den Auswirkungen von Vater und Kind beschäftigten, kommen zu dem Ergebnis, dass die Folgen der Trennung für das Kind umso nachteiliger sind, je früher die Trennung erfolgt. Dabei wirkt sich eine berufsbedingte vorübergehende Abwesenheit des Vaters weniger ungünstig auf das Kind aus als eine Trennung oder Scheidung der Eltern (Fthenakis et al., 1982).
Entgegen orthodoxer psychoanalytischer Annahmen, nach der die ödipale Phase (im 4-5. Lebensjahr des Kindes) als der Beginn einer Identifikation mit dem Vater als erster Lebensabschnitt angenommen wird, in dem ein nennenswerter Effekt auf die Entwicklung der Kinder zu erwarten wäre (Schmidt-Denter, 1996), geht die moderne neo-psychoanalytische Forschung davon aus, dass Kinder ihre Väter bereits viel früher zum Erwerb einer stabilen Geschlechtsidentität und als "Gegenpol" zur Mutter brauchen. Die Entwicklungsaufgabe, bei denen nach neueren tiefenpsychologisch orientierten Theorien hier ein anwesender Vater hilfreich sein kann, ist die frühkindliche Triangulierung (Abelin, 1986), die die Ablösung von der Mutter erleichtert. Nach dieser Annahme bildet die Identifikation mit dem Vater für Jungen das Kernstück einer eigenen Geschlechtsidentität, wogegen für das Mädchen vor allem die Interaktion der Mutter des Kindes zum Vater bedeutsam ist. Das Mädchen erlebt die elterliche Beziehung als Hinwendung der Mutter zu einem anderen Säugling (obwohl es der Vater ist), und introjiziert diese „mütterliche Urobjektbeziehung“, das zukünftige Kernstück der weiblichen Geschlechtsidentität (Mertens, Bd. 1; Eine ausführlichere Darstellung findet sich bei Schon, 1995). Eine Störung der Geschlechtsrollenentwicklung von Jungen kann durch die Abwesenheit des Vaters begünstigt sein, was sich auch in einer Überkompensation durch betont männliches Verhalten äußern kann (Biller & Bahm, 1971). Besonders bei Jungen kann es verstärkt zu sozialen Anpassungsstörungen in der Schule und zu aggressivem Verhalten kommen (Santrock, 1974). Allerdings gibt es nach Schmidt-Denter (1996) eine Reihe von Komponenten der familiären Konstellation (z.B. die Anwesenheit anderer männlicher Bezugspersonen, Geschwister, finanzielle Situation, Familienklima vor der Trennung usw.), die sich moderierend auf die negativen Folgen der Trennung vom Vater auswirken können. Auch scheint sich die Interaktion zwischen Müttern und Kindern in einer vaterlosen Familie von der Interaktion einer Familie, in der der Vater anwesend ist, qualitativ zu unterscheiden (Santrock, 1974): In vaterlosen Familien scheinen insbesondere Jungen weniger Zuwendung zu erhalten als in Familien mit Vater.
Neben einer „dichotomen“ Betrachtungsweise, die sich auf die Unterschiede zwischen Familien mit vs. ohne Vater konzentriert und die besonders bis zu den 70er Jahren dominierte, zeichnen neuere Studien ein differenziertes Bild der Vater-Kind-Beziehung. Danach können Kinder, im Gegensatz zur Monotropie-Annahme von Bowlby (1969), bereits ab dem 5. Lebensmonat, zeitgleich mit der Bindung an die Mutter, Bindungen zum Vater aufbauen (Pedersen et al., 1980; Lamb, 1981). Die offensichtlich bei Kindern vorhandene Fähigkeit, schon sehr früh zwischen verschiedenen Personen unterscheiden zu können und Beziehungen zu diesen aufbauen zu können, wird mit dem Begriff der multiplen Bindung (multiple attachment) bezeichnet (Schmidt-Denter, 1984). Daneben ist die Beziehung zwischen Vätern und Kindern in das soziale Netzwerk eingebettet, in dem z.B. auch die Beziehung zu anderen Bezugspersonen, die familiären Interaktionen und die soziale Umgebung eine ausgeprägte oder eher subtile Rolle für die Entwicklung des Kindes spielen. Eine Betrachtung der Familie als komplexes soziales Beziehungsgeflecht wird der neueren gesellschaftlichen Entwicklung gerecht, wonach eine zunehmende Anzahl von Familien von dem „herkömmlichen“ Modell einer Familie aus Vater-Mutter-Kind abweicht (z.B. Alleinerziehende, „Patchwork“-Familien, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften mit Kindern) (vgl. Schmidt, 2002).
Hinsichtlich des Interaktionsstils zu ihren Kindern zeigten sich einige bedeutsame Unterschiede zwischen Vätern und Müttern. Eine Studie von Schmidt-Denter (1984) zeigte, dass Väter einen geringeren Anteil der zur Verfügung stehenden Zeit für Pflegetätigkeiten aufwandten als Mütter. Daneben zeigte sich, dass Väter sowohl häufiger als auch anders mit ihrem Kind spielen als Mütter. Der väterliche Spielstil zeichnet sich nach Clarke-Stewart (1978) dadurch aus, dass er unvorhersehbarer und individueller als der von Müttern ist. Väter übernehmen beim Spiel auch allgemein eine aktivere Rolle in der Interaktion mit dem Kind als Mütter (Schmidt-Denter, 1996). Im Gegensatz zur landläufigen Annahme scheint jedoch der Interaktionsstil der Väter weniger restriktiv als der der Mütter zu sein (Pedersen, 1980). Die Bedeutung des Vaters hat sich offenbar im Laufe der Zeit von seiner Rolle als Autoritätsperson stärker zu einer partnerschaftlichen Gewichtung der Beziehung zum Kind verändert (Schmidt-Denter, 1984). Dabei scheinen Väter nach Ansicht dieses Autors besonders für die emotionale Entwicklung ihrer Kinder eine entscheidende Rolle zu spielen. Nach Biller (1981) ist für Mädchen die Interaktion mit dem Vater für ihre spätere Beziehungen zu anderen Männern von Bedeutung. In einer Studie von Radin (1982) zeigte sich außerdem, dass Kinder, die viel Zeit mit ihren Vätern verbrachten, selbstbestimmter waren als andere Kinder. Es machte dabei jedoch einen Unterschied, ob der Vater sich hinsichtlich seines sozialen Rollenverhaltens eher traditionell-maskulin oder nicht-traditionell verhielt. Nicht-traditionelle Männer zeigten vermehrt kognitive Stimulierung ihrer Töchter und interessierten sich später verstärkt für deren berufliche Laufbahn. Andererseits scheint die Zeitdauer der Anwesenheit im Haus an sich nur ein schlechter Indikator für das Ausmaß der Interaktion zu sein (Lewis, Feiring & Weintraub, 1981). Responsivität und das Herstellen von Kongruenz und Wechselseitigkeit - also Aspekte der Beziehungs qualität - erwiesen sich nach Lewis & Coates (1980) als bedeutsamer für die spätere Entwicklung der Kinder als die reine Häufigkeit der verbalen oder körperlichen Kontaktaufnahme.
Der Übergang zur Elternschaft und die folgende Zeit zu dritt stehen im Zusammenhang mit individuellen Entwicklungsprozessen von Vater, Mutter und Kind, die sich untereinander wechselseitig beeinflussen. Der soziale Ort, an dem sich diese Entwicklung abspielt, ist die Familie. Familien können als spezielle soziale Kleingruppe definiert werden, die besonders durch den gemeinschaftlichen Lebensvollzug gekennzeichnet sind (Schneewind, 1987). Schneewind fasst dabei Familien als intime Beziehungssysteme auf, die sich durch einen mehr oder minder hohen Grad an interpersonaler Involviertheit von anderen Beziehungen unterscheiden. Väter haben dabei nach Seiffge-Krenke und Shulman (1997) die Funktion, Vorbild und Vermittler zu sein, wie in der Familie die beiden Gegensätze Individualität vs. Nähe/ Intimität ausbalanciert werden können und wie damit flexibel umgegangen werden kann. Der Vater spielt nach dieser Ansicht eine wichtige moderierende Rolle im Beziehungsgeflecht der Familie und vermittelt dabei zwischen der „Innenwelt“ der Familie und der „Außenwelt“ der sozialen Umgebung. Bei einer solchen Auffassung der Familie als dynamischen Beziehungssystem, das mit der komplexen Struktur der Außenwelt in Verbindung steht, scheint es naheliegend, auch diese Umgebung der Familie, die deren Rahmenbedingungen konstituiert, näher zu betrachten.
2.4 Ökologie des Lebensraumes und persönliche Nische
Die Ökologie im psychologischen Zusammenhang und auf das System Familie bezogen, umfasst in Anlehnung an Lewin (1951/1963) und Barker (1968) die physikalisch-materielle, räumliche und soziale Umwelt sowie die Gesamtheit aller physikalisch wirksamen Faktoren, mit denen sowohl das Individuum als auch das „System Familie“ in einer aktiven und transaktionalen Wechselbeziehung steht.
Grundlage der phänomenologischen Auffassung der Umwelt bilden die Ideen von Kurt Lewin, der die Konstrukte des "Lebensraumes" und des "Psychologischen Feldes" eingeführt hat. Lewin vertritt die Position, nicht die Realität, wie sie in der sogenannten objektiven Umwelt existiere, sei die Umwelt von größter Bedeutung für das wissenschaftliche Verständnis von Verhalten und Entwicklung, sondern die Realität, wie sie in der psychischen Organisation der Person erscheine (vgl. Bronfenbrenner, 1989).
1. Die strukturelle Komponente des Umweltmodells:
Der psychologische Raum, das psychologische Feld, besteht aus verschiedenen Bereichen. Die Bereiche repräsentieren nicht Räume im buchstäblichen Sinne, sondern psychologische Möglichkeiten von Handlungen und Ereignissen. Einzelne dieser Bereiche stehen für mögliche positive oder negative Ereignisse. Diese bezeichnet Lewin als „Zielregionen“ mit „positiven Valenzen“ bzw. „Abschreckungsregionen“ mit „negativen Valenzen“. Alle übrigen Bereiche repräsentierten instrumentelle Handlungsmöglichkeiten, die an eine Zielregion heranführen oder von einer Abschreckungsregion wegführen. Die Person ist in einem der Bereiche lokalisiert
2. Die dynamische Komponente des Umweltmodells
Die Person ist im psychologischen Feld unterschiedlichen Kräften ausgesetzt, die der psychologischen Bewegung der Person Richtung und Stärke geben. Treffen entgegengerichtete Kräfte von annähernd gleicher Stärke an der Person an, kommt es für die Person zum Konflikt. Richtung heißt dabei die Abfolge einzelner, zweckgerichteter Handlungen. Das Umweltmodell ist auch dazu geeignet, Motivationsprobleme darzustellen und zu klären. Dazu Heckhausen:
„Die heuristische Fruchtbarkeit des Umweltmodells liegt, wenn auch nicht in der Erklärung, so doch in der Bedingungsanalyse von Verhalten in relativ freien Situationen. Wichtige Einflussfaktoren in der Komplexität des psychologischen (d.h., verhaltenswirksamen) Feldes - wie Kräfte, Barrieren, Handlungspfade, Nähe zum Zielbereich, lassen sich aufspüren und ableiten“.(Heckhausen, 1989)
Bronfenbrenner (1977, 1983) hat unter Bezugnahme auf Kurt Lewin und seinem Konzept einer "Ökologie der menschlichen Entwicklung" der ökopsychologischen Familienforschung entscheidende Impulse gegeben. Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich, nach Bronfenbrenner „...mit der fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozess wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den größeren Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind“. (Bronfenbrenner, 1989, S.37)
Bronfenbrenners Modell besteht aus vier Systemen, die sich jeweils konzentrisch umfassen. Im Mittelpunkt steht das Mikrosystem, das durch „ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen [gekennzeichnet ist] die die in Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen Lebensbereich mit dem ihm eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt". Das Mikrosystem ist umgeben vom Mesosystem, das die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen wichtigeren Lebensbereichen (Settings) bezeichnet, an denen die sich entwickelnde Personen aktiv beteiligt ist. Ein „Setting“ ist dabei definiert "als ein Ort mit besonderen physikalischen Eigenschaften, in dem sich die Teilnehmer in spezifischer Weise in spezifischen Rollen [...] und in spezifischen Zeitabschnitten betätigen" (Bronfenbrenner, 1989, S.41). Bezogen auf die Familie versteht Bronfenbrenner hierunter die Beziehungen zwischen dem Mikrosystem Familie und der Familie der beiden Elternteile (Großeltern), sowie zwischen der Kernfamilie und anderen außerfamiliären Settings wie Bekanntenkreis, Schule, Nachbarschaftsbereich. Beide Systeme, Mikrosystem und Mesosystem, werden durch das Exosystem beeinflusst. Damit sind ein oder mehrere Lebensbereiche gemeint, „[...] an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht, oder die davon beeinflusst werden [...]“ (Bronfenbrenner 1989, S.42), wie z.B. der Berufsbereich des Partners.
Alle drei Systeme wiederum sind Bestandteile des Makrosystems, das Normen, Wertvorstellungen und Einstellungen bzw. ihnen zugrundeliegenden Weltanschauungen und Ideologien, kurz die ökonomischen, kulturellen, sozialen, politischen und rechtlichen Gegebenheiten der Gesellschaft beinhaltet (Bronfenbrenner 1989, S.42). Das Makrosystem ist somit das allumfassende System der gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge und setzt so die Rahmenbedingungen z.B. für die Erziehung von Kindern, oder die Bedingungen der beruflichen Arbeit; aber auch für die in einer Gesellschaft üblichen Rollenerwartungen und Einstellungsmuster (vgl. Petzold & Nickel, 1989, S.248). Bronfenbrenner (1989, S.19) definiert Entwicklung im ökologischen Kontext „[...] als dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie die Person die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt“. Menschliche Entwicklung ist weiterhin als ein Prozess zu betrachten, durch den die sich entwickelnde Person erweitert, differenziert und verlässlichere Vorstellungen über ihre Umwelt erwirbt.
Die Entwicklung der Person steht danach also in einer transaktionalen Beziehung zur Umwelt. Dabei gibt es verschiedene Bereiche der Umwelt, die unterschiedliche Aufforderungscharaktere für die Person ("Valenzen") haben. Die Valenz eines Bereiches der Umwelt spielt als Auslöser von Handlungen eine große Rolle (Willi, 1996, S. 44; vgl. Heckhausen, 1989). Der Schweizer Psychotherapeut und Buchautor Jürg Willi hat aufbauend auf den Modellen von Lewin und Bronfenbrenner Überlegungen zur „Ökologischen Psychotherapie“ formuliert. Er nennt den „subjektiven Lebensraum“ (Thomae, 1985) einer Person „persönliche Nische“. Zum Inventar der Nische gehören die Personen sowie die belebten und unbelebten Objekte, mit denen eine Person in einer realen, aktiven Beziehung steht. Daneben ist auch die subjektive Bedeutung, die die Person diesen Beziehungen beimisst, entscheidend für deren psychische Entfaltung und kann nicht alleine anhand der bloßen Häufigkeit und Dauer der Interaktion gemessen werden. Objektiv kann nur untersucht werden, welcher Art die Interaktionen sind und wie die Konfiguration der Nische als Ganzes ist. Als Beispiel für die Notwendigkeit einer Berücksichtigung der subjektiven Bedeutsamkeit nennt Willi die langdauernden Beziehungen zu Familienangehörigen und Freunden, die für die psychische Entfaltung sehr wichtig sind, auch wenn man nur wenig miteinander spricht. (Willi, 1996, S. 28)
Willi begründet die Relevanz dieses Konzeptes für die psychotherapeutische Praxis vor allem mit der Tatsache, dass positives Coping (aktives, agierendes, konfrontierendes Verhalten) eine umfassende und vielschichtige persönliche Nische voraussetzt. Der Verlauf des Copingprozesses wird von der Struktur der Umgebung, der innerpsychischen Voraussetzungen und der transaktionalen Beziehungen zueinander bereits beeinflusst. Als Beispiel nennt Willi die sozial unsichere und verunsichernde Lebenssituation eines Asylbewerbers, der in Anbetracht einer drohenden zwangsweisen Abschiebung unter Stress leidet und krank wird. Für ihn sind die sonst empfohlenen Coping-Strategien, wie sich in die Arbeit stürzen, Kreativität entfalten, eine Reise machen, sich etwas Gutes gönnen, gestaute Aggressionen ausleben oder sich offen auflehnen, nicht realisierbar (Willi, 1996, S. 31). Willi versteht dieses „ökologische Denkweise“ als den zentralen Aspekt einer ökologischen Psychotherapie, da manchmal erst unter Berücksichtigung des individuellen ökologischen Hintergrundes (resp. der persönlichen Nische) die gegeben Belastungssituation eines Patienten für den Therapeuten verständlich und nachvollziehbar wird. Dabei ist es im Zusammenhang des Übergangs zur Elternschaft vor einer Beschäftigung mit spezifischen Gegebenheiten wie Stressoren und Ressourcen zunächst bedeutsam, von welchen zentralen Annahmen zur Stressentstehung und -Bewältigung im allgemeinen ausgegangen werden kann.
2.5 Elternschaft, Stress und Coping
Lewin nahm an, dass nicht die objektiv messbare Realität für das wissenschaftliche Verständnis von Verhalten und Entwicklung bedeutsam ist, sondern die Realität, wie sie in der psychischen Organisation der Person erscheint. Ganz ähnlich geht Lazarus (1966) bei seinem Stressmodell davon aus, dass Stress als eine Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt aufgefasst werden muss. Dabei sei weniger die objektive Stimulusqualität relevant, als die subjektive Interpretation des Ereignisses durch die Person. Schätzt eine Person eine Situation oder ein Ereignis als herausfordernd, bedrohend oder schädigend ein („primary appraisal“) und nimmt sie die durch innere oder äußere Bedingungen gestellten Anforderungen als die eigenen Ressourcen beanspruchend oder übersteigend wahr („secondary appraisal“) entsteht Stress. (Folkman, 1984). Die Bedeutung der Relation zwischen den Anforderungen der Situation und der Fähigkeit der Person, mit diesen Anforderungen ohne zu hohe Kosten oder destruktive Folgen fertig zu werden (Lazarus, 1981, S.213), ist essentieller Bestandteil dieses Stressmodells.
Tabelle 1: Relationales Stressmodell. Lazarus & Folkmann (1987) nach Schedlowski (1996)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Einschätzungen und Bewältigung des Stressors verändern sich im Verlauf der wechselseitigen Auseinandersetzung ständig, wobei die Veränderungen eines Elements zur Veränderung des gesamten Systems führt (Bodenmann, 1995, S. 32). Aufbauend auf diesen grundlegenden Vorannahmen zur Wirkungsweise der Prozesse im Zusammenhang mit belastenden Situationen gibt es einige Ansätze, die jene Stressoren, die auf ein Familiensystem einwirken, näher spezifizieren.
Miller (1983, S. 56-57) unterscheidet in Bezug auf die Eltern zwischen physischen (insbesondere Belastungen durch die Tätigkeiten der Kinderversorgung, die damit verbundene Erschöpfung und Müdigkeit sowie die Veränderungen der partnerschaftlichen Sexualität), psychologischen (vor allem Ängste der Eltern um das Wohl ihrer Kinder) und finanziellen Stressoren (Sorgen um die materielle Situation der Familie). Hill (1958) geht bei der modellhaften Systematisierung von Stressoren von Situationen aus, die eine Veränderung der Familienstruktur zur Folge haben und die im Verlauf mit einem großen Belastungspotential verbunden sein können:
1. Zuwachs: Veränderungen der Familienstruktur durch ein weiteres Familienmitglied (z.B. durch Geburt eines Kindes)
2. Zerstückelung: Veränderung der Familienstruktur durch Verlust eines Familienmitgliedes (z.B. Tod eines Kindes)
3. Verlust von familiärer Moral und Zusammenhalt (z.B. durch Alkoholismus, Substanzmissbrauch)
4. Veränderung der familiären Struktur und Moral (z.B. Verlassen, Scheidung)
Dabei müssen aber solche potentiell belastenden Situation für die Familie nicht zwangsläufig zur Krise werden. Auch Hill vertritt eine transaktionale Auffassung der Wirkung und Bewältigung von Stress: In seinem Familienkrisenmodell (ABCX-Modell) geht Hill davon aus, dass ein Stressor (A-Komponente) erst in Abhängigkeit der der Familie zur Verfügung stehenden Bewältigungsressourcen (B-Komponente) und ihrer Einschätzung (Definition) des Stressereignisses (C-Komponente) zu einer Krise (X-Komponente) führen kann (Hill, 1958, zit. nach Bodenmann, 1995, S. 21). In Zusammenhang mit dem ABCX-Modell nennen Hansen und Hill (1964) verschiedene interne und externe Variablen, die sich auf den Verlauf des Coping-Prozesses auswirken können. Zu den internen Variablen zählen die Autoren z.B. die familiäre Organisation, Familienbeziehungsstrukturen, die Art der familiären Kommunikation, die Güte der affektiven Beziehung zwischen den Familienmitgliedern. Ehezufriedenheit, familieninterne Werte, Attributionen, frühere Stress- und Copingerfahrungen sowie die Partnerschaftsqualität. Externe Variablen beziehen sich z.B. auf die Intensität des Stressreizes, die Unvorhersehbarkeit des Stressors, externe Ressourcen, die Struktur des Sozialnetzes sowie generelle kulturelle, soziokulturelle und ökonomische Rahmenbedingungen (Hansen & Hill, 1964, zit. nach Bodenmann, 1995).
In einer theoretischen Weiterentwicklung des ABCX-Modells ergänzte und präzisierte Burr (1973) die einzelnen Variablen/Faktoren, die den Coping-Prozess beeinflussen. Er nahm hier ein stärkere Differenzierung zwischen famiären Reaktionen auf Stressereignisse (einzelne Stressoren) und familiären Reaktionen auf Krisen (Kumulation mehrerer Stressoren oder ein einzelner, sehr gravierender Stressor: zwingt die Familie zur Neuorientierung und Reorganisation) vor. Nach Burr ist Stress in der Familie charakterisiert durch das Ausmaß an Veränderungen im familiären sozialen System, welche die normale Transformationsmöglichkeit der Familie übersteigen (Burr, 1973, zit. nach Bodenmann, 1995). Besonders dann, wenn eine Anpassungsleistung als besonders schwierig und als die eigenen Möglichkeiten übersteigend wahrgenommen wird, kann Stress entstehen. Eine Folge von Stress kann zum Beispiel Erschöpfung und emotionale Instabilität sein, die sich ihrerseits z.B. auf das Kommunikations- und Streitverhalten auswirken können. Wenn die belastende Situation trotz allen Bewältigungsversuchen anhält, kann das dazu führen, dass sich ein Familienmitglied aufgrund des anhaltenden Stresses aus einem Teil seines Verantwortungsbereiches zurückzieht. Selbst dann, wenn ein solcher „Rückzug“ nur auf einer emotionalen Ebene erfolgt, kann dies weitreichende Konsequenzen für das Familienklima und für alle Familienmitglieder haben. Im folgenden Abschnitt sollen einige Aspekte dieses „Ausbrennens“ infolge einer übermäßigen Belastung beleuchtet werden.
2.5.1 Burnout
Die Begriffe „Burnout“ oder „Burnout-Syndrom“ wurden lange Zeit vor allem im Zusammenhang mit der besonderen Arbeitsbelastung der helfenden Berufe gesehen (Maslach, 1982). Inzwischen werden Burnout-Prozesse auch zunehmend in anderen Berufsgruppen beobachtet. Kennzeichen des Burnout-Syndroms sind emotionale Erschöpfung (Gefühl der Überbeanspruchung und des Ausgelaugtseins), Depersonalisierung (gestörte Beziehung vom Helfer zu dessen Klienten, Reduzierung auf ein Denken in „Fällen“), Einschränkung der persönlichen Leistungsfähigkeit (subjektives Gefühl des Misserfolges und der Inkompetenz) (Zimbardo, S. 575). Nach Weinert, der den Begriff allgemein auf das Feld der Berufsarbeit ausdehnt (a.a.O., S. 249), ist der Burnout-Effekt durch einen sich allmählich entwickelnden Zustand charakterisiert, der mit einer Reihe typischer Einstellungen einhergeht:
- Langeweile: Fehlendes Interesse, die Arbeit zu verrichten
- Unzulänglichkeit: Das Gefühl, nicht fähig zu sein, die gesetzten Ziele zu erreichen
- Unzufriedenheit: Das Gefühl, für die eigenen Bemühungen nicht so belohnt zu werden, wie man glaubt, es verdient zu haben
- Misserfolgsgefühl: Die Neigung, die eigene Leistung unterzubewerten und den Schluss zu ziehen, unwirksam zu sein
- Flucht: Der Wunsch, von allem davonzulaufen
Zimbardo (a.a.O.) betont, dass für die Entstehung des Burnout-Syndroms soziale und situative Faktoren mitberücksichtigt werden müssen. Das Ausmaß der kognitiven, sensorischen und emotionalen Überlastung hängt z.B. davon ab, wie groß die Anzahl der zu erledigenden Aufgaben ist, wie viel Zeit für Aufgaben aufgewendet werden muss, die als belastend erlebt werden, in welchem Verhältnis Arbeitszeit und Freizeit zueinander stehen, ob die tageszeitliche Verteilung der Arbeit ausreichende Nachtruhe ermöglicht und ob durch Arbeitsteilung Möglichkeiten bestehen, sich vorübergehend aus stressgeladenen Situationen zurückzuziehen (Beispiele modifiziert nach Zimbardo, 1995, S. 575). In Anbetracht solcher Überlegungen scheint es berechtigt, die Arbeit in den Bereichen Haushalt, Erziehung und Kinderbetreuung, wie sie in Familien geleistet wird, ebenfalls mit Verfahren zu untersuchen, die im Zusammenhang mit berufsbedingtem Burnout entwickelt wurden. Für die Arbeit im Haushalt und mit Kindern ist ein ähnliches Maß an Verpflichtung und Verbindlichkeit erforderlich, wie sie auch für die Berufsarbeit gilt. Dabei gilt zu beachten, dass das hohe Ausmaß des erlebten Stresses und die als ungenügend wahrgenommenen Bewältigungsressourcen auch davon abhängen, wie stark etwa ein Vater in die Belange seiner Familie involviert ist und wie sehr er sich beispielsweise auch die chronische Belastung seiner Frau „zu Herzen nimmt“.
2.5.2 Empathie
Das Sich-Hineinversetzen in andere wird nach Bischof-Köhler (1985, S.11-15) durch drei entscheidende kognitive Fähigkeiten ermöglicht:
Fähigkeit zu simultaner Identifikation: Ermöglicht es, gleichzeitig gegebene, aber räumlich getrennte Phänomene als Erscheinungsformen derselben Sache erfahren zu können. Damit ist auch die Repräsentation von Wahrnehmungsinhalten in der Vorstellung sowie inneres Probehandeln möglich.
Fähigkeit zur Verdinglichung: Nicht nur konkrete Dinge, sondern auch Eigenschaften, Relationen und Prozesse können mit Dingkategorien belegt werden. Ein Mensch verfügt somit über Begriffe wie "Dauer", "Ursache" oder "Heftigkeit", um innerseelische Vorgänge wie Emotionen kategorisieren und ein Selbstkonzept entwickeln zu können. Für Bischof-Köhler ist „[...] das Selbstkonzept eine Verdinglichung relevanter Erfahrungen mit und über sich selbst, mit der sich das Subjekt simultan identifiziert und das gleichsam das innere Gegenstück zum Spiegelbild darstellt“ (Bischof-Köhler, 1985, S.13).
Fähigkeit zur Dezentrierung: Erlaubt es, einen Sachverhalt von unterschiedlichen Perspektiven beurteilen zu können, ohne den eigenen Standort zu wechseln. Dadurch ist es möglich, bei der Einsicht in die Erfahrungen anderer den individuellen Besonderheiten des anderen Rechnung zu tragen.
„Dezentrierung erlangt [...] soziale Bedeutsamkeit, wenn man sich in die Lage einer anderen Person versetzt, das Zentrum des Erlebens also gleichsam aus dem eigenen Ich heraus in sie hineinverlegt und so eine Situation aus ihrer Perspektive zu sehen vermag“. (Bischof-Köhler, 1985, S. 14)
Diese Art der Dezentrierung bezeichnet Bischof-Köhler (1985) als „Soziale Dezentrierung“ oder „Rollenübernahme“, bzw. „Perspektivübernahme“. Erst dann, wenn diese Übernahme der Perspektive eines anderen unter emotionaler Beteiligung geschieht, kann, nach Ansicht der Autorin, von „Empathie“ gesprochen werden (a.a.O., S.15). Die Qualität der Emotionen, die dabei im Spiel ist, wird nach dieser Definition nicht näher spezifiziert. Im Sprachgebrauch von Eisenberg & Fabes (1990, S.132-133) wird „Empathie“ als unspezifische, emotionale Beteiligung aufgefasst, „Sympathie“ oder „empathische Anteilnahme“ hingegen als eine Reaktion auf Leiden, Not oder Bedürftigkeit des anderen, die Mitleid, Mitgefühl und Bedauern impliziert (zit. nach Enzmann, 1996, S. 79). Als notwendiges Merkmal dieser empathischen Anteilnahme gilt das Bewusstsein darüber, dass es sich bei dem empfundenen Gefühl um das primär empfundene Gefühl eines anderen handelt (Bischof-Köhler,1985, S.16). Ansonsten wird in der Terminologie von „Gefühlsansteckung“ oder „Stimmungsübertragung“ gesprochen. Steht dabei nicht mehr die Befindlichkeit des anderen im Vordergrund, sondern gerät die eigene Befindlichkeit ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wird von empathischen Distress gesprochen. Empathischer Distress kann auch dadurch hervorgerufen werden, „ [...] dass das durch empathische Anteilnahme hervorgerufene Bedürfnis oder die durch die durch die Perspektivübernahme vermittelte Verpflichtung zu helfen, aufgrund äußerer Bedingungen oder wegen ungenügender Kompetenz nicht realisiert werden kann“ (Enzmann, 1996, S. 80). Zusammenfassend werden also Personen, die hinsichtlich ihrer dispositionellen empathischen Reaktionsbereitschaft dazu neigen, von den Gefühlen anderer angesteckt zu werden, eher vom empathischen Distress überwältigt. Personen, denen eher bewusst wird, dass es sich bei den wahrgenommenen Gefühlen um die Gefühle eines anderen handelt, die sich also eher „abgrenzen“ können, sind eher dazu in der Lage, empathisch-anteilnehmend zu reagieren.
Empirische Studien (Eisenberg, Fabes, Murphy et al., 1994) belegen auch den Zusammenhang zwischen solchen dispositionellen Faktoren und prosozialem Verhalten. Personen, die emotional intensiver reagieren und weniger in der Lage sind, ihre Aufmerksamkeit zu steuern und eine Aktivität beizubehalten, auch wenn sie mit aversiven Empfindungen einhergeht, werden weniger empathische Anteilnahme und mehr empathischen Distress erleben. (Enzmann, 1996, S. 81). Im Sinne einer Transaktion zwischen Person und Umwelt bleibt hier anzumerken, dass es in dem o.g. Sinn keinen optimalen dispositionellen "Ausgangspunkt" für empathisches Verhalten geben kann, der unabhängig von der spezifischen Situation und den diese bestimmenden Umgebungsfaktoren ist: Eine Arbeitsumgebung, die den Arbeitenden weitgehende Distanz zu den Menschen ermöglicht, an denen diese Arbeit verrichtet wird, kann die Belastung durch diese Arbeit im Sinne der Gefahren von Burnout verringern (dies ist z.B. im intensivmedizinischen Bereich bei der sog. „Funktionspflege“ realisiert). Auf der anderen Seite kann aber solch eine Reduzierung der zwischenmenschlichen Interaktionen und „Versachlichung“ der Arbeit dazu führen, dass sich die Personen, die Zielobjekte dieser Arbeit sind, in dieser Umgebung nicht mehr wohl fühlen.
In Bezug auf die Thematik dieser Arbeit könnte das Gesagte etwa bedeuten, dass ein Vater, der sich neben einem anstrengenden Berufsalltag zu sehr von der schwierigen Situation zuhause in Anspruch genommen sieht und sich von den Gefühlen (z.B. der Erschöpfung) seiner Frau „anstecken“ lässt („empathischer Distress“), dazu neigen könnte, Überdruss zu entwickeln. Andererseits könnte eine völlige emotionale Distanziertheit den Mann zwar vor der Wahrnehmung einer Belastung bei Frau und Kind bewahren, wäre aber vermutlich kaum einem positivem Familienklima und einer zufriedenstellenden Partnerschaftsqualität zuträglich (wenn sich z.B. die Partnerin in ihren Sorgen und Problemen daheim mit dem Kind nicht ernst genommen und verstanden fühlt). Man könnte jedoch sicher dann eher von einer erfolgreichen Anpassung an die neue Situation sprechen, wenn es dem Mann gelänge „empathisch anteilnehmend“ auf den häuslichen Stress zu reagieren, ohne sich zu sehr im Sinne einer Gefühlsübertragung davon „irritieren“ zu lassen (was z.B. bedeuten könnte, dass er weniger mit einem „schlechten Gewissen“ der Frau gegenüber reagiert, als konkret im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten versucht, seine Frau zu entlasten).
Wie an den vorangehenden Ausführungen deutlich geworden ist, kann sich über Wechselwirkungen und das enge Beziehungsgeflecht zwischen den Familienmitgliedern Stress eines Familienmitgliedes auf die gesamte Familie übertragen. Unter diesem Aspekt ist es besonders bedeutsam, welche Ressourcen eine Familie in einem solchen Fall zur Stressbewältigung bereitstellen kann und ob es ganz besondere Stressoren gibt, die typischerweise die Übergangsphase zur Elternschaft und die Entwicklung des Familiensystems charakterisieren. Bevor jedoch näher auf diese spezifischen Merkmale der Situation junger Eltern eingegangen wird, sollen einige Ergebnisse der Forschung zu „Humor“ als möglicher Bewältigungsressource für Stress dargestellt werden.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832455965
- ISBN (Paperback)
- 9783838655963
- DOI
- 10.3239/9783832455965
- Dateigröße
- 3.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Juli)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- humaor generativität baby-blues empathie erstelternschaft
- Produktsicherheit
- Diplom.de