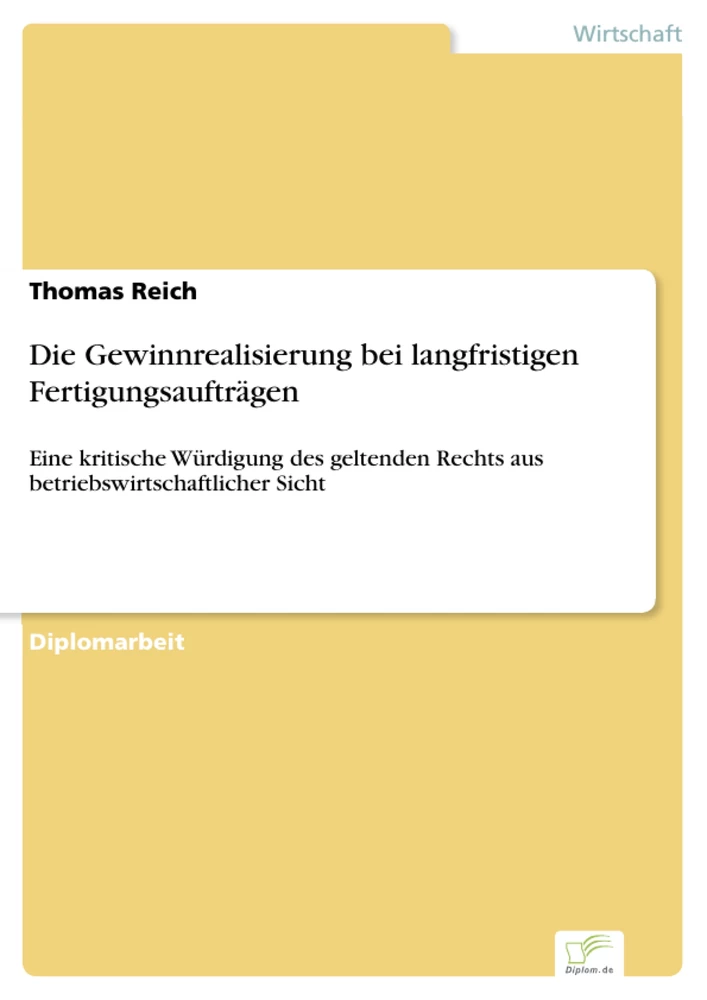Die Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen
Eine kritische Würdigung des geltenden Rechts aus betriebswirtschaftlicher Sicht
©2002
Diplomarbeit
54 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Aufstellung des Jahresabschlusses dient der Erfüllung zweier zentraler Aufgaben: Zum einen soll der Jahresabschluß eine Informationsfunktion erfüllen, indem er über das Vermögen des Unternehmens und den Erfolg der Geschäftstätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr Rechenschaft ablegt; zum anderen dient er im Rahmen der Zahlungsbemessung der Ermittlung des ausschüttbaren Gewinns und der gewinnabhängigen Steuern.
Die Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen wirft folgende Problematik auf: Nach geltendem Recht dürfen Gewinne erst im Jahr der Abnahme des Auftrags realisiert werden, so daß es unter Umständen in den Perioden der Auftragsdurchführung zu einem Verlustausweis kommen kann, obwohl das Unternehmen profitabel arbeitet und ein Gewinn mit der Abnahme zu erwarten ist.
Das hier unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips und des daraus abgeleiteten Realisationsprinzips entstehende Erfolgsbild steht in Divergenz zu den GoB nach § 243 Abs. 1 HGB bzw. zu der speziell für Kapitalgesellschaften in § 264 Abs. 2 HGB kodifizierten Generalnorm, so daß die Informationsfunktion aus betriebswirtschaftlicher Sicht eingeschränkt wird. Die Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auf die einzelnen Rechnungsperioden im Laufe der Auftragsabwicklung stellt somit das zu lösende Problem dar. Zudem besitzt die Thematik der Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen zunehmend praktische Relevanz, da durch den technologischen Fortschritt in einigen Branchen langfristige Projektzeiten zur Regel werden.
Im folgenden gilt es zu erörtern, inwieweit das geltende Recht der Besonderheit der langfristigen Auftragsfertigung gerecht wird und welche alternativen Lösungsansätze aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein aussagekräftigeres Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse in Form einer periodengerechten Erfolgsermittlung ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
AbkürzungsverzeichnisIII
1.Einleitung1
2.Charakterisierung der langfristigen Fertigungsaufträge2
2.1Begriffsbestimmung2
2.2Weitere typische Eigenschaften und Risiken von langfristigen Fertigungsaufträgen3
2.2Die zivilrechtliche Ausgestaltung der langfristigen Fertigungsaufträge4
2.4Langfristige Fertigungsaufträge als schwebende Geschäfte5
3.Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung7
3.1Allgemeine Bedeutung7
3.2Das Realisationsprinzip7
3.2.1Zweck des Realisationsprinzips7
3.2.2Der Realisationszeitpunkt8
4.Die Bedeutung der Generalnorm des […]
Die Aufstellung des Jahresabschlusses dient der Erfüllung zweier zentraler Aufgaben: Zum einen soll der Jahresabschluß eine Informationsfunktion erfüllen, indem er über das Vermögen des Unternehmens und den Erfolg der Geschäftstätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr Rechenschaft ablegt; zum anderen dient er im Rahmen der Zahlungsbemessung der Ermittlung des ausschüttbaren Gewinns und der gewinnabhängigen Steuern.
Die Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen wirft folgende Problematik auf: Nach geltendem Recht dürfen Gewinne erst im Jahr der Abnahme des Auftrags realisiert werden, so daß es unter Umständen in den Perioden der Auftragsdurchführung zu einem Verlustausweis kommen kann, obwohl das Unternehmen profitabel arbeitet und ein Gewinn mit der Abnahme zu erwarten ist.
Das hier unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips und des daraus abgeleiteten Realisationsprinzips entstehende Erfolgsbild steht in Divergenz zu den GoB nach § 243 Abs. 1 HGB bzw. zu der speziell für Kapitalgesellschaften in § 264 Abs. 2 HGB kodifizierten Generalnorm, so daß die Informationsfunktion aus betriebswirtschaftlicher Sicht eingeschränkt wird. Die Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auf die einzelnen Rechnungsperioden im Laufe der Auftragsabwicklung stellt somit das zu lösende Problem dar. Zudem besitzt die Thematik der Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen zunehmend praktische Relevanz, da durch den technologischen Fortschritt in einigen Branchen langfristige Projektzeiten zur Regel werden.
Im folgenden gilt es zu erörtern, inwieweit das geltende Recht der Besonderheit der langfristigen Auftragsfertigung gerecht wird und welche alternativen Lösungsansätze aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein aussagekräftigeres Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse in Form einer periodengerechten Erfolgsermittlung ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
AbkürzungsverzeichnisIII
1.Einleitung1
2.Charakterisierung der langfristigen Fertigungsaufträge2
2.1Begriffsbestimmung2
2.2Weitere typische Eigenschaften und Risiken von langfristigen Fertigungsaufträgen3
2.2Die zivilrechtliche Ausgestaltung der langfristigen Fertigungsaufträge4
2.4Langfristige Fertigungsaufträge als schwebende Geschäfte5
3.Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung7
3.1Allgemeine Bedeutung7
3.2Das Realisationsprinzip7
3.2.1Zweck des Realisationsprinzips7
3.2.2Der Realisationszeitpunkt8
4.Die Bedeutung der Generalnorm des […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5564
Reich, Thomas: Die Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen: Eine kritische
Würdigung des geltenden Rechts aus betriebswirtschaftlicher Sicht / Thomas Reich - Hamburg:
Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Mainz, Universität, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
ID 5565
Lazenby, Robert: Unternehmenskulturen junger Internet-Unternehmen: Eine empirische
Erfassung und Analyse ihres Selbstverständnisses / Robert Lazenby -
Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
I
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis I
Abkürzungsverzeichnis III
1 Einleitung
1
2 Charakterisierung der langfristigen Fertigungsaufträge
2
2.1 Begriffsbestimmung
2
2.2 Weitere typische Eigenschaften und Risiken von langfristigen Fertigungs-
aufträgen
3
2.2 Die zivilrechtliche Ausgestaltung der langfristigen Fertigungsaufträge
4
2.4 Langfristige Fertigungsaufträge als schwebende Geschäfte
5
3 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
7
3.1 Allgemeine Bedeutung
7
3.2 Das Realisationsprinzip
7
3.2.1 Zweck des Realisationsprinzips
7
3.2.2 Der Realisationszeitpunkt
8
4 Die Bedeutung der Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB
10
5 Die Methoden der Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen
und deren Übereinstimmung mit dem geltenden Recht
11
5.1 Die Completed-Contract-Methode
11
5.2 Die Percentage-of-Completion-Methode
12
5.3 Die Aktivierung zu Selbstkosten
14
5.4 Die Teilgewinnrealisierung durch echte Teilabnahmen
17
5.5 Die Teilgewinnrealisierung durch kalkulatorische Teilabrechnungen
20
5.6 Die verbesserte Percentage-of-Completion-Methode
22
6 Die Frage der Zulässigkeit der Teilgewinnrealisierung gemäß § 252 Abs. 2 HGB
24
7 Eine kritische Würdigung des geltenden Rechts aus betriebswirtschaftlicher Sicht
26
7.1 Die Anforderungen an die Methoden der Gewinnrealisierung aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht
26
7.2 Die Bewertung der Methoden der Gewinnrealisierung aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht
27
7.2.1 Die Bewertung der Completed-Contract-Methode
27
7.2.2 Die Bewertung der Percentage-of-Completion-Methode
31
7.2.3 Die Bewertung der Aktivierung zu Selbstkosten
33
II
7.2.4 Die Bewertung der Teilgewinnrealisierung bei echter Teilabnahme
34
7.2.5 Die Bewertung der Teilgewinnrealisierung durch kalkulatorische
Teilabrechnungen
35
7.2.6 Die Bewertung der verbesserten Percentage-of-Completion-Methode
36
8 Abschließende Betrachtung
38
Literaturverzeichnis
IV
III
Abkürzungsverzeichnis
a.A.
anderer
Auffassung
a.a.O.
am
angegebenen
Ort
a.M.
am
Main
Abs.
Absatz
Abt.
Abteilung
AktG
Aktiengesetz
Aufl.
Auflage
Bd.
Band
bearb.
bearbeitet
BGB
Bürgerliches
Gesetzbuch
bzw.
beziehungsweise
d.h.
das
heißt
Diss.
Dissertation
e.V.
eingetragener
Verein
f.
folgende
ff.
fortfolgende
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GoB
Grundsätze
ordnungsmäßiger
Buchführung
GuV
Gewinn-
und
Verlustrechnung
HGB
Handelsgesetzbuch
Hrsg./ hrsg.
Herausgeber/ herausgegeben
IAS
International Accounting Standard(s)
Nr.
Nummer
PublG
Publizitätsgesetz
Rn.
Randnummer
S.
Seite
u.a.
und
andere
US-GAAP
United States-Generally Accepted Accounting Principles
v.
von
Vgl.
vergleiche
z.B.
zum
Beispiel
1
1 Einleitung
Die Aufstellung des Jahresabschlusses dient der Erfüllung zweier
zentraler Aufgaben: Zum einen soll der Jahresabschluß eine Informa-
tionsfunktion erfüllen, indem er über das Vermögen des Unterneh-
mens und den Erfolg der Geschäftstätigkeit im vergangenen Ge-
schäftsjahr Rechenschaft ablegt; zum anderen dient er im Rahmen der
Zahlungsbemessung der Ermittlung des ausschüttbaren Gewinns und
der gewinnabhängigen Steuern.
1
Die Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen wirft
folgende Problematik auf: Nach geltendem Recht dürfen Gewinne erst
im Jahr der Abnahme des Auftrags realisiert werden, so daß es unter
Umständen in den Perioden der Auftragsdurchführung zu einem Ver-
lustausweis kommen kann, obwohl das Unternehmen profitabel arbei-
tet und ein Gewinn mit der Abnahme zu erwarten ist.
2
Das hier unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips und des daraus
abgeleiteten Realisationsprinzips entstehende Erfolgsbild steht in Di-
vergenz zu den GoB nach § 243 Abs. 1 HGB
3
bzw. zu der speziell für
Kapitalgesellschaften in § 264 Abs. 2 HGB kodifizierten General-
norm,
4
so daß die Informationsfunktion aus betriebswirtschaftlicher
Sicht eingeschränkt wird. Die Zuordnung der Aufwendungen und Er-
träge auf die einzelnen Rechnungsperioden im Laufe der Auftragsab-
wicklung stellt somit das zu lösende Problem dar.
5
Zudem besitzt die
Thematik der Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträ-
gen zunehmend praktische Relevanz, da durch den technologischen
1
Vgl. Coenenberg, Adolf Gerhard, Jahresabschluß und Jahresabschlußanalyse, 17.
Aufl., Landsberg/Lech 2000, S. 40.
2
Vgl. Krawitz, Norbert, Die bilanzielle Behandlung der langfristigen Auftragsferti-
gung und Reformüberlegungen unter der Berücksichtigung internationaler Ent-
wicklungen, in: Deutsches Steuerrecht, 35. Jg. (1997), S. 886.
3
Vgl. Freidank, Carl-Christian, Erfolgsrealisierung bei langfristigen Fertigungspro-
zessen, in: Der Betrieb, 42. Jg. (1989), S. 1198.
4
Vgl. Wiechers, Klaus, Gewinnrealisierung bei langfristigen Aufträgen, in: Buch-
haltungsbriefe, Zeitschrift für Buchführung, Bilanz und Kostenrechnung Betrieb
und Rechnungswesen, Sammelwerk, 44. Aufl., Herne/Berlin 1998, Nr. 19 (1996),
Fach 20, S. 541.
5
Vgl. IAS 11, Internationaler Rechnungslegungsgrundsatz des International Accoun-
ting Standards Commitee: Zur Bilanzierung von Fertigungsaufträgen (construction
contracts), in: Die Wirtschaftsprüfung, 32. Jg. (1979). S. 447.
2
Fortschritt in einigen Branchen langfristige Projektzeiten zur Regel
werden.
6
Im folgenden gilt es zu erörtern, inwieweit das geltende Recht der
Besonderheit der langfristigen Auftragsfertigung gerecht wird und
welche alternativen Lösungsansätze aus betriebswirtschaftlicher Sicht
ein aussagekräftigeres Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse in Form
einer periodengerechten Erfolgsermittlung ermöglichen.
2 Charakterisierung der langfristigen Fertigungsaufträge
2.1 Begriffsbestimmung
Der Begriff der Langfristigkeit muß in diesem Kontext relativ gesehen
werden, da es von der Größe und der Leistungsfähigkeit des Unter-
nehmens abhängt, wieviel Zeit es zur Auftragsabwicklung benötigt.
So verfügt ein Großunternehmen über größere Kapazitäten als ein
kleines und benötigt daher auch weniger Zeit für einen Auftrag.
7
Un-
ter langfristiger Auftragsfertigung wird daher ein komplexer Herstel-
lungsprozeß verstanden,
8
der nach herrschender Meinung über zwei
oder mehrere Rechnungsperioden andauert, damit sich ein Unter-
schied gegenüber den sich bei üblicher Fertigung entstehenden unfer-
tigen Erzeugnissen und Leistungen ergibt.
9
Die Auftragsfertigung stellt dabei die Erstellung eines oder mehrerer
gleichartiger Einzelobjekte nach Auftragserteilung durch einen Kun-
den dar, d.h. es liegt Einzelfertigung vor.
10
Langfristige Fertigungsauf-
träge können sich sowohl auf die Produktion von Sachleistungen als
auch auf die Erbringung von Dienstleistungen beziehen. Als Beispiele
sind der Industrieanlagen- und Großmaschinenbau, der Schiffs- und
6
Vgl. Freidank, Carl-Christian, a.a.O., S. 1197.
7
Vgl. Bodarwé, Ernst, Bewertung und Darstellung nicht abgerechneter Leistungen
bei ,,langfristiger Fertigung" im Jahresabschluß, in: Der Betrieb, 24. Jg. (1971), S.
1973.
8
Vgl. Leuschner, Carl-Friedrich, Gewinnrealisierung bei langfristiger Fertigung, in:
Rechenschaftslegung im Wandel, Festschrift für Wolfgang Dieter Budde, hrsg. v.
Gerhart Förschle u.a., München 1995, S. 378.
9
Vgl. Schmidt, Wilfried, und Volker Meyer, Bilanzausweis der Leistungen bei lang-
fristiger Fertigung (I), in: Der Betrieb, 28. Jg. (1975), S. 68.
10
Vgl. Stewing, Clemens, Bilanzierung bei langfristiger Auftragsfertigung, in: Der
Betriebs-Berater, 45. Jg. (1990), S. 100.
3
Flugzeugbau bzw. im Dienstleistungssektor die Softwareentwicklung
zu nennen.
11
2.2 Weitere typische Eigenschaften und Risiken von langfristigen
Fertigungsaufträgen
Die Durchführung von langfristigen Fertigungsaufträgen konfrontiert
die Unternehmen aufgrund bestimmter Eigenschaften mit einer Viel-
zahl von Risiken, von denen im folgenden die wichtigsten kurz vorge-
stellt werden: Ein wesentliches Merkmal bildet die Höhe der vorver-
traglichen Kosten, die bei langfristigen Fertigungsaufträgen bereits
vor dem Fertigungsbeginn einen erheblichen Anteil der Gesamtkosten
ausmachen können.
12
Zudem wird die Situation für die Unternehmen
dadurch erschwert, daß sich diese einer niedrigen Abschlußquote bei
den Vertragsverhandlungen gegenübersehen, wodurch ein beträchtli-
ches Angebotsrisiko entsteht.
13
Da im allgemeinen mit der Fertigung
erst begonnen wird, wenn der Kunde vertraglich gebunden ist, besteht
für Langfristfertiger kein Absatzrisiko.
14
Ein Kalkulationsrisiko ergibt sich aufgrund der Merkmale der Indivi-
dualität und Einmaligkeit, die aus der speziell auf einen Kunden zuge-
schnittenen Lösung resultieren.
15
So ist es im Rahmen der Preisbil-
dung nicht möglich, Preise aus einem Markt abzuleiten. Die einzige
Möglichkeit besteht in der Ableitung aus der eigenen Kostenrechnung,
11
Vgl. Richter, Martin, Gewinnrealisierung bei langfristiger Fertigung, in: US-
amerikanische Rechnungslegung, Grundlagen und Vergleiche mit dem deutschen
Recht, hrsg. v. Wolfgang Ballwieser, Stuttgart 1995, S. 128.
12
Vgl. Buhleier, Claus, Harmonisierung der Rechnungslegung bei langfristiger
Auftragsfertigung: Perspektiven für die Bilanzierung in Deutschland und Öster-
reich, Diss. Wien 1996, Wiesbaden 1997, S. 31.
13
Vgl. Lindeiner-Wildau, Klaus, Risiken und Risikomanagement im Anlagenbau,
in: Langfristiges Anlagengeschäft - Risiko-Management und Controlling, hrsg. v.
Joachim Funk und Gert Lassmann, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche For-
schung, Sonderheft Nr. 20, Düsseldorf 1986, S. 22 f.
14
Vgl. Leffson, Ulrich, und Andreas Schmid, Die Erfassungs- und Bewertungsprin-
zipien des Handelsrechts, in: Handbuch des Jahresabschlusses in Einzeldarstel-
lungen, hrsg. v. Klaus von Wysocki und Joachim Schulze-Osterloh, Köln 1993,
1. Bd., Abt. I/7, Rn. 65.
15
Vgl. Lindeiner-Wildau, Klaus, a.a.O., S. 25.
4
die zumeist auf unsicheren Erfahrungen beruht.
16
Ein weiteres typi-
sches Risiko stellt das technische Risiko dar. Dieses ist darauf zurück-
zuführen, daß der Anbieter die vertraglich zugesicherten Eigenschaf-
ten nicht einhalten kann und zusätzliche Kosten entstehen.
17
Ferner begeben sich die Auftragnehmer in eine wirtschaftliche Ab-
hängigkeit von dem Besteller, da dieser durch die Einzigartigkeit des
Auftrags die Fertigung stark beeinflussen kann.
18
Eine andere Eigen-
schaft besteht in der hohen Wertigkeit der einzelnen Aufträge, die
zugleich für verschieden große Unternehmen ein unterschiedlich star-
kes Existenzrisiko mit sich bringt. Auch der Auftragseingang, der eng
mit der hohen Wertigkeit verbunden ist, unterliegt bei langfristiger
Auftragsfertigung im Zeitablauf erheblichen Schwankungen, so daß
ein Risiko bei der Kapazitätsauslastung entstehen kann.
19
Außerdem steht der Auftragsfertiger einem Zahlungsrisiko gegenüber,
wenn der Abnehmer der Zahlung nicht termingerecht oder betragsge-
recht nachkommt. Zusätzlich kann ein Währungsrisiko bestehen, falls
das Geschäft in Fremdwährung abgeschlossen wird.
20
Zuletzt sei er-
wähnt, daß sich die Unternehmen außer wirtschaftlichen auch politi-
schen und steuerlichen Risiken gegenübersehen.
21
2.3 Die zivilrechtliche Ausgestaltung der langfristigen Fertigungs-
aufträge
Langfristige Fertigungsaufträge basieren grundsätzlich auf Werkver-
trägen nach § 631 BGB oder auf Werklieferungsverträgen nach § 651
BGB. Das Ziel dieser Verträge ist jeweils die Erzielung eines Erfolgs
auf Herstellerseite.
22
Beim Werkvertrag wird das Material vom Auf-
16
Vgl. Hay, Paul Helmut, Planungs- und Kontrollrechnung im Anlagengeschäft, in:
Langfristiges Anlagengeschäft - Risiko-Management und Controlling, hrsg. v.
Joachim Funk und Gert Lassmann, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche For-
schung, Sonderheft Nr. 20, Düsseldorf 1986, S. 90.
17
Vgl. Lindeiner-Wildau, Klaus, a.a.O., S. 26.
18
Vgl. Stewing, Clemens, a.a.O., S. 102.
19
Vgl. Richter, Martin, a.a.O., S. 130 f.
20
Vgl. Buhleier, Claus, a.a.O., S. 38.
21
Vgl. Lindeiner-Wildau, Klaus, a.a.O., S. 26.
22
Vgl. Marx, Franz Jürgen, und Christoph Löffler, Bilanzierung der langfristigen
Auftragsfertigung, in: Beck'sches Handbuch der Rechnungslegung, hrsg. v. Ed-
gar Castan u.a., München 2000, Bd. II, Stand: Juli 2000, B 700 Rn. 7.
5
traggeber zur Verfügung gestellt, so daß lediglich die Produktion Ver-
tragsgegenstand ist. Beim Werklieferungsvertrag verpflichtet sich der
Auftragnehmer, den Gegenstand mit von ihm selbst beschafften Mate-
rial herzustellen und ihn an den Auftraggeber zu übereignen.
23
Einen wesentlichen Zeitpunkt stellt die Abnahme dar, da der Auftrag-
nehmer sowohl nach § 644 BGB bis zur Abnahme durch den Auftrag-
geber die Gefahr für das Gesamtwerk trägt, als auch die Vergütung
nach § 641 BGB mit der Abnahme fällig ist.
24
Der Besteller besitzt
nur dann das Recht, sich gemäß § 640 Abs. 1 BGB der Abnahme zu
entziehen, wenn die Beschaffenheit des Werks eine Abnahme nicht
zuläßt.
25
Mit dem Übergang der Preisgefahr entzieht sich der Auftrag-
nehmer der Haftung für jegliche Risiken der Vertragsausführung. Zu-
dem behält er den Anspruch auf die Gegenleistung, auch wenn der
Leistungsgegenstand unvorhergesehenen Schaden nimmt.
26
Hinsichtlich der vereinbarten Vergütung werden allgemein zwei
Grundtypen unterschieden: Entweder schließen die Vertragspartner
Festpreisverträge ab, bei denen der Hersteller einem vertraglich fest-
gelegten Preis zustimmt oder die Vergütung beruht auf ,,cost-plus"-
Verträgen, bei denen dem Hersteller die vertraglich festgelegten Ko-
sten zuzüglich eines Prozentsatzes dieser Kosten oder eines Festprei-
ses erstattet werden.
27
2.4 Langfristige Fertigungsaufträge als schwebende Geschäfte
Langfristige Fertigungsaufträge sind unter der Problematik von
schwebenden Geschäften zu erfassen.
28
Diese werden als schwebende
Geschäfte bezeichnet, da es sich um zweiseitig verpflichtend ge-
23
Vgl. Woerner, Lothar, Grundsatzfragen zur Bilanzierung schwebender Geschäfte,
in: Finanz-Rundschau, 39. Jg. (1984), S. 494 f.
24
Vgl. Stewing, Clemens, a.a.O., S. 100 f.
25
Vgl. Woerner, Lothar, Die Gewinnrealisierung bei schwebenden Geschäften, in:
Der Betriebs-Berater, 43. Jg. (1988), S. 776.
26
Vgl. Leuschner, Carl-Friedrich, Gewinnrealisierung bei langfristiger Fertigung,
in: Rechenschaftslegung im Wandel, Festschrift für Wolfgang Dieter Budde,
hrsg. v. Gerhart Förschle u.a., München 1995, S. 381.
27
Vgl. IAS 11, a.a.O., S. 447.
28
Vgl. Jung, Alwin, Erfolgsrealisation im industriellen Anlagengeschäft: ein Ansatz
zur Operationalisierung einer zusätzlichen Angabepflicht, in: Beiträge zum Rech-
nungs-, Finanz- und Revisionswesen, Bd. 28, hrsg. v. Adolf Gerhard Coenenberg
u.a., Diss. Frankfurt 1989, Frankfurt a.M., Bern, New York, Paris 1990, S. 16.
6
schlossene Verträge handelt, bei denen die Vertragspartner ihre Ver-
pflichtungen noch nicht vollständig erfüllt haben.
29
Der Schwebezu-
stand beginnt mit der Unterzeichnung des Vertrags und endet mit der
Abnahme durch den Auftraggeber.
30
Obwohl durch den Vertrag Rech-
te und Pflichten entstanden sind, wird der Vertrag bilanziell nicht er-
faßt.
31
Zu einem bilanziellen Ausweis kommt es erst, wenn einer der
Vertragsparteien Aufwendungen entstanden sind.
32
Die bilanzielle Nichtberücksichtigung von aus schwebenden Geschäf-
ten resultierenden Ansprüchen und Verpflichtungen wird mit dem
Vorsichtsprinzip begründet, da schwebende Geschäfte ein erhebliches
Risiko in sich bergen und eine Aktivierung der Forderungen aus dem
schwebenden Geschäft gegen das Realisationsprinzip verstößt.
33
Zu-
dem wird die aus diesem Geschäft resultierende Verbindlichkeit durch
die Forderung kompensiert, und kommt daher keiner wirtschaftlichen
Belastung gleich.
34
Die in der älteren Literatur gegen die Bilanzie-
rungsfähigkeit angebrachte Begründung, daß sich Ansprüche und
Verpflichtungen in gleicher Höhe gegenüberstehen, kann nicht gefolgt
werden, da sich diese Gleichwertigkeit erst durch das Realisations-
prinzip ergibt.
35
Im Gegensatz zu in schwebenden Geschäften vorhandenen Gewinnen
sind Verluste nach dem Imparitätsprinzip durch Rückstellungsbildung
nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB zu berücksichtigen, wenn sich diese
mit genügender Sicherheit abzeichnen.
36
29
Vgl. Baetge, Jörg/ Hans-Jürgen Kirsch und Stefan Thiele, Bilanzen, 5. Aufl.,
Düsseldorf 2001, S. 375.
30
Vgl. Schmidt, Wilfried, und Volker Meyer, a.a.O., S. 69.
31
Vgl. Stewing, Clemens, a.a.O., S. 101.
32
Vgl. Ebenda, a.a.O., S. 106.
33
Vgl. Woerner, Lothar, Gewinnrealisierung, a.a.O., S. 771.
34
Vgl. Baetge, Jörg/ Hans-Jürgen Kirsch und Stefan Thiele, a.a.O., S. 375.
35
Vgl. Woerner, Lothar, Gewinnrealisierung, a.a.O., S. 771.
36
Vgl. Schildbach, Thomas, Der handelsrechtliche Jahresabschluß, 6. Aufl., Berlin
2000, S. 179.
7
3 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
3.1 Allgemeine Bedeutung
Die GoB sind allgemein anerkannte Normen, die zum Teil schriftlich
in das Gesetz aufgenommen wurden, ohne daß das Gesetz allerdings
den Begriff ,,GoB" definiert. Es handelt sich bei diesen Grundsätzen
um einen unbestimmten Rechtsbegriff, da sie bei Einzelfällen zur
Anwendung kommen, bei denen das Gesetz keine Lösung vorgibt
oder Auslegungsschwierigkeiten auftreten.
37
Alle Kaufleute sind nach
§ 243 Abs. 1 HGB veranlaßt, den Jahresabschluß nach den GoB im
Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit aufzustellen.
38
Speziell
für Kapitalgesellschaften beinhaltet die Generalnorm nach § 264 Abs.
2 HGB die GoB, nach der der Jahresabschluß unter Beachtung der
GoB ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Lage vermitteln soll.
39
Grundsätzlich geht der Gesetzgeber davon aus, daß bei Einhaltung
dieser Grundsätze der Zweck der Rechnungslegung und damit die
Ziele des Jahresabschlusses erfüllt werden.
40
3.2 Das Realisationsprinzip
3.2.1 Zweck des Realisationsprinzips
Das Realisationsprinzip ist Bestandteil der GoB und wird im Gesetz
durch den § 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB konkretisiert. Es be-
sagt, daß Gewinne nur dann berücksichtigt werden dürfen, wenn sie
am Abschlußstichtag realisiert sind.
41
Ein Gewinn ist dann entstanden,
wenn die realisierten Erträge die dafür benötigten Aufwendungen ü-
bersteigen.
42
Der Zweck besteht in der Verhinderung des Ausweises
37
Vgl. Coenenberg, Adolf Gerhard, a.a.O., S. 59.
38
Vgl. Kriebel, Hugo-Manfred, Gewinnrealisierung bei langfristigen freiberuflichen
Leistungen, in: Bilanzierung und Besteuerung der Unternehmen, Das Handels-
und Steuerrecht auf dem Weg ins 21. Jahrhundert, Festschrift für Herbert Brönner
zum 70. Geburtstag, hrsg. v. Jens Poll, Stuttgart 2000, S. 216.
39
Vgl. Selchert, Friedrich Wilhelm, Das Realisationsprinzip Teilgewinnrealisie-
rung bei langfristiger Auftragsfertigung, in: Der Betrieb, 43. Jg. (1990), S. 797.
40
Vgl. Döllerer, Georg, Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung, deren Entste-
hung und Ermittlung, in: Der Betriebs-Berater, 14. Jg. (1959), S. 1220.
41
Vgl. Leffson, Ulrich, Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, 7. Aufl.,
Düsseldorf 1987, S. 247.
42
Vgl. Selchert, Friedrich Wilhelm, in: Küting, Karlheinz und Claus-Peter Weber
(Hrsg.), Handbuch der Rechnungslegung: Kommentar zur Bilanzierung und Prü-
fung, 4. Aufl., Stuttgart 1995, Bd. I a, § 252 Rn. 82.
8
und der Ausschüttung unrealisierter Gewinne und in der Gewährlei-
stung der Erfolgsneutralität von Beschaffungsvorgängen.
43
Aus diesem Zweck können daher zwei wesentliche Punkte abgeleitet
werden: Einerseits bestimmt das Realisationsprinzip den Zeitpunkt,
wann ein Ertrag aus einem Erzeugnis oder einer Leistung vereinnahmt
werden darf, andererseits mit welchem Wert ein noch nicht realisiertes
Erzeugnis oder eine nicht realisierte Leistung in der Bilanz angesetzt
wird.
44
Durch den zweiten Aspekt umfaßt das Realisationsprinzip
auch das in § 253 Abs. 1 HGB kodifizierte Anschaffungskostenprin-
zip. Es besagt, daß beschaffte oder selbst erstellte Erzeugnisse oder
Leistungen bis zum jeweiligen Umsatzakt, d.h. bis die Güter oder
Leistungen den Absatzmarkt erreicht haben, mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten zu bewerten sind, so daß Wertsteigerungen
am ruhenden Vermögen nicht zu einem Gewinn führen können.
45
Das Realisationsprinzip dient somit der Erhaltung des Nominalkapi-
tals und dem Gläubigerschutz.
46
3.2.2 Der Realisationszeitpunkt
Das Gesetz benennt keinen Realisationszeitpunkt, so daß der Zeit-
punkt der Gewinnrealisierung durch die GoB festgelegt wird. Diese
machen den Zeitpunkt vom zugrunde liegenden Rechtsgeschäft ab-
hängig,
47
wobei hier ausschließlich auf Lieferungs- und Leistungs-
geschäfte eingegangen werden soll. Grundsätzlich soll der Realisa-
tionszeitpunkt dem Vorsichtsprinzip entsprechen und eine periodenge-
rechte Erfolgsermittlung ermöglichen.
48
Die Problematik hinsichtlich
des Realisationszeitpunktes tritt bei Leistungsbeziehungen auf, die
über einen längeren Zeitraum andauern, da hier der Vertragsabschluß,
43
Vgl. Leffson, Ulrich, GoB, a.a.O., S. 251.
44
Vgl. Coenenberg, Adolf Gerhard, a.a.O., S. 63.
45
Vgl. Wiechers, Klaus, a.a.O., S. 542 f.
46
Vgl. Döll, Brigitte, Bilanzierung langfristiger Fertigung: eine theoretische und
empirische Untersuchung aktienrechtlicher Rechnungslegung, in: Beiträge zum
Rechnungs-, Finanz- und Revisionswesen, Bd. 9, hrsg. v. Adolf Gerhard Coenen-
berg, Frankfurt a.M., Bern, New York 1984, S. 55.
47
Vgl. Selchert, Friedrich Wilhelm, Realisationsprinzip, a.a.O., § 252 Rn. 82.
48
Vgl. Freidank, Carl-Friedrich, a.a.O., S. 1198.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832455644
- ISBN (Paperback)
- 9783838655642
- DOI
- 10.3239/9783832455644
- Dateigröße
- 632 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Juni)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- rechnungslegung aufgaben jahresabschlusses informationsfunktion zahlungsbemessungsfunktion
- Produktsicherheit
- Diplom.de