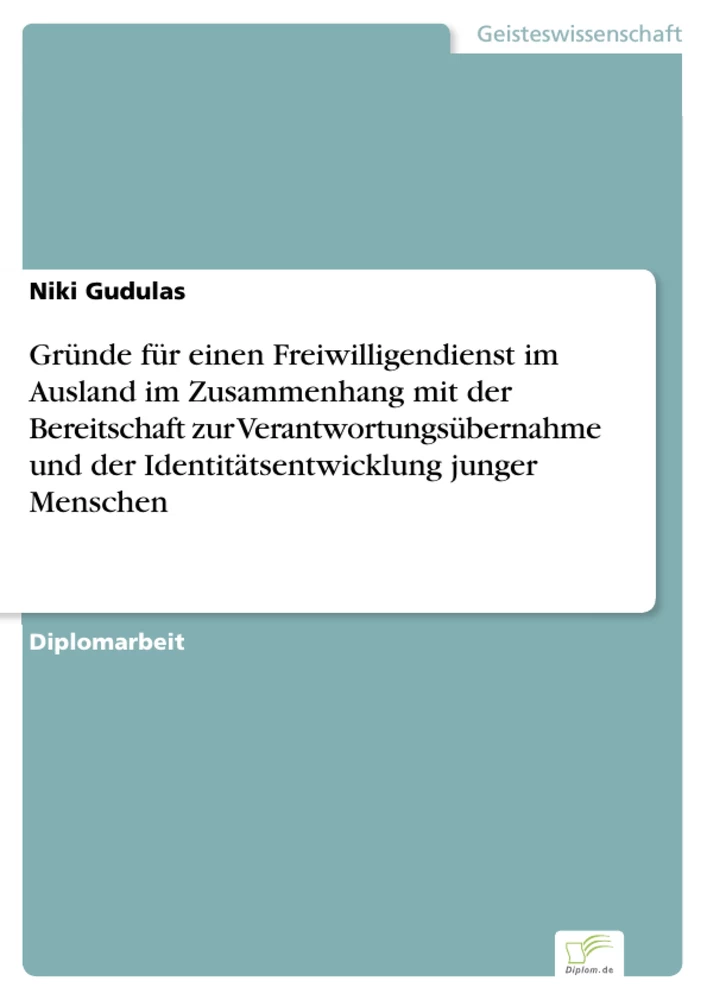Gründe für einen Freiwilligendienst im Ausland im Zusammenhang mit der Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und der Identitätsentwicklung junger Menschen
©2002
Diplomarbeit
117 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die Darstellung der Ergebnisse einer Befragung von 164 Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren, welche im Zeitraum von April bis Juni 2001 in Dresden und Berlin durchgeführt wurde. 99 Teilnehmer hatten sich für einen freiwilligen sozialen Dienst im Ausland beworben, 65 gehörten zur Gruppe der Nichtbewerber. Thema dieser Befragung waren Motive, die für oder gegen einen sozialen Dienst im Ausland sprechen, im Zusammenhang mit der Bereitschaft, soziale Verantwortung zu übernehmen und im Zusammenhang mit der Identitätsentwicklung junger Menschen.
Zur Erfassung der Beweggründe, die zu einer Bewerbung für einen sozialen Dienst im Ausland führen können, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Fragebogen entwickelt. Die Bereitschaft, Verantwortung für benachteiligte Menschen zu übernehmen, wurde mit einem Instrumentarium von Krettenauer, aufbauend auf dem Existentielle Schuld Inventar von Montada, Dalbert, Reichle und Schmitt, erhoben, die Erfassung des Identitätsstatus erfolgte unter Verwendung eines Fragebogens von Adams.
Die empirischen Befunde zeigen, daß sich Bewerber für einen sozialen Dienst stärker als Nichtbewerber aus ihren Idealen heraus engagieren wollen und daß sie einen stärkeren Wunsch angeben, ins Ausland zu gehen. Außerdem wollen Bewerber stärker als Nichtbewerber das Berufsfeld Sozialarbeit erkunden. Die Bewerber für einen sozialen Dienst im Ausland zeigen deutlicher als Altersgenossen eine Bereitschaft, soziale Verantwortung zu übernehmen. In der Bewerbergruppe wurde häufiger als in der Vergleichsgruppe der Identitätsstatus Moratorium gefunden, in der Vergleichsgruppe hingegen häufiger diffuse und übernommene Identität.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
VERZEICHNIS DER TABELLEN5
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN7
ZUSAMMENFASSUNG8
EINFÜHRUNG9
1.ENTWICKLUNGSAUFGABEN IN DER ADOLESZENZ11
2.MOTIVE FÜR EINEN FREIWILLIGENDIENST13
3.ÜBERNAHME SOZIALER VERANTWORTUNG19
4.ENTWICKLUNG VON IDENTITÄT23
5.EXKURS: FREIWILLIGES ENGAGEMENT VON JUNGEN MENSCHEN - EINBETTUNG IN GESELLSCHAFTLICHE GEGEBENHEITEN28
5.1BEGRIFFSBESTIMMUNG FREIWILLIGENDIENST28
5.2FREIWILLIGENTÄTIGKEIT IN DEUTSCHLAND29
5.3ORGANISATIONSFORMEN EINES FREIWILLIGEN JAHRES IM AUSLAND30
6.FRAGESTELLUNGEN33
7.EMPIRISCHE UMSETZUNG35
7.1STICHPROBE35
7.1.1Bewerber für einen Dienst35
7.1.2Vergleichsgruppe37
7.1.3Vergleich der beiden Stichproben39
7.2FRAGEBOGEN41
7.2.1Motivteil41
7.2.2Übernahme […]
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die Darstellung der Ergebnisse einer Befragung von 164 Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren, welche im Zeitraum von April bis Juni 2001 in Dresden und Berlin durchgeführt wurde. 99 Teilnehmer hatten sich für einen freiwilligen sozialen Dienst im Ausland beworben, 65 gehörten zur Gruppe der Nichtbewerber. Thema dieser Befragung waren Motive, die für oder gegen einen sozialen Dienst im Ausland sprechen, im Zusammenhang mit der Bereitschaft, soziale Verantwortung zu übernehmen und im Zusammenhang mit der Identitätsentwicklung junger Menschen.
Zur Erfassung der Beweggründe, die zu einer Bewerbung für einen sozialen Dienst im Ausland führen können, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Fragebogen entwickelt. Die Bereitschaft, Verantwortung für benachteiligte Menschen zu übernehmen, wurde mit einem Instrumentarium von Krettenauer, aufbauend auf dem Existentielle Schuld Inventar von Montada, Dalbert, Reichle und Schmitt, erhoben, die Erfassung des Identitätsstatus erfolgte unter Verwendung eines Fragebogens von Adams.
Die empirischen Befunde zeigen, daß sich Bewerber für einen sozialen Dienst stärker als Nichtbewerber aus ihren Idealen heraus engagieren wollen und daß sie einen stärkeren Wunsch angeben, ins Ausland zu gehen. Außerdem wollen Bewerber stärker als Nichtbewerber das Berufsfeld Sozialarbeit erkunden. Die Bewerber für einen sozialen Dienst im Ausland zeigen deutlicher als Altersgenossen eine Bereitschaft, soziale Verantwortung zu übernehmen. In der Bewerbergruppe wurde häufiger als in der Vergleichsgruppe der Identitätsstatus Moratorium gefunden, in der Vergleichsgruppe hingegen häufiger diffuse und übernommene Identität.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
VERZEICHNIS DER TABELLEN5
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN7
ZUSAMMENFASSUNG8
EINFÜHRUNG9
1.ENTWICKLUNGSAUFGABEN IN DER ADOLESZENZ11
2.MOTIVE FÜR EINEN FREIWILLIGENDIENST13
3.ÜBERNAHME SOZIALER VERANTWORTUNG19
4.ENTWICKLUNG VON IDENTITÄT23
5.EXKURS: FREIWILLIGES ENGAGEMENT VON JUNGEN MENSCHEN - EINBETTUNG IN GESELLSCHAFTLICHE GEGEBENHEITEN28
5.1BEGRIFFSBESTIMMUNG FREIWILLIGENDIENST28
5.2FREIWILLIGENTÄTIGKEIT IN DEUTSCHLAND29
5.3ORGANISATIONSFORMEN EINES FREIWILLIGEN JAHRES IM AUSLAND30
6.FRAGESTELLUNGEN33
7.EMPIRISCHE UMSETZUNG35
7.1STICHPROBE35
7.1.1Bewerber für einen Dienst35
7.1.2Vergleichsgruppe37
7.1.3Vergleich der beiden Stichproben39
7.2FRAGEBOGEN41
7.2.1Motivteil41
7.2.2Übernahme […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5549
Gundulas, Niki: Gründe für einen Freiwilligendienst im Ausland im Zusammenhang mit der
Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und der Identitätsentwicklung junger Menschen /
Niki Gundulas - Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Berlin, Universität, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
3
Inhaltsverzeichnis
VERZEICHNIS DER TABELLEN ... 5
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN ... 7
ZUSAMMENFASSUNG... 8
EINFÜHRUNG... 9
1. ENTWICKLUNGSAUFGABEN IN DER ADOLESZENZ ... 11
2. MOTIVE FÜR EINEN FREIWILLIGENDIENST ... 13
3. ÜBERNAHME SOZIALER VERANTWORTUNG... 19
4. ENTWICKLUNG VON IDENTITÄT... 23
5. EXKURS: FREIWILLIGES ENGAGEMENT VON JUNGEN MENSCHEN -
EINBETTUNG IN GESELLSCHAFTLICHE GEGEBENHEITEN... 28
5.1 B
EGRIFFSBESTIMMUNG
F
REIWILLIGENDIENST
... 28
5.2 F
REIWILLIGENTÄTIGKEIT IN
D
EUTSCHLAND
... 29
5.3 O
RGANISATIONSFORMEN EINES FREIWILLIGEN
J
AHRES IM
A
USLAND
... 30
6. FRAGESTELLUNGEN... 33
7. EMPIRISCHE UMSETZUNG... 35
7.1. S
TICHPROBE
... 35
7.1.1. Bewerber für einen Dienst ... 35
7.1.2 Vergleichsgruppe ... 37
7.1.3 Vergleich der beiden Stichproben... 39
7.2. F
RAGEBOGEN
... 41
7.2.1 Motivteil... 41
4
7.2.2 Übernahme sozialer Verantwortung ... 45
7.2.3 Identitätsstatus ... 49
7.2.4 Fragebogen für die Vergleichsgruppe... 50
8. DATENANALYSE UND ERGEBNISSE ... 51
8.1. V
ORANALYSEN
... 51
8.1.1 Faktorenanalyse zu Motiven... 51
8.1.2 Bildung der Motivskalen ... 53
8.1.3 Prüfung der Motivskalen ... 56
8.2 E
RGEBNISSE
... 57
8.2.1 Motive für einen Freiwilligendienst im Ausland... 57
8.2.1.1 Unterschiede zwischen der Bewerber- und der Vergleichsgruppe ... 57
8.2.1.2 Geschlechtsunterschiede in der Bewerbergruppe... 60
8.2.1.3 Gründe, die gegen einen sozialen Dienst im Ausland sprechen... 62
8.2.2 Übernahme sozialer Verantwortung in der Bewerber- und der
Vergleichsgruppe ... 63
8.2.3 Identitätsstatus in der Bewerber- und der Vergleichsgruppe... 64
8.2.3.1 Summenskalen zum Identitätsstatus... 64
8.2.3.2 Typenbildung zum Identitätsstatus... 67
8.2.4 Stützung der Motivationsfaktoren ... 72
8.2.4.1 Idealismus und soziale Verantwortungsübernahme ... 72
8.2.4.2 Selbstfindung und Moratorium... 72
8.2.5 Zusammenhänge zum Geburtsland... 73
8.2.6 Multiple Analyse zur simultanen Erfassung des Beitrags mehrerer Variablen
zur Unterscheidung von Bewerber- und Vergleichsgruppe... 74
9. ZUSAMMENFASSENDE DISKUSSION, SCHLUßFOLGERUNGEN UND
AUSBLICK ... 78
LITERATUR ... 83
ANHANG ... FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
5
Verzeichnis der Tabellen
Tab.1. Die vier Identitätszustände nach Marcia... 25
Tab.2. Geburtsland der Befragten in der Bewerbergruppe... 40
Tab.3. Geburtsland der Befragten in der Vergleichsgruppe... 41
Tab.4. Faktorladungsmatrix Motive... 54
Tab.5. Varianzaufklärung durch die Faktoren... 55
Tab.6. Korrelationen nach Pearson zwischen den Motivsummenskalen... 56
Tab.7. Mittelwerte der Motivsummenskalen für die Bewerbergruppe... 58
.
Tab.8. Mittelwerte der Motivsummenskalen für die Vergleichsgruppe... 58
Tab.9. Ergebnisse der t - Tests zur Prüfung von Mittelwertsunterschieden der
Motivskalen bei Bewerber- und Vergleichsgruppe... 59
Tab.10. Mittelwerte der Motivskalen für Männer und für Frauen der Bewerbergruppe... 61
Tab.11. Ergebnisse der t - Tests zu Motiven bei Frauen und Männern der
Bewerbergruppe... 61
Tab.12. Mittelwerte der Summenskala zur sozialen Verantwortungsübernahme für
die Bewerber- und die Vergleichsgruppe... 63
Tab.13. Ergebnisse des t - Tests zur Prüfung von Mittelwertsunterschieden der
Summenskala soziale Verantwortungsübernahme bei Bewerber- und
Vergleichsgruppe... 64
Tab.14. Mittelwerte der Summenskalen zum Identitätsstatus für die Bewerber- und
die Vergleichsgruppe... 65
Tab.15. Ergebnisse der t - Tests zur Prüfung von Mittelwertsunterschieden der
Summenskalen zur Identität bei Bewerber- und Vergleichsgruppe... 67
6
Tab.16. Cut - off - Werte (Summe von Mittelwert und Standardabweichung) für
die vier Identitätsskalen... 69
Tab.17. Kreuztabelle Gruppenzugehörigkeit x Identitätsstatus... 72
Tab.18. Ergebnisse der t - Tests zur Prüfung von Mittelwertsunterschieden bei
Befragungsteilnehmern mit dem Geburtsort neue oder alte Bundesländer... 75
Tab.19. Ergebnisse einer schrittweisen multiplen linearen Regressionsanalyse,
abhängige Variable: Zugehörigkeit zur Bewerber- bzw. Vergleichsgruppe... 77
Tab.20. Koeffizienten der schrittweisen multiplen linearen Regressionsanalyse,
abhängige Variable: Zugehörigkeit zur Bewerber- bzw. Vergleichsgruppe... 77
7
Verzeichnis der Abbildungen
Abb.1. Häufigkeiten der Antworten auf die Zusatzfragen für die Vergleichsgruppe... 38
Abb.2. Prozentuale Häufigkeit von Frauen und Männern in der Bewerber- und der
Vergleichsgruppe... 39
Abb.3. Alter der Befragten in der Bewerber- und der Vergleichsgruppe... 40
Abb.4. Screeplot zur Faktorenanalyse zu Motiven... 51
Abb.5. Mittelwerte der Summenskalen zu Motiven für die Bewerber- und die
Vergleichsgruppe... 59
Abb.6. Mittelwerte der Summenskalen zum Identitätsstatus für die Bewerber- und
die Vergleichsgruppe... 66
Abb.7. Identitätsstatuskategorien nach einer Zuordnung aller Befragungsteilnehmer... 70
Abb.8. Prozentuale Häufigkeiten der Identitätsstatus für die Bewerber- und die
Vergleichsgruppe... 71
8
Zusammenfassung
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die Darstellung der Ergebnisse einer
Befragung von 164 Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren, welche im Zeitraum von April
bis Juni 2001 in Dresden und Berlin durchgeführt wurde. 99 Teilnehmer hatten sich für
einen freiwilligen sozialen Dienst im Ausland beworben, 65 gehörten zur Gruppe der
Nichtbewerber. Thema dieser Befragung waren Motive, die für oder gegen einen sozialen
Dienst im Ausland sprechen, im Zusammenhang mit der Bereitschaft, soziale
Verantwortung zu übernehmen und im Zusammenhang mit der Identitätsentwicklung
junger Menschen. Zur Erfassung der Beweggründe, die zu einer Bewerbung für einen
sozialen Dienst im Ausland führen können, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein
Fragebogen entwickelt. Die Bereitschaft, Verantwortung für benachteiligte Menschen zu
übernehmen, wurde mit einem Instrumentarium von Krettenauer (1998), aufbauend auf
dem ,,Existentielle Schuld Inventar" von Montada, Dalbert, Reichle und Schmitt (1986),
erhoben, die Erfassung des Identitätsstatus erfolgte unter Verwendung eines Fragebogens
von Adams (1998). Die empirischen Befunde zeigen, daß sich Bewerber für einen sozialen
Dienst stärker als Nichtbewerber aus ihren Idealen heraus engagieren wollen und daß sie
einen stärkeren Wunsch angeben, ins Ausland zu gehen. Außerdem wollen Bewerber
stärker als Nichtbewerber das Berufsfeld Sozialarbeit erkunden. Die Bewerber für einen
sozialen Dienst im Ausland zeigen deutlicher als Altersgenossen eine Bereitschaft, soziale
Verantwortung zu übernehmen. In der Bewerbergruppe wurde häufiger als in der
Vergleichsgruppe der Identitätsstatus Moratorium gefunden, in der Vergleichsgruppe
hingegen häufiger diffuse und übernommene Identität.
9
Einführung
Das Jahr 2001 wurde von der UNO zum internationalen Jahr der Freiwilligen erklärt.
Gewürdigt wurde damit der unentgeltliche Einsatz für andere, bedürftige Menschen, der
zugleich mehr ist als ein Ersatz für professionelle Hilfe oder eine bloße Ergänzung des
bestehenden Sozialsystems. Durch Freiwilligenarbeit können Fertigkeiten entwickelt
werden, eine solche Arbeit ist ,,eine Schule der Solidarität und sozialer Bildung" (Iben,
1999). Gerade auch junge Menschen sind bereit, sich freiwillig zu engagieren. Eine
Möglichkeit bietet ihnen dazu das Freiwillige Soziale Jahr im Ausland (FSJ - A)
beziehungsweise der Europäische Freiwilligendienst (EFD). Kriegsdienstverweigerer
können einen Anderen Dienst im Ausland (ADA) anstelle des Zivildienstes absolvieren.
Das Interesse an einem solchen Einsatz ist jedes Jahr so groß, daß bei weitem nicht allen
Bewerbern eine Dienststelle im Ausland angeboten werden kann. In der Pressemitteilung
zum Manifest zu Freiwilligendiensten der Robert Bosch Stiftung vom Oktober 1998 heißt
es dazu:
,,Tausende von Jugendlichen in Deutschland sind bereit, sich für eine begrenzte Zeit
freiwillig zu engagieren, im Sozialen und für die Umwelt, im eigenen Land oder woanders.
Doch viele bemühen sich jedes Jahr vergeblich um einen Freiwilligendienst. Damit wird
ein entscheidendes Element der Bürgergesellschaft ignoriert: Das freiwillige Engagement
der jungen Generation und ihre Bereitschaft, aktiv ihre Lebensplanung zu gestalten und
soziale Verantwortung zu übernehmen - ein wichtiger bürgerschaftlicher Beitrag im
zusammenwachsenden Europa." (In: ICE-Kontakt, November 1998, S. 49)
Was bewegt junge Leute zu einer Bewerbung für einen sozialen Dienst im Ausland? Sind
es eher Ideale, wie der Wunsch, anderen zu helfen oder gibt es vorrangig Motive, die als
eher egoistisch bezeichnet werden können, wie zum Beispiel, eine andere Sprache zu
lernen? Wie stark fühlen sich junge Menschen, die sich für den Dienst bewerben,
verantwortlich für andere, benachteiligte Personen? Entspringt der Wunsch, ein Jahr im
Ausland, weg von zu Hause und konfrontiert mit völlig neuen Anforderungen zu
verbringen, eher der Tatsache, daß die Bewerber noch nicht genau wissen, wohin sie ihren
weiteren Lebensweg lenken wollen? In der vorliegenden Untersuchung wurde der Versuch
10
unternommen, sich diesen Fragen im Rahmen einer empirischen Untersuchung zu nähern.
Dabei wurden nicht nur Bewerber für einen sozialen Dienst im Ausland befragt, sondern
auch junge Menschen, die sich nicht für einen entsprechenden Dienst beworben haben. Es
wurde eine Klärung der Frage angestrebt, warum junge Menschen die relativ hohen
Anforderungen eines sozialen Dienstes im Ausland auf sich nehmen, und was sie
möglicherweise von anderen Gleichaltrigen unterscheidet.
Die hier vorgenommene Darstellung will zuerst näher auf das Problemfeld eingehen,
indem schon vorhandene Erkenntnisse zum freiwilligen Engagement einbezogen werden.
Ausgangspunkt ist die Lebensphase Jugend mit ihren spezifischen Entwicklungsaufgaben.
Darauf aufbauend wird jeweils den möglichen Motiven für einen entsprechenden Dienst,
der Frage nach Übernahme von Verantwortung für strukturell Benachteiligte und dem
Problemgebiet der Identitätsentwicklung ein eigenes Kapitel gewidmet. Ein Exkurs zeigt
die Möglichkeiten eines sozialen Engagements junger Menschen vor allem unter dem
organisatorischen Aspekt auf und betrachtet auch die gesellschaftlichen Gegebenheiten, in
die ein sozialer Dienst eingebunden ist. Diese theoretischen Vorüberlegungen führen zu
den Fragestellungen, welche der hier vorgestellten Untersuchung vorangingen. Im
Anschluß wird genauer auf die bei der Arbeit verwendete Methode, auf den
Untersuchungsablauf und das Erhebungsinstrument und schließlich auf Ergebnisse und
mögliche Interpretationen eingegangen.
11
1. Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz
Junge Menschen zwischen 17 und 21 Jahren, wie sie in der vorliegenden Untersuchung
befragt wurden, befinden sich in einem Lebensabschnitt, der häufig als Spätadoleszenz
bezeichnet wird (Oerter & Montada, 1995). Die Entwicklungsphase der Adoleszenz ist zum
einen gekennzeichnet durch biologische und intellektuelle Veränderungen des
Individuums, zum anderen durch veränderte Anforderungen der Umwelt an die Person. In
der Entwicklungspsychologie wird heute in der Regel von einer interaktionistischen
Sichtweise ausgegangen: Umwelt und Individuum beeinflussen sich wechselseitig.
Verschiedene Autoren haben dargelegt, welche sogenannten ,,Entwicklungsaufgaben" ein
Jugendlicher beziehungsweise junger Erwachsener bewältigen muß, um für die späteren
Anforderungen im Erwachsenenalter vorbereitet zu sein. Von großem Einfluß war dabei
die Entwicklungstheorie von Erikson (1950, 1973). Diese psychoanalytisch fundierte
Theorie weist als zentrale Aufgabe der (lebenslangen) Persönlichkeitsentwicklung den
Aufbau einer Ich-Identität aus. Das Ringen um Identität vollzieht sich vor dem Hintergrund
verschiedener charakteristischer, alterstypischer Krisen, deren Bewältigung zum Erwerb
von Kompetenzen und schließlich zum Gefühl der ,,inneren Einheit" führt. Eriksons
Überlegungen sind gerade für das Verständnis der Jugendphase wichtig, da in diesem
Lebensabschnitt die Entwicklung von Ich-Identität eine besondere Bedeutung gewinnt. In
der Jugendzeit können verschiedene Rollen ausprobiert, verschiedene Lebensmodelle
erwogen werden. Erikson prägte dafür den Begriff des psychosozialen Moratoriums
(Erikson, 1973). Für Erikson ist auf der Altersstufe ,,Pubertät und Adoleszenz" das
Erlangen von Identität, mit der Gefahr der Identitätsdiffusion, besonders zentral.
Eine weitere Theorie, formuliert von Havighurst, stellt den Erwerb von bestimmten
typischen Kompetenzen in den Mittelpunkt. Havighurst (1948) versteht eine
Entwicklungsaufgabe als ,,Lernaufgabe". Er führt aus, daß die erfolgreiche Bewältigung
einer solchen Lernaufgabe zu Glück und Erfolg bei späteren Aufgaben führt, während ein
Mißlingen mit Unglücklichsein und Mißbilligung durch die Gesellschaft einhergeht. Solche
Entwicklungsaufgaben sind aber bei Havighurst keine abgeschlossenen Einheiten, sie
können zeitlich begrenzt sein oder sich über mehrere Perioden in der Lebensspanne
12
erstrecken. Für die Adoleszenz formulierte Havighurst (1948) eine Reihe von
Entwicklungsaufgaben, die im Folgenden aufgeführt werden: Aufbau neuer und reiferer
Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts, Übernahme der männlichen
beziehungsweise weiblichen Geschlechtsrolle, Akzeptieren der eigenen körperlichen
Erscheinung, emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und von anderen Erwachsenen,
Vorbereitung auf Ehe und Familienleben sowie auf eine berufliche Karriere, Erlangung von
Werten und Erarbeiten eines ethischen Systems, das als Leitfaden für das Verhalten dient
sowie Anstreben sozial verantwortlichen Verhaltens. Ähnliche Aufgabenkataloge finden
sich zum Beispiel bei Newman und Newman (1975) und bei Hurrelmann (1997). Auch für
Hurrelmann sind Aufgaben des späten Jugendalters unter anderem die Vorbereitung auf
eine berufliche Karriere, der Aufbau eines Wertesystems als Leitfaden für das Verhalten
und die Erlangung eines stabilen Selbstbildes beziehungsweise einer Ich-Identität. Hinzu
kommen aber bei Hurrelmann neue Aufgaben, die im Zusammenhang mit veränderten
gesellschaftlichen Bedingungen stehen: Junge Menschen sind gefordert, spezifische
Handlungskompetenzen zur Nutzung des gewachsenen Konsumwarenmarktes und des
kulturellen Freizeitmarkts zu erwerben. Weitere Anforderungen ergeben sich aus der
Aufweichung von traditionell vorgegebenen Lebensabschnitten. Die Jugendphase hat sich
in den letzten Jahrzehnten zeitlich ausgedehnt und zeichnet sich durch Heterogenität aus.
Die deutliche Abgrenzbarkeit von Jugend- und Erwachsenenalter durch Ereignisse wie
Heirat oder Eintritt ins Berufsleben geht zunehmend verloren (Lenz, 1998). Risikofaktoren
wie Arbeitslosigkeit und Instabilität sozialer Beziehungen führen dazu, daß bereits gelöste
Entwicklungsaufgaben zum Teil noch einmal in Angriff genommen werden müssen. Die
große Freiheit bei der Wahl von Lebensstilen, sozialen Beziehungen, Ausbildung etc.
bringt auch eine erhöhte Anforderung an Entscheidungsfähigkeit und
Verantwortungsübernahme für das eigene Handeln mit sich. Junge Menschen sehen sich
also vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die sich aus körperlichen und
intellektuellen Veränderungen, aus den Erwartungen und Erfordernissen der Gesellschaft
und aus individuellen Wünschen und Werten ergeben. Möglicherweise bietet ein sozialer
Dienst hier eine Orientierungshilfe. Das Jahr im Ausland, welches in der Regel zwischen
Schule und Ausbildungsbeginn beziehungsweise Berufseintritt absolviert wird, ermöglicht
13
die Lösung vom Elternhaus, das Ausprobieren neuer, insbesondere auch berufsbezogener
Rollen, die Auseinandersetzung mit Werten, mit den eigenen Fähigkeiten und Grenzen und
nicht zuletzt die Verortung der eigenen Person als Teil der Gesellschaft.
2. Motive für einen Freiwilligendienst
Die im ersten Kapitel vorgestellten Entwicklungstheorien, wie zum Beispiel von
Havighurst (1948) und Hurrelmann (1997), zeigen, daß sich junge Menschen einer Reihe
von Anforderungen, sogenannten Entwicklungsaufgaben gegenüber sehen, die sie durch
eine aktive Auseinandersetzung bewältigen können. Es gehört nach diesen Theorien
beispielsweise zu den Entwicklungsaufgaben im Jugendalter, sich zunehmend emotional
von den Eltern zu lösen und ein eigenes Wertesystem, eine eigene Identität, aufzubauen.
Hierbei kann ein Jahr, welches außerhalb des familiären Umfeldes verbracht wird, hilfreich
sein. So findet Bartjes (1996) bei der Befragung von Zivildienstleistenden, daß der Dienst
auch als eine Trennungshilfe von den Eltern verstanden wird und als eine Möglichkeit für
eine Neuorientierung, für ein Nachdenken über den eigenen weiteren Lebensweg. Dieses
Motiv, über sich nachzudenken und zu eigenen Überzeugungen zu gelangen, wird auch im
Rahmen von Theorien zur Identitätsentwicklung betrachtet und daher im Kapitel 4 weiter
erläutert.
Es kann angenommen werden, daß ein weiterer Beweggrund für das Absolvieren eines
sozialen Dienstes im Ausland der Wunsch ist, Werte, die als persönlich wichtig erlebt
werden, in der Praxis umzusetzen. Zu diesen Werten gehört möglicherweise die
Überzeugung, daß man benachteiligte Menschen unterstützen sollte. Das Bedürfnis,
anderen Menschen uneigennützig zu helfen, kann trotz unterschiedlicher individueller
Ausprägung als universell betrachtet werden und ist bereits bei jungen Kindern
beobachtbar. Begründet wird das Hilfeverhalten mit zunehmendem Alter durch das
Menschsein des anderen, die Person wird als Person geschätzt. Forschungsarbeiten hierzu
finden sich vor allem bei Eisenberg (1992). Es sollen hier aber auch Auffassungen
Beachtung finden, die davon ausgehen, daß Altruismus in einer reinen Form nicht zu finden
14
ist, sondern daß vielmehr auch geholfen wird, um ,,sich gut zu fühlen", so wie es
beispielsweise Smith (1982) formuliert. Aus dem Helfen kann ein positives Selbstbild
bezogen werden, die Hilfetätigkeit wird dadurch verstärkt. Bierhoff (1995) spricht in
diesem Zusammenhang von einer ,,ich instrumentellen Funktion" der positiven
Einstellung zur ehrenamtlichen Tätigkeit als dem Ausdruck von Wertvorstellungen und der
Stärkung des Selbstbildes einer Person.
Immer häufiger wird darauf hingewiesen, daß junge Menschen ihr Verhalten weniger an
traditionellen Vorbildern ausrichten und daß sie sich verstärkt von egoistischen oder
hedonistischen Motiven leiten lassen. Ein geläufiges Schlagwort hierfür ist die sogenannte
,,Spaßgesellschaft". Die Erwartungen junger Menschen an eine Freiwilligentätigkeit
werden dahingehend auch von der Shell-Jugendstudie 1997 unter dem Titel ,,Ohne Spaß
kein Engagement" zusammengefaßt. Daß sich die Bereitschaft zum Helfen und zur
Verantwortungsübernahme und das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Spaß
keineswegs ausschließen, stellen die Autoren des Manifests ,,Jugend erneuert
Gemeinschaft" (1998) fest:
,,Jugendliche wollen Erfahrungen sammeln, experimentieren, Verantwortung übernehmen,
Befriedigung und Freude finden. Verantwortung und Individualität sind für sie
ebensowenig Gegensätze wie der Wunsch nach Selbstverwirklichung und das Bedürfnis,
etwas Sinnvolles zu tun. Sie identifizieren sich mit überschaubaren und befristeten
Projekten und Initiativen, bei denen sie ihre Fähigkeiten einbringen können und
Anerkennung finden. Immer weniger attraktiv sind für sie dagegen Großorganisationen und
Verbände, Routine und Vereinnahmung durch Stereotype ,,selbstlosen Engagements" oder
Ideologien." (S.9)
Zusammenfassen lassen sich diese Aussagen, daß ein Bedürfnis, anderen Menschen zu
helfen und Verantwortung für andere zu übernehmen, für die Übernahme eines sozialen
Dienstes spricht, wobei es ergänzend auch ein Bedürfnis nach einem positiven und
kongruenten Selbstbild gibt. Der Wunsch, sich freiwillig über ein Jahr hinweg im sozialen
Bereich zu engagieren, setzt vermutlich bereits ein vergleichsweise hohes Maß an
Verantwortungsübernahme voraus, eine Annahme, die in der vorliegenden Untersuchung
weitere Prüfung erfährt.
15
Einen eigenständigen Bereich stellt das soziale Engagement aus religiöser Überzeugung
dar. Das Gebot der Nächstenliebe ist zentral in der christlichen Religion, und ehrenamtliche
Tätigkeit wird in unserer Gesellschaft traditionell aus christlicher Überzeugung geleistet
(Küpper & Bierhoff, 1999, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
2001). Der Verein, bei dem Bewerber für einen sozialen Dienst im Ausland für die
vorliegende Untersuchung befragt wurden, bekennt sich bereits in seinem Namen
,,Initiative Christen für Europa" zu seinem christlichen Fundament. Möglicherweise sind
eine Reihe von Bewerbern religiös gebunden und wollen sich auch aus diesem Hintergrund
sozial engagieren. Küpper und Bierhoff (1999) finden beispielsweise in ihrer
Untersuchung einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Wichtigkeit der Religion
für eine Person und deren Hilfsbereitschaft. Auch Untersuchungen von Fitch (1991) und
Serow (1991) und anderen zeigen, daß ehrenamtlich tätige Personen mehr Religiosität
angeben als andere. Allerdings stellt die Erfassung von Religiosität relativ hohe
Anforderungen, so daß dieser Bereich aufgrund seiner Komplexität in der zu
beschreibenden Untersuchung nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Ein weiterer zentraler Aspekt des sozialen Dienstes im Ausland ist es, die vertraute
Umgebung zu verlassen und in einem anderen kulturellen Umfeld zu leben und zu arbeiten.
Die Möglichkeit, ein Jahr ins Ausland zu gehen, kann für junge Menschen mit einer Reihe
von Anreizen verbunden sein. So kann es eine bereits erworbene Affinität zum Lebensstil
und zur Kultur eines bestimmten Landes oder Kulturraumes oder aber eine Neugier auf die
andere Lebensweise und das Fremdartige bei den Bewerbern für einen Dienst im Ausland
geben. Vielleicht besteht der Wunsch, eine andere Sprache zu lernen oder zu
vervollkommnen, um sich im Ausland verständigen zu können oder aber, um sich einen
Vorteil auf dem Bildungsmarkt zu verschaffen. Lernen findet im Ausland auch über den
Spracherwerb hinaus statt, indem eigene Denkmuster überprüft werden und eventuell
übernommene Überzeugungen sich an geänderten Lebensumständen messen lassen
müssen. Das Bedürfnis, ins Ausland zu gehen, kann auch aus der Erkenntnis heraus
entstehen, daß gegenseitige Vorurteile abgebaut werden müssen, um ein friedliches
Miteinander von Menschen zu ermöglichen. Der Wunsch nach einem Dienst im Ausland ist
vermutlich eng verwoben mit einigen anderen Motiven. In der vorliegenden Untersuchung
16
wird unter dem Aspekt Ausland hauptsächlich auf das Interesse an einer anderen Kultur
und Gesellschaft Bezug genommen.
Ein Aufenthalt im Ausland ist auch mit der Konfrontation mit neuartigen Situationen
verbunden, welche bewältigt werden müssen. Zumeist sehen sich die Freiwilligen vor
Sprachschwierigkeiten und einem gänzlich ungewohnten Umfeld. Der Wunsch, sich einer
solchen Herausforderung zu stellen, kann ebenfalls zu den Triebfedern für eine Bewerbung
für einen sozialen Dienst im Ausland gehören. Herausforderung bietet sich bei einem
solchen Dienst in doppelter Hinsicht: Neben der Bewältigung des Lebens im Ausland,
kommt die für viele neuartige Tätigkeit im sozialen Bereich hinzu. Wenn solche
Anforderungen bewältigt werden, kann eine Selbstwirksamkeit erfahren werden, wie sie
junge Menschen in ihrem bisherigen relativ geschützten Umfeld von Schule und Elternhaus
vielleicht nicht erleben konnten. Es soll hierbei beispielhaft auf die Betrachtungen von
Junge (1995) verwiesen werden, die das Problem des Hinausschiebens der Erwerbstätigkeit
und die damit verbundene späte Erfahrung gesellschaftlicher Nützlichkeit thematisieren.
Die Erkenntnis, daß man zur Bewältigung von Aufgaben fähig wäre, die sich in dem
bisherigen Umfeld gar nicht stellen, kann möglicherweise zu einer Bewerbung motivieren.
Schließlich kann während eines entsprechenden Dienstes das Berufsfeld Sozialarbeit
erkundet werden, und die Freiwilligen können erste Kompetenzen in diesem Bereich
erwerben. Gerade die Wahl eines sozialen Berufs wirft die Frage auf, ob man den
beruflichen Belastungen gewachsen ist und über entsprechende Fähigkeiten verfügt. Hier
kann ein Soziales Jahr im Ausland Möglichkeiten bieten, sich auszuprobieren. Hofer
(1999) konstatiert eine Zunahme des Interesses an sozialen Berufen und stellt fest, daß
unbezahlte soziale Arbeit häufig als Einstieg in den Beruf genutzt wird. Es kann
angenommen werden, daß vor allem bei jungen Frauen diese Berufsfelderkundung bei der
Bewerbung für einen sozialen Dienst eine Rolle spielt. Zumindest wünschen sich junge
Frauen stärker als junge Männer eine Tätigkeit, bei der sie mit Menschen zu tun haben und
anderen helfen können (Hurrelmann, 1997). So fand Fend (1991) auch in seinem
Konstanzer Längsschnitt, daß sich Mädchen besonders häufig für Berufe wie
Krankenschwester, Arzthelferin, Kindergärtnerin oder Krankengymnastin interessieren.
17
Neben Kenntnissen, die speziell in sozialen Berufen benötigt werden, vermittelt eine
soziale Tätigkeit im Ausland eine Reihe sogenannter Schlüsselqualifikationen, nach
Mertens (1974, zitiert nach Mundorf, 2000) ,,solche Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten, welche nicht unmittelbaren und begrenzten Bezug zu bestimmten, disparaten
praktischen Tätigkeiten erbringen, sondern vielmehr a) die Eignung für eine große Zahl
von Positionen und Funktionen als alternative Option zum gleichen Zeitpunkt und b) die
Eignung für die Bewältigung einer Sequenz von (meist unvorhersehbaren) Änderungen von
Anforderungen im Laufe des Lebens." (S.17). In Anbetracht eines knappen Marktes
werden von Arbeitgebern immer mehr berufliche Qualifikationen, Schlüsselqualifikationen
oder
,,soft - skills" erwartet. Die Autoren des Manifests ,,Jugend erneuert Gemeinschaft"
(Berninger et. al., 1998) schreiben hierzu: ,,Mehr als je zuvor sind für die heutigen
Jugendlichen Schlüsselqualifikationen wie interkulturelle Kompetenz, Sprachen und
Erfahrungen mit modernen Computer- und Kommunikationstechnologien nötig und
attraktiv. Sie sind Lernziel und Motivation zugleich mit Blick auf die personale
Kompetenz ebenso wie hinsichtlich der späteren Berufschancen." (S.9) Da Jugendliche die
Probleme der Arbeitswelt sehr wohl wahrnehmen, ja sie als größte Sorge angeben, kann ein
Motiv für die Bewerbung für einen freiwilligen sozialen Dienst im Ausland auch in der
Erkundung des Berufsfelds Sozialarbeit und in der Erhöhung beruflicher Chancen liegen.
1
Es gibt bereits einige Untersuchungen, bei denen nach Motiven für das Absolvieren eines
sozialen Dienstes gefragt wurde. Eine erste umfangreiche Studie hierzu wurde vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegeben und 1998
veröffentlicht (Rahrbach, Wüstendörfer & Arnold, 1998). In qualitativen Interviews
wurden zunächst mögliche Motive für die Bewerbung für ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) erfragt und daraufhin ein Fragebogen entwickelt. Die Gründe, sich für ein FSJ -
Ausland zu bewerben, bezogen sich nach dieser Befragung vor allem auf den Wunsch, ins
Ausland zu gehen und eine fremde Kultur kennenzulernen, des weiteren aber auch auf
1
Shell-Jugendstudie 1997: Mehr als 92% der Jugendlichen geben an, daß sie die steigenden
Arbeitslosenzahlen als ein großes oder sehr großes Problem für unsere Gesellschaft ansehen (Jugendwerk der
Deutschen Shell, 1997)
18
Werthaltungen wie ,,gegenseitige Vorurteile abzubauen". Es wurde die Möglichkeit
gesehen, sich von zu Hause zu lösen und Fertigkeiten (zum Teil für einen späteren Beruf)
zu erwerben. Außerdem wollten sich die jungen Leute persönlich weiterentwickeln und
dazu die Erfahrungen eines sozialen Dienstes im Ausland nutzen. Bierhoff (1995) und
Mitarbeiter untersuchten Einstellungen und Motive ehrenamtlicher Helfer, welche über
einen längeren Zeitraum in Einrichtungen wie zum Beispiel dem Roten Kreuz tätig waren.
Auch hier wurde eine große Zustimmung zu Aussagen, die der Dimension
,,Verantwortung" (Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen) zuzuordnen sind, gefunden.
Weitere in der Untersuchung aufgezeigte Motive für einen sozialen Dienst sind die Suche
einer Herausforderung, der Wunsch nach Anerkennung durch Familie und Freunde und
nach sozialen Bindungen in der gewählten Organisation.
Bei der Bewerbung für einen sozialen Dienst im Ausland scheinen also Beweggründe wie
die Umsetzung persönlicher Werthaltungen, der Wunsch, ins Ausland zu gehen und über
sich und den weiteren Lebensweg nachzudenken, eine Rolle zu spielen. Weiterhin kann ein
sozialer Dienst im Ausland auch dazu genutzt werden, die eigenen Grenzen zu erkunden
und Erfahrungen im Bereich der Sozialarbeit zu machen. Solche Motive legen bereits die
erwähnte Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend und auch die Studie von Bierhoff und Mitarbeitern nahe. Welche Motive
besonders wichtig für die Entscheidung sind, ein Jahr im Sozialbereich im Ausland zu
arbeiten, will die vorliegende Untersuchung klären. Anders als beispielsweise in der
Untersuchung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird hier
auch die Frage aufgeworfen, ob sich die Bewerber für einen entsprechenden Dienst in ihren
Motiven von gleichaltrigen jungen Menschen, welche sich nicht beworben haben,
unterscheiden.
19
3. Übernahme sozialer Verantwortung
Warum setzen Menschen ihre Kräfte und Fähigkeiten für andere ein, warum geben sie
etwas von ihren Ressourcen ab, ohne zunächst offensichtlich einen Gewinn davon zu
haben? Warum fühlen sich Personen für andere, benachteiligte Menschen verantwortlich?
Zu dem Begriff der Verantwortung gibt Krettenauer (1998) eine Definition: ,,Ein
Individuum fühlt sich aufgrund spezifischer Gerechtigkeitsüberzeugungen vor seinem
eigenen Gewissen für bestimmte Handlungen, die das Wohlergehen anderer befördern
könnten, prospektiv und aktiv verantwortlich." (S. 85). Die Instanz, vor der sich eine
Person hier verantwortet, ist also das eigene Gewissen, der Antrieb sind ,,spezifische
Gerechtigkeitsüberzeugungen". Was sind nun diese Gerechtigkeitsüberzeugungen und wie
entstehen sie? Es gibt verschiedene theoretische Annäherungen an das Problem der
Gerechtigkeit. Vornehmlich in der Sozialpsychologie wird unter diesem Aspekt die
Verteilung von Belohnungen oder Gütern an verschiedene Personen mit verschiedenen
Leistungen und verschiedener Bedürftigkeit betrachtet. Untersucht wird hier das
distributive Gerechtigkeitsdenken. Eine Form davon, das austauschorientierte
Gerechtigkeitskonzept, berücksichtigt die Proportionalität der Beiträge der einzelnen
Personen zu einer Leistung. Das Motto heißt hier: ,,Jedem nach seiner Leistung". Eine
verteilungsorientierte Herangehensweise macht demgegenüber eine Verteilung von Gütern
nicht abhängig von der Leistung einer Person. Es werden häufig zwei verteilungsorientierte
Gerechtigkeitskonzepte unterschieden: Zum einen kann eine strikte Gleichbehandlung
angestrebt werden, es wird also das Prinzip ,,Jedem das Gleiche" angewendet. Zum anderen
ist eine Orientierung an Bedürftigkeit anzutreffen: ,,Jedem nach seinen Bedürfnissen".
Dabei wird bei einer Einbeziehung von Leistung und Bedürftigkeit die praktisch
vorhandene Ungleichheit von Personen beachtet und sich auf diesem Weg dem Ideal der
Gleichbehandlung von Menschen genähert. Es wird ersichtlich, daß nicht jede
Gerechtigkeitsorientierung zur Übernahme sozialer Verantwortung führt. Eine
austauschorientierte Gerechtigkeitskonzeption kann zu einer Ausgrenzung von weniger
leistungsfähigen Personen führen. Entsprechende Begründungsmuster für eine
Chancenungleichheit finden sich beispielsweise bei ausländerfeindlichen Jugendlichen,
20
wie eine Untersuchung von Held u.a. (1991) ergab. Die Chancenungleichheit zwischen
Menschen wird hier mit unterschiedlichen individuellen und kollektiven Leistungen
begründet und als verdient betrachtet. Solche Unterschiede in der Auffassung, was gerecht
oder ungerecht ist, können auch zu verschiedenen Positionen gegenüber Menschen führen,
die über weniger Ressourcen verfügen. Berührt wird dabei die Frage, ob andere Personen
als benachteiligt angesehen werden. Wieso verfügen einige Menschen über ein
austauschorientiertes Gerechtigkeitskonzept und andere über ein verteilungsorientiertes?
Die Gerechtigkeitsauffassungen unterliegen über die Zeit von Kindheit und Jugend hinweg
anscheinend einer typischen Entwicklung, wie besonders das Modell von Damon (1977)
zeigt. Damon konfrontierte Personen mit relevanten Situationen und anschließenden
Fragen dazu und fand drei Niveaus zum distributiven Gerechtigkeitsdenken, die jeweils
noch einmal unterteilt werden. Auf dem Niveau Null (etwa 4 Jahre und jünger) reichen
zuerst allein egozentrische Wünsche als Begründung für eine Verteilung von Gütern aus,
danach werden auch bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel Größe, Alter oder
Geschlecht zur Begründung herangezogen, welche jedoch nur eine quasi - objektive
Rechtfertigung für eine Ressourcenverteilung darstellen. Auf der Stufe Eins (etwa 5-9
Jahre) liegt zuerst eine strikte Gleichbehandlung aller Personen vor, bevor später auch der
unterschiedliche Verdienst von Menschen beachtet wird. Auf der Stufe Zwei (etwa 8 Jahre
und älter) werden solche Billigkeitserwägungen noch ausgebaut, zur Beachtung des
Verdienstes kommt die Einbeziehung von Bedürftigkeit. Zuerst wird noch versucht, allen
geäußerten Ansprüchen irgendwie gerecht zu werden, zwischen konfligierenden
Ansprüchen wird pragmatisch vermittelt. Schließlich gelangt das Individuum zu einer
Gerechtigkeitsauffassung, die eine moralische Vermittlung zwischen konfligierenden
Ansprüchen ermöglicht, so daß nur gerechtfertigte Ansprüche beachtet werden. Dieses
fruchtbringende Modell ist empirisch gut untermauert und korrespondiert mit einem älteren
Entwicklungskonzept, welches von Piaget (1932/ 1983) formuliert wurde. Piaget fand in
seinen Untersuchungen mit Kindern und Jugendlichen bei den jüngeren eine Denkweise,
die er als heteronome Gerechtigkeit bezeichnete und die eine Orientierung an der Meinung
von Autoritäten darstellt. Gerecht ist, was die Autorität, also beispielsweise die Mutter,
sagt. Erst später, etwa mit dem Eintritt in die Schule, beginnt ein Kind Normen und Regeln
21
zu hinterfragen und unabhängig von Autoritäten zu urteilen. Es gelangt damit zu einer
autonomen Gerechtigkeitsauffassung. Dabei fand Piaget für das Stadium der Autonomie,
daß bei einer Verteilung von Gütern zuerst für alle das Gleiche gefordert wird, bevor auf
einer Stufe höherer Entwicklung auch Billigkeitsüberlegungen (hier wurde nur
Bedürftigkeit untersucht) hinzukommen (vergleiche das Modell von Damon). Diese
Konzepte zeigen, daß die Gerechtigkeitsorientierung ein Teil der kognitiven Entwicklung
ist und sich über den Lebensverlauf hinweg in der Regel in bestimmten Bahnen vollzieht.
Wie Krettenauer (1998) feststellt, ist es nicht zwingend, daß mit zunehmendem Alter das
verteilungsorientierte Denken zunimmt, da eine Berücksichtigung des unterschiedlichen
Verdienstes auch zu einer rein austauschorientierten Gerechtigkeitsauffassung führen kann.
Wichtig ist die moralische Entwicklung einer Person, die eng mit der Entwicklung von
Autonomie (Unabhängigkeit von Autoritäten in der Beurteilung von Normen) verbunden
ist. Colby und Kohlberg (1987) fanden, daß Personen, die in ihren moralischen Urteilen als
autonom betrachtet werden können, eher in der Lage sind, eigene Bedürfnisse
zurückzustellen, wenn es dafür moralische Erfordernisse gibt. Moralische Erfordernisse
begründen sich dabei aus einem uneingeschränkten Respekt vor anderen Menschen
2
. Wie
eine Studie von Haan, Smith und Block (1968) ergab, zeigen Personen, die als autonom
bezeichnet werden können, auch eine hohe Konsistenz zwischen moralischen Urteilen und
ihrem Verhalten und eine größere Bereitschaft zu soziopolitischem Engagement.
Die Auffassung, was gerecht und was ungerecht ist, unterliegt also einer lebensgeschichtli-
chen Entwicklung. Dies relativiert in gewisser Weise die Angst darum, daß in einer
Gesellschaft, in der traditionelle Gemeinschaftsbindungen zunehmend verloren gehen und
eine große Anforderung an individuelle Sinnfindung gestellt wird, die Bereitschaft zur
Übernahme sozialer Verantwortung verloren geht. Es scheint so zu sein, daß
Entwicklungsvariablen für die Ausbildung von sozialer Verantwortung sogar wichtiger
sind als Bedingungen der Umwelt. Entsprechende Ergebnisse ergab eine Untersuchung von
Krettenauer (1998). Ein entscheidender Faktor für die Übernahme sozialer Verantwortung
ist nach dieser Studie die Entwicklung moralischer Autonomie. Die eigene soziale Lage hat
keinen Einfluß, lediglich das Bildungsniveau einer Person spielt eine gewisse Rolle.
2
vergleiche Kants Moralverständnis (Kant 1785/ 1974) und Durkheim (1984)
22
Solange die Umwelt die Ausbildung moralischer Autonomie ermöglicht, scheint eine
wesentliche Voraussetzung für die Übernahme sozialer Verantwortung gegeben.
Eine weitere Forschungslinie beschäftigt sich mit altruistischem Verhalten. Auch hier
wurde versucht, Entwicklungsprozesse über den Lebensverlauf zu finden (Eisenberg,
1982; Hoffman, 1982). Bei Altruismus - Konzepten, besonders bei Hoffman (1982), wird
ein stärkeres Gewicht auf Empathie gelegt, wobei Empathie hier sowohl als Wissen, was
ein anderer fühlt, als auch als Mitgefühl verstanden wird. Es geht also nicht primär um die
Überlegung, ob ein anderer der Hilfe bedarf, um Gerechtigkeit herzustellen, sondern um
Emotionen, die die Bedürftigkeit beim potentiellen Helfer auslöst. Definiert wird
Altruismus auch zum Teil mit Uneigennützigkeit (Bartussek, 1997). Es handelt sich
beispielsweise nach Bartussek um ein Verhalten, welches nicht auf den eigenen Gewinn
zielt und anderen zum Vorteil gereicht. In ähnlicher Weise, aber ohne den expliziten
Verweis auf die Uneigennützigkeit werden prosoziale Reaktionen bei Bierhoff (1992)
verstanden. Nach Bierhoff ist prosoziales Verhalten gekennzeichnet durch die Absicht,
etwas Gutes zu tun und die Freiheit in der Entscheidung (also beispielsweise ohne
berufliche Verpflichtung). Wie Untersuchungen ergaben, ist prosoziales beziehungsweise
altruistisches Verhalten bereits bei kleinen Kindern und universell zu beobachten.
Obwohl es anscheinend zum Menschsein gehört, uneigennützig um das Wohlergehen
anderer bemüht zu sein, betont Bierhoff (1992) auch, daß altruistisches Verhalten nicht
notwendigerweise ohne persönlichen Gewinn bleibt. Neben den oben beschriebenen
Motiven für soziale Verantwortungsübernahme wie moralische Verpflichtung und
Empathie, kann auch der Wunsch nach Anerkennung und Selbstwertsteigerung eine Rolle
spielen. So wurden in einer Untersuchung von Bierhoff (1992) auf die Frage nach Motiven
für prosoziales Verhalten bei Unfällen der Wunsch nach Selbstwertsteigerung und
moralische Verpflichtung am häufigsten genannt. In der gleichen Studie wurde ebenfalls
Empathie und die Erwartung von Hilfeleistung in einer eigenen Notlage (Reziprozität)
gefunden. Das Motiv nach einer Selbstwerterhaltung und -steigerung kann bei
altruistischem Verhalten eine Rolle spielen und hängt auch mit erfolgten Attributionen
zusammen. Wenn ein Mensch, beispielsweise aufgrund der Einschätzung von
Bezugspersonen, sich selbst als prosozial einschätzt, so wird er möglicherweise eher bereit
23
sein zu helfen. Es wurde auch in einer Reihe von Studien festgestellt, daß soziales und
gesellschaftliches Engagement bei Freiwilligen in ihrem Selbstbild verankert ist (Colby &
Damon, 1992; Fendrich, 1993; McAdam, 1988). Zusammenfassend lassen sich
verschiedene Zugänge und Erklärungen zu einer prosozialen Einstellung, die sich in einer
Bewerbung für einen sozialen Dienst äußern kann, finden. Zum einen verfügen Menschen
über die Fähigkeit, sich in die Situation benachteiligter Menschen einzufühlen und
aufgrund einer emotionalen Betroffenheit zu handeln. Dies ist lebensgeschichtlich schon
früh zu beobachten. Ein solches Phänomen wird in der Regel bei spontanem Hilfeverhalten
betrachtet. Es kann angenommen werden, daß für ein längerfristiges Engagement weitere
Erklärungen hinzugezogen werden müssen. Wenn eine kognitive Auseinandersetzung mit
der Bedürftigkeit und der möglichen Hilfe erfolgt, so wird zum einen auf
Reziprozitätsüberlegungen verwiesen. In der Regel ist für die Einbeziehung von
Nutzenüberlegungen (der andere wird mir in einer späteren Notlage helfen) eine umgrenzte
Bezugsgruppe Voraussetzung. Zum anderen spielen kognitive Aspekte bei verschiedenen
Auffassungen von Gerechtigkeit eine Rolle. Da die moralische Entwicklung schließlich zu
einer Unabhängigkeit von Bezugsgruppen führt und den Menschen aufgrund seines
Menschseins wertschätzt, stellt sie ein geeignetes Konzept zur Erklärung der Übernahme
sozialer Verantwortung dar.
4. Entwicklung von Identität
Die Ablösung vom Elternhaus und die Suche nach eigenen Werten und
Lebensauffassungen, welche möglicherweise durch ein soziales Jahr im Ausland unterstützt
wird, kann der Entwicklung einer eigenen Identität dienen. Identität ist nach James E.
Marcia (1980, zitiert nach Haußer, 1995) ,,eine innere, selbst konstruierte, dynamische
Organisation von Trieben, Fähigkeiten, Überzeugungen und individueller Geschichte"
(S.3). Die Identität wird von Inhalten gebildet, die einer Person bewußt sind und die sie
selbst konstruiert hat.
24
Die Selbstkonstruktion von Identität geschieht dabei durch verschiedene Erfahrungen, die
eine Person im Laufe ihres Lebens macht und führt sie zu Antworten auf die Frage ,,Wer
bin ich?". Hierbei sind Prozesse der Selbstwahrnehmung, der Selbstbewertung und der
personalen Kontrolle beteiligt. Haußer (1995) betont, daß nur die Erfahrungen für die
Identitätsbildung relevant sind, die eine subjektive Betroffenheit beim Individuum
hervorrufen. Aus diesen Überlegungen zur Entstehung von Identität kommt Haußer (1995)
zu der folgenden Definition:
,,Identität läßt sich nunmehr bestimmen als die Einheit aus Selbstkonzept, Selbstwertgefühl
und Kontrollüberzeugungen eines Menschen, die er aus subjektiv bedeutsamen
Erfahrungen über Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und personaler Kontrolle
entwickelt und fortentwickelt und die ihn zur Verwirklichung von Selbstansprüchen, zur
Realitätsprüfung und zur Selbstwertherstellung im Verhalten motivieren." (S.66)
Dabei entsteht das Selbstkonzept aus der Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl aus
der Selbstbewertung heraus, während Kontrolle die Fähigkeit darstellt, Ereignisse und
Zustände zu erklären und/oder vorauszusagen und/oder zu beeinflussen.
3
So gesehen ist die
Identitätsentwicklung eine lebenslange individuelle Aufgabe, nach Kohli eine ,,Leistung,
die immer wieder erbracht werden muß", die dem Individuum aber auch die Erfahrung von
Kontinuität und Selbstsein vermittelt. Eng verknüpft ist dieses Verständnis von der eigenen
Identität mit dem Bild, welches andere von einer Person haben. Die Umwelt nimmt Einfluß
auf die Identitätsentwicklung einer Person durch Rückmeldung: ,,Das bist Du (im Vergleich
zu anderen)." und durch beständig einwirkende sozialisatorische Kräfte, die sich in
bestimmten Anforderungen an eine Person in einem bestimmten Alter äußern. Diese
alterstypischen Anforderungen können als Entwicklungsaufgaben verstanden werden, wie
sie im Kapitel 1 beschrieben wurden. Dabei werden Entwicklungsaufgaben aber nicht nur
von der Umwelt gestellt, sondern auch durch biologische Entwicklungsprozesse bedingt.
Besondere Bedeutung bei der Identitätsentwicklung kommt der Jugendzeit zu. Es war ein
Verdienst Marcias herauszustellen, daß sich einzelne Bereiche des Lebens, mit denen sich
Jugendliche oder junge Erwachsene auseinandersetzen müssen, hinsichtlich der drei
3
Vergleiche ,,personale Kontrolle" bei Averill (1973) und Kontrolltheorie von Rotter (1966)
25
Dimensionen Krise, Verpflichtung und Exploration kennzeichnen lassen (Marcia, 1993).
Solche Lebensbereiche können die Berufsfindung, der Umgang mit der eigenen
Geschlechtsrolle oder die Auseinandersetzung mit religiösen Überzeugungen sein. Als
Krise wird das Ausmaß an Unsicherheit, Beunruhigung, eventuell auch Rebellion
bezeichnet, über welches eine Person bezüglich eines bestimmten Lebensbereiches verfügt.
Die Krise kann zur Exploration führen, das heißt, der entsprechende Lebensbereich wird
erkundet, damit eine bessere Orientierung erreicht wird und möglichst eine Entscheidung
zwischen verschiedenen Auffassungen getroffen werden kann. Wenn eine solche
Entscheidung getroffen wurde, erlangt das Individuum eine innere Verpflichtung oder
commitment in dem entsprechenden Lebensbereich, das heißt, es kommt zu einer inneren
Bindung und zu einem größeren Engagement auf diesem Gebiet. Marcia unterscheidet vier
verschiedene Identitätsformen, die sich aus dem Vorhandensein beziehungsweise der
Abwesenheit von Exploration und Krise ableiten. Dies wird in Tabelle 1 verdeutlicht.
Tab.1. Die vier Identitätszustände nach Marcia
Exploration keine
Exploration
innere Verpflichtung
erarbeitete Identität
übernommene Identität
keine innere Verpflichtung
Moratorium diffuse
Identität
Eine Person, die über eine übernommene Identität verfügt, ist eine klare Verpflichtung,
beispielsweise bezüglich eines bestimmten Berufs, eingegangen. Dabei wurde aber keine
echte Krise durchgemacht, sondern die Festlegung auf den Beruf entstand aus einer starken
Orientierung an den Wünschen und Auffassungen der Eltern.
Eine Person, welche sich im Stadium der diffusen Identität befindet, ist in dem
entsprechenden Lebensbereich desorientiert und empfindet keine innere Verpflichtung. Sie
ist entscheidungsunfähig und ohne Interesse. Diese Desorientierung kann, muß aber nicht
zu einer Krise führen. Für das Beispiel Beruf bedeutet dies, daß keine Festlegung auf einen
bestimmten Beruf stattgefunden hat und keine Auseinandersetzung mit der Berufswahl
erfolgt.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832455491
- ISBN (Paperback)
- 9783838655499
- DOI
- 10.3239/9783832455491
- Dateigröße
- 2.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin – Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Juni)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- soziales engagement freiwilliges jahr identität jugendalter motive
- Produktsicherheit
- Diplom.de