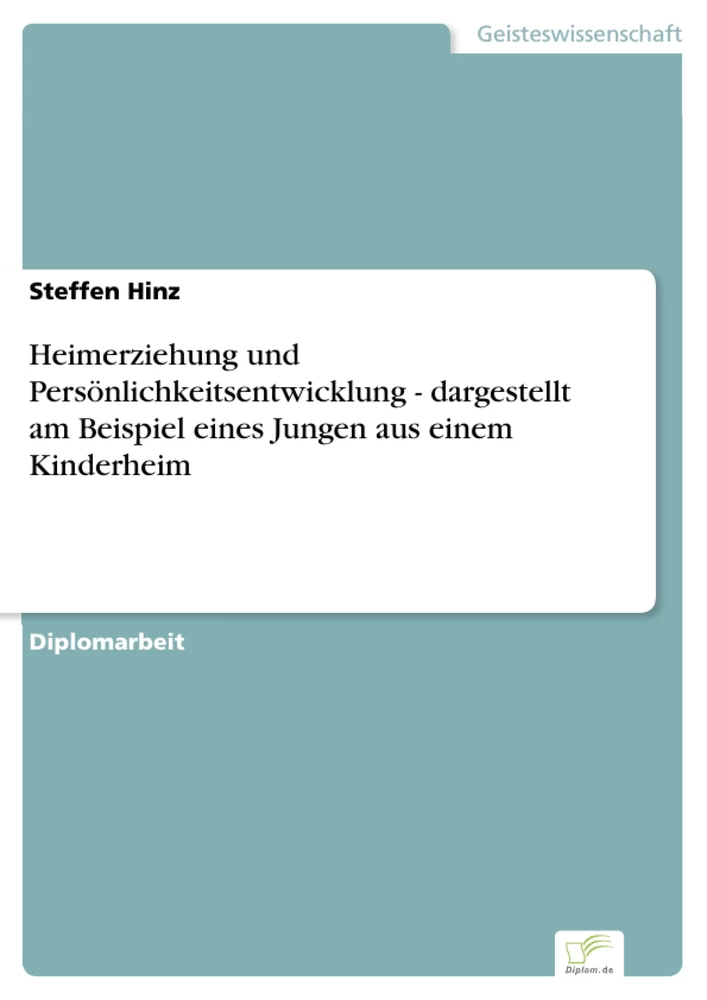Heimerziehung und Persönlichkeitsentwicklung - dargestellt am Beispiel eines Jungen aus einem Kinderheim
Zusammenfassung
Man sagt, Heime sind wichtig, um Kriminalität zu vermeiden, während dort in Wirklichkeit Kriminalität gezüchtet wird, sie sind bekanntlich Brutstätten der Kriminalität. Dieser veröffentlichte Standpunkt ist oft zu hören. In weiten Kreisen gilt, daß Heimerziehung kaum in der Lage ist, auf die Problemlagen der Kinder und Jugendlichen einzugehen, geschweige denn, ihnen bei der Bewältigung ihrer aktuellen Lebenskrise hilft. Angesichts dieser Urteile gilt es zu hinterfragen, wie die Auswirkungen der Heimerziehung auf das Erleben und Verhalten ihrer Bewohner sind.
Innerhalb meiner Arbeit möchte ich mich mit folgenden Fragen auseinandersetzen:
Welche Auswirkungen hat eine Heimsozialisation für die Persönlichkeitsentwicklung der Bewohner?
Wie muß Heimerziehung gestaltet sein, um negative Sozialisationsfaktoren zu minimieren?
Als Grundlage meiner Arbeit habe ich mir das Modell der ökologischen Sozialsationsforschung gewählt. Dieses erläutere ich in den folgenden Abschnitten genauer. Anschließend untersuche ich einzelne Systemmerkmale von Heimen in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung .
Im praktischen Teil meiner Arbeit stelle ich exemplarisch einen Jungen aus einem Kinderheim vor. Dabei gehe ich auf dominierende Verhaltensweisen, mit verursacht oder verstärkt durch neunjährige Heimerziehung, ein. In seiner Heimbiographie möchte ich Kritikpunkte aufzeigen und Alternativen darstellen.
In großen Teilen der Öffentlichkeit besitzt Heimerziehung ein negatives Image. Weitverbreitete Meinungen sind:
- Heimerziehung ist das letzte Mittel und die Vorstufe zum Gefängnis.
- In Heimen werden kriminelle Jugendliche untergebracht, die selbst daran schuld sind.
Zugleich wird den Heimen abgesprochen, effektive Hilfe zu leisten, da sie Anonymität ausstrahlen, die Kinder ohne feste Bezugspersonen aufwachsen und keinen Raum zur Individualität lassen.
Dass verschiedenartige Angebot von stationären Jugendhilfeeinrichtungen macht es schwer, von der Heimerziehung im allgemeinen zu sprechen. Innerhalb meiner Arbeit werde ich dennoch versuchen, übergreifende Systemmerkmale herauszuarbeiten. Um der Mannigfaltigkeit gerecht zu werden, gehe ich auf Binneneigenschaften von Heimen gesondert ein.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Theoretischer Teil
1.Fragestellung4
2.Einleitung, theoretischer Teil5
3.Das Sozialisationsmodell6
3.1Sozialisation aus der Sicht der ökologischen Sozialisationsforschung6
3.2Zur […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht
Theoretischer Teil
1. Fragestellung
2. Einleitung, theoretischer Teil
3. Das Sozialisationsmodell
3.1. Sozialisation aus der Sicht der ökologischen Sozialisationsforschung
3.2. Zur ökologisch - systemischen Sicht des Heimes
3.3. Systemspezifische Eigenschaften von Sozialisationsprozessen in Heimen
3.4. Die ökologische Entwicklungstheorie von Urie Bronfenbrenner
3.5. Zusammenfassende Gedanken zum ökologischen Sozialisationsbegriff
4. Grundlagen für eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung
4.1. Übersicht wesentlicher Erziehungsfaktoren
4.2. Kontinuität, Zugehörigkeit, Verantwortlichkeit
4.3. Vertrauen, Selbständigkeit, Initiative
4.4. Die Gruppe - Anerkennung, Teilen, Solidarität, Auseinandersetzung
4.5. Erziehung und Lernen
4.6. Materielle Bedingungen
5. Systemeigenschaften von Heimen und deren Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von Heimkindern
5.1. Sozialisationsbedingte Probleme in Heimen
5.1.1. Ausgangssituation
5.1.2. ”Totale Institution”
5.1.3. Überversorgung
5.1.4. Häufiger Wechsel von Bezugspersonen
5.1.5. Professionalisierung des pädagogischen Bezugs
5.1.6. Stigmatisierung
5.2. Chancen der Heimerziehung
6. Binneneigenschaften von Heimen und deren Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von Heimkindern
6.1. Größe der Einrichtung
6.2. Strukturierung der Freizeit
6.3. Handlungsfreiräume innerhalb des Binnensystems Heim
6.4. Erzieherschlüssel
6.5. Erziehungsstil
7. Sozialisationsrelevante Merkmale des Heimkindes und deren Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung
7.1. Häufigkeit der Kontakte zwischen dem Kind und den Eltern/Bezugspersonen
7.2. Anwesenheit von Geschwistern
7.3. Alter zum Zeitpunkt der Heimeinweisung und Aufenthaltsdauer
7.4. Weitere sozialisationrelevante Merkmale
8. Verhaltensstile in Heimen
8.1. Verhaltensauffälligkeiten in Heimen
8.2. Dominierende Verhaltensstile in Heimen
9. Schlußfolgerungen auf die Entwicklung der Heimerziehung Praktischer Teil
10. Einleitung, praktischer Teil
11. Vorstellung der Einrichtung
12. Anamnese
12.1. Familiengenogramm
12.2. Zeit von der Geburt bis zur Heimeinweisung
12.3. Zeit von der Heimeinweisung bis zum Schulanfang
12.4. Zeit vom Schulanfang bis zur vierten Klasse
12.5. Zeit ab vierter Klasse bis jetzt
13. Auswertung der Tests
13.1. Auswertung HAWIK – R
13.2. Auswertung VFHK
13.2.1. Methodik
13.2.2. Interpretation der einzelnen Skalen
13.2.3. Interpretation der Abweichungen des Fragebogens Nummer vier
14. Dominierende Verhaltensstile von H. vor dem Hintergrund einer langen Heimsozialisation
14.1. Dominierende Verhaltensstile bei H.
14.2. Vergleich der Verhaltensstile von H. mit dominierenden
Verhaltensstilen hervorgerufen durch die Heimsozialisation
15. Exemplarisch dargestellte Kritikpunkte in der Heimbiographie von H. und daraus resultierende Handlungsalternativen
15.1. Allgemeine Vorbemerkungen
15.2. Strukturierung des Heimes
15.3. Enge Bezugspersonen innerhalb des Heimes
15.4. Lernfelder außerhalb der Einrichtung
15.5. Elternarbeit - stetige Bezugspersonen außerhalb des Heimes
15.6. Der Heimwechsel
16. Chancen der Heimerziehung für H.
17. Schlußwort
Literaturverzeichnis
Anhang
Theoretischer Teil
1. Fragestellung
”Man sagt, Heime sind wichtig, um Kriminalität zu vermeiden, während dort in Wirklichkeit Kriminalität gezüchtet wird, sie sind bekanntlich Brutstätten der Kriminalität” (Homes, 1984, S. 58). Dieser veröffentlichte Standpunkt ist oft zu hören. In weiten Kreisen gilt, daß Heimerziehung kaum in der Lage ist, auf die Problemlagen der Kinder und Jugendlichen einzugehen, geschweige denn, ihnen bei der Bewältigung ihrer aktuellen Lebenskrise hilft. Angesichts dieser Urteile gilt es zu hinterfragen, wie die Auswirkungen der Heimerziehung auf das Erleben und Verhalten ihrer Bewohner sind.
Innerhalb meiner Arbeit möchte ich mich mit folgenden Fragen auseinandersetzen:
Welche Auswirkungen hat eine Heimsozialisation für die Persönlichkeitsentwicklung der Bewohner?
Wie muß Heimerziehung gestaltet sein, um negative Sozialisationsfaktoren zu minimieren?
Als Grundlage meiner Arbeit habe ich mir das Modell der ökologischen Sozialsationsforschung gewählt. Dieses erläutere ich in den folgenden Abschnitten genauer. Anschließend untersuche ich einzelne Systemmerkmale von Heimen in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung .
Im praktischen Teil meiner Arbeit stelle ich exemplarisch einen Jungen aus einem Kinderheim vor. Dabei gehe ich auf dominierende Verhaltensweisen, mit verursacht oder verstärkt durch neunjährige Heimerziehung, ein. In seiner Heimbiographie möchte ich Kritikpunkte aufzeigen und Alternativen darstellen.
2. Einleitung, theoretischer Teil
In großen Teilen der Öffentlichkeit besitzt Heimerziehung ein negatives Image.
Weitverbreitete Meinungen sind:
- Heimerziehung ist das letzte Mittel und die Vorstufe zum Gefängnis;
- In Heimen werden kriminelle Jugendliche untergebracht, die selbst daran schuld sind.
Zugleich wird den Heimen abgesprochen, effektive Hilfe zu leisten, da sie Anonymität ausstrahlen, die Kinder ohne feste Bezugspersonen aufwachsen und keinen Raum zur Individualität lassen.
Doch gilt dieses Bild heute noch? Literatur, die eine völlige Ablehnung gegenüber der Heimerziehung zum Ausdruck bringt, entstand in der Bundesrepublik überwiegend Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre. Geschuldet war dies der Heimkampagne, welche auf mangelhafte Zustände in den damaligen Heimen aufmerksam machte. Seitdem hat sich in der alten Bundesrepublik und seit der Wiedervereinigung auch in den neuen Bundesländern viel verändert. ”In der Praxis der Heimerziehung sind z.B. die Ausweitung der Betreuungsangebote, Dezentralisierung und die Auflösung der geschlossenen Anstalten zu nennen. Bestimmte Betreuungsformen sind mittlerweile legitime Alternativen für Kinder alleinerziehender Väter oder Mütter. Mädchenhäuser und Kinderhäuser haben sich als sinnvolle und notwendige Form des Schutzes von Mädchen und Kindern vor zunehmender Gewalt erwiesen und etabliert. Zu verzeichnen ist auch eine (tendenziell) veränderte Einstellung vieler Jugendlicher gegenüber ”dem Heim”. So wollen z. B. immer mehr Kinder selbst entscheiden, ob sie in Jugendwohngemeinschaften statt in der Familie wohnen wollen” (vgl. Kupffer (Hrsg.) 1994, S.14). Des weiteren haben sich zahlreiche Sonderformen und Alternativen zur klassischen Heimerziehung gebildet.
Dieses verschiedenartige Angebot von stationären Jugendhilfeeinrichtungen macht es schwer, von der Heimerziehung im allgemeinen zu sprechen. Innerhalb meiner Arbeit werde ich dennoch versuchen, übergreifende Systemmerkmale herauszuarbeiten. Um der Mannigfaltigkeit gerecht zu werden, gehe ich auf Binneneigenschaften von Heimen gesondert ein.
3. Das Sozialisationsmodell
3.1. Sozialisation aus der Sicht der ökologischen Sozialisationsforschung
Zur Erklärung von Sozialisationsprozessen in Heimen habe ich mir das Schema der ökologischen Sozialisationsforschung gewählt. Dieser Erklärungsansatz wird durch seine interdisziplinäre Ausrichtung den vielseitigen Prozessen und deren gegenseitigen Abhängigkeiten nach meiner Meinung am besten gerecht. Eines der bekanntesten Modelle ökologischer Sozialisation stammt von Bronfenbrenner. Menschliche Entwicklung wird in diesem Ansatz gleichgesetzt ”mit der fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche” ( Bronfenbrenner 1989, S.37). Bronfenbrenner betont die Wechselwirkung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Aus der Sicht des Heimes bedeutet dies, daß ein Jugendlicher nicht nur von der Situation im Heim geprägt wird, sondern seinerseits auch die Situation im Heim prägt. Die für die Entwicklung so entscheidende Wechselwirkung kommt auch im folgendem Satz zum Ausdruck. ”Dieser Prozeß wird fortlaufen von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von größeren Kontexten beeinflußt , in die sie eingebettet sind” ( Bronfenbrenner 1989, S.37 ). Diese Kontexte werden als unterschiedlichste Systeme gesehen. So gibt es bei Bronfenbrenner die sogenannten Mikro-, Exo-, Makro- und Chronosysteme ( vgl. Bronfenbrenner 1989, S.38 ff.). Sie stehen in enger Wechselwirkung zueinander. Die ursprünglich von Bronfenbrenner konzipierte Modellvorstellung favorisiert konsequent die Wechselwirkung der einzelnen Systeme. Bertram (1981) modifiziert dieses Modell. Er sieht einen kausalanalytischen Aufbau, der die Determinierung einer Systemebene durch die jeweils höher gestufte Ebene postuliert. Jedoch schließt auch Bertram kausale Wirkungen von unten nach oben nicht aus.
Innerhalb der systemischen Sichtweise Bronfenbrenners ist aus methodischen Gründen eine Forschung an Einzelzusammenhängen und Teilabhängigkeiten wichtig. Diese sind nach Analyse in den ökologische Kontext einzuordnen und zu bewerten.
Bronfenbrenner sieht Auswirkungen der Umwelt auf Verhalten und Entwicklung darin, daß es ”bedeutsam ist, wie sie wahrgenommen wird, und nicht wie sie in der objektiven Realität sein könnte” (Bronfenbrenner 1979, S.20). Für die Beurteilung der Bedingungen in Heimen bedeutet dies, daß eine systemische Sichtweise erfolgen muß..
3.2. Zur ökologisch - systemischen Sicht des Heimes
Innerhalb der ökologisch - systemischen Sichtweise betrachte ich das Heim als Mikrosystem. Damit ist mit dem Grundmuster ”Mikrosystem” keine letzte unteilbare Einheit entstanden. Vielmehr kann das Mikrosystem Heim weiter strukturiert werden. Diese Elemente sieht Bronfenbrenner als strukturelle Determinanten, als unabhängige Variable. Sie spielen bei der Persönlichkeitsentwicklung eines Heimkindes eine große Rolle. Zu diesen Elementen innerhalb des Heimes zählen:
- Die Bewohner;
- Die Mitarbeiter;
- sowie die allgemeinen Wohn und Lebensbedingungen.
Sie sind konkret vorhanden, also reale Elemente.
Auf der abstrakten Ebene (abstrakte Elemente) sind:
- Die formale Organisation, hierzu zählen die Gestaltung von Dienstplänen, Hausordnungen usw. sowie
- Das pädagogische (z.B. klassisches Erziehungsheim im Gegensatz zu betreuter Außenwohngruppe) zu sehen.
Diese Elemente gehen innerhalb des Mikrosystems Heim Interaktionsbeziehungen ein. In vielen Untersuchungen, so auch bei Hansen werden die Bewohner von Heimen als abhängige Variable gesehen. Durch folgende Grafik (Hansen 1994, S.12) sollen die gegenseitigen Verflechtungen im Mikrosystem Heim dargestellt werden.
Mikrosystem Heim
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhand dieser Grafik sind die einzelnen Elemente des Mikrosystems Heim gut zu erkennen. Sie bedingen sich einander und stehen in einem Interaktionsverhältnis. Auch ist die Einbettung des Mikrosystems in andere Systeme festzustellen. So existiert das Heim nicht für sich sondern steht im Austausch mit dem Meso-, Exo-, Makro- und Chronosystem. Als Mesosysteme sind hier die Gemeinde, das politische Umfeld sowie die Trägerschaft zu nennen. Das staatliche Sozialwesen steht für ein Makrosystem während die Eltern, andere Bezugspersonen sowie die Nachbarschaft Exosysteme darstellen. Innerhalb dieser Systeme gibt es zunächst objektive Eigenschaften. So lassen sich zum Beispiel die Größe der Einrichtung, die Höhe der Tagessätze oder Zuschüsse sowie die Trägerschaft feststellen. Doch läßt Bronfenbrenner in seiner Theorie ausdrücklich erlebte Umwelten zu. So können z.B. die nachbarschaftlichen Beziehungen verschieden erlebt werden.
Nach Dreesmann (1986, S. 447 - 469) lassen sich folgende ökologische Dimensionen innerhalb des Mikrosystems Heim feststellen:
Physikalische, architektonische Dimension Lage des Ortes
Größe des Ortes
Größe des zur Verfügung stehenden Wohnraums
Zuschnitt des Wohnraums
Funktionale Dimensionen Belohnung und Unterstützung
Modell- und Identifikationsmöglichkeiten
Arten von Sanktionsmaßnahmen
Psychosoziales Klima Erzieherverhalten (Strenge versus Unterstützung /
Konsistenz)
Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kinder im Alltag
Häufigkeit von Sachbeschädigungen
Art der Gruppenzusammensetzung und daraus
resultierender Gruppeneinfluß
Behavior setting Heim
Wohngruppe
Gemeinschaftsräume
Kinderzimmer
Küchen
Organisationsstruktur des Heimes Konzeption des Heimes / Art des Heimes
Anzahl der Heimplätze
Gruppenstärke
Strukturierungsgrad der Freizeit
Elternarbeit
Diese Merkmale haben eine Sozialisationsrelevanz innerhalb des Heimes. Im folgenden Teil meiner Arbeit möchte ich auf einige näher eingehen. Neben diesen Faktoren, welche zum Großteil durch das Heim bedingt sind, gibt es auch externe Faktoren, welche auf das Heimkind wirken.
Hierzu zählen zum Beispiel:
- Familiäre Kontakte;
Wie oft wird das Kind beurlaubt?
Wie eng ist der Elternkontakt?
Hat es Bezugspersonen außerhalb des Heimes?
- Schulische Situation;
Wie gut ist das Kind in der Schule?
Kann es eventuelle Mißerfolge durch seine schulischen Leistungen kompensieren oder nimmt es in der Schule eine Außenseiterrolle ein?
- Besondere Umstände der Heimbiographie;
Wie oft mußte es seine Gruppe wechseln?
Gab es einen Heimwechsel?
Hat es Erfahrungen mit Pflegefamilien?
Wie viele unterschiedliche Erzieher hatte es schon?
3.3. Systemspezifische Eigenschaften von Sozialisationsprozessen in Heimen
Eine allgemeine Bestimmung von systemspezifischen Eigenschaften von Heimen ist schwierig, da einerseits sich in den letzten fünfundzwanzig Jahren sich sehr verschiedene Arten von Heimen herausgebildet haben, andererseits auch das bewußte Erleben der Heimumwelt eines jeden Kindes anders ist. Gleichwohl gibt es neben den Differenzen auch Gemeinsamkeiten. So haben alle Kinder bereits einen Bruch in ihren Beziehungen zu engen Bezugspersonen hinter sich. Sei es, weil die Ursprungsfamilie als Sozialisationsinstanz versagt hat oder weil mit auftretenden Störungen der Person innerhalb der Familie nicht mehr umgegangen werden konnte und somit eine Heimeinweisung durchgeführt wurde. Es gibt hierbei natürlich auch Kombinationen aus beiden. So können auftretende Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten zum Versagen des Systems Familie führen oder aber auch durch das Versagen des Systems Familie Verhaltensauffälligkeiten auftreten. In beiden Fällen steht aber ein Abbruch bzw. eine starke Einschränkung der Kontakte zur ursprünglichen Bezugsperson an. Auch bei den Waisen, welche in der heutigen Heimerziehung sehr selten vorkommen, läßt sich ein Beziehungsabbruch feststellen. Somit erleben alle Kinder, die in ein Heim wechseln, einen Beziehungsabbruch oder eine Einschränkung der Beziehung und einen Systemwechsel. Dieser Systemwechsel kann sowohl positiv als auch negativ erlebt werden. Das Kind kommt aus einem für seine Entwicklung negativen familiären Sozialisationsmilieu in das Heim. Somit kann, auch in Begleitung der Freizeitangebotes des Heimes, dieser Wechsel für das Kind, sich als positiv darstellen. Im allgemeinen wird die Heimeinweisung durch ein betroffenes Kind jedoch negativ erlebt. Es ist eine Trennung von seinem sozialem Umfeld (Eltern, Geschwister Freundeskreis). Sprau – Kuhlen (vgl. 1983, S.49 f.) zählt zu den sozial und emotional verunsichernden Faktoren einer Heimeinweisung:
- Das Ungültigwerden der bisherigen an das Kind herangetragenen Verhaltenserwartungen und Rollenzuschreibungen;
- Die Konfrontation mit einer Vielzahl von undurchschaubaren Regeln, Funktionen, Rollen, Erziehungsstilen, Interaktionspartnern;
- Den Wegfall erlernter und eingeschliffener Konfliktlösungsmechanismen;
- Die damit verbundene Neuorientierung hinsichtlich individueller Problemlösungsstrategien;
- Das Erleben von Kontroll- und Machtlosigkeit bzw. Fremdbestimmung;
- Die Statusverunsicherung als Neuling in einer stabilen Gruppenstruktur.
(vgl. Sprau – Kuhlen 1983, S.49 f.)
Die Reaktionen auf die ”Lebenskrise” Heimeinweisung werden individuell sehr verschieden sein. So ist ein aktiver Protest gegen diesen massiven Lebenseinschnitt möglich. Dieser spiegelt sich im Entziehen der Heimeinweisung oder durch ein ständiges Opponieren gegen die Rolle als Heimkind wieder. Ebenso kann es jedoch auch zu einer Resignation kommen. Das Heimkind zeigt dann keinen Widerstand mehr und fügt sich den Erwartungen ohne mit seiner Perspektive zufrieden zu sein. Auch ist ein erneutes Überdenken der veränderten Lebenssituation vorstellbar. Das Kind könnte dann zu dem Ergebnis kommen, daß es so schlimm im Heim gar nicht ist und seine neue Lebenssituation aktiv bejahen.
In Folge der Bewältigung der Heimeinweisung kommt es zu einer Angleichung zwischen dem individuellen Verhalten des Kindes und dem Heimmilieu. Es entsteht eine Kongruenz zwischen dem Subsystem Heimkind und dem System Heim. Im Rahmen dieser Anpassung verbleiben beiden gewisse Toleranzbereiche. Innerhalb dieser ist ein abweichendes Verhalten möglich, ohne daß eines der beiden Systeme geschädigt wird. Weicht das Verhalten des Kindes allerdings stärker als innerhalb der von Toleranzen vorgegebenen Grenzen ab, so entsteht eine Konfliktsituation, in der entweder das Subsystem Heimkind oder (gemäß Bronfenbrenner, Wechselwirkung) das Mikrosystem Heim sich verändern müssen um das System zu bewahren. Diese Anpassung an das System Heim kann zum Erlernen institutionsspezifischer Eigenschaften führen. Mitunter können diese Fähigkeiten für das wirkliche Leben außerhalb des Heimes wenig brauchbar sein. ” Im Heim wird für das Heim erzogen” äußerten sich Augustin und Brocke (1986, S.51).
Eine weitere systemspezifische Eigenschaft von Heimen ist das Vorhandensein bzw. das nicht dauerhafte Vorhandensein von mehreren Bezugspersonen. Das Kind erlebt einerseits innerhalb des Gruppendienstes mehrere Erzieher, was für Alternativen bei der Wahl von Bezugspersonen spricht und durchaus positiv einzuschätzen ist. Auf der anderen Seite sind diese Vertrauenspersonen nicht ständig da und in Krisensituationen für das Kind nicht unbedingt verfügbar. Auch kommt es häufig zu zwiespältigen Gefühlen der Kinder zu den Erziehern einerseits sowie zu ihren Eltern andererseits. So streben sie vielleicht ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Erziehern an, doch wie weit darf dieses Vertrauen gehen, daß nicht das ursprüngliche Verhältnis zu ihren Eltern gefährdet wird. Hierbei spielt es nach meiner Auffassung weniger eine Rolle, wie eng das Verhältnis objektiv ist, sondern vielmehr, wie es vom Kind und insbesondere von seinen leiblichen Eltern empfunden wird. Hieraus resultiert die Schlußfolgerung nach einer intensiven Elternarbeit der Heime, um derartigen Gefahren vorzubeugen.
Weitere Eigenschaften von Heimen werde ich in den Kapiteln über die Systemeigenschaften von Heimen näher betrachten und daraus resultierende Schlußfolgerungen ziehen.
3.4. Die ökologische Entwicklungstheorie von Urie Bronfenbrenner
Gemäß Bronfenbrenner vollzieht sich Entwicklung durch die ”fortschreitende gegenseitige Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche” (Bronfenbrenner 1989, S.37). Eine molare Tätigkeit ist für Bronfenbrenner ”ein über gewisse Zeit fortgesetztes Verhalten, das sein eigenes Beharrungsvermögen besitzt und von den am Lebensbereich Beteiligten als bedeutungs- und absichtsvoll wahrgenommen wird” (Bronfenbrenner 1989, S.60).
Laut Bronfenbrenner ist die Existenz von Dyaden für Entwicklungsprozesse bedeutend. Diese Existenz ist gegeben, wenn zwei Personen einander bei ihren Aktivitäten beobachten. Bronfenbrenner unterscheidet drei funktionale Dyadenformen, welche für die Entwicklung wichtig sind: Die Beobachtungsdyade, eine Dyade gemeinsamer Tätigkeit und die Primärdyade.
”In einer Beobachtungsdyade verfolgt einer der Beteiligten mit fortgesetzter und gespannter Aufmerksamkeit die Tätigkeit des anderen, der seinerseits das gezeigte Interesse zumindest zur Kenntnis nimmt” (Bronfenbrenner, 1989, S.71).
”In einer Dyade gemeinsamer Tätigkeit nehmen die Beteiligten sich als gemeinsam tätig wahr. Das heißt nicht, daß sie dasselbe tun, ihre Tätigkeiten sind einigermaßen verschieden, aber komplementär, sind Teile eines integrierten Musters” (Bronfenbrenner, 1989, S.72).
”Eine Primärdyade besteht im Bewußtsein der beiden auch dann, wenn sie nicht zusammen sind. Jeder denkt an den anderen und hat starke Gefühle für ihn, jeder beeinflußt das Verhalten des anderen auch weiterhin, wenn sie getrennt sind” (Bronfenbrenner, 1989, S.73).
So wie sich innerhalb dieser Dyaden Entwicklungsprozesse vollziehen, sind sie auch wichtig für das Zustandekommen größerer zwischenmenschlicher Strukturen wie Triaden, Tetraden und so weiter.
Das Heimkind hat demnach günstigere Entwicklungschancen je vielfältigere und komplexere molare Tätigkeiten das Heimumfeld erlaubt. Als entwicklungsfördernd wird das Vorhandensein von Dyaden beschrieben. Bronfenbrenner sieht Lernen und Entwicklung begünstigt, ”wenn die in Entwicklung begriffene Person sich mit jemanden, zu dem sie eine starke und dauerhafte Beziehung gebildet hat, an fortschreitend komplexeren Mustern wechselseitiger Tätigkeit beteiligt und sich das Kräfteverhältnis allmählich zu ihren Gunsten verschiebt” (Bronfenbrenner, 1989, S.75). Hierbei wird besonders auf das Vorhandensein von langen und starken Beziehungen verwiesen, welche für die Entwicklung als fördernd angesehen werden.
Des weiteren verweist Bronfenbrenners ökologische Entwicklungstheorie auf die Auswirkungen des Verhaltens durch Rollenzuweisungen. Hierbei haben insbesondere Verhaltenserwartungen der Umwelt auf das Heimkind eine Bedeutung. Im Rahmen eines gesonderten Kapitels (5.1.6.) werde ich speziell auf diese Problematik eingehen.
3.5. Zusammenfassende Gedanken zum ökologischen Sozialisationsbegriff
Das zu Grunde liegende Sozialisationskonzept habe ich gewählt, da es nach meiner Meinung am umfassensten die ablaufenden Prozesse beschreiben kann. Nach dem Modell der ökologischen Sozialisation vollzieht sich Heimsozialisation nicht als passive Übernahme vorhandener Regeln und Normen. Vielmehr bleiben dem Heimkind Interpretationsspielräume und Toleranzen innerhalb der Rollenerwartungen. Auch beeinflußt das Heimkind durch sein Verhalten das Mikrosystem Heim mit. Somit ist Heimsozialisation auch immer Selbstsozialisation des Heimkindes. Die Entwicklung in einem so verstandenen Sozialisationsbegriff steht somit zwischen eigeninitiiertem Handeln und ökologischer Determination durch das Umfeld.
4. Grundlagen für eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung
4.1. Übersicht wesentlicher Erziehungsfaktoren
Kontinuität der Beziehung
- Verläßlichkeit, Zugehörigkeit, Verantwortlichkeit
- Kontinuität der Umgebung: allmähliche Erweiterung der Erfahrungsgrenzen
Qualität der Beziehung
- Vertrauen: Sicherheit und Geborgensein als Lebensgrundlage
- Autonomie: Achtung der Freiheit und Einmaligkeit jedes Menschen
- Initiative: Selbständig werden können, Spiel- und Lebensräume vergrößern
Gruppenerfahrungen
- Soziale Anerkennung finden
- Soziales Teilen lernen
- Solidarität erfahren
- Sich auseinandersetzen
Erziehung und Lernen
- Lernen als lebenslanger Erfahrungsprozeß
- Erziehung als gegenseitiger Prozeß
- Erwachsene als Modell, Orientierung und Hilfestellung
Materielle Lebensbedingungen
- Geld und Zeit der Erwachsenen
- Erfahrungsmöglichkeiten und Lernanreize bieten
- Schichtspezifische Erziehung: Bewertungsmaßstäbe beachten
- Wohnverhältnisse, Unterschiede zwischen Stadt und Land berücksichtigen
(vgl. Hanselmann / Weber, 1986, S.23)
4.2. Kontinuität, Zugehörigkeit, Verantwortlichkeit
Kinder brauchen feste und stabile Beziehungen. Dies unterstreicht auch das Modell der psychosozialen Entwicklung von Erikson (siehe Anhang). Hierbei entsteht bei ausreichender Fürsorge und hinreichender Befriedigung der Grundbedürfnisse ein Urvertrauen. Erst dann und darauf aufbauend kann das Kind weitere Entwicklungsschritte vollziehen. Die psychosozialen Folgen sind nach Erikson im positiven Fall Autonomie, Initiative, Leistung und Intimität. Fehlt es jedoch an festen Bezugspersonen in der Kindheit, insbesondere in der frühen Kindheit, können diese Entwicklungsschritte nicht vollzogen werden. Im Kleinkindalter verkraften deshalb Kinder nur wenige ”Hauptbindungsfiguren”. Die Behauptung, daß mehrere Bindungspersonen automatisch zu einer Abschwächung der Bindung führen, ist jedoch nicht immer richtig. So geht Bowlby davon aus , daß Kinder ungehemmter , weniger ängstlich und intensivere Bindungen eingehen, wenn sie zunächst die Erfahrung von Sicherheit und Vertrauen in einer ersten Beziehungen gemacht haben (vgl. Bowlby 1975, S. 279-285). So lernt das Kind auch schnell eine Differenzierung zwischen Haupt-, Neben- und vorübergehenden Bindungspersonen. Doch die Biographien vieler Heimkinder zeigen, daß es in ihrer Kindheit selten eine feste Bindungsperson gab, die erforschendes Verhalten ermöglichte und gleichzeitig bei der Notwendigkeit des Rückzuges stets zur Verfügung stand. Häufig waren oder fühlten sich die Bezugspersonen schon in der frühen Kindheit des Kindes überlastet. Diese Überforderung kann bis zu einer emotionalen Ablehnung des Kindes gehen. Die Heimeinweisung stellt dann für diese Kinder einen erneuten Beziehungsabbruch dar und verschärft somit ihre Krise.
4.3. Vertrauen, Selbständigkeit, Initiative
In den ersten Lebensjahren ist für das Kind eine ausreichende Kontinuität der Beziehung wichtig. Doch neben dieser Kontinuität gibt es auch qualitative Aspekte der Beziehung, ”ihre Tiefe, ihre Gegenseitigkeit, ihre Emotionalität, die Befriedigung ,welche sie erlauben und die Realität, welche sie vermitteln” (Hanselmann und Weber, 1986, S.25). Im Modell der psychosozialen Entwicklung von Erikson erprobt das Kind, nachdem es die Erfahrung von Vertrauen und Zughörigkeit gemacht hat, sein eigenes Handeln. Dabei erfährt es im positiven Fall Vertrauen zu sich selbst und wird zu neuen Handlungen ermuntert. Erikson nennt diese psychosozialen Folgen ”Autonomie” und ”Initiative” (vgl. Anhang). Hierbei nimmt das Kind eine aktive Rolle ein. Es erkennt sein soziales Umfeld. Dabei gibt es soziale Grenzen. Das Kind lernt, verschiedene Handlungen auszuführen, andere zu unterlassen. ”All diese Bausteine der frühen Jahre schaffen das Fundament, die Wände, die Freiräume, vielschichtige ”Etagen” - also gleichsam das ”Gebäude menschlicher Identität”, in dem später nur noch begrenzt umgebaut werden kann” (Hanselmann, Weber 1986, S.25). Doch was geschieht, wenn diese Bausteine nur unvollständig oder gar nicht zusammengesetzt wurden? Wenn fehlende bzw. mangelnde Fürsorge zu Mißtrauen, Scham und Zweifel führen (vgl. ”Die acht Stadien der psychosozialen Entwicklung nach Erikson.”; siehe Anhang)? Wenn es keine Gelegenheit gab, die Grenzen zu testen oder beim Erproben die Unterstützung fehlte?
Hier ist auch ein Problem der Heimerziehung zu sehen. Es fehlt an dauerhaften, immer zur Verfügung stehenden Bezugspersonen. Auch Bronfenbrenner gibt Dyaden bei der Entwicklung eines Menschen einen entscheidenden Stellenwert. Doch wie kann es bei nur unregelmäßigem Kontakt zu erziehenden Personen zur Entstehung einer Primärdyade kommen? Nach Bronfenbrenner erwirbt ein Kind ”Fertigkeiten, Wissen und Werte eher von einer Person, mit der es eine Primärdyade gebildet hat, als von einer, die nur für es existiert, wenn sie im gleichen Lebensbereich anwesend ist” (Bronfenbrenner 1989, S. 74). Primärdyaden dürften für Heimkinder wesentlich schwieriger und seltener als für Kindern aus ”Normalfamilien” einzugehen sein. Damit gibt es in ihrer Entwicklung einen strukturellen Nachteil.
4.4. Die Gruppe - soziale Anerkennung, soziales Teilen, Solidarität, Auseinandersetzung
Noch immer ist die Diskussion Gemeinschafts- versus Familienerziehung häufig von ideologischen Gesichtspunkten bestimmt. Die Frage wird nach einem entweder oder gestellt. Denkbare Mischformen oder das Abwägen von Vor- und Nachteilen beider bleiben häufig auf der Strecke. So wird Gruppenerziehung schon in weiten Bereichen, etwa Schulen, Kindergärten im Freizeitbereich oder in den Landschulheimen praktiziert. Der Peer - Gruppen Erziehung kommt heute in der Erziehung junger Menschen ein wichtiger Stellenwert zu. In der Heimerziehung stellt die Gruppe ein wichtiges pädagogisches Medium dar. Innerhalb einer Gruppe finden die Kinder Rückhalt und Anerkennung. Sie bietet zugleich einen gewissen ”Schutzraum” vor dem als übermächtig erscheinenden Erwachsenen. Gerade Kinder, die schon mehrere Beziehungsabbrüche zu erwachsenen Personen erlebt haben, können innerhalb einer Gruppe Gleichaltriger lernen, neue Beziehungen aufzubauen. Gruppen können Schutz vor dem Alleinsein, der Hilflosigkeit und der Einsamkeit bieten. Innerhalb einer Gruppe übernimmt der Einzelne Funktionen, hat Macht und reale Verantwortlichkeit. Die Gruppe wird zu einem Experimentierfeld, in der jeder sein Verhalten erproben kann. Somit bildet die Gruppe vielseitige Möglichkeiten zur Selbstfindung und Selbsterfahrung. Die Struktur der Gruppe, insbesondere der im Heim, ist nicht fest gefügt. Ständig laufen in ihr Rang und Machtkämpfe ab, auch verändert ein Wechsel von einzelnen Mitgliedern der Gruppe ihre Struktur. Die meisten Kinder und Jugendlichen werden in stationären Formen der Erziehungshilfe mit Beginn der Pubertät untergebracht. In diesem Alter werden Wertvorstellungen und Normen der Erwachsenen in Frage gestellt. Hier bietet die Gruppe einen Schutz- und Schonraum, um die eigene Identität zu finden.
Neben diesen, zweifellos großen Vorteilen der Gruppe, gibt es jedoch auch Nachteile und Probleme der Gruppenerziehung. So ermöglicht permanente Gruppenerziehung kaum ein Ausweichen oder sich Zurückziehen des Einzelnen. Auch wird der Einzelne zu einem Teil der Gruppe, in der er vieles teilen muß. So kann bei bestimmten Kindern und Jugendlichen ein Gefühl des ”zu kurz zu kommen” auftreten. Besonders jüngere Kinder sind teilweise mit dem Geflecht und der Dynamik der verschiedenen wechselnden Beziehungen innerhalb einer Gruppe überfordert.
4.5. Erziehung und Lernen
”Was erzieht?
Es erzieht der Hunger und die Art wie er gestillt werden kann.
Es erzieht die Kälte und die Art, wie ein Obdach oder Kleidung errungen werden können.
Es erzieht die Art, wie die Menschen miteinander begegnen, wie einander zu begegnen sie durch ihre Nöte gezwungen werden”
(Brecht, Bd. 20, S.84, vgl. Augustin / Brocke 1979, S.44).
Im Gedicht ”Was erzieht” drückt Brecht treffend aus, daß es die existentiellen materiellen und sozialen Bedürfnisse sind sowie die Art, wie diese befriedigt werden, welche einen Menschen formen.
Es sind Erfahrungen mit der unmittelbaren Umwelt sowie unserem sozialem Umfeld. Dieses Wissen kann individuell sehr verschieden sein. Ein Kind, das in ländlicher Umgebung aufwächst, wird andere Lernfelder und Lebensumwelten haben, als ein großstädtisch geprägtes Kind. Beide müssen sich in unterschiedlichen Sozialisationsmilieus zurecht finden und lernen dafür auch unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Normalfall einer erfolgreichen Sozialisation werden sich später beide in ihren Lebensumwelten gut zurechtfinden.
Doch was geschieht bei einer Lebensumwelt (Heim), deren Regeln und Normen nicht an der realen Lebenswirklichkeit orientiert sind? Wo andere Regeln als im späteren Lebensumfeld gelten? Ich möchte diesen Punkt hier nicht weiter ausweiten sondern auf Kapitel 5.1.2. meiner Arbeit verweisen.
Während in der Familie Erziehungsprozesse quasi nebenbei ablaufen, werden diese im Heim bewußt geplant. Hierzu gehört eine didaktische Strukturierung des Lernfeldes. Diese Didaktik ist Familien fremd. Eltern vermitteln ihre Werte und Einstellungen unbewußt und selbstverständlich im Alltag mit an ihre Kinder.
Hanselmann und Weber plädieren in ihrem Buch ”Kinder in fremder Erziehung” dafür, daß Pädagogen im Alltag Echtheit, Direktheit und Gegenseitigkeit zulassen. Dies sind Eigenschaften, die sich nicht planen oder organisieren lassen, die aber für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender Bedeutung sind (vgl. Hanselmann und Weber 1986, S.30). Die Wichtigkeit von dyadischen Beziehung in Lernprozessen habe ich bereits im Kapitel 4.3. erläutert. Die Bedeutsamkeit dieser möchte ich noch einmal hervorheben ohne gesondert darauf einzugehen.
4.6. Materielle Bedingungen
Ein Punkt, welcher entscheidend die Entwicklung eines Kindes prägt, wird in entwicklungspsychologischen Betrachtungen häufig vergessen. Ich sehe es als eine Art Überbau, der dem Kind erst die sozialen Teilnahmechancen gibt. Es sind die materiellen Bedingungen, in denen es aufwächst.
Wie wirkt es sich auf die Entwicklung des Kindes aus, wenn es wegen Geldmangels der Eltern nicht an der Klassenfahrt teilnehmen kann, wenn alle aus seiner Klasse Fußballschuhe haben, nur er nicht?
Die Sozialisationsbedingungen eines Kindes aus der unteren Schicht sind wesentlich andere als eines Kindes der Mittelschicht. So enthalten zwar beide Wohnumfelder Erkundungs- und Spielmöglichkeiten, doch wie eingeschränkt sind diese in einem Neubauviertel einer Großstadt?
Durch diese materiellen Bedingungen treten auch psychische Belastungen der Unterschichtfamilien auf, die sich im Erziehungsstil und im Erziehungsverhalten niederschlagen.
Probleme unterer Sozialschichten zeigen sich in mannigfacher Weise, zu diesem Ergebnis kommt eine von der Universität Bremen 1999 vorgestellte Studie (Stengel, 1999, S.31, siehe Anhang). ”Am stärksten zeigten sich Zukunftssorgen und damit verbundene Gesundheitsprobleme in den unteren Sozialschichten. ... So gaben doppelt so viele Hauptschüler wie Abiturienten an, daß sie in den vergangenen Monaten dreimal oder öfter ernsthaft erkrankt waren” (Stengel, 1999, S.31, siehe Anhang).
Weiterhin gehen Studien davon aus, daß in Familien der Unterschicht mehrheitlich autoritärer erzogen wird als in Familien der Mittelschicht. Somit ergeben sich für Angehörige der Unterschicht andere Kommunikationsstrukturen, Einstellungen, Normen und Werte als für Angehörige der Mittelschicht. Im Heim, in welches mehrheitlich Kinder der Unterschicht kommen, wird nun nach Werten, Prinzipien und Normen der Mittelschicht von Pädagogen größtenteils aus der Mittelschicht erzogen. Dabei kommt es bei den Kindern und Jugendlichen häufig zu Verhaltensunsicherheiten, da ihre früher gemachten Erfahrungen ihnen häufig nicht mehr viel nützen.
In vielen Fällen können sie jedoch erstaunliche Anpassungsleistungen vollbringen. So übernehmen sie in ihren Verhaltensweisen den im Heim üblichen Erziehungsstil, können jedoch bei einem Wechsel in ihr Herkunftsmilieu ihre ursprünglich erlernten und für nützlich erwiesenen Verhaltensweisen anwenden.
5. Systemeigenschaften von Heimen und deren Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von Heimkindern
5.1. Sozialisationsbedingte Probleme in Heimen
5.1.1. Ausgangssituation
Wie bereits in der einleitenden Fragestellung (Kapitel 2.) angesprochen, ist es schwierig, ”das Heim” zu bestimmen und daraus ableitend allgemeingültige Systembedingungen zu beschreiben. Gleichwohl stimmt die wissenschaftliche Literatur in einigen übergreifenden Punkten auffällig überein. In der Regel wird bei diesen Punkten von einer negativen Auswirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung des Heimkindes ausgegangen. In den folgenden Kapiteln werde ich mich insbesondere auf die empirischen Studien von Hansen (1994) und Bürger (1990) stützen. Diese beiden Untersuchungen gehören zu den wenigen im deutschen Sprachraum, welche ihre Erhebungen ganz oder teilweise an Kindern und Jugendlichen machten, die nach der Heimkampagne und den damit einhergehenden Reformen in Heimen lebten.
5.1.2. ”Totale Institution”
Ein Problem der Heimerziehung ist die Trennung des Heimes von der Gesellschaft. Hanselmann und Weber kommen zu der These, daß dieses Problem heute kein Heim ganz lösen kann (vgl. Hanselmann und Weber 1986, S.56). ”Denn ein wirklich gutes Heim darf nicht ”zu öffentlich” und nicht ”zu privat” sein” (Hanselmann und Weber 1986, S.56)! Demnach haben Heime heute einen Spagat zu vollbringen. Sie müssen einerseits so geschlossen sein, daß sie ihren Bewohnern den Schutz der Privatsphäre garantieren, andererseits müssen sie öffentlich genug sein, um positive Außenkontakte und Außenbeziehungen ihrer Bewohner zu ermöglichen. Insbesondere in den 70er Jahren wurde diese Isolation der Heime, mit den nur darin geltenden Regeln unter dem Begriff ”Totale Institution” kritisiert. Goffmann (1972, S.11) beschreibt diese wie folgt: ”Eine totale Institution läßt sich als Wohn- und Arbeitsstätte ähnlich gestellter Individuen definieren, die für längere Zeit von der Gesellschaft abgeschnitten sind und miteinander ein abgeschlossenes, formal reglementiertes Leben führen.” Nach seiner Ansicht sind die Freiheiten der dort lebenden Bewohner in erheblichen Maße eingeschränkt.
Seit der pädagogischen Neuorientierung der Heimerziehung erscheint es für viele Heime als fragwürdig von totaler Institution zu sprechen. Trotzdem lassen sich bestimmte Systemmerkmale aufzeigen, die auf eine ”totale Institution” hindeuten. Dies dürfte insbesondere für größere zentralisierte Einrichtungen zutreffen. Zu den Systemmerkmalen zählen u.a.:
- Die räumliche und kulturelle Abschottung vom eigenen Umfeld;
Dies wird deutlich durch eine abseits gelegene Lage, durch eigene Sport- und Freizeitanlagen, durch eine fehlende architektonische Integration des Gebäudes in das Umfeld, durch einen zentralen Einkauf und eine zentrale Essenzubereitung.
- Die Regelung und Disziplinierung im Alltagsablauf durch starre Regeln und Verbote;
Diese Regeln sind zumeist schriftlich fixiert. Sie sollen für alle das Leben transparent und durchschaubar machen. In der Praxis muß der Pädagoge diese dann jedoch ohne jegliche Toleranz auslegen, um nicht selbst in Konflikte zu kommen.
- Die Öffentlichkeit in weiten Bereichen der Lebensvollzüge;
Dies bezieht sich auf das Fehlen oder den Mangel an individuellen Raum für das Heimkind. So besitzt nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer, in das es sich bei Bedarf ungestört zurückziehen kann. Wenig persönlicher Besitz und eine stark vorgegebene Freizeit sind weitere Merkmale.
- Abschottung von Lernfeldern;
Dieses Merkmal geht eng mit dem Systemmerkmal der räumlichen und kulturellen Abschottung einher. Das Kind erwirbt seine Lebenserfahrungen überwiegend innerhalb der Institution. Dies bedeutet zugleich, es macht sie überwiegend mit Regeln dieser Institution und nicht mit dem ”wirklichen Leben”. Der Satz ”Im Heim wird für das Heim erzogen” unterstreicht dies nachdrücklich. Zu dem Mangel an Lernfeldern möchte ich im Praxisteil meiner Arbeit noch einmal gesondert eingehen.
Die Heimkinder entwickeln unterschiedliche Anpassungsmerkmale. Diese können je nach Dauer und Intensität dieser ”totalen Einflüsse” sich zu übersituativen Merkmalen (Persönlichkeitsmerkmalen) verfestigen. Goffmann (vgl. 1972, S.48 f.) beschreibt einzelne Reaktionen aus denen auf auftretende Persönlichkeitsmerkmale geschlossen werden kann. Zunächst ist hier die ”Strategie des Rückzuges aus der Situation” zu nennen. Das betroffene Kind zeigt nur noch geringes Interesse und eine geringe Beteiligung an einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Ereignis. Es stumpft sozial und emotional ab. ”Beobachtet werden retreative Verhaltenstendenzen, Passivität und Antriebsschwäche” (Hansen, 1994, S.42).
Im Vergleich zum ”Rückzug aus der Situation” ist der nächste Verhaltensstil der ”kompromißlose Standpunkt” von den meisten Heimkindern nicht dauerhaft durchzuhalten und damit eher selten zu finden. In ihm lehnt sich das Kind aktiv gegen vorgegebene Normen auf. Die Konsequenz dieses Verhaltens ist eine dauerhafte Konfrontation mit den Pädagogen, die durch die ihnen zur Verfügung stehende Machtmittel eine Änderung des Verhaltensstils bewirken. Mit ziemlicher Sicherheit wird ihnen das auf Dauer auch gelingen oder das Kind wird das Mikrosystem Heim wieder verlassen. Somit ist dieses Verhalten zeitlich begrenzt, eine Verfestigung zu einem Persönlichkeitsmerkmal scheint deswegen eher unwahrscheinlich.
Ein weiterer Verhaltensstil ist der des ”kolonisierten” Heimkindes. Es hat sich mit seiner Umgebung so weit wie möglich arrangiert. Die pädagogischen Bemühungen scheinen bei ihm auf Erfolg zu stoßen. Es strebt ein freundliches Verhältnis zu seinen Erziehern an und versucht, die ihm gegebenen Möglichkeiten für seine Entwicklung zu nutzen. Problematisch hierbei wirken kindliche Autonomiebestrebungen. Diese können sich im Umfeld ”totaler Institutionen” aufgrund der permanenten und engeren Kontrollen schlechter entwickeln. Denkbar wäre hier ein dadurch resultierendes höheres Aggressionsbedürfnis.
So kommt auch die Studie von Hansen (vgl. 1994, S.196 f.) zu erhöhten Werten der Probanden aus Heimen bei dem Punkt ”aggressives Bedürfnis nach Ich - Durchsetzung”. Er beschreibt: ”Die daraus zu schließenden aggressionsverstärkenden Sozialisationseffekte des Heimaufenthaltes finden sich besonders markant in den Bereichen der manifesten Aggression mit offenen Durchsetzungscharakter und für das Moment der Ich - Durchsetzung” (ebd. s. o.).
Einen vierten Anpassungsmodus sieht Goffmann bei der ”Konversion”. Das Heimkind zeigt sich bedingungslos gehorsam und angepaßt. Es geht ständig mit der Meinung der Erzieher konform. Hier scheint ein übersteigerter Glaube an Autoritäten vorhanden zu sein. Diese These stützt die Studie von Hansen (1994, S.199). In ihr liegt die Abhängigkeits- und Gehorsamsneigung der Heimkinder höher als der der Familienkinder. Die höchsten Werte erreichen Kinder und Jugendliche, die erst kurzzeitig in Heimen leben, während mit zunehmender Länge des Heimaufenthaltes ein Sinken der Ergebnisse zu verzeichnen ist. Dies hängt mit der Herkunft vieler Heimkinder aus der Unterschicht zusammen. Der dort verbreitete autoritärere Erziehungsstil kann (vgl. Kapitel 4.5.) bei den Systemwechslern zu einer höheren Erwachsenen - Abhängigkeit führen. Mit Zunahme des Heimaufenthaltes verringert sich dieser Wert und es werden vermehrt eigene Bedürfnisse des Heimkindes eingefordert. ”Vereinfacht könnte man sagen, daß Heimkinder lernen, weniger ”blind” zu gehorchen” (Hansen, 1994, S.200).
Eine weitere Eigenschaft der ”totalen Institution” ist die Abschottung gegenüber der Umwelt. Wie bereits beschrieben, muß ein jedes Heim einen Weg zwischen einer Öffentlichkeit und den Schutz der Privatsphäre seiner Bewohner finden. Das Heim als Organisation ist ein soziales System. Diese Systeme sind aus sich heraus nicht überlebensfähig, sondern auf den Rückgriff auf externe Ressourcen angewiesen. Durch diese Umweltoffenheit werden Veränderungen und Anpassungen der Organisation vorangetrieben. Somit erreichen offenen Systeme nie ein völliges Gleichgewicht. Dies würde ihre Existenz in Frage stellen. ”Totale Institutionen” neigen jedoch zu einer Starrheit und einem weitestgehenden Ausschluß der Umwelt. Innerhalb dieses Mikrosystems erstarren einzelne Subsysteme. Simmen (1990, S.48 f.) sieht, daß Starrheitstendenzen in der Heimerziehung häufig anzutreffen sind. Es finden immer weniger überlebensnotwendige Austauschprozesse mit der Umwelt statt und alle Aktivitäten und Energien werden auf die Subsysteme gelenkt. Das Mikrosystem Heim kann sein Überleben dann nur noch sichern, indem es einen Mindestaustausch mit der Umwelt zuläßt (Ärztebesuche, Wechsel von Heimkindern, Wechsel von Teilen des Personals) oder innersystemische Konflikte so dringlich werden, daß sie thematisiert werden müssen. So können Systemveränderungen entstehen, welche das System wieder überlebensfähig machen und aus seiner Starrheit befreien. Erfolgt diese Systemveränderung bzw. der fortwährende Umweltaustausch nicht, so werden sich Auswirkungen der Systemerstarrung bei den Subsystemen (Erzieher, Heimkinder) zeigen. Diese können mit Resignation, Passivität oder Rückzug reagieren. Auf Seiten der Erzieher sei hier das Burn -Out Syndrom genannt. Bei den Kindern und Jugendlichen könnte durch erhöhte Aggressivität oder das Entweichen Verhaltenserscheinungen auftreten, die Systemveränderungen notwendig machen und das Mikrosystem somit am Leben erhalten.
In der Praxis dürften diese Verhaltenserscheinungen hervorgerufen durch das Systemmerkmal der ”Totalen Institution” nur noch in abgeschwächter Form vorkommen. Durch Dezentralisierung, Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen auf die unteren Ebenen und Entbürokratisierung versuchen viele Einrichtungen, dieses Systemmerkmal zu minimieren.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1999
- ISBN (eBook)
- 9783832454128
- ISBN (Paperback)
- 9783838654126
- DOI
- 10.3239/9783832454128
- Dateigröße
- 4.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Berufsakademie Sachsen in Breitenbrunn – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Mai)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- persönlichkeitsentwicklung sozialisationsfaktoren heimerziehung
- Produktsicherheit
- Diplom.de