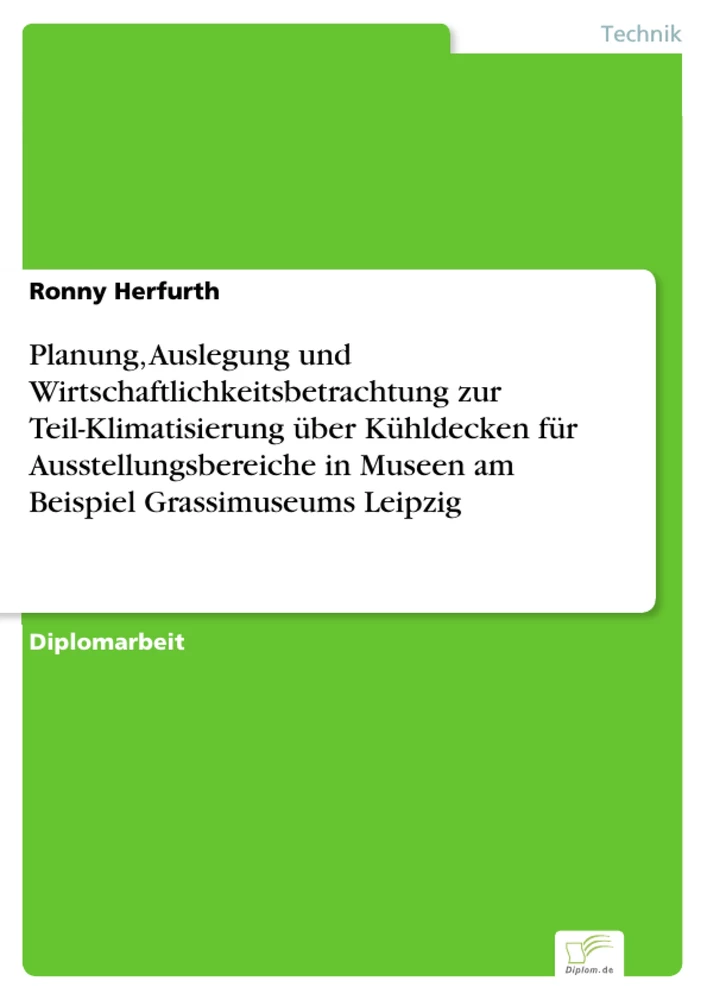Planung, Auslegung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Teil-Klimatisierung über Kühldecken für Ausstellungsbereiche in Museen am Beispiel Grassimuseums Leipzig
©2001
Diplomarbeit
85 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Entsprechend DIN 1946/2 zählen Museen nicht als Versammlungsräume, in denen die Behaglichkeitsbedürfnisse der Personen erfüllt werden müssen, sondern primär dient hier eine Luftbehandlung dem Schutz der Kunstwerke. Hierzu gehören z.B. Gemälde auf Leinwänden oder Holz, Holzskulpturen, Holztafelbilder, völkerkundliche Sammlungsgegenstände, Fresken, Handschriften, Zeichnungen, Drucke, Gegenstände tierischen Ursprungs, Teppiche, Musikinstrumente u.a.
Zunächst müssen die Einflüsse von außerhalb des Gebäudes verhindert oder vermindert werden. Dazu zählen die starken Temperatur- und Feuchteschwankungen und die Luftverschmutzungen. Moderne Bauten mit großen Fensterflächen und umfangreiche Beleuchtungskörpern verursachen außerdem erhöhte Kühllasten, die eine Luftkühlung erforderlich machen.
Gang der Untersuchung:
Im Rahmen der Diplomarbeit soll eine Kühldecke für die Klimatisierung von Ausstellungsräumen in einem Museum ausgelegt werden. Dabei soll überprüft werden, ob über das ausgelegte System eine Beheizung der Räume erfolgen kann. Des weiteren soll eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des eingesetzten Systems zu einer Teilklimaanlage erfolgen.
Für die Ausstellungsbereiche des Kunsthandwerkes soll dabei eine Teilklimatisierung über Kühlflächen erfolgen. Es stehen 3 Varianten zu Auswahl:
Variante 1: Kühlflächen im Fußboden.
Variante 2: Kühlflächen im Wandbereich.
Variante 3: Kühldecken.
Unter Abwägung aller technischen Vor- und Nachteile, der Auswirkung auf die Ausstellungsgestaltung sowie der jeweils erforderlichen Kosten bleibt die Kühldecke die einzig sinnvolle Lösung für die Einordnung von Kühlflächen in den Ausstellungsbereichen. Dabei soll die Kapillarrohrtechnik als Kühldeckensystem zum Einsatz kommen und im Rahmen dieser Diplomarbeit als Entwurfsplanung ausgelegt werden.
Des weiteren soll überprüft werden, ob eine Beheizung über dieses System erfolgen kann, und welche Investitionsersparnisse beim Einsatz der Kühl- und Heizdecke inklusive Lüftung gegenüber einer Teilklimaanlage sich ergeben.
Vor der Wärmebedarfs- und Kühllastberechnung aller Ausstellungsbereiche und der Auslegung der Kühl- und Heizmatten werden kurz wichtige Erklärungen und Informationen zur Kapillarrohrtechnik gegeben.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Vorwort4
1.Museen5
1.1Einleitung5
1.2Anforderungen an Raumklima5
1.2.1Relative Luftfeuchte5
1.2.2Raumtemperaturen6
2.Definitionen zur Berechnung des Wärmebedarfs nach DIN […]
Entsprechend DIN 1946/2 zählen Museen nicht als Versammlungsräume, in denen die Behaglichkeitsbedürfnisse der Personen erfüllt werden müssen, sondern primär dient hier eine Luftbehandlung dem Schutz der Kunstwerke. Hierzu gehören z.B. Gemälde auf Leinwänden oder Holz, Holzskulpturen, Holztafelbilder, völkerkundliche Sammlungsgegenstände, Fresken, Handschriften, Zeichnungen, Drucke, Gegenstände tierischen Ursprungs, Teppiche, Musikinstrumente u.a.
Zunächst müssen die Einflüsse von außerhalb des Gebäudes verhindert oder vermindert werden. Dazu zählen die starken Temperatur- und Feuchteschwankungen und die Luftverschmutzungen. Moderne Bauten mit großen Fensterflächen und umfangreiche Beleuchtungskörpern verursachen außerdem erhöhte Kühllasten, die eine Luftkühlung erforderlich machen.
Gang der Untersuchung:
Im Rahmen der Diplomarbeit soll eine Kühldecke für die Klimatisierung von Ausstellungsräumen in einem Museum ausgelegt werden. Dabei soll überprüft werden, ob über das ausgelegte System eine Beheizung der Räume erfolgen kann. Des weiteren soll eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des eingesetzten Systems zu einer Teilklimaanlage erfolgen.
Für die Ausstellungsbereiche des Kunsthandwerkes soll dabei eine Teilklimatisierung über Kühlflächen erfolgen. Es stehen 3 Varianten zu Auswahl:
Variante 1: Kühlflächen im Fußboden.
Variante 2: Kühlflächen im Wandbereich.
Variante 3: Kühldecken.
Unter Abwägung aller technischen Vor- und Nachteile, der Auswirkung auf die Ausstellungsgestaltung sowie der jeweils erforderlichen Kosten bleibt die Kühldecke die einzig sinnvolle Lösung für die Einordnung von Kühlflächen in den Ausstellungsbereichen. Dabei soll die Kapillarrohrtechnik als Kühldeckensystem zum Einsatz kommen und im Rahmen dieser Diplomarbeit als Entwurfsplanung ausgelegt werden.
Des weiteren soll überprüft werden, ob eine Beheizung über dieses System erfolgen kann, und welche Investitionsersparnisse beim Einsatz der Kühl- und Heizdecke inklusive Lüftung gegenüber einer Teilklimaanlage sich ergeben.
Vor der Wärmebedarfs- und Kühllastberechnung aller Ausstellungsbereiche und der Auslegung der Kühl- und Heizmatten werden kurz wichtige Erklärungen und Informationen zur Kapillarrohrtechnik gegeben.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Vorwort4
1.Museen5
1.1Einleitung5
1.2Anforderungen an Raumklima5
1.2.1Relative Luftfeuchte5
1.2.2Raumtemperaturen6
2.Definitionen zur Berechnung des Wärmebedarfs nach DIN […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5369
Herfurth, Ronny: Planung, Auslegung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Teil-Klimatisierung
über Kühldecken für Ausstellungsbereiche in Museen am Beispiel Grassimuseum Leipzig /
Ronny Herfurth - Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Riesa, Berufsakademie, Diplomarbeit, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-1-
98VU023
Inhaltsverzeichnis:
Seite:
0 Vorwort... 4
1 Museen... 5
1.1 Einleitung... 5
1.2
Anforderungen an Raumklima ... 5
1.2.1 Relative
Luftfeuchte ... 5
1.2.2 Raumtemperaturen... 6
2
Definitionen zur Berechnung des Wärmebedarfs nach DIN 4701 ... 7
2.1
Definition des Begriffs Wärmebedarfs... 7
2.2 Erforderliche
Berechnungsgrundlagen ... 8
2.3 Norm-Wärmebedarf... 8
2.4 Norm-Gebäudewärmebedarf ... 9
2.5
Norm-Transmissions- und Norm-Lüftungswärmebedarf ... 9
2.6 Wärmedurchgang... 10
3
Definition zur Kühllastberechnung ... 11
3.1 Definition
Kühllast ... 11
3.2
Berechnungsverfahren zur Kühllastbestimmung... 11
3.3 Innere
Kühllast ... 12
3.4 Äußere
Kühllast ... 13
3.5 Wärmespeicherung ... 13
3.6 Kühllastfaktoren ... 14
3.6.1 Temperaturen... 14
3.6.2 Wärmespeicherfaktoren... 14
4 Kühldecken ... 15
4.1 Allgemeines ... 15
4.2
Vorteile und Merkmale von Kühldecken ... 17
4.3
Lüftung bei Anwendung einer Kühldecke... 19
4.3.1
Kühldecken mit natürlicher Fensterlüftung ... 19
4.3.2
Kühldecken mit unterstützender Lüftung ... 20
5
Kombinierte Kühl- und Heizdecke... 21
5.1 Vorbemerkung ... 21
5.2 Kapillarrohrtechnik... 22
5.2.1
Anwendungsbereiche für das Kapillarrohrsystem... 22
5.2.2 Technische
Beschreibung ... 22
5.2.3
Funktionsweise von Kapillarrohr-Flächenkühl- und heizsystem ... 23
5.2.4 Systemtrennung ... 24
5.2.5 Einsatzmöglichkeiten... 25
5.2.6
Regelung von Heiz- und Kühldecken... 26
5.2.6.1 Allgemeines ...26
5.2.6.2 Raumtemperaturregelung ...27
5.2.6.3 Taupunktregelung ...28
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-2-
98VU023
5.2.7
Armaturen zur wasserseitigen Regelung und zum hydraulischen
Abgleich... 28
5.2.8
Übergabe- bzw. Etagenverteilstation mit Wärmetauscher, Pumpe etc... 29
6
Planung und Auslegung einer Kühl- und Heizdecke... 31
6.1 Kühllast
und
Wärmebedarf... 31
6.2 Parameter ... 31
6.2.1 Raumtemperatur ... 31
6.2.2 Raumluftfeuchte ... 32
6.2.3
Systemtemperaturen für Vorlauf und Rücklauf... 32
6.2.4 Deckentyp
/
-aufbau... 33
6.2.5 Mattentyp... 33
6.3
Leistung der Kühldecke... 34
6.4
Leistung von Deckenheizungen... 36
6.5
Auslegung der Kühldecke ... 37
6.6
Auslegung der Heizdecken ... 39
6.7
Rohrnetzberechnung von Heiz- und Kühldecken... 39
6.7.1 Allgemeines ... 39
6.7.2
Auslegung des Rohrnetzes... 40
6.7.3
Aufteilung und Belegung der Zonen ... 41
6.7.4
Verrohrung und Anordnung der Zonenregelgruppen ... 41
6.7.5
Druckverlust und Pumpenauswahl ... 42
6.8 Ausdehnungsgefäß... 44
6.9 Basisstation ... 46
7 Quelllüftung... 47
7.1 Einführung ... 47
7.2
Funktionsprinzip und Eigenschaften der Quelllüftung... 47
7.3
Grenzen der Quelllüftung und bauliche Voraussetzungen ... 48
7.4
Bestimmung des Mindest-Luftvolumenstromes... 49
8 Projektberechnung ... 50
8.1 Objektbeschreibung ... 50
8.2
Bestimmung des Wärmebedarfs ... 52
8.2.1 Allgemeine
Gebäudekenngrößen... 52
8.2.2 k-Werte ... 53
8.2.3 Raumwärmebedarf... 53
8.3
Kühllastberechnung nach VDI 2078 ... 54
8.3.1 Kühllastparameter... 54
8.3.2
Bestimmung der Kühllasten ... 55
8.4
Auslegung der Kühl- und Heizmatten ... 56
8.4.1 Festlegung
der
Auslegungsparameter... 56
8.4.2
Auslegung der Kühl- und Heizdecke... 58
8.5
Auslegung und hydraulischer Abgleich des Rohrnetzes ... 64
8.6
Dimensionierung des Wärmetauschers und des Ausdehnungsgefäßes ... 65
8.7 Pumpenauswahl ... 68
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-3-
98VU023
9
Energie- und Kostenbetrachtung zur Kühl-/Heizdecke... 69
9.1 Investitionskosten ... 69
9.2
Energieeinsatz bei Kühldecken... 71
9.3 Beurteilung ... 72
10 Schlußwort... 73
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-4-
98VU023
0
Vorwort
Für die Restaurierung des Grassimuseums in Leipzig soll das Ingenieurbüro IKL
+ Partner die Planung und Bauüberwachung der haustechnischen Anlagen
übernehmen.
Für die Ausstellungsbereiche des Kunsthandwerkes soll dabei eine Teil-
klimatisierung über Kühlflächen erfolgen.
Es stehen 3 Varianten zu Auswahl:
-
Variante 1: Kühlflächen im Fußboden
-
Variante 2: Kühlflächen im Wandbereich
-
Variante 3: Kühldecken
Unter Abwägung aller technischen Vor- und Nachteile, der Auswirkung auf die
Ausstellungsgestaltung sowie der jeweils erforderlichen Kosten bleibt die
Kühldecke die einzig sinnvolle Lösung für die Einordnung von Kühlflächen in
den Ausstellungsbereichen.
Dabei soll die Kapillarrohrtechnik als Kühldeckensystem zum Einsatz kommen
und im Rahmen dieser Diplomarbeit als Entwurfsplanung ausgelegt werden.
Des weiteren soll überprüft werden, ob eine Beheizung über dieses System
erfolgen kann, und welche Investitionsersparnisse beim Einsatz der Kühl- und
Heizdecke inklusive Lüftung gegenüber einer Teilklimaanlage sich ergeben.
Vor der Wärmebedarfs- und Kühllastberechnung aller Austellungsbereiche und
der Auslegung der Kühl- und Heizmatten werden kurz wichtige Erklärungen und
Informationen zur Kapillarrohrtechnik gegeben.
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-5-
98VU023
1
Museen
1.1 Einleitung
Entsprechend DIN 1946/2 zählen Museen nicht als Versammlungsräume, in
denen die Behaglichkeitsbedürfnisse der Personen erfüllt werden müssen, sondern
primär dient hier eine Luftbehandlung dem Schutz der Kunstwerke. Hierzu
gehören z.B. Gemälde auf Leinwänden oder Holz, Holzskulpturen, Holztafel-
bilder, völkerkundliche Sammlungsgegenstände, Fresken, Handschriften,
Zeichnungen, Drucke, Gegenstände tierischen Ursprungs, Teppiche, Musik-
instrumente u.a.
Zunächst müssen die Einflüsse von außerhalb des Gebäudes verhindert oder
vermindert werden. Dazu zählen die starken Temperatur- und Feuchte-
schwankungen und die Luftverschmutzungen.
Moderne Bauten mit großen Fensterflächen und umfangreiche Beleuchtungs-
körpern verursachen außerdem erhöhte Kühllasten, die eine Luftkühlung
erforderlich machen.
1.2
Anforderungen an Raumklima
1.2.1 Relative
Luftfeuchte
Der relativen Luftfeuchtigkeit muss die größte Bedeutung zugemessen werden, da
die meisten Kunstgegenstände aus hygroskopischen
1)
Materialien bestehen. Wird
zwischen der Raumluft und der Substanz der Ausstellungsgegenstände Wasser-
dampf ausgetauscht, kommt es zu Volumenänderungen, die Formänderungen und
Spannungen im Material verursachen können. Ist die Luft zu trocken, kann es zu
irreparablen Schäden durch Schwinden kommen, vorwiegend in Form von
1)
hygroskopisch » Wasser an sich ziehend, bindend
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-6-
98VU023
Rißbildungen. Ist die Luft zu feucht, kann es zu Quellungen und Blasenbildungen
z.B. an der Farbe kommen. Außerdem bleiben Staubteilchen der Luft an der
Oberfläche haften, die Gegenstände werden trübe und je nach Verschmutzungs-
grad der Luft auch beschädigt.
Mögliche Schäden können vermieden werden, wenn sich die relative Feuchte
innerhalb eines engen Toleranzbereichs nur langsam ändert. Den Mittelwert von
50-55%
±
5 kann man je nach Material noch weiter eingrenzen und demnach auch
die Luftbehandlung differenzierter vornehmen.
Die endgültige Festlegung der relativen Luftfeuchte bestimmt letztendlich der
Restaurator. Die nachfolgenden Werte sollen dabei nur als Richtwerte dienen.
Empfohlene Werte nach STOLOW
2)
sind:
Pergament 55-60%
Lackobjekte
50-60%
Musikinstrumente, gefaßte Skulpturen, Holztafelgemälde
45-60%
Holz, Leder, Faserstoffe, Möbel
40-60%
Leinwandgemälde
40-55%
Papier
40-50%
Textilien,
Teppiche
30-50%
Photographien,
Filme
30-45%
Keramik,
Stein
20-60%
Metallobjekte
20-30%
Waffen, Rüstungen, oxidierendes Material
15-40%
1.2.2 Raumtemperaturen
Die Raumtemperatur kann man entsprechend der Jahreszeit etwas unterschiedlich
angeben, nach oben jedoch gleitend nur bis etwa 26°C.
In den Wintermonaten sollte ein Mindestwert von 18-20°C angestrebt werden, in
den Sommermonaten ein Wert von 25°C
±
1.
2)
Quelle: Sammlungsgut in Sicherheit, Teil 2 (1987) ,,Lichtschutz, Klimatisierung",
von G. S. Hilbert
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-7-
98VU023
Wie bei der relativen Luftfeuchte muss auch hier der Restaurator die Raum-
temperatur festlegen. Dabei kann es durch aus möglich sein, dass eine konstante
Temperatur ganzjährig im Raum zu halten ist.
2
Definitionen zur Berechnung des Wärmebedarfs nach
DIN 4701
2.1
Definition des Begriffs Wärmebedarfs
Der Wärmebedarf ist abhängig von der freien oder geschützten Lage des
Gebäudes, der Außentemperatur, dem Windanfall, der Bauweise der Um-
fassungs- und Öffnungsflächen und damit der Qualität des Wärmeschutzes sowie
dem Bestimmungszweck der einzelnen Räume.
Für die Auslegung der Heizungsanlage und der einzelnen Heizflächen ist der
Wärmebedarf entscheidend, der bei festgelegten äußeren Randbedingungen für
ein bestimmtes Gebäude entsteht. Deshalb können im Gegensatz zum Jahres-
Heizwärmebedarf und zum Jahres-Heizenergieverbrauch hier keine über das Jahr
verteilte ,,interne" oder ,,solare" Wärmegewinne berücksichtigt werden.
Die genaue Berechnung des Wärmebedarfs erfolgt raumweise nach der DIN 4701
(Deutsches Institut für Normung e.V.) ,,Regeln für die Ermittlung des
Wärmebedarfs von Gebäuden".
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-8-
98VU023
2.2 Erforderliche
Berechnungsgrundlagen
Für die Aufstellung der Wärmebedarfsrechnung, die raumweise auf besonderen
Formblättern erfolgt (siehe Anlage 3), sind folgende Unterlagen und Angaben
erforderlich:
1. Lageplan mit Himmelsrichtung
2. Grundriß-, Schnitt- und Ansichtszeichnungen des Gebäudes mit allen
erforderlichen Bemaßungen
3. Angaben über den Aufbau und das Material der Wände, Decken und Dächer
zur genauen Berechnung der Wärmedurchgangs- bzw. Wärmeleitwiderstände
4. Daten über die Fenster und Außentüren
5. Angaben über die Nutzung der Räume, möglicherweise von der Norm
abweichende Raumtemperaturen
6. Werte für Norm-Außentemperaturen, Norm-Innentemperaturen, Rechenwerte
für Temperaturen angrenzender Räume, Außenflächen- und Sonnenkorrektur-
faktoren, Wärmedurchgangskoeffizienten für Außen- und Innentüren, Fugen-
durchgangskoeffizienten, Hauskenngrößen, Raumkennzahlen und weitere
Angaben, Bilder und Algorithmen enthält die DIN 4701 T2
2.3 Norm-Wärmebedarf
Der Norm-Wärmebedarf
N
Q
&
eines Raumes ist maßgebend für die Dimen-
sionierung der Heizflächen pro Raum und ist für jeden Raum einzeln zu ermitteln.
Er setzt sich zusammen aus dem Transmissionswärmebedarf und dem Lüftungs-
wärmebedarf pro Raum.
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-9-
98VU023
2.4 Norm-Gebäudewärmebedarf
Der Norm-Gebäudewärmebedarf
Geb.
N,
Q
&
wird für die Bemessung der gesamten
Heizungsanlage des Gebäudes, z.B. für die Heizkesselleistung, benötigt.
Er ergibt sich aus dem gesamten Norm-Transmissionswärmebedarf aller
Außenbauteile und dem Lüftungswärmebedarf aller Räume unter Berück-
sichtigung des gleichzeitig wirksamen Lüftungswärmeanteils (Faktor
), da nicht
in allen Räumen gleichzeitig ein Lüftungswärmebedarf auftritt.
+
=
L
T
N,Geb.
Q
Q
Q
&
&
&
(1)
Im Wärmeleistungsbedarf sind die Verluste des Heizsystems und ein notwendiger
Bedarf für die Brauchwassererwärmung nicht enthalten.
2.5
Norm-Transmissions- und Norm-Lüftungswärmebedarf
Man ermittelt den Norm-Transmissionswärmebedarf
T
Q
&
aus der Summe aller
Wärmeströme, die vom Raum durch Wärmeleitung über alle raumum-
schließenden Flächen abgegeben werden.
Er wird für alle Teilflächen mit unterschiedlichen Parametern getrennt berechnet,
wobei behaglichkeitsmindernde Einflüsse kalter Außenfläche und Auswirkungen
der Sonneneinstrahlung durch entsprechende Korrekturfaktoren berücksichtigt
werden.
( )
a
i
N
T
A
k
Q
-
=
&
(2)
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-10-
98VU023
Der Norm-Lüftungswärmebedarf
L
Q
&
setzt sich zusammen aus dem Lüftungs-
wärmebedarf bei freier Lüftung und dem Lüftungswärmebedarf für nach-
strömende Luft infolge maschineller Lüftungsanlagen.
2.6 Wärmedurchgang
Bei der Berechnung des Transmissionswärmebedarfes eines Raumes bzw. eines
Gebäudes handelt es sich um die Berechnung des Wärmestromes.
Der Wärmestrom, der zwischen den beiden durch eine Fläche getrennten Medien
ausgetauscht wird, bezeichnet man auch als Wärmedurchgang. Diese Art
Wärmeübergang geschieht aufgrund eines Temperaturunterschiedes.
Der Wärmedurchgang besteht immer aus drei physikalischen Vorgängen, d.h. aus
zwei Wärmeübergängen und einem Wärmeleitungsvorgang.
Nun gilt es, die drei Vorgänge in einen zusammenzufassen. Kennzeichnend für
diesen Vorgang ist der sogenannte Wärmedurchgangskoeffizient k.
Der k-Wert eines Bauteils gibt an, welche Wärmemenge durch 1m
2
bei einer
Temperaturdifferenz von 1K pro Zeiteinheit übertragen wird.
Allgemeine Berechnungsformel:
a
2
2
1
1
i
k
1
d
d
1
k
R
1
...
R
k
+
+
+
+
=
=
(3)
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-11-
98VU023
3
Definition zur Kühllastberechnung
3.1 Definition
Kühllast
So wie für die Auslegung einer Heizungsanlage die Wärmebedarfsberechnung
nach DIN 4701 zugrunde gelegt wird, ist für die Luftkühlung die Kühllast-
berechnung nach der VDI-Richtlinie 2078 (Verein Deutscher Ingenieure)
maßgebend.
Ebenfalls wie bei der Wärmebedarfsberechnung ermittelt man heute in der Regel
die Kühllast mittels EDV-Programme, um zu schnelleren und genaueren Ergeb-
nissen zu kommen.
Wichtig für den Planer sind die Zusammenhänge zwischen Gebäudeentwurf,
Materialien und Wärmeumsätze im Raum.
Bei gekühlten oder klimatisierten Gebäuden bzw. Räumen sind die Kühllasten
(abzuführende Wärmeströme) in der Regel der Maßstab zur Bestimmung
notwendiger Luftmengen oder Kühlleistungen zum Kühllastausgleich.
Es ergeben sich somit in der Regel die Größe von lufttechnischen Anlage mit
Kühlung aus den anfallenden Wärmelasten, die zu kompensieren sind, um eine
bestimmte Raumtemperatur einzuhalten.
Somit bildet die VDI-Richtlinie 2078 ,,Berechnung der Kühllast klimatisierter
Räume" die Grundlage für die Dimensionierung sämtlicher Teile einer Klima-
anlage bzw. für die Auswahl von Klimageräten.
3.2
Berechnungsverfahren zur Kühllastbestimmung
Die VDI-Richtlinie unterscheidet zwei Berechnungsverfahren, die bei der
Einhaltung gleicher Randbedingungen auch zu ähnlichen Ergebnissen führen.
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-12-
98VU023
a) Kurzverfahren
Bei diesem Verfahren werden feste Randbedingungen vorgegeben, wie z.B.
konstante Raumlufttemperatur, 24-stündlicher Anlagenbetrieb, periodische innere
und äußere Belastungen, eingeschwungener Zustand und konstanter Sonnen-
schutz.
Außerdem werden die Strahlungslasten durch sog. Kühllastfaktoren s
i
und s
a
der
Speichereinfluß der Außenwände und Dächer mit dem Verfahren der äquivalenten
Temperaturdifferenzen ermittelt.
b) EDV-Verfahren
Bei diesem mathematisch sehr aufwendigen Verfahren kann man die Kühllast-
berechnung mittels EDV-Programme durchführen.
Der große Vorteil ist, dass eine Berechnung unter zahlreichen Randbedingungen
bzw. wählbaren Belastungsverläufen durchgeführt werden kann.
So werden zeitlich unterschiedliche Raumlufttemperaturen, Betriebszeiten,
beliebige Beschattungen und Sonnenschutzbetätigungen berücksichtigt.
Ein solches dynamisches Kühllastrechenprogramm bezieht demnach die Gebäu-
deausführung, die Anlagentechnik und die Nutzung des Anlagenbetriebs ein.
3.3 Innere
Kühllast
Bei der Kühllast unterscheidet man zwischen der (gebäude)inneren Kühllast
I
Q
&
und der äußeren Kühllast
A
Q
&
.
Innere Kühllasten
sind die Wärmequellen, die innerhalb des Gebäudes auf den
zu klimatisierenden Raum einwirken.
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-13-
98VU023
Sie setzt sich zusammen aus:
R
E
P
I
Q
Q
Q
Q
&
&
&
&
+
+
=
(4)
3.4 Äußere
Kühllast
Äußere Kühllasten sind die Wärmeströme, die von außen auf die Gebäudeum-
schließungsfläche einwirken.
Einige der nachfolgenden Kühllastanteile können zeitweise auch negativ sein und
stellen dann eine Heizlast dar.
Sie ergibt sich aus:
FL
S
W
A
Q
Q
Q
Q
&
&
&
&
+
+
=
(5)
3.5 Wärmespeicherung
Die Einflußgrößen auf die Kühllast sind neben den thermischen Raumbe-
lastungen auch die Wärmespeicherung im Raum und der gewünschte Temperatur-
verlauf.
Die Wärmespeicherung im Raum macht sich im Gebäude bemerkbar, wenn die
Wärmelast entweder infolge von Strahlung entsteht oder wenn sich Raum-
temperaturen verändern.
Grundsätzlich sind zu unterscheiden, ob es sich außer der Transmissionswärme
um konvektive
3)
Lasten oder um Wärmestrahlungen handelt.
3)
Konvektion » Transport von Wärme durch bewegte Teilchen
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-14-
98VU023
3.6 Kühllastfaktoren
3.6.1 Temperaturen
Hinsichtlich der richtigen Maximal-Auslegungstemperaturen wird nach Klima-
zonen unterschieden, die in der Karte im Anhang 1 dargestellt sind.
Hiernach unterscheidet man:
Zone 1
= Küstenklima, Maximaltemperatur +29°C
Zone 1a = Hangklima (Mittelgebirge)
Zone 2
= Binnenklima I, Maximaltemperatur +31°C
Zone 3
= Binnenklima II, Maximaltemperatur +32°C
Zone 4
= Südwestdeutsches Flußtalklima, Maximaltemperatur +33°C
Zone 5
= Höhenklima
3.6.2 Wärmespeicherfaktoren
Das Einbeziehen der zeitabhängigen Speicherung in die Kühllastberechnung
infolge innerer und äußerer Strahlungslasten erfolgt durch die Einführung eines
Kühllastfaktors (früher Speicherfaktor). Um die tatsächliche Kühllast berechnen
zu können, muss das Maximum der jeweiligen Wärmebelastungen (z.B.
T
Q
&
,
B
Q
&
,
M
Q
&
) mit dem entsprechenden Kühllastfaktor s
i
oder s
a
multipliziert werden.
In der VDI-Richtlinie 2078 werden die Ergebnisse der Speichervorgänge für fest
vorgeschriebene Belastungsformen durch Tagesgänge von Kühllastfaktoren ange-
geben.
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-15-
98VU023
4
Kühldecken
4.1 Allgemeines
Bei Kühldecken handelt es sich fast ausschließlich um kaltwasserführende Rohr-
systeme. Die Kühlflächen nehmen dabei die sensible Wärme aus dem Raum
unmittelbar durch Strahlung und Konvektion auf, wobei das Verhältnis Strahlung
zu Konvektion eine wesentliche Rolle spielt. Die Wärmeübergangszahl zwischen
Raum und Kühldecke liegt dabei bei etwa 9...12W/(m
2
*K).
Die Kühldecke hat lediglich die Aufgabe, die sensible
4)
Kühllast ganz oder teil-
weise abzuführen. Die Lüftungsanlage übernimmt weiterhin die Aufgaben der
Frischluftzuführung, der Abführung von Verunreinigungen und Feuchtelasten und
in der Regel auch die Luftbefeuchtung.
Die Kühldecke bietet gegenüber üblichen RLT-Anlagen die Vorzüge hinsichtlich
größerer Behaglichkeit aufgrund mehrerer Faktoren.
Zum einen führen die geringeren Zuluftströme, die jetzt durch den Mindest-
Luftwechsel und nicht durch die Kühllast bestimmt werden, zu geringeren Raum-
luftgeschwindigkeiten. Des weiteren entspricht die empfundene Raumtemperatur
etwa dem Mittelwert aus mittlerer Raumlufttemperatur und mittlerer Oberflächen-
temperatur der Umschließungsfläche. Eine Kühldecke ist in der Lage, ein weit-
gehend gleichmäßiges vertikales Temperaturprofil im Raum aufzubauen.
Bei Kühldecken mit hoher Strahlungsaufnahme liegt die empfundene Raum-
temperatur um 1,5-2K unterhalb der Raumlufttemperatur, was sich auf die
Behaglichkeit positiv auswirkt. Nicht zuletzt gibt der Mensch seine überschüssige
Wärme zu ca. 50% durch Strahlung auf umliegende Flächen ab.
4)
sensible Kühllast = trockene Kühllast » keine Aufnahme von feuchten Lasten
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-16-
98VU023
Das untere Bild soll dabei die Luftströmung im Raum beim Einsatz einer Kühl-
decke verdeutlichen.
Bild 1: Luftströmung im Raum / Quelle: gabocool-Ordner
Die Kühldecken unterscheidet man im wesentlichen in folgende zwei Systeme mit
wiederum zahlreichen Varianten.
1. Geschlossene Decken:
Hier handelt es sich um Kühldecken mit glatter
Unterseite ohne offene Fugen, um Putzdecken oder Montagedecken. Der
Raum über den mit Rohren versehenen Metallplatten (Kühlpaneelen) steht mit
dem Nutzraum in keiner luftseitigen Verbindung. Werden Rohre oder
Rohrmatten in die Decke bzw. in den Deckenputz eingebracht, spricht man
auch von einem ,,Nassverlegesystem" oder von Bauteilkühlung, bei dem nicht
das Rohrmaterial, sondern vor allem die Unterdecke einen entscheidenden
Einfluss auf Wirkungsweise und Leistung hat.
Die spezifische Kühlleistung liegt bei etwa 50...80 W/m
2
, die nach oben
durch die Verhinderung einer Kondensatbildung begrenzt ist. Die Strahlungs-
aufnahme beträgt etwa 50...60%, kann aber durch Deckenluftdurchlässe
zugunsten des Konvektionsanteils verändert werden.
eingereicht von:
Ronny Herfurth
Diplomarbeit Seite:
-17-
98VU023
2. Offene Kühldecken:
sind verlegte Kühlpaneele in Form von frei hängenden,
gut zugänglichen Systemen oder um Kühlelemente, meist in Form von
Rohrregistern, die über Lochdecken oder über Rasterdecken mit etwa 90 bis
95% freiem Querschnitt montiert werden. Die Höhe des Deckenhohlraums
beträgt ca. 20 bis 30 cm. Je nach Konstruktion kann die aufsteigende
Warmluft von oben in die Kühlelemente nachströmen, während die
austretende kalte Luft nach unten strömt.
Die Decke hat demnach Öffnungen für die zur Erhöhung der Kühlleistung
erforderliche Luftzirkulation. Dementsprechend wird der konvektive Teil der
Wärmeabgabe wesentlich größer als bei der geschlossenen Decke.
Die Leistung kann bei 100% Deckenbelegung bis über 150 W/m
2
liegen. Die
Speichermasse der Rohdecke kann zur Kühlung bzw. Temperierung genutzt
werden (thermische Bauteilaktivierung).
4.2
Vorteile und Merkmale von Kühldecken
Die wesentlich geringere Luftgeschwindigkeit und die Turbulenzgrade durch die
Entkoppelung von Luftstrom beim Einsatz einer Kühldecke verbessern das
Raumklima. Man spricht auch von einem ,,sanften Klima", einer ,,stillen
Kühlung" oder von einem ,,statischen Kühlsystem", da die Kühlung nicht mehr
durch Zuluft und Luftbewegung erfolgt. Letztere entsteht bei der Kühldecke fast
ausschließlich durch Dichteunterschiede der Luft.
Der Zuluftvolumenstrom und somit die Luftwechselzahlen werden geringer, da
die sensible Kühllast nicht mehr durch die Zuluft, sondern durch die Kühldecke
abgeführt wird. Die Zuluft hat demnach vielfach nur die Lüftung, d.h. die
hygienisch gewünschten Außenluftraten, zu garantieren, Mischkammern können
unter Umständen entfallen. Die RLT-Zentrale kann bis zu 50% kleiner werden.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832453695
- ISBN (Paperback)
- 9783838653693
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Berufsakademie Sachsen in Riesa – unbekannt
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- heizdecken kapillarrohrmatten kühlung klimaanlage
- Produktsicherheit
- Diplom.de