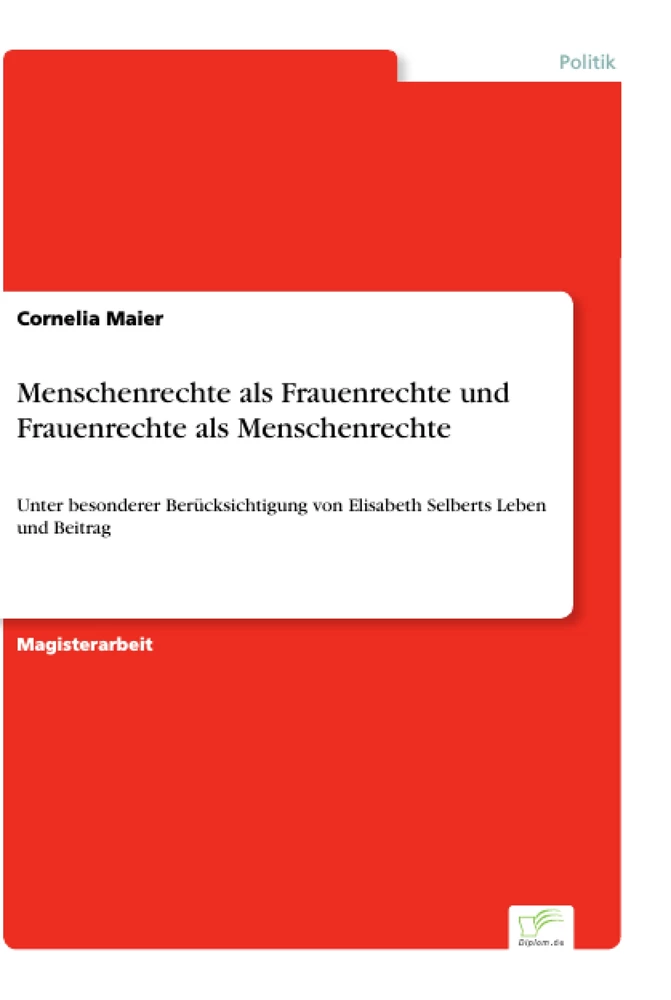Menschenrechte als Frauenrechte und Frauenrechte als Menschenrechte
Unter besonderer Berücksichtigung von Elisabeth Selberts Leben und Beitrag
Zusammenfassung
Der Kampf der Frauen um ihre faktische Gleichstellung und um die Anerkennung der Frauenrechte als Menschenrechte hat bereits eine lange Geschichte und ist auch heute noch lange nicht beendet. Weiteres Engagement bleibt hier unbedingt notwendig. Ein Meilenstein auf diesem Weg ist jedoch die gesetzliche Gleichberechtigung. Diese wurde in Deutschland im Parlamentarischen Rat von der sozialdemokratischen Anwältin Elisabeth Selbert erkämpft. Darum ist dieser Politikerin meine Arbeit gewidmet.
Gang der Untersuchung:
Nach einer gründlichen Einführung in die Thematik Menschenrechte als Frauenrechte und Frauenrechte als Menschenrechte ordne ich Elisabeth Selbert in diesen Kontext ein. Danach folgt eine ausführliche Biographie dieser Frau unter Berücksichtigung ihrer familiären Sozialisation, ihrer Partnerschaft mit Adam Selbert, ihrer Erfahrungen in Partei, Studium und Beruf, ihrer Notlage in der Nazizeit und ihres Engagements beim demokratischen Wiederaufbau nach der Befreiung durch die Alliierten. Dann folgt ein längeres Kapitel darüber, wie Elisabeth Selbert den Gleichberechtigungsartikel im Grundgesetz erkämpfte.
Danach berichte ich über Elisabeth Selberts Leben und Engagement nach diesem historischen Erfolg, wobei ich wie auch in den Kapiteln, die ihr Leben und ihre Arbeit vor ihrer Wahl in den Parlamentarischen Rat thematisieren, besonders auf ihre Aktivitäten im frauenpolitischen Bereich eingehe. Abschließend folgt eine kritische Würdigung Elisabeth Selberts, wiederum unter besonderer Berücksichtigung ihres Beitrags zur Menschen- und Frauenrechtspolitik. Gerade in diesem Kapitel beschäftige ich mich, ebenso wie in der Einleitung, nochmals allgemein mit Frauenrechten als Menschenrechten und Menschenrechten als Frauenrechten.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung und Einordnung von Elisabeth Selbert in den Kontext der Menschen- und Frauenrechtsgeschichte und des Kampfes um eine geschlechterdemokratische Gesellschaft3
2.Elisabeth Selberts Leben und Arbeit vor ihrer Wahl in den Parlamentarischen Rat10
a)Ihre Kindheit und Jugend10
b)Der Anfang der Beziehung mit Adam Selbert und der damit verbundene Weg zur Sozialdemokratie13
c)Erste politische Erfahrungen15
d)Elisabeths Partnerschaft mit Adam Selbert19
e)Elisabeths Studium und Dissertation22
f)Elisabeths Leben unter der Nazi-Diktatur24
g)Die Befreiung und Elisabeths Rückkehr in die PolitikS29
h)Elisabeths Tätigkeit als Stadtverordnete in […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Gliederung:
1. Einleitung und Einordnung von Elisabeth Selbert in den Kontext der Menschen- und Frauenrechtsgeschichte und des Kampfes um eine geschlechterdemokratische Gesellschaft
2. Elisabeth Selberts Leben und Arbeit vor ihrer Wahl in den Parlamentarischen Rat
a) Ihre Kindheit und Jugend
b) Der Anfang der Beziehung mit Adam Selbert und der damit verbundene Weg zur Sozi aldemokratie
c) Erste politische Erfahrungen
d) Elisabeths Partnerschaft mit Adam Selbert
e) Elisabeths Studium und Dissertation
f) Elisabeths Leben unter der Nazi-Diktatur
g) Die Befreiung und Elisabeths Rückkehr in die Politik
h) Elisabeths Tätigkeit als Stadtverordnete in Kassel
i) Elisabeths Arbeit in der Landespolitik
j) Elisabeths Verhältnis zu den Emigranten
3. Elisabeth Selberts bahnbrechender Erfolg für die Frauen im Parlamentarischen Rat
4. Elisabeth Selberts Leben und Engagement nach dieser ihrer historischen Leistung
a) Elisabeth und die Anfänge der Bundesrepublik
b) Eine politisch wie privat äußerst schwierige Zeit in Elisabeths Leben
c) Elisabeths Leben nach ihrem partiellen Rückzug aus der Politik
d) Elisabeths frauenpolitisches Engagement und ihre öffentlichen Erfolge in der Bundesrepublik, insbesondere im höheren Alter
5. Kritische Würdigung von Elisabeth Selbert, insbesondere im Kontext der Frauen- und Menschenrechte
1. Einleitung und Einordnung von Elisabeth Selbert in den Kontext der Menschen- und Frauenrechtsgeschichte und des Kampfes für eine geschlechterdemokratische Gesellschaft
Im Zeitalter der Aufklärung wurde erstmals die Forderung nach Menschenrechten erhoben. Diese wurden u.a. als Recht auf Leben, Freiheit, insbesondere der Religion, Eigentum, Sicherheit, Widerstand gegen Unterdrückung und Streben nach Glück definiert. Im Rahmen der Virginia Bill of Rights und der Unabhängigkeitserklärung (Declaration of Independence) der USA und auch der Französischen Revolution kam es bereits zu Verabschiedungen von Menschenrechtserklärungen. Gemäß John Locke bestand der Sinn und Zweck des Staates im Schutz der Menschenrechte, welcher im anarchistischen „Naturzustand“ stets gefährdet war. Somit stellte er klar, daß ein Staat, der Willkür, Diktatur und Terror ausübt, inakzeptabel ist und keine Legitimation besitzt. Diese Werte und Ideen wurden in der Declaration of Independence zugrunde gelegt und im Sinne eines Widerstandsrechts weiterentwickelt, um den bewaffneten Kampf gegen die britische Kolonialmacht zu begründen und zu rechtfertigen.
Die Anerkennung und Umsetzung demokratischer Grundsätze war aber eine lange Entwicklung, die auch heutzutage noch nicht abgeschlossen ist. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Frauenrechte, für deren Verwirklichung Engagement in besonderem Maße notwendig ist (vgl. Cornelia Maier 2000: Weitreichende Ideen der Aufklärung).
Selbst die meisten Aufklärer wendeten sich keineswegs gegen das Patriarchat, sondern betrachteten dies als naturgegeben und als wünschens- und unterstützenswert.
Dazu wird in einer Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung Folgendes geschrieben: „Die Vertreter und Vertreterinnen der Gegenposition, die für gleiche Rechte und Pflichten eintraten und die Vormachtstellung des Mannes auf die jahrhundertelange Unterdrückung der Frauen zurückführten waren in der Minderheit.
Die Französische Revolution, an der sich viele Frauen aktiv beteiligten, brachte ihnen nicht die geforderte rechtliche Gleichstellung...Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 durch die Nationalversammlung galt – wie zuvor die Festlegung der Bürgerrechte in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 – nur für Männer ...
1791 veröffentlichte Olympe de Gouges in Paris unter dem Titel „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ eine Streitschrift, die international Aufsehen erregte. Sie erhielt insgesamt 17 Artikel, darunter “Art. I: Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne ebenbürtig in allen Rechten...
Art. II: Ziel und Zweck jedes politischen Zusammenschlusses ist die Wahrung der natürlichen und unverjährbaren Rechte von Mann und Frau, als da sind: Freiheit, Eigentum, Sicherheit und insbesondere das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung.“
Am 3. Nov. 1793 wurde Olympe de Gouges hingerichtet. Sie war eines der vielen Opfer der Jakobinerdiktatur.
Als eine Reaktion auf die Ergebnisse der Französischen Revolution erschien 1792 in London das Buch „Eine Verteidigung der Rechte der Frauen“ von Mary Wollstonecraft..
In Deutschland setzte sich im selben Jahr bemerkenswerterweise ein Mann für die Rechte der Frauen ein. Geistreich und witzig focht Theodor Gottlieb von Hippel mit seinem Traktat „Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber“ für die Abkehr von der Männergesellschaft.“ (Bundeszentrale für politische Bildung: Informationen zur politischen Bildung 1. Quartal 1997: Frauen in Deutschland / Auf dem Weg zur Gleichstellung: S. 4-5).
Ich gehe davon aus, daß das Patriarchat die tiefste und am besten verankerte Unterdrückung darstellt. Dazu schreibt z.B. Charlotte Bunch: „Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist heutzutage die weltweit am meisten verbreitete Verletzung der Menschenrechte...Aber diese Gewalt ist so tief in den Kulturen der Welt verankert, daß sie fast unsichtbar ist. Dennoch ist sie weder zwangsläufig noch naturgegeben. Einmal als das erkannt, was sie ist, (nämlich) ein Konstrukt zur Erhaltung des Status Quo – kann sie demontiert werden... Wo Empörung über einen unerträglichen Status Quo laut werden sollte, wird statt dessen abgestritten und hingenommen, daß „die Dinge halt sind, wie sie sind...“ (Charlotte Bunch: Der unerträgliche Status Quo / Gewalt gegen Frauen und Mädchen, in: Anita Heiliger / Steffi Hoffmann (Hg.) (1998): Aktiv gegen Männergewalt).
Ähnlich, nur im Stil einer mitreißenden politischen Rede statt einer wissenschaftlichen Analyse, ist die Aussage der iranischen Oppositionspolitikerin Maryam Radjavi:
„Die Frauen sind die ersten Opfer der Unterdrückung in der Geschichte. Nicht nur, daß sie politische und sozio-ökonomische Unterdrückung zu erleiden haben, sie müssen auch für die Sünde büßen, Frauen zu sein...Die Hälfte der Menschen auf diesem Planeten jedoch sind Frauen, und unvermeidlicherweise betrifft die geschlechtliche Unterdrückung und die zugehörige Kultur auch die andere Hälfte der menschlichen Spezies, die Männer, und schlägt sie in Ketten. Deshalb ist eine wirkliche Freiheit des Individuums und der Gesellschaft letztlich nur durch die Emanzipation der unterdrückten Frauen denkbar. Mit anderen Worten: Die Diskriminierung gegen Frauen betrifft alle anderen Bereiche menschlicher Existenz und geht über sie hinaus...
Die geschlechtliche Unterdrückung ging so tief, daß niemand glaubte, daß es sie überhaupt gebe. Die geschlechtliche Unterdrückung wurde überhaupt nicht als Unterdrückung gesehen, sondern als für die Frau nur natürlich...
Jetzt ist es an den Frauen, sich gegen alle Formen der Unterdrückung zu erheben und die auf dem Geschlecht beruhende Unterdrückung und Ungleichheit zu beenden, Frauen und Männer in ihrer wahren menschlichen Identität zu vereinen...
Die Frauen der Vergangenheit, die eine Geschichte von Leid und Unterdrückung erlitten haben, und die Frauen, Kinder und Männer der Zukunft richten heute ihre Augen auf euch. ..Ihr seid es, die die Menschheit in das goldene Alter der Gleichheit, des Friedens, der Demokratie und der Entwicklung vorantreiben werden.
Ein Hoch auf alle freidenkenden Männer und Frauen überall, die den hohen Preis der Freiheit zahlen...Der Sieg liegt vor euch, gehört euch und erwartet euch. Die Unterdrückten von heute sind die Sieger von morgen. Ihre Stimme wird in Ewigkeit erklingen..“ (Maryam Radjavi: Eine vereinte Front gegen den Fundamentalismus, in: Internationale Vereinigung für Menschenrechte der Frauen (WHRIA), 21. Juni 1996: Frauen, die Stimme der Unterdrückten).
Dennoch gibt es trotz spezifischer Bedingungen, Schwierigkeiten und Ausprägungen zahlreiche Gemeinsamkeiten mit anderen Unterdrückungsformen, ebenso bezüglich allgemeinem Engagement für Humanität und Freiheit (Cornelia Maier 2000, insb. anhand eines Vergleichs von anthropologischen Prämissen in Kants Aufsatz: Was ist Aufklärung, mit feministischen Erkenntnissen).
Doch bis zur rechtlichen Gleichstellung war es ein langer Weg, und die Erlangung der faktischen Gleichstellung wird noch längere Zeit dauern. In vielen Ländern ist die Unterdrückung und Diskriminierung von Frauen weitaus umfassender, schlimmer und offensichtlicher als z.B. in Deutschland, wo das verübte Unrecht meist subtiler, aber nicht immer minder folgenschwer ist. Zu diesem Thema zitiere ich aus einer Ausgabe der Zeitschrift „Menschenrechte für die Frau“ von Terre De Femmes (TDF): „Unser Engagement begann, als zahlreiche Morde an Mädchen und Frauen im Mittleren Osten bekannt wurden. Man lastete ihnen die Verletzung der Familienehre an, zum Beispiel, wenn sie sich in andere Männer verliebten als in die für sie vorgesehenen... Aber der „Tod als Ehrensache“ war nur eine gravierende Frauenrechtsverletzung unter vielen: Genitalverstümmelung, Mitgiftmorde, Frauenhandel, Zwangsprostitution, Abtreibung weiblicher Föten usw...
Es mag den Anschein haben, diese Torturen gebe es ausschließlich in der Dritten Welt. Das ist ein Trugschluß. Auch hierzulande werden täglich Frauen und Mädchen gedemütigt, mißbraucht, ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Integrität beraubt. Oftmals subtiler als bei den gerade genannten Gewaltformen, aber nicht minder folgenschwer.“
(TDF: Menschenrechte für die Frau, 2 / 1999: S. 9).
Die rechtliche Gleichstellung kann jedoch als Meilenstein auf dem Weg zur geschlechterdemokratischen Gesellschaft gesehen werden.
Schon seit längerer Zeit wurden gleiche Rechte eingefordert, z.B. von Louise Otto-Peters mit den Worten:“ Freiheit ist unteilbar! Also freie Männer dürfen auch keine Sklaven neben sich dulden, also auch keine Sklavinnen. Wir müssen den redlichen Willen und die Geisteskräfte aller Freiheitskämpfer in Frage stellen, welche nur die Rechte der Männer, nicht aber die Rechte der Frauen vertreten.“
(Louise Otto-Peters / Ute Gerhard in: Ariadne, Heft 30, September 1996, Den Frauen ihr Recht / Zum 100. Geburtstag von Elisabeth Selbert: S. 48).
U.a. setzte sich z.B. Hedwig Dohm in Deutschland für die Frauenrechte, insbesondere das Wahlrecht, gleiche wissenschaftliche Ausbildung, Berufsfreiheit und gegen Geschlechterrollenstereotypen, Emanzipationsfeindlichkeit, auch von Frauen, und das patriarchale Hausfrauenleitbild ein.
Sie zeigte auf, daß aufgrund der technischen Fortschritte und der Auslagerung der Produktion aus den Haushalten die Hausarbeit verringert werden könnte. Dies geschah jedoch nicht. Statt dessen wurden Frauen unter Zuhilfenahme entsprechender Indoktrination auf Haushalt, Ehemann und Familie beschränkt und festgelegt.
Von Hedwig Dohm stammen u.a. die Sätze: „Die Menschenrechte haben kein Geschlecht“, „Es gibt keinen Geschlechtsberuf, sondern nur einen allgemein menschlichen und einen individuellen“, „Das Geschlecht ist doch nicht das Unanständige bei den Männern, ihre Roheit ist es. Ist das wirklich ein unveränderlicher Charakterzug des Mannes?“ und „Ohne politische Rechte seid ihr, mögen eure Seelen vor Güte, Edelsinn und Mitleid überfließen, den ungeheuren Verbrechen, die an eurem Geschlecht begangen werden, machtlos. Rafft euch empor!“. Auch verwies sie darauf, daß es ohne Frauen keine wirkliche Demokratie geben könne, sondern allenfalls eine Herrschaft männlicher Bürger über weibliche Bürgerinnen. Das Wahlrecht erhielten die deutschen Frauen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs durch einen Beschluß des sozialistischen Rates der Volksbeauftragten.
(Heike Brandt 1995: Die Menschenrechte haben kein Geschlecht / Die Lebensgeschichte der Hedwig Dohm).
Damit war jedoch noch lange keine Gleichberechtigung verbunden. Im Gegenteil, gerade im Familienrecht war die patriarchalische Unterdrückung und Entrechtung verankert. Erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese diskriminierenden Bestimmungen aufgehoben. Damit wurde das BGB dem Artikel 3 des Grundgesetzes angepaßt, der lautet: Männer und Frauen sind gleichberechtigt, und der 1994 durch den Gleichstellungsauftrag als Staatsziel ergänzt wurde.
Erst durch den Gleichberechtigungsartikel des GG erhielten die Grundrechte, welche für die bundesrepublikanische Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals und gleichzeitig endlich zugrunde gelegt und an den Anfang der Verfassung gestellt wurden, auch Geltung für die Frauen. Diskriminierende Bestimmungen waren somit eigentlich spätestens nach Ablauf der Übergangsfrist für die Anpassung der Gesetze verfassungswidrig, auch wenn die Umsetzung der Gleichberechtigung durch die Gesetzgebung weitaus länger dauerte. Die Verankerung der Gleichberechtigung im Grundgesetz hat die sozialdemokratische Anwältin Elisabeth Selbert im Parlamentarischen Rat erkämpft, gegen harten Widerstand, mit wenig Unterstützung auch bei den Kolleginnen. Dazu schreibt die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach:
„Vor ihrem Engagement im Parlamentarischen Rat hatte sich Elisabeth Selbert, geborene Rhode, bereits in vielfältiger Weise für eine neue, auf Gleichberechtigung basierende Gesellschaftsordnung stark gemacht. Privat führte sie mit ihrem Mann Adam Selbert eine vom Gesetz nicht vorgesehene, partnerschaftliche Ehe... Ihr überzeugender Einsatz gegen das tradierte und gesetzlich zementierte Frauenbild begründete das besondere Renommee, welches Elisabeth Selbert im entscheidenden Moment im Parlamentarischen Rat zum Sieg verhalf. Am 8. Mai 1949 nahmen die Väter und Mütter des Grundgesetzes den bis heute unveränderten Art. 3 Abs. 2 Satz 1 auf.: Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Elisabeth Selbert hat den Moment, in dem sich der Hauptausschuß für die Annahme ihres Antrags entschied, später als Sternstunde ihres Lebens bezeichnet. Es ist nicht zu hoch gegriffen, ihn auch als Sternstunde für die bundesrepublikanischen Frauen zu begreifen...
Die von Elisabeth Selbert geforderte rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau ist mittlerweile Realität. Die soziale und wirtschaftliche Gleichheit der Geschlechter haben wir noch nicht erreicht. Ein Blick auf das Bundeskabinett und die Landesregierungen zeigt, daß Frauen in Machtpositionen noch lange nicht entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung vertreten sind. Auch in der Wissenschaft, Wirtschaft und Justiz sind Frauen in Führungspositionen eine Ausnahme. Und für Frauen im gebärfähigen Alter gilt nach wie vor, daß die Frauenfrage eine Kinderfrage ist. Sie rücken nicht in dem für das männliche Geschlecht üblichen Gleichschritt die Karriereleiter hinauf.
Auf der Ebene dieses Befundes diskutierte die Gemeinsame Verfassungskommission im Jahre 1992 den Gleichberechtigungsgrundsatz erneut. Zur Debatte stand, ob dieser Grundsatz heute genügt oder ob ein Staatsziel in das Grundgesetz aufgenommen werden sollte, auch die faktische Benachteiligung der Frauen zu beseitigen. Wie im Januar 1949 überreichten Frauen dem Vorsitzenden der Verfassungskommission zwei Waschkörbe voller Eingaben, um in Erinnerung an die erfolgreiche Kampagne Elisabeth Selberts für eine umfassende Gleichberechtigung zu plädieren. Auch ihnen war Erfolg beschieden: Art. 3 Abs. 2 GG wurde um einen Zusatz ergänzt. Seit dem 15. 11. 1994 heißt es nach dem von Elisabeth Selbert erkämpften Gleichberechtigungsgrundsatz: „Der Staat fördert die tatsächliche Gleichberechtigung von Mann und Frau und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Damit ist der Staat in die Pflicht genommen, es bei der rechtlichen Gleichstellung nicht zu belassen, sondern aktiv Frauenförderung zu betreiben.“ (Limbach / Ariadne Sept. 1996: S. 38 – 39).
Gemäß den Angaben von TDF dauerte es lange, bis Frauenrechte als Menschenrechte anerkannt wurden, was eine wichtige Etappe auf dem Weg zur faktischen Umsetzung ist:
„Das 1981 in Kraft getretene Übereinkommen zur Beseitigung von jeder Diskriminierung der Frau (kurz: Frauenkonvention) ist das bedeutendste Menschenrechtsdokument für Frauenrechte...Die Abschlußerklärung der UN-Menschenrechtskonferenz in Wien 1993 enthält erstmals in der Geschichte der Vereinten Nationen die ausdrückliche Verurteilung der Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung...Auf der UN-Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking waren Frauenrechte als Menschenrechte in zentrales Thema...Die Pekinger Erklärung ist ...eine gute Berufungsgrundlage...“
(vgl. TDF: Buchkalender PLANERIN 2001: S.161-163).
Elisabeth Selberts Erfolg im Parlamentarischen Rat ist höchst relevant dafür gewesen, daß Menschenrechte auch Frauenrechte werden. Die endgültige Umsetzung steht noch aus.. Dazu hat sie selbst gesagt: „Im übrigen sollten die Frauen nie vergessen, daß es ihre Aufgabe ist, selbst für ihre Gleichberechtigung zu sorgen.“
(Selbert / Limbach / Ariadne Sept. 1996: S. 39).
In Anbetracht ihres wegweisenden Verdienstes und der Tatsache, daß sie ein interessantes, meiner Meinung nach in vielem ermutigendes und anregendes Beispiel für eine Politikerin, Feministin und historisch bedeutsame Frau darstellt, ist das zentrale Thema dieser Arbeit Elisabeth Selberts Leben und „die Sternstunde“ ihres Lebens, die Annahme der Gleichberechtigung im Parlamentarischen Rat, die ich eben in den Kontext der Frauen- und Menschenrechtsgeschichte und des Kampfs für eine geschlechterdemokratische Gesellschaft eingeordnet habe.
Dazu werde ich zunächst ausführlich über Elisabeth Selberts Leben und Engagement vor ihrer Wahl in den Parlamentarischen Rat berichten.
Dies umfaßt im wesentlichen ihre Kindheit und Jugend, ihren Weg zur Sozialdemokratie, ihre Partnerschaft mit Adam Selbert, ihre politischen Erfahrungen in der Weimarer Republik, ihre Ausbildung zur Anwältin und ihre Dissertation, aber auch über ihre Notlage im Dritten Reich und ihr Leben und Engagement nach der Befreiung vor der Teilnahme an der Ausarbeitung des Grundgesetzes.
Anschließend werde ich mich mit ihrem bahnbrechenden Erfolg für die Frauen in eben diesem Gremium, das als Konstituante der Bundesrepublik Deutschland zu sehen ist, beschäftigen.
Dabei handelt es sich um ihre eigentliche historische Tat, durch welche sie Bedeutung über Hessen und Kassel hinaus erreichte und faktisch „Geschichte machte“ (vgl. Antje Dertinger 1989: Elisabeth Selbert / Eine Kurzbiographie: S. 26-27). Eben diese Tat ist es, wodurch Elisabeth Selbert Bedeutung für die Frauen- und Menschenrechtsgeschichte gewonnen hat. Darauf werde ich ausführlich eingehen.
Im nächsten Kapitel werde ich dann ihr Leben und Engagement nach diesem historischen Ereignis thematisieren, wobei ich zunächst die unzureichende und unzulängliche Frauenpolitik in der Nachkriegszeit als historischen Hintergrund untersuchen werde, um dann über Elisabeths politische und private Probleme in einer für sie schwierigen Zeit, ihren partiellen Rückzug aus der Politik 1957 / 1958 und ihr Leben danach zu berichten. Trotz alledem ist es wichtig, daß Elisabeth nie aufgehört hat, sich zu engagieren und daß sie in hohem Alter endlich die verdiente Anerkennung fand. Daher werde ich über ausführlich über Elisabeths frauenpolitsches Engagement in der Bundesrepublik und ihre Ehrungen berichten, bevor ich diese Arbeit mit einer kritischen Würdigung Elisabeth Selberts, gerade auch im Kontext der Fragestellung „Menschenrechte als Frauenrechte und Frauenrechte als Menschenrechte“ abschließen werde.
2. Elisabeth Selberts Leben und Arbeit vor ihrer Wahl in den Parlamentarischen Rat
2.a) Ihre Kindheit und Jugend
Elisabeth Rhode, die nach ihrer Heirat Elisabeth Selbert hieß, wurde am 22. September 1896 in Kassel geboren, also interessanterweise nur 34 Tage nach der Unterzeichnung des patriarchalischen und „bereits bei seinem Inkrafttreten überholten“ BGB, welches mit ihrem späteren Werk und Leben dadurch aufs Engste verknüpft sein sollte, daß Elisabeth die Ausgangsbasis (nicht nur) für die Reform (oder Demokratisierung) dieses Gesetzbuches schuf.
(vgl. Limbach / Ariadne Sept. 1996: S. 36).
Dies war in mancher Hinsicht vielleicht überraschend. Elisabeths Familie war einerseits „ganz bürgerlich“ und nicht etwa sozialdemokratisch, aber in vielem doch recht fortschrittlich. So war eine schulische und berufliche Ausbildung für alle vier Töchter selbstverständlich. Die Eltern hatten jedoch nicht genügend Geld, um Elisabeth einen Besuch des Gymnasiums zu ermöglichen, was in der damaligen Zeit auch dadurch erschwert worden wäre, daß nur wenige Gymnasien Frauen aufnahmen
(Dertinger 1989: S. 7-8).
Elisabeth wurde in Kassel geboren, wo sie auch zeitlebens wohnte. Mit dieser Stadt war sie so verbunden, daß sie später auch trotz Nachteilen für ihre politische Karriere in Hessen nicht nach Niedersachsen (vgl. unter 4.) umziehen wollte, sondern sich, als diese Entscheidung anstand, lieber auf ihre ebenfalls heißgeliebte Anwältinnentätigkeit und ihr Privatleben konzentrierte.
Kassel gehörte damals zu Preußen, was für Elisabeths politische und berufliche Sozialisation wesentlich war. So empfand sie nicht nur die dortige Verwaltung als beispielgebend, sondern entwickelte auch Eigenschaften wie Disziplin, Pflichterfüllung und Genauigkeit. Progressiver wirkt da schon, daß Elisabeth sich schon als Schülerin von der Verehrung des Kaisers abgestoßen fühlte. Ihr Vater war Gefängnisaufseher in der „Elwe“ genannten Justizanstalt, was Elisabeth beeindruckte und schon früh ihr Interesse für rechtliche Fragen weckte. Manchmal besuchte sie mit ihrer Mutter und ihren Schwestern den Vater bei der Arbeit. Bei diesen Aufenthalten im Gefängnis fühlte sie sich wohl, da sie diese Form des Strafvollzugs als human erlebte. Dieser Wert war ihr überaus wichtig, und auch später setzte sie sich im Hessischen Landtag für eine Humanisierung des Justizvollzugs ein.
Elisabeths Mutter war Hausfrau. Beide Großmütter waren starke Persönlichkeiten. Auch diese drei Frauen beeindruckten Elisabeth mit ihrem Durchsetzungsvermögen. Das Verhältnis der einzelnen Familienmitglieder zueinander war sehr gut. So wurde von engen Beziehungen und viel Hilfsbereitschaft berichtet. Auch Elisabeth hatte später enge Beziehungen zu Verwandten, die von viel Unterstützung geprägt waren. Sie war die Lieblingstochter ihres Vaters und wurde auch vom Großvater mütterlicherseits sehr gefördert (vgl. Heike Drummer und Jutta Zwilling: Die Biographie Elisabeth Selberts, in: Hessische Landesregierung 1999: Ein Glücksfall für die Demokratie: Elisabeth Selbert, die große Anwältin der Gleichberechtigung: S. 16-19).
Elisabeth erzählte Barbara Böttger in einem Interview folgendes über ihre Familie:
„Ich stamme eigentlich nicht aus intellektuellen, sondern vielmehr aus bäuerlich-bürgerlichen Kreisen. Mein großes Leitbild war eigentlich der Vater meiner Mutter, der Landwirt und zugleich Schmiedemeister war...(Mein Vater) war sonst sehr eifrig, half der Mutter auch im Haushalt...Aber sie war klug in der Umgangssprache und in ihren Ansichten. Sie war auch heiterer als mein Vater. Mein Vater neigte sehr leicht zu Depressionen. Mutter konnte gut singen. Meine Mutter war meinem Vater intellektuell überlegen. Das hat aber nie etwas (Negatives) bedeutet. Vater förderte es sehr.“
Trotz gewisser materieller Einschränkungen fühlte sie sich sehr wohl zu Hause:
„Man hatte ja keine Zentralheizung. Meine Eltern hatten auch nie ein Bad zu der Zeit. Bitte stellen Sie sich vor, das spielte sich noch in der Volksbadewanne ab, in der Küche. Es war eine Riesenküche, wunderschön zurechtgemacht: Da stand ein Sofa, das unwahrscheinlich gemütlich war. Da stand vor dem Herd noch ein Holzkasten, der unwahrscheinlich gemütlich war, auf dem man so nett sitzen konnte und wo es warm war, und da war der große Herd, auf dem immer etwas drauf stand, in der Bratröhre waren Äpfel; und Heißwasser war in einem großen Schiff. Diese Wohnküchen waren so eingerichtet, daß man sich unendlich wohlfühlen konnte.“
Auch mit dem Erziehungsstil und mit dem gesamten familiären Klima war sie sehr zufrieden:
„Der Vater war gar nicht streng, er war ein sehr gütiger Mann, sehr weichherzig. Der strenge Teil der Eltern war die Mutter...Vater war dann später sehr stolz auf mich...Das Zusammenleben mit meinen Eltern war durch die gewisse Zucht und Ordnung – ohne Gewaltanwendung – und die Güte meiner Eltern vorbildlich.“
(Selbert / Barbara Böttger 1990: Das Recht auf Gleichheit und Differenz / Elisabeth Selbert und der Kampf der Frauen um Art. 3 Abs. 2 GG: S. 123 – 129).
Glücklicherweise (an)erkannten die Eltern Elisabeths Begabung und förderten die Tochter unabhängig vom Geschlecht. Auch hatte Elisabeth keinen Bruder, der möglicherweise aufgrund des Geschlechts hätte bevorzugt werden können. In ihrer Familie erlebte sie keine Diskriminierung. In der Schule jedoch wurde sie aufgrund ihres Geschlechts von der Mittleren Reife ausgeschlossen, was sie als „bitteres Unrecht“ erkannte. Sie beschäftigte sich schon früh mit Frauenfragen bzw. Geschlechterverhältnissen, möglicherweise auch aufgrund dieser Diskriminierungserfahrung. Helene Lange und die bereits oben erwähnte Louise Otto-Peters, welche sich beide letztendlich erfolgreich für die Mädchenbildung eingesetzt hatten, verehrte Elisabeth ebenso wie Feministinnen aus der Arbeiterbewegung bis ins hohe Alter. Aufgrund der Arbeit der beiden besagten Frauen konnte sie auch später das Abitur nachholen und studieren.
Schon früh hatte Elisabeth intellektuelle Interessen, denen sie glücklicherweise trotz der Tatsache, daß diese in ihrer Familie nicht gepflegt wurden, relativ mühelos nachgehen konnte. Ihre bevorzugten Autoren waren Charles Darwin, Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant. Schließlich weigerte sie sich auch erfolgreich, die zur (damaligen) geschlechtsspezifischen Sozialisation gehörenden Handarbeiten zu verrichten (Drummer / Zwilling / Hess. Landesreg.1999: S. 19-21).
Zur Sozialdemokratie kam sie allerdings erst später, und zwar über ihren künftigen Ehemann Adam Selbert. In ihrer Herkunftsfamilie war lediglich Philipp Scheidemann des öfteren lobend erwähnt worden. Elisabeths Vater sagte gelegentlich, „daß man Scheidemann eigentlich wählen müsse aufgrund von seinem Einsatz für die kleinen Leute“. Später arbeitete Elisabeth mit besagtem Politiker, dem sie auch freundschaftlich verbunden war, zusammen. Damals interessierte sie sich jedoch noch wenig für Politik (Dertinger 1989: S.7-8).
Sie hatte jedoch schon sehr früh weitergehende, in ihrem Milieu eher unbekannte geistige Interessen, welche sie dann auch mit Hilfe von Bildung zielstrebig verfolgte. Dies deckt sich mit einer Theorie der Andersartigkeit, derzufolge insbesondere Menschen, die später etwas Außergewöhnliches taten oder erreichten, sich in ihrem Herkunftsmilieu unverstanden und unglücklich fühlten oder zumindest aufgrund anderer, oft auch intellektueller Interessen, Begabungen und Neigungen nicht immer in besagtem Umfeld verbleiben wollen. Oftmals erreichen sie den gewünschten Aufstieg durch Bildung. Sie suchen sich selbst ein Umfeld, das ihnen entspricht und in dem sie sich selbst verwirklichen können, was sie oft erst im Nachhinein erkennen und reflektieren. Diese Theorie stützt auch die Prämisse, daß Menschen nicht durch genetische Anlagen und Umwelteinflüsse determiniert werden, sondern durchaus Freiheit dahingehend besitzen, daß sie sich entscheiden können, was sie im Rahmen gewisser Bedingungen mit ihrem Leben anfangen wollen und wie sie handeln und was sie dabei zugrunde legen (vgl. z.B. Hildegard Macha 2000: Erfolgreiche Frauen / Wie sie wurden, was sie sind: S.99-120).
Für Elisabeth war eine künftige Berufstätigkeit und die damit einhergehende finanzielle Un- abhängigkeit selbstverständlich, was vor allem für die damalige Frauengeneration ungewöhnlich war. Aus finanziellen Gründen konnte sie nicht Lehrerin werden. Aufgrund ihrer englischen und französischen Sprachkenntnisse arbeitete sie in Jahr lang als Auslandskorrespondentin. Später war sie als Postbeamtin tätig. Die kriegsbedingte Abwesenheit der meisten Männer vereinfachte dies. In diesen Zeiten war die weibliche Reserve äußerst gefragt, was sich nach dem Krieg nicht unbedingt im Sinne der Gleichberechtigung oder gar Gleichstellung auszahlte: Die Frauen wurden wieder zurück an den Herd gedrängt, und die heimkehrenden Männer sollten die entsprechenden Arbeitsplätze wieder einnehmen (vgl. Drummer / Zwilling / Hess. Landesreg. 1999: S. 22).
Insgesamt hat Elisabeth trotz mancher Schwierigkeiten ihre Kindheit und Jugend als „sehr glücklich“ bezeichnet (Drummer / Zwilling / Hess. Landesreg. 1999: S. 16).
2. b) Der Anfang der Beziehung mit Adam Selbert und der damit verbundene Weg zur Sozialdemokratie
Mit 22 Jahren lernte Elisabeth (nach Dertinger bei einem Theaterbesuch, vgl. Dertinger 1989: S. 8, nach Böttger zwar flüchtig bei der Post, aber persönlich im Theater, vgl. Böttger 1990: S. 129) ihren späteren Ehepartner Adam Selbert kennen. Zunächst war ihr der junge Mann aus der Nachbarschaft nicht aufgefallen. Auch hatte sie sich bisher nicht für Männer interessiert. Zu ihrer Zurückhaltung auf diesem Gebiet mag die strenge und konservative Moral der religiösen Mutter beigetragen haben. Als Elisabeth Adam kennenlernte, begann sie einen neuen Lebensabschnitt. Sie fand in Adam einen Gleichgesinnten, der sich ebenfalls in hohem Maße für Philosophie, Kultur und Bildung interessierte. Außerdem war er bereits vor dem Krieg Mitglied der SPD gewesen. Nach dem Krieg war er auch Vorsitzender des anscheinend als temporär, nicht aber kommunistisch intendierten Arbeiter- und Soldatenrates von Niederzwehren, der insbesondere mit der Versorgung der Bevölkerung nach dem Zusammenbruch betraut war und in dem Sozialdemokraten die Mehrheit hatten (zum Arbeiter- und Soldatenrat Niederzwehren vgl. Selbert / Böttger 1990: S. 129).
Adam machte Elisabeth mit der Sozialdemokratie bekannt.
Auch politisch erschlossen sich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Abdankung des Kaisers neue Möglichkeiten: Die Weimarer Republik wurde gegründet, Deutschland befand sich im gesellschaftlichen Umbruch, und die SPD konnte erstmals an der politischen Macht teilhaben (Drummer / Zwilling / Hess. Landesreg. 1999: S. 23-26).
Adam lud Elisabeth auf Veranstaltungen seiner Partei ein, damit sie „sich selbst über die Absichten und Vorstellungen der Partei informieren“ konnte. Sehr gut dazu paßte die Tatsache, daß der sozialistische Rat der Volksbeauftragten am 12. 11. 1918 nur drei Tage nach der Proklamation der freien deutschen Republik durch Philipp Scheidemann, das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen verkündet hatte. Damit war eine wichtige Station auf dem Weg zur Gleichberechtigung erreicht. Ebenso war damit eine alte sozialdemokratische Forderung umgesetzt worden. Elisabeth widmete sich der Gleichberechtigung der Frauen als einem von vielen politischen Anliegen, ohne daß dies zentral für ihre politische Identität gewesen wäre. Dennoch erreichte sie später auf diesem Gebiet ihren größten Erfolg, nämlich die Verabschiedung des Gleichberechtigungsartikels im Grundgesetz.
Jedenfalls fand Elisabeth, die sich selbst als „Suchende“ bezeichnet hatte, schnell den Weg zur Sozialdemokratie. Bereits im Revolutionsjahr 1918 wurde sie Genossin, und sie engagierte sich tatkräftig für die Partei, was sie auch mit den Worten „Es gehört zu meinen persönlichen Charaktereigenschaften, daß, wenn ich von etwas überzeugt sein kann, es auch mit Nachdruck vertrete.“ und „Was ich mache, das tue ich ganz.“ (Selbert / Dertinger 1989: S. 11) unterstrich.. U.a. mobilisierte sie auch die Frauen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und sich politisch zu informieren und zu engagieren (Dertinger 1989: S. 8-9).
Für ihr politisches Engagement waren insbesondere Philipp Scheidemann und
die bekannten Sozialdemokratinnen auf den Frauenkonferenzen als Vorbilder sowie die Unterstützung ihres Partners wichtig:
„Mir haben diese Frauen (auf den Konferenzen) ...sehr imponiert. Ich habe erlebt, wie sehr sie den Anforderungen der Zeit gewachsen waren. Ich glaube, das war sogar ein noch größerer Eindruck als die Vorgänge beim Zusammenbruch...Die (besagte Frauen) haben doch eine enorme Rolle gespielt...
Scheidemann war ja ursprünglich auch Buchdrucker, und sie (besagter Politiker und Adam) waren in derselben Gewerkschaft. Als Scheidemann hier in Kassel Reichstagsabgeordneter war, kamen wir uns dadurch näher, daß er mich bat, mit ihm in politischen Versammlungen draußen im Lande zu sprechen...Diese Veranstaltungen haben mir immer sehr viel bedeutet...
(Obwohl es damals für Frauen noch relativ ungewöhnlich und oft ziemlich schwierig war, sich politisch zu engagieren), war es für mich leicht, weil ich durch meinen Mann politisch motiviert worden bin.“ (Selbert / Böttger 1990: S. 132-135).
2. c) Erste politische Erfahrungen
Elisabeth engagierte sich nicht „nur“ im Bereich der damals sogenannten Frauenagitation. Auch bestritt sie zusammen mit ihrem Mann Veranstaltungen und trat auch, wie schon erwähnt, gemeinsam mit Scheidemann auf, der damals Oberbürgermeister von Kassel und den Selberts auch noch später freundschaftlich verbunden war, wobei er Elisabeth und Adam wichtige Impulse gab und ein Vorbild für die beiden darstellte, auf (Drummer / Zwilling / Hess. Landesreg. 1999: S.31-32).
Elisabeth sammelte erste politische Erfahrungen. Sie kam nicht umhin, sich auch wiederholt zu den Krisen und existentiellen Schwierigkeiten der Weimarer Republik zu äußern. Z.B. erinnerte sie die Frauen in einem Artikel, der in der von der Kasseler SPD herausgegebenen Zeitschrift „Zehn Jahre Revolution“ im Jahre 1928 erschien, daß man nicht verkennen solle, daß vor zehn Jahren der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen war und die Republik verkündet worden war. Mit der rhetorischen Frage „War das nichts?“
machte sie auf die Tatsache aufmerksam, daß es sich dabei um einen wichtigen Fortschritt handelte, und sie zeigte auf, daß auch „die Frauen des arbeitenden Volkes teil an diesem großen geschichtlichen Werden hatten“. Elisabeth führte die Novemberrevolution auf das immense Leid durch den Ersten Weltkrieg zurück, ebenso wie auf die Erkenntnis, daß das Volk für den Krieg der Reaktionäre mißbraucht worden war, welche ursprünglich von einem Verteidigungskrieg gesprochen hatten und daß der Krieg sinnlos war, was sie mit den Worten, daß die Deutschen „genarrt, daß die furchtbaren Opfer umsonst gebracht“ worden waren zum Ausdruck brachte. Sie sprach von der Unsumme „Volksleid, das dann den gewaltigen, geheiligten Willen des Volkes empor zwang, sein Geschick selber in die Hand zu nehmen“. Leider sollte die Mehrheit der Bürger letztendlich die Demokratie nicht mehr unterstützen, sondern eben deren Feinde, was Hitler die „Machtergreifung“ ermöglichte. Wollte Elisabeth in dieser Rede vor einer damaligen Entwicklung warnen? Vieles spricht dafür. Sie würdigte den Beitrag der Frauen, die ebenfalls zahlreich zur Revolution beigetragen hatten und an den vorausgegangenen Mißständen gelitten hatten, und fuhr fort: “Sie glaubten, nach dem furchtbaren Erleben die Morgenröte einer besseren, glücklichen Zeit heraufsteigen zu sehen...Und heute, wo sind all die Tausende? War’s nur ein Strohfeuer? Vielleicht waren sie in ihren Erwartungen enttäuscht, daß nach einem verlorenen Krieg selbst die Sozialdemokratie kein wirtschaftliches Eldorado hervorzaubern konnte. Und das andere, das große, das die Novemberrevolution brachte, die politische Freiheit, war das nichts?... Selbst die Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht hätten nicht im entferntesten geahnt, daß schon so bald das große Ziel der politischen Gleichberechtigung erreicht werden könnte, freier und gleicher, als es kaum ein anderes Kulturvolk der Welt besitzt. Wissen alle Frauen das Wahlrecht als politisches Machtmittel zu würdigen? Und die Antwort lautet: Nein! Es würde sonst wahrlich in der deutschen Republik anders aussehen. Frauen, die sicherlich doch die Schrecken des letzten Krieges miterlebt, wählten trotz alledem in großer Zahl deutschnational, wählten die Kriegshetzer. Wie groß aber auch die Zahl der politisch indifferenten Frauen, der Gleichgültigen. Menschlich verständlich, wenn auch nicht entschuldbar.“
Elisabeth betonte, daß Arbeiter und Frauen aufgrund ihrer gemeinsamen Unterdrückung in ihrem Kampf beistehen konnten, wobei sie sich in die Tradition der proletarischen Frauenbewegung stellte und wobei sie sich auch auf August Bebel berief. Auch forderte sie zum Kampf für den Sozialismus und zum Vertrauen auf dessen Erfolg auf.
Sie appellierte auch dadurch an die Frauen, daß sie versuchte, sie durch Einbeziehung traditionell „weiblicher“ Aspekte anzusprechen und politisch zu motivieren: „Die Mütter der heranwachsenden und kommenden Generationen müssen Sozialistinnen sein, wie könnten sie sonst ihre Kinder zu Sozialisten, zu Stützen für die Rechte des arbeitenden Volkes erziehen! Frauen! Wie ihr die Jugend bildet, bildet ihr die Zukunft! Frauen müssen daher in größerer Zahl hinein in die Organisation, auch in die Parlamente.“
Besonders fortschritttlich ist jedoch die Passage, in der Elisabeth schon 1928 vom „Kampf um ihre Frauen-, ihre Menschenrechte“ spricht (vgl. Titel meiner Arbeit). Daraus entnehme ich, daß ihr klar war, daß Frauenrechte Menschenrechte sind und nicht etwa gnädig gewährte Privilegien! (vgl. Elisabeth Selbert / Ariadne, Sept. 1996: S. 16-17).
Obwohl die Frauen 1918 das Wahlrecht erhalten hatten (Elisabeth konnte im Alter von 22 Jahren bereits an der Wahl teilnehmen), ist festzuhalten, daß sich ansonsten in der Weimarer Republik in Sachen Frauenpolitik wenig tat:
So hieß es in Art. 109 WRV 2. Abs. lediglich: “Männer und Frauen haben grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ Die zuerkannte Gleichberechtigung bezog sich somit nur auf den staatsbürgerlichen Bereich, so das Wahlrecht, wobei das Wort „grundsätzlich“ zudem Ausnahmen zuläßt. Dies implizierte, daß die frauenfeindlichen Vorstellungen des BGB nicht geändert werden mußten! Trotz einer Initiative sozialdemokratischer Parlamentarierinnen um Marie Juchacz und von Abgeordneten der USPD kam es nicht zu einer Umformulierung des Artikels, da sowohl männliche Reaktionäre als auch deren Kollaborateurinnen von einer rein differenztheoretischen und dabei mit dem Patriarchat vereinbaren „Gleichwertigkeit“ der Geschlechter ausgingen, die offensichtlich mit Menschenwürde und Menschenrechten nichts zu tun hatte! Auch mußten die Frauen ihre Arbeitsplätze für männliche Kriegsheimkehrer räumen. Vor allem verheiratete Frauen waren von dieser diskriminierenden Bestimmung betroffen. Somit wurden Frauen wieder auf die Hausfrauenrolle verwiesen! Auch Elisabeth wäre von dieser Regelung betroffen gewesen, hätte sie ihren Arbeitsplatz bei der Post nicht aufgrund der Geburt ihres Sohnes „freiwillig“ gekündigt! Effektive Möglichkeiten des Protests gab es kaum. In diesem Zusammenhang dürfte auch einzuordnen sein, daß der Frauenanteil der SPD zwischen 1919 und 1923 von 20, 4 % auf 10, 3 % sank! (vgl. Drummer / Zwilling / Hess. Landesreg. 1999: S.29-30)
Bereits in der krisengeschüttelten Weimarer Republik engagierte sich Elisabeth für die Gleichberechtigung ebenso wie für andere Anliegen. Ihr fortschrittliches Denken zeigte sich z.B. auch in ihren sozialstaatlichen Forderungen. So verlangte sie, Hilfsprojekte für Bedürftige mittels einer staatlichen Steuer statt mit „Sammlungen“ und „Bettelei“ zu finanzieren. In der Tradition der Sozialdemokratie verfocht sie einen Rechtsanspruch der Bedürftigen statt gnädig gewährter Wohltätigkeit, aber auch die Selbsthilfe der Betroffenen: „Vor dem Kriege hatte man Geld für diese Arbeit, und es geschah nichts; heute sind wir vollkommen ausgepowert, und trotzdem sehen wir, daß überall eine intensive Wohlfahrtspflege wenn nicht betrieben, so doch projektiert wird. Wir Frauen nun müssen dafür sorgen, daß der bisherigen Wohlfahrtspflege der Charakter mitleidiger Wohltätigkeit genommen wird. (Es) sollte ... das Krebsübel bei der Wurzel gefaßt und diejenigen auf steuergesetzlichem Wege herangezogen werden die letzten Endes die Schuldigen an der Verelendung unseres Volkes sind.“ (Selbert / Dertinger 1989: S. 35). Auch verdeutlichte sie, daß die schlechten Arbeits- und Wohnbedingungen oftmals schwere Krankheiten verursachten. Sie forderte eine staatlich gesicherte Wohlfahrt. Ebenso verlangte sie gezielt Aufklärungsabende für Frauen und die Verwirklichung der bisher „rein papiernen“ Gleichberechtigung (Selbert / SPD-Frauenkonferenz Kassel 1920 / Stadtarchiv Kassel).
In der Weimarer Republik, in welcher die Demokratie so wenig in der politischen Kultur verankert und dadurch in ihrem Bestand so wenig gesichert war, daß sie letztendlich von den Nazis zerstört werden konnte, war Elisabeth selbstverständlich auch mit dem Problem der so zahlreich vorhandenen Antidemokraten konfrontiert. Schon im oben zitierten Artikel in einer Zeitschrift der Kasseler SPD wurde dies klar ersichtlich. Auch auf der SPD-Frauenkonferenz im Juni 1924 in Berlin hatte Elisabeth bereits ca. vier Jahre zuvor erklärt : “Zum Schluß möchte ich den Warnungsruf ergehen lassen und Sie auf den großen Gesichtspunkt hinweisen, daß von der Deutschvölkischen Partei und zum Teil von der Deutschnationalen das Frauenwahlrecht wieder in den Orkus geworfen werden soll. Wir sozialistischen Frauen wir betonen das mit aller Schärfe – werden uns dieses Mitbestimmungsrecht im gesellschaftlichen und politischen Leben aber niemals wieder entreißen lassen, und wenn wir es mit den Zähnen verteidigen müßten!“ (Selbert / Dertinger 1989: S.35). Hier wird einiges über die Zusammenhänge von Demokratie im allgemeinen und geschlechterdemokratische Ansätze im besonderen deutlich, ebenso über deren gemeinsame Bedrohung beider durch die reaktionären Kräfte (nicht nur?) in der Weimarer Republik. Elisabeth leistete einen positiven Beitrag zum politischen Leben in der Weimarer Republik.
Auch wenn diese erste Demokratie auf deutschem Boden scheiterte, so hatte Elisabeth doch auch viel für ihre spätere politische Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt, insbesondere von Philipp Scheidemann, der ihr als „Self-made-Mensch“ und zugleich hervorragender Politiker von ungewöhnlichem geistigem Format sehr imponiert hatte, und auf den großen SPD-Frauenkonferenzen. Elisabeth setzte sich insbesondere auch für das Recht auf gleiche Entlohnung für Frauen ein, auch das eine alte Forderung der sozialdemokratischen Frauenbewegung (Dertinger 1989: S.36-37). 1919 wurde Elisabeth zudem in den Gemeinderat von Niederzwehren gewählt, wo sie im Finanz- und Steuerausschuß mitarbeitete. Obwohl Elisabeth auf der SPD-Frauenkonferenz in Kassel dezidiert eine Wohlfahrtsreform gefordert hatte, beschäftigte sie sich nun kaum mit diesem Gebiet. Bereits dies legt die Vermutung nahe, daß sie sich auch in ihrer politischen Arbeit nicht auf „typisch weibliche“ Gebiete beschränkte, sondern einen von Geschlechterrollenstereotypen weitgehend unabhängigen Weg ging (vgl. Drummer / Zwilling / Hess. Landesreg. 1999: S.32-34).
Als Erklärungen für die unzureichende frauenpolitische Situation gab Elisabeth aus der Retrospektive an, die Sozialdemokratinnen hätten sich in der Weimarer Republik „nicht sehr mit Frauenthemen beschäftigt, deshalb konnte es auch passieren, daß im Weimarer Reichstag die Reform des Familienrechts überhaupt nicht vorwärts gekommen ist ... Das ist mir erst später bewußt geworden, als ich als Anwältin tätig war und nun die Reform des Familienrechts zum Anlaß nahm, die Gleichberechtigung im Parlamentarischen Rat durchzusetzen.“ (Selbert / Barbara Böttger: Elisabeth Selbert – Mutter des Grundgesetzes, profilierte Politikerin, Anwältin aus Berufung, Frauenrechtlerin wider Willen, in: Ariadne, Sept. 1996: S.7). Dieser Satz läßt wichtige Aussagen über die Entwicklung ihres frauenpolitischen Bewußtseins zu. So wird hier deutlich, daß ihr die Entrechtung der Frauen im BGB, mit welcher sie später als Anwältin konfrontiert wurde, die Notwendigkeit der verfassungsrechtlichen Klarstellung der Gleichberechtigung (durchaus im Sinne des Titels meiner Arbeit) verdeutlichte.
In der Weimarer Republik war nämlich deutlich zu sehen gewesen, was lediglich „staatsbürgerliche“ Gleichberechtigung bedeutet. Dazu äußerte sich Elisabeth später folgendermaßen: „In der Weimarer Verfassung war wohl die Rede von Gleichberechtigung. Staatsbürgerliche Gleichheit bedeutete der Mehrheit der Verfassungsrichter damals aber offenbar: Frauen konnten wählen und gewählt werden. Mehr nicht. Sonst wäre es auch nicht möglich gewesen, daß sich im BGB eine ganze Reihe von Vorschriften erhalten hat, die rein patriarchalisch sind, rein patriarchalisch!, die auch in der Zeit der Zwanziger Jahre schon nicht mehr der tatsächlichen Stellung der Frau entsprachen. Auch war ja damals schon der Gedanke einer echten Partnerschaft aufgekommen, und in Folge dessen hätte der Reichstag die Verpflichtung gehabt, entsprechend dem Verfassungsauftrag an die Arbeit der Anpassung (der fraglichen Gesetze) heranzugehen.“ (Selbert / Dertinger 1989: S. 41).
(Nicht nur) die frauenpolitische Entwicklung in der Weimarer Republik zeigt meines Erachtens, daß der geschichtliche Fortschritt oft langsam und vor Rückschlägen nicht gefeit ist.
Elisabeth wollte eine derartige Entwicklung, wie diejenige, die sie erlebt hatte, für alle Zukunft ausschließen. Im Parlamentarischen Rat forderte sie „entschieden und wiederholt“, „weiter zu gehen als in Weimar“ und Frauen auf allen Rechtsgebieten, nicht nur im staatsbürgerlichen Bereich gleichzustellen, wobei sie ihre Erfahrungen als Anwältin mit der Entrechtung der Frauen bestärkten. Vor diesem Hintergrund erkämpfte sie später die verfassungsrechtliche Gleichstellung der Frauen in der Bundesrepublik (vgl. Dertinger 1989: S. 41 - 42).
Jedenfalls hat Elisabeth viel für die Geschlechterdemokratie erreicht und war dabei oftmals ihrer Zeit anscheinend voraus. Letzteres kann auch von ihrer überwiegend sehr emanzipierten Partnerschaft mit Adam Selbert gesagt werden.
2. d) Elisabeths Partnerschaft mit Adam Selbert
Über Adam hatte Elisabeth den Weg zu ihrer Partei gefunden. Er selbst stammte aus Gmünden an der Wohra und war gelernter Schriftsetzer. Im Ersten Weltkrieg hatte er eine Verwundung davongetragen, aber immerhin überlebt. Später wohnte er bei einer Tante in Niederzwehren bei Kassel. Auch nach seiner Zeit als Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates engagierte er sich stark in der Politik, insbesondere in der Kommunal- und Regionalpolitik. Neben seiner politischen und fürsorgerischen Tätigkeit in der Verwaltung der Gemeinde Niederzwehren war er in der Weimarer Republik auch Mitglied des Provinziallandtages und zeitweise auch der Bezirksregierung. 1913 war er mit 19 Jahren in die SPD eingetreten.
Während der Nazi-Diktatur kam er ins für einen Monat ins KZ, was zu einer schweren Krankheit und zu seiner vorzeitigen Pensionierung führte und auch für Elisabeth schwere Probleme mit sich brachte. Dennoch machte er sich um den demokratischen Aufbau des späteren Bundeslandes Hessen verdient.
Adam war Elisabeth ein echter Partner, der sie immer wieder ermutigte und unterstützte. Auch finanzierte er ihr späteres Jurastudium und verzichtete auf seinen eigenen beruflichen Aufstieg (Dertinger 1989: S.11-13). Ihn interessierte am meisten die Kommunalpolitik. Elisabeth übertraf ihn an - historischer und politischer – Bedeutung (vgl. Antje Dertinger 1980: Die bessere Hälfte kämpft um ihr Recht / Der Anspruch der Frauen auf Erwerb und andere Selbstverständlichkeiten: S.228).
Adam erkannte, daß seine Frau aufgrund ihrer besseren Schulbildung sich leichter dabei tun würde, das Abitur abzulegen und zu studieren. Er stand der Gleichberechtigung sowohl theoretisch als auch praktisch aufgeschlossen gegenüber. So war sein erstes Geschenk für Elisabeth das Buch „Die Frau und der Sozialismus“ von August Bebel. Laut Drummer / Zwilling hätte er seine Frau gern als eine „zweite Rosa Luxemburg“ gesehen und ermutigte sie also auch vor diesem Hintergrund, sich auf höherer Ebene zu engagieren. Elisabeth erzählte Böttger darüber: „Mein Mann hat mich im guten Sinne gefördert, vielleicht, damit ich das täte, was ihm versagt geblieben ist, (nämlich) in die höhere politische Ebene aufzusteigen. Er glaubte, ich hätte die besseren Voraussetzungen, weil er sich als Kommunalpolitiker fühlte und dort sein ganzes Können gegeben hat. Mir traute mein Mann aber zu, daß ich die Hürden nehmen könnte, die für seine Begriffe nötig waren, um in der großen Politik mitwirken zu können“ (Selbert / Böttger 1990: S. 130 – 131). Daraus ist zu schließen, daß er auch stolz auf sie war.
Elisabeths Vater hatte – im Gegensatz zu seinen Eltern – keine Vorbehalte gegenüber dem zukünftigen Schwiegersohn. Doch auch die Aversion der Großeltern Rhode verringerte sich.
Am 2. Okt. 1920 heirateten Elisabeth und Adam. Die Ehe dauerte 45 Jahre, bis zu Adams Tod. Elisabeth kennzeichnete diese langjährige Partnerschaft als „Neigungsehe“. Die Partner teilten geistige und politische Interessen, Achtung und tiefe Zuneigung, was Elisabeths Charakter weitaus mehr entsprach als etwa eine wilde Leidenschaft. Später kam es jedoch vor allem nach Adams Pensionierung auch zeitweise zu ernstzunehmenden Eheproblemen (Drummer / Zwilling / Hess. Landesreg. 1999: S. 26-27).
Elisabeths Schwiegertochter Ruth beschrieb Adam als einen äußerst gütigen, humorvollen Menschen, der auch sehr schlagfertig und hintergründig sein konnte und es schätzte, „wenn man ihm mit Witz parierte“, und der leider schon 1965, also ca. 20 Jahre vor seiner Frau verstarb. Im Vergleich zu Adam beschrieb Ruth Selbert Elisabeth als weniger humorvoll. Sie erwähnte aber, daß Elisabeth sich gern geistreich unterhielt (Ruth Selbert: Elisabeth Selbert: Eine Mutter des Grundgesetzes – meine Schwiegermutter, in: Ariadne, Sept. 1996: S. 12).
Elisabeth und Adam übernahmen von den Eltern der Frau die Gewohnheit, sich „Vat“ und „Mamchen“ zu nennen, was dann auch die Söhne und enge Freunde taten. Elisabeth bewertete dies nicht als exzessive Fixierung auf die Elternrolle, sondern als Zeichen großer Zuneigung (Drummer / Zwilling / Hess. Landesreg. 1999: S. 19). Vermutlich vermittelte diese Gewohnheit ihr auch Geborgenheit.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832453589
- ISBN (Paperback)
- 9783838653587
- Dateigröße
- 646 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Augsburg – Philosophische Fakultät I
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- emanzipation gender suffrage gleichstellung geschlechterforschung
- Produktsicherheit
- Diplom.de