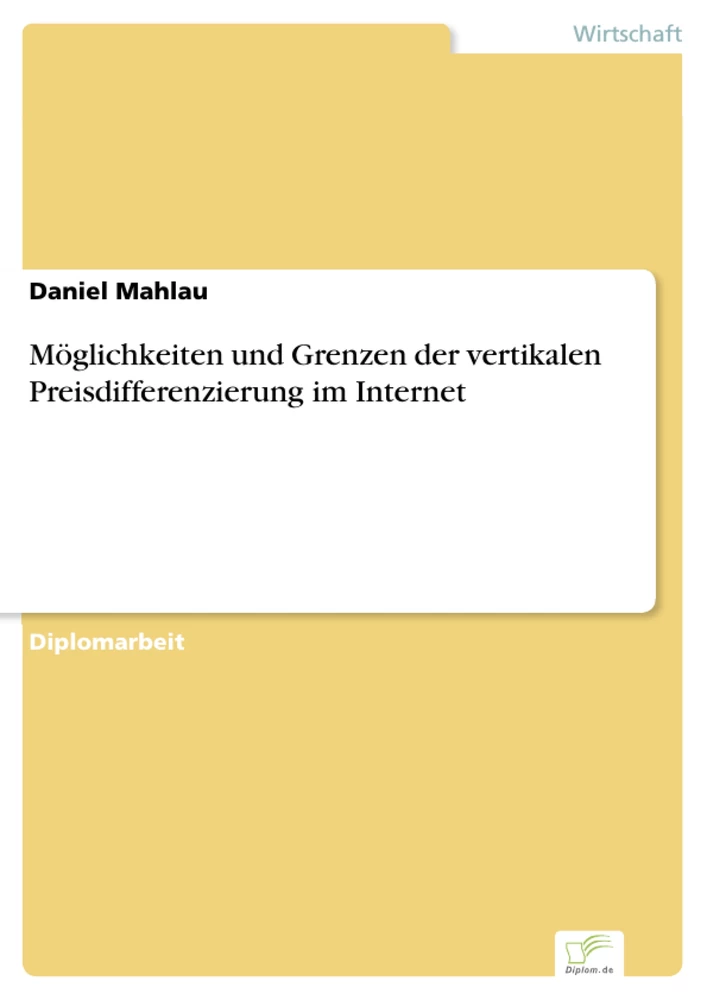Möglichkeiten und Grenzen der vertikalen Preisdifferenzierung im Internet
©2001
Diplomarbeit
61 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Setzt ein Anbieter unterschiedliche Preise für ein Produkt auf verschiedenen Märkten, und sind die daraus resultierenden Preisunterschiede nicht durch unterschiedliche Kosten bedingt, so spricht man von einer vertikalen Preisdifferenzierung. Diese Form der Differenzierung ist nur dann sinnvoll, wenn die Märkte voneinander isoliert sind, da es ansonsten zur Entstehung grauer Märkte kommen würde. Durch das Internet haben sich die Möglichkeiten einer globalen Kommunikation, vor allem hinsichtlich der Geschwindigkeit und Verfügbarkeit, in den letzten Jahren deutlich verbessert. Ländergrenzen existieren im Internet nicht und Informationen jeglicher Art sind jederzeit, von jedem beliebigen Punkt der Welt aus in Sekunden einseh- und somit auch vergleichbar. Vor diesem Hintergrund stellt sich dann die Frage, ob sich eine vertikale Preisdifferenzierung im Internet selbst - also im E-Commerce - aufrecht erhalten lassen wird.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Möglichkeiten und Grenzen eines Anbieters bzgl. der Durchführung einer vertikalen Preisdifferenzierung im Internet zu evaluieren.
Die im E-Commerce besonders stark vertretenen Produkte, auf denen auch der Schwerpunkt der Betrachtung liegt, sind Bücher, Musik-CDs, Bekleidung sowie Computer Hard- und Software. Nachdem sich diese Produkte nur bedingt bzw. gar nicht hinsichtlich der Zeit in der sie genutzt werden, dem Alter oder dem Einkommen des Käufers differenzieren lassen, erfolgt die Untersuchung ausschließlich hinsichtlich einer räumlichen Differenzierung. Daher steht vertikale Preisdifferenzierung im folgenden für internationale Preisdifferenzierung.
Diese Untersuchung ist zudem auf den B2C Markt beschränkt, da im B2B Bereich oft unternehmensinterne Lösungen zum Einkauf im Internet bestehen und größere Kunden oft ausschließlich individuelle Verhandlungen mit dem betreuenden KeyAccount-Manager führen. Ferner fokussiert sich die vorliegende Arbeit auf die Betrachtung des europäischen B2C E-Commerce, da einerseits in einem zusammenwachsenden Europa der Frage nach der Isolierung von Märkten eine sehr große Bedeutung und Aktualität zukommt. Andererseits wird auf eine Betrachtung außereuropäischer Märkte verzichtet, da teilweise sehr hohe Transportkosten und Zölle die Gefahr grauer Märkte als unwahrscheinlich erscheinen lassen.
Gang der Untersuchung:
Kapitel 2 widmet sich den Beschaffenheiten des Internetmarktes und prüft in wieweit er sich zur erfolgreichen […]
Setzt ein Anbieter unterschiedliche Preise für ein Produkt auf verschiedenen Märkten, und sind die daraus resultierenden Preisunterschiede nicht durch unterschiedliche Kosten bedingt, so spricht man von einer vertikalen Preisdifferenzierung. Diese Form der Differenzierung ist nur dann sinnvoll, wenn die Märkte voneinander isoliert sind, da es ansonsten zur Entstehung grauer Märkte kommen würde. Durch das Internet haben sich die Möglichkeiten einer globalen Kommunikation, vor allem hinsichtlich der Geschwindigkeit und Verfügbarkeit, in den letzten Jahren deutlich verbessert. Ländergrenzen existieren im Internet nicht und Informationen jeglicher Art sind jederzeit, von jedem beliebigen Punkt der Welt aus in Sekunden einseh- und somit auch vergleichbar. Vor diesem Hintergrund stellt sich dann die Frage, ob sich eine vertikale Preisdifferenzierung im Internet selbst - also im E-Commerce - aufrecht erhalten lassen wird.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Möglichkeiten und Grenzen eines Anbieters bzgl. der Durchführung einer vertikalen Preisdifferenzierung im Internet zu evaluieren.
Die im E-Commerce besonders stark vertretenen Produkte, auf denen auch der Schwerpunkt der Betrachtung liegt, sind Bücher, Musik-CDs, Bekleidung sowie Computer Hard- und Software. Nachdem sich diese Produkte nur bedingt bzw. gar nicht hinsichtlich der Zeit in der sie genutzt werden, dem Alter oder dem Einkommen des Käufers differenzieren lassen, erfolgt die Untersuchung ausschließlich hinsichtlich einer räumlichen Differenzierung. Daher steht vertikale Preisdifferenzierung im folgenden für internationale Preisdifferenzierung.
Diese Untersuchung ist zudem auf den B2C Markt beschränkt, da im B2B Bereich oft unternehmensinterne Lösungen zum Einkauf im Internet bestehen und größere Kunden oft ausschließlich individuelle Verhandlungen mit dem betreuenden KeyAccount-Manager führen. Ferner fokussiert sich die vorliegende Arbeit auf die Betrachtung des europäischen B2C E-Commerce, da einerseits in einem zusammenwachsenden Europa der Frage nach der Isolierung von Märkten eine sehr große Bedeutung und Aktualität zukommt. Andererseits wird auf eine Betrachtung außereuropäischer Märkte verzichtet, da teilweise sehr hohe Transportkosten und Zölle die Gefahr grauer Märkte als unwahrscheinlich erscheinen lassen.
Gang der Untersuchung:
Kapitel 2 widmet sich den Beschaffenheiten des Internetmarktes und prüft in wieweit er sich zur erfolgreichen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5308
Mahlau, Daniel: Möglichkeiten und Grenzen der vertikalen Preisdifferenzierung im Internet /
Daniel Mahlau - Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Passau, Universität, Diplom, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Inhaltsübersicht
I
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis... I
Abkürzungsverzeichnis ...III
1 Einleitung ...1
2 Die Voraussetzungen ...4
3 Die Möglichkeiten bei der Preissetzung...15
4 Die Grenzen der vertikalen Preisdifferenzierung im Internet ...34
5 Schlussfolgerungen ...46
Literaturverzeichnis...V
Eidesstattliche Erklärung...XXXVII
Inhaltsverzeichnis
II
1. Einleitung ...1
2. Die Voraussetzungen...4
2.1. Die Internet-Shopper...4
2.1.1. Internet-Shopper und Präferenzen...4
2.1.2. Markttransparenz im Internet ...7
2.1.3. Der Preis als Entscheidungskriterium ...10
2.2. Einzelne Teilmärkte ...11
2.3.
Preiselastizitäten...12
3. Die Möglichkeiten bei der Preissetzung...15
3.1. Der Optimalpreis...15
3.2. Die Vermeidung von grauen Märkten und Parallelimporten ...17
3.2.1. Der Preiskorridor...18
3.2.2. Die Isolierung der Märkte ...20
3.2.3. Das akquisitorische Potenzial eines Internet-Shops ...23
3.2.3.1. Möglichkeiten zur aktiven Kundenbindung ...23
3.2.3.2. Kundenbindende Rahmenbedingungen...27
3.2.4. Der modifizierte Preiskorridor ...29
4. Die Grenzen der vertikalen Preisdifferenzierung im Internet ...34
4.1. Besonderheiten des Internet ...34
4.1.1.
Preisvergleichsagenturen...34
4.1.2. Virtuelle B2C Marktplätze und TTP ...37
4.2. Besonderheiten bei den Produktarten...40
4.2.1. Das digitale Produkt ...40
4.2.2. Das standardisierte Produkt...41
4.2.3. Das individuelle Produkt... 44
5. Schlussfolgerungen...46
Abkürzungsverzeichnis
III
Abkürzungsverzeichnis:
%
Prozent
&
und
AG
Aktiengesellschaft
Anm.d.Verf
Anmerkung des Verfassers
AOL
America
Online
Aufl.
Auflage
B2B
Business
to
Business
B2C
Business
to
Consumer
Bsp.
Beispiel
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
CD
Compact
Disk
CEO
Chief
Executive
Officer
CTO
Chief
Technical
Officer
d.h.
das
heißt
Diss.
Dissertation
DVD
Digital Versatile Disc
E-Commerce
Electronic
Commerce
et
al.
et
alii
etc.
et
cetera
Hrsg.
Herausgeber
HTML
Hypertext
Markup
Language
IBM
International
Business
Machines
IS
Internet-Shopper
ISP
Internet
Service
Provider
K
Kosten
max
maximal
/
Maximum
Abkürzungsverzeichnis
IV
min
minimal
/
Minimum
neubearb. neubearbeitet(e)
No.
Number
NY
New
York
o.V.
ohne
Verfasser
P
Preis
PAF
Preis-Absatz-Funktion
S.
Seite
TTP
Trusted
Third
Party
TV
Television
überarb. überarbeitet(e)
USA
United States of America
V2C
Value to the Customer
Vgl. / vgl.
Vergleiche
VMP
Virtueller
Marktplatz
vollst.
vollständig
XML
Extensible
Markup
Language
z.B.
Zum
Beispiel
Einleitung
1
1. Einleitung
Setzt ein Anbieter unterschiedliche Preise für ein Produkt auf verschiedenen
Märkten, und sind die daraus resultierenden Preisunterschiede nicht durch
unterschiedliche Kosten bedingt, so spricht man von einer vertikalen
Preisdifferenzierung.
1
Diese Form der Differenzierung ist nur dann sinnvoll, wenn
die Märkte voneinander isoliert sind, da es ansonsten zur Entstehung grauer
Märkte kommen würde.
2
Durch das Internet haben sich die Möglichkeiten einer globalen Kommunikation,
vor allem hinsichtlich der Geschwindigkeit und Verfügbarkeit, in den letzten
Jahren deutlich verbessert. Ländergrenzen existieren im Internet nicht und
Informationen jeglicher Art sind jederzeit, von jedem beliebigen Punkt der Welt
aus in Sekunden einseh- und somit auch vergleichbar. Vor diesem Hintergrund
stellt sich dann die Frage, ob sich eine vertikale Preisdifferenzierung im Internet
selbst also im E-Commerce aufrecht erhalten lassen wird.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Möglichkeiten und Grenzen eines
Anbieters bzgl. der Durchführung einer vertikalen Preisdifferenzierung im
Internet zu evaluieren.
Die im E-Commerce besonders stark vertretenen Produkte, auf denen auch der
Schwerpunkt der Betrachtung liegt, sind Bücher, Musik-CDs, Bekleidung sowie
Computer Hard- und Software.
3
Nachdem sich diese Produkte nur bedingt bzw.
gar nicht hinsichtlich der Zeit in der sie genutzt werden, dem Alter oder dem
Einkommen des Käufers differenzieren lassen, erfolgt die Untersuchung
ausschließlich hinsichtlich einer räumlichen Differenzierung.
4
Daher steht
vertikale Preisdifferenzierung im folgenden für internationale
Preisdifferenzierung.
Diese Untersuchung ist zudem auf den B2C Markt beschränkt, da im B2B Bereich
oft unternehmensinterne Lösungen zum Einkauf im Internet bestehen und größere
Kunden oft ausschließlich individuelle Verhandlungen mit dem betreuenden Key-
Account-Manager führen. Ferner fokussiert sich die vorliegende Arbeit auf die
1
Vgl. Schmalen (1995), S. 182.
2
Vgl. Schmalen (1996), S. 421.
3
Vgl. Klietmann (2001).
4
In Anlehnung an Schmalen (1996), S. 421.
Einleitung
2
Betrachtung des europäischen B2C E-Commerce, da einerseits in einem
zusammenwachsenden Europa der Frage nach der Isolierung von Märkten eine
sehr große Bedeutung und Aktualität zukommt. Andererseits wird auf eine
Betrachtung außereuropäischer Märkte verzichtet, da teilweise sehr hohe
Transportkosten und Zölle die Gefahr grauer Märkte als unwahrscheinlich
erscheinen lassen.
Kapitel 2 widmet sich den Beschaffenheiten des Internetmarktes und prüft in
wieweit er sich zur erfolgreichen Durchführung einer vertikalen
Preisdifferenzierung eignet. Daher wird sowohl der Frage nachgegangen, ob die
Charakteristika von Internet-Shoppern (IS) eine vertikale Preisdifferenzierung
zulassen, als auch der Frage ob es sich im europäischen B2C E-Commerce um
einen gemeinsamen, oder um mehrere Teilmärkte handelt. Da für eine
erfolgreiche Durchführung einer vertikalen Preisdifferenzierung unterschiedliche
Preiselastizitäten auf den einzelnen Märkten herrschen müssen
5
wird zum Ende
des Kapitels untersucht, ob unterschiedliche Preiselastizitäten vorhanden sind und
über welche Möglichkeiten ein Anbieter im Internet verfügt um diese zu
ermitteln.
Auf der Basis der in Kapitel 2 ermittelten Ergebnisse, befasst sich Kapitel 3 mit
den Möglichkeiten, die einem Anbieter zur Durchführung einer vertikalen
Preisdifferenzierung im Internet zur Verfügung stehen. Zu Beginn wird
geschildert, wie ein Anbieter durch die technischen Möglichkeiten des Internets
zusätzliche Determinanten zur Preissetzung erhalten kann. Im weiteren Verlauf
des Kapitel wird untersucht über welche Möglichkeiten zur Eindämmung von
grauen Märkten, die bei größeren Preisdifferenzen zwischen den Märkten
auftreten können
6
, ein Anbieter verfügt. Als Instrument für eine
länderübergreifende Preiskoordination wird ein internationaler Preiskorridor
7
beschrieben und geprüft in wieweit er für eine Umsetzung im Internet geeignet ist.
Nachdem sich die Breite eines Preiskorridors an den Arbitragekosten orientieren
sollte
8
, werden im weiteren Verlauf des Kapitels Internet-spezifische
5
Vgl. Schneider (1972), S. 155.
6
Vgl. Bucklin (1990), S. 26.
7
Vgl. Simon / Wiese (1992), S. 253.
8
Vgl. Simon / Wiese (1992), S. 254.
Einleitung
3
Möglichkeiten zur Steigerung der Arbitragekosten untersucht. In Kapitel 3.2.4.
wird schließlich geprüft ob, und in wieweit, sich die Korridorbreite durch die
Internet-spezifischen Möglichkeiten erhöhen lässt.
Kapitel 4 befasst sich zum einen mit mehrheitlich Internet-spezifischen
Erscheinungen wie beispielsweise Preisvergleichsagenturen und prüft in wieweit
diese die Möglichkeiten zur vertikalen Preisdifferenzierung eingrenzen können.
Auch wird ein Ausblick auf mögliche zukünftige Formen von
Preisvergleichsagenturen gegeben um auch diese hinsichtlich ihres Einflusses auf
die Preisdifferenzierung zu untersuchen.
Abschließend befasst sich der zweite Teil dieses Kapitels mit den einzelnen Arten
von Produkten und prüft in wieweit für diese Grenzen bzgl. einer vertikalen
Preisdifferenzierung bestehen.
Im Kapitel ,,Schlussfolgerungen" werden die erarbeiteten Ergebnisse
zusammengefasst und Implikationen für die Anbieter aufgezeigt.
Die Voraussetzungen
4
2. Die Voraussetzungen
Für eine erfolgreiche Durchführung einer vertikalen Preisdifferenzierung müssen
gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Kunden, die über keinerlei Präferenzen
bzgl. der Anbieter verfügen, absolute Markttransparenz haben und Kunden, die
einzig den Preis als Entscheidungskriterium heranziehen, würden diese Form der
Differenzierung ebenso unmöglich machen wie das Fehlen unterschiedlicher
Märkte oder unterschiedlicher Preiselastizitäten. Daher wird das Internet auf diese
Kriterien hin untersucht und geprüft, ob es sich zur Durchführung einer vertikalen
Preisdifferenzierung eignet.
2.1. Die Internet-Shopper
Das folgende Kapitel befasst sich mit den Kunden im B2C E-Commerce. Daher
wird untersucht, ob IS Präferenzen bzgl. der Anbieter im Internet haben, ob sie
über eine umfassende Markttransparenz verfügen und in welchem Ausmaß der
Preis eine Rolle als Entscheidungskriterium spielt.
2.1.1. Internet-Shopper und Präferenzen
Ein Käufer in unvollkommenen, traditionellen - oder auch offline - Märkten trifft
seine Entscheidung bezüglich eines Anbieters meist nicht nur in Abhängigkeit
vom Preis eines Produktes. Öffnungszeiten, Nähe oder gute Erreichbarkeit des
Anbieters, Auswahl, Beratung, Parkmöglichkeiten, Freundlichkeit sowie
Reputation des Anbieters sind einige dieser nicht-monetären Auswahlkriterien.
Nachdem ein Internet-Shop sowohl ortsunabhängig bequem erreichbar als auch 24
Stunden / 7 Tage in der Woche offen ist und ein persönlicher Kontakt mit dem
Anbieter in der Regel nicht stattfindet entfallen einige der offline geltenden
Präferenzen bzw. nicht-monetären Auswahlkriterien. Baker / Marn / Zawada
berichten von einer oft geäußerten Ansicht, dass zukünftig allein der Preis als
Auswahlkriterium für IS relevant sei.
9
Träfe diese Annahme zu, so wäre
9
Vgl. Baker / Marn / Zawada (2001), S. 123.
Die Voraussetzungen
5
zumindest auf der Nachfragerseite die Homogenitätsbedingung des
vollkommenen Marktes erfüllt.
10
Modahl sowie Schneider / Gerbert sind zudem
der Ansicht, dass nationale Grenzen beim Einkauf im Internet keine, bzw. kaum
eine Rolle spielen.
11
Sollten diese Annahmen zutreffen, so wäre die erfolgreiche Durchführung einer
vertikalen Preisdifferenzierung im Internet erschwert oder kaum möglich, da sich
der Käufer einzig vom Preis als Entscheidungskriterium leiten ließe und daher
Preisdifferenzen möglicherweise nicht hinnehmen würde.
Diese Argumentation lässt allerdings einige für das Internet spezifische
Gegebenheiten außer acht. Bereits gemachte positive Erfahrungen schaffen
Vertrauen und hindern einen IS oft daran, zu einem anderen Anbieter zu
wechseln
12
, nicht zuletzt aufgrund der unter IS weit verbreiteten Angst vor
,,schwarzen Schafen" unter den Anbietern.
13
Je nach dem Grad der technischen
Versiertheit eines IS kann es relativ zeitintensiv gewesen sein, den Umgang mit
der Homepage eines Betreibers zu erlernen. Daraus resultieren insofern
Wechselkosten, als der IS den Umgang mit der Homepage eines anderen
Anbieters erst wieder neu erlernen müsste.
14
Darüber hinaus erfordert jede
Bestellung im E-Commerce eine zumindest einmalige Registrierung der
persönlichen Daten, die bei einem anderen Anbieter erneut zu durchlaufen wäre
15
und somit eines zusätzlichen zeitlichen Aufwandes bedürfte.
Positive Erfahrungen in der Vergangenheit, bei denen sich der bekannte Anbieter
als zuverlässig erwiesen hat
16
(korrekte Abrechnung, pünktliche Lieferung des
richtigen Produkts und korrekter Umgang mit persönlichen Daten, etc.) schaffen
Vertrauen und bilden, zusammen mit den oben genannten Gründen, eine
Präferenz zugunsten des bisherigen Anbieters.
Ebenso besteht eine Präferenz bzgl. der Bestellung bei einem einheimischen
Anbieter. Europaweit waren 1999 67% aller E-Commerce Bestellungen nationale
10
Vgl. Schmalen (1995), S. 51.
11
Vgl. Modahl (2000), S. 111; sowie Schneider / Gerbert (1999), S. 47.
12
Vgl. Expertengespräch mit Oliver Beisel, Frage 9.
[Oliver Beisel: Consultant bei McKinsey & Comapny, München].
13
Vgl. Expertengespräch mit Sebastian Kral, Frage 1.
[Sebastian Kral: Business Analyst bei Roland Berger & Partner, Frankfurt / Main].
14
Vgl. Brynjolfsson / Smith (2000), S. 24.
15
Vgl. Brandtweiner (2001), S. 41.
16
Vgl. Marn (2000), S. 129.
Die Voraussetzungen
6
Bestellungen, in Deutschland sogar 75%.
17
Ein wichtiger Grund hierfür sind
Sprachbarrieren. Einerseits ist dieses begründet durch das Verhalten der
Anbieter
18
, andererseits durch die Fremdsprachenkenntnisse der IS
19
. Diese
Barriere wird auch mittelfristig, zumindest in zufriedenstellender Qualität, nicht
durch Übersetzungsseiten überbrückt werden können.
20
Ein weiteres Hemmnis für eine Bestellung im Ausland stellt die Unsicherheit über
rechtliche Ansprüche wie Garantie u.Ä. und ausländische Rechtssysteme dar.
21
Die Bekanntheit und Reputation eines Anbieters spielen im E-Commerce
ebenfalls eine wichtige Rolle als Entscheidungskriterium.
22
Deutlich wird dieses
am Beispiel des Internet-Shops Amazon
23
. Amazon besitzt heute 75%
Marktanteil, hat aber lediglich in 2% der Fälle den niedrigsten Preis
24
und konnte
von 1997 bis 1999 seine Preise um 8% anheben bei einer gleichzeitigen
Steigerung des Marktanteils um 6%, während der Discount-Konkurrent ,,Books-
A-Million" in der gleichen Zeit seine Preise um 30% gesenkt hat.
25
Gestützt wird
diese Aussage zudem durch die Beobachtung, dass im europäischen Durchschnitt
die jeweils drei größten Anbieter eines Landes und einer Branche 60 70% der
Verkäufe generieren.
26
Nachdem ,,der Internet-Shopper" genauso wenig eine homogen strukturierte
Gruppe wie beispielsweise ,,der Urlauber" oder ,,der Käufer" ist, trifft die oben
17
Vgl. Gerth / Barth / Machill (1999), S.16.
Forth / Pecaut / Hansen (2000) gehen sogar davon aus, dass der Umsatzanteil, den
europäische E-Commerce Anbieter mit innereuropäischem, grenzübergreifendem Handel
verdienen bei lediglich 5% liegt (S. 25).
18
In Spanien z.B. werden gem. Gerth / Barth / Machill (1999), S.17 100% der E-Commerce
Homepages auf Spanisch, 14,3% auf Englisch, 2,9% auf Französisch und 0,0% auf
Deutsch angeboten.
Großbritannien: 100% englisch, 0% deutsch / französisch / spanisch.
Frankreich:
100% französisch, 42,9% englisch, 8,6% deutsch, 2,9% spanisch.
Deutschland: 100%
deutsch, 17,4% englisch, 6,4% französisch / spanisch.
19
gemäß des Charts Nr. 007606 von
www.eMarketer.com
sprechen 41% der Deutschen Englisch
und 9% Französisch.
20
Vgl. Expertengespräch mit Oliver Beisel, Frage 2; siehe auch Expertengespräch mit Martin
Reinhofer, Frage 2.
[Martin Reinhofer: Director of Business Strategy bei IBM USA, Armonk, NY, USA].
21
Vgl. Forth / Pecaut / Hansen (2000), S.16.
22
Vgl. Forth / Pecaut / Hansen (2000), S.20; siehe auch Expertengespräch mit Sebastian Kral,
Frage 1.
23
www.amazon.de
,
www.amazon.com
,
www.amazon.fr
,
www.amazon.co.uk
.
24
Vgl. Brynjolfsson / Smith (2000), S. 12.
25
Vgl. Marn et al. (2001), S. 2.
26
Vgl. Forth / Pecaut / Hansen (2000), S.11.
Die Voraussetzungen
7
angeführte Argumentation selbstverständlich nicht auf 100% der IS zu. Baker /
Marn / Zawada taxieren allerdings die Gruppierung der ,,aggressive Bargainers"
auf unter 10% der Internet User.
27
Brynjolfsson / Smith fanden heraus, dass 51%
der als eher preissensibel einzustufenden Benutzer eines Preisvergleichsdienstes
nicht das preiswerteste Angebot kauften, sondern dass offensichtlich andere
Gründe als der Preis den Ausschlag zugunsten eines Anbieters gaben.
28
Die überwiegende Mehrheit der IS hat folglich gewisse Präferenzen bzgl. des
Anbieters im E-Commerce, weshalb die Hypothese der käuferseitigen Erfüllung
der Homogenitätsbedingung des vollkommenen Marktes abgelehnt werden muss.
Zudem wird sich bei der ,,second wave"
29
der IS, die nicht über das gleiche
technische Know-how der Pioniere verfügt und somit im technischen Umgang mit
dem Internet unsicherer ist, die Tendenz zu den angeführten Präferenzen noch
verstärken.
30
2.1.2. Markttransparenz im Internet:
Ebenso wie IS, die ohne Präferenzen bzgl. des Anbieters einzig den Preis als
Entscheidungskriterium nutzen würden, könnte auch eine umfassende
Markttransparenz der Käufer ein Hindernis für die erfolgreiche Durchführung
einer vertikalen Preisdifferenzierung sein.
In diesem Kontext wird oft von einer weltweiten Markttransparenz im Medium
Internet gesprochen
31
, die im Extremfall einen Preisverfall auf das geringst
mögliche Preisniveau zu Folge haben könnte.
32
In einem stark spezialisierten
Marktsegment mit geringer Anbieterzahl mögen diese Aussagen bzgl. der
27
Vgl. Baker / Marn / Zawada (2001), S. 123.
Laut der 12. W3B Umfrage wollen 52,9% (Vgl.:
http://www.w3b.org/ergebnisse/w3b12/shopping.html )der Internet User das Internet
(auch) in Zukunft zum Einkauf nutzen. Werden diese 52,9% der User als 100% Basis der
IS interpretiert, so macht die Gruppe der ,,aggressive Bargainers" weniger als 1/5 aller IS
aus.
28
Vgl. Brynjolfsson / Smith (2000), S. 12.
29
Abend / Pauschert (2000) berichten beispielsweise von der Gruppe der ,,Schnupperer". Internet-
User die der E-Commerce zwar generell interessiert, ihm gegenüber aber noch eine
gewisse Unsicherheit verspüren und daher noch keine einschlägigen Erfahrungen
gesammelt haben.
30
Vgl. Expertengespräch mit Sebastian Kral, Frage 1.
31
Vgl. Schneider / Gerbert (1999), S. 88; siehe auch: Evans / Wurster (2000), S. 7.
32
Vgl. Modahl (2000), S. 112.
Die Voraussetzungen
8
Transparenz zutreffen, der Großteil des B2C E-Commerce findet allerdings mit
Produkten statt, die weder stark spezialisiert sind, noch von einer geringen Zahl
von Anbietern angeboten werden.
33
Aufgrund der technischen Möglichkeiten wäre das Erlangen einer umfassenden
Markttransparenz zwar durchaus möglich, allerdings für den einzelnen IS sehr
unwahrscheinlich. Der einzelne IS sieht sich einer noch nie da gewesenen
Informationsflut
34
und Fülle von Anbietern gegenüber, die alle über verschiedene
Bestell- und Abwicklungsprozesse verfügen.
35
Klassische Suchmaschinen liefern
bei der Suche nach einem bestimmten Produkt unsortierte Hyperlinks als
Ergebnis, die auf Homepages verweisen, auf denen das gesuchte Produkt gekauft,
gewonnen oder ersteigert werden kann, auf denen es besprochen wird oder Tipps
im Umgang damit zu finden sind oder sich eine Online Community zu diesem
Thema etabliert hat.
36
Sie eignen sich somit als Mittel zur Erlangung von
Angebotstransparenz nur bedingt.
Die momentane Masse von Anbietern verwirrt die IS mehr, als dass sie
transparenzfördernd wirkt
37
, wovon vor allem die Anbieter mit einem auch offline
starken Markennamen profitieren.
38
Dem Argument einer weltweiten Transparenz
stehen ebenfalls die in Kapitel 2.1.1. bereits angesprochenen Sprachbarrieren
entgegen. Momentan stellt das Internet folglich einen Markt mit asymmetrischer
Information dar
39
, in dem der IS von der Existenz von ca. 10-15% der
vorhandenen Anbieter pro Branche / Produktart weiß.
40
Preisvergleichsagenturen
können in diesem Zusammenhang zwar eine gewisse Angebotstransparenz in
33
gem. Klietmann (2001) werden vor allem Bücher, Musik-CDs, Bekleidung, Computer Software
und Hardware im E-Commerce gekauft. Ergänzend hierzu:
Bücher nehmen in diesem Zusammenhang, einerseits wegen der Sprachgebundenheit,
sowie in Deutschland aufgrund der Buchpreisbindung, eine Sonderrolle ein, die eine
höhere Transparenz zur Folge haben kann. (Vgl. Expertengespräch mit Sebastian Kral,
Frage 2.
34
Vgl. Brandtweiner (2001), S. 23.
35
Vgl. Gerth / Barth / Machill (1999), S. 5.
36
Diller (1978) schreibt zu dieser Problematik, dass nicht allein die Menge, sondern auch die
unmittelbare Verwendbarkeit von Informationen relevant sind.
Zitiert nach: Diller (1991), S. 89.
37
Vgl. Expertengespräch mit Elisabeth Schick, Frage 7.
[Elisabeth Schick: CEO von DealTime.com Europe, Heidelberg]
38
Vgl. Expertengespräch mit Dr. Wolf Garbe, Frage 1;
[Dr. Wolf Garbe: CEO & CTO von Bingooo AG, Köln]
Kral berichtet in diesem Zusammenhang, dass IS pro Produktart lediglich ca. 3 Anbieter
namentlich kennen. (Vgl. Expertengespräch mit Sebastian Kral, Frage 3).
39
Vgl. Brandtweiner (2001), S. 70.
40
Vgl. Expertengespräch mit Sebastian Kral, Frage 3.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832453084
- ISBN (Paperback)
- 9783838653082
- DOI
- 10.3239/9783832453084
- Dateigröße
- 592 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Passau – Betriebswirtschaft, Absatzwirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2002 (April)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- marketing internet preisdifferenzierung preispolitik
- Produktsicherheit
- Diplom.de